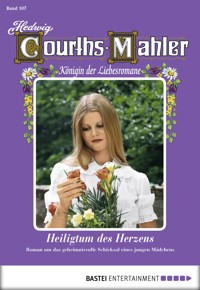Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Genauso schwer wie der Titel des Romans ist auch das Schicksal der Protagonistin Rose Rietberg. Als Kind wächst sie nach dem Tod des Vaters bei Verwandten auf, die sich jedoch vor allem an ihrem Erbe bereichern. Als Rose schließlich auch noch gewinnbringend verheiratet werden soll, läuft sie von ihrer Pflegefamilie weg. Doch wird die junge Frau ihren Weg im Leben finden?-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hedwig Courths-Mahler
Verkaufte Seelen
Saga
Verkaufte Seelen
Coverbild/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1929, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726950397
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
Rose Rietberg war ein zwölfjähriges Mädchen, als ihr Vater starb, ihre Mutter hatte sie schon zwei Jahre früher verloren. Die Mutter war bei der Geburt eines Sohnes gestorben, den sie nach dreizehnjähriger Ehe ihrem Gatten schenkte. Er hatte sich diesen Sohn mit einer so zähen Inbrunst gewünscht, daß er sich auf dem Gipfel seines Glückes wähnte, als man ihm meldete, nach einer in Unruhe verbrachten Nacht, daß ihm ein Sohn geboren sei. Glückstrahlend war er an das Lager seiner Gattin, die er über alles liebte, geeilt und hatte ihre Hände mit Küssen bedeckt. Matt hatte sie zu ihm aufgesehen und leise gelächelt.
„Nun bist du restlos glücklich, mein Albert, nicht wahr?“ hatte sie gefragt.
„Unsagbar glücklich,“ hatte er geantwortet.
Und dann war er gegangen, als man ihn wieder aus dem Zimmer trieb, nachdem er seinen kleinen Sohn an sein Herz gedrückt hatte, dann war er zu seinem Töchterchen Rose gegangen und hatte ihm gesagt, daß es ein Brüderchen bekommen habe.
Rose hatte sich nach Kinderart über das neue Brüderchen gefreut, ahnungslos, wie teuer sie diese kurze Freude würde bezahlen müssen. Auch ihr Vater hatte nicht geahnt, wie bald seine Freude in bitteres Leid umschlagen würde.
Schon am Abend desselben Tages starb seine Frau, und am nächsten Morgen folgte ihr der kleine Sohn in die Ewigkeit nach. Vielleicht hatte er geahnt, daß der Vater ihn bitter hassen würde, weil er, der so heiß Ersehnte, der geliebten Frau das Leben gekostet hatte; vielleicht auch fühlte das kleine, zarte Seelchen, daß es ohne Mutterliebe traurig und trübe auf der Welt wäre. Kurzum, er folgte seiner Mutter in den Tod nach.
Rose Rietberg stand diesen Ereignissen fassungslos gegenüber. Sie war noch zu jung, um die ganze Größe ihres Verlustes zu ermessen, aber doch schon alt genug, um ihn als einen tiefen Schmerz und ein großes Unglück zu erfassen. Denn dem Tode von Mutter und Bruder folgte der seelische Zusammenbruch ihres Vaters und erschütterte sie noch mehr.
Das damals erst zehnjährige, aber sehr sensitive Kind reifte in jenen Tagen merkwürdig schnell.
Sie fühlte instinktiv, daß sie dem seelisch zusammengebrochenen Vater viel sein müsse, damit er das Leben weiter zu tragen vermöge. Sie verstand zwar nicht, warum er sich in den leidenschaftlichsten Tönen anklagte, schuld an dem Tode der inniggeliebten Frau zu sein, weil er unbedingt vom Schicksal einen Sohn hatte ertrotzen wollen. Das Schicksal, so sagte er, habe seinen Wunsch erfüllt, um ihn zu strafen, weil er sich nicht mit dem Glück, ein geliebtes Weib und eine geliebte Tochter zu besitzen, hatte begnügen wollen.
Diese leidenschaftlichen Anklagen, die so gar nicht für das Ohr des zehnjährigen Mädchens geeignet waren, ließen Rose erzittern vor den Mysterien des Lebens, die sie doch nicht begreifen, nicht einmal ahnen konnte. Aber sie schloß tapfer die Augen vor dem Furchtbaren, das ihr kleines Herz erzittern ließ in unverstandenem Schmerz. Sie suchte den Vater in ihrer kindlich heldenhaften Weise zu trösten, obwohl ihr selbst das Herz zum Brechen weh tat.
Froh wurde der Vater nie mehr nach jenem Schicksalsschlage. Rose reifte in den zwei Jahren, die der Vater noch lebte, um viel mehr, als sonst wohl die dreifache Zeit einen so jungen Menschen reift. Sie wurde ein opfermutiges und opferfreudiges Geschöpf. Ihr im Grunde sonniges und heiteres Temperament kämpfte sich immer wieder durch Herzensnot und Jammer hindurch. Und jedes arme Lächeln, das sie dem Vater abnötigte, war ihr ein herrlicher Lohn für alle ihre Mühe, ein wenig Freude in sein lichtloses Dasein zu bringen.
Zwei Jahre nach dem Tode seiner Frau, genau an dem Tage, da sie ihm einen Sohn geschenkt hatte, erlitt Albert Rietberg auf dem Wege zur Universität, wo er als Professor wirkte, einen schweren Autounfall. Er war Professor der Philologie, ein bekannter Sprachforscher, der vor seiner Verheiratung aller Herren Länder bereist hatte und als ein Sprachgenie galt.
Der schwere Unfall, der ihn traf, brachte ihm den Tod. Es blieb ihm nur noch Zeit, sein Testament zu machen, in dem er seine Tochter zur Universalerbin seines sehr beträchtlichen Vermögens einsetzte, und zu bestimmen, daß sein Vetter Herbert Rietberg, der einzige männliche Verwandte, den er noch besaß, Roses Vormund werden sollte. Dieser Vetter, schnell herbeigerufen, versprach ihm, seine Tochter treu zu behüten, Albert Rietberg traf noch einige Bestimmungen, Rose ferneres Leben betreffend. Er kannte seinen Vetter nicht sehr genau, hielt ihn aber für einen Ehrenmann, der zwar nicht mit Glücksgütern gesegnet war, sich aber in einer guten Stellung befand und in gesicherten Verhältnisssen lebte. Und da er sein einziger Verwandter war, hielt er ihn am geeignetsten, Roses Vormund und Beschützer zu werden.
Rose saß mit großen starren Augen am Lager ihres Vaters und hatte für nichts weiter Sinn als für ihn. Sie fühlte jedoch mit atemloser Angst, daß der Tod abermals seine Hände ausstreckte nach einem Menschen, der ihr teuer war — nach dem einzigen, dem ihr junges Herz in heißer Liebe zugetan war, der noch zu ihr gehörte. Ihr war, als müsse sie laut aufschreien vor Angst, aber die Furcht, den geliebten Vater zu erschrecken, schloß ihr den Mund. Die Hand seiner Tochter in der seinen, hauchte Albert Rietberg sein Leben aus, und als es geschehen war und man ihr mitleidig sagte, daß der Vater gestorben sei, brach sie ohne einen Laut, und wie aller Kraft beraubt, an seiner Leiche zusammen und sah mit großen, angstvollen Augen in das bleiche, stille Gesicht.
Sie weinte und schrie nicht nach Kinderart — nein — sie brach nur stumm zusammen durch den furchtbaren Schmerz, den sie mit der ganzen Schwere und Innerlichkeit ihres leidgewohnten Kinderherzens empfand. Eine furchtbare Angst vor dem unbarmherzigen Schicksal, das alles vernichtete, was ihr lieb war, ließ sie erstarren. Sie wollte die Hand des Vaters nicht aus der ihren lassen — bis die Kälte dieser Hand sie erschauern ließ.
Dann erst ließ sie sich willenlos fortführen.
Auch jetzt war sie noch tränenlos, und man nannte sie ein merkwürdiges Kind.
Der Vetter ihres Vaters, der nun ihr Vormund war, brachte sie zu seiner Frau. Diese nahm sie erst mit wenig Freude auf und schalt ihren Mann, daß er sich eine solche Last hatte aufbürden lassen. Rose hörte das, und es traf wie ein Dolchstoß ihr armes, zuckendes Herz. Der Onkel übergab sie einer Dienerin und führte seine Frau in ein anderes Zimmer. Hier hatten die Gatten eine lange Unterredung, und als sie wieder zum Vorschein kamen, war die Tante völlig verändert. Sie kam Rose jetzt plötzlich mit einer überschwenglichen Freundlichkeit und Zärtlichkeit entgegen, aber das sensitive Kind empfand dieses so plötzlich veränderte Wesen als unecht und unwahr. Rose konnte kein Herz fassen zu dieser Frau, auch nicht zu dem Onkel, und nicht nur, weil sie bisher mit diesen beiden Menschen nur selten zusammengetroffen war und sie ihr ziemlich fremd waren. Nein, sie empfand instinktiv, daß diese Liebenswürdigkeit ohne Wärme, diese scheinbare Güte ohne Wahrheit war, und verschloß ihr Herz scheu vor diesen Menschen. Und das wurde nie anders, wenn sie sich auch still und gefügig zeigte. In ihr Inneres konnten diese Menschen nicht dringen, das hielt sie vor ihnen verschlossen, obwohl sie nicht gehört hatte, was Onkel Herbert an jenem Tage mit seiner Frau gesprochen und was deren völlige Umänderung bewirkt hatte.
Dies Gespräch war folgendermaßen verlaufen: Frau Helene Rietberg hatte ihren Gatten zunächst mit Vorwürfen überhäuft, daß er ihr die Last der Pflege und Erziehung für das Kind Albert Rietbergs aufbürden wollte. Darauf hatte er erwidert:
„Höre mich doch erst ruhig an, Helene, dann wirst du ganz anders denken. Rose ist die Universalerbin ihres Vaters, und er hinterläßt ihr viel mehr, als ich je für möglich gehalten habe bei seinem bescheidenen Auftreten. Er hat testamentarisch bestimmt, daß bei Roses Erziehung nicht gespart werden soll, sie soll ihr Leben fortsetzen wie bisher, soll jeden Sommer eine Erholungsreise machen und alle Annehmlichkeiten haben, die ihr die Zinsen ihres Vermögens erlauben. Die Zinsen ihres Vermögens können jedes Jahr aufgebraucht werden für die Erziehungs- und Verpflegungskosten. Daß wir arm sind und nur auf meinen Gehalt angewiesen, hat Albert gewußt und deshalb hat er alles getan, um uns keine Unkosten aufzubürden. Wir werden es gut so einrichten können, daß auch wir in Zukunft von diesen Zinsen leben können und bedeutend besser als bisher. Verstehst du nun, was für einen Vorteil wir davon haben, daß Rose unter unserer Obhut leben soll? Alles Gute, was sie genießt, können wir auf ihre Kosten mitgenießen, wir können mit ihr auf Reisen gehen und uns das Leben leicht machen. Sie hat jährlich gegen vierzehntausend Mark an Zinsen zu verzehren, und da sie jetzt zwölf Jahre alt ist, werden wir neun Jahre, bis ihrer Mündigkeit, mit diesen Zinsen rechnen können. Mein Gehalt werden wir in all dieser Zeit sparen können und haben dann etwas vor uns gebracht. Das Vermögen ist in mündelsicheren Papieren angelegt und soll auch so angelegt bleiben. Und Albert hat mir vor seinem Tode selbst den Vorschlag gemacht, daß wir mit Rose seine Wohnung beibehalten, sie soll sich nicht in anderer Umgebung zurechtfinden müssen. Das wird dir doch gefallen? Eine schöne Siebenzimmerwohnung in der Prinzregentstraße mit allem Komfort der Neuzeit und dieser schönen Ausstattung — du kennst ja die Wohnung, wenn wir auch nur selten dort waren. Die Miete wird selbstverständlich von den Zinsen bezahlt. Unsere Möbel können wir in die große Speicherkammer stellen, bis wir sie mal wieder brauchen. Begreifst du nun, daß es keine Last ist, wenn wir uns Roses annehmen? Eine solche Gelegenheit, unsere sehr bescheidene Lage zu verbessern, kommt nicht wieder, da muß man zufassen. Wir haben keine Kinder, Rose ist ein gefügiges, gutartiges Kind, das leicht zu leiten ist, und im übrigen wird sie dir schon deshalb keine Mühe machen, weil wir ja einen Angestellten für sie halten können. Also — was sagst du nun zu dieser Angelegenheit?“
Atemlos hatte Frau Helene zugehört, und in ihre kalten Augen kam ein begehrliches Flimmern.
„Das viele Silberzeug und das Porzellan und Kristall können wir doch auch in Gebrauch nehmen — es ist reichlich von allem da,“ sagte sie.
Er nickte.
„Natürlich, gewiß, neun Jahre lang sind wir unumschränkte Herren in der Wohnung.
Sie atmete befriedigt auf.
„Dann freilich, dann ist das etwas ganz anderes, das dürfen wir freilich nicht von der Hand weisen. Nun komm schnell, wir wollen zu dem Kinde gehen und es trösten.“
Das war geschehen, und die feinfühlige Rose hatte sehr wohl bemerkt, daß das veränderte Wesen dieser Frau einen besonderen Grund haben müsse und daß ihre Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit unecht waren.
Sie setzte dieser unechten Güte eine stille Passivität entgegen und zog sich in sich selbst zurück. Aber das empfanden die beiden eigennützigen Menschen nur als angenehm. Gleich nach der Beerdigung Albert Rietbergs zog sein Vetter mit seiner Frau und Rose in die bisherige Wohnung des Verstorbenen. Rose behielt ihr Zimmer, in den übrigen machte sich Frau Helene breit, als sei sie hier von jeher zu Hause gewesen.
Rose war froh, wenn sie in ihrem Zimmer allein sein konnte. Es tat ihr weh, als sie bemerkte, wie Onkel und Tante sich in den Zimmern breit machten, die bisher ihre Eltern benutzt hatten. Onkel Herbert saß jetzt an des Vaters Schreibtisch, lag auf dem Diwan, auf dem der Vater sein Schläfchen gehalten hatte und benutzte das Glas, aus dem der Vater getrunken. Und Tante Helene benutzte den Toilettentisch der Mutter, der nach ihrem Tode heilig gehalten war. Sie saß an Mutters Nähtisch, pflegte ihre Blumen und kramte in ihrem Wäscheschrank. Bei Tisch saßen ihr die beiden auf den Plätzen gegenüber, wo früher die Eltern gesessen hatten.
Das alles erschien Rose wie eine Entweihung all ihrer Kindheitserinnerungen. Sie litt seelisch sehr darunter und wurde immer blasser und stiller. Oft saß sie in ihrem Zimmer und weinte sich aus. Dabei erschien sie sich undankbar und kleinlich, denn Onkel und Tante überschütteten sie mit Liebkosungen und Freundlichkeiten. Aber sie konnte kein Herz zu ihnen fassen. Seit des Vaters Tode war sie einsam geblieben im Herzen, und wenn sie von Tante und Onkel umschmeichelt wurde, war ihr oft, als müsse sie sie von sich stoßen und davonlaufen, so weit sie ihre Füße trugen.
Daß sie pekuniär ungeheuer ausgenutzt wurde, erschien ihr wenig wichtig, denn sie hatte noch keinen Begriff von Geld und Geldeswert. Sie hätte es kaum bemerkt, wenn nicht die Angestellte, die noch von ihren Eltern her im Hause war, in ihrer Gegenwart darüber gesprochen hätte. Untergebene sind scharfe Richter ihrer Herrschaften, und dieses kluge Berliner Mädel sah den Dingen auf den Grund und mokierte sich zuweilen in Roses Gegenwart. Rose lief dann davon, sie wollte das nicht hören, aber die Angestellte sprach immer wieder davon, daß Onkel und Tante es sich auf ihre Kosten wohl sein ließen, mit ihr reisten, Gesellschaften gaben und Theater und Konzerte besuchten — alles von ihrem Gelde.
Rose bewertete das alles viel geringer, als daß sie so pietätlos die Gegenstände der Eltern benutzten. Sie hätte ihnen gern alle anderen Vorteile gegönnt. Sie fragte nie, was dies und jenes koste, ob dies oder das nötig sei — nur einmal wurde sie energisch — als Tante Helene ihr Sprach- und Musikstunden absagen wollte, weil „sie unnötiges Geld kosteten“.
„Du hast es doch gar nicht nötig, dich damit herumzuplagen, Rose, wir wollen diese Stunden aufgeben“, hatte sie gesagt.
Da hatte sich Rose kampfbereit aufgerichtet.
„Das wäre ganz bestimmt nicht in Vaters Sinne, er wollte, daß ich mein Sprachtalent, das ich von ihm geerbt habe, ausnütze. Die Sprachstunden behalte ich bei, bis ich die vier Sprachen beherrsche, deren Studium ich begonnen habe. Und auch die Musikstunden setze ich fort, wie Vater es gewollt hat.“
Frau Helene hatte eingesehen, daß Rose in dieser Frage nicht zu beeinflussen war. Eigentlich war sie es überhaupt nicht, aber weil sie meistens zu allen Anordnungen von Onkel und Tante schwieg, glaubten sie, daß sie sich ihren Einfluß füge. Jedenfalls nahm Rose ihre Stunden weiter, und es wäre auch schade gewesen, wenn sie es nicht getan hätte, da sie wirklich von ihrem Vater ein großes Sprachtalent geerbt hatte und sich mit diesem schon immer abwechselnd in der französischen, englischen, spanischen und italienischen Sprache unterhalten hatte. Und sie war in all diesen Sprachen schon so weit, daß sie die von dem Vater hinterlassenen fremdsprachigen Bücher geläufig lesen konnte. Und da Sprachkundige zumeist auch musikalisch sind, war Rose trotz ihrer Jugend schon eine sehr gute Klavierspielerin und hatte außerdem einen angenehmen Mezzosopran.
Immer zum Jahresschluß teilte ihr Onkel Herbert mit, daß die Zinsen ihres Vermögens gerade ausgereicht hätten für alle Unkosten.
Rose nahm diese Mitteilungen ziemlich interesselos auf, denn sie hatte eben von Geld und Geldeswert nur unklare Vorstellungen.
Zum Glück hatte Roses Vater testamentarisch bestimmt, daß Roses Vermögen nie angegriffen oder anders angelegt werden dürfe, sonst hätte Herbert Rietberg in seiner Habgier vielleicht auch noch das Kapital angegriffen.
Es sollte übrigens mit diesem Kapital später nicht anders gehen, als mit so vielen Vermögen im deutschen Vaterlande. Und früher, als sie glaubten, sollte das habgierige Ehepaar, das so gewissenlos alle eignen Ausgaben auf die Mündelgelder buchte, auf die Annehmlichkeiten verzichten müssen, die sie sich erschlichen hatten.
Der Krieg war ausgebrochen, und mit der zunehmenden Teuerung mußte Herbert Rietberg sparsamer wirtschaften. Er konnte jetzt nicht mehr sein Gehalt sparen, was ihm auch nichts genützt hatte, da seine Ersparnisse von der Inflation verschlungen wurden, wie Roses Vermögen auch, das mehr und mehr zusammenschmolz. Er mußte noch froh sein, daß sein Gehalt mit der Inflation stieg.
Rose hatte inzwischen die Schule bis Selekta besucht und füllte ihre Zeit mit ihren Sprachstudien aus, die sie immer mehr erweiterte. Sie vergrub sich mehr und mehr in die von dem Vater hinterlassenen Bücher.
Aber dann wurden ihr die Sprachstunden energisch gestrichen, als ihre Zinsen weniger und weniger galten. Die Freundlichkeit und Zärtlichkeit, die Onkel und Tante ihr entgegengebracht hatten, kühlten sich mehr und mehr mit dem Hinschwinden ihrer Einkünfte ab. Sie wurde oft rauh und hart angelassen, und als man endlich die Angestellte entlassen mußte, wurden Rose all die Arbeiten aufgebürdet, die sonst diese geleistet hatte. Es wurde aus dem Besitz von Roses Eltern ein Stück nach dem andern verkauft, das Silber verschwand, die kostbaren Teppiche und teilweise auch die Möbel, die durch die Möbel von Onkel und Tante ersetzt wurden. Herbert Rietberg und seine Frau hatten sich so sehr an das gute Leben gewöhnt, daß sie nicht davon lassen wollten — bis alle Quellen erschöpft waren.
Und die arme Rose bekam nun täglich harte Vorwürfe, wie sehr man sich verrechnet habe und welch eine Last sie für Onkel und Tante sei.
Nur zu gut begriff Rose jetzt, wie recht die Angestellte gehabt hatte. Sie wußte nun gewiß, daß alle Freundlichkeit und Liebe nur ihrem Gelde gegolten hatten.
Mit großen bangen Augen sah sie in die harten, unfreundlichen Gesichter der Verwandten. Tante Helene klagte über die teure Wohnung, die ihnen aufgehalst worden sei, und über die viele Arbeit, die sie habe. Dabei schob sie alle grobe und schwere Arbeit Rose zu, die jetzt von früh bis spät sich plagen mußte und dafür nur Scheltworte erntete.
Ohne Murren fügte Rose sich in die veränderten Verhältnisse. Sah sie doch, daß es anderen Leuten auch nicht anders ging. Aber in ihrem jungen Herzen wurde es immer kälter und leerer.
Herbert Rietberg hatte viele unliebsame Szenen mit seiner Frau. Und er ließ seinen Ärger darüber selbstverständlich an Rose aus. Sie war ja bettelarm geworden und hatte keine Zinsen mehr zu verzehren.
Rose hörte alle die Streitereien zwischen Onkel und Tante, die ihrer Person galten, mit tiefer Beschämung an und hätte viel darum gegeben, hätte sie ihnen nicht länger zur Last fallen müssen. Daß sie sich ihr Brot reichlich verdiente durch ihre schwere Arbeit, kam ihr nicht einmal zum Bewußtsein. Aber sie arbeitete immer fleißiger, um nur etwas zu tun, was ihr eine Daseinsberechtigung gab.
Es kamen schlimme, sehr schlimme Zeiten für die arme Rose. Sie galt jetzt bei ihren Verwandten nicht mehr als eine Last.
Die Inflation hatte ihren Höhepunkt erreicht. Roses mündelsichere Papiere hatten nur noch Makulaturwert, und sie war jetzt ganz auf die Gnade oder vielmehr Ungnade ihrer Verwandten angewiesen. Trotz aller Not war Rose zu einem schönen Mädchen herangewachsen. Sie hatte eine schlanke Gestalt, wundervolles, blondes Haar mit einem satten Goldton, und einen blütenzarten Teint. Ihre grauen Augen leuchteten mit einer intensiven Klarheit aus dem lieblichen Gesicht heraus, das feine Züge hatte, und ihre Bewegungen waren voll Anmut und Vornehmheit. Aber all diese Lieblichkeit war von einer stillen Trauer überschattet. Nur selten sah man ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Sie, die ein so heiteres und schelmisches Kind gewesen war, schien in Leid und Unglück gleichsam erstarrt zu sein. Wieder und wieder zuckte sie schmerzhaft zusammen, wenn Onkel und Tante mit unverdienten Vorwürfen über sie herfielen. Sie hatte nie ein Wort der Erwiderung darauf. Aber eines Tages, als man ihr wieder vorhielt, welche Last sie sei, raffte sie sich aus ihrer Erstarrung auf und sagte heiser und rauh vor Erregung:
„Laßt mich fort! Ich will mir eine Stellung suchen. Ich habe mancherlei gelernt und hoffe, mir mein Brot verdienen zu können.“
Da fiel die Tante mit Schmähreden über sie her. Ob sie denn glaube, daß sie mit ihren fremden Sprachen eine Stellung ausfüllen könne. Dazu gehöre mehr. Rose nahm alle Kraft zusammen.
„Ich kann ja noch lernen, was nötig ist, und irgendwie muß ich doch diese Kenntnisse verwenden können.“ Tante Helene blitzte sie mit bösen Augen an.
„Ah, das ist der Dank für all die Opfer, die wir dir gebracht haben, jetzt willst du uns den Stuhl vor die Tür stellen. Jetzt, wo wir uns kein Mädchen halten können und mit der großen Wohnung dasitzen, willst du mir alle Arbeit allein aufbürden. Schämst du dich nicht deiner Undankbarkeit?“
Rose war fassungslos diesem Ausfall gegenüber, aber sie wagte doch zu erwidern:
„Ihr sagt mir doch immer, daß ich euch eine Last sei, und davon wollte ich euch befreien. Wenn ihr mich braucht, dann will ich gewiß nicht fortgehen.“
Und sie blieb und arbeitete noch mehr als bisher. Außer der Hausarbeit, die sie zum großen Teil selbst erledigte, frischte sie auch ihre und der Tante Garderobe auf. Neues konnte nicht mehr angeschafft werden, aber aus dem großen Vorrat von Garderobe aus besseren Zeiten schuf sie Neues mit ihren geschickten Händen. Aber Vorwürfe bekam sie immer wieder zu hören. Nur härmte sie sich jetzt nicht mehr so sehr darüber, denn es war ihr klar geworden, daß sie keine Last war, sondern sehr nötig gebraucht wurde. In ihrer Herzenseinsamkeit berührte es sie seltsam, als sie eines Tages Onkel und Tante von einer Cousine Herbert Rietbergs sprechen hörte. Erst dadurch erinnerte sie sich daran, daß auch ihr Vater einmal von dieser Cousine erzählt hatte. Sie lebte in Argentinien, und es fiel Rose auf, daß Onkel und Tante sehr abfällig über diese Josephine sprachen, während ihr Vater sehr lieb und gut über sie gesprochen hatte. Und es war Rose ein ganz seltsames Gefühl, daß diese Josephine eine Tante von ihr war. Ein Mensch lebte also doch noch irgendwo in der Welt, der durch Blutsbande zu ihr gehörte, wenn sie diese Tante Josephine auch nie kennengelernt hatte. Der Vater dieser Tante war der Bruder ihres Großvaters gewesen, während Herbert Rietbergs Vater nur ein Vetter dieser beiden Brüder gewesen war. Also war diese Tante Josephine ihr näher verwandt als Onkel Herbert und Tante Helene. Diese Erkenntnis überkam Rose in der Verlassenheit ihres Herzens wie ein leiser Trost. Wenn sie diese Tante Josephine auch nicht kannte, nie gesehen hatte und sie vielleicht nie sehen würde, so war sie doch auf der Welt — und ihr Vater hatte stets gut von ihr gesprochen. Freilich, ihr herrlicher Vater hatte fast von allen Menschen gutes geglaubt, denn er traute allen nur das Beste zu, bis sie ihn vom Gegenteil überzeugt hatten. Deshalb hatte er auch Onkel Herbert vertraut und ihm sein Kind ans Herz gelegt. Aber diese Tante Josephine war vielleicht doch ein lieber, guter Mensch. Und Rose schuf sich von ihr im Herzen eine Idealgestalt, stattete sie mit allen Vorzügen aus, nur um jemand zu haben, an den sich ihr einsames Herz im stillen klammern konnte.
Zu allem Unglück kam noch ein neues — ihr Onkel verlor seine Stellung, er wurde abgebaut, und das wäre zu einer Katastrophe geworden, wenn er nicht zufällig einen Jugendfreund getroffen hätte, der in der Inflation ungeheure Reichtümer zusammengerafft hatte. Dieser Jugendfreund, ein Herr Brückner, besaß eine große Automobilfabrik und war nach Berlin gekommen, um hier eine Filiale und einen Verkaufsraum für seine Autos einzurichten. Er stellte Herbert Rietberg als Leiter dieser Filiale an, mit einem noch besseren Gehalt, als er bisher bezogen hatte. Er tat das freilich erst, als er Herbert Rietberg in seiner Wohnung besucht und dabei Rose gesehen hatte — und diese hatte sofort einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht. Er war ein Mann in der Mitte der Vierzig, klein, untersetzt, mit einem gewöhnlichen Gesicht, dicken, wulstigen Lippen und kleinen, aber scharfblickenden Augen, die Rose als besonders unangenehm auffielen. Alfred Brückner wurde jäh von einer wilden Leidenschaft für Rose befallen. Er, der im Leben niemals Zeit gehabt hatte, sich mit Frauen zu befassen, weil er nur mit nimmersatter Gier nach Besitz und Reichtum gestrebt und zusammengerafft hatte, was er erraffen konnte, wurde jetzt, nachdem er sein Ziel erreicht hatte, plötzlich von einer so jähen Leidenschaft für dieses schöne Mädchen erfaßt, daß er alles andere darüber vernachlässigte. Dieses feine, stille Mädchen mit den traurigen Augen erschien ihm das schönste und begehrenswerteste Geschöpf unter der Sonne.
Er machte Herbert Rietberg gegenüber bald kein Hehl daraus, daß er sein Herz an Rose verloren habe. Gerade weil sie in ihren schlichten Kleidern so stolz und vornehm wirkte, gefiel sie ihm, der die Personifizierung des Gewöhnlichen war. Er malte sich aus, wie schön sie erst sein würde, wenn er sie mit Schmuck und schönen Kleidern behängen würde und wenn sie erst durch die Räume seiner mit allem Komfort ausgestatteten Villa dahinschreiten würde.
Er kam wieder und wieder, und nun begann eine Leidenszeit für Rose, die alles bisherige übertraf. Onkel und Tante drangen in sie, sie solle Herrn Brückner freundlich und liebenswürdig begegnen. Sie sei es ihnen schuldig, da Herr Brückner den Onkel angestellt und sie alle so aus großer Not befreit habe. So ein Glück werde ihr nie wieder geboten. Mit einem Schlage könne sie wieder reich, viel reicher als zuvor sein, und sie könne alles von ihm erlangen, was sie wolle, und werde hoffentlich ihren Einfluß auch für sie, ihre „Wohltäter“, geltend machen. Rose hörte das alles mit Entsetzen an. Als ihr der Onkel mit heuchlerischer Liebenswürdigkeit zum ersten Male davon sprach, daß sie einen großen Eindruck auf Herrn Brückner gemacht, und daß er sich auf den ersten Blick in sie verliebt habe, sagte sie, ihn mit großen Augen erstaunt ansehend:
„Du mußt dich irren, Onkel Herbert, Herr Brückner ist doch so alt wie du, er wird sich doch nicht in ein so junges Ding, wie ich bin, verlieben.“
„Was willst du? Brückner ist in den besten Mannesjahren, und vor allen Dingen ist er reich, sehr reich und kann seiner Frau alles bieten, was ihr Herz begehrt.“
„Reichtum kann nie erfüllen, was das Herz begehrt, Onkel Herbert. Du mußt mir gar nicht von Herrn Brückners Wünschen sprechen. Es peinigt mich, wenn dieser entsetzliche Mensch mich mit begehrlichen Blicken ansieht.“
„Einen entsetzlichen Menschen nennst du den, der mir Lohn und Brot gegeben hat und dadurch auch zu deinem Wohltäter wurde? Er hat uns alle vor dem Verhungern geschützt, das vergiß nicht.“
Rose wurde blaß.
„Du hast recht, ich hätte das nicht sagen sollen, wir müssen ihm dankbar sein. Aber er darf nicht daran denken, mich zu seiner Frau machen zu wollen. Lieber will ich auf der Stelle sterben, als diesen Mann heiraten!“
„Du bist überspannt, das habe ich schon immer gesagt“, kreischte Tante Helene. „Was bildest du dir denn ein? Du solltest Gott auf den Knien danken, daß so ein gediegener, gesetzter Mann dir seinen Reichtum zu Füßen legen will.“
Rose drückte die Hände an das Herz.
„Nein, Tante Helene, nie, niemals werde ich diesen Mann heiraten. Alles in mir setzt sich dagegen zur Wehr.“
„So? Und was soll aus uns werden? Er wird Onkel wieder entlassen, wenn du ihn abweisest.“
Erschrocken sah Rose in ihr Gesicht.
„Das wird er doch nicht tun? Er kann es Onkel doch nicht entgelten lassen, daß ich ihn nicht heiraten will?“
„Ganz gewiß wird er das tun.“
„Dann ist er kein guter Mensch, dann hat er eine niedrige Gesinnung.“
„Rede nicht solchen Unsinn. Sei endlich vernünftig und denke daran, was du uns schuldig bist. Jahrelang haben wir dich hier durchgeschleppt. Das hast du anscheinend vergessen.“
Frau Helene dachte selbstverständlich nicht daran, daß sie es sich jahrelang hatte wohl sein lassen von Roses Erbe. Das ignorierte sie wenigstens als belanglos. Rose starrte sie entsetzt an.
„Du wirst doch nicht verlangen, daß ich mich an einen Mann verkaufe, der mir widerlich ist, nur, weil ich euch meine Dankbarkeit beweisen soll?“
„Ich sage dir noch einmal, laß diese überspannten Reden. Du wirst Herrn Brückner dein Jawort geben, Onkel als dein Vormund hat ja da zum Glück ein Machtwort zu sprechen.“
„Alles will ich tun, arbeiten will ich für euch von früh bis spät, aber nur das nicht, nur das nicht!“
Herbert Rietberg ermannte sich auf einen Wink seiner Gattin.
„Du mußt schon gestatten, daß ich als dein Vormund nicht zugebe, daß du eine solche Partie ausschlägst. Du wirst dich fügen, wenn ich dir sage, daß ich Herrn Brückner in deinem Namen dein Jawort gebe. Es ist zu deinem Besten, und wenn junge Menschen so unvernünftig sind, muß man sie zu ihrem Glücke zwingen. Das alles kommt dir nur ein wenig überraschend, und ich werde dafür sorgen, daß du Zeit hast, dich an den Gedanken zu gewöhnen. Noch heute sage ich Herrn Brückner, daß es dir eine hohe Ehre sein wird, seine Gattin zu werden, daß du ihn aber bitten läßt, dir vier Wochen Zeit zu lassen, bis du dich im Herzen würdig auf diese Ehre vorbereitet hast. Und damit Punktum. Ich muß ihm das auf eine plausible Weise beibringen, damit er nicht gekränkt wird und abspringt. Also richte dich danach, in vier Wochen feiern wir deine Verlobung, und die Hochzeit wird bald folgen.“
Rose wollte etwas erwidern, aber er fuhr sie an: „Schweig jetzt, ich bin es müde, deine Torheiten anzuhören.“
Da preßte sie die Lippen zusammen und ging hinaus an ihre Arbeit. Niemand als sie selbst wußte, wie verzweifelt und unglücklich sie war. Aber eines wußte sie gewiß — lieber suchte sie den Tod, als daß sie diesem Manne angehören würde. Sie wußte nur, daß es keinen Zweck mehr hatte, zu widersprechen.
Herbert Rietberg sagte zu seinem neuen Chef, als er später mit ihm zusammentraf:
„Ich habe mein Mündel von Ihrer Bewerbung in Kenntnis gesetzt. Sie ist ganz benommen vor Glück. Das hat sie sich nicht träumen lassen, und sie ist noch ganz fassungslos. Sie ist überhaupt so ein bißchen sensitiv, und Sie müssen ihr ein wenig Zeit lassen, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen.“
Herrn Brückners begehrliche Augen funkelten. Er strich sich den Bart.
„Na ja, kann mir schon denken, daß ein solcher Glücksumstand ihr den Atem benimmt. Soll mit einem Male klotzig reich werden. Was ich in jahrelangem Ringen erreicht habe, soll ihr so mit einmal in den Schoß fallen. Das ist schon was für so ein armes Mädel. Aber es gefällt mir, daß sie sich ein wenig sperrt, andere Weiber werfen sich einem an den Hals, sie ist eine Aparte — ein wenig wehren, spornt das Begehren. Wie lange soll ich denn auf den ersten Kuß warten?“
„Sagen wir vier Wochen, lieber Herr Brückner.“
„Vier Wochen? Ist ein bißchen lange für meine Sehnsucht, aber gut, es soll sein, ich reise noch heute wieder ab, denn hier halte ich es nicht so lange aus. Heute in vier Wochen feiern wir Verlobung.“
„So soll es sein, Herr Brückner.“
„Unsinn, warum nennen Sie mich immer Herr Brückner? Wir waren doch mal Jugendfreunde. Na — und nun werden wir Verwandte. Schwiegeronkelchen! Na, dein Schaden soll es nicht sein, die Verwandten meiner Frau sollen es gut haben. Weißt doch, ich bin ein guter Kerl!“
Herbert Rietberg hätte zwar auf Herrn Brückners Güte keine Häuser gebaut, aber ihm genügte es, daß Brückner ihm versicherte, daß es sein Schaden nicht sein sollte. Er war durchaus willens, den Brücknerschen Reichtum auch auf sich mit ausstrahlen zu lassen. Und es stand fest bei ihm, daß er in den vier Wochen Roses Widerstand zerbrechen würde. Irgendwie würde er sie schon zur Räson bringen. Noch war er ja ihr Vormund, wenn auch nur noch kurze Zeit. Dann war sie mündig. Aber vorher würde er sie so weit bringen, daß sie Brückner ihr Jawort gab.
* * *
Rose saß im Dunkeln in ihrem Zimmer und starrte mit großen Augen vor sich hin. Tante Helene pflegte des Abends das elektrische Licht abzudrehen, damit es nicht unnütz verschwendet wurde. In der Inflationszeit hatten auch sonst nicht so sparsame Leute gelernt, das teure Licht zu sparen, und jetzt, da die Inflationszeit vorüber war, galt es doppelt zu sparen.
Onkel und Tante waren längst zu Bett gegangen und glaubten das von Rose auch. Aber so müde sie auch war, so fand sie doch keine Ruhe. Sie saß wohl schon eine Stunde so im Dunkeln, und die Gedanken jagten angstvoll hinter ihrer Stirn. Sie hatte am Abend noch einen Auftritt mit Onkel Herbert gehabt. Er hatte ihr kurz und bündig erklärt, Herr Brückner habe sein Wort, und in vier Wochen sei Verlobung. Sie hatte noch einmal versucht, ihre Einwände geltend zu machen, aber er hatte sie kaum zu Worte kommen lassen, und da hatte sie geschwiegen, weil ihr Reden doch nichts genützt hätte. Das hatte er als ein Zeichen angesehen, daß sie „vernünftig“ sein und sich fügen würde.
Aber während Rose nun im Dunkeln saß und sich frierend in ein Tuch wickelte, vor Erregung zitternd, suchte sie angstvoll nach einem Ausweg. Es war ihr klar, daß sie niemals in diese Verbindung willigen würde. Lieber ging sie in den Tod. Aber sie war jung und liebte trotz allem das Leben, das ihr seit dem Tode ihrer Eltern soviel Leid gebracht hatte. Ja, sie liebte das Leben und hoffte, wie jeder junge Mensch, daß auch für sie noch irgendwo ein Glück bereit sein würde.
Aber was konnte sie tun? Einfach davonlaufen? Wohin? Sie rief die Geister ihrer Eltern um Schutz und Hilfe an, denn auf der ganzen weiten Welt hatte sie ja keinen Menschen, zu dem sie hätte fliehen können. Freilich — sie hatte noch eine Tante in Argentinien — der Gedanke an diese fremde Tante überfiel sie wie ein leiser Hoffnungsfunke. Aber dieser Funke erlosch sofort wieder. Wie sollte sie zu dieser Tante gelangen? Und selbst, wenn das der Fall wäre, würde sie bei ihr Hilfe finden? Sie kannte ja diese Tante gar nicht, wußte über sie nur, was sie von Onkel und Tante und von ihrem Vater über sie gehört hatte, und das widersprach sich beides. Ihr Vater hatte diese Tante Josephine ein tapferes, unverzagtes Geschöpf genannt. Das fiel ihr jetzt ein in ihrer Herzensnot. Wie hatte doch der Vater von ihr gesagt? Sie saß und sann, und dann war ihr, als höre sie wieder deutlich die Stimme ihres Vaters: Er hatte ihr erzählt, wie lieb er die Mutter gehabt habe, wie sie sein alles gewesen sei. Außer der Mutter habe er nun keinen Menschen mehr, der zu ihm gehöre, außer seiner kleinen Rose, die ihm nun alles ersetzen müsse.
Und da hatte ihn Rose gefragt:
„Haben wir gar keine Verwandten mehr, außer Onkel Herbert und Tante Helene, lieber Vater!“
Er hatte vor sich hin gesehen.
„Eine Cousine lebt wohl noch von mir, irgendwo in der Welt, wahrscheinlich in Argentinien. Sie ist direkter mit mir verwandt als Onkel Herbert, denn mein Vater und der ihre waren Brüder. Sie hieß Josephine und war ein sehr schönes Mädchen. Ich habe sie immer gern gehabt, hatte aber mit meinem eignen Glück so viel zu tun, daß ich mich damals wenig um sie kümmerte. Und dann habe ich gehört, daß sie in die weite Welt gegangen ist mit dem Manne, den sie liebhatte, weil man sie zwingen wollte, einen reichen, ungeliebten Mann zu heiraten. Ein liebes, tapferes Geschöpf, sie hat recht getan, man muß seinem Herzen treu bleiben, sonstverliert man sich selbst.“
Rose war auf einmal, als streiche wie damals des Vaters Hand über ihr Haar. Ihr Herzschlag setzte aus. War das nicht, als spräche der Vater jetzt diese Worte noch einmal zu ihr und eindringlicher als damals?
Sie hat recht getan, man muß seinem Herzen treu bleiben, sonst verliert man sich selbst.
„Ja, Vater, lieber Vater, ich weiß, weshalb mir diese deine Worte gerade jetzt wieder ins Gedächtnis kommen, du willst mich mahnen, mir selbst getreu zu bleiben. Du bist bei mir in meiner Not und willst mir sagen, daß auch ich wie jene unbekannte Tante lieber hinaus in die weite Welt gehen soll, als meinem Herzen untreu zu werden. Hilf mir, lieber Vater, hilf mir, meine süße Mutter, ihr beiden da oben, ihr werdet doch euer Kind nicht aus den Augen lassen. Ich danke dir für diesen Fingerzeig, lieber Vater, lieber hinaus in die fremde Welt, als diesem schrecklichen Manne angehören.“
Wenn sie nur wüßte, wie sie zu der fremden Tante gelangen könnte.
Es fiel ihr nun auch wieder ein, was Tante Helene über jene Tante Josephine gesagt hatte. Sie sei durchgebrannt, das leichtfertige Geschöpf, mit einem armen Ingenieur, trotzdem ihr Onkel Herbert einen reichen Freier vorgestellt habe, der sie hatte zu seiner Frau machen wollen. Mit ihrem Herzliebsten sei sie davongelaufen, der auch nicht mehr gehabt habe als sie selber. Onkel Herbert habe es so gut mit ihr gemeint, habe alles versucht, sie zur Vernunft zu bringen, aber sie habe nicht auf ihn gehört. Ihr Herzliebster habe eine Stelle in Argentinien angenommen, und sie sei mit ihm gegangen. Und erst von Buenos Aires habe sie dann ihre Vermählungsanzeige geschickt. Bis dorthin sei sie als seine Geliebte mitgegangen. Sie sei eben eine ganz leichtfertige Person gewesen.
Gerade diese Vermählungsanzeige war es gewesen, die das Gespräch auf jene Tante Josephine gebracht hatte. Tante Helene hatte im Schreibtisch unter alten Papieren gekramt, und da war diese Vermählungsanzeige herausgefallen. Mit einem seltsamen Gefühl hatte Rose damals auf diese Anzeige geblickt. Mit einem Johannes Wörth hatte sich diese Tante Josephine verheiratet, hieß also jetzt Josephine Wörth. Josephine Wörth in Buenos Aires? Das war alles, was sie über diese ihr fremde Tante wußte. Sie sagte es noch einmal vor sich hin: Josephine Wörth aus Buenos Aires. Und ihr war, als grüße sie plötzlich etwas Vertrautes aus diesem Namen. Hatte das Schicksal Tante Josephines nicht Ähnliches mit ihrem eignen?
Entschlossen hob sie den Kopf. Ja, sie wollte auch lieber in die weite Welt gehen, als sich an einen ungeliebten Mann verschachern zu lassen. Irgendwo würde sie schon ein Unterkommen finden. Sie war jung und gesund und konnte und wollte arbeiten. Daß es jetzt schwer war, sein Fortkommen zu finden, wußte sie aus jener Zeit, da der Onkel abgebaut war und nach einer neuen Existenz suchte. Da hatte man in ihrer Gegenwart viel davon gesprochen, wie groß das Angebot an Stellensuchenden und wie klein das an Stellungen war. Und Tante hatte dann oft gesagt:
„Nur Hausangestellte finden immer sofort ein neues Unterkommen, an ihnen ist immer Mangel, die sind nie zu haben, wenn sie gebraucht werden.“