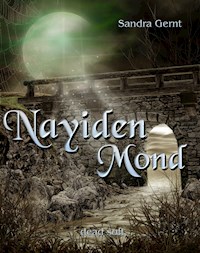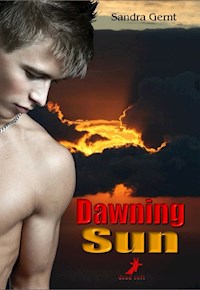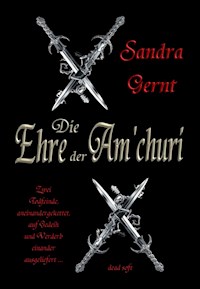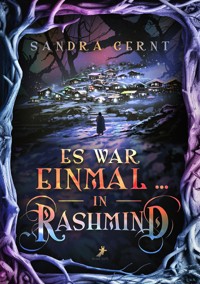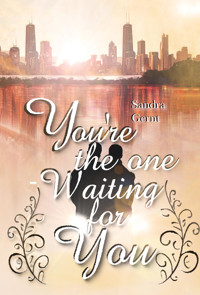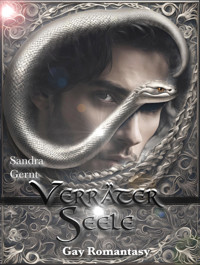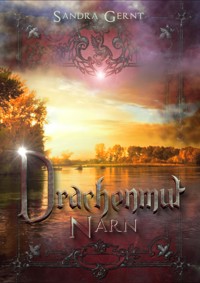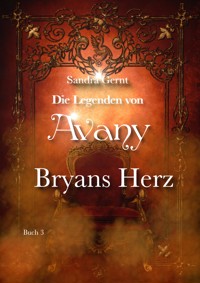5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Teil 1 der Vielleicht-Trilogie! Ben wusste eigentlich von Anfang an, dass es eine dumme Idee ist, in das Haus seiner Großmutter zu ziehen. Die alte Dame ist leicht dement und benötigt jemanden, der ihr im Alltag unter die Arme greifen kann. Soweit, so gut, doch warum muss er sich dafür opfern? Und warum kann er die Augen nicht von Sven lassen, der im Haus gegenüber wohnt? Sven ist nicht so ganz zufrieden mit seinem Leben. Mit seiner Freundin läuft es nicht. Das Studium ist nicht genau das, was er sich erhofft hat. Die Probleme mit seiner Familie helfen da auch nicht weiter. Als Ben gegenüber einzieht, freut er sich über einen gleichaltrigen Kumpel. Mehr als das ist da nicht. Kann ja auch gar nicht sein, schließlich sind sie beide nicht … anders. Oder vielleicht doch? Ca. 70.000 Wörter Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte ungefähr 335 Seiten. Teil 1: Vielleicht ... Mit dir Teil 2: Vielleicht ... Beim zweiten Versuch Teil 3: Vielleicht ... Beim dritten Mal
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Ben wusste eigentlich von Anfang an, dass es eine dumme Idee ist, in das Haus seiner Großmutter zu ziehen. Die alte Dame ist leicht dement und benötigt jemanden, der ihr im Alltag unter die Arme greifen kann. Soweit, so gut, doch warum muss er sich dafür opfern? Und warum kann er die Augen nicht von Sven lassen, der im Haus gegenüber wohnt?
Sven ist nicht so ganz zufrieden mit seinem Leben. Mit seiner Freundin läuft es nicht. Das Studium ist nicht genau das, was er sich erhofft hat. Die Probleme mit seiner Familie helfen da auch nicht weiter. Als Ben gegenüber einzieht, freut er sich über einen gleichaltrigen Kumpel. Mehr als das ist da nicht. Kann ja auch gar nicht sein, schließlich sind sie beide nicht … anders. Oder vielleicht doch?
Ca. 70.000 Wörter
Im normalen Taschenbuchformat hätte diese Geschichte ungefähr 335 Seiten.
von
Sandra Gernt
„Ich bin zu Hause!“
Sven warf seinen Fahrradhelm in das entsprechende Fach im Garderobenschrank. Die Spezialhandschuhe folgten, zuletzt die Schuhe. Auf Socken lief er durch den laminatgedeckten Flur in die großzügig geschnittene Küche und lauschte der allumfassenden Stille im Haus.
Seine Eltern waren beide arbeiten. Sein Vater als Busfahrer im Schichtdienst, ihn bekam Sven manchmal eine ganze Woche lang kaum zu Gesicht. Seine Mutter war Röntgenassistentin in der hiesigen Klinik, ebenfalls im Schichtdienst. Entsprechend sah er sie keineswegs häufiger als seinen Vater, vor allem, seit sie vor über elf Jahren wieder in die Vollzeit eingestiegen war. Da war Sven gerade zehn geworden und seine kleine Schwester Esther acht.
Esther leistete gerade ein soziales Jahr in einer historischen Stiftung ab, um etwas Sinnvolles zu tun, während sie überlegte, was sie mit dem Rest ihres Lebens anfangen wollte. Die Arbeit war recht interessant, zu Tode schuften musste sie sich hingegen nicht. Normalerweise war sie um diese Zeit zu Hause. Sie verbrachte allerdings so viel Zeit wie möglich mit Hendrik, ihrem Freund; und einer Idee, was sie beruflich mit sich anfangen wollte, hatte sie noch nicht entwickelt. Wann auch, wenn sie eigentlich ununterbrochen damit beschäftigt war, mit Hendrik abzuhängen, mit ihm zu chatten oder ihre Freundinnen zu nerven, wie verliebt sie doch war?
Sven schmunzelte nachsichtig. Als er mit Leonie zusammengekommen war, hatte er auch die ganze Welt wahnsinnig gemacht. Frisch Verliebte waren nun einmal anstrengend. Und irgendwie süß. Darum konnte er Esther gut verstehen und ihr verzeihen, dass sie im Augenblick zu nichts zu gebrauchen war.
Er schaute in den Kühlschrank, in der vagen, von vorneherein vergeblichen Hoffnung, dass seine Mutter es geschafft haben könnte, einen Großeinkauf zu leisten. Im Moment musste sie immer wieder in die Nachtschicht einspringen und hatte kurze Wechsel, weil mehrere Kollegen krank oder im Urlaub waren. Das waren die Tage, wo sie es verfluchte, in der Klinik zu arbeiten statt in einer Privatpraxis, wo sie strikt geregelte Arbeitszeiten hätte, keinen Wochenenddienst, keine Rufbereitschaft. Da würde sie allerdings auch erheblich weniger verdienen, weil die ganzen Zuschläge wegfallen würden. Darum wollte sie bleiben, wo sie war, damit sie sich weiterhin die Abtragung für dieses kleine Haus leisten konnten, das zweite Auto, die Kurzurlaube an der Nordsee. Als Busfahrer brachte sein Vater leider nicht genug nach Hause, um die Abschläge ausgleichen zu können, die bei einem Wechsel anfielen.
Sven seufzte innerlich. Esther und er würden in den nächsten Jahren ausziehen. Er, sobald er sein Studium beendet und einen Job gefunden hatte, Esther, sobald sie wusste, was sie wollte, und es entsprechend durchgezogen hatte. Dann würden seine Eltern allein in diesem Haus hocken. Es war nicht riesig, dafür alt. Ein Reihenendhaus aus den Sechzigern. Immer war irgendetwas kaputt, der Garten machte eher Arbeit als Freude. Eine hübsche kleine Wohnung mit Balkon wäre so viel sinnvoller, seiner Meinung nach. Ein zweites Auto brauchten seine Eltern eigentlich auch nicht zwanghaft, mit etwas Organisation kämen sie mit einem einzigen wunderbar zurecht. Dann könnte seine Mutter auf einen entspannteren Arbeitsplatz wechseln und die Nordsee wäre trotzdem noch drin. Aber das war ihr Leben, nicht seines.
Er betrachtete die wenigen Lebensmittel, die dieser Kühlschrank zu bieten hatte. Für ein Omelett würde es gerade noch reichen. Rasch schnitt er sich Frühlingszwiebeln, Kirschtomaten und Fetakäse auf, verquirlte Eier und hatte nach wenigen Minuten ein nettes Spätnachmittagessen. In dieser Zeit musste er zu seinem Leidwesen feststellen, dass er doch nicht allein daheim war – über seinem Kopf polterte und quietschte es rhythmisch. Sven seufzte in sich hinein. Also hatten Esther und Hendrik gerade jede Menge Spaß. Was er ihnen von Herzen gönnte, auch wenn er selbst keinen Spaß hatte. Stattdessen übernahm er Esthers Anteil am Haushalt, indem er rasch die Spülmaschine ausräumte, während er aß und sich eine Kanne Früchtetee aufsetzte. Er war völlig besessen von dem Zeug und trank praktisch nichts anderes, wenn es möglich war. Weil keine sauberen Küchenhandtücher mehr da waren, warf er gleich noch eine Waschmaschine an und er holte sich Haushaltsgeld aus der Zuckerdose, um nachher ein bisschen einkaufen zu gehen. Wenn seine Mutter in ihrem Schichtsystem verloren ging, bedeutete das automatisch den Untergang des Haushaltsschiffs. Und sie ging nun einmal jede Woche aufs Neue verloren, schon seit Jahren, und Besserung war nicht in Sicht. Sein Vater bemühte sich nach Kräften, war aber in der Regel zu erschöpft und auch zu lethargisch, um viel zu kompensieren und tat selten etwas freiwillig, ohne dass man ihn explizit dazu aufgefordert hatte. Im Klartext hieß das: Sven leistete deutlich mehr als den üblichen Teil, damit niemand verhungerte und es saubere Wäsche und Geschirr gab. Meistens tat er es gerne.
Er trug seine Teekanne und die Studienunterlagen hoch in sein Zimmer. Auf Zehenspitzen huschte er am Zimmer seiner Schwester vorbei, aus dem momentan bloß erschöpfte Stille und ein gelegentliches Kichern drang. Eigentlich könnte er auch durch lautes Pfeifen klarmachen, dass sie nicht mehr länger allein im Haus waren, aber dazu hatte er keine Lust. Würde bloß Stress und Vorwürfe geben, das konnte er überhaupt nicht gebrauchen.
Mit Ohrstöpseln und Handymusik, um die unvermeidliche nächste Runde Matratzensport nebenan auszublenden, saß er da und genoss eine Tasse heißen Tee. Die Augen geschlossen dachte er einfach an nichts. Er war müde. Müde, weil er um 5.00 Uhr morgens aufstehen musste, um pünktlich zur Uni zu kommen. Müde, weil er in einer Stunde zum Nebenjob hasten musste. Zwei Stunden jobben in der Eisdiele, zwei- bis dreimal die Woche, dazu das Wochenende. Damit verdiente er genug, um seine Monatskarte und die Semestergebühren zusammenzustoppeln. Im Winter, wenn die Eisdiele geschlossen war, suchte er sich wieder etwas anderes, das hatte bislang immer geklappt. Es war enttäuschend, dass er seine geringe Freizeit nicht in Ruhe auskosten konnte, sondern kochen, einkaufen, waschen und aufräumen musste, um seine Familie zu unterstützen. Der Weltuntergang war es nicht. Bloß ein bisschen anstrengend.
Sven öffnete die Lider, stand auf, stellte die leere Teetasse auf den Schreibtisch. Er musste los, wenn er tatsächlich noch einkaufen wollte, bevor er Eisbecher, Kaffee und Kaltgetränke servierte. Ein Blick aus dem Fenster ließ ihn stutzen. Auf der Straße unter ihm stand ein klappriger grau-blauer Wagen mit geöffnetem Kofferraum. Der war mit Kartons und Körben gefüllt. Zog jemand ein?
Sven beugte sich etwas vor und entdeckte die geöffnete Haustür beim Haus unmittelbar gegenüber. Dort lebte eine alte Dame, die ihm früher immer Kaugummis geschenkt hatte. Frau Schmittzens. Die war im Verlauf der Jahre tüddelig geworden, wie man gerne sagte. Das klang niedlicher als dement. Sie war nicht völlig hilflos, konnte tatsächlich noch allein leben. Seit einiger Zeit bekam sie die Mahlzeiten vom Sozialdienst geliefert, einmal die Woche besuchte sie zudem eine Haushaltshilfe, die ihr mit dem Notwendigsten unter die Arme griff. Zog sie jetzt vielleicht aus und siedelte in ein Altersheim über?
Nein. Sven beobachtete einen schlanken jungen Mann mit dunklem Kurzhaarschnitt, der sich zwei Kartons auf einmal schnappte und diese ins Haus hineintrug. Merkwürdig … Hatte die Familie der Dame vielleicht die Einliegerwohnung in der ersten Etage vermietet? Frau Schmittzens Tochter Frauke hatte dort früher gewohnt. Soweit Sven wusste, stand die Wohnung seit Jahren leer und staubte vor sich hin.
Nun denn. Es war egal, er musste los. Schließlich wollte er die Tiefkühlerbsen nicht mit ins Eiscafé nehmen.
Ben schnaufte und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Nur mal schnell umziehen. Heute Morgen hatte es sich angefühlt, als wäre das wirklich alles gar kein Problem. So viel Zeug besaß er schließlich gar nicht. Sein Auszug von daheim vor eineinhalb Jahren war überhaupt keine Schwierigkeit gewesen, in weniger als zwei Stunden beendet. Klar, seitdem hatte er ein wenig Haushaltskram gekauft, aber das sollte nicht viel ausmachen, oder? Dementsprechend hatte er die Hilfsangebote seiner Eltern ausgeschlagen, war um sechs Uhr aufgestanden, hatte geduscht, gefrühstückt, angefangen zu packen …
Seither war er bereits bei zwei Supermärkten gewesen, um leere Kartons zu erbetteln und erst vor rund einer Stunde damit fertig geworden, den gesammelten Kram und Krempel halbwegs geordnet zu verstauen. Wann bitteschön hatte sich sein Besitz verhundertfacht? Er konnte sich beim besten Willen nicht erinnern, das ganze Zeug gekauft zu haben. Einen Gutteil Gerümpel hatte er direkt zur Müllkippe gefahren und er hoffte und betete, dass er heute noch fertig werden würde. Immerhin musste er seine alte Bude besenrein übergeben, und das bereits morgen Mittag. Er hatte sich völlig verschätzt. Mit allem. Es war schon nach fünf, verdammt! Und er hatte noch einmal mindestens dieselbe Menge an Kartons in seiner alten Bude herumstehen!
Für einen Moment lehnte sich Ben müde gegen sein Auto. Warum genau hatte er sich auf diesen Unfug eingelassen? Er wusste es nicht. Wirklich nicht. Irgendwie hatte seine Mutter ihn über den Haufen gerannt, wie üblich. Eigentlich wollte er seine Wohnung überhaupt nicht aufgeben! Ach, das war alles Dreck, verdammt! Es hatte ihn derartig aus dem Takt gebracht, dass er seine normale Vorgehensweise ignoriert hatte. Typisch für ihn wäre es gewesen, schon zwölf Wochen vorher alles akribisch zu planen, fünfundzwanzig Listen anzufertigen, was benötigt wurde, um einen stress- und reibungsfreien Ablauf zu garantieren, und diesen Plan dann Punkt für Punkt abzuarbeiten. Stattdessen hatte er den Umzugstag einfach verdrängt, bis nichts mehr ging, und war jetzt im totalen Chaos versackt. Das war das Gegenteil von jenem Maß an Kontrolle, das er sonst wie Luft zum Atmen benötigte. Das war furchtbar! Und er hasste diesen Umzug noch immer und konnte nichts dagegen tun!
Übellaunig packte er sich die nächsten beiden Kartons auf die Arme, drehte sich schwungvoll um …
… und stürzte über die Bordsteinkante.
Es krachte, schepperte, klirrte. Für einen Augenblick blieb Ben völlig erstarrt dort hocken, wo er gelandet war. Dann kam der Schmerz an. Knöchel, Knie, Hände. Letztere waren aufgeschrammt. Und seine Gläser wahrscheinlich alle kaputt. Nicht dass sein Herz daran gehangen hätte. Es war ein Sammelsurium aus leeren Senf- und Marmeladengläsern und ein paar Billigteile aus einem Möbelhaus für fünfzig Cent pro Stück gewesen. Trotzdem ärgerte er sich gerade maßlos und zerrte wild fluchend die beiden Kartons zu sich heran. Ein Blick genügte – alles kaputt.
„Verdammte Scheiße!“, knurrte er und schubste den Müll von sich. Mehr als Müll war schließlich nicht übrig. Na fein! Wasser konnte man prima aus der Flasche trinken. Auch wenn seine Oma der Meinung war, dass solche Leute jegliche Kontrolle über ihr Leben verloren hatten. Das wiederum hatte nichts weiter zu bedeuten, denn seine Oma hatte selbst die Kontrolle über ihr Leben verloren. Genau deshalb saß er ja auch hier, versuchte umzuziehen, obwohl er das gar nicht wollte und wagte gerade nicht aufzustehen, weil er nicht wirklich herausfinden wollte, ob sein Knöchel nun ebenfalls kaputt war oder nicht.
„Hey, alles okay mit dir?“
Ben fuhr zusammen, als er die Stimme hörte, und blickte über die Schulter. Ein Typ stand einige Meter entfernt von ihm neben dem Auto und schaute ihn besorgt an. Ungefähr sein Alter, schätzte er spontan, also Anfang zwanzig. Mittelgroß, schmal gebaut, Brille, dunkelblondes, fransiges Haar, das unter einer schwarz-weiß-geringelten Beanie hervorlugte. Er trug eine schwarze Jacke, die Hände waren in den Taschen vergraben. Etwas an ihm wirkte vertraut. Stirnrunzelnd starrte Ben ihn an.
„Du wohnst gegenüber, oder?“, fragte er. Sofort wurde ihm klar, dass sein Tonfall nicht gerade freundlich rüberkam, denn der Typ wich zwei Schritte zurück.
„Ja“, sagte er dann allerdings. „Kennen wir uns? Du ziehst hier ein?“ Jetzt furchte er ebenfalls die Stirn und Erkenntnis sickerte in seine Augen. „Warte, du bist einer der Enkel von Frau Schmittzens, oder?“
„Ja. Und ja, ich ziehe ein. Und nein, es ist nicht alles okay. Ich habe meine Gläser geschrottet.“
„Hast du dich verletzt? Ich bin übrigens Sven.“ Er kam auf ihn zu und streckte ihm die Hand entgegen. Murrend stellte Ben sich vor, stand dann auf und belastete vorsichtig sein Bein. Erfreulicherweise war der Schmerz zu ertragen.
„Alle Sehnen und Gelenke scheinen überlebt zu haben“, murmelte er. „Dank dir. Ich mach mal besser weiter.“
Sven zögerte, blickte auf sein Handy, wohl um die Uhrzeit zu checken. „Soll ich dir ein bisschen helfen? Ich wollte eigentlich vor Schichtbeginn kurz einkaufen, aber das kann ich auch danach tun. Ich hab einen Aushilfsjob bei Tony.“
Tony war der einzige Eisladen und damit der Höhepunkt in diesem Städtchen, das selbst diese Bezeichnung kaum verdient hatte. Ben hatte völlig vergessen, wie gerne er dort früher gewesen war, um seinen heiß geliebten Cookie-Eisbecher zu genießen. Das war jedenfalls ein Pluspunkt, wenn es darum ging, zurück in dieses Kaff zu ziehen.
Während er noch sinnierte, hatte Sven sich die beiden Kartons mit der Bruchware geschnappt und die Scherben im Restmüll entsorgt.
„Ich will dich nicht aufhalten“, murmelte Ben abwehrend.
„Ich mach das gerne. Und es ist für mich auch wirklich kein Problem. Sag mir, was wohin gehört, umso schneller bist du fertig.“ Ein breites Grinsen erhellte Svens Gesicht. Er hatte Sommersprossen auf der Nase und Grübchen in der Wange, wenn er so breit lachte. Aus irgendeinem Grund dämpfte dieser Anblick die latente Wut, die schon den ganzen vermurksten Tag in Ben kochte, und er nickte ihm zu.
„Okay. Schnapp dir, was du tragen kannst, und folge mir. Meine Oma kennt dich, also wird sie hoffentlich nicht gleich die Polizei rufen, nur weil ich Leute in ihr Haus lasse.“
Sven stutzte verblüfft. „Ist es so schlimm mit ihr geworden?“, wisperte er. „Ich sehe sie bloß selten.“
„Lass uns nicht davon reden“, flüsterte Ben zurück. „Ihre Ohren sind unglaublich gut, wenn sie etwas nicht mitbekommen soll.“
Sven nickte traurig vor sich hin. Demenz war nicht einfach zu verstehen, es machte betroffen, es befremdete. Ben erging es da keineswegs anders. Er jedenfalls würde niemals behaupten, dass er Demenz vollumfänglich begriff. Seine Oma war in erster Linie anders als zuvor. Mal ängstlich. Mal wütend. Mal völlig draußen. Mal gut dabei. Es war nicht so, als hätte sie den Text ihrer Lebensmelodie vergessen, sondern eher, als würde sie gelegentlich ein, zwei Noten überspringen und sich darüber entweder wundern, ärgern oder fürchten. Also nicht die völlige Umnachtung, die viele Leute mit Demenz in Verbindung brachten, sondern lediglich milde Verwirrung und sehr, sehr viel Starrsinn.
Gemeinsam luden sie sich die Arme voll und betraten das Haus.
„Es gibt eigentlich einen gesonderten Eingang für die Einliegerwohnung oben“, sagte er, bemüht, den Karton mit den Tellern fest und sicher zu halten, damit wenigstens die heil blieben. „So herum geht es schneller.“
„Okay.“
„Benny!“ Seine Oma kam aus der Küche geschossen. Ziemlich mollig war sie in den letzten Jahren geworden, dazu beständig kleiner. Oder lag es daran, dass er größer geworden war? Schwer zu sagen … Sie färbte sich die Haare noch immer in ihrer gewohnten Haarfarbe, einem kräftigen Nussbraun. Dadurch wirkte sie jünger als ihre fünfundsiebzig Jahre. Ihr dunkelblaues Kleid hingegen war verknittert, was früher undenkbar gewesen wäre. Sie blickte durch ihre Lesebrille, bemerkte, dass sie damit nichts erkannte und tauschte sie gegen die andere Brille, die sie hoch ins Haar geschoben hatte. „Benny! Warum steht die Haustür denn immer noch offen? Und wer ist das da?“ Anklagend wies sie auf Sven.
Irgendein Typ, der mich auf der Straße angequatscht hat. Du kennst ihn vielleicht. Das wäre die faktisch richtige, aber wenig hilfreiche Antwort.
„Hallo Frau Schmittzens“, sagte Sven da bereits und lächelte freundlich. „Sie kennen mich, ich wohne direkt gegenüber.“ Er zerrte sich die Beanie vom Kopf. „Entschuldigung“, fügte er leise hinzu und errötete dabei leicht, als wäre es eine Todsünde, im Haus eine Mütze zu tragen.
„Ach!“, rief Bens Oma und lächelte nun auch. „Der Sven. Du bist ordentlich groß geworden! Magst du denn immer noch so gerne die Fruchtkaugummis?“
„Nicht mehr so unbedingt, nein.“ Sven sah hilfesuchend zu ihm und Ben wies auf die Kartons.
„Oma, wir müssen weitermachen. Ich muss gleich noch einmal los, um die Reste zu holen und ich wollte durchaus vor Mitternacht fertig werden.“
„Ist gut, Junge. Lieb von dem Sven, dass er dir hilft. Ihr habt früher zusammen gespielt, oder?“
Ben zögerte auf dem Weg zur Treppe, die ins erste Obergeschoss zur Einliegerwohnung führte. Er erinnerte sich sehr diffus, dass er mit einer Horde Kinder auf der Straße Fußball gespielt hatte, wenn er damals hergekommen war, um seine Oma zu besuchen. Möglich, dass Sven dabei gewesen war. Also nickte er, um sie zufrieden zu stellen, und eilte dann die Treppe hinauf. Normalerweise war die Tür oben abgeschlossen. Seine Mutter hatte ihm geschworen, dass er das auch weiterhin auf diese Weise handhaben durfte, damit er nicht irgendwann nachts um drei wach wurde, weil seine Oma schlafwandelnd neben seinem Bett stand.
Es war eine dumme Idee gewesen. Warum zur Hölle hatte er sich bloß darauf eingelassen, hierher zu ziehen?
Mit Svens Unterstützung ging es zumindest sehr schnell, das Auto leerzuräumen.
„Ich fahr dich schnell zu Tony runter“, sagte Ben. „Das ist das Mindeste für deine Hilfe.“
„Hab ich gerne gemacht.“ Sven zuckte mit den Schultern. „Aber das Angebot nehme ich trotzdem an, sonst komme ich zu spät. Musst du noch viel holen?“
„Etwa ein Dutzend Kartons, die Matratze und Bettwäsche sowie einige Koffer mit Klamotten. Die restlichen Möbel hole ich morgen früh. Da hilft mir mein Cousin, der besitzt einen Transporter. Leider hatte der heute keine Zeit.“
„Klingt doch machbar.“ Sven saß neben ihm und schwieg den Rest der kurzen Fahrt über, bis das Eiscafé in Sicht kam.
„Dank dir nochmals“, murmelte Ben. Er war nicht allzu gut darin, sich anständig bei den Leuten zu bedanken. An selbstlose Hilfsaktionen war er sowieso nicht gewohnt. „Ich mach das gut“, fügte er etwas lahm hinzu.
„Das musst du nicht. Genieß deine erste Nacht in der neuen Wohnung. Du weißt ja, die Träume sind wichtig und so.“ Kurz zögerte Sven, als er sich abschnallte und nach seinem schwarzen Rucksack griff. „Wir haben übrigens nie zusammen gespielt, als wir klein waren“, murmelte er. „Ich war die Brillenschlange.“ Er stieg aus, lächelte, winkte ihm zu und verschwand, noch bevor Ben reagieren konnte.
Ihm wurde heiß und kalt zugleich. Hatte er ihn etwa gemobbt? Er konnte sich nicht erinnern! So etwas würde er nicht tun, oder? Er war kein Mobber gewesen. Jedenfalls nie mit Absicht. Er hatte schon immer dazu geneigt, die Dinge geradeheraus zu sagen, ohne Rücksicht auf Gefühle oder Befindlichkeiten anderer Leute. Wenn er mal wieder unsensibel war, merkte er das mittlerweile an den Reaktionen und konnte die Sache klarstellen. Als Kind hatte er da garantiert versagt … Niedergeschlagen starrte er auf die große Fensterscheibe des Eiscafés. Es wäre nicht allzu klug, dort jetzt reinzugehen und sich für etwas zu entschuldigen, an das er sich nicht einmal erinnerte.
Also fuhr er weiter, zu seiner alten Wohnung. Fünfunddreißig Kilometer entfernt von dem Dorf, in dem seine Oma lebte. Eine etwas größere Stadt mit guter Infrastruktur, das war ihm eigentlich extrem wichtig gewesen, als er von zu Hause ausgezogen war. Zugegeben: Seine Mutter hatte ihn eigentlich nur deshalb erfolgreich überreden können, diesen Schritt zurück auf sich zu nehmen, weil er von den Nebenwirkungen der guten Infrastruktur genervt war. Direkt gegenüber seines Schlafzimmerfensters befand sich eine Bushaltestelle, die bis zwei Uhr morgens viel frequentiert wurde. Ab fünf Uhr ging es dann auch schon wieder los. Nicht selten wurde er nachts von Polizei- und Feuerwehrsirenen geweckt. Der allgemeine Verkehrslärm war groß. Am Wochenende flanierten Partygänger und Besoffene die ganze Nacht unter seinem Fenster. Ja, man konnte bis Mitternacht einkaufen. Es gab Ärzte, Friseure, Apotheken und Therapeuten und alles das in ausreichender Menge und guter Erreichbarkeit. Von Omas Häuschen aus konnte man allerdings auch vieles in kurzer Zeit erreichen. Es blieb dabei: Er hatte sich breitschlagen lassen, weil er verwundbar gewesen war, und somit einer wirklich dummen Idee zugestimmt. Wie das enden sollte, das war beim besten Willen nicht abzusehen … Und ob er in dieser Wohnung bleiben wollte, bis es seine Oma nicht mehr gab, darüber wollte er noch viel weniger spekulieren. Sie war erst fünfundsiebzig und insgesamt sehr rüstig. Es gab keinen Grund anzunehmen, dass sie nicht noch zwanzig Jahre fröhlich weiterleben würde und genau das gönnte er ihr auch von Herzen. In der Hoffnung, dass sich ihr geistiger Zustand nicht verschlimmerte und sie diese Zeit bestmöglich genießen durfte.
Ben schloss die Wohnungstür auf. King Charles der I., grundsätzlich Charly, manchmal aber auch Stinker genannt, trabte zu ihm. Die Nase schrammte fast am Boden, er winselte leise. Normalerweise war der Jack Russel durch nichts zu bändigen und sprang wie ein Flummi auf Speed an ihm rauf, sobald Ben durch die Tür kam. Besorgt kniete er sich zu seinem kleinen Kumpel nieder.
„Hey! Was ist denn mit dir passiert?“, fragte er und streichelte den Hund beruhigend. Der ließ sich fallen und bot sein strammes Bäuchlein dar. „Okay. Du hast Blödsinn gemacht, hm, Stinker? Schlimmen Blödsinn? Ist was kaputt gegangen? Hast du wieder meine Hausschuhe zerfleddert?“ Er hob sich den Hund auf die Arme, was dieser wie stets tolerierte, statt wie die meisten anderen Hunde energisch dagegen zu protestieren, und ging durch die schmerzlich chaotischen Räume. Möbel standen kreuz und quer, vereinzelte Kartons verteilten sich hier und dort, Müll lag herum, erstaunliche Dreckmengen. Ben war extrem reinlich, darum empfand er es als erschreckend bis widerwärtig, wie viel Staub und Dreck zum Vorschein kam, wenn man Möbel beiseite räumte, hinter die man sonst nicht kriechen konnte, weil sie zu dicht an den Wänden standen. Und das nach lediglich eineinhalb Jahren!
In der Küche entdeckte er eine stinkende kleine Pfütze auf den weißen Fliesen.
„Aha. Dir ist ein Unfall passiert, hm? Ist nicht schlimm, Dickerchen. Ich war zu lange weg. Und hier ist alles anders als sonst, so unruhig und es riecht fremd … Hattest du Angst? Angst, dass ich niemals wiederkomme?“
Charly leckte ihm hingebungsvoll über die Finger und winselte weiter. Armer Hund. Ben setzte ihn neben sich, streichelte ihn, sprach auf ihn ein, während er die Bescherung wegwischte.
„Ich hätte dich besser mitgenommen, das war richtig dumm von mir. Dann hättest du nicht allein in diesem zugemüllten Drecksloch auf mich warten müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass es so wahnsinnig lange dauert. Außerdem wollte ich nicht, dass du zu viel Stress hast. Die lange Fahrerei, in der Wohnung hätte ich dich festbinden müssen, damit du dich nicht verletzt, du wärst mir trotzdem ständig zwischen die Beine geraten … Ist jetzt einfach sehr anstrengend. Aber morgen wird es schon besser, das verspreche ich dir. Und gleich nehme ich dich mit, dann lernst du das neue Zuhause auch schon kennen. Okay? Du kennst das Haus. Und du magst Oma. Das wird gut werden, keine Sorge.“
Er gab dem Kleinen sein Abendessen, brachte so rasch wie möglich die restlichen Kartons, Matratze und Bettzeug nach unten, kontrollierte, ob er auch wirklich nichts Wichtiges vergessen hatte. Alle Elektrogeräte waren ausgestöpselt, inklusive Kühlschrank und Waschmaschine. Zahnbürste und Rasierapparat befanden sich bereits in der neuen Wohnung. Den Rest würde er morgen früh mit Nico, seinem Cousin erledigen. Es juckte ihm zwar in den Fingern, hier noch weiterzumachen und am besten bis zwei Uhr morgens zu ackern, um so viel wie möglich wegzuschaffen. Aber zum einen war er müde bis an den Rand des Auseinanderbröselns, zum zweiten musste er morgen früh zu vollkommen unchristlichen Zeiten aufstehen und wieder antreten und zum dritten wartete seine Oma auf ihn und wollte früh zu Bett gehen. Darum packte er lediglich Charlys Körbchen, Futter- und Wassernapf, Bürste, Decken, Spielzeug, Futter, Leckerlis, Kauknochen und all die tausend anderen Dinge, die es benötigte, um einen Hund zu versorgen und glücklich zu machen. Der Kleine fiepte aufgeregt und stromerte ihm zwischen den Beinen herum. Sicher hatte er Angst, wieder zurückgelassen zu werden.
„Komm, Charly! Wir fahren!“
Charly bellte laut und anhaltend, was er sonst eigentlich nie tat – deutliches Zeichen dafür, dass er heute vernachlässigt worden war und sich nicht richtig hatte austoben dürfen. Ben versuchte gar nicht erst, ihn am Bellen zu hindern. Die Nachbarn durften ruhig wissen, dass sie unterwegs waren und nach dem morgigen Tag würde er diese Leute nie mehr wiedersehen. Draußen ließ er Charly ein bisschen herumschnüffeln, ausgiebig pinkeln und etwas umherlaufen, bevor er ihn ins Auto scheuchte.
Es war nicht geplant gewesen. Doch als er die neue Heimat erreichte, hatte er tatsächlich so lange herumgetrödelt, dass er Sven entdeckte. Der hatte seine Arbeitseinheit im Eiscafé offenkundig schon beendet und kam gerade aus der Einfahrt des Supermarkts. Er bewegte sich derartig müde, dass Ben unwillkürlich anhielt und das Fenster herunterfuhr.
„Soll ich dich mitnehmen?“, fragte er. „Spart dir eine Viertelstunde Fußmarsch und du weißt, es ist definitiv kein Umweg.“
„Passe ich denn noch mit rein?“, fragte Sven skeptisch und starrte auf die zugestopfte Rückbank.
„Du musst dich bloß mit Charly arrangieren.“ Ben wies auf seinen Hund, der bei der Nennung seines Namens sofort aufmerkte und leise wuffte. Er hockte in seiner Transportbox, die auf dem Sitz angeschnallt war. „Es wäre ganz gut, wenn ihr euch kennenlernt, bevor du versuchst, die Box zu bewegen.“
„Okay …“ Sven umrundete den Wagen, öffnete vorsichtig die Beifahrertür und beugte sich langsam hinab, kritisch beäugt von Charly, der ihn nicht aus dem Blick ließ. Der Kleine kläffte leise, knurrte jedoch nicht.
„Er kann schwierig sein, wenn er auf Fremde trifft“, sagte Ben. „Er würde aber niemals einfach zuschnappen. Was er ja im Moment sowieso nicht kann. Hey, Charly! Ist alles gut, mein Junge!“
Charly warf ihm einen Blick zu, der eindeutig sagte, dass gar nichts gut war, solange er in dieser Kiste hocken musste. Dann legte er sich nieder und protestierte nicht, als Sven sich am Gurt zu schaffen machte.
„Er mag dich, wie es scheint.“ Ben konnte sich das Grinsen nicht verkneifen und wusste nicht einmal, warum genau. Irgendwie gefiel es ihm, dass sein Hund sich von der besten Seite präsentierte, das musste es wohl sein. Sven verstaute seinen prall gefüllten Rucksack im Fußraum, nahm die Transportkiste mit Charly auf den Schoß und schaffte es irgendwie, sich mitsamt der Kiste anzuschnallen. Die Fahrt dauerte keine fünf Minuten. Es war schon dunkel, als sie ankamen, auch wenn es im April bereits länger hell blieb.
„Ich helfe dir noch mit der Matratze“, verkündete Sven. Es war keine Frage, sondern eine Tatsache, die er offenkundig nicht diskutieren wollte. Dazu war Ben auch viel zu müde, darum versuchte er es gar nicht erst. Er brachte rasch Charly ins Haus zu seiner Oma. Die kannte den Hund und freute sich immer, ihn zu sehen.
„Kannst du ihn bitte ein bisschen auf der Terrasse herumscheuchen?“, fragte Ben. „Er hatte heute viel zu wenig Bewegung.“
„Na klar. Komm, Junge, komm!“ Seine Oma schlüpfte in ihren dicken Mantel und die Filzpantoffeln und griff zu der Frisbeescheibe, was Charly in helle Freude versetzte. Das war ein Sport, den er stundenlang betreiben könnte. Da er unglaublich geschickt war, musste Bens Oma sich kaum bewegen, sondern bloß die grellgrüne Plastikscheibe werfen, die Charly ihr brav wieder apportierte. Derweil trug Sven die Matratze mit nach oben und packte unaufgefordert auch bei den Kartons mit an. Nach weniger als fünfzehn Minuten war das Auto ausgeräumt.
„Ich mache das gut“, wiederholte Ben sein Versprechen von vorhin. „Kann ich dich vielleicht demnächst auf eine Pizza einladen?“
„Bei Pizza würde ich niemals nein sagen.“ Sven lächelte matt und rückte seine Einkäufe zurecht. „Samstag wäre ganz gut. Oder auch Sonntag. Ich arbeite an beiden Tagen von zwölf bis achtzehn Uhr, danach habe ich frei.“
„Samstagabend klingt perfekt. Um sieben? Also abends natürlich.“
„Ich komme dann rüber.“
Seltsam – es schien, als könnte Sven jetzt kaum schnell genug vor ihm fliehen. Er blickte Ben nicht einmal mehr an, rief einen Abschiedsgruß nach draußen auf die Terrasse, den Bens Oma garantiert nicht hörte, und verschwand dann wie ein Geist durch die Haustür. Irgendwas war merkwürdig an ihm, oder? Aber er hatte der Einladung zur Pizza zugestimmt, was er nicht getan hätte, wäre ihm die Idee zuwider, Zeit mit Ben zu verbringen. Die Hilfe hatte er ebenfalls freiwillig angeboten.
Ben schüttelte die Gedanken ab und ging hinaus, wo er noch ein bisschen mit seiner Oma redete und ihr half, Charly müde zu spielen. Oder es zumindest zu versuchen. Ein zweijähriger Jack Russel besaß viel zu viel Energie. Zumindest war er danach ausgeglichener, als Ben ihn schließlich auf den Arm nahm, um ihn die Treppe hinaufzutragen.
„Schlaf gut, Oma“, sagte er.
„Oha. Ja, ein altes Weib wie ich gehört schon lange ins Bett!“, rief sie erschrocken und starrte auf die Uhr. Dabei war es noch nicht einmal zehn Uhr abends. Sie schlief sonst meistens schon bei den Acht-Uhr-Nachrichten auf der Couch ein, döste danach im Bett, begann um Mitternacht wieder durch den Fernseher zu zappen oder geisterte durch die Wohnung, um zu putzen oder Kuchen zu backen, den niemand aß. Zumindest erzählte sie so von ihren Nächten.
Als Ben die Verbindungstür abgeschlossen hatte und in seine neue Wohnung trat, die noch fremd roch und fremd war und in erster Linie aus feindlichem Chaos bestand, verharrte er mitten im Schritt. Das Licht war ausgeschaltet. Sehen konnte er dennoch eine Menge, was zum einen an der Straßenlaterne lag, die zum Wohnzimmerfenster hineinleuchtete …
… und zum anderen an Sven. Dessen Zimmer lag offenkundig genau auf einer Höhe mit Bens Wohnzimmer, und es war hell erleuchtet. Von der Straße aus konnte man vermutlich nichts sehen und die anderen Häuser auf dieser Seite lagen versetzt. Sven war anscheinend gewohnt, dass niemand bei ihm abends hineinschauen konnte. Jedenfalls hatte er die Jalousien nicht herabgelassen, obwohl er gerade splitterfasernackt vor seinem Kleiderschrank stand. Sein Haar wirkte feucht, er war wohl eben erst duschen gewesen. Nun drehte er sich um, mit Klamotten in den Händen.
Ben wusste, dass er fortschauen sollte. Es war mehr als ungehörig, Leute anzustarren, die sich nicht bewusst waren, dass sie in einem intimen Moment beobachtet werden konnten. Nein, das war mehr als ungehörig, es war pervers. Niederträchtig. Unverzeihlich! Er sollte zu Boden blicken. Den Raum verlassen. Egal was, alles wäre besser, als Sven zu beobachten, der in seiner ganzen Pracht dastand, sich jetzt auch noch reckte und streckte, bevor er sich ein schwarzes T-Shirt überstreifte. Es war nur so … Ja. Solch ein schöner Anblick. Sven war kein gestylter Hollywoodstar und auch kein Ausdauersportler oder Gewichtheber. Kein Sixpack weit und breit. Stattdessen glatte, helle Haut und schlanke Muskeln. Etwas dünn vielleicht. Viel breiter war Ben jetzt allerdings auch nicht gewachsen …
Scheiße. Dachte er wirklich gerade darüber nach, ob ihm der Typ von gegenüber optisch gefiel? Er stand doch gar nicht auf Kerle!
Mit energischen Schritten kehrte er zur Tür zurück, schaltete das Licht an und stürmte dann mit gesenktem Kopf in Richtung Fenster, um die Jalousien herabzulassen. Erst jetzt blickte er hoch. Sven stand am Fenster, vollständig bekleidet, und winkte ihm zu, ohne zu lächeln. Ben hob die Hand und winkte gespielt lässig zurück. Momente später sah er nur noch sein eigenes Spiegelbild.
Verdammt.
Das war seltsam gewesen. Bizarr. Es musste an der Erschöpfung liegen. Ja, ganz bestimmt war das der einzige Grund, warum er auf diese Weise reagiert hatte. Er ging in die Küche, füllte Charlys Wassernapf und holte das Hundekörbchen sowie eine Reihe von Stofftieren und Spielsachen. Das alles deponierte er im Schlafzimmer neben seiner Matratze, die einsam auf dem Boden lag. Charly folgte ihm unentwegt auf dem Fuß, spürbar nervös von der neuen Umgebung und den vielen fremdartigen Gerüchen, aber bereit, ihm unbegrenzt zu vertrauen. Solange er da war, ging es Charly auch gut.
Ben ging Zähne putzen, wusch sich am Waschbecken mit eisigkaltem Wasser, zog sich um. Stellte den Handywecker. Legte sich zum Schlafen nieder. Kraulte Charly noch für eine Weile, bis dieser sich weit genug beruhigt hatte, um sich in sein Körbchen zurückzuziehen, in dem er bereits als Welpe geschlafen hatte.
Die schmerzenden Muskeln und Knochen, die gegen die Überbeanspruchung vom heutigen Tage protestierten, kamen langsam zur Ruhe. Er selbst hingegen konnte keine finden. Zu viel Neues wartete auf ihn. Zu viel Ungewissheit. Zu viele Entscheidungen, deren Folgen er nicht abschätzen konnte. Und ein Typ, der sich beharrlich in seine Gedanken drängte, obwohl Ben keinen Raum für ihn hatte. Vielleicht weil er sich nicht erinnern konnte, wann ihm jemals jemand einfach so geholfen hatte, ohne etwas dafür zu verlangen. Das war nicht einmal innerhalb seiner Familie üblich, und dabei hatte er ziemliches Glück mit dieser Bande, wie er fand.
Hatte er Sven damals verletzt? Wenn ja, konnte es nicht ernst gewesen sein. Andernfalls hätte er noch viel weniger Grund gehabt, ihm spontan zu helfen, und das gleich zweimal an einem Tag.
Energisch drehte Ben sich auf die andere Seite. Er war müde. Ein weiterer anstrengender Tag wartete auf ihn. Jetzt war also keine Zeit, um über den Kerl von nebenan nachzudenken. Jetzt war Zeit, endlich zu schlafen.
Sven holte die Schüssel mit dem aufgetauten Tiefkühlbeerenobst aus der Mikrowelle und füllte die rote Masse auf seinen aufgepufften Amaranth und die Leinsamen. Noch ein dicker Schwupps Mandeldrink und eine großzügige Handvoll Nüsse dazu, fertig war das gluten-, industriezucker- und laktosefreie, supergesunde Frühstück. Er gehörte definitiv nicht zu jenem geringen Teil der Bevölkerung, der tatsächlich genetisch nicht in der Lage war, Brot zu essen oder Milch zu trinken. Tatsächlich liebte er Pizza, Käse, Eis, Schokolade und Kakao und sah auch keinen Grund, warum er auf irgendetwas davon verzichten sollte. Diese Art von Frühstück hatte er sich vor vier Jahren angewöhnt, als seine Eltern in der Fastenzeit die Hardcorediät versucht hatten. Kein industrieller Zucker, kein Gluten, keine Laktose, kein Alkohol. Sein Vater war nach neun Tagen eingebrochen, seine Mutter nach siebzehn. Weder Sven noch seine Schwester Esther hatten an diesem Projekt freiwillig teilgenommen, waren allerdings dadurch eingeschränkt worden, dass es weder Brot noch Milch, Aufschnitt oder Käse im Haus gegeben hatte. In dieser Zeit hatte Sven festgestellt, dass er es mochte, diese Art Pampe zu essen, und war darum dauerhaft dabei geblieben; auch dann noch, als seine Eltern längst zu Toast mit Salami und Nutella zurückgekehrt waren und niemals wieder versucht hatten, derartige Radikalkuren anzugehen. Zudem ging es recht schnell, alle Zutaten zusammenzukippen und niemand wurde von der Mikrowelle gestört, weil die Wände gut isoliert waren.
Zusammen mit seiner ersten Tasse Tee setzte er sich an den Küchentisch, um sein Frühstück zu löffeln und dabei am Handy zu surfen. Diese zwanzig Minuten am Morgen waren extrem wichtig für ihn. So wichtig, dass er dafür sogar früher aufstand, als er eigentlich müsste, denn er könnte sich durchaus mehr beeilen. Gerade der Tee kostete ihn einiges an Zeit. Aber es war wunderbar ruhig, niemand störte ihn, niemand zwang ihn, irgendetwas zu tun …
„Moin.“
Sven zuckte heftig zusammen, als seine Mutter plötzlich auf ihn zukam. Sie gähnte verschlafen.
„Was machst du denn schon hier?“, fragte er verblüfft.
Ein strafender Blick traf ihn.
„Der Herr Sohn hat vergessen, Kaffee zu kaufen“, knurrte sie vorwurfsvoll. „Herr Sohn hat für reichlich Tee gesorgt, was fein ist, aber leider nur für ihn. Außer ihm trinkt in diesem Haus nämlich niemand Tee.“
„Oh!“ Schuldbewusst stellte er seine gerade geleerte Tasse ab. „Verdammt, ich war gestern so müde, es ist mir durchgegangen. Tut mir leid, Mama! Ich bringe gleich zwei Packungen mit, wenn ich von der Uni komme, und …“
„Bist du irre?“ Sie unterbrach ihn mit ungeduldiger Geste. „Dein Vater, Esther und ich laufen auf Koffein. Ich hatte es zum Glück schon gestern Abend bemerkt, dass der Kaffee fehlt und mir extra den Wecker gestellt. Ich gehe zur Tankstelle und kaufe uns dort ein Päckchen. Kostet ja auch nur ungefähr das Dreifache.“
Ihr ätzender Tonfall machte klar, wie gründlich er es verbockt hatte.
„Mama, es tut mir leid. Ehrlich“, murmelte er.
„Deine Unzuverlässigkeit macht mich müde“, entgegnete sie und musterte ihn enttäuscht. „Immer denkst du bloß an dich selbst, wenn es um alle anderen geht, ist es Glückssache, ob du deinen Teil erfüllst. Ist ja nun wirklich nicht das erste Mal. Ich habe keine sechs Stunden geschlafen, um sicherzustellen, dass dein Vater nicht ohne Kaffee zur Schicht muss. Heute wechselt er nämlich und fährt die Tour von acht bis sechzehn Uhr. Sprich, er hat Schulkinder. Wie soll er das ohne reichlich Koffein überleben? Klar, ich hätte das auch gepackt, wenn ich eine halbe Stunde später aufgestanden wäre, aber ich wollte mit dir reden. Das geht hier so nicht, Sven. Dein Vater und ich müssen verdammt hart arbeiten. Esther schafft es immer, ihren Teil zu erfüllen. Warum gelingt es dir nicht?“
Weil ich Vollidiot für meine Schwester mitarbeite, wenn die es verbockt, und zu blöd bin, sie einfach mal auf die Schnauze fallen zu lassen, dachte Sven. Es lohnte sich dabei nicht einmal, auf Esther wütend zu sein. Die konnte nichts dafür, dass sie Mamas heiliger Engel war, und das seit dem Tag ihrer Geburt. Aus jahrelanger Erfahrung heraus wusste Sven, dass Diskussionen und Rechtfertigungen nicht halfen. Seine Mutter liebte ihn. Leider war sie nicht stolz auf ihn, egal wie sehr er sich das wünschte.
„Es tut mir wirklich leid, Mama“, sagte er und blickte ihr geradewegs in die Augen. Der Tag war gelaufen, noch bevor er richtig angefangen hatte. In seinem Bauch klumpte die verzweifelte Wut darüber, dass seine Eltern nicht anerkennen konnten, wie sehr er sich bemühte. Mit hängendem Kopf räumte er sein Geschirr in die Spülmaschine. Es war nicht fair. An Tagen wie diesen fiel es ihm schwer, sich klarzumachen, wie vielen Leuten es noch viel, viel schlechter als ihm erging. Niemand schlug ihn, sperrte ihn ein, misshandelte ihn oder schrie ihn in Grund und Boden. Es war nichts weiter als diese kleine Unfairness. Dieses unschöne Bild, das seine Eltern von ihm aufgebaut hatten, warum auch immer. Ein Bild, nach dem er unzuverlässig war. Ihre Erwartungen enttäuschte, gleichgültig, was er tat, um Anerkennung zu finden. Er wünschte, Mama würde ihn umarmen. Einfach nur zeigen, dass sie ihn trotzdem lieb hatte. Manchmal tat sie das. Heute morgen war sie wohl zu erschöpft. Jedenfalls war sie grau im Gesicht und sah regelrecht krank aus, weil sie viel zu viel arbeitete und zu wenig schlief und sich über ihren enttäuschenden Sohn ärgern musste.
Zögernd trat Sven auf sie zu, um sie nun seinerseits zu umarmen, denn offenkundig hatte sie es nötiger als er.
„Du kommst zu spät“, sagte sie abwehrend, noch bevor er sie erreicht hatte. „Beeil dich, sonst verpasst du deine Bahn.“
Er biss die Kiefer aufeinander, um nichts zu entgegnen. Stumm zog er Helm und Handschuhe an, griff sich seinen Rucksack mit den Unisachen und seine Schlüssel, und eilte aus dem Haus. Warum war er so dumm gewesen? Warum hatte er nicht alles eingekauft, was benötigt wurde? Warum hatte er es wieder geschafft, seine Mutter zu enttäuschen? Dafür zu sorgen, dass sie hinter ihm herräumen musste, weil er es mal wieder nicht gepackt hatte, alles richtig zu machen?
„Uah, Vorsicht!“ Ben schaffte es gerade noch, Charly zur Seite zu zerren, als eine dunkle Gestalt auf einem Fahrrad sie beinahe über den Haufen gefahren hätte. Die Gestalt fluchte heftig, schlingerte und verhinderte nur mit viel Mühe einen Sturz. Als sie sich aufrichtete, erkannte Ben, wer da um ein Haar in sie hineingekracht wäre.
„Sven? Was jagst du denn wie ein Irrer um diese Uhrzeit durch die Gegend?“, fragte er, noch immer ein bisschen erschrocken.
„Sorry. Es tut mir leid. Ich bin heute zu gar nichts zu gebrauchen.“ Sven schaute ihn entschuldigend an. Er sah nicht gut aus, das konnte man selbst in dem fahlen Licht der Straßenlaterne erkennen. „Habe ich Charly erwischt?“, fügte er hinzu und beugte sich zu dem Kleinen hinab, der freudig kläffte und mit dem Schwanz wedelte.
„Alles okay. Er freut sich, dich zu sehen“, brummte Ben.
„Schön. Ähm, ich muss weiter. Muss zum Bahnhof. Wenn ich die Bahn verpasse, komme ich nicht pünktlich zur Uni.“ Er winkte und war auch schon wieder fort, bevor Ben ihn verabschieden konnte. Es war ein ziemliches Stück bis zum nächsten Bahnhof, seit man die Station in ihrem Ort stillgelegt hatte. Fast zwanzig Kilometer mit dem Fahrrad über eine mangelhaft beleuchtete und sehr schmale Landstraße, die manche Leute mit einer Rennstrecke verwechselten. Nicht ungefährlich … Gerade in der dunklen Jahreszeit. Danach noch eineinhalb Stunden mit der Bahn, um nach Hamburg reinzufahren, falls Sven dort studierte. Oder knapp zwei Stunden bis nach Kiel. Hamburg war wohl wahrscheinlicher. Nachmittags beziehungsweise abends dann dieselbe Strecke zurück. Dazu noch nebenher arbeiten. Faul war Sven jedenfalls nicht.
Ben beendete den Spaziergang, den er Charly geschuldet hatte. Fast eine Stunde war er mit ihm gelaufen. Immer noch viel zu wenig für ein solch bewegungshungriges junges Tier, aber besser als nichts. Unterwegs hatte er einen Bäcker gefunden, bei dem er sich mit einem belegten Brötchen und einem Kakao to go versorgen konnte. Jetzt war er bereit für die große Aufgabe des Tages.
Wie aufs Stichwort kam Nico mit seinem Transporter um die Ecke. Sein Cousin war zwölf Jahre älter als er und besaß eine kleine Gartenbaufirma. Extra für ihn hatte er sich einen halben Tag freigeschaufelt. Die gesamte Familie war eben sehr interessiert, dass Oma nicht mehr länger ganz allein leben musste, dazu fünfzehn Kilometer entfernt vom nächsten Verwandten, der im Notfall helfen konnte.
„Hey!“, rief er fröhlich durch das halb herabgelassene Fenster. „Bereit? Alles fertig? Was macht Oma?“
„Die schläft noch“, brummte Ben und hob Charly in den Transporter. „Ich hole nur schnell die Hundebox, dann können wir los.“ Einen solch kleinen und leichten Hund konnte man nicht gut ohne Box im Auto mitnehmen. Viele Leute machten es dennoch. Da Ben als Techniker beim TÜV arbeitete, hatte er schon einiges mitbekommen, was mit solchen ungesicherten Tieren bei einer Vollbremsung geschehen konnte.