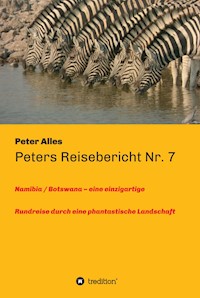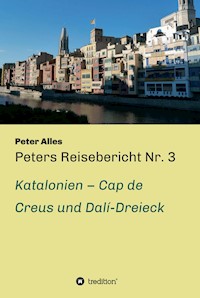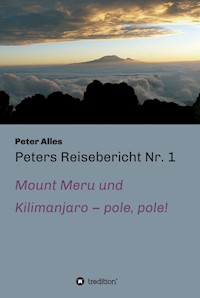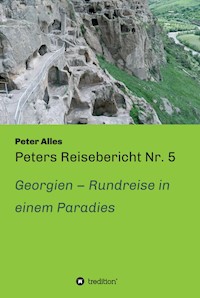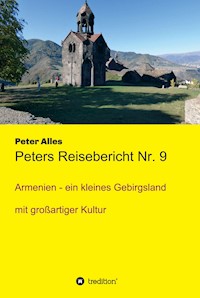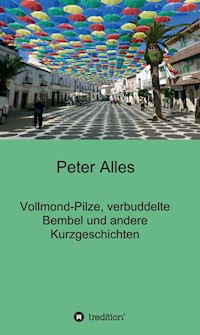
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
In seinem Buch erzählt der Autor in 34 Kurzgeschichten Erlebnisse aus 36 Jahren seines Lebens, die er oft auf Reisen erfahren hat. Die meisten sind entweder lustig, peinlich, grotesk oder komisch, auf jeden Fall aber einzigartig. Viele Geschichten hat er mit Gedanken über die gemachten Erfahrungen sowie weitergehenden Erkenntnissen angereichert, die zum Nachdenken anregen. Sein Ziel ist es, den Leser zum Schmunzeln zu bringen oder zu trösten, da er sicherlich teilweise ähnliche Erlebnisse und Gedanken gehabt haben dürfte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für all jene, die gerne reisen und was erleben wollen.
Peter Alles
Vollmond-Pilze, verbuddelte Bembel und andere Kurzgeschichten
© 2020 Peter Alles
Umschlag, Illustration: Peter Alles
Verlag: tredition GmbH,
Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
978-3-347-06432-4 (Paperback)
978-3-347-06433-1 (Hardcover)
978-3-347-06434-8 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhaltsverzeichnis
Verbotene Ossi-Wessi-Kontakte
„Hey, Sirs!“
Gipfelglück
Hinterwildalpen
Der Eindringling
Vino tinto
Weihnachten mal ganz anders
Riechtest oder organoleptische Diagnose
Verlust der Defäkationsreflexsteuerung
Flatulenz-Kadenz
Oral-Flatulenz
Hotel California
Der Konzertbesuch
Nach dem Gipfelsturm versumpft
Verbuddelte Bembel
Vollmond-Pilze
Im Schlaflabor
Der 60. Geburtstag
Es geht auch anders am 60. Geburtstag
WhatsDepp
Das verbotene Buch
Hauskauf in Spanien
Kratzer
Die Spanier haben einen Knall
Unpolitisch inkorrekt
Cake News
Ersatzbatterien
Die Ballonfahrt
Abzocke auf die feine englische Art
Im Coffee Shop
Wenn einer eine Reise tut,so kann er was erzählen
Warum bestellen Sie nicht gleich42 Packungen des Medikaments?
Wartezeit
Alles nur Verschwörung
Verbotene Ossi-Wessi-Kontakte
Ein Jahr nach erfolgreichem Ende meines Hauptstudiums stieß ich eines Tages auf ein Themengebiet, das mich sehr interessierte und wovon ich mir vorstellen konnte, darüber zu promovieren. Fast alle Fachliteratur, die ich damals dazu fand und zu studieren begann, ging auf Mathematiker zurück, die in Prag lehrten und forschten. Da mein Doktorvater an der TH Darmstadt von dem Thema keine Ahnung hatte, sich dafür auch überhaupt nicht interessierte, und ich inhaltlich alleine nicht weiterkam, dachte ich mir, dass es nützlich sein könnte, in einem kurzen Auslandsstudium an der Karls-Universität in Prag mit den Autoren direkten Kontakt aufzunehmen und in Zusammenarbeit mit ihnen mein tatsächliches Promotionsthema zu finden, um die relevanten Fragestellungen zu konkretisieren.
Beim DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) stellte ich daher im Herbst 1984 einen Förderantrag für ein Studium an der altehrwürdigen Karls-Universität (Mitteleuropas älteste Uni war 1348 von Kaiser Karl IV. gegründet worden). Ende 1983 hatte ich auf einer kleinen Konferenz im böhmischen Dorf Příhrazy, einem Weiler am Nordrand des Český ráj (deutsch: Böhmisches Paradies), teilgenommen und einen der besagten Forscher persönlich kennengelernt.
Am Abend der zweitägigen Konferenz hatte ich mit ihm zehn DM in Kronen getauscht, was ja strengstens verboten gewesen war und ihn in größte Aufregung versetzt hatte, was aber jeder gerne machte, der die Gelegenheit bekam. Eine Win-win-Situation: der eine kam an Devisen heran, der andere konnte mehrere Biere in der Tagungskneipe kaufen. Außerdem war das der Beginn einer langanhaltenden Freundschaft, die uns viele Jahre immer wieder zusammenbrachte, wobei wir gemeinsame Ausflüge in Böhmen unternahmen und mathematische Fragestellungen bearbeiteten.
Auf dem Rückweg nach Darmstadt unternahmen wir (ein Darmstädter Professor, ein Kommilitone und ich) eine kleine Rundfahrt durch Prag, wobei ich mich spontan in die Stadt verliebte. Dieser Kurzaufenthalt hatte meine Idee bestärkt, für ein paar Monate in die tschechoslowakische Hauptstadt zu gehen.
Obwohl ich keine Ahnung hatte, was ich dort genau tun und wie mein „Studium“ verlaufen würde, gelang es mir, meinen Förderantrag an den DAAD, mein zukünftiges Arbeitsgebiet und meinen Arbeitsplan so überzeugend darzustellen, dass ich schon bald die Finanzierungszusage erhielt. Auch die heute üblicherweise für ein Auslandsstudium geforderte Sprachkenntnis des Gastlandes konnte ich damals nicht vorweisen, obwohl ich mich vor und während des Aufenthaltes intensiv mit der gewöhnungsbedürften Aussprache des Tschechischen beschäftigte und ein paar Wörter der Sprache erlernte. Mein Trimester sollte am 1. April 1985, einem warmen Frühlingsmontag, beginnen.
Für meine studentischen Lebensverhältnisse ungewöhnlich früh startete ich an diesem Tag um 8 Uhr morgens mit meinem klapprigen VW Polo in Richtung Prag und erreichte kurz vor Mittag die Grenze bei Waidhaus/Rozvadov. Die Grenzbefestigung am Eisernen Vorhang war damals martialisch und gigantisch: Nachdem man aus Deutschland ausgereist war, fuhr man einen Kilometer durch eine Art Niemandsland, bevor man an die tschechoslowakische Grenze kam. Der Zwischenstreifen war radikal gerodet, damit man noch aus 250 m Entfernung sehen konnte, ob sich dort evtl. eine bewaffnete Maus herumtrieb. Beide Grenzdurchgänge waren mit dicken Schlagbäumen aus Stahl verschlossen, deren senkrechte Rotationsachsen nur eine Öffnung nach innen zuließen, so dass ein „Durchbrechen“ der Schranke nach außen faktisch unmöglich war. So viel zur Begründung, dass die Grenzbefestigung als antifaschistischer Schutzwall diente.
Die Einfahrt in den Grenzbereich, d.h. die Ausreise aus Deutschland, ging nach der üblichen Pass- und Führerscheinkontrolle zügig vonstatten. Auf der tschechoslowakischen Seite stand man jedoch erst einmal eine Stunde vor dem Schlagbaum, bevor sich überhaupt etwas tat. In dieser Zeit wurden die wenigen wartenden Fahrzeuge von Grenzsoldaten mit Maschinengewehr im Anschlag bewacht. Das mulmige Gefühl, das sich während dieser öden, ereignislosen Wartezeit einstellte, werde ich nie mehr vergessen. Ich hoffte, dass, falls sie mich erschießen sollten, richtig zielen und gleich final treffen würden, denn leiden wollte ich nicht. Ich musste aber leiden, denn es tat sich gar nichts, die arbeitsfaulen Grenzer hatten null Bock. Auch hatte ich Angst, dass sie mir wegen der mitgeführten verbotenen Westzeitschriften, die ich offen auf dem Rücksitz liegen hatte, die Karre auseinandernehmen würden, aber außer einer Pass-, Visums- und Führerscheinkontrolle ist schließlich nichts weiter passiert.
Ich fuhr weiter über Plzeň (Pilsen) nach Prag. Damals und auch noch viele Jahre später roch man es sofort, wenn man die tschechische Grenze überquert hatte, es stank nämlich immer und überall nach Braunkohle, und man sah es an den rußgeschwärzten Fassaden der Häuser in den Dörfern und Städten. Auch in Prag herrschten die Farben dunkelgrau und schwarz an den Häuserfassaden vor.
Gegen 15 Uhr fand ich das Amt in Prags Innenstadt, auf dem ich mich melden sollte. Ich wollte eigentlich früher da sein, aber die antriebslosen Grenzsoldaten hatte meinen Zeitplan torpediert. Heute unvorstellbar, damals fand ich die Adresse ohne Navi (natürlich, das gab es ja noch nicht) und Stadtplan (den gab es schon, er wurde aber aus militärischen Gründen unter Verschluss gehalten) und nur mit minimalen Sprachkenntnissen. Heutzutage würde ich mir das kaum noch zutrauen. Glücklicherweise sprach man dort Deutsch und erklärte mir, dass sie schon Feierabend hätten, ich solle aber ruhig ins Wohnheim fahren, wo ich während meines Aufenthaltes leben würde. Das Kolej Hvězda lag im Stadtteil Petřiny fünf Kilometer westlich der Innenstadt, die Anlage fand ich am späten Nachmittag nach etwas Herumirren durch die Plattenbausiedlungen der Stadtrandbezirke.
Im Verwaltungsbüro war man noch am gleichen Tag in der Lage, mir ein Zimmer zuzuweisen. Eigentlich war es nur ein halbes Zimmer in einem 2-Zimmer-Appartement mit kleiner Küche, Duschbad und Telefonanschluss. Diese für studentische Verhältnisse luxuriösen Unterkünfte waren den ausländischen Studenten vorbehalten. Die einheimischen Studenten waren ebenfalls in Zweibettzimmern untergebracht, die aber auf einem langen Flur angeordnet waren, und mussten sich in größerer Anzahl Etagen-Küche und –Bad teilen.
Ich war angenehm überrascht, dass ich in „meinem“ Appartement mit drei weiteren Deutschen untergebracht wurde. Allerdings waren sie mir gegenüber sehr reserviert und sagten kaum einen Ton. Das konnte ja heiter werden, wenn ich drei Monate mit den einsilbigen Berlinern – einen entsprechenden Dialekt konnte ich aus den wenigen, mir entgegengebrachten Worten heraushören – verbringen sollte. Und dann auch noch in einer Mundart, die nicht zu meinen Lieblings-Sprachfehlern gehörte.
Dass es sprachlich noch schlimmer kommen würde, musste ich die nächsten Wochen erfahren, wenn ich in Prag unterwegs war. Als Nebenfach hatte ich nämlich Stadtbesichtigung gewählt, was mich fast jeden Tag mehrere Stunden lang beschäftigte, wenn ich mit meiner Kamera unterwegs war. Eigentlich war das Mathematikstudium nebensächlich, was ich natürlich nicht zugeben konnte. Wenn ich dann so in Prags Straßen auf der Suche nach Fotomotiven, von denen ich sehr viele fand, unterwegs war, ließ es sich nicht vermeiden, immer mal wieder Menschen nicht-tschechoslowakischer Provenienz zu begegnen, und das waren leider zu 90% Sachsen.
Das „Säggs'sch“ wird zwar von den Stammlern dieses Dialekts, die sich als „gmieedliches Välgchn“ sehen, gerne als Weltsprache angesehen, aber für Hochdeutschspreche wie mich als Hesse ist es eine auditive Grausamkeit. Damals war die Tschechoslowakei das einzige Land, zumal Nachbarland, das DDR-Bürger ohne große Formalitäten bereisen konnten, entsprechend hoch war der Anteil dieser Touristen im Vergleich zu Westdeutschen und anderen Ausländern. Auf Schritt und Tritt begegnete man den weichen Konsonanten, die alles besiegen: „De Weeschn besieschn de Hardn“. „Ai faabibsch, do genndsde bleede wärrn“. Das Motto der Sachsen wie aller DDR-Bürger war, „von der Sowjetunion lernen heißt siechen lernen“, was keiner zugeben durfte, aber der Wahrheit entsprach.
Meinen Berlinern war es offensichtlich auch unangenehm, so wortkarg mir gegenüber zu sein. Nach zwei Tagen schlugen sie vor, dass wir mal gemeinsam einen trinken gehen könnten. Das war eine Idee, die mich spontan begeisterte und für die ich mein Haupt- und Nebenfachstudium gerne unterbrach. Sie schlugen das U Holečků vor, das einen Kilometer westlich unseres Wohnheims am geschichtsträchtigen Bilá hora („Weißer Berg“) lag. Dort hatte am 8. November 1620 eine erste große Schlacht des Dreißigjährigen Krieges stattgefunden, bei der die böhmischen Truppen Friedrichs V. den kaiserlichen und bayerischen Truppen der Katholischen Liga unterlagen.
Der Vorschlag, sich am Weißen Berg in Ruhe zu unterhalten, hatte trotzdem keine tiefere Symbolik, sondern war einfach nur der Tatsache geschuldet, dass die Kneipe weit genug vom Wohnheim entfernt war. Warum das wichtig war, erschloss sich mir etwas später im Laufe des Abends. Es bestätigte sich nämlich mein Verdacht, dass zwei meiner Mitbewohner aus dem östlichen Teil Berlins kamen. Der dritte Mitbewohner kam aus Jena. Ich hatte damit kein Problem, sehr wohl aber der ostdeutsche Staat, der es seinen Bürgern strikt untersagt hatte, in Kontakt mit dem westdeutschen Klassenfeind zu treten.
Die drei, denen ich nicht unsympathisch war und die nicht gegen die Entscheidung des Wohnheims, uns zusammen einzuquartieren, vorgehen wollten, durften keinesfalls riskieren, von anderen Ostdeutschen denunziert und überführt zu werden. Diese Vorsichtsmaßnahme führte im Laufe der folgenden Wochen dazu, dass ich mindestens in Schweigen verfiel, wenn sie Besuch von anderen Ossis erhielten, oder besser fluchtartig, aber unauffällig – notfalls auch durchs Fenster des Parterre-Appartements – die Bude verließ. Die DDRler mussten komplett unter sich bleiben und durften keinen Kontakt mit westlichen Studenten haben, was jedoch in dem internationalen Wohnheim kaum machbar war. Die Tschechen sahen das anscheinend viel lockerer als unsere östlichen Brüder und Schwestern.
Nachdem sie mir dies erklärt hatten, wurde es noch ein richtig lockerer Abend mit guter tschechischer Hopfenkaltschale und „Stullen mit watt druff“. Wie man sich gut vorstellen kann, war die gegenseitige Wissbegier groß, wobei ich großer Unkenntnis der DDR überführt wurde, während die drei über die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse der BRD erschreckend gut informiert waren. Trotz Westfernsehen-Verbots kannten sie sich hervorragend aus, während mir mein Unwissen über den Arbeiter- und Bauernstaat immer peinlicher wurde.
Nichtsdestotrotz und trotz der Gefahr, entdeckt zu werden, unternahmen wir in den folgenden Wochen viele gemeinsame Ausflüge, z.B. zur großartigen Burg Karlštejn und ins Sandsteingebirge Český ráj.
So besuchten wir zusammen auch einige Spiele der in dieser Zeit in Prag laufenden Eishockey-WM. Welche Spiele das waren, weiß ich im Nachhinein nicht mehr, jedenfalls das Spiel BRD gegen DDR, das 6: 0 ausging, war nicht darunter gewesen. Aber das denkwürdige Fußballspiel BRD gegen Tschechoslowakei, das 5: 1 endete, besuchten wir zusammen. Für mich verwirrend war, dass sehr viele DDR-Bürger das Spiel sahen, wobei alle für die Mannschaft des Klassenfeindes fieberten und bei jedem deutschen Tor in großen Jubel ausbrachen.
Zuvor hatte ich, der keine Eintrittskarte besaß, noch ein einmaliges Erlebnis: vor dem Stadion fand ich jemanden, der mir seine Eintrittskarte für 20 DM verkaufen wollte, wozu ich aber als Student zu geizig war. Stattdessen kaufte ein mir wildfremder Ostdeutscher die Karte und schenkte sie mir. Das war vielleicht peinlich …
Aus der Zeit meines Aufenthaltes in Prag kann ich noch von zwei anderen Erlebnissen berichten. Einmal, als ich mich wieder intensiv meinem Nebenfachstudium widmete, fuhr ich mit einer Straßenbahn in einen etwas abgelegenen Stadtteil, weil ich dort irgendwas besichtigen wollte. Die tschechische Durchsage an einer Haltestelle verstand ich nicht, mir fiel nur auf, dass alle anderen Fahrgäste den Zug verließen. Ich blieb sitzen, die Türen schlossen sich, die Tram fuhr in ein Depot, wurde abgestellt und der Fahrer machte ein Nickerchen. Ich war im hinteren Wagen, konnte mich ihm nicht bemerkbar machen, und trotz lautem Rufen und Klopfen musste ich zwei Stunden im Wagen ausharren, bevor er aufwachte und die Fahrt fortsetzte.
Ein anderes Mal wurde mir klar, dass Dresden von Prag nicht weit entfernt ist, zumindest viel näher als es von Frankfurt ist. Also wollte ich mein Nebenstudium auch in diese Richtung etwas ausdehnen, musste dazu aber das Visumsproblem lösen: Ich war nur zur einmaligen Einreise in die Tschechoslowakei berechtigt, nicht jedoch zu einem zwischenzeitlichen Verlassen in Richtung DDR mit der Möglichkeit zur Rückkehr nach Prag. Daher suchte ich zunächst die bundesdeutsche Botschaft in Prag auf, um mir ein Erweiterungsvisum ausstellen zu lassen. Dort verwies man mich an die Botschaft der DDR, da ich ja dorthin einreisen wollte. Diese erklärte sich für mich als Bundesbürger in der Tschechoslowakei nicht zuständig, sondern ich sollte mich stattdessen an die Ständige Vertretung der DDR in Westberlin wenden.
Dies war mir von Prag aus zu kompliziert. Deswegen hatte ich die Idee, mich an die Polizeistation in Prag zu wenden, auf der ich mich nach meiner Einreise gemeldet hatte, weil man das damals so tun musste. Dort stieß ich auf einen Beamten, der meinen Wunsch sofort verstand und meinte, das sei alles kein Problem, ich solle doch am Folgetag wiederkommen. Dies tat ich und bekam tatsächlich problemlos ein Visum zur einmaligen Ausreise in die DDR mit Wiederkehrrecht nach Prag. So einfach war das mit den Tschechen! An diesem und vielen anderen Beispielen bekam ich den Eindruck, dass sie die Unverkrampftesten hinterm Eisernen Vorhang waren, auch wenn ich keinen Vergleich mit anderen Ostblockländern hatte.
Leider konnte ich den Ausflug dorthin doch nicht unternehmen, da kurze Zeit später mein Vater anrief und mir mitteilte, dass er schwer erkrankt sei, sich einer Operation unterziehen müsse und ich daher vorzeitig zurückkehren müsse, zumal meine Mutter aufgrund eines Schlaganfalles seit vielen Jahren schwer behindert war und vom Vater gepflegt wurde. Sonst hätte ich sicherlich beim Grenzübertritt in die DDR eine strengere Kontrolle als bei der Einreise in die ČSSR erleben dürfen: „Gänsefleisch mal `n Kofferraum uffmachen?" Dresden konnte ich dann später, nach dem Fall der Mauer, besichtigen.
Mit den beiden Ostberlinern (Wolfgang und Günter) sowie der Frau des inzwischen verstorbenen Prager Wissenschaftlers stehe ich heute noch in Kontakt. Insbesondere Wolfgang habe ich öfters getroffen, nach Prag auch in Ostberlin noch vor dem Mauerfall. Und ich wollte ihn in dieser Zeit auch einmal in Bonn treffen, als ihm, der an der Ostberliner Humboldt-Universität lehrte und forschte, die Teilnahme an einem Seminar an der Bonner Uni genehmigt worden war. Da ich von seinem geplanten Aufenthalt wusste und selbst oft in Bonn aus beruflichen Gründen weilte, hatte ich Wolfgang zuvor einen Brief geschrieben und ihm das Treffen vorgeschlagen.
Leider wartete ich am, wie ich meinte, vereinbarten Tag und Ort vergebens auf ihn. Hinterher, als wir uns mal wiedersahen, war Wolfgang sehr überrascht über mein vergebliches Warten, denn er hatte keinen Brief erhalten und wusste daher nichts vom geplanten Treffen.
Einige Jahre später stellte Wolfgang beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik einen Antrag auf Akteneinsicht und erfuhr dadurch von meinem Brief. Dieser fand sich nämlich in seiner Stasi-Akte fein säuberlich einsortiert. Die DDR hatte ihn offensichtlich abgefangen und aufgehoben. Auch ich stellte dann einen Antrag bei der Gauck-Behörde, allerdings war über mich keine Akte vorhanden. Ich war für die Stasi wohl nicht interessant genug gewesen.
„Hey, Sirs!“
Zwei Jahre nach dem Ende meines Studiums dachte ich mir während meiner Berufstätigkeit, dass es an der Zeit sei, mal wieder was Besonderes zu machen. Dazu hatte ich mir eine Konferenz ausgesucht, die ich gerne auf Firmenkosten besuchen wollte. Zwei Monate vor dem Termin hatte ich dafür einen Antrag gestellt. An sich war eine Konferenzteilnahme kein Problem, nur fand diese in Santa Barbara in Kalifornien statt. Das war für meine Firma etwas sehr Außergewöhnliches und ich war vermutlich der erste, möglicherweise auch der letzte, der dorthin wollte. Sonst fanden Tagungen, Fortbildungsveranstaltungen und Seminare eigentlich nur in Deutschland statt, die Teilnahme in einem anderen europäischen Land war da schon eine Ausnahme. Denn dort wollten und durften, wenn überhaupt, nur die Vorgesetzten hin, die fachlich meist wenig Ahnung hatten, aber damit renommieren wollten, was jedoch häufig durchschaut und deswegen verhindert wurde. Aber außerhalb Europas? Das ging ja gar nicht.
Entsprechend schmackhaft wurde mir das von meinem Chef gemacht: „Lassen Sie diesen Quatsch, das gibt nur Ärger und wird sowieso nicht genehmigt.“ Mein Chefchef war etwas zurückhaltender: „Inhaltlich befürworte ich Ihre Teilnahme, aber das wird Ihnen die Geschäftsführung nicht genehmigen können.“ Dessen Chef wiederum sah das ähnlich, aber er wollte auch nicht derjenige sein, der mir die Absage erteilt. Als wenn sie Angst vor mir gehabt hätten.
Und dann war hierarchisch schon die Geschäftsführung erreicht, die die finale Entscheidung zu treffen hatte und die einzige Instanz im Unternehmen war, die eine Interkontinentalreise genehmigen durfte – ablehnen durften auch die Ebenen darunter. Zu einem der beiden Direktoren hatte ich einen guten Draht, es kam schon mal vor, dass er mich direkt unter Missachtung der üblichen hierarchischen Wege zum Gespräch bat: „Herr Alles, kommen Sie doch mal zu mir hoch, ich muss was mit Ihnen besprechen. Kommen Sie alleine, Herrn K. brauchen wir dazu nicht.“ Er meinte meinen direkten Chef, den wir bei dem geplanten Fachgespräch entbehren konnten, da er inhaltlich nichts würde beitragen können.
Auch ein Jahr nach dem Ereignis, von dem hier berichtet werden soll, rief er mich zu sich, nachdem ich gekündigt hatte, und bot mir seine zukünftige Unterstützung an: „Wenn Sie mal eine Referenz brauchen, schreibe ich Ihnen gerne was.“ Mein Chef bot mir keine Unterstützung an, er war ja auch nur ein kleines Licht.
Mein Reiseantrag zur Konferenzteilnahme mit mehrtägigem Aufenthalt in Santa Barbara, zwei Verlängerungstagen zur Erholung von den strapaziösen Vorträgen, mit Business-Class-Flug nach Los Angeles und Mietwagen vor Ort lag einige Wochen bei der Geschäftsführung herum. Auch ich wollte vor allem dorthin, um damit glänzen zu können („Stellt Euch vor, die haben mich sogar nach Kalifornien geschickt!“).
Fachlich war die Veranstaltung am Pazifik äußerst anspruchsvoll, ich würde nur einen geringen Teil der neuesten kryptologischen Forschungsergebnisse verstehen können, die präsentiert und diskutiert werden sollten. Und für meine praktische Arbeit war es zwar nicht uninteressant, aber eigentlich nicht wirklich verwendbar.
Das hatte vermutlich die Geschäftsführung durchschaut, denn eine Woche vor dem Abflugtermin hatte es immer noch keine Entscheidung gegeben, als ich nachfragte. Immerhin, das konnte man auch positiv sehen, ablehnen hätte man ja gleich können. Erst vier Tage vor dem geplanten Abflug teilte mir die Sekretärin meines Chefchefs mit, dass die Reise genehmigt sei, die Firma alle Kosten übernehmen wolle und man mir einen guten Flug und eine aufschlussreiche Konferenz wünsche.
Das kam im letzten Moment, schließlich brauchte ich noch ein Visum für die USA. Glücklicherweise gab es in Frankfurt ein Generalkonsulat und in dieser Zeit, Ende der 1980er Jahre, waren die Sicherheitsbestimmungen noch nicht so ausgeufert, dass man nicht kurzfristig hingehen und ein Visum bekommen konnte. Den Rest der Reisebuchung übernahm meine Firma.
Damals arbeiteten wir an einem ganz neuen elektronischen Zahlungssystem auf Basis kryptographischer Verfahren, das es in dieser Form vorher noch nicht gegeben hatte. Wir entwickelten dazu die Konzepte, erstellten detaillierte funktionale und Test-Spezifikationen und machten Pläne zur Erprobung und zur Wirkbetriebseinführung. Die eigentliche technische Entwicklung erfolgte bei einer Firma, die bereits ähnliche Komponenten auf den Markt gebracht hatte. Um sicher zu sein, dass das System auch funktionieren und robust genug gegenüber Manipulationsversuchen sein würde, arbeiteten wir außerdem mit einer externen Gutachterfirma zusammen, die ihrerseits zwei universitäre Forschungslabore zu Rate zog.
Den Chef dieser Gutachterfirma traf ich bei meinem Abflug auf dem Frankfurter Flughafen, er wollte ebenfalls an der Konferenz teilnehmen, was ich zuvor nicht gewusst hatte. Drei Jahre später würde er mein neuer Chef werden, was ich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls nicht ahnte. Und in Santa Barbara traf ich überraschend noch zwei Mitarbeiter der Forschungslabore, mit denen wir im Projekt zusammengearbeitet hatten. Das Universum war doch klein, zumindest im Kreis entsprechender Spezialisten!
Dies war mein erster Ausflug in die neue Welt. Den Direktflug im August 1988 genoss ich trotz seiner Länge auf einem Fensterplatz, wovon ich einen herrlichen Blick auf die Weite des Nordatlantiks, die Gletscher Grönlands, die gewaltigen Eisberge vor Kanadas Küste, die riesige Hudson Bay, die Einsamkeit der Great Plains und schließlich, schon im beginnenden Sinkflug, auf den Grand Canyon hatte.
Nach der Landung in L.A. holte ich den reservierten Mietwagen ab und verließ mit dem Gutachterchef als Beifahrer den Ballungsraum in westlicher Richtung über zehn- oder mehrspurige Highways, die ich so vorher nur aus Filmen kannte. Wir waren vom Ausmaß des Straßenverkehrs tief beeindruckt, schafften es dennoch unfallfrei nach Santa Barbara, in die Hauptstadt der „American Riviera“. Diese Leistung war insofern auch bemerkenswert, dass ich zum ersten Mal ein Automatik-Wagen steuerte.
Die mehrtägige Konferenz im Campus der UCSB (University of California, Santa Barbara) war wie erwartet sehr anspruchsvoll, die Themen häufig nur mit extremem mathematischen Vor- und Tiefenwissen nachvollziehbar und die Buntheit und Vielfalt der Teilnehmer aus aller Welt beeindruckend. Die UCSB befindet sich in Goleta, einer Kleinstadt zehn Kilometer westlich von Santa Barbara, nahe dem Pazifikstrand. Dort fand auch das berühmte und jährlich wiederkehrende Highlight der Konferenz statt, nämlich ein abendliches Beach Barbecue. Am Sandstrand bei warmem Wetter, wenn die Sonne leuchtend-rot im Pazifik versinkt, ist dieser Social Event unübertrefflich; da störten nicht einmal der halbverweste Hai und die angeschwemmten Erdölklumpen, die auf dem Sandstrand herumlagen.
Da die Konferenz über mehrere Tage ging und das Beach Barbecue nur einen Abend versüßte, machten sich mein zukünftiger Chef, die beiden Forschungskollegen und ich eines Abends nach dem Conference Dinner auf den Weg zum nächsten Supermarkt, um uns mit Gersten-Smoothies für einen romantischen Strandabend einzudecken. Wir erstanden einen Sixpack, den man uns in einer braunen Papiertüte aushändigte, warfen gleich vor dem Laden die Verpackung weg und öffneten schon mal drei Dosen (einer war Antialkoholiker), um das kalifornische Produkt zu evaluieren. Dann machten wir uns in fröhlicher Stimmung auf den Weg zum Strand.
„Hey, Sirs!“ ertönte es plötzlich sehr laut und barsch hinter uns, das erste, etwas freundlichere „Hey, Sirs!“ hatten wir als nicht wirklich uns zugedacht großzügig überhört. Wir wandten uns um und erblickten einen grimmig dreinschauenden Sheriff einige Meter hinter uns, breitbeinig dastehend mit auf seine beiden Colts aufgelegten Händen. Wir waren angemessen beeindruckt, verstanden aber nicht, ob er uns gemeint hatte und was er evtl. ausdrücken wollte. Nach einem kumpelhaften „Guten Abend, liebe Freunde“ hatte es sich jedenfalls nicht angehört und er sah uns deutlich missbilligend an.
Als wir uns gerade wieder abwenden wollten, weil wir uns immer noch nicht angesprochen gefühlt hatten, wiederholte er seine Kurzansprache in noch ruppigerem Tonfall und ergänzte diese mit der Frage, was wir machten. Wir fanden das zwar klar, was wir machten, nämlich fröhlich sein, Bier trinken und durch die Straßen schlendern, aber es schien eher eine rhetorische Frage gewesen zu sein.
Nachdem er verstanden hatte, dass wir nichts verstanden hatten – es mangelte nicht an unserem Englisch oder seiner Aussprache –, erklärte er uns, dass es in Kalifornien verboten sei, auf offener Straße Alkohol zu trinken. Auf eine Diskussion darüber, ob man Bier als Alkohol bezeichnen kann, wollte er sich nicht einlassen, er schien überhaupt wenig Humor zu haben. Wir hätten ihm auch sagen können, dass wir zwar Nein zu Alkohol sagen, er aber nicht auf uns hören will. Unsere fröhliche Stimmung trug jedenfalls nicht dazu bei, dass die seinige ebenfalls besser wurde. Eher im Gegenteil. Er forderte uns auf, das gute Getränk, das noch in den Dosen war, auch in den ungeöffneten, sofort in den nächsten Gulli zu kippen, wenn sich der Abend nicht ganz anders entwickeln sollte, als wir uns das vorgestellt hätten. Aber der Abend war ohnehin schon auf dem besten Weg dazu. Trotzdem blieb uns nichts anderes übrig, als das wertvolle Blechbier wegzuschütten. Der Abend endete damit für uns in einem enttäuschenden Ausklang.
Bis zu diesem Zeitpunkt war mir, und meinen Mittrinkern anscheinend auch, nicht klar gewesen, wie befangen die Amis im Umgang mit Alkohol in der Öffentlichkeit sind. Es wird sogar geraten, „zur Vermeidung von Missverständnissen“ gekaufte Dosen und Flaschen mit alkoholischem Inhalt in Papiertüten zu packen. Wir hatten unsere Tüte ja gleich entsorgt. Sie gehen sogar soweit, dass man gekauften Alkohol im Auto nur im Kofferraum mitführen darf, da sonst der Verdacht besteht, dass man während der Fahrt getrunken hat!
Es ist zwar bundesstaatabhängig, aber die Bestimmung in den USA sind bezüglich Alkohols meist sehr restriktiv, in Gaststätten und Restaurants dürfen nur lizensierte Betriebe ausschenken, wozu Fast-Food-Restaurants, Cafés, Raststätten an Highways und chinesische Niedrigpreisrestaurants eher nicht gehören. Auch in Bars kann es passieren, dass Whiskey nicht im Glas, sondern als verschlossene „Miniflasche” mit leerem Glas serviert wird; dann darf Alkohol nur „by the bottle” verkauft werden, einschenken muss man sich aus der erworbenen Flasche selbst. Das ist dann keine Schikane des Barkeepers, sondern eine Form phantasievollen Umgangs mit hinderlichen Gesetzesvorgaben.
Nachdem es mir also wegen drohender Nichtgenehmigung der Reise fast nicht gelungen war, überhaupt nach Kalifornien zu kommen, wäre ich am Ende beinahe wegen Nichtgenehmigung öffentlichen Alkoholtrinkens erst mit Verspätung wieder zurückgekommen, da ich möglicherweise für ein paar Tage ein US-Gefängnis hätte kennenlernen dürfen. Der Sheriff hatte mich jedenfalls zutiefst und für mein ganzes Restleben so nachhaltig beeindruckt, dass ich mich auch heute noch gerne an das besondere Erlebnis im Land der unbegrenzten Möglichkeiten erinnere. Vor allem der unerwartete Anblick eines schießbereiten Cowboys hinter meinem Rücken geht mir nie mehr aus dem Sinn.
Gipfelglück
In meinen Enddreißigern, als ich beinahe 20 kg weniger als heute auf die Waage brachte und immer noch sehr nahe an meinem gewichtsmäßigen Erwachsenen-Allzeittief weilte, verbrachte ich einmal eine Wanderurlaubswoche im Osttiroler Virgental in einer kleinen Pension. Von hier aus unternahm ich diverse Bergwanderungen in das Gebiet der Venedigergruppe in den Hohen Tauern. Die Gebirgsgruppe liegt im Grenzbereich der Bundesländer Salzburg und Osttirol.
Gleich am zweiten Tag meines Aufenthaltes stieß ich auf eine Tourenankündigung eines ausgebildeten Bergführers, der eine zweitägige geführte Tour auf den Großvenediger plante. Da der Termin bestens in meine Urlaubstage passte und ich schon immer mal eine Gletschertour mitmachen wollte, war ich sofort Feuer und Flamme, sofern man diesen unpassenden Begeisterungsausbruch für das eisige Vorhaben akzeptieren kann. Der Gipfel des ca. 3.662 m hohen Berges (es kursieren unterschiedliche Höhenangaben), Österreichs fünfthöchstem, ist nämlich immer schneebedeckt und von spaltenreichen Gletschern umgeben. Und das letzte Stück zum Gipfel über einen schmalen Grat erfordert Schwindelfreiheit und absolute Trittsicherheit.
Der Veranstalter der Bergtour stellte glücklicherweise seinen Kunden für diese Tour alles zur Verfügung, was auch ich nicht dabei hatte, nämlich Steigeisen für die steilen, vereisten Passagen, Schneeschuhe für den Übergang über große, frische Schneefelder und ein Bergseil für die Gletscher- und Grat-Passagen. Alles andere wie feste Bergschuhe, Rucksack, Mütze, Anorak und Handschuhe hatte ich natürlich dabei. Eine Übernachtung auf der Neuen Prager Hütte war vorgesehen, auch hierfür brauchte ich glücklicherweise nichts mitzubringen, ein Hüttenschlafsack wurde gestellt.
Unser Bergführer Rudi hatte eine Besteigung über die sog. Ostroute ausgewählt. Diese begann am Matreier Tauernhaus in der Nähe der Südpforte des Felber-Tauern-Tunnels und führte unsere kleine Gruppe mit sechs Bergbegeisterten zunächst über eine Schotterstraße durchs Gschlössbachtal nach Innergeschlöss und dann nach dem Talschluss über einen steilen und sehr anstrengenden Aufstieg vorbei an der Alten über Serpentinen zur Neuen Prager Hütte auf 2.782 m Höhe. Die Hütte nordöstlich des Großvenediger-Gipfels war 1901 bis 1903 unter maßgeblicher Beteiligung eines Prager Kaufmanns und Alpinismus-Mäzens errichtet worden, daher ihr Name. Die 300 m tiefer gelegene Alte Prager Hütte ist schon länger geschlossen, soll aber zukünftig renoviert und als Österreichs höchstgelegenes Museum irgendwann wiedereröffnet werden.
Nachdem wir auf der Neuen Prager Hütte einen gemütlichen Abend und eine geruhsame Nacht verbracht hatten, machten wir uns am frühen Morgen auf den Weg zum Gipfel. Diese Tour unterschied sich in mehrfacher Hinsicht deutlich von derjenigen des Vortages. Zum einen kamen wir bald zum Schlatenkees östlich des Gipfels, wo wir Steigeisen anlegen und uns zu einer Seilschaft einbinden mussten, um uns beim Überschreiten der teils sehr tiefen Gletscherspalten nicht in Gefahr zu bringen. Zum anderen wurde das Wetter deutlich schlechter, es waren dicke, weiße Wolken aufgezogen, die glücklicherweise keinen Neuschnee brachten. Trotzdem war es für einen Berglaien wie mich über lange Strecken nicht möglich, optisch zwischen Schnee, Gletscher und Nebelwolken zu unterscheiden. Alles schien in einem weißen Brei zu verschmelzen. Ohne unseren ortskundigen Bergführer hätte die Tour für uns in einem Fiasko enden können, da alle das gleiche Problem hatten.
Kurz vor dem Gipfelanstieg verkürzten wir den Seilabstand und stiegen über ein sehr steiles Stück über den Südosthang hoch auf den Gipfelgrat, der sich mit der Zeit immer stärker verengte. An dieser Stelle trafen alle Wege der Normalanstiegsrouten zusammen, aber außer uns war keine weitere Gruppe unterwegs.
Dank der dichten Nebelwolken konnten wir von der Enge des Grates nicht viel sehen, was den nicht Schwindelfreien unter uns deutlich entgegenkam. Für zwei Teilnehmer war das letzte Stück des Gipfelanstiegs extrem mühsam, sie konnten es nur mit letzter Mühe bewältigen. Die Vorfreude auf das Ende der Anstrengungen war zwar groß, die auf wenige Meter beschränkte Sicht ließ jedoch zunächst keine Euphorie aufkommen. Ganz im Gegenteil, wir begannen die idiotische Idee, diese riesige Anstrengung bei Scheißwetter auf uns zu nehmen, zu verfluchen. Zumal die Tour nicht gerade billig gewesen war.
Ganz anders aber, als wir endlich am Gipfelkreuz angekommen waren! Nun rissen die Wolken immer mehr auf, die Sonne schien uns so nah wie nie und wir wurden mit einer phantastischen Aussicht auf die schneebedeckten Gipfel der rundherum liegenden Berge der Hohen Tauern belohnt. Die Fernsicht war grandios, sogar der 30 km entfernte Gipfel des Großglockners, Österreichs höchstem Berg, war klar zu erkennen. Hier und jetzt war das chinesische Sprichwort „Steigst Du nicht auf die Berge, so siehst Du auch nicht in die Ferne“ nicht besser nachvollziehbar.
Was war das für ein Gefühl nach der physisch und psychisch anstrengenden Tour! Die Stunden zuvor hatten wir uns verflucht, dass wir eine solche Tour auf einen in den Wolken liegenden Gipfel unternommen hatten. Und nun dieser überwältigende Ausblick, der uns für alle Mühen reichlich entschädigte. Einige fingen an zu weinen, die anderen lachten und ich bekomme heute noch eine Gänsehaut, wenn ich mich an das Erlebnis erinnere.
Nach einem einstündigen Gipfelaufenthalt machten wir uns auf den Rückweg und wählten hierfür die gleiche Route, allerdings ohne erneute Übernachtung, aber mit Einkehr auf der Neuen Prager Hütte.