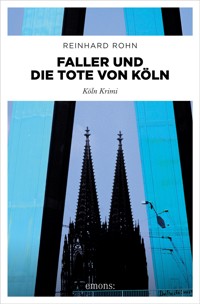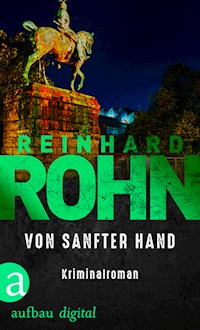
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Lisa Martin ist das schwarze Schaf einer ansonsten überaus angesehenen Münchner Familie. So hat sie sich mit ihren dreißig Jahren in einigen Berufen versucht, ohne jemals wirklich Fuß zu fassen. Nun verdient sie ihren Unterhalt auf höchst ungewöhnliche Weise: Sie reist quer durch Deutschland von Hotel zu Hotel und lässt sich von wohlhabenden Männern mit aufs Zimmer nehmen. Dort betäubt Lisa sie und raubt sie aus – allerdings ohne ihnen ein Haar zu krümmen. Eines Tages muss sie jedoch eine schockierende Entdeckung machen: Sie liest in der Zeitung von zwei Mordfällen, die in Kölner Hotels verübt wurden, und es ist schnell klar, dass die Opfer ihre letzten beiden Wohltäter sind. Das Täterprofil ist genau auf sie zugeschnitten, und Lisa weiß, dass sie von einer Sekunde zur nächsten in höchste Gefahr geraten ist. Aber wer ist so genau über sie informiert, und vor allem – wer hasst sie so sehr, dass er ihr zwei Morde anhängen will? Als Lisa spürt, dass sie immer mehr ins Visier des Unbekannten gerät, beschließt sie, die Rollen zu tauschen – und selbst zur Jägerin zu werden ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
Lisa Martin ist das schwarze Schaf einer ansonsten überaus angesehenen Münchner Familie. So hat sie sich mit ihren dreißig Jahren in einigen Berufen versucht, ohne jemals wirklich Fuß zu fassen. Nun verdient sie ihren Unterhalt auf höchst ungewöhnliche Weise: Sie reist quer durch Deutschland von Hotel zu Hotel und lässt sich von wohlhabenden Männern mit aufs Zimmer nehmen. Dort betäubt Lisa sie und raubt sie aus – allerdings ohne ihnen ein Haar zu krümmen.
Eines Tages muss sie jedoch eine schockierende Entdeckung machen: Sie liest in der Zeitung von zwei Mordfällen, die in Kölner Hotels verübt wurden, und es ist schnell klar, dass die Opfer ihre letzten beiden Wohltäter sind.
Das Täterprofil ist genau auf sie zugeschnitten, und Lisa weiß, dass sie von einer Sekunde zur nächsten in höchste Gefahr geraten ist. Aber wer ist so genau über sie informiert, und vor allem – wer hasst sie so sehr, dass er ihr zwei Morde anhängen will?
Als Lisa spürt, dass sie immer mehr ins Visier des Unbekannten gerät, beschließt sie, die Rollen zu tauschen – und selbst zur Jägerin zu werden ...
Über Reinhard Rohn
Reinhard Rohn wurde 1959 in Osnabrück geboren und ist Schriftsteller, Übersetzer, Lektor und Verlagsleiter. Seit 1999 ist er auch schriftstellerisch tätig und veröffentlichte seinen Debütroman »Rote Frauen«, der ebenfalls bei Aufbau Digital erhältlich ist.
Die Liebe zu seiner Heimatstadt Köln inspirierte ihn zur seiner spannenden Kriminalroman-Reihe über »Matthias Brasch«. Reinhard Rohn lebt in Berlin und Köln und geht in seiner Freizeit gerne mit seinen beiden Hunden am Rhein spazieren.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Reinhard Rohn
Von sanfter Hand
Roman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Zweiter Teil
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Dritter Teil
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Epilog
Danksagung
Impressum
Erster Teil
1
Ich rieche die Einsamkeit der Männer. Manche Frauen haben andere Fähigkeiten; sie können in den Karten das Schicksal ihrer Mitmenschen lesen; sie entwickeln einen sechsten Sinn, wenn es um ihre Kinder geht, oder sie müssen ihrem Gegenüber nur in die Augen schauen, um zu erkennen, welche geheimen Krankheiten in ihm wüten. Ich aber weiß immer genau, wann ich es mit einem Mann zu tun habe, der all seine Hoffnung verloren hat und auf ein Abenteuer wartet, darauf, dass etwas mit ihm geschieht. Ich beschere ihm dieses Abenteuer; es kostet mich kaum mehr als ein kaltes Lächeln.
Man findet diese Verlorenen überall. In jedem Café, in jeder Bar sitzen sie, und überall auf der Welt verhalten sie sich gleich. Die meisten Männer sind langweilig. Sie rauchen, sie telefonieren, blättern in Zeitungen und dabei suchen sie mit unruhigen Augen ihre Umgebung ab; wie ängstliche, argwöhnische Tiere. Am liebsten sind mir die Angeber, die sich hinter teuren Sonnenbrillen verstecken, die miesen Großtuer, die einem gleich die Welt erklären wollen. Sie geben die besten Opfer ab. Für sie muss ich mir keine Mühe geben. Ein Hauch von Tarnung genügt: eine Perücke vielleicht, ein aufdringlicher Lippenstift, ein falscher Vorname. Trotz ihrer heimlichen Angst sind solche Männer niemals misstrauisch. Die Fähigkeit, eine wirkliche Gefahr zu wittern, ist ihnen längst abhanden gekommen.
Wenn ich einen einsamen Mann aufgespürt habe, ist meine wichtigste Arbeit eigentlich schon getan. Ich muss nur noch ein wenig Geduld aufbringen und abwarten. Manche Männer brauchen sehr lange, bis sie den Mut finden, sich heranzuschleichen und mich anzusprechen. Bei anderen dauert es keine fünf Minuten. Ich habe mir angewöhnt, es diesen Männern niemals leicht zu machen, nicht, weil ich fürchten würde, damit ihren Verdacht zu erregen. Ich locke sie nicht, ich möchte sehen, wie sie mir in die Falle laufen. Also betreibe ich keine albernen Spielchen; ich sitze niemals mit einer nicht angezündeten Zigarette da, suche niemals viel zu offensichtlich nach einem Taschentuch, und niemals bin ich es, die einen Mann anspricht. Sie sollen das Gefühl haben, ich sei ihr Opfer. Bis zu dem Augenblick, wenn ich sie mit sanfter Hand verzaubere, wenn ich mein schwarzes Tuch über sie lege und sie zu kleinen, unschuldigen Kindern werden, die im Schlaf reden, weil sie Angst vor Albträumen haben.
Ich habe in meinem Leben nie etwas zu Ende gebracht. Ich bin eine Meisterin der Anfänge. Keine Schule habe ich länger als ein Jahr besucht. In dem einzigen Internat, auf das meine Eltern mich in ihrer Verzweiflung steckten, habe ich es sogar nur wenige Wochen ausgehalten. Dann verfiel ich in ein Schweigen, das ich seit meiner Kindheit beherrsche und das meinen Mitschülern Angst einjagte. In gewissen Situationen bin ich nichts als Stille. Die Stille regiert mich. Ich atme Stille, ich rede nicht mehr, verstehe auch nicht. Die Sprache der anderen wird zu einem Farbenspiel. Die Worte fallen ihnen wie bunte Steine aus dem Mund. Manche Worte sind rot, wie ein Leuchtsignal in der Nacht, andere sind gelb und tun mir in den Augen weh; wieder andere sehen aus wie grauer, nasser Zement, oder sie sind schwarz, als wären sie aus Kohle. Am liebsten sind mir die silbernen Worte; sie bedeuten Wahrheit und tiefe Gedanken, doch silberne Worte sind selten. Man findet sie fast nie; das ist, als würde man auf das Meer hinausfahren und darauf warten, dass ein Delphin aus dem Wasser springt und das Licht sich auf ihm spiegelt.
Täglich mit meinem Schweigen konfrontiert, bekam es auch der Internatsleiter nach ein paar Wochen mit der Angst zu tun. Meine Stille erschien ihm wie eine Krankheit, wie Bulimie oder eine sanfte Dysphorie, und er bat meine Eltern, mich von der Schule zu nehmen. Ich lernte das Sprechen wieder; es machte mir nichts aus, eine Zeit lang auf meine Stille zu verzichten und keine bunten Worte mehr zu sehen.
Auch an der Universität blieb ich nicht länger als sechs Wochen. Zum Ärger meiner Eltern hatte ich mich entschieden, Archäologie zu studieren. Steine sind das Gegenteil von Wasser. Steine sind heiß und schwer und haben ein unendliches Gedächtnis. Kein Zeichen, das in einen Stein gehauen wurde, geht jemals ganz verloren. Ich freute mich darauf, Steine zu lesen und in den Ferien berühmte Ausgrabungsstätten zu besuchen. Leider kam alles ganz anders.
Nach sechs Wochen lud der Dozent mich zu sich ein. Doktor Schmitter war ein kleiner, schüchtern wirkender Mann, der nie anders als mit weißem Hemd und Fliege aus dunklem, rotem Samt auftrat. Seine Augen sahen unwirklich aus, so als wären sie aus blauem, gebrochenem Glas. Schmitter führte mir ein orientalisches Tee-Ritual vor, während er von Winkelmann und Schliemann, den Heroen der Archäologie, redete. Der Tee schmeckte ungewöhnlich, beinahe wie eine süße, zuckrige Droge. Dann zeigte Schmitter mir sein Haus, ein ehrwürdiges, weitläufiges Gebäude, das er offenbar von seinen Eltern geerbt hatte und das aussah, als könnten hinter jeder Tür livrierte Diener oder Kammerzofen lauern. Ich wusste längst, worauf diese kleine Aufführung hinauslief. Doch ich wollte damals noch keine Spielverderberin sein.
Im Keller des Hauses hatte Schmitter ein Schwimmbecken einbauen lassen. Im verblassenden Licht der Dämmerung sah das Wasser, das von vier Scheinwerfern im Becken erhellt wurde, unwirklich blau aus, wie ein Stück Himmel, das jemand eingefangen und auf die Erde herabgeholt hatte. Schmitter lächelte, seine Glasaugen funkelten selbstsicher; er hatte seinen Pool schon häufiger mit beachtlichem Erfolg jungen, unbedarften Studentinnen vorgeführt.
Als er wortlos, aber mit großer Geste seine Samtfliege ablegte, wusste ich, dass unser harmloses Rendezvous nicht ohne Komplikationen enden würde. Ich hasse Wasser; wenn ich Wasser nur rieche, werde ich nervös und gereizt. Außerdem kann ich nicht schwimmen, und ich werde es auch niemals lernen.
Mit einem Lächeln schritt Schmitter mir entgegen. »Gegen ein kleines Bad wäre doch wohl nichts einzuwenden«, sagte er mit sanfter Stimme. Seine Glasaugen tasteten mein Gesicht ab, suchten nach Zeichen von Zustimmung.
Ich schüttelte stumm den Kopf. Ich wusste, dass ich am besten den sofortigen Rückzug antrat, wenn es keinen Ärger geben sollte, doch im nächsten Moment kam Schmitter schon den letzten Schritt auf mich zu. Ich hätte nicht die rechte Hand heben und ihm meine Faust ins Gesicht schlagen müssen, aber da war es schon zu spät. Ich sah, wie Schmitter überrascht zurücktaumelte, wie er seine Hand ungläubig auf seine blutende Nase legte und dann langsam und ungelenk in sein wunderbares, blaues Schwimmbecken rutschte. Meine Karriere als Archäologin war beendet.
Allerdings haben mir all meine Anfänge später geholfen, mich in meinen verschiedenen Rollen zurechtzufinden. Nach dem Debakel an der Universität verkaufte ich vier Wochen lang finnisches Knäckebrot in einem Supermarkt, dann durfte ich einer alten, erblindeten Schauspielerin vorlesen und ihre drei Hunde ausführen. In einem langen, heißen Sommer war ich Erdbeerpflückerin und arbeitete in einer Marmeladenfabrik. Danach saß ich in einem kleinen Theater an der Kasse und spielte in einem Stück von Ibsen ein Dienstmädchen, das zwei Sätze aufzusagen hatte. Fast fühlte ich mich schon zur Schauspielerin berufen, bis ich so pleite war, dass ich mir zumindest vorübergehend einen anderen Job suchen musste. Ich wurde Pharma-Referentin, eine gut bezahlte, einfache Tätigkeit. Ich bekam einen teuren Wagen und musste in Arztpraxen neuartige Pillen anbieten. Pillen für eine geregelte Verdauung, Pillen gegen Falten und gegen den ungezähmten Hunger, Pillen, die jedem sofort den Kopfschmerz nahmen oder ihn in einen sanften, freundlichen Schlaf wiegten. Doch schon nach zwei schwierigen Wochen, in denen ich mit meinen Pillen kaum Erfolg gehabt hatte, begegnete ich Georg.
Georg machte den Anfang. Er war mein Lehrmeister, ohne es zu ahnen, und mein Vater sah mir dabei zu, wie ich eine ganz neue Karriere begann.
Ich hatte mich verfahren und war in Erlangen gestrandet, in einem vollkommen altmodischen Hotel, das an einer lauten, vierspurigen Straße lag. Ich mag Hotels, genauso wie ich Bahnhöfe und Flughäfen liebe. Reisen ist für mich manchmal die einzige Möglichkeit, am Leben zu bleiben.
Georg hockte in der Bar, einem winzigen, düsteren Raum, der hinter der Rezeption des Hotels lag. Er war der einzige Gast. Ein junges Mädchen in der Kluft eines Serviermädchens hatte sich hinter den Tresen zurückgezogen und beobachtete ihn argwöhnisch. Georg sah aus wie einer dieser tumben Männer, die unbesiegbar wirkten, in Wahrheit aber ständig auf der Flucht waren. Er roch nach einem Haufen Schulden, einer Frau, die längst nicht mehr auf ihn wartete, und nach zwei kleinen Kindern, deren Wesen er überhaupt nicht verstand. Sein Anzug war von einer langen Autofahrt zerknittert, und seine Krawatte mit einem abscheulichen gelben Blumenmotiv hing auf Halbmast. Erst als ich auf seine Hände blickte, gefiel er mir besser. Seine Hände waren schlank und fast weiß, so als wären sie aus Wachs. Keine Spur von Nikotin war an ihnen zu entdecken. Die Nägel waren perfekt gerundet und ordentlich geschnitten.
Ich habe mich stets geweigert, irgendeine der Weisheiten anzunehmen, die mein Vater ständig verbreitete, so wie andere Leute penetrant gute Laune verströmten, aber zwei Dinge hat er mich doch gelehrt. Man sollte auf die Stimme eines Menschen aufpassen. Manche haben eine Stimme, vor der man sich hüten muss. Sie hüllen einen mit ihrer Stimme ein, wie eine Spinne, die ihr Netz spinnt, und verführen einen zu Träumen, die man sich niemals eingestehen würde. Außerdem brachte mir mein Vater bei, auf die Hände eines Menschen zu achten. Anders als das Gesicht verraten die Hände, wen man wirklich vor sich hat. In ihnen ist nicht nur das wahre Alter eines Menschen eingraviert; seine Angst, seine Unruhe, sogar seine Art, die Dinge zu sehen, sind in ihnen zu lesen. Hände haben ihre eigene Sprache. Georgs Hände waren ruhig, viel ruhiger als der Rest seines Körpers.
Er schaute mich mit einem müden, freundlichen Blick an, als ich mich neben ihn an die Bar setzte.
Das Serviermädchen machte einen vorsichtigen Schritt auf mich zu. Ich bestellte ein Glas Rotwein. Ich trinke niemals Weißwein. Bei weißem Wein denke ich an Wasser und werde missmutig oder depressiv.
Georg hatte ein leeres Whiskeyglas neben sich. Daher hatte das Serviermädchen ein wenig Angst vor ihm. Er hatte offenbar Kurs auf einen wunderbaren Alkoholrausch genommen, und obendrein lag er wie alle Säufer auf der Lauer, um loszureden, irgendeine Geschichte loszuwerden. Georg interessierte mich nicht wirklich, doch plötzlich, kaum hatte ich den ersten Schluck Rotwein getrunken, überfiel mich eine seltsame Stimmung. Ich spürte meine Einsamkeit wie eine Krankheit, die sich an mich heranschlich. In zwei Tagen hatte ich Geburtstag. Mit neunundzwanzig war niemand alt, aber ich hatte zu viele alte, eisige Gedanken in letzter Zeit.
Ich weiß nicht, warum ich ihn anlog und ihm Leahs Namen nannte, als er mich fragte. Vielleicht weil Leah auch in zwei Tagen Geburtstag hatte. Nur würde Leah niemals neunundzwanzig werden; sie würde immer acht bleiben, mit langen, blonden Zöpfen und Augen, in denen der Schrecken wohnte.
Georg bestand darauf, meinen Rotwein zu bezahlen und mich auf ein zweites Glas einzuladen. Als ich seine Stimme hörte und er mich zum ersten Mal anlächelte, sah ich, dass ich mich getäuscht hatte. Er hatte keine Ehefrau und keine zwei Kinder zu Hause. Seine Zähne waren schief, standen kreuz und quer im Mund, als würde es da keine Ordnung geben, und seine Stimme verriet den Eiferer, der andere zu etwas bekehren wollte. Georg war ein Erfinder; er hatte die ewige Uhr erfunden, die niemals stehen bleiben, niemals zerstört werden konnte. Und mit diesen Uhren zog er umher, aber wie ich mit meinen Pillen hatte er nirgends den gewünschten Erfolg. Trotzdem wäre ich niemals mit ihm auf sein Zimmer gegangen, wenn Georg nicht angefangen hätte, über meine Hände zu sprechen. Offenbar hatten sich die Weisheiten meines Vaters über Hände allgemein herumgesprochen, oder Georg hatte seinen eigenen, ganz besonderen Tick.
Er suchte ein Mannequin für seine Uhren, sagte er, doch bei den Fotoaufnahmen, die er machen wollte, käme es nicht auf das Gesicht oder die Figur des Models an, sondern nur auf die Hände und Handgelenke. Lediglich die Hände mit seinen Uhren wären auf den Fotos zu sehen.
Mir gefiel der Gedanke, ein Model für Hände zu sein. Dabei kann man meine Hände nicht eigentlich hübsch nennen; sie sind ein wenig zu breit geraten, als müssten sie noch wachsen. Auch meinen Fingernägeln fehlt die richtige Länge, sie sind oval und eine Spur zu breit, und auf meinem rechten Daumen habe ich einen kleinen, unförmigen Höcker, so wie bei Kindern, die sich nicht rechtzeitig das Daumenlutschen abgewöhnt haben. Noah, der erste und vielleicht einzige Mann, der mir etwas bedeutete, hatte einmal gesagt, ich hätte Kinderhände, die nur so taten, als wären sie erwachsen. Noahs Hände waren sanft und schwarz wie Schokolade. Noch Jahre, nachdem er verschwunden war, träumte ich von ihnen.
Erst als Georg die Zimmertür hinter sich schloss, bemerkte ich, dass er eine Flasche Sekt in der Hand hielt. Er lächelte. In seinem Mund schienen die Zähne voller Freude hin und her zu hüpfen. Im Zimmer roch es nach Schweiß und durchgelaufenen Schuhen. In einer Ecke sendete ein stummer Fernseher bunte Bilder. Für einen Moment glaubte ich, in einem Gemälde von Edward Hopper gelandet zu sein. Als ich mich auf den einzigen Sessel setzte, ahnte ich schon, dass ich es nicht lange in Georgs Zimmer aushalten würde.
»Zeig mir deine Uhren«, sagte ich.
Er blieb reglos an der Tür stehen, aber er veränderte sich ein wenig. Es war nicht nur sein Gesicht, sein ganzer Körper schien einen ernsten, entschlossenen Ausdruck anzunehmen. Ich begriff, dass ich Georg falsch eingeschätzt hatte. Vielleicht war er viel gefährlicher, vielleicht hauste ein unbändiges, rücksichtsloses Tier in ihm. Doch mit der nächsten Bewegung fiel seine Anspannung wieder von ihm ab. Er wandte sich einem kleinen silbernen Metallkoffer zu und stellte ihn vor mich auf den Tisch. Er lächelte, ohne seine schiefen Zähne zu zeigen. »Mit diesen Uhren kannst du auf den Himalaya steigen, Leah, oder dreitausend Meter tief tauchen, theoretisch«, sagte er und klappte den Deckel wie ein Zauberer auf, der einem gebannten Publikum einen Blick auf seine geheimnisvollen Hilfsmittel gestattete. »Und wenn diese Bude hier abbrennt, dann bleibt von dir und mir nur ein Häufchen Asche übrig, aber diese Uhren laufen noch wie ’ne Eins.«
Zwanzig goldene Armbanduhren lagen auf schwarzem Samt und schienen mich erwartungsvoll anzuschauen. Sie sahen so schwer und unförmig aus, als müsste man mindestens in Georgs Gewichtsklasse gehören, um sie tragen zu können.
Georg hielt mir ein Glas Sekt hin und lächelte mich wieder an. »Sind sie nicht prächtig?«, fragte er voller Stolz. »Meine wunderbaren Babys?« Nein, sie waren nicht prächtig. Eher hätte ich mir ein paar Ketten um das Handgelenk geschlungen, als mit diesen klobigen Uhren durch die Welt zu laufen. Für solche Ungetüme brauchte Georg kein Fotomodell.
Ich spürte, dass er ungeduldig wurde. Ich hatte zu lange mit meiner Antwort gezögert. Ich nahm das Glas Sekt und stieß mit ihm an. »Prächtige Uhren«, sagte ich, ohne überzeugt zu klingen, »allerdings recht groß für eine Frau.«
Der Sekt war lauwarm. Georg kam ein wenig näher. »Frauen mögen große Uhren«, sagte er. Ich sah seine schiefen, kantigen Zähne, sah seine wässrigen blauen Augen, sah winzige blonde Härchen an seinen Schläfen, die unruhig pulsierten. »Zieh sie an, Leah!« Georg nahm die größte Uhr, ein goldenes Ungeheuer mit einem Armband, das so breit wie ein gewöhnlicher Gürtel war, und packte mein linkes Handgelenk.
Männer verstehen viele einfache Dinge nicht, zum Beispiel, dass es unsichtbare Grenzen auf dieser Welt gibt, die man besser nicht überschreitet. Jeder trägt eine Unmenge dieser unsichtbaren Grenzen mit sich herum; jeder sagt unentwegt: Hier, lieber Freund, ist für dich Endstation.
Georg segelte munter über eine dieser unsichtbaren Grenzen hinweg. Er hauchte mir fröhlich seinen sauren Alkoholatem ins Gesicht und legte mir die Uhr um, als wäre sie eine Fessel. »Geh auf und ab«, sagte er, »zeig mir die Uhr. Wir könnten uns auch mit ein paar netten Spielen amüsieren. Ich komme auf dich zu; du kennst mich nicht, und ich frage dich, wie spät es ist. Oder du versuchst, mir deine Uhr zu verkaufen, aber ich will sie nicht. Du musst mich überzeugen. Bin sehr gespannt, wie du das anstellst.«
Mit einer schnellen, nur scheinbar sanften Bewegung befreite ich mich aus seinem Griff und erhob mich. Als ich an einem Spiegel vorbeihuschte, entdeckte ich mich selbst für einen Moment: eine blonde, recht hübsche Frau in einem cremefarbenen Kostüm. Mein Gesicht war vollkommen ausdruckslos und wirkte sogar ein wenig gelangweilt. Ich habe Angst vor Wasser, vor Albträumen, in denen ich ein kleines hilfloses Kind bin, und vor den langen Nächten, in denen kein Mond am Himmel steht, aber Männer wie Georg haben mir noch nie Angst eingejagt. Und doch hatte ich den Zeitpunkt verpasst, die Reißleine zu ziehen und mich ganz harmlos mit einem Wangenküsschen verabschieden zu können. Ich hatte im Hotel noch nicht einmal richtig eingecheckt, also wusste wahrscheinlich nur das schüchterne Serviermädchen, dass ich hier oben mit Georg zusammen war.
»Leah! Geh auf und ab«, sagte Georg. Sein Tonfall klang eine Spur härter, was mir ganz und gar nicht behagte. Er lehnte an der Tür und sah mir zu; vermutlich kam er sich wie ein berühmter Modedesigner vor, der vor einer großen Show seine Models inspizierte.
Ich machte ein paar Schritte, hob die Hand, an der seine Fünf-Kilo-Uhr hing. Georg lächelte glücklich, und ich lächelte zuckersüß zurück, dabei begann ich mir ernsthafte Gedanken zu machen. Georg mochte ungefähr hundert Kilo wiegen; die meisten Männer waren viel fetter und untrainierter, als es auf den ersten Blick wirkte. Es würde nicht so leicht sein, ihm kräftig in die Eier zu treten und aus seinem stinkigen Zimmer zu verschwinden.
Georgs blaue Wasseraugen verfolgten mich. Ihm war heiß geworden. Ein paar winzige Schweißperlen waren ihm auf die Stirn geklettert. Sein Mund war ganz auf Dauerlächeln eingestellt. »Und?«, fragte er. »Wie fühlst du dich mit meiner wunderbaren Uhr?«
Es gibt ein paar Methoden, wie man sich einen Mann vom Hals hält; ein treffsicherer, leicht spöttischer Scherz gehört dazu oder eine selbstbewusst vorgebrachte Provokation. Bei Georg und seinem Uhrenwahn würden solch harmlose Strategien wenig bringen; dennoch reizte mich sein penetrantes Lächeln zum Widerspruch.
Ich schaute ihn an und hob wieder meinen Arm mit der Uhr. »Wenn du mal jemanden umgebracht hast, brauchst du dir wenigstens keine Gedanken mehr machen, wie du die Leiche verschwinden lässt«, sagte ich mit meiner freundlichsten Stimme. »Zwei Uhren ums Handgelenk und schon versinkt die Leiche auf Nimmerwiedersehen in jedem See in den Alpen.«
Er lächelte noch immer, aber schon wirkte es angestrengter. Ein Zug von dunkler Nachdenklichkeit trat in seine Augen. »Du magst meine Uhren nicht«, sagte er leise. »Also werden wir das andere Spiel spielen. Die Uhren gehören dir; du bist die Verkäuferin und ich der Käufer.« Er machte zwei Schritte von der Tür ins Zimmer, aber nur um die Flasche Sekt zu ergreifen und sie sich an den Hals zu setzen. Ich begriff, dass Georg ein Verdurstender war; ihn dürstete nach Lob, nach Anerkennung und wahrscheinlich auch nach einer Frau, die mit ihm ins Bett stieg. Leider würde ich ihm da wenig helfen können.
Ich ging auf Georg zu. »Deine Uhren sind klasse«, sagte ich, »und gleich werde ich dir einen ganzen Lastwagen voll goldener, unverwüstlicher Armbanduhren verkaufen, zu zehntausend Mark das Stück.« Ich sah mein Gesicht winzig und dunkel in seinen wässrigen Augen. »Aber vorher möchte ich mich in deinem Bad ein wenig auf meine Rolle vorbereiten, wenn du gestattest.« Ohne seine Reaktion abzuwarten, nahm ich meine kleine Ledertasche, die ich immer bei mir trage, und mein Glas Sekt und ging ins Bad.
Bäder in billigen Hotels sind ein eindrucksvolles Sinnbild von Ödnis und Trostlosigkeit. Kein noch so winziges Fenster wies ins Freie, nur gelbe Kacheln reflektierten das grelle Neonlicht, und mit dem Licht sprang eine Belüftungsanlage an, die aber wohl nur Geräusche machte, statt wirklich für frische Luft zu sorgen. Georg hatte ordentlich aufgefahren: Zahnbürste, Zahnpasta, elektrischer Rasierapparat, ein billiges Aftershave in einer Halbliterflasche, ein Mittel gegen Haarausfall und eine Packung Kondome. Doch um mir all seine kleinen Schätze anzusehen, hatte ich keine Zeit. Ich drehte das Wasser an und nahm mir meine Ledertasche vor. Wenn ich meine Tasche einmal verlieren sollte, wäre ich nur noch ein halber Mensch. Alle lebenswichtigen Utensilien habe ich hier: mein Portemonnaie mit Papieren und Kreditkarte, Haarbürste, Lippenstift, einen winzigen Schminkspiegel, ein Parfümfläschchen, Tampons, Kopfschmerztabletten für meine Migräneattacken und ein Foto von Leah, wie sie allein unterm Weihnachtsbaum sitzt und ihre Lieblingspuppe im Arm hält. Allerdings trage ich auch ein paar Dinge mit mir herum, die eigentlich nicht in die Handtasche einer Dame gehören: ein Schweizer Messer, Beruhigungspillen, eine kleine Spraydose mit Reizgas, mit der man sich unliebsame Zeitgenossen vom Hals hält, ein Set mit verschiedenen Schraubenziehern und ein Fläschchen mit Tropfen, die jedem nach ein paar Minuten einen hundertprozentigen Tiefschlaf bescheren sollten.
Ich nahm das Fläschchen hervor. Bisher hatte ich die Tropfen noch nicht ausprobiert und wusste daher nicht, wie schnell sie wirken mochten. Ich wollte aber nicht kleinlich sein und gönnte Georg eine ordentliche Dosis. Zwanzig Tropfen zählte ich ab; zum Glück nahm der Sekt in meinem Glas keinerlei Färbung an. Wahrscheinlich aber würde das Zeug nun so bitter schmecken, als hätte ich Galle hineingerührt.
Dann zog ich rasch meine Lippen nach und bürstete mein Haar zurück, und kaum hatte ich den Wasserhahn abgedreht und mir einen schnellen Blick im Spiegel zugeworfen, als Georg auch schon wie ein kleiner, ungeduldiger Junge meinen Namen rief.
Es war halb elf; im Fernsehen hatten die Abendnachrichten begonnen, die Lieblingssendung meines Vaters. Ich hielt mein Glas bitteren Sekt in der Hand und lächelte Georg entgegen. Er stand noch immer an der Tür, scheinbar unverändert, nur seine scheußliche Krawatte hatte er abgelegt. Ich machte eine halbe Drehung, als hätte ich nicht nur meinen Lippenstift erneuert, sondern für Georg ein elegantes Abendkleid angezogen. Mit einer einladenden Geste näherte ich mich dem schmalen, zerschlissenen Sofa.
»Voilà, bitte nehmen Sie Platz. Die Vorstellung beginnt.«
Georg nickte brav und setzte sich. Die Flasche Sekt, die fast leer war, platzierte er vor sich auf den Tisch. Ich bemerkte, dass er noch stärker nach Schweiß roch und dass er aufgeregt war. Er glaubte tatsächlich, dass für ihn ein wunderbarer Abend beginnen würde.
»Mein Herr«, sagte ich. »Sie haben das unverschämte Glück eine dieser einzigartigen, unzerstörbaren Uhren erwerben zu können.« Während ich ihm tief in seine blauen Wasseraugen sah, schob ich mein Glas Sekt vor ihn. Dann nahm ich das andere, in dem nur noch ein fader Rest schwamm, und prostete ihm zu. Gehorsam nahm Georg das volle Glas und nippte daran. Ich beobachtete ihn genau. Der entscheidende Moment war gekommen. Wenn er voller Ekel den Sekt ausspuckte und das Glas hinter sich warf, wäre mein kleiner Trick aufgeflogen.
Georg jedoch zeigte keine Regung. Als er das Glas abstellte, war es leer. Fast hätte ich ihm wie eine fürsorgliche Mutter lobend den Kopf getätschelt, doch ich musste mit meiner Vorführung beginnen.
»Stellen Sie sich einmal vor, mein Herr«, fing ich an und berührte Georg sanft am Arm, »dieses lauschige Hotel, in dem wir uns zufällig getroffen haben, brennt heute Nacht ab.«
»Das gilt nicht, Leah«, unterbrach mich Georg. Seine Stimme schwankte bereits ein wenig, was aber eher am Alkohol als an meinen Tropfen lag. »Von einem Feuer habe ich vorhin schon gesprochen.«
Ich ließ mich nicht beirren. »Also stellen Sie sich ein Feuer vor. Flammen schießen aus den Fenstern, der Dachstuhl brennt ab und stürzt Funken sprühend in sich zusammen. Wir haben es leider nicht mehr geschafft, uns zu retten, und so bleibt von uns beiden Hübschen nur noch ein Häufchen Asche übrig.«
Georg schüttelte heftig den Kopf, doch ich ließ mich nicht wieder unterbrechen. »Ihre Frau verzehrt sich nach Ihnen. Ihre fünf Kinder weinen sich die Augen aus dem Kopf, doch da kommt ein freundlicher Polizeibeamter und bringt Ihren Angehörigen diese Uhr.« Ich ergriff eine der Monsteruhren und hob sie vorsichtig am Armband in die Höhe, als wäre sie ein großer, stinkiger Fisch, den ich gleich in eine Pfanne werfen würde. »Dieser wunderbare Chronometer ist das letzte Andenken an Sie, denn er hat den furchtbaren Brand überlebt. Mit dieser Uhr können Sie in einer Goldmine verschüttet werden oder mit einem Flugzeug abstürzen. Deswegen wird sie keine Sekunde nachgehen.«
Ich sah, dass Georg wieder Anstalten machte zu widersprechen. Er öffnete den Mund, gestikulierte mit seiner rechten Hand, aber irgendwie schienen ihm ein paar Dinge durcheinander zu geraten. Kein artikulierter Laut kam ihm über die Lippen. Sollten die Tropfen tatsächlich so schnell wirken?
Als ich mit meiner Vorstellung weitermachen wollte und schon die nächste Uhr aufnahm, warf ich einen flüchtigen Blick zum Fernseher. Mein Vater schaute mich an, so freundlich und verständnisvoll, wie er mich im wahren Leben nur selten angeschaut hatte. Auf dem Bildschirm machte er stets eine großartige Figur, deshalb war er auch so oft in den Abendnachrichten zu sehen: der attraktive, weißhaarige Kommentator, der seine Worte klug abwägte und beinahe jeden mit seiner sonoren Stimme einfing. Da Georg den Ton abgedreht hatte, konnte ich nicht verstehen, was mein Vater sagte, aber das war auch nicht nötig. Er spulte sein normales Programm ab: ernsthafte, staatsmännische Sätze, die er gelegentlich mit einem Lächeln ummalte. Auch wenn es offenbar niemandem auffiel, unterschieden sich die Kommentare meines Vaters eigentlich nie; er sang immer das Loblied auf den Einzelnen. Nur in dem Einzelnen steckten Kraft und Phantasie. Der Einzelne war seines Glückes Schmied, der Einzelne durfte dem Staat nicht auf der Tasche liegen oder auf die Segnungen der Kirche hoffen, sondern war immer für sich selbst verantwortlich.
Georg neben mir war der Kopf auf die Brust gesunken. Einmal noch zuckte er zusammen, wie Kinder es manchmal kurz vorm Einschlafen tun, und schaute mich mit großen, staunenden Augen an. Dann kippte er zur Seite und blieb in einer äußerst unbequemen Haltung auf dem Sofa liegen. Die Wundertropfen waren ein echter Hauptgewinn. Keine zehn Minuten hatte meine Vorstellung gedauert.
Ich hatte Georg ausgeknipst, wie man eine lästige, grelle Lampe ausschaltet, und er wirkte alles andere als unglücklich dabei. Entspannt lag er da, mit leicht geöffnetem Mund. Seine Augenlider flatterten kaum merklich. Wahrscheinlich spazierte er im Tiefschlaf durch einen Kinderhimmel, der ihm als Erwachsener im wachen Zustand gänzlich verschlossen blieb.
Erschöpft und auch ein wenig erleichtert legte ich die Uhr zurück. Zum ersten Mal fiel mir auf, wie heiß mir geworden war. Mein Vater lächelte mich vom Bildschirm an und nickte mir freundlich zu. »Hallo, Vater«, sagte ich, »ich soll dich von Leah grüßen.« Dann verschwand er und machte einem jungen, adretten Nachrichtensprecher Platz.
Ein kleiner, kostbarer Frieden legte sich über mich. Manchmal denke ich, dass es gar nicht das Geld ist, diese leichte Art, die nächste Miete aufzubringen, weshalb ich mein Leben geändert habe, sondern der Genuss dieser wenigen, friedlichen Minuten.
Ich schloss die Augen und lehnte mich zurück. Das Zimmer schien sich plötzlich zu weiten; die Mauern wichen zurück, von irgendwo drang ein frischer Wind herein. Und von jenseits der Zeit hörte ich Leahs fröhliche Stimme. »Gut gemacht«, sagte sie, »hat Lisa gut gemacht.«
Bevor ich ging, bettete ich Georg ein wenig bequemer und legte ihm eine Decke über die Beine. Dankbar flüsterte er ein paar schläfrige Worte, ohne allerdings die Augen zu öffnen. An der Tür erst fiel mir ein, dass er mir für meine Dienste ein angemessenes Entgelt schuldig war. Ich nahm den Metallkoffer mit den schweren ewigen Uhren und klappte ihn zu. Nur ein Exemplar ließ ich ihm zurück, damit er eine Erinnerung an mich hatte.
Vorsichtig hängte ich das »Bitte nicht stören«-Schild an die Tür und schlich die enge Treppe hinunter. Ich fühlte mich nicht wie eine Diebin, eher wie eine ordentliche Geschäftsfrau, die gerade einen Handel perfekt gemacht hatte. Niemand begegnete mir, als ich das Hotel verließ.
Welches Risiko ging ich ein, erwischt zu werden? Im Hotel hatte ich nur nach einem freien Zimmer gefragt, aber noch keine Anmeldung ausgefüllt, und Georg hatte ich Leahs Namen genannt. Um Leah zu finden, musste er schon mehr als zwanzig Jahre durch die Zeit reisen und an einem düsteren, zugefrorenen See enden. Es war also wenig wahrscheinlich, dass er irgendwann mit der Polizei vor meiner Tür stehen würde, um seine hässlichen Uhren einzufordern.
Ich fuhr die halbe Nacht nach München zurück. Den Metallkoffer hatte ich wie teures Beutegut auf dem Beifahrersitz platziert. Ich wusste selbst nicht, warum ich so heiter war. Leah sang irgendwo in meinem Kopf. Ihre Stimme klang beinahe ausgelassen, so wie Kinder singen, wenn sie sich ganz und gar bei sich fühlen. Als sie erfahren hatte, dass sie zwanzig Minuten älter war, hatte sie mir manchmal vorgesungen, wenn wir allein waren und ich mich abends fürchtete. Wie eine Puppe hielt sie mich dann im Arm, strich mir noch eine Haarsträhne aus dem Gesicht und hauchte voller Ernst ihre beruhigenden Worte auf mich herab. Hinterher stritten wir uns, wer zuerst eingeschlafen war; wir knufften und stießen uns, dabei wusste ich immer, dass sie im Recht war. Ich war die Kleine, die Ängstliche, ich schlief vor ihr ein.
Kurz vor München hielt ich auf einem Rastplatz. Der Himmel wirkte wie ein schwarzes Tuch, das jemand mit Juwelen geschmückt hatte. Millionen von Sternen funkelten auf mich herab. Einer dieser Sterne musste Leah gehören; von dort schickte sie mir ihren Gesang. Die Nacht war bitterkalt, als ich um meinen Wagen herumlief. Aber selbst wenn ich plötzlich am Nordpol, mitten im Eisbärenland gewesen wäre, hätte mir die Kälte nichts ausgemacht. Leahs Stimme umfing und wärmte mich. Ich lud meinen schweren Musterkoffer aus; jede Schachtel mit den sinnlosen Pillen und Tröpfchen warf ich einzeln in einen Müllcontainer. Auch wenn ich noch keine Ahnung hatte, was Georgs bleischwere Armbanduhren mir einbrachten, so wusste ich, dass ich nie wieder mit meinem Pillenköfferchen von einer Arztpraxis zur nächsten stöckeln würde.
Nachdem ich die letzten Pillen weggeworfen hatte, zog ich noch mein beigefarbenes Kostüm aus und stopfte es zu den Medikamenten in den Container. Am liebsten hätte ich mich, halb nackt wie ich war, auf das Autodach gelegt und zu den Sternen hinaufgeschaut, bis sie im Licht der Dämmerung langsam verblassten, doch dann rollte ein Wagen, den ich für eine Zivilstreife hielt, langsam auf den Rastplatz und stoppte mit eingeschalteten Scheinwerfern in einiger Entfernung. Meine Fähigkeit, Polizisten zehn Meilen gegen den Wind zu riechen, hat mir immer gute Dienste geleistet. Hastig streifte ich mir in der Dunkelheit einen Pullover und eine Jeans über und fuhr weiter. Gegen drei Uhr bog ich in meine stumme, verlassene Straße. Nie in den letzten Jahren hatte ich besser geschlafen als in dieser Nacht.
Mit einem Koffer voller gestohlener, goldener Uhren kann man nicht bei einem x-beliebigen Juwelier auftauchen oder eine freundliche Annonce in die Zeitung setzen. Man braucht einen Experten; jemanden, der sich auf gewisse Geschäfte knapp außerhalb der Gesetze versteht. Ich wusste nicht, wem ich meine erbeuteten Uhren zeigen sollte, um sie möglichst schnell zu Geld zu machen, aber darüber musste ich mir nicht meinen Kopf zerbrechen. Immer, wenn ich in den letzten Jahren in Schwierigkeiten geraten war, hatte mir Pierre geholfen.
Jede Frau braucht einen Mann wie Pierre. Er renovierte meine Wohnung, er kümmerte sich um meinen alten Volvo und war überhaupt immer in meiner Nähe, wenn mir nach harmloser Gesellschaft war. Hätte ich ihn nachts aus seinem heiligen Schlaf gerissen und ihn nach Paris, nach Rom oder irgendwo ans Ende der Welt bestellt, um mich abzuholen, hätte er sich sofort auf den Weg gemacht. Als ich ihn kennen lernte, war er ein ernster junger Mann, dem kaum ein Wort über die Lippen kam und der gerade begonnen hatte, katholische Theologie zu studieren. Pierre hat schwarzes lockiges Haar, seine Augen wirken dunkel und geheimnisvoll, als könnte er Dinge sehen, die andere nicht wahrnehmen. Ich bin sicher, er hätte einen ganz passablen Priester abgegeben, wenn er nach unserer ersten Begegnung nicht schwach geworden wäre. Wie ein herrenloses, ängstliches Hündchen war er mir nachgelaufen und hatte mitten in eiskalter Nacht an meiner Tür geklingelt.
Danach war Pierre etwas aus der Spur geraten. Fast als wollte er wie ich ein Meister der Anfänge werden, jobbte er eine Weile nur herum, bis er schließlich doch noch Priester wurde. Weil er stets so sanft und melancholisch wirkt, engagierte man ihn, um in einer drittklassigen Fernsehserie einen schweigsamen Kaplan zu mimen. Doch nach einem Jahr hatte sich die Handlung der Serie so verwirrt, dass Pierre die Lust verlor und sein falsches Priesteramt aufgab. Immerhin konnte er sich von der Gage einen Wagen leisten und ein Antiquariat aufmachen.
Bevor er in seinem Laden Bücherwände hinaufklettert, alte Romane sortiert, Gedichte schreibt oder im Internet nach bibliophilen Kostbarkeiten forscht, sitzt Pierre jeden Morgen eine Stunde im Café Puck. Diese Stunde ist seine Frühmesse. Er sitzt mit einer Zeitung da, trinkt seinen Milchkaffee, raucht filterlose Zigaretten, und niemand auf der Welt darf ihn stören; kein Mensch, wenn er nicht Lisa Martin heißt.
Ich hatte mir keine Geschichte zurechtgelegt, als ich mit meinem Metallkoffer das Café Puck betrat. Ich war müde und noch immer ganz umfangen vom Rausch meiner Nacht. Leise schlich ich an Pierre heran und küsste ihn auf sein schwarzes, langes Haar. Es hatte eine Zeit gegeben, ein paar kurze Stunden nur, als er mir damals nachgelaufen und in mein Bett geschlichen war, da hatte ich gedacht, dass ich vielleicht bei ihm bleiben sollte, dass er vielleicht meine Rettung sein könnte. Aber dann hatte ich bemerkt, dass mich etwas an ihm abstieß. Ich konnte meinen Kopf nicht auf seinen verschwitzten Bauch legen und den Geruch seiner feuchten Haut einatmen. Was ich an ihm roch, war nicht Einsamkeit, sondern eine vollständige, bedingungslose Hingabe: hier war jemand, der einem anderen ganz und gar vertrauen und sich selbst für ihn aufgeben würde. Pierres Geruch bereitete mir Übelkeit, und fast wäre ich in unserer einzigen Nacht hinaus in Eis und Schnee geflohen, um ihm zu entgehen.
Pierre schaute mich an. Er gehörte immer zu den wenigen Männern, die nicht sofort aufsprangen und mir einen Kuss auf die Wange hauchen wollten. Er war unrasiert. In der Hand hielt er eine filterlose Zigarette. Seine Hände haben mir auf Anhieb gefallen; sie sind schüchtern und noch ein wenig jünger als er, und doch wirken sie nicht schwach, sondern wachsam und muskulös. »Lange nicht gesehen, Lisa«, sagte er leise und scheinbar gleichgültig. Doch seine braunen Augen lächelten. Wenn ich seine sanften Augen sah, wusste ich, dass ich ihn noch immer am Haken hatte. Pierre hatte eine unverzeihliche Charakterschwäche: Er liebte mich.
Ich stellte meinen Metallkoffer auf den Tisch und trank einen Schluck von seinem Milchkaffee.
»Hast du eine Bank überfallen?« Seit Pierre nirgendwo mehr den Priester mimte, war er ein ziemlich normaler, neugieriger Mensch geworden.
Ich bedachte ihn mit einem langen, freundlichen Blick. »Morgen habe ich Geburtstag«, sagte ich. »Ich hoffe, du hast schon ein Geschenk für mich gekauft.«
»Klar.« Mit der Zigarette, die in seinem Mundwinkel auf und ab wippte, beugte Pierre sich über den Metallkoffer, wie ein ordentlicher Handwerker, der ein kleines Problem gewittert hat.
»Mein erstes Geburtstagsgeschenk. Hat einer meiner fürsorglichen Verehrer für mich dagelassen.«
Während ich mich setzte und ein Stück von seinem Croissant abbiss, öffnete Pierre den Koffer. Als er auf die Uhren blickte, glitt ein Leuchten über sein Gesicht, das mich erstaunte. Ich hatte immer gedacht, dass ich Pierres Gedanken lesen konnte, aber dieses Leuchten kannte ich nicht; nicht einmal wenn er mich plötzlich irgendwo in einer Menschenmenge entdeckte, hatte sein Gesicht einen solch verzückten Ausdruck angenommen.
»Hast du noch nie eine Sammlung von Armbanduhren gesehen?« Das Puck füllte sich. An unserem Nebentisch nahm ein Schauspieler Platz, den ich vor ein paar Wochen in einem mittelmäßigen Fernsehfilm gesehen hatte. Er spielte immer denselben Typ, Marke Aufreißer mit Dreitagebart und schlechten Manieren. Während er mit großer Geste nach der Kellnerin winkte, schien er sich zu fragen, wer im Café ihn erkannt hatte.
Pierre nahm in einer nachdenklichen Bewegung seine Zigarette aus dem Mund. »Du lügst wieder, Lisa«, sagte er, aber ohne den Hauch von Spott in der Stimme, den er sich in den letzten Jahren angewöhnt hatte. »Nie und nimmer hat dir jemand diese Uhren geschenkt. Doch falls sie wirklich ein Geschenk sind, dann rate ich dir: Heirate diesen Kerl und nimm ihn richtig aus.«
Hatten die Armbanduhren sich über Nacht verändert? Waren aus hässlichen, unverkäuflichen Monsteruhren plötzlich modische, filigrane Chronometer geworden? Ich blickte in den Koffer. Das helle Licht tat den Uhren gut; wie goldene Echsen, die sich in der Sonne rekelten, lagen sie auf dem schwarzen Samt. Sie wirkten auch nicht mehr ganz so schwer und unförmig. Wenn ich Georg in meinem nächsten Leben noch einmal über den Weg lief, würde ich Abbitte leisten müssen.
»Die Uhren müssen ein Vermögen wert sein«, sagte Pierre. »Jede sieht aus, als wäre sie eine Einzelanfertigung.«
»Kann sein«, erwiderte ich scheinbar gleichgültig. »Finde es heraus.«
Pierre schaute mich fragend an. Auch diesen Blick kannte ich nicht; er wirkte kühl und professionell, so als rechnete Pierre hastig durch, was ihm dieses Geschäft bringen könnte.
»Zwanzig Prozent für dich«, fügte ich schnell hinzu, »wenn du die Dinger verkaufen kannst.«
Pierre fuhr sich mit der linken Hand durch sein rabenschwarzes Haar, seine häufigste Geste der Ratlosigkeit, dann nickte er stumm. Ich lächelte ihn an. Eigentlich hatte er sich eine andere Art von Partnerschaft gewünscht, doch nun würde er mein Komplize werden. Innerhalb von einer Sekunde entwarf ich meine Zukunft. Es gab so viele Georgs auf der Welt, die ich um die eine oder andere Last erleichtern könnte. Zusammen mit einer unsichtbaren Leah und ihrem wunderbaren Gesang in meinem Kopf würde ich umherreisen und Beute machen, um sie an Pierre weiterzugeben.
»Könnte sein, dass mir in nächster Zeit noch ein paar Verehrer Geschenke machen werden«, sagte ich zu Pierre und trank von seinem lauwarmen Kaffee.
Pierre schaute mich an. In seinen braunen Augen hüpfte ein kleines Licht auf und ab. Auch er hatte mich selten so freudig und aufgekratzt gesehen.
Ich gab ihm beinahe feierlich die Hand. »Wir sind Partner.« Der Schauspieler vom Nebentisch blickte mit mildem Erstaunen zu uns herüber. Ich zwinkerte ihm zu, als wäre eigentlich ich die Berühmtheit, die er erkennen sollte. Verlegen lächelte er mich an und zwinkerte ungeschickt zurück. Einer wie er würde mein nächstes Opfer sein.
2
Ich bin keine gewöhnliche Diebin. Ich gebe den Männern, denen ich begegne, etwas, das sie sonst nicht haben: Ich verleihe ihnen einen Moment von Bedeutung und Tragik. Manchmal würde ich gern zusehen, wenn sie erwachen, wenn sie aus dem tiefen, warmen Meer des Schlafes, in das ich sie hinabstoße, langsam wieder an die Oberfläche treiben. Ich bin sicher, dass die meisten Männer mit zwei Gefühlen ringen, die sie so fest und stark gar nicht in sich vermutet haben. Natürlich sind sie wütend, voller Zorn, dass sie kaltblütig hereingelegt und bestohlen worden sind; ihr Geld ist weg, ihre Kreditkarte, die Uhr, die sie getragen haben, mitunter auch ein Ring, je nachdem, ob er mir gefallen hat oder nicht. Doch dann spüren sie noch ein anderes Gefühl; sie empfinden das Abenteuer, den Reiz, in Gefahr gewesen zu sein, so wie ein Jäger, der ohne Beute zurückkehrt, aber weiß, dass er einem großen, gefährlichen Tier so nahe wie noch nie in seinem Leben gekommen ist.
Und dann, nachdem ein paar Augenblicke vergangen sind und sie ganz in die Wirklichkeit zurückgefunden haben, erleben diese Männer noch ein drittes, heimliches Gefühl. Sie empfinden Scham, und diese Scham ist meine eigentliche Sicherheit. Auch wenn ich mir eine gewisse Tarnung auferlege und mir jeden Leichtsinn verbiete, weiß ich doch, dass die meisten Männer, die ich bestehle, nicht zur Polizei gehen. Eher denken sie sich ein paar Lügen aus, belügen sich und ihre Frauen, warum ihr Siegelring, ihre Rolex, ihre neue Fotoausrüstung, ihr wunderbarer Cam-Rekorder sich plötzlich aufgelöst haben.