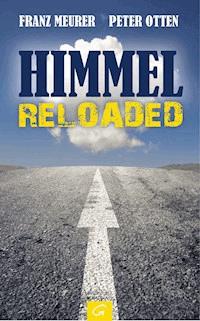Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Franz Meurer ist ein Kölsches Original, bundesweit bekannt wurde er spätestens mit seinem Bestseller "Glaube, Gott und Currywurst". Pünktlich zu seinem 70. Geburtstag, der – falls es die Pandemielage erlaubt – mit Karnevalsbands und Freunden wie Eckart von Hirschhausen groß feiern wird, erscheint sein neues Buch. Wie Zusammenhalt gelingt, Kirchengemeinden lebendig bleiben und Religion nicht belanglos wird, beschreibt er darin ebenso überzeugend wie einladend. Auf jeder Seite wird unaufdringlich deutlich, wie das Leben gelingt, wenn man es kreativ und ohne Vorbehalte für andere einsetzt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 240
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Franz Meurer
Waffeln, Brot und Gottes Glanz
Wie Kirche es gebacken kriegt
Der Autor hätte unter Berücksichtigung der gesellschaftlich laufenden Debatte gerne die geschlechtergerechte Sprache seines Textes mit dem Gender-Sternchen (*) deutlich gemacht. Der Verlag Herder hat für alle seine Publikationen entschieden, auf Gender-Sonderzeichen wie *, / und _ zu verzichten. Blinden- und Sehbehindertenverbände haben darauf hingewiesen, dass Vorlesegeräte diese Zeichen nicht verarbeiten können. Das, findet der Autor, ist ein Argument und er hat deshalb dem Gebrauch der Beidnennung wie »Messdienerinnen und Messdiener« sowie alternativ der wechselnden Nennung der weiblichen und männlichen Form zugestimmt.
Die Bibeltexte sind entnommen aus:
Die Bibel. Die Heilige Schrift
des Alten und Neuen Bundes.
Vollständige deutsche Ausgabe
© Verlag Herder, Freiburg im Breisgau 2005
Originalausgabe
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2021
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
E-Book-Konvertierung: ZeroSoft SRL, Timisoara
Umschlaggestaltung: Verlag Herder
Umschlagmotiv: Oksana_Schmidt / shutterstock
ISBN E-Book (ePub) 978-3-451-82360-2
ISBN Print 978-3-451-39060-9
Inhalt
Einleitung
1. Gut
2. Brot
3. Vingst
4. Jecken
Georg K.
Michael P.
Elisabeth H.
5. Pandemie
Reinhold H.
6. Familienrallye
Ulrike G.
7. Krankenbesuch
Elisabeth P.
8. HöVi-Dorf
Gisela R.
9. Wochenandacht
Martin Stankowski: Toleranz ist überflüssig
Michael N.
10. Firmung
Hanns C.
11. Kirche
Marliese G.-W.
Guido R.
Friedrich R.
12. Vertrauen
Jörg Wolke: Miteinander
13. Missbrauch
Markus W.
Jürgen Becker: Sagen wir mal so ...
14. Prävention
Anne B.
15. Immobilien
Jannis Butterhof, Carolin Hillenbrand, Thorlak Aretz, Jana Gellissen: La Familia
16. Fußball
Elke M.
17. Klimawandel
Hans-Joachim Höhn: »Entscheidend christlich ist, was alle Menschen verbindet!«
18. Sozialistisch
Adele M.
Helga G.
Margret Sch.
19. Kinderlob
20. Lieblingsbibelgeschichten
Internetadressen, Kontakt und Dank
Vita
Einleitung
Der Clou sind die Waffeln am Stiel.
Jeden Sonntag ist nach der Heiligen Messe, die um 11 Uhr beginnt, Treffen im Kirchencafé und drum herum. Immer gibt es Blechkuchen, den liebe Frauen am Freitag vorher frisch im Konvektomat backen. Kaffee natürlich auch. Und für die Kinder Kakao.
Manchmal gibt es auch Fritten, Pizza oder kleine Würstchen. Besonders beliebt sind allerdings die frischen Waffeln. Spätestens zur Predigt hat der Duft aus den Waffeleisen die ganze Kirche erfüllt, obwohl die Glastür zum Café geschlossen bleibt. Alle freuen sich schon.
Dann und wann machen wir für die Kinder auch Waffeln am Stiel. Dafür haben wir spezielle Waffeleisen besorgt, die vier Holzstiele in vier Herzwaffeln einbacken. Da die Stiele teurer sind als der Teig, erlauben wir uns den Spaß nur hin und wieder.
Ich habe vorgeschlagen, die Kinder doch zu bitten, die Stiele nach Verzehr der Waffel zurückzugeben, und sie dann in der Spülmaschine zu säubern. Das lehnt das Café-Team strikt ab: Was andere im Mund hatten, besonders wenn es aus porösem Holz ist, darf man nicht noch einmal verwenden. Der Stiel ist also eine Stil-Frage.
Wie auch die ganze Waffel. Der Stiel ist für die Kinder wie ein Upgrade: Dadurch wird die Waffel dem Eis am Stiel gleichwertig!
Das bekommen die Kinder im Sommer auch jeden Sonntag. Zum Glück finden sie das bunte Wassereis am besten: Wenn man 200 Stück kauft, kostet so ein Eis tatsächlich nur 6 Cent. Wichtig sind dabei die Farben. Manches Kind überlegt eine ganze Minute lang, welche Farbe es wählen soll. Ältere Kinder sind scharf auf Schwarz, denn darin steckt der Cola-Geschmack.
Die Waffel am Stiel passt zu unserem Stil. Unser Motto stammt von Hilde Domin: »Denn wir essen Brot, aber wir leben vom Glanz.«
Oder einfacher: Wo es arm ist, darf es nicht ärmlich sein.
So erlauben wir uns manchmal den Luxus, die Kinder mit Waffeln am Stiel zu erfreuen. Viele verstehen den Stil und essen die Waffel nicht sogleich, sondern nehmen sie mit nach Hause, um sie anderen Kindern oder Oma und Opa zu zeigen.
1. Gut
»Mir geht es gut. Wenn es den anderen auch gut ginge, ginge es mir noch besser.« Diesen Spruch hörte ich erst kürzlich, er drückt aus, was Solidarität meint. Wie auch der kölsche Satz: »Mer muss och jünne könne«, also den andern etwas gönnen können.
Kinder sind schon mit zwei Jahren solidarisch, wie der Verhaltensforscher Michael Tomasello in jahrzehntelanger Arbeit bewiesen hat. Nicht, um den Eltern zu gefallen – das wäre Darwinismus –, sondern weil es sich über Jahrzehntausende in uns Menschen genetisch entwickelt hat. Wir sind also Im Grunde gut, wie der Bestseller von Rutger Bregman aus dem Jahr 2020 heißt.
Rutger Bregman zeigt auf über 400 Seiten plus mehr als 40 Seiten mit Anmerkungen, dass wir Menschen grundsätzlich zum Guten fähig sind. Da dies auch meine Meinung ist, musste ich das Buch unbedingt lesen. Hier die zwei Geschichten, die mich besonders bewegt haben:
Die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich den Weltbestseller von William Golding. 1954 schrieb er das Buch Der Herr der Fliegen. Darin schildert er die erfundene Geschichte einer Gruppe englischer Internatsschüler, die auf einer Insel stranden und ohne Lehrer überleben sollen. Die Jugendlichen vergessen ihre sehr gute Erziehung. Es wird ein Horrortrip. Der einzige Vernünftige, wegen seiner Körperform Piggy genannt, wird umgebracht, auch andere sterben. Das Feuer, das nie ausgehen soll, erlischt, weil die Nachtwachen pennen. Viele haben das Buch in der Schule gelesen, auch auf Englisch.
Stimmt diese Botschaft: Der Mensch ist des Menschen Wolf, und die dünne Haut der Zivilisation zerreißt ganz schnell? Rutger Bregman erbringt den Gegenbeweis mit einer wahren Geschichte. Er hat die Story recherchiert und zeigt im Buch sogar Fotos von Beteiligten. 1977 sind sechs Jungen in einem Internat auf der Insel Tonga in der Südsee. Ihnen ist langweilig, und sie beschließen, sich einfach ein Boot zum Angeln »auszuleihen«. Sie stechen in See und geraten in ein schweres Unwetter. Nach rund 200 Seemeilen erleiden sie Schiffbruch auf der unbewohnten kleinen Insel Ata. Hier harren sie 16 Monate aus, bis sie gerettet werden. Was geschieht?
Das genaue Gegenteil zum Herrn der Fliegen, die sechs halten zusammen. Sie legen einen Gemüsegarten an, fangen Fische. Einem, der später Ingenieur wird, gelingt es nach einiger Zeit, mit einem Holzstab, den er zwischen den Händen rollt, und sehr trockenem Gras Feuer zu machen. Pfadfinderinnen und Pfadfinder kennen das. Einer bricht sich das Bein, gut geschient wächst es zusammen. Natürlich gibt es auch Krach. Dann machen die sechs, was mich am meisten begeistert: Die Kontrahenten gehen auf die entgegengesetzten Seiten der kleinen Insel und kommen erst wieder zusammen, wenn der Ärger verraucht ist. Im Grunde gut. Die Realität toppt die Fiktion!
Die andere Geschichte, die mich bewegt hat, ist wohl erfunden. Ein Opa sagt zu seinen Enkelsöhnen: »Ihr habt zwei Wölfe in euch, einen guten und einen bösen. Die kämpfen miteinander.« Die Jungs: »Wer gewinnt?« Der Opa: »Der, den du fütterst.« So wünsche ich Ihnen und mir, dass wir den richtigen Wolf füttern. Denn wir sind ja im Grunde gut.
Solidarität kommt vom lateinischen Begriff: »insolidum«, »für das Ganze«. Für das Ganze und den anderen eintreten, für ihn bürgen. Die Bürgin oder der Bürge trägt also die Last der oder des anderen. Die Gesunden die Last der Kranken, die Reichen die Last der Armen.
Es ist auch eine Frage der Solidarität, wie wir mit dem Virus und seinen Risiken umgehen. Hält das soziale Netz? Geben wir den Kranken eine Chance?
Es sieht ja gut aus. Nicht nur unsere Bundeskanzlerin und Gesundheitsminister Spahn beschwören den Zusammenhalt. Auch der Landrat des Kreises Heinsberg, wo die ersten Coranakranken waren, wird als Local Hero, als Held vor Ort, in den Medien gefeiert, weil er die richtigen Worte und Wege fand. Damit stimmt auch das Karnevalsmotto 2020 in Köln: »Et Hätz schleiht em Veedel«, das Herz schlägt im Wohnviertel, lokal.
Was heißt das praktisch? Wer in Quarantäne leben muss, erfährt die Hilfe der Nachbarn. Sie kaufen für ihn ein und stellen die Sachen vor die Tür. Über die sozialen Medien sprechen die Menschen mit den in Quarantäne Lebenden. Oder sie nehmen Kinder auf, die nicht mehr bei ihren Eltern sein sollen, weil die vielleicht infiziert sind.
Der Fantasie der Solidarität sind keine Grenzen gesetzt! Vielleicht spielt jemand Schach über das Internet mit einem Menschen, der zu Hause bleiben muss. Vielleicht liest einer im Internet Geschichten vor für die Kinder, deren Kindergarten geschlossen wurde. Vielleicht kennt jemand Rätsel oder spannende Aufgaben für die Kinder, die nicht in die Schule gehen können. Dies soll nicht den Lehrerinnen und Lehrern vorgreifen, die Aufgaben per Mail stellen. Aber es kann ja die gemeinsame Verantwortung aller in fröhlicher Art ins Wort bringen.
»Et Hätz schleiht em Veedel«. Also birgt die Krise auch eine Chance! Dass wir entdecken, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind.
2. Brot
»Denn wir essen Brot, aber wir leben vom Glanz.« Das Wort aus Hilde Domins Gedicht Die Heiligen ist die Überschrift der ökumenischen und anderer Aktivitäten in unserem leider recht armen Stadtteil Höhenberg/Vingst, kurz »HöVi« genannt, im Osten der Stadt Köln. Wir gehören zum Stadtbezirk Kalk. Der war einmal, zum Ende des 19. Jahrhunderts, für kurze Zeit der größte Industriestandort in Europa. Die Fabriken prägten bis in die 80er-Jahre des 20. Jahrhunderts das Leben der Menschen. Den Älteren sind noch die Namen bekannt: Klöckner-Humboldt, Deutz-Motoren, Ronson-Feuerzeuge, Hagen-Batterien, Fahr-Traktoren, Liesegang. Allein das Kabelwerk in Mülheim hatte mehr als 20 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Heutzutage sind Überseekabel entbehrlich. Die Chemische Fabrik in Kalk hatte noch 1500 Arbeiterinnen und Arbeiter, als ich hier vor dreißig Jahren als Pastor anfing, heute gibt es sie nicht mehr. Insgesamt fielen rund um unseren Stadtteil etwa 60 000 Arbeitsplätze weg.
Damals hatten die Arbeiterinnen und Arbeiter ein gutes Einkommen. Der Kaufhof in Kalk war einmal im Verhältnis zur Verkaufsfläche der umsatzstärkste in Deutschland, auch den gibt es nicht mehr.
Die Straßenbahnen hatten einen speziellen Billigtarif zur Mittagszeit, damit die Frauen ihren Männern das Essen in die Fabriken bringen konnten. Die Firmen stellten keine Kantinen, sondern nur flache Behälter mit heißem Wasser, in die die Ehefrauen die »Henkelmännchen« mit dem Mittagessen stellen konnten. Bevor es die Straßenbahn gab, organisierten die Frauen eine Kutsche, die von Pferden gezogen das Essen transportierte. Summa summarum: eine blühende Arbeiterkultur. Mit viel selbstverständlicher Solidarität. Die Jungsozialisten brachten den Seniorinnen die Kohlen in die Etagenwohnungen. Zum Baden wurde damit der berühmte Kohleofen in runder Form geheizt, der das warme Wasser von unten hochdrückte. Es gibt bei uns eine Museumswohnung, in der man das besichtigen kann, auch die weiße Küche mit dem Kühlschrank, der mit Blockeis betrieben wurde.
Wenn eine Familie in den 50er-Jahren des letzten Jahrhunderts eine Schallplatte kaufte, wurde die natürlich der ganzen Nachbarschaft präsentiert und mehrmals gemeinsam angehört. Wenn ein Fernseher angeschafft wurde, natürlich schwarz-weiß, stand der auch den Nachbarn zur Verfügung. So habe ich meinen ersten Fernsehfilm im Nachbarvorort Mülheim beim übernächsten Nachbarn geschaut: So weit die Füße tragen. Unseren Stadtteil trennt von den ehemaligen Fabriken in Kalk eine breite Eisenbahnstrecke, die im Güterbahnhof Gremberg endet. Zwei lange Unterführungen schaffen die Verbindung. Als es die vielen Fabriken noch gab, standen freitags die Ehefrauen vor der Unterführung, um den Männern die Lohntüten abzunehmen. Das Gehalt wurde damals nämlich noch wöchentlich und in bar ausgezahlt. Etwas durften die Männer behalten, denn hinter den Eisenbahnunterführungen reihten sich die Wirtschaften. Dort durften sie sich dann als Lohn für die harte Arbeitswoche einige Kölsch genehmigen, wie hier das Bier gleichlautend zum Dialekt heißt. Heute gibt es auch die Wirtschaften nicht mehr. Stattdessen sind dort Läden in türkischer Hand. Inzwischen haben 76 Prozent der Kinder bei uns einen Migrationshintergrund, wie man das heute nennt. Was ja okay ist. So läuft eben Segregation.
Warum haben hauptsächlich die Männer in den Fabriken gearbeitet, weniger die Frauen? Es war klar, dass die Männer ihren Ehefrauen gerne sagten: Nun brauchst du nicht mehr arbeiten zu gehen, ich verdiene genug! Du kannst zu Hause bleiben und für ein schönes Familienleben sorgen. Dann machten die Frauen vielleicht noch einen Teilzeitjob. Die Männer arbeiteten durchweg auch am Samstag und machten gerne Überstunden. Das Ziel war, das Geld für einen Volkswagen oder einen Ford zusammenzutragen und dann mal in Urlaub zu fahren.
Die Frauen trafen sich in den Waschhäusern. Es gibt bei uns noch zwei, die inzwischen zu Begegnungsräumen umgebaut wurden. Es gab ja noch keine Waschmaschinen zu Hause; der Werbespruch »Miele, Miele sprach die Tante, die alle Waschmaschinen kannte« zog erst später. Die Waschhäuser waren sozusagen feministische Kommunikationsorte. An jedem Wochentag hatte eine andere Frauengruppe Zugang. Im katholischen Milieu ergänzte die wöchentliche Frauenmesse die segensreiche Funktion der Waschhäuser. Danach war Kaffee und Kuchen im Pfarrheim vorbereitet. Kommunikation pur. Wie weit dieser Austausch zum Frieden in den Familien beigetragen hat, lässt sich kaum ermessen.
In der Arbeiterkultur gab es eine klare Position zur Abtreibung. Als Studenten im Bonner Priesterseminar haben wir jeden Abend eine Demonstration bekocht, die sich gegen die Schließung des Braunkohletagebaus bei Aachen richtete. Als wir eines Tages das Essen brachten und die Kohlefeuer in den Öltonnen brannten, kam die Sprache auf dieses Thema. Die einhellige Meinung war: »Wo fünf Kinder satt werden, reicht es auch für sechs. Notfalls kommt Wasser in die Suppe.« Klartext.
Warum erzähle ich das alles?
Weil ich das Buch von Thomas Ruster gelesen habe: Wandlung. Ein Traktat über Eucharistie und Ökonomie (Matthias Grünewald Verlag 2009). Dahinter vermute ich die Vision einer solidarischen Gesellschaft, wie sie auch Papst Franziskus in seiner Enzyklika Fratelli tutti umtreibt. Und wie die Arbeiter sie lebten. Der erste Satz des Buches lautet: »Nichts deutet auf einen Wandel der Verhältnisse zum Besseren hin.« Das sehe ich allerdings etwas anders und möchte es im Folgenden begründen.
Wahrscheinlich rührt mein Standpunkt auch daher, dass ich mir seit Langem abtrainiert habe, auf das Schlechte zu schauen. Nach dem Motto: Noch nie hat ein gesunder Apfel einen faulen wieder frisch gemacht, immer nur umgekehrt.
So entdecke ich in unserem Veedel, wie ein Stadtteil in Köln heißt, immer noch die Nachwirkungen der alten Arbeiterkultur. Fast immer melden sich mehr Menschen, die mithelfen wollen bei Projekten, als nötig sind. Dies gilt auch für die Bewohner mit Migrationshintergrund! Offensichtlich steckt Solidarität gegenseitig an.
Mich angesteckt hat in Corana-Zeiten die Erkenntnis von Thomas Ruster: »Die katholische Art der Verwandlung von Eigennutz in Güte und Schönheit vollzieht sich im Gottesdienst« (S. 36). Wie Ruster dies im Blick auf das Fronleichnamsfest im Einzelnen entwickelt, ist im Buch zu lesen. Zentral ist die Erkenntnis nach Papst Urban IV. (1261–1264), dass die Speise, die den Tod bringt, verwandelt wird in die Speise, die das Leben bringt, Schönheit, Güte und Glanz. Das Erste, die Speise zum Tod, ist symbolisch die Frucht am »Baum der Erkenntnis«. Davon war es verboten zu essen, und als die Menschen es doch taten, so der biblische Mythos, führte das zum Verlust des Paradieses, zur Mühsal der Arbeit, um sich zu ernähren, und zum Tod. Mich erinnert das an die Menschen, die hart und oft mehr als zumutbar arbeiten müssen, um sich und ihre Familie zu ernähren, und es gibt viele Menschen auf der Erde, bei denen es trotz harter Arbeit nicht für das Notwendige reicht. In Deutschland kennen zum Beispiel viele alleinerziehende und im Niedriglohnsektor berufstätige Mütter diese Klemme. Daneben gibt es Menschen, die sterben den »Tod am Brot allein«. Dorothee Sölle hat das so formuliert und dazu ausgeführt: »Wir atmen noch, konsumieren weiter, wir scheiden aus, wir erledigen, wir produzieren, wir reden noch vor uns hin und leben doch nicht.« Solche Menschen kennen Sie und ich auch, und die Gefahr, so zu leben, vielmehr so zu »sterben«, ist nie weit weg. Und es gibt, zweitens, die Speise, die das Leben bringt. Das ist das Brot der Eucharistie, das Papst Urban IV. meinte. Aber damit ist auch jedes Brot gemeint und alles, das miteinander geteilt wird: das solidarische Brot und das solidarische Leben in Beziehungen.
Ökonomie und Eucharistie sind die Gegensätze.
Ruster ist genauso Kapitalismuskritiker wie Papst Franziskus mit seinem berühmten Wort: »Diese Wirtschaft tötet.« Der Theologe beschreibt die »hässliche Fratze« des Kapitalismus, starker Tobak. Auch in der Form der Sozialen Marktwirtschaft sieht er das Böse am Werk. Für jede Ökonomie, die zum Wachstum verdammt ist, gilt: »Dieses System hindert uns daran, das Böse zu unterlassen« (S. 15). Also resümiert er: »Am Ende steht in jedem Fall die Tatsache, dass Rheinischer Kapitalismus bzw. Soziale Marktwirtschaft in den Zeiten der verschärften Globalisierung ausgespielt haben. An diese Tradition ist nicht mehr anzuknüpfen« (S. 105).
Das sehe ich anders, und zusammen mit anderen habe ich zwei Bücher zum Rheinischen Kapitalismus verfasst. Eins stellt elf Unternehmen vor, in denen Fairness und Orientierung an den Stakeholdern praktiziert und gelebt werden (Kapitalismus, der gut tut. Elf rheinische Wirtschaftsbürger, die mehr machen als Geld, von Franz Meurer und Peter Sprong, Books on Demand 2019). Im anderen Buch ist zu lesen, was den Rheinischen vom Raubtierkapitalismus unterscheidet, den es leider auch gibt (Rheinischer Kapitalismus. Eine Streitschrift für mehr Gerechtigkeit, von Franz Meurer, Jochen Ott und Peter Sprong, Verlag Greven 2014).
Sehr einverstanden bin ich mit der zentralen Bedeutung der Eucharistie bei Ruster. Über die Selbsthingabe Christi schreibt er: »Das Brot, Ausdruck elementarer Selbsterhaltung und Wirtschaftens, wird verwandelt in ein Nahrungsmittel, das nicht mehr aus dem Kampf um knappe Güter hervorgeht« (S. 143).
Ruster schreibt von »Kirche als Gegengesellschaft« (S. 156), sogar von »Kirche als antikapitalistischer Gegengesellschaft« (S. 169). Gemäß dem Wort von Hilde Domin versuchen wir in unserem Viertel mit gut 25 000 Einwohnern etwas davon zu leben. 26 Prozent der Haushalte sind überschuldet, gut 50 Prozent der Kinder arm. Was wir im Einzelnen tun, findet sich im Internet unter www.hoevi.de.
Alles, was irgend geht, findet ökumenisch statt, nach dem Motto: Ökumene ist doppelt so gut und halb so teuer. Das Highlight ist seit 27 Jahren die Kinderstadt im Sommer mit über 600 Pänz, wie die Kinder in Köln heißen. Mit Geld kann man bei uns nichts kaufen. Ein Pfarrfest, bei dem man Essen und Trinken kaufen muss, schließt sofort die Lieblinge Jesu aus, die Armen.
»Wo es arm ist, darf es nicht ärmlich sein.« So waren vor der Weihe der neuerbauten Kirche im Kirchencafé schon die »Mercedesse unter den Kaffeemaschinen« installiert, wie die Menschen stolz feststellen. Im Basement der Kirche befinden sich die Lebensmittelausgabe, eine Fahrradwerkstatt mit über 2000 verschenkten Rädern pro Jahr, Kleiderkammer, Kinderbedarfskammer, Werkstätten. Von all dem habe ich im vorhergehenden Buch Glaube, Gott und Currywurst (Verlag Herder 2020) erzählt.
Zum »Glanz« gehört bei uns aber auch die Fronleichnamsprozession mit dem eucharistischen Brot in der Mitte. Anders als Thomas Ruster sie beschreibt, eine »komische oder bloß folkloristische Vorstellung« (S. 8), ist bei uns die Prozession ein Ereignis, das jedes Jahr Menschen aus der Gemeinde neu gestalten. Die Regenbogenfahne und die Fahne von Maria 2.0 sind neben den anderen selbstverständlich dabei. Die Regenbogenfahne weht auch am Mast vor der Kirche. Wir machen auch multireligiöse Feiern in unserem Viertel, in dem wir Christen nicht mehr die zahlenmäßig größte Religion stellen. Aber gerade die Muslime finden es voll in Ordnung, dass wir Christen wie sie auch die religiösen Feste öffentlich feiern. Nach der Prozession ist natürlich Agape mit Fritten und Pizza.
Thomas Ruster sieht die Problematik der Erstkommunionvorbereitung: »Kaum eine Kommunionkatechese, die darauf verzichtete, die Erfahrung des Mahlens der Körner, des Backens und gemeinsamen Verzehrens symbolisch auszudeuten. Die Gegenwart des Herrn reduziert sich auf den ethischen Impuls, sich der Mahlsymbolik entsprechend zu verhalten« (S. 105). Er schreibt, er wolle dies nicht kritisieren, ich mache es daher.
Vielleicht ist es hier bei uns einfacher, weil die Armut unsere Chance ist. Communio heißt Gemeinschaft. Wir teilen das Brot, denn Teilen macht froh – »in echt«, wie die Pänz bei uns sagen. Kommunion bedeutet: »Ich loss dich nitt em Riss.« Damit öffnet sich der Himmel, denn Auferstehung heißt ja auf Hochdeutsch: »Ich lasse dich nicht hängen.« Im direkten Wortsinn: auch nicht am Kreuz.
Thomas Ruster schreibt, dass es nicht gelingt, »die Kommunionkinder nach der Erstkommunion als Gemeinschaft zusammenzuhalten« (S. 106). Sicherlich nicht nur in den alten Formen, obwohl es bei uns auch Pfadfinder, KJG, Kinderchor und Messdienerinnen gibt. Spätestens in der Kinderstadt im Sommer sind dann allerdings alle dabei. Aber auch das ist nicht das Wichtigste. Aus meiner Sicht ist entscheidend, ob die Kinder spüren, dass die Frucht der Eucharistie die Solidarität ist. Dies nicht im moralischen Sinn, sondern existenziell: Wir Menschen sind aufeinander angewiesen. Weil Gott dabei mitmacht und uns Kraft gibt durch seinen Sohn, können wir uns auf ihn und aufeinander verlassen. Das Wir toppt das Ich.
Ganz praktisch bedeutet das, dass wir dann »in echt« niemanden, der am Fliegenfänger klebt, hängen lassen dürfen, wie man bei uns sagt, wenn jemand ohne Hilfe nicht mehr abheben kann.
Das macht Arbeit, von der ich in diesem Buch erzähle, das ergibt aber auch Sinn, und den kriegen Sie vielleicht auch mit.
Das Buch von Ruster habe ich mit großem Gewinn gelesen. Persönlich würde es mich freuen, wenn der Kapitalismus nach Corona sich so entwickelt, dass Thomas Ruster, wir in HöVi und viele, die Solidarität brauchen, mehr Freude daran finden können. On verra.
3. Vingst
Ab und zu kommen Briefe an mit der Aufschrift »Köln-Pfingst«. Bevor ich hier Pastor wurde, wusste ich auch nicht, dass es ein »Vingst« gibt. Woher kommt der Name dieses Stadtteils?
In einer Urkunde von 1003 wird Vingst als fränkischer Hof der Abtei in Deutz erwähnt. Bis zum Ende des Mittelalters in verschiedenen Schreibweisen: Winshem, Vinzenza, Vinza, Vinx, schließlich Vingst. Ein Forscher vermutet, der Name habe mit Wein zu tun, von dem Lateinischen »vinitor«, Weinbauer. Das wäre allerdings ein saurer Tropfen gewesen!
Den Zugang zur wahrscheinlichsten Herkunft des Namens findet man im Auto. Wenn man von Köln über die A61 nach Koblenz fährt, überquert man die Ahr, dann das Brohltal und bald darauf den Vinxtbach. Er fließt durch ein wunderbares Wacholdergebiet mit den kleinen Dörfern Ober-, Mittel- und Untervinxt. Warum heißt der Bach so? Weil er eine Grenze markiert, nämlich erstens bis heute eine Sprachgrenze, die zwischen mosellanischem und rheinischem Dialekt. Zweitens markiert der Bach in alter Zeit die Grenze zwischen Ober- und Niedergermanien mit den Hauptstädten Trier und Köln.
Also heißt »ad vinxtum«: an der Grenze, am Rand. An welchem Rand liegt denn nun Vingst? Ein Blick auf die Nachbarvororte von Köln weist die Richtung. Da sind Merheim und Heumar. »Mer« und »mar« verweisen auf »Maar« oder »Meer«, also Wasser. Höhenberg als direkter Nachbarvorort zeigt, dass es etwas mit höher und tiefer zu tun hat. Wenn man dann noch weiß, dass bei uns in Vingst die unterste von zwei Parketagen in einem Hochhaus immer unter Wasser steht und nie ein Auto dort parken kann und dass unter der Kreuzung Burgstraße/Olpener Straße ein Pumpwerk arbeitet, dann ist die Lösung nicht mehr weit. Hier verläuft der alte Rheinarm zwischen Porz-Groov und Flittard. Vingst liegt am Rande dieses Rheinarms.
Für die sozialen Räume unter der Kirche St. Theodor ist dies der Kick gewesen. Durch die Sandaufschüttungen des verlandeten Rheinarms liegt die Straße vor der Kirche 1,70 Meter höher als das Niveau hinter der Kirche. So geht es davor sechs Prozent hoch, dahinter sechs Prozent runter, mehr Gefälle ist nicht erlaubt. Dadurch gewinnen wir ein Basement von gut 800 Quadratmetern. Für Fahrradwerkstatt, Kleiderkammer, Lebensmittelausgabe, Werkstätten, Kinderbedarfskammer …
Der Papst sagt, Christen sollten an die Ränder gehen. Wir sind schon dort, sogar im Wortsinn. Vingst: Nomen est omen.
4. Jecken
Das gilt in Köln: »Jeder Jeck is anders«.»Jeck« ist hier natürlich generisch gebraucht. Papst Benedikt ist zwar Bayer, hat aber auch im Rheinland gewirkt als Professor an der Universität Bonn und als Berater von Kardinal Frings. Der war schon fast erblindet und lernte für das Konzil die Reden auswendig, die Ratzinger mit vorbereitete. Vielleicht brachte seine Zeit im Rheinland den späteren Papst dazu, auf die Frage eines Kindes, wie viele Wege zu Gott es denn gebe, zu antworten: »So viele, wie es Menschen gibt.« Jeder Jeck ist eben anders auf seinem Weg zu Gott.
Zur Verstärkung des Gedankens dient noch ein anderer Kölner Spruch: »Jeck loss Jeck elans«, also: Lass die andere oder den anderen seine Eigenart auch leben! Der Rheinländer ist also in den Genen liberal. Da er wie alle Menschen Ebenbild Gottes ist, dehnt er diese Einstellung auch auf Gott aus und ist sich sicher: »Der Herrjott is nit esu.«
Warum verkleidet sich der Rheinländer – wieder generisch gemeint – dann noch zu Karneval? Weil es den Blick weitet, in neue Rollen zu schlüpfen. Und ganz einfach aus »Spaß an der Freud« – die pure Tautologie, aber nicht nur im Karneval eine gute Begründung für manches. Es gibt einen weiteren, tieferen Grund. Für unser Verhältnis zu Gott gilt das Gesetz der Analogie. Das heißt: Jede Aussage über Gott ist ihm unähnlicher als ähnlich! Aha, hört sich kompliziert an, ist aber ganz einfach: Gott begegnet uns immer in Verkleidung, wir erkennen ihn selten oder nie direkt. So sehen wir in Jesus das Bild, die Ikone des unsichtbaren Gottes. Jesus wiederum begegnen wir in den Menschen in Not. »Was ihr diesem Armen, Nackten, Hungrigen … getan habt, habt ihr mir getan.«
Noch tiefer bedenkt es Dietrich Bonhoeffer, wenn er schreibt: »Einen Gott, den es gibt, gibt es nicht.« Oder verständlicher: »Wir leben in dieser Welt ohne Gott vor Gott.« Wir können ihn nicht festhalten oder in Begriffe fassen oder auf einem Video streamen, aber doch »anschauen« – im Gebet, in Menschen in Not. Die Muslime drücken die Unerreichbarkeit Gottes mit dem hundertsten Namen Allahs aus, der unbekannt ist: 99 wissen wir, etwa »der Barmherzige«, aber den wohl entscheidenden hundertsten nicht.
Menschen sind mit dem Bild, das sie auf der Straße, im Beruf und in ihrer freien Zeit abgeben, auch nie hundert Prozent authentisch. Da ist sowieso viel Uniformität dabei, die das Geschlecht, der Berufsstand, die Mode, die Konvention und der jeweilige Anlass vorgeben. Jede und jeder ist und kann auch ganz anders. Und nur in der Verschiedenheit sind alle gleich. Das zeigt der Karneval.
Die Segnung homosexueller Partnerschaften wurde 2021 zum Thema in der Kirche, weil der Vatikan auf eine Anfrage von unbekannter Seite, »Dubium« genannt, verlauten ließ, dies sei nicht erlaubt. Daraufhin zog unser Pfarrgemeinderat sogleich die Regenbogenfahne vor der Kirche auf.
Zur Frage, was denn segensreich sei, kann der Rheinländer, noch immer generisch, Entscheidendes beitragen. Denn er kennt als Heilsmittel nicht nur sieben, sondern zehn Sakramente. Nummer 8 lautet »Bläsiessäje un Äschekrützje« (Blasiussegen und Aschenkreuz). Hier wirft der Rheinländer gleich zwei Sakramentalien in einen Topf. Nummer 9 ist »Tant em Kluster« (eine Tante im Kloster). Wenn die dort intensiv betet, kann man das eigene Gebetsleben entsprechend gering dosieren. Und zehntens »Kreppche luure« (Weihnachtskrippen anschauen). Die stehen im Rheinland nicht nur in den Kirchen, sondern auch in Geschäften, auf den Weihnachtsmärkten und unter freiem Himmel.
Wer jetzt noch nicht genug hat, kann gerne die Palmzweige vom Palmsonntag als Nr. 11 rechnen. Die Nachfrage ist enorm. So haben wir eine kleine Plantage mit Buchsbaum angelegt, um Selbstversorger zu sein. Auf dem Markt ist der Palm teuer! Zum Glück ist unser Buchs noch vom Buchsbaumzünsler verschont geblieben.
Jeder Jeck is anders, das zeigen die in diesem Buch verteilten meist kurzen Texte von Menschen, die sich in HöVi engagieren. Da unser Ansatz im Sozialraum von den Beiträgen der Vielen lebt, wollte ich dies nicht nur beschreiben, sondern auch »Originaltöne« aufnehmen. Deshalb habe ich Menschen gefragt, warum sie mitmachen und was die Bedingungen für das Engagement sind. Die Spanne ist weit: Einer tritt als junger Mensch in die Kirche ein und lässt sich taufen, ein anderer tritt aus und bleibt in der Gemeinde. Ihre Beiträge sind, so haben wir das vereinbart, mit ihrem Vornamen und dem Initial ihres Nachnamens gekennzeichnet. Der evangelische Pastor gehört ja eigentlich auch dazu, aber vereinnahmen wollen wir ihn nicht, also steht sein ganzer Name da. Ebenso beim Beitrag von den jungen Menschen aus einer christlichen Wohngemeinschaft und bei den drei Stimmen, die nicht aus HöVi kommen, die aber solidarisch, kritisch und hilfsbereit dazugehören, gewissermaßen »ehrenhalber«.
Mich freut in den Gemeindestimmen der frohe Grundton, nicht nur beim Veranstalter der Kirmes. Und Humor ist auch dabei.
Martin Buber hat gesagt: »Wenn ein Mensch nur Glauben hat, steht er in Gefahr, bigott zu werden. Hat er nur Humor, läuft er Gefahr, zynisch zu werden. Besitzt er aber Glaube und Humor, dann findet er das richtige Gleichgewicht, mit dem er das Leben bestehen kann.«
Georg K., 59 Jahre:
Mir wurde es quasi in die Wiege gelegt und von meinen Eltern vorgelebt. Meine Eltern, die beide verstorben sind, waren immer im Viertel und in der katholischen Pfarrgemeinde St. Theodor engagiert. Auch die kölschen Gene kamen dabei nicht zu kurz.
Der Kirchenchor St. Theodor führt unsere KiChoThe-Karnevalssitzung seit 1951 mit Künstlern aus den eigenen Reihen und aus dem Viertel durch. Gerne organisiere ich unsere Pfarrsitzung und präsidiere dieser gemeinsam mit meiner Schwester Gabi.
Ebenso präsentieren wir eine kleine Ausgabe unserer Sitzung montags in der Karnevalswoche im Altenclub, dem Seniorencafé unserer Gemeinde. Hier erfahre ich immer wieder, wie dankbar und erfreut unsere älteren Mitbürger darüber sind. Manchmal erfahre ich dies erst später, wenn sie mich zum Beispiel beim Einkaufen ansprechen: »Et wor widder schön, hatt ihr joot jemaht. Mer hatten widder ne Püngel Freud.«