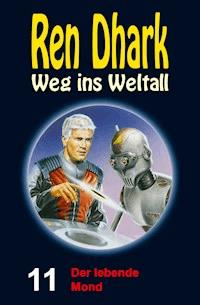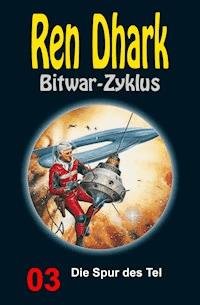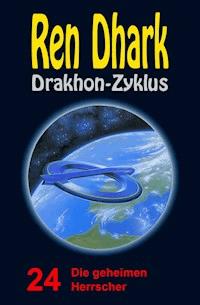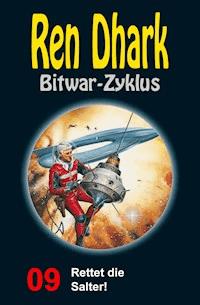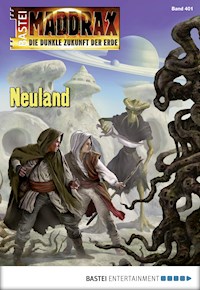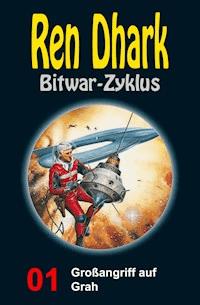Wer einst die Menschheit beerbt: Science Fiction Fantasy Großband 3 Romane 7/2022 E-Book
Jo Zybell
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CassiopeiaPress
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Dieser Band enthält folgende SF-Romane (XXX) von Jo Zybell: Lennox und die Erbe der Menschheit Lennox und der Barbar Lennox und der Aufbruch in die NEUE WELT Eine kosmische Katastrophe hat die Erde heimgesucht. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Die Überlebenden müssen um ihre Existenz kämpfen, bizarre Geschöpfe sind durch die Launen der Evolution entstanden oder von den Sternen gekommen und das dunkle Zeitalter hat begonnen. In dieser finsteren Zukunft bricht Timothy Lennox zu einer Odyssee auf …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 568
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jo Zybell
Inhaltsverzeichnis
Wer einst die Menschheit beerbt: Science Fiction Fantasy Großband 3 Romane 7/2022
Copyright
Lennox und die Erben der Menschheit: Das Zeitalter des Kometen #6
Copyright
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Lennox und der Barbar
Lennox und der Aufbruch in die „Neue Welt“
Wer einst die Menschheit beerbt: Science Fiction Fantasy Großband 3 Romane 7/2022
Jo Zybell
Dieser Band enthält folgende SF-Romane
von Jo Zybell:
Lennox und die Erbe der Menschheit
Lennox und der Barbar
Lennox und der Aufbruch in die NEUE WELT
Eine kosmische Katastrophe hat die Erde heimgesucht. Die Welt ist nicht mehr so, wie sie einmal war. Die Überlebenden müssen um ihre Existenz kämpfen, bizarre Geschöpfe sind durch die Launen der Evolution entstanden oder von den Sternen gekommen und das dunkle Zeitalter hat begonnen.
In dieser finsteren Zukunft bricht Timothy Lennox zu einer Odyssee auf …
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author / COVER LUDGER OTTEN
© dieser Ausgabe 2022 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Lennox und die Erben der Menschheit: Das Zeitalter des Kometen #6
von Jo Zybell
Der Umfang dieses Buchs entspricht 142 Taschenbuchseiten.
Auf der Erde hat ein Kometeneinschlag die Zivilisation vernichtet. Tim Lennox und seine Gefährten müssen um ihr Überleben kämpfen.
Die wenigen Einwohner der Communities London und Salisbury kämpfen um ihr Überleben und betrachten Tim Lennox als willkommene Verstärkung, auch wenn Marrela nur unter Misstrauen akzeptiert wird. Er stellt verblüfft fest, dass der technische Fortschritt regelrechte Quantensprünge gemacht hat. Doch ein Angriff der bestens ausgerüsteten Nordmänner stellt die Bevölkerung vor große Probleme. Was nutzen gute Waffen, wenn es nicht genug Leute gibt, sie zu bedienen?
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author /COVER LUDGER OTTEN
© dieser Ausgabe 2019 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen in Arrangement mit der Edition Bärenklau, herausgegeben von Jörg Martin Munsonius.
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Twitter
https//twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags geht es hier
https//cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
1
Ein Tier schrie anders. Nicht so gellend, nicht so lang anhaltend. Das waren die Schreie eines Menschen in Todesnot!
Im Laufschritt pflügte Fanlur durch das Schilf. Bis über die Knöchel versanken seine Stiefel im sumpfigen Boden. Wulf setzte in weiten Sprüngen an ihm vorbei. Bald sah Fanlur nicht einmal mehr den weißen Schweif seines Lupas vor sich.
Schlagartig lichtete sich das mannshohe Schilf, und Fanlur stand bis zu den Knien im Uferwasser. Am anderen Ufer der Themse ragten Ruinentürme auf, und mitten im Fluss erhob sich das Skelett eines Brückenfragments. Gut dreißig Schritte vom Ufer entfernt sah er Wulfs weißes Fell – er schwamm auf ein Kanu in der Flussmitte zu. Einer der drei Menschen darin war es, der so panisch schrie.
Fanlur setzte sein Binokular an die Augen. Der Schreihals war ein Junge, fünf oder sechs Jahre alt. Und er hatte Grund zu schreien: Der Fluss entlang des Bootsrandes schien zu brodeln. Wasser spritzte, Fontänen schossen in die Luft, massige dunkle Körper wurden für Augenblicke sichtbar; Reptilien, Fische – Fanlur konnte es nicht erkennen, zu blitzartig tauchten sie aus den Fluten auf, zu schnell verschwanden sie wieder darin. Zwei Männer versuchten den Angriff abzuwehren. Der eine stand aufrecht am Bug und stach mit einem Speer ins Wasser, der andere kniete im Kanu und schwang ein kurzstieliges Beil.
„Zurück!“, brüllte Fanlur dem Lupa hinterher. Er zoomte die Szene heran. Der Junge kauerte im Heck des Kanus, die Schultern hochgezogen, Knie und Schenkel gegen die Brust gepresst, die Hände auf den Wangen, als wollte er seine verzweifelten Schreie festhalten.
Die Männer waren in hellbraune Wildlederwesten gehüllt. Ihr zu Zöpfen geflochtenes Langhaar flatterte um bärtige Gesichter, während sie nach den rätselhaften Angreifern stachen oder hieben.
Etwas schoss aus dem Wasser, schlang sich um die Hand des Beilkämpfers und riss ihn auf den Bootsrand herab. Vergeblich versuchte er seinen Arm von der Schlinge zu befreien – das klebrige rote, riemenartige Ding zog sich nur noch fester zusammen. Dann schnellten zwei Hände aus dem Fluss – schmutzig-grün und Schwimmhäute zwischen den langen Fingern –, fuhren in die Haare des armen Kerls und zerrten ihn ins Wasser. Das Kanu drohte zu kentern. Die Schreie des Jungen schraubten sich in höchste Tonlagen.
Dann eine Wasserfontäne, ein schmutzig-grüner Körper sprang mitten ins Kanu, groß wie Fanlurs Lupa – eine Riesenkröte! Fanlur ließ das Binokular los und riss seinen Laserbeamer von der Schulter. Der Lupa war noch etwas mehr als einen Speerwurf weit vom Boot entfernt. Gleißend weiß schoss der Zielstrahl über das Wasser und erfasste die Kröte. Dann der Blitz der Energiekaskade aus dem unteren Lauf. Eine zweite, glühende Haut schien um das Tier zu wachsen; es schwoll an, sein Körper warf Blasen, und endlich zerplatzte es. Teile seines kochenden Gewebes zischten, eine Rauchwolke hinter sich herziehend, durch die Luft und klatschten ins Wasser.
Der Junge verstummte. Der Schock schien ihm den Atem zu rauben; wie erfroren hockte er im Heck des Kanus. Sein Begleiter stieß den Speer rechts und links des Bootes ins brodelnde Wasser. Hinter ihm klammerten sich amphibische Pranken am Bootsrand fest, ein platter schwarz-grüner Krötenkopf schnellte aus dem Fluss, etwas Rotes, Schmales schoss aus seinem Maul – eine Zunge. Fanlur drückte den Knopf für die Laseroptik, doch bevor der dünne Zielstrahl den Kopf der Kröte erfasste, tauchte die Bestie wieder unter – und zog den zweiten Mann in den Fluss. So schnell, dass er kaum zum Schreien kam.
„Wulf! Bleib dem Boot fern!“, brüllte Fanlur. Doch der Lupa schien ihn nicht zu hören. Zielstrebig schwamm er dem Kanu entgegen. Der Jagdtrieb beherrschte ihn, und die Gewohnheit, kleine und geschwächte Menschen zu beschützen. Das hatte Fanlur ihm antrainiert – jetzt würde es den Lupa womöglich das Leben kosten.
Wieder begann der Junge zu schreien. Das Kanu schaukelte hin und her. Einen Wasserschleier mit sich reißend, sprang eine besonders große Kröte ins Boot. Sie überragte den Jungen um mehr als eine Elle. Fanlur reagierte blitzschnell: Zielstrahl, Abzugstaste, Energieblitz – die Kröte quoll auf und zerplatzte.
Doch sofort griffen zwei Paar Schwimmklauen aus den Fluten nach dem Bootsrand. Sie rüttelten an dem Kanu
Sind sie intelligent?, schoss es Fanlur durch den Kopf. Es sah tatsächlich so aus, als wollten sie gezielt das Kanu zum Kentern bringen. Er legte die Waffe an und schätzte gleichzeitig die Entfernung zwischen Wulf und dem Boot – weniger als zwanzig Meter. Außer den beiden Kröten am Bootsrand waren keine weiteren Angreifer mehr zu sehen.
Der Ziellaser bohrte sich ins Wasser, eine der Kröten glühte auf und platzte. Die zweite ließ los und tauchte ab.
„Nimm das Paddel!“, rief Fanlur. „Nimm das Paddel, und versuch hierher ins Schilf zu kommen!“ Der Junge reagierte nicht, obwohl Fanlur die englische Sprache benutzte. Er wusste, dass die Stämme in den Ruinen Londons Hoch-Englisch zumindest teilweise verstanden.
Er verlegte sich auf Gesten und winkte den Jungen heran. Endlich beugte sich dessen kleiner Körper ins Kanu hinein und tauchte mit einem Paddel wieder auf. Es war fast doppelt so lang wie er selbst. Kaum konnte er es halten – trotzdem gelang es ihm, das Kanu zu drehen. Bug voran nahm es Fahrt auf. Wulf schwamm noch dreißig Schritte entfernt und näherte sich dem Jungen rasch.
Plötzlich begann das Kanu zu schwanken. Fanlur musste das Binokular ansetzen, um die Krötenpfoten hinter dem Jungen am Heckrand zu entdecken. Als wollte sie das Kanu zwischen sich und Fanlur bringen, griff die Bestie von hinten an. Fanlur ließ den Laserbeamer sinken – zu gefährlich; der Junge befand sich direkt in der Schussbahn.
Das Boot neigte sich gefährlich zur Seite. Der Junge ließ das Paddel los. Schreiend stürzte er in den Fluss, tauchte unter, tauchte auf, verschwand erneut unter Wasser, und dann war der Lupa bei ihm. Er schwamm an seiner Seite, und der Junge griff in sein langes Zottelfell. Die Wasseroberfläche wölbte sich, untertassengroße Augen wurden sichtbar, ein flacher Kopf, ein breites Maul, das sich öffnete und dem Lupa die rote Zunge entgegenschleuderte.
Fanlur riss den Laserbeamer hoch – doch zu spät: Die Zunge schlang sich um Wulfs Nacken. Wieder erklangen die Schreie des Jungen, kläglicher diesmal und unterbrochen von Prusten und Keuchen – es gelang ihm kaum noch, sich über Wasser zu halten.
Wulfs Kopf fuhr herum, und sein Raubtiergebiss schnappte nach der Zunge. Er biss sie glatt durch. Wulf setzte nach, erwischte das Biest im kurzen Nacken. Er und die Kröte versanken in den Fluten. Der Junge schlug mit den Armen um sich und drohte jeden Moment abzusaufen. Fanlur war zum Zuschauen verurteilt – er konnte weiter nichts tun, als den Ziellaser um den zappelnden Jungen kreisen zu lassen – für den Fall, dass Wulf den Kampf verlor oder dass sich weitere Kröten näherten.
Doch die Fänge des Lupas gaben die Kröte nicht mehr frei. Ihr großer Körper hüpfte im Wasser auf und ab – Fanlur konnte die langen dunkelgrünen Beine und die flossenförmigen Füße sehen. Sie zerrte an Wulfs Fell, stemmte sich mit den Flossen gegen seine Flanken, ihr breites Maul öffnete und schloss sich, schnappend zunächst, und dann immer träger und seltener, und ihre Bewegungen wurden schwächer und schwächer. Schließlich erschlaffte sie ganz.
Der Lupa ließ den Kadaver los und schwamm zu dem Jungen. Der schlang beide Arme um Wulfs Hals. Nach ein paar vergeblichen Versuchen schaffte er es, sich halb auf den Rücken des mutierten Wolfs zu schieben. Viel mehr als Ohren und Schnauzenspitze sah Fanlur nicht von seinem Gefährten, als der den Jungen in Richtung Schilf trug.
Fanlur schulterte den Laserbeamer und watete durchs seichte Uferwasser, bis es ihm bis zu den Hüften reichte. Fast doppelt so lange brauchte der Lupa für den Rückweg. Aber Fanlur wusste, dass er es schaffen würde.
Auch ihn selbst hatte der Lupa drei Tage zuvor an ein rettendes Ufer gezogen. An die Südküste Britanas. Eine gewaltige Flotte der Nordmänner hatte seinen Steamer beschossen und vermutlich versenkt. Fanlur war überzeugt davon, dass seine Gefährten längst tot waren. Zwei waren vor seinen Augen von detonierenden Kanonenkugeln zerfetzt worden. Von der Steilküste aus hatte Fanlur gesehen, wie die Nordmänner den havarierten Steamer geentert hatten. Er kannte das Mordvolk aus dem Norden: Sie pflegten keine Gefangenen zu machen. Sie nannten sich selbst Disuuslachter – Götterschlächter.
Der Lupa näherte sich seinem Herrn. „Tapfer, mein Freund“, lobte Fanlur. Er griff nach dem Jungen und nahm Wulf die Last ab. In großen Sprüngen legte der Lupa die letzten Schritte zurück. Sein langes Fell war schwer von Wasser. An Land schüttelte er es aus.
Fanlur trug den entkräfteten Körper des Jungen bis zum Waldrand. Dort legte er ihn ins Gras. „Wie heißt du?“, fragte er ihn. Nur ein undeutliches Krächzen drang aus dem kleinen Mund.
Fanlur ließ ihm Zeit. Er setzte sich neben ihn und zog ihm die nasse Lederkutte aus. Der schmächtige Körper bibberte. Fanlur streifte seine braune Lederweste ab, zog sein graues Hemd aus und hüllte das Kerlchen in den trockenen Leinenstoff. „Verschnauf erst einmal.“
Es dauerte seine Zeit, aber bald kam der Junge wieder zu Kräften. Zaghaft streckten sich seine Ärmchen aus, um Fanlurs Laserbeamer zu betasten. „’n Feuawoa“, krächzte er ehrfürchtig. „Bisse vonne Maulwöafe?“
„Gibt’s hier Maulwürfe mit Feuerrohren?“, lächelte Fanlur. Dann begriff er: Der Junge sprach von den Technos. „Ich bin ein Freund von ihnen“, sagte er schließlich. Keine leicht verdauliche Auskunft für den Knaben. Er machte ängstliche Augen und rückte sogar ein Stück von dem großen weißhäutigen Mann mit dem langen Grauhaar ab.
Fanlur wusste, dass der Junge zu den Barbaren gehörte, die in den Ruinen Landáns lebten. Allein die Tatsache, ihn und seine Begleiter hier an der Themse zu finden, sprach dafür. Und dann noch die gelbliche Haut und das verwaschene Englisch des Kerlchens – es war die Sprache der Socks. Oder der „Lords“, wie die Barbaren von Landán sich selbst nannten. Oder nein – „Loads“ nannten sie sich, um ganz genau zu sein: Sie konnten kein „R“ aussprechen.
Fanlur hatte seine Kindheit in Britana verbracht. Vier Tagesmärsche weiter südwestlich zwar, aber er war in jenen Jahren zweimal in den Ruinen von Landán gewesen.
„Dankdankdank“, murmelte der Junge. Er richtete sich auf und legte seine Händchen auf Fanlurs Brust.
„Wie heißt du, mein Junge?“
„Djeff.“ Wieder hingen seine Augen am Laserbeamer. „Kwötschis sinne volle platzt.“
„Kwötschis?“ Fanlur kannte den Begriff nicht. „Nennt ihr die Riesenkröten so?“ Der Junge nickte. „Die Männer, die von den Kwötschis getötet wurden – war dein Vater dabei?“
Der Junge schüttelte den Kopf. „Wa’ne Littload unne Simpload. Mein Vadde hätte Kwötschis plattemacht.“ Er richtete sich auf. Stolz drückte er seine schmächtige Brust heraus und hob den Kopf. „Mein Vadde isse Gwanload Pöacival.“ Erwartungsvoll blickte er in die roten Augen des weißhäutigen Mannes mit den langen weißgrauen Haaren.
„Was du nicht sagst …“ Fanlurs weiße Brauen wanderten nach oben. Von seinem eigenen Vater wusste er ein wenig Bescheid über die Lords. Ihre Stämme – drei oder vier lebten in der großen Ruinenregion Landáns – waren streng hierarchisch geordnet. Ein Grandlord führte den Stamm, unter ihm ein paar sogenannte Biglords, und dann eben die Simplords und Littlords, die der Kleine erwähnt hatte. Frauen rangierten knapp über Frekkeuschern und Wakudas.
„Ein Sohn des Grandlords also“, murmelte Fanlur. „Und darauf bist du mächtig stolz, was?“ Der Junge nickte heftig. Fanlur schmunzelte. Die Socks waren nicht nur rohe und gefährliche, sondern auch mächtig stolze Burschen. Schon ihre Knirpse infizierten sie mit ihrem Dünkel. Vermutlich hielten sie sich für die Krone der Schöpfung. „Und wo lebt deine Sippe?“
„Landán-Tschelsi“, sagte der Junge.
Fanlur stand auf. „Dann los, Djeff – ich bringe dich zu deinem Vater.“ Er deutete auf Wulf. „Du darfst auf meinem Lupa reiten.“
Ein Strahlen ging über das erschöpfte Jungengesicht. Er stand auf und klammerte sich im Zottelfell des Wolfes fest. Sie hatten annähernd gleiche Schulterhöhe, und Djeff benötigte zwei Anläufe, bis er endlich auf dem Rücken des Lupas saß. Sie brachen auf. Fanlur ging voraus. „Mein Vadde wiadia gwoße Schenke mache, weile mich gewettet has“, krähte Djeff hinter ihm.
„Da bin ich mir nicht so sicher.“ Fanlur folgte einem ausgetretenen Uferpfad. „Einem Boten, der schlechte Nachrichten bringt, macht man keine Geschenke.“
„Schlächde Nachwichde?“
„Ja.“ Das Schilf lichtete sich, der Blick auf die Brückenruine wurde frei. Ein schwarz-grüner Schleier von Schlingpflanzen hing von überwucherten Stahlträgern ins Wasser hinab. „Ich komme von der Küste – dort sah ich viele Schiffe eines grausamen Volkes.“ Zwei große Rabenvögel kreisten in Ufernähe über der Themse. Kolks – sie begleiteten Fanlur, seit er sich vor drei Tagen auf die Steilküste gerettet hatte. „Es wird Krieg geben.“
2
Wellen bäumten sich auf und warfen sich auf den weißen Strand. Das Meer glitzerte türkisfarben. Hoch im Zenit des blauen Himmels glühte die Sonne. Ihr Lichtschimmer funkelte in der Brandung. In der Ferne war ein Korallenriff zu erkennen, das sich weit in den Ozean hineinstreckte. Gischt schäumte, wenn die Wogen sich dagegen warfen.
Links des Sandstrands lag eine Düne. Und hinter ihr der Hang eines bewaldeten Bergrückens. Erst sanft, dann immer steiler stieg er an und gipfelte schließlich, weit entfernt, in einen Vulkankegel.
Rechts säumten lange Palmen mit gebogenen Stämmen den Strand. Die Büsche zwischen ihnen hingen voll mit trichterförmigen roten und weißen Blüten. Wenn man den Blick vom Strand weg ins Innere der Insel richtete, sah man auf die weit ausladende Krone eines Baumes. Blaue und grüne Papageien flatterten im Geäst herum. Leise Musik perlte von irgendwoher – Harfenakkorde und eine Flöte. Sonst war nichts zu hören – kein Papageiengeschrei, nicht das Rauschen des Windes in den Palmen, keine Brandung.
Nur die Stimme eines Mannes noch. Eine tiefe, volltönende Stimme. Gesicht und Oberkörper waren inmitten der Palmenkronen zu sehen, umgeben von einem hellgrünen Rechteck und übergroß. Ein hartes, ernstes Gesicht. Der Mann, dem es gehörte, trug ein bordeauxrotes weites Jackett und darunter ein schwarzes Hemd.
Inmitten des Strandpanoramas stand ein runder gläserner Tisch, hellblau und mit sechs breiten S-förmigen Beinen. Drei Männer und drei Frauen saßen um ihn herum auf Stühlen aus ebenfalls blauem Glas. Das Kunstleder der runden Sitzflächen und Lehnen glänzte in einer Farbe, die dem Türkis des Meeres entsprach. Drei Stühle waren unbesetzt. Einer davon hatte eine höhere Rückenlehne und war größer als die anderen.
Die sechs Männer und Frauen trugen weite Jacken und Hosen, cremefarben zumeist, nur eine der Frauen hatte sich in einen schneeweißen langen Mantel mit rüschenbesetzten Kragenaufschläge gehüllt. Alle blickten sie auf den Monitor in der Glaswand des Kuppelsaales.
„Ich habe die Bilder gesehen“, sagte der Mann auf dem Monitor. Sein kantiges Gesicht war schneeweiß. Tiefe Furchen querten die Stirn und durchzogen es von den Nasenflügeln bis zu den herabgezogenen Mundwinkeln. Dicke tiefblaue Adern überzogen seinen perückenlosen Schädel. „Ja, es ist mein Sohn, den unsere Späher entdeckt haben. Aber ich kann nicht verstehen, dass er zu Fuß am Themseufer entlang marschiert.“ Die stechenden roten Augen lagen tief in ihren Höhlen. Augen, die viel gesehen hatten. „Er hatte mir angekündigt, mit einem Schiff kommen zu wollen.“
Hin und wieder zitterte das Bild ein wenig. Manchmal entfärbte es sich und die tiefe Männerstimme verwandelte sich kurzzeitig in verzerrte Vibrationen, als würde man eine Stahlsaite anschlagen. Die Funkverbindung zwischen der Community London und der Community Salisbury litt unter der CF-Strahlung. Eine weltweite Strahlung, wie die Ingenieure der Communities annahmen. Ihre Hauptquelle lag in den Weiten Asiens. Doch viel mehr noch litt die externe Kommunikation der Community London unter der Störstrahlung aus dem Einschlagskrater in der ehemaligen City, wo ein Trümmerstück „Alexander-Jonathans“ niedergegangen war.
„Er wollte mit einem Schiff kommen?“ Eine der Frauen am runden Tisch machte ein erstauntes Gesicht. „Woher wissen Sie das, Sir Gabriel?“
Mit ihren achtundsiebzig Jahren war Valery Heath die Jüngste im Kuppelsaal. Die Mehrzahl der Octaviatsmitglieder hatte die Hundertzwanzig längst überschritten. Sie trug eine Perücke aus langem blonden Haar. Ihre Haut war bleich, aber nicht weiß, ihre Augen von einem samtenen Braun. Valery Heath war Octavian für Außenbeziehungen. Deswegen leitete sie das Gespräch mit dem Botschafter von Salisbury.
„Ich stehe durch einen Späher in Kontakt mit ihm“, sagte Leonard Gabriel. „Nachdem er mir auf diesem Wege von jenem rätselhaften Jetpiloten berichtet hatte, bat ich ihn nach Britana zu kommen, um diesen Tinnox mit einer unserer Communities in Kontakt zu bringen.“
„Das hatten wir miteinander beschlossen“, bestätigte Valery Heath. „Nicht zuletzt, weil wir uns Sorgen um den Mann machten – der Socks wegen. Eine berechtigte Sorge, wie sich gezeigt hat. Aber dass Ihr Sohn mit einem Schiff kommen wollte, ist mir neu.“
„Ein Segelschiff?“, erkundigte sich ein kleiner rundlicher Mann mit schwarzer Hautfarbe. Ibrahim Fahkas Vorfahren stammten aus Ostafrika. Er vertrat als Octavian die Interessen der Ingenieurskaste in der Community-Regierung.
„Fanlur besitzt einen kleinen Raddampfer, ein sehr altes Fahrzeug allerdings. Ich hoffe sehr, es hat keinen Schiffbruch erlitten.“
„Selbst wenn, Sir Gabriel“, ergriff Valery Heath wieder das Wort. „Sie haben die Aufnahmen gesehen – Ihr Sohn ist wohlauf.“
„Ja, dem Himmel sei Dank. Nur …“ Gabriel zögerte und senkte den Blick.
Heath runzelte die Stirn. Sie kannte Gabriel gut. Schon als sie noch ein kleines Mädchen und er noch Octavian gewesen war, hatte sie mit ihm zu tun gehabt. Manchmal glaubte sie seine Gedanken lesen zu können. Schlagartig wurde ihr klar, dass er den wahren Grund seiner heutigen Kontaktaufnahme noch gar nicht genannt hatte.
Gabriel hob den Kopf. Seine Stimme klang leiser, als er fortfuhr. „Er wollte uns etwas mitbringen, Ladies und Gentlemen. Etwas sehr Wichtiges.“
„Werden Sie deutlicher, Botschafter!“ Eine schroffe Frauenstimme meldete sich zu Wort. Die Frau in dem weißen Mantelkleid, Josephine Warrington, die Prime der Community London, die Vorsitzende des Octaviats. Blauschwarzes steifes Haar rahmte ihr breites Gesicht ein, eine Perücke natürlich. Ihre Haut wirkte grau. Ein unwilliger Zug lag um ihre dunklen Augen. „Was hatte Ihr Sohn so Wichtiges an Bord?“
„Darüber Auskunft zu geben überschreitet die Grenzen meines Mandats, Lady Prime“, sagte Gabriel steif. „Ich erlaube mir, unseren Prime um das Wort zu bitten.“
Das Bild verblasste und baute sich gleich darauf wieder auf. Ein anderer Mann erschien vor der Kulisse sattgrüner Weiden, auf denen Vieh graste. Die Landschaft war unschwer als eine irische Flussebene zu erkennen. Der Mann, der diese Kulisse bevorzugte, hieß James Dubliner – er war der Prime der Community Salisbury. „Ich begrüße Sie, Ladies und Gentlemen!“ Er sprach schnell und mit hoher Stimme. Von kleiner drahtiger Gestalt und mit hellwachen grauen Augen, wirkte er straff und kraftvoll, obwohl sein gelbliches, lederhäutiges Gesicht alt aussah. Fast so alt, wie er tatsächlich war: einhundertdreiundsiebzig Jahre. Er war in einen schwarzen Umhang gehüllt. „Ich mache es kurz: Sir Gabriels Sohn hatte einen CF-Kristall an Bord.“
„Waas?“, schrie der Wissenschafts-Octavian und schlug auf den Tisch. Bis auf die Prime sprang das gesamte anwesende Octaviat Londons von den Stühlen.
„Wir hätten Sie zu gegebener Zeit informiert“, schnarrte Dubliner. Anders als in London, wo der König ein Vetorecht hatte und Octaviats-Sitzungen leiten konnte, verkörperte der Prime im wesentlich hierarchischer organisierten Salisbury die oberste Regierungsinstanz. Dubliner war der Chef der kleinen Community. Seine Pläne und Anordnungen konnten nur durch eindeutige Mehrheiten in geheimen Octaviats-Abstimmungen blockiert werden. Dubliner, ein mit allen Wassern gewaschener Fuchs, wusste solche Abstimmungen in der Regel zu verhindern. „Wir wollten das Objekt erst einmal in unserem Speziallabor untersuchen, um ganz sicher zu gehen, dass es sich wirklich um einen CF-Kristall handelt.“
„Unsere Verträge sehen vor, dass schon bei Verdacht auf einen CF-Kristall Informationspflicht besteht!“, protestierte Valery Heath.
„Über die Feinheiten der Vertragsinterpretation verständigen Sie sich bitte mit meinem Octavian für externe Angelegenheiten und mit Botschafter Gabriel, Lady Heath“, sagte der Prime kühl. „Mir scheint, dass wir im Moment dringendere Probleme haben. Wenn unser V-Mann wirklich einen CF-Kristall an Bord hatte, sollten wir wissen, wo er geblieben ist. Ich beantrage hiermit in aller Form Nachbarschaftshilfe. Nehmen Sie Kontakt mit dem Sohn unseres Botschafters auf und sorgen Sie dafür, dass er möglichst schnell nach Salisbury gebracht wird.“
„Wir werden darüber beraten, Sir Dubliner“, sagte Josephine Warrington schroff.
„Ich habe vollstes Vertrauen zu Ihnen, Lady Prime.“ Dubliner deutete eine Verbeugung an, der Bildschirm verblasste, das Rechteck in der Glaskuppelwand füllte sich mit blauem Himmel.
Nacheinander setzten sich die Octaviane wieder.
„Ungeheuerlich!“ Noch einmal schlug Anthony Hawkins, der Octavian für Wissenschaft und Forschung, mit der flachen Hand auf den Glastisch. „Hat einen Kristall gefunden und informiert uns nicht!“
„Er hätte uns noch informiert – ich glaube ihm“, meldete sich die dritte Frau im Kuppelsaal zu Wort. „Dubliner ist zuverlässig. Das hat er in den fünfundfünfzig Jahren, in denen er Prime ist, bewiesen.“ Die Frau trug eine rote Perücke und war auffällig dünn und groß. Rose McMillan – die Verantwortung für Frauen, Kinder und Fortpflanzung lag in ihren Händen. „Er pflegt sich an Vereinbarungen zu halten.“
„Ich schließe mich Ihrer Meinung an, Rose – Dubliner hätte uns vertragsgemäß an den Untersuchungen des Kristalls teilhaben lassen.“ Josephine Warrington lehnte sich zurück und faltete ihre grauen Hände vor sich auf dem Tisch. „Was machen wir mit seinem Antrag?“
„Vorschlag“, sagte Heath. „Wir schicken dem V-Mann einen EWAT entgegen, bringen ihn in einen der septischen Außenräume der Westminster Hall und vernehmen ihn dort. Danach entscheiden wir, ob wir ihn nach Salisbury bringen oder allein seine Wege ziehen lassen.“
„Hat jemand ein Argument gegen diesen Vorschlag?“ Warrington blickte sich in der Runde um. Niemand meldete sich zu Wort. „Dann warten wir, bis der General zurück ist – ich will, dass er den Einsatz persönlich leitet.“
Der Großbildmonitor in den Palmen flammte auf. Ein braungebrannter, nur mit einem weißen Lendentuch bekleideter Mann wurde sichtbar. Kräftige Muskelstränge überzogen seinen Körper. Schwarze drahtige Locken wucherten auf seinem Quadratschädel. Der persönliche E-Butler der Prime.
„Was gibt es, Herkules?“, fragte Warrington.
„Entschuldige die Störung, Josey, aber das Hauptportal meldet eben die Rückkehr des königlichen EWATs.“
„Dann sei so freundlich und verbinde uns mit dem Pforten-Butler. Und mach die Musik aus.“
Der halbnackte Adonis trat zurück und verschwand hinter dem rechten Bildschirmrand. Der Außenbereich vor dem Hauptportal wurde eingeblendet.
„Und nun, Ladies und Gentlemen, wird es spannend.“ Die Stimme der Prime klang jetzt verschwörerisch. „Sehen Sie sich den Mann gut an. Wenn sich die Gerüchte bestätigen, die Gabriel aus Köln hörte, dann könnte dieser Tinnox unser Mann sein.“
„Ich werde ihn mit Argusaugen betrachten“, sagte Hawkins. „Verlassen Sie sich darauf, Lady Prime.“
„Ich halte diese Geschichten nach wie vor für Märchen!“ Ibrahim Fahka blies verächtlich die Wangen auf. „Ein Jet des 21. Jahrhunderts! Eine Faustfeuerwaffe! Ich kann’s nicht glauben!“
„Lassen wir uns überraschen.“ Josephine Warrington wandte sich dem Monitor im Südsee-Panorama zu. Alle taten das. Gespannte Stille hing über dem runden Tisch unter der Glaskuppel. Die Musik verstummte.
Ein weitgehend freies, mit niedrigen Sträuchern bewachsenes Feld wurde auf dem Monitor sichtbar. Links dahinter die Trümmer ehemaliger Ministerien. Rechts ein leidlich von Gestrüpp freigehaltener Säulengang, darüber das schwarze Gemäuer einer eingebrochenen Fassade, und dann die jämmerlichen Reste Big Bens, über und über mit Efeu bedeckt.
Ein EWAT rollte den Betrachtern entgegen. Er passierte die Ruine Big Bens und den Säulengang. Das viergliedrige Fahrzeug bestand größtenteils aus einer molekularverdichteten Teflon-Carbonat-Legierung. Ein mattes dunkles Grün überzog die Raupe – nur die Ketten und die Frontkuppel waren tiefschwarz. Man konnte keine Personen in der Kommandozentrale erkennen; nur von innen war die Kuppel durchsichtig.
Die Maße des königlichen EWATs wichen von denen der restlichen Flotte ab: Das Steuersegment des Tanks war zwei Meter länger, was dem Earth-Water-Air-Tank eine Gesamtlänge von zweiundzwanzig Metern verlieh. Auch war König Rogers Tank nicht drei, sondern dreieinhalb Meter breit und mit seinen drei Metern Höhe um einen halben Meter höher als die Standardmodelle.
Das gleichmäßige Sirren der Teflonketten war deutlich zu hören. Langsam glitt der EWAT aus dem Bild. Dann die Stimme des E-Butlers, der für das Hauptportal zuständig war: „Bitte identifizieren Sie sich!“ Das Bild wechselte, das Innere der Kommandozentrale des EWATs wurde sichtbar. Und das Menschengedränge darin.
Valery Heath und Rose McMillan standen auf und näherten sich dem Bildschirm, die anderen reckten die Hälse. Nicht den fünf helmlosen Besatzungsmitgliedern in der Kommandozentrale galt ihre ganze Aufmerksamkeit, sondern den drei Menschen in silbergrauen Schutzanzügen und durchsichtigen Helmen. Vor allem dem großen breitschultrigen Mann unter ihnen. Neugierig betrachteten die Octaviane sein kantiges Gesicht. Ein junges Gesicht, aber gezeichnet von Entbehrung und Kampf. Tinnox – der Mann, den das Octaviat so gespannt erwartete. Der Mann, der nach Einschätzung der Community Salisbury für den großen Auftrag geeignet sein könnte. Unter den anderen beiden Helmen sah man Frauenköpfe, einen dunkelhaarigen und einen blonden.
„Sie sind zu dritt!“, entfuhr es McMillan. Empörung spiegelte sich auf der Miene der Octavian. „Zwei Personen waren uns angekündigt! Wer ist die dritte?“ Niemand reagierte; die Prime winkte mit herrischer Geste ab.
„Captain Cinderella Loomer“, sagte die dunkelhäutige Frau auf dem Pilotensitz. Der E-Butler identifizierte Personen, die das Portal passierten, anhand einer Stimmanalyse.
„Roger der Dritte, Prinz von Kent und König der Britannischen Inseln.“ Ein schmales, tiefbraunes Gesicht blickte von der Leinwand. Die kleine Nase hätte man noch als aristokratisch bezeichnen können – das leicht vorgeschobene Kinn jedoch und der kleine Schmollmund zerstörten diesen Eindruck. Sie verliehen dem Gesicht des Königs einen eher kindlichen Zug. Und einen sehr eigensinnigen. Josephine Warrington hatte ihre Mühe mit dem trotzigen Wesen des sehr viel jüngeren Monarchen. King Roger III war gerade mal neunundfünfzig Jahre alt.
Die anderen Besatzungsmitglieder identifizierten sich: Jefferson Winter – Berater des Königs, Dichter und Octavian für Kultur und Unterhaltung, ein Albino. General Charles Draken Yoshiro, der leitende Kommandant der Community-Force und Militär-Octavian, japanischer Abstammung und ebenfalls ein Albino. Wie immer trug der stämmige Mann eine blaue Zopfperücke. Und schließlich Commander Curd Merylbone, ein auffallend kleiner und schmächtiger Mann, der irgendwie unauffällig hinter der Navigationseinheit saß. Nach ihm meldeten sich die Waffentechniker und Infanteristen aus den hinteren Segmenten des EWATs mit Rang und Namen.
Die reguläre Besatzung – also die Besatzung, mit welcher der Tank Stunden zuvor die Community verlassen hatte – trug den bei solchen Einsätzen üblichen enganliegenden Anzug aus dünnem weichen Kunstfaserstoff. Den drei Fremden hatte die Besatzung nach Betreten des EWATs Schutzanzüge verpasst. Ein reiner Selbstschutz – schon die natürlichen und für die Fremden harmlosen Erreger auf ihrer Haut konnten für ein Community-Mitglied zu lebensgefährlichen Infektionen führen. Die fatale Immunschwäche bei allen bisher bekannten Communities hatte sich als schier unüberwindliches Handicap erwiesen. Seit Generationen verdammte es die Communities zu einem von der Welt abgeschotteten Leben unter der Erdoberfläche.
Der blonde Mann im Schutzanzug trat in den Vordergrund. „Mein Name ist Commander Timothy Lennox.“ Ein Lächeln huschte über sein Gesicht. „Oder auch Tinnox; so nennen mich die Wandernden Völker.“
Getuschel unter den Octaviats-Mitgliedern. Aufmerksam betrachtete die Prime den Fremden. Entschlossenheit sprach aus seinen Zügen, Geradlinigkeit aus seinen Augen – der Mann gefiel ihr.
„Den Namen verdanke ich meiner Partnerin.“ Commander Timothy Lennox wandte sich um und wies auf eine der Barbarinnen hinter sich, eine Frau mit einem schönen ebenmäßigen Gesicht und braunen Augen. Ihre drahtige Lockenmähne füllte fast den gesamten Helm aus.
„Marrela“, stellte sie sich mit rauchiger Stimme vor. Die zweite Frau sprach kein Wort.
„Das ist Lu“, sagte der Mann, der sich als Commander Lennox vorgestellt hatte. „Die Lords wollten sie töten; wir haben sie unter unsere Fittiche genommen.“
Entrüstetes Zischen im Kuppelsaal. „Eine Socks!“, fauchte McMillan. „Das muss man sich einmal vorstellen!“
Die Stimme des E-Butlers tönte aus dem Off. „Für zwei Individuen liegt keine Passage-Genehmigung vor.“
Jetzt erhob sich die Prime von ihrem Stuhl. „Verzeiht, Eure Majestät“, sie näherte sich den Palmen mit dem Bildschirm. „Da Ihr mit an Bord seid, nehme ich an, dass Ihr die Aufnahme der Wilden zu verantworten habt, Sire. Ich muss um eine Erklärung bitten!“
„Hätte ich sie dem Tod überlassen sollen, Lady Prime? Wir mussten uns mit den Riesenspinnen auseinandersetzten – beinahe hätten sie mich übrigens getötet und den General ebenfalls. Die Socks formierten sich gerade zu einem neuen Angriff – die …“ Er unterbrach sich und musterte die verängstigte Frau hinter sich, als würde er eine Bezeichnung für sie suchen. „Das Mädchen sollte hingerichtet werden und wäre jetzt nicht mehr am Leben, wenn wir sie nicht aufgenommen hätten.“
„Eure humanistischen Erwägungen in Ehren, Sire, aber die sind in diesem Falle absoluter Luxus!“ Die Prime wurde heftig. „Wisst Ihr denn, welche Keime die Wilde in den EWAT eingeschleppt hat? Euer Verantwortungsgefühl für Eure Community scheint mir noch ausbaufähig, Sire!“ Den letzten Satz stieß sie mit scharfer, zischender Stimme aus.
„Wir hatten keine Wahl“, schaltete sich der General ein. Er machte einen zerknirschten Eindruck. Auch er wäre um ein Haar im Verdauungssystem einer mutierten Riesenspinne gelandet. „Wir mussten sie aufnehmen. Und Tinnox und seine Gefährtin haben sicher nicht weniger Keime mit in das Fahrzeug gebracht. Wir haben sie alle besonders ausgiebig in den UV-Schleusen bestrahlt und sofort mit Schutzanzügen versehen.“
Die dunklen Augen der Prime blitzten zornig. Dass der Militär-Octavian sich dem Standpunkt des Königs anschloss, verdross sie. Normalerweise widersprach Yoshiro dem Monarchen, wo immer er konnte. Er war Warringtons zuverlässigster Partner im Octaviat.
„Durchfahrt verweigern!“, schnarrte sie. Die Vollmacht über das Panzerglastor der Außenpforte lag immer beim ranghöchsten Regierungsmitglied innerhalb des Bunkers. Und da der König sich außerhalb des Bunkers befand, lag sie im Augenblick bei der Prime.
„Das ist ungeheuerlich!“, mokierte sich König Roger. „Dann werde ich meinen Individual-Code einsetzen!“ Natürlich verfügte Roger III. über einen persönlichen Code, der ihm den Zugang in die Community ermöglicht hätte. Alle Regierungsmitglieder hatten einen derartigen Individual-Code. Und die leitenden Offiziere spezieller Kommandos ebenfalls. Der Code wurde nach einmaligem Gebrauch ungültig, und sein Benutzer musste einen neuen beantragen. Das Gesetz der Community gebot, diesen Code nur im Notfall zu benutzen. Solange innerhalb des Bunkers mindestens zwei Octaviane eine beschlussfähige Regierung vertraten, war es bei Strafe verboten, die Außenpforte eigenmächtig zu öffnen. Dieses Gesetz und die Individual-Codes gab es erst seit etwa einhundertachtzig Jahren. Damals war ein externes Kommando der Community Birmingham vor verschlossener Außenpforte zugrunde gegangen, weil innerhalb des Bunkers über neunzig Prozent der Bevölkerung einer Infektion zum Opfer gefallen waren. Darunter sämtliche Regierungsmitglieder. Die Community Birmingham existierte nicht mehr.
„Das werdet Ihr nicht wagen, Sire!“, blaffte die Prime. „Unterbrich die Verbindung, Herkules!“ Wütend begann Josephine Warrington um den runden Tisch herum zu tigern. „Ihre Meinung, Ladies und Gentlemen!“ Es kam zu einer erregten Diskussion. Schließlich einigte man sich. Die Verbindung zum großen Portal wurde wieder hergestellt.
„Sie alle haben sich einer prophylaktischen Therapie zu unterziehen“, teilte sie der EWAT-Besatzung den Beschluss des Octaviats mit. „Commander Lennox bleibt einen Tag zur Entkeimungsquarantäne im SEF. Morgen früh darf er die Community im Schutzanzug betreten. Die beiden Wilden dürfen die Community nicht betreten. Sie dürfen aber einen Raum im SEF benutzen.“
Das SEF war eine Art Vorhalle über dem eigentlichen Bunkerzugang. Es lag in der ehemaligen Westminster Hall.
In der Kommandozentrale des EWATs brach eine erregte Diskussion los. Vor allem die dunkelhaarige Barbarin gestikulierte wild. Commander Lennox hatte sich zu ihr umgedreht. Ihre Gesichtszüge unter dem Helm signalisierten Widerwillen und Zorn. Sie stieß lautstarke Sätze in einer Sprache aus, die keiner der anwesenden Octaviane verstand. Der Mann, der sich Tinnox nannte, schien ihr nicht viel entgegnen zu können. Sie ließ ihn kaum zu Wort kommen. Beruhigend legte er den Arm um sie.
„Nichts für ungut, Ma’am.“ Commander Lennox wandte sich wieder um und blickte vom Bildschirm auf Josephine Warrington herab. „Aber ohne meine Partnerin werde ich Ihren Bunker nicht betreten.“
König Roger schaltete sich ein. In Tonfall einer beleidigten Diva pochte er auf seine Befehlsgewalt und verlangte, der Barbarin Marrela Einlass zu gewähren.
Die zeternde Einlassung des Königs ließ Warrington kalt. Aber diesen Tinnox wollte sie nicht vor den Kopf stoßen. Wenn ihre Intuition Recht behalten sollte, würden sie den Mann noch brauchen. Sie gab nach. Die Verbindung zum Portal wurde unterbrochen. Josephine Warrington wandte sich an ihre anwesenden Octaviane. „Ihr erster Eindruck, Ladies und Gentleman – ist er der Mann, den wir suchen?“
„Ich kann es nicht glauben.“ Ibrahim Fahka schüttelte den Kopf. „Wenn es auf dieser verkommenen Erde einen Barbarenstamm geben sollte, dem es gelungen ist, einen Jet zu bauen, wüssten wir das!“
„Wenn Sie sich da mal nicht täuschen, Sir“, sagte Warrington kühl. „Unsere Expeditionen haben noch nicht einmal die Alpen überwunden, geschweige denn die Karpaten. Commander Carlyles Ostexpedition hat sich zuletzt vom Rhein aus gemeldet – das ist fast vier Monate her – und Commander Nashs Skandinavien-Kommando ist seit zwei Jahren überfällig. Wir wissen gar nichts.“
„Sein genetisches Profil könnte interessant für uns sein“, gab Octavian Hawkins zu bedenken. „Und natürlich das der Barbarin. Ob er allerdings der Mann für den großen Auftrag ist …“
„Seine Anwesenheit wird eine Menge Unruhe in der Community auslösen“, meldete sich Rose McMillan zu Wort. „Ein junger potenter Mann – das wird Frühlingsgefühle bei unseren Frauen auslösen.“ Die anwesenden Männer hüstelten verlegen in ihre Fäuste.
Die Prime grinste. „Die Angst vor einer Infektion wird sie hoffentlich vom Äußersten abhalten“, sagte sie mit ironischem Unterton.
„Nehmen wir den Mann doch einfach mal unter die Lupe.“ Zum ersten Mal im Verlauf der Sitzung bequemte sich der Octavian für Infrastruktur und Logistik zu einem Statement. Der zwergenhafte Louis Blair hatte den Ruf eines notorischen Schweigers. „Außerdem fehlen uns die Meinungen der Octaviane Winter und Yoshiro.“ Er räusperte sich. „Und natürlich die des Königs.“
„Korrekt.“ Warrington nickte grimmig. „Schauen wir uns den Mann an. Und beten Sie, dass er sich als der Richtige erweist. Dann können wir diesen Tag in unsere Geschichtschronik eintragen.“
3
Das Ding war aus grauem Metall. Ein rundes Glas bedeckte seine Vorderseite. Unter dem Glas waren Zahlen und zwei Pfeile angebracht, ebenfalls aus grauem Metall. Ein kurzer und ein langer. Honnes hatte so ein Ding noch nie gesehen. Nicht einmal im Hauptquartier, in Fanlurs Gemächern.
„Du hast Zeit, bis der große Zeiger auf die Zwölf vorgerückt ist“, sagte das dicke Männchen neben dem Tisch, auf dem das Ding stand. Es deutete auf den längeren Pfeil des Dings und auf die obere Zahl. Honnes begriff, dass seine Peiniger die Zeit mit dem Ding maßen. Der große Pfeil stand kurz vor der oberen Zahl.
Der kleine Fettwanst trug einen Anzug aus grauem schuppigen Leder. Die gegerbte Haut irgendwelchen Meeresviehzeugs, nahm Honnes an. Er hatte strohgelbes Haar, das ihm dicht und fettig über die Ohren und bis in den Nacken wucherte. Kleine Äuglein funkelten in seinem rötlichen fetten Gesicht, und er hatte sich mit „Olaaw“ vorgestellt. Er sprach Honnes’ Sprache mit hartem Akzent und dolmetschte die wenigen Worte, die der Coelleni zwischen zusammengebissenen Zähnen hervorstieß, für die anderen Männer im Raum.
Ein Frachtraum, vermutete Honnes. Er hockte auf dem Boden, angekettet an die Schiffswand. Dumpfes Stampfen drang aus dem Inneren des Schiffsrumpfes. Honnes hörte das Quietschen und Knarren der Schaufelräder. Ganz nah pflügten sie durchs Wasser, höchstens ein, zwei Schritte von ihm entfernt hinter der geteerten Wand.
Blutige Striemen bedeckten seinen nackten Oberkörper, blaue Flecken sein zerknautschtes Ledergesicht. Seine von Natur aus schon wulstigen Lippen glichen kleinen aufgeplatzten Lischetten-Larven. Er schielte zu den Männern mit den Peitschen, die sich auf die gegenüberliegende Seite des Frachtraums zurückgezogen hatten. Vier Kerle, jünger und größer als er. Zwei trugen Ledermasken, die nur Löcher für Mund und Augen freiließen. Die Gesichter der anderen beiden wirkten merkwürdig eingedrückt. Sie trugen sackartige braune Hemden, darüber erdfarbene Wildlederwesten und Wildlederhosen, die an den Außenseiten geschnürt waren. Stundenlang hatten die Kerle auf ihn eingeprügelt.
Er beäugte den grimmig dreinblickenden Mann neben der offenen Kiste mit dem Kristall. Eine Art Führer, schloss Honnes aus seinem herrischen Benehmen und aus den schwarzen und roten Streifen, die seine gepanzerte Lederweste zierten. Auch der glatte Lederhelm, den er sich mit einer Schnalle unter dem fliehenden Kinn befestigt hatte, war mit solchen Streifen versehen. Er hatte nur vier Finger an jeder Hand, und statt einer Nase hing ihm ein gelblicher Hautlappen zwischen Augen und Oberlippe. Bei den anderen Soldaten hatte Honnes ähnliche Missbildungen bemerkt. Knorpelstummel statt Ohrmuscheln, gespaltene Lippen und Kiefer, missgebildete Nasen. Der Führer schoss zornige Blicke auf Honnes ab. Der aber fürchtete den immer wieder in wütendes Geschrei ausbrechenden Mann nicht.
Wenn er jemanden fürchtete, dann den schweigenden Alten, der mit vor der Brust verschränkten Armen auf der anderen Seite des Kristalls stand. Er trug ockergelbe Schnürhosen und ein Schnürhemd gleicher Farbe. Dazu schwarze Stiefel und einen Umhang aus schwarz glänzendem Leder, der auf den Brustteilen mit roten Ornamenten verziert war, und auf dessen Rücken eine rote Götterfratze drohte. Jedenfalls ging Honnes davon aus, dass es eine Götterfratze war, denn er hielt diesen schweigsamen Mann für eine Art Priester. Sein Gesicht schien wie aus schmutzigem Kalkstein gemeißelt. Weder Wut noch Genugtuung spiegelte sich in seiner Miene. Wie eine Statue stand er da. Nur seine gespaltene Oberlippe zuckte mitunter, und manchmal fuhr er sich mit der sechsfingrigen Rechten über die schwarze Lederkappe, die sein linkes Auge abdeckte. Das rechte Auge fixierte Honnes unablässig. Als könnte es durch seinen Schädelknochen hindurch in sein Hirn blicken.
Auf der rechten Schulter des Priesters hockte ein kleiner, offensichtlich gezähmter Gerul. Das schwarze Vieh mit dem gemaserten Brustfell klammerte sich mit seinen Greifhänden am Kragen des Umhangs fest. Ständig entblößte es seine messerscharfen Nagezähne, als wollte es Honnes auslachen.
„Von mir erfahrt ihr nichts“, krächzte Honnes erschöpft. Seine Haut brannte, sein Schädel schmerzte, sonst fühlte er nichts. „Sag ihnen, dass sie Taratzen-Ärsche sind, und von mir aus können sie mir die Kehle durchbeißen.“ Er versuchte zu grinsen. „Da wo ich herkomme, ist man einiges gewöhnt.“
Sie wollten von ihm wissen, woher der Kristall stammte. Und sie wollten wissen, wer der Mann war, der sich mit seinem Lupa an die Küste hatte retten können. Da war für Honnes klar gewesen, dass Fanlur noch lebte. Allein diese Gewissheit hatte seine Widerstandskraft gestärkt.
Mit eigenen Augen hatte er gesehen, wie sie den Steamer seines langjährigen Kampfgefährten und Anführers versenkten. Und wie sie einem überlebenden Gefährten kochendes Öl in den Hals gegossen und ihm danach Augen und Zunge herausgeschnitten hatten. Nur er, Honnes, und Fanlur lebten jetzt noch. Honnes wünschte sich den Tod. Hauptsache, Fanlur hatte den Zusammenstoß mit der fremden Kriegsflotte überlebt.
Olaaw ging vor ihm in die Hocke. „Die Kehle durchbeißen? Das wäre ein schöner Tod, was?“ Ein bitteres Grinsen flog über sein Fettgesicht. „Glaub mir, Honnes – sie werden dir nicht die Kehle durchbeißen. Ich bin schon in ihrer Gefangenschaft groß geworden, ich weiß, wie fantasievoll Nordmänner sind, wenn es ums Töten geht.“
„Du sollst ihnen sagen, dass sie Taratzen-Ärsche sind“, knurrte Honnes.
„Vielleicht werden sie dir die Haut abziehen und dich danach an einem Seil ins salzige Meerwasser tunken. Vielleicht wird Hakuun auch seinem Gerul erlauben, dir die Eier anzunagen, wer weiß?“ Er schwieg ein Weilchen, um seine Worte wirken zu lassen. „Wenn du sprichst, stehst du auf der Siegerseite“, fuhr er dann fort und schlug einen schmeichelnden Ton an. „Die Nordmänner werden die Insel erobern und mächtige Waffen erbeuten. Und bald werden sie die Herren von Euree sein. Und viele Dolmetscher brauchen.“
Honnes schaute das Ding an, mit dem man offensichtlich die Zeit messen konnte. Der große Pfeil würde jeden Moment auf die oberste Zahl vorrücken. Verächtlich musterte er die vier Folterknechte und ihre Peitschen. Dicke Fischgräten waren in die Lederriemen eingeflochten. Er blickte dem ungeduldigen Anführer ins nasenlose Gesicht, und er betrachte mit einem Frösteln den Priester und den Gerul auf seiner Schulter. Alles in ihm sträubte sich bei der Vorstellung, diese mörderischen Barbaren würden über sein geliebtes und gerade erst befreites Coellen herfallen. Nicht einmal den Dysdoorern würde er diesen Feind gönnen.
„Ich habe vergessen, wo ich herkomme“, krächzte Honnes schließlich. „Und von einem Mann, der angeblich mit einem Feuerrohr durch die Gegend schießen soll, habe ich nie gehört.“
Olaaw erhob sich, der große Pfeil rückte auf die obere Zahl des Zeitmess-Dings, und der Kriegsführer namens Kaikaan brüllte einen Befehl. Die vier Folterknechten stellten sich breitbeinig um Honnes herum auf und hoben ihre Peitschen.
4
Das Gefühl, ein Gast zu sein, den man erwartete, und auf den man sich vorbereitet hatte, verstärkte sich. Timothy Lennox fragte sich immer öfter, warum die Technos Interesse an ihm zeigten. So viel Interesse, dass ihr König und ihr militärischer Führer persönlich aus der Bunkerstadt aufgebrochen waren, um ihn mitten in den Ruinen zu treffen. Die Bedrohung durch die hinterlistigen Lords hatten sie dabei genauso in Kauf genommen wie das Risiko, den mörderischen Riesenspinnen zum Opfer zu fallen.
Der Mann, der sie durch die unwirkliche Welt unter den ehemaligen Houses of Parliament führte, nannte sich Octavian Jefferson Winter. Er sei der Berater des Königs, hatte er gesagt. Unter einem Berater konnte Tim sich zumindest etwas vorstellen. Was ein „Octavian“ war, blieb ihm schleierhaft. Zunächst.
„Ihr Gastgeschenk habe ich heute aus dem Sterilisator geholt und persönlich unseren Historikern übergeben“, sagte er. „Sie werden die alte Datenbank auswerten.“ Tim hatte den Technos Richard Jaggers Medienplayer überlassen.
Statt der hellen engen Kleidung, in der Tim ihn kennengelernt hatte, trug der hochgewachsene kahlköpfige Mann jetzt eine lange weite Jacke und eine weite Hose. Beides Schwarz, und beides aus dünnem weichen Stoff. Ein Albino, ohne Zweifel, und ein ziemlich alter dazu – seine Haut sah aus wie gebleichtes Pergament. Ein Geflecht von blauen Adern durchzog sie. Die roten Augen blickten kritisch und ernst aus dem knochigen Gesicht. Tim versuchte, sich dieses Gesicht lachend vorzustellen – es gelang ihm nicht.
Sie durchschritten eine kreisrunde Gewölbehalle, so weiträumig wie eine Sportarena. Menschen in weiten bunten Jacken und Hosen verlangsamten ihren Schritt, wenn sie Tim und Marrela entdeckten, und beäugten sie neugierig. Beide trugen Schutzanzüge mit durchsichtigen Kugelhelmen. Einen Tag hatten sie zusammen mit Lu in einem Schott vor dem zentralen Tunneleingang verbracht. Ärzte in Schutzanzügen hatten sie untersucht, und sie waren mit UV-Licht bestrahlt worden.
Am Morgen nach einer unruhigen Nacht hatte sich General Yoshiro auf dem Monitor ihrer Schlafkuppel gezeigt. Jetzt stand eine Audienz in den Privatgemächern des Königs auf dem Programm und danach ein Gespräch mit der Regierung dieser unterirdischen Welt.
Fasziniert bewunderten Tim und Marrela die Wasserbögen eines Springbrunnens im Zentrum der Kuppel. Eine bunte Figur thronte über dem Wasserspiel. Tim betrachtete sie kopfschüttelnd – sie trug deutlich die Züge von Queen Elisabeth II.
Unter der höchsten Stelle der Kuppel blieb Tim stehen und legte den Kopf in den Nacken. Er traute seinen Augen kaum. Blauer Sommerhimmel wölbte sich hoch über der Halle. Sternförmig zweigten Gänge in alle Richtungen ab. Zwischen den bogenförmigen Eingängen in die Abzweigungen glaubte Tim zunächst Bäume und ein Bergpanorama zu sehen. Entsprechend überrascht blieb er stehen und starrte in die Kronen der Ginkgos und Akazien. Ihre Zweige und Blätter bewegten sich, als würde der Wind durch die Bäume wehen. Doch schnell merkte Tim, dass die Naturkulisse weiter nichts war als eine idyllische Täuschung war – eine Computeranimation, die auf die Kuppelwände projiziert wurde.
Marrela neben ihm machte große Augen und bekam den Mund nicht mehr zu. Fassungslosigkeit spiegelte sich auf ihrem Gesicht.
Nirgends konnte Tim Winkel entdecken, nirgends Kanten – alles war rund, bogenförmig, gewölbt und geschwungen. Bevor sie einen der hohen Gänge betraten, legte er seine Hände auf die Gewölbewand. Trotz der Handschuhe, die er und Marrela tragen mussten, fühlte er die glatte warme Fläche. „Was ist das für ein Material?“, wollte er wissen.
„Titanglas“, sagte Winter. „Es hat sich schon vor über dreihundert Jahren als Baustoff durchgesetzt. Man braucht keine großen Rohstoffressourcen, keine großflächigen Produktionsanlagen, und es hält Jahrtausende.“
„Sie verfügen über keine industrielle Produktionsstätten?“, erkundigte sich Tim. Die Bilder rechts und links des Ganges gaukelten die Illusion vor, durch ein Flusstal zu spazieren.
„Es gibt vier solcher Hallen, wie wir sie eben durchschritten haben“, gab der Albino bereitwillig Auskunft. „Um jede gruppiert sich ein spezielles Bunkersegment, ein anderer Stadtteil, wenn Sie so wollen. Gerade befinden wir uns im Wohnbereich. Hier findet der größte Teil des sozialen Lebens statt. Von einer zweiten Halle aus gelangt man in die Laboratorien der Genetiker, Biotechniker und Ingenieure. Über dreißig Prozent der Community-Mitglieder widmen sich dort der Wissenschaft und der Forschung. In einem dritten Segment wird ausschließlich produziert. Viele Gebrauchsgegenstände wie Kleider und Nahrungsmittel stellen wir natürlich synthetisch her. Doch wir betreiben auch ertragreiche Gewächshäuser. Die vierte Halle schließlich nennen wir Octaviats-Arena. Dort finden Community-Versammlungen statt, dort werden öffentliche Feste gefeiert, dort pflegt der König zur Community zu sprechen. Der um die Octaviats-Arena gruppierte Bunkerbereich wird ausschließlich von der Regierung und vom Militär genutzt.“
Tim nutzte die unverhoffte Redseligkeit ihres Begleiters aus und schoss eine Frage nach der anderen auf ihn ab. So erfuhr er, dass genau fünfhundertdreiundneunzig Menschen in der Community London lebten. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag bei erstaunlichen einhundertsiebzig Jahren. Die Regierung bestand aus acht Köpfen – fünf Männern und drei Frauen. „Octaviane“ nannte Winter die Regierungsmitglieder, das gesamte Gremium hieß „Octaviat“, der oder die Vorsitzende wurde Prime genannt.
Was Tim über das Regierungssystem zu hören bekam, klang nicht besonders demokratisch. Die einzelnen Octaviane wurden von bestimmten Gruppen innerhalb der Community gewählt. Die Ingenieure, die Wissenschaftler, die Militärs, die Künstler, und so weiter – alle Gruppen wählten einen Mann oder eine Frau, die sie im Octaviat vertreten sollte. Das Amt hatte der oder die Gewählte dann auf Lebenszeit inne. Das Octaviat wählte aus seiner Mitte den Regierungschef, den Prime. Auch dessen Sessel wurde in der Regel erst mit seinem Tod wieder frei.
Über dem Prime allerdings – seit Jahrzehnten wurde London von einem weiblichen Prime regiert – stand der König. Mit seinem Vetorecht konnte er jeden Entschluss des Octaviats zu Fall bringen. Er hatte auch das Recht, eigene Gesetzesentwürfe einzubringen und Octaviats-Sitzungen anzuordnen. Der König schien zweifellos der mächtigste Mann der Community London zu sein.
Octavian Jefferson Winter blieb stehen. „Hier ist der Eingang zu den Privatgemächern König Rogers des Dritten.“
Tim hatte das Gefühl, im kniehohen Gras einer Frühlingswiese zu stehen. Er sah Farnsträucher und Brombeerhecken und dahinter die Stämme von Buchen und Eschen, aber keine Tür. „Aha“, brummte er.
Der Albino lächelte. Zum ersten Mal. „Ich kann mir vorstellen, wie Ihnen zumute ist, Commander Lennox – die vielen Eindrücke müssen Sie geradezu erschlagen.“
„Tja“, Tim seufzte, „könnte man so sagen.“ Er blickte um sich und hob ratlos die Hände. „Diese unterirdische Stadt, diese Naturkulissen, diese ganze …“ Er unterbrach sich und suchte nach Worten, „ … diese ganze fantastische Welt – wie haben Sie das nur zustande gebracht?“
„Die Generationen nach Alexander-Jonathan haben hart gearbeitet, Commander Lennox. Ohne die großartigen Leistungen vor allem unserer Bioinformatiker wäre unser Dasein noch weit entbehrungsreicher. Vielleicht würde die Community ohne sie schon nicht mehr existieren. Aber das ist ein weites Feld.“ Winter wandte sich dem Waldrand zu – beziehungsweise der gewölbten Titan-Glaswand des Ganges.
„Die Bioinformatiker?“, staunte Tim.
„Ja.“ Der Octavian nickte. „Ende des zweiten Jahrhunderts haben sich unsere Computerfachleute fast vollständig von den Computersystemen verabschiedet, die Sie kennen.“ Er blickte Tim prüfend an. „Falls es wirklich wahr ist, dass Sie aus dem einundzwanzigsten Jahrhundert stammen.“
Tim ging nicht auf die indirekte Frage ein. „Ihre Computer arbeiten nicht mehr mit elektronischen Schaltkreisen?“
Der Octavian schüttelte den Kopf.
„Sie haben den Quanten-Computer weiter entwickelt?“
„Auch nicht. Vor etwas mehr als dreihundert Jahren haben unsere Vorfahren begonnen, fast ausschließlich mit Helix-Computern zu arbeiten.“ Tim machte ein begriffsstutziges Gesicht. „Der Begriff Helix müsste Ihnen etwas sagen, Commander Lennox. Er stammt aus der Genetik und der Molekularbiologie.“
Zahllose Begriffe schossen Tim durch den Kopf – Molekülstruktur, Eiweißketten, Nukleinsäure. „Sprechen Sie von der Doppelhelix der DNS?“
„Ganz genau“, sagte Winter. „Die Doppelspirale, auf der die Gene eines Organismus gespeichert sind. Natürlich verwenden wir nur menschliche DNS. Schon zu Ihrer Zeit hat man versucht, die immanente Intelligenz der Körperzellen für ein Computermodell auszuwerten. DNS-Computer nannte man das damals, wenn ich mich recht entsinne. Der Helix-Computer basiert schlicht auf der Fähigkeit des Zellkerns, Informationen in Eiweißcodes zu speichern und sie bei seiner Teilung zu kopieren. Unsere Wissenschaftler haben dieses Modell bis zur Perfektion weiter entwickelt.“ Er legte seine Hand auf die leicht gewölbte Glaswand, oder auf eine Brombeerhecke – je nach dem, was man sehen wollte. „Aber ich bin Dichter und kein Bioinformatiker. Fragen Sie einen unserer Wissenschaftler. Der wird Ihre Neugier besser befriedigen können als ich.“
Eine Lerche schwirrte tschilpend aus dem hohen Gras und schwang sich über die Baumwipfel. Ein bogenförmiger Durchgang öffnete sich in der Glaswand – oder im Waldrand, je nachdem. Der Albino trat durch ihn hindurch, Tim und Marrela folgten.
5
Niemand wagte es, sich in seine unmittelbare Nähe zu setzen. Nur Wulf lag neben ihm und beäugte misstrauisch die wilden Gestalten, die Fanlur gegenüber in einem Halbkreis um das Feuer hockten. Die zwölf Biglords des Stammes hatten sich eingefunden, um Fanlur zu verabschieden. Und natürlich Grandlord Pörcival. Der saß sechs Schritte von Fanlur entfernt auf der anderen Seite des Feuers. Fünf seiner vielen Söhne hatten sich um den graubärtigen Hünen geschart. Djeff, sein Jüngster, kuschelte sich in seinen Schoß. Dahinter, in respektvollem Abstand, standen etwa sechzig Simplords und Littlords. Und zwischen den kleinen schiefen Steinhäusern zahllose Frauen und Kinder.
Fanlur registrierte feindselige Blicke aus der Menge. Die Lords trauten ihm genauso wenig, wie er ihnen traute. Der Laserbeamer lag über seinen gekreuzten Beinen. Seine großen weißen Hände lagen entspannt auf dem Waffenkolben.
Dampf stieg aus einem verrußten Kessel, der an einer Kette über dem Feuer zwischen zwei schwarzen Metallböcken eingespannt war. Zwei Frauen in langen Wildlederkutten schöpften eine klare bräunliche Flüssigkeit aus dem Kessel in kleine Tongefäße und verteilten sie unter den Männern – Tee. Fünfzig Schritte weiter links, auf einem von schwärzlichen Steinhütten umgebenen dreieckigen Platz, schichteten ein paar Männer Holz aufeinander.
„Sinne scheiß Tach“, knurrte Grandlord Pörcival. Er trug einen knöchellangen Mantel aus braunem Wildleder, darunter ein schwarzes Lederhemd und schwarze, seitlich geschnürte Lederhosen. „East laufemia zwei wuums wäch, dann weed mia dweizänte Bigload abemuakst, dann wollede Kwötschis minne Jüngste vapudze, unnu onoch Kwiech …“ Er schüttelte sein zu zwei Zöpfen geflochtenes Grauhaar. Eine schwarze Lederkappe saß auf seinem Quadratschädel.
In aller Ausführlichkeit hatte der hünenhafte Patriarch Fanlur schon am Abend zuvor von seinem Pech erzählt. Am meisten schien ihn der Verlust zweier blutjungen Frauen – wuums nannten die Lord das andere Geschlecht – zu schmerzen. Auf seine alten Tage wollte er seinen vielköpfigen Harem mit ihnen verjüngen. Und vermutlich sich selbst.
„Owguudoo müsse stinkewutig sein.“ Er riss sich die Lederkappe vom Kopf und zerwühlte sein Lockengestrüpp. „Wäan ihm heute’n obfa bwingen …“
Auch dass die Lords Verehrer des finsteren Orguudoos waren, hatte Fanlur inzwischen mitbekommen. Davon hatte sein Vater nie erzählt. Religion hatte während seiner Kindheit in der Community Salisbury so gut wie keine Rolle gespielt. Deswegen begegnete Fanlur den religiösen Anschauungen und Sitten der Menschen, deren Wege er kreuzte, immer mit einer respektvollen Gleichgültigkeit.
Fanlur beobachtete die bärtigen Biglords rechts und links ihres Patriarchen. Fast alle waren in Wildleder gekleidet: Schnürhosen, lange Hemden und Westen darüber. Die meisten der verwegen aus ihrem Bartgestrüpp lauernden Burschen waren blond, einige grau. Kaum einer trug das Haar offen. Fanlur konnte sich nicht erinnern, dass ihm die kranke Hautfarbe in seiner Kindheit schon aufgefallen war: Die Haut der Lords hatte durchweg einen Gelbstich.
Fanlur merkte, dass die Blicke einiger Biglords begehrlich an seinem Laserbeamer hingen. Der Grandlord hatte ihn zwar gestern Abend offiziell zum Freund seines Stammes erklärt – aus Dankbarkeit für die Rettung seines Sohnes –, aber Fanlurs Instinkt warnte ihn davor, diesen gerissenen Burschen auch nur einen Moment zu trauen. Obwohl Grandlord Pörcival zwei Wachen vor der Steinhütte postiert hatte, um ihm symbolisch Schutz zu demonstrieren, hatte Fanlur nicht geschlafen. Sicher hätte der Lupa ihn geweckt, wenn sie versucht hätten, ihn zu bestehlen – aber Fanlur verließ sich lieber auf sich selbst. Er konnte tagelang ohne Schlaf auskommen.
„Wieville Schiff vonne Noadmänne hasse gesään?“ Mit den Wurstfingern seiner Rechten zerwühlte der Grandlord seinen struppigen Rauschebart.
„Achtzig oder neunzig.“ Fanlur musste die Frage zum dritten Mal beantworten. Der Grandlord tat sich schwer, der Wahrheit ins Auge zu sehen.
„Un wieville Noadmänne schätze?“
„Ich weiß es nicht“, sagte Fanlur. „Fünfzig bis siebzig pro Schiff ganz bestimmt. Eher mehr.“
Der Grandlord stöhnte auf. „Sinne vafluch ville!“
Der Holzstoß auf dem Versammlungsplatz wuchs. Aus den Augenwinkeln beobachtete Fanlur zwei Lords, die vier Fackeln auf den Platz brachten. Sie stellten sich neben dem Holzstoß auf. Zwei weitere schleppten einen schwarzen Kessel heran.
Grandlord Pörcival bellte Befehle nach links und rechts. Drei Biglords sprangen auf. Sie stürmten auf die Menge der Simplords und Littlords zu und brüllten ihrerseits Befehle. Fanlur verstand nicht alles. Aber so viel, dass sie Botschafterdelegationen an die anderen drei Stämme und Spähtrupps zusammenstellten, bekam er mit. Zwei Spähtrupps, wie es aussah. Einer sollte zur Themsemündung, ein zweiter an die Südküste vorstoßen.
Pörcival widmete sich wieder seinem Gast. „Was machse jez? Wo gässe hin?“ Er war nicht mal mehr mit halber Aufmerksamkeit bei Fanlur. Seine Gedanken kreisten um die drohenden Kämpfe mit den Nordmännern. Und um die bevorstehende Feier auf dem Versammlungsplatz. Ständig schweifte sein Blick dorthin ab.
Fanlur spielte für einen Moment mit dem Gedanken, um einen Scout zu bitten. Er hatte die Community London zwar zweimal besucht, aber das lag fünfzig Jahre und länger zurück. Seine Vorstellung von dem Weg zu ihrem Bunker war mehr als diffus. Aber er ließ den Gedanken fallen. Er wusste, wie sehr die Lords die Technos hassten. Wenn er von Tschelsi aus – so nannten die Lords ihre Fluss-Siedlung im ehemaligen Stadtteil Chelsea – dem Themseufer flussabwärts folgte, konnte er die schwarze Palastruine eigentlich nicht verfehlen.
„Wer kann seinen Weg wirklich beschreiben, bevor er ihn gegangen ist?“, orakelte er. Der Grandlord nickte schweigend. Er begriff, was Fanlur ihm sagen wollte: Es geht dich nichts an, wohin ich gehe.
Fanlur stand auf. Um den Holzstoß auf dem dreieckigen Platz versammelten sich mehr und mehr Menschen. Vermutlich das Opferfest für den dunklen Gott der Lords. Höchste Zeit zu verschwinden. Zwei scheue junge Frauen brachten ihm einen Lederschlauch mit Wasser und einen Brotfladen. Er bedankte sich höflich.
Als erstes verabschiedete er sich von dem Knirps. „Kommse wieda?“, fragte Djeff. Seine Augen leuchteten, während er zu Fanlur aufsah. Eine Mischung aus Ehrfurcht und Bewunderung lag auf seinem Kindergesicht.
„Vielleicht.“ Fanlur hob Pörcivals Sohn hoch und stemmte ihn über den Kopf. „Vielleicht auch nicht. Geh den Kwötschis in Zukunft aus dem Weg.“ Er verneigte sich vor dem Grandlord. Den Biglords nickte er flüchtig zu.
Der Lupa trottete neben ihm her, während er eine der engen Gassen zwischen den schiefen Häusern ansteuerte. Er musste den Versammlungsplatz überqueren. Die Leute beäugten ihn wie ein exotisches Tier.
Als er die Gasse erreichte, blickte er sich noch einmal um. An der Spitze seiner Biglords betrat Pörcival den Platz. Irgendwo zwischen den kleinen Häusern wurden Schreie laut.
Geh weiter, raunte Fanlurs innere Stimme. Seine Augen verengten sich, als er eine Gruppe Männer in der Gasse gegenüber auftauchen sah. Sie zerrten vier Frauen mit sich. Eine von ihnen schrie hysterisch und riss an dem Strick, mit dem man sie an Hals und Händen festgebunden hatte. Die anderen drei trotteten apathisch zwischen den Lords auf den Platz.
Die Fackelträger entzündeten den Holzstoß. Wulf knurrte und senkte den großen Schädel. Fanlurs Brustkorb verengte sich. Gemurmel wurde laut unter den etwa dreihundert Menschen auf dem Platz. Es steigerte sich rasch zu einem monotonen Singsang. Der Grandlord hob die Hände gegen den bleigrauen Himmel. Sein dröhnender Bass übertönte den Gesang.
Eine Beschwörungsformel, dachte Fanlur. Er ruft seinen Gott Orguudoo an! Die Flammen auf dem Holzstoß loderten mannshoch. Und schlagartig verstand er, welche Art von Opfer die Lords ihrem grausamen Gott bringen wollten. Geh jetzt, forderte Fanlurs innere Stimme. Wulf stimmte ein heiseres Gebell an.
Sie führten die Frauen zu dem großen Kessel. Er stand nur ein paar Schritte von den Flammen entfernt. Einer der Männer zog ein langes Messer unter der Lederweste heraus. Die Schreiende wurde über den Kesselrand gedrückt.
Fanlurs Finger schlossen sich um den Kolben seines Laserbeamers. Seine Kaumuskeln arbeiteten. Du kannst ihre Welt nicht durch Schüsse verändern, raunte seine innere Stimme. Die Frau kreischte wie von Sinnen. An den Haaren rissen sie ihr den Kopf in den Nacken. Der Mann mit dem Messer setzte ihr die Klinge an die Kehle.
Fanlur drehte sich um. Der Todesschrei der Frau verstummte. Im Laufschritt verließ er die Ansiedlung der Lords.
6
Wie nicht anders zu erwarten, war auch der Raum, in den Jefferson Winter sie führte, kuppelförmig. Leise Musik kam von irgendwo her; ein Walzer. Verwirrt blickte Marrela sich um, und Tim musste schmunzeln – statt in einer Feld-, Wald- und Wiesenlandschaft befanden sie sich plötzlich in einer alpinen Hochgebirgsregion: Schneegipfel, Gletscher, steil abfallende Hänge, sattgrüne Wiesenmatten, und dort, wo eben noch eine Türöffnung gegähnt hatte, ein reizendes Flusstal und grasendes Rindvieh.
Tim machte sich klar, dass er dergleichen vermutlich nie mehr in Natura zu sehen bekommen würde und wusste nicht, ob er weinen sollte. Und gleichzeitig führte er sich vor Augen, dass die Erben der Menschheit hier die Illusion einer Idylle konservierten, die ihre Vorfahren selbst zu zerstören im Begriff gewesen waren, bevor der Komet diesen Job für sie erledigt hatte. Und er wusste nicht, ob er lachen sollte.
Er tat keines von beidem, ignorierte Winters kritischen Blick und ergriff die Hand, die sich ihm entgegen streckte – die Hand König Rogers III.
„Freut mich außerordentlich, Sie in meinen Privatgemächern begrüßen zu können, Commander Lennox.“ Der Monarch wandte sich an Marrela und deutete eine Verbeugung an. „Und Sie natürlich auch, Lady …“, sein ratloser Blick traf Winter.
„Marrela“, raunte der.
„ … Lady Marrela“, beeilte sich der König zu sagen. Etwas hilflos ergriff Marrela die Hand des ein wenig weibisch wirkenden Mannes. Sich die Hand zum Gruß zu reichen war ihr vollkommen fremd. Vielleicht irritierte sie auch die äußere Erscheinung des Monarchen: Anders als gestern im EWAT trug er weite cremefarbene Kleider, roséfarbene Stiefel mit nach oben gebogenen Spitzen, ein Rüschenhemd gleicher Farbe und eine voluminöse Perücke aus zahllosen altrosa Zöpfchen.
„Bedauerlich natürlich, dass wir ständig durch einen Schutzanzug voneinander getrennt sein werden“, fuhr König Roger im Plauderton fort. „Wir müssen ihn tragen, wenn wir zu Ihnen hinauf kommen, und Sie, wenn Sie zu uns herunter kommen.“ Er lächelte wehmütig. „Sonst erkälten wir uns unter Umständen ein wenig.“ Bedauernd breitete er die Arme aus. „So ist das eben. Das Leben legt uns so manche Mängel auf, und wenn wir nicht mit ihnen zu leben lernen, vernachlässigen wir leicht die Stärken, mit denen es uns ausgestattet hat.“
Tim nickte nur. Er nahm sich vor, gelegentlich über diesen Satz nachzudenken. Jetzt aber fesselten der schillernde Mann und seine ungewöhnliche Umgebung seine ganze Aufmerksamkeit. Zum Beispiel der Großbildmonitor im Himmel über den alpinen Schneegipfeln. Die nackte Frau, die dort in einem gläsernen Badezuber zu sehen war, kannte Tim: Lu, die Lordfrau. Heute Morgen erst hatten sie sich von ihr verabschiedet. Die Erlaubnis zum Betreten der Community war ihr verweigert worden. Um sie nicht der Verfolgung durch ihre Sippe auszuliefern, hatte man ihr einen Raum außerhalb des Bunkers zur Verfügung gestellt. Im „septisch-externen Foyer“, abgekürzt: SEF. So nannten die Technos den Teil der Westminster-Hall-Ruine, den sie durch Kuppelgewölbe abgestützt und durch Schleusen von der Außenwelt abgeschottet hatten.
Lu wollte sich ein paar Tage erholen und dann noch einmal die Flucht aus London wagen. Tim fragte sich, wohin eine Frau in dieser Gegend fliehen wollte.
„Ist sie nicht ein reizendes Geschöpf?“ Verzückt blickte der König zum Monitor. Lu räkelte sich in der Wanne, streckte ein Bein in die Höhe und wusch es mit einem Tuch. „Ein bisschen abgemagert vielleicht, und die Haut hat einen ungesunden Gelbstich. Wir versorgen sie mit Aufbaunahrung.“ Er wandte sich zu seinem Berater um und lächelte schalkhaft. „Schade, dass ich ihr nicht meine private Sonnenbank anbieten kann.“ Wieder widmete er sich dem in der Tat appetitlichen Anblick der Badenden.
„Euer Majestät!“ Winter setzte eine strenge Miene auf. „Ihr überspannt den Bogen ganz entschieden!“
Tim spürte plötzlich Marrelas wütenden Blick von der Seite. Sie schien ihm etwas Ähnliches sagen zu wollen. Taktvoll, wie Tim nun mal sein konnte, wenn er wollte, riss er seinen Blick von der blonden Lu los und schaute sich im königlichen Glasgewölbe um.
„Und das vor unseren Gästen!“ Winter war noch immer damit beschäftigt, den König zu tadeln. „Sie ist eine schmutzige, primitive Wilde!“ Der Octavian drohte die Fasson zu verlieren.
„Nun, schmutzig ist sie jetzt nicht mehr.“ Seufzend ließen auch die Augen des Königs vom Monitor ab. „Micky!“, rief er laut. „Weg mit dem Bild, bitte!“ Der Monitor verblasste; blauer Himmel strahlte an seiner Stelle.
Tim wusste nicht, wer „Micky“ war, aber er hatte längst verstanden, dass die Computersysteme dieser eigenartigen Menschen auf Zuruf reagierten.
„Warum war das hübsche Geschöpf auf der Flucht, Commander Lennox?“ Roger III führte Tim und Marrela zu einem großen ovalen Tisch. Ein Stadtmodell war darauf aufgebaut. Unzählige Miniaturmodelle säumten das blaue Band der Themse – Spielzeughäuser aus gefärbtem Glas. Tim erkannte die Tower Bridge, die St. Pauls Cathedral und den Westminster Palace.
„Sie sollte den Harem eines gewissen Grandlord Pörcival aufstocken und zog die Flucht vor“, erzählte Tim. „Gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester. Den Mord an ihr konnten wir leider nicht verhindern.“
„Pörcival also, dieser verdammte Stinkstiefel“, zischte der König. „Ein blutdurstiger geiler Nimmersatt. Und der Mächtigste dieser Karikaturen von Menschen dort oben.“ Er stieß einen tiefen Seufzer aus. „Ist es nicht erschütternd, was aus der Menschheit geworden ist, Commander Lennox?“
„Es ist nichts aus ihr geworden, was sie nicht schon immer auch gewesen ist, Sire“, antwortete Jefferson Winter an seiner Stelle.
Tim war sich nicht sicher, wem er beipflichten sollte. Der König sog scharf die Luft durch die Nase ein. „Diese Dichter!“ Er gab dem Albino mit einer Handbewegung zu verstehen, dass er schweigen möge. „Müssen immer ihren Kommentar loswerden.“ Er wandte sich der Raummitte zu. „Stühle bitte!“ Der Boden öffnete sich; zwei Stühle mit geschwungenem Glasrahmen und Kunstledersitzen schoben sich aus den Schächten. „Nehmen Sie Platz, Lady Marrela; bitte, Commander Lennox.“
Neben dem Stadtmodell lag ein Buch. Tim glaubte, seinen Augen nicht zu trauen: Es war ein in durchsichtigen Kunststoff eingeschweißter Walt-Disney-Comic!
„Micky!“ Erneut rief King Roger den Namen des Unsichtbaren.
Im Bergpanorama flammte der Monitor auf. Eine Mickymaus wurde sichtbar. Sie hob die Hand – eine vierfingrige Hand mit weißen Handschuhen. „Wie geht’s so, Tim? Hi-ho, Marrela!“
So unerwartet einem seit Kindesbeinen vertrauten Bekannten zu begegnen machte Tim erst einmal sprachlos.
„Was liegt an, Roger?“
„Beschaff uns was zu trinken, Micky.“
„Alles klar, Roger. Bin gleich zurück.“ Micky zwinkerte Marrela zu, bevor er aus dem Monitor huschte. Der Bildschirm verblasste.
Tims Verblüffung machte sich in lautem Gelächter Luft. „Was um alles in der Welt war das? Sind Sie Disney-Fan?“
„Das war mein E-Butler“, erklärte der König seelenruhig. „Octavian Hawkins, unser Chef-Bioinformatiker hat ihn für mich geschaffen. Micky ist nicht nur sehr intelligent, sondern auch äußerst sympathisch, finden Sie nicht?“ Er warf seinem Berater einen spöttischen Blick zu. „Was man von Jeffersons E-Butler nicht sagen kann.“
Virtuelle Wesen also. „Sie sprechen von diesen Computer-Animationen, als hätten sie Persönlichkeit“, hakte Tim nach.
„Aber ja doch.“ Die Bemerkung schien den König zu verwirren. „Sie sollten Micky mal erleben, wenn er einen Tobsuchtsanfall bekommt! Oder wenn er sich für mein utopisches London begeistert.“ Ein verklärtes Lächeln huschte über die weichen Züge des Monarchen. „Micky!“, rief Roger III, „sei doch so freundlich und wechsle die Kulisse. Und danach bitte die Kuppel für das Stadtmodell.“
„Wird gemacht“, kam es zurück. „Aber zuerst wird serviert!“ Eine Art Durchreiche öffnete sich in der Kuppelwand. Vier mit gelber Flüssigkeit gefüllte Gläser wurden sichtbar. Jefferson Winter holte das Tablett und verteilte die Gläser.
Als er sich bewusst wurde, dass Tim und Marrela Schutzanzüge trugen, wies er sie in das Procedere ein, wie die Flüssigkeit über einen dünnen Schlauch ins Innere des Helms und weiter in ihre Münder gelangen konnte. Tim probierte vorsichtig – ein Saft. Er schmeckte nach Grapefruit.
Es wurde dunkel. Die Bergwelt verblasste. Nachthimmel wölbte sich stattdessen über dem Raum. Sterne glitzerten, das Milchstraßenband zog sich über die Kuppeldecke.
Der Tisch mit dem Städtemodell wurde aus einer für Tim verborgenen Lichtquelle erleuchtet. Und wieder boten ihm die Technos Grund zum Staunen: Eine leuchtende Halbkugel wuchs plötzlich an der Stelle des Städtemodells, wo die Houses of Parliament am Themseufer standen.
„Meine Utopie.“ Etwas Feierliches lag plötzlich in der Stimme des Königs. „Meine Vision für die Community der Zukunft – eine Projektgruppe arbeitet bereits seit zwei Jahren daran.“
Mit der Selbstvergessenheit eines in sein Spielzeug verliebten Kindes erzählte Roger III von seinem Plan, London wieder aufzubauen. Eine energetische Kuppel sollte die neue Stadt von der feindlichen Umwelt abschotten und zu einer aseptischen Enklave inmitten von Ruinen machen.
Marrela schien aufmerksam zuzuhören. Ihrem konzentrierten Gesichtsausdruck merkte Tim an, dass sie den König belauschte, während er von seiner Vision schwärmte. Vermutlich ergänzte sie auf diese Weise englische Worte, die sie nicht verstehen konnte.
Aufgeregtes Gezwitscher unterbrach Roger III. Tim sah die Konturen der Lerche durch den Sternenhimmel flattern. „Victoria kann eintreten, Micky!“
Die Lerche war also eine Art Türglocke. Woraus der König allerdings auf die Identität seines Gastes draußen vor dem Kuppelraum schließen konnte, blieb Tim verborgen. Vielleicht enthielt das Tschilpen eine Melodie für jeden potentiellen Gast, die man heraushören konnte.
Der bogenförmige Durchgang schob sich auf; eine in ein silbergraues Kostüm gekleidete Gestalt trat ein. Die Körperformen ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig – eine Frau. Unter dem frackartigen Jackett trug sie ein weinrotes Hemd.
„Victoria!“ Der König ging ihr entgegen und hauchte ihr einen Kuss auf die Wange. „Darf ich dir Commander Timothy Lennox und seine Begleiterin vorstellen …“
Tim und Marrela erhoben sich. Die Frau gönnte ihnen die Andeutung eines Lächelns und reichte ihnen die Hand, als würde sie ihnen damit eine Ehre erweisen. Tim wunderte sich über ihren kräftigen Händedruck, verbreitete doch der ganze Habitus der Lady eine unirdische Aura.