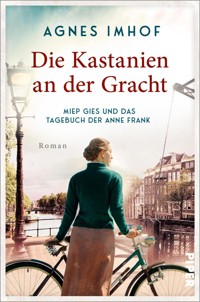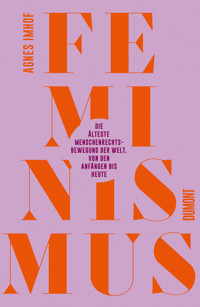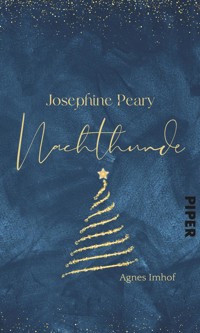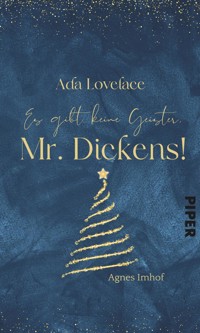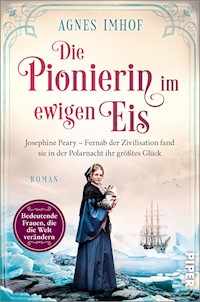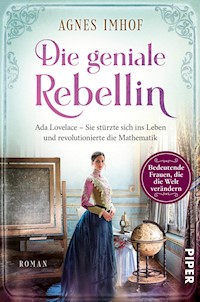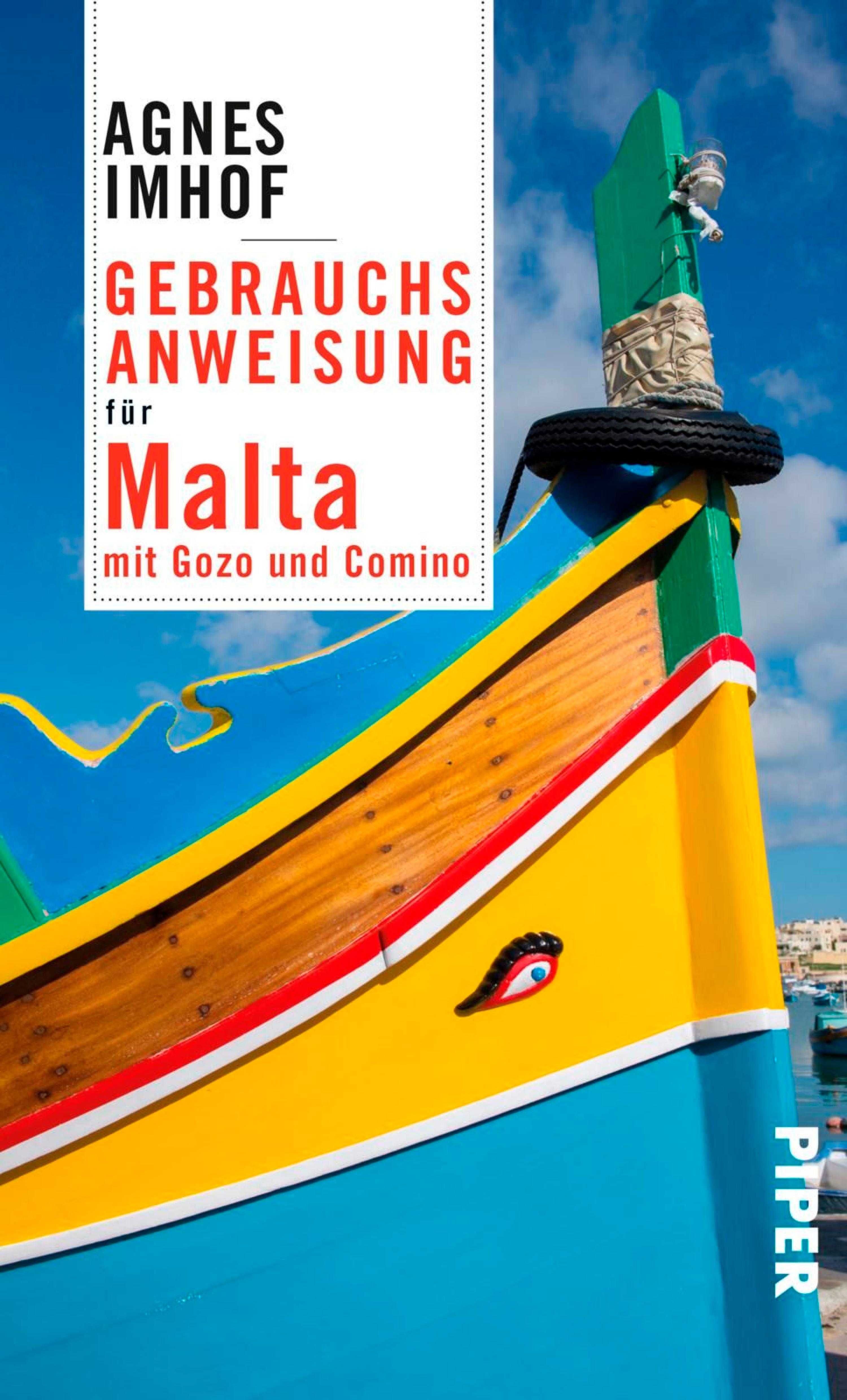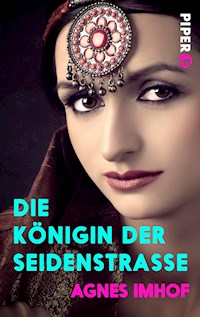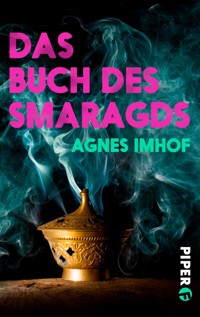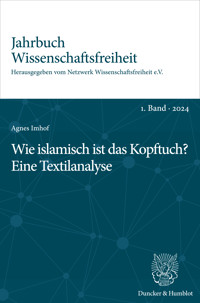
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ist der Schleier Kennzeichen der islamischen Kultur? Angesichts der Entwicklungen im Iran wird die Frage wieder aktuell. Eine Analyse zeigt: In der Bibel finden sich konkretere Hinweise auf ein Verschleierungsgebot als im Koran. Verschleierung ist sowohl diachron als auch synchron auch in anderen Kulturen bekannt. Im Islam ist sie primär Phänomen der zunehmend patriarchalischen Ordnung im Kontext der entstehenden Rechtsschulen. Die Gleichsetzung von Religion und religiösem Recht geht auf Ibn Taimiyya zurück und ist charakteristisch für den Fundamentalismus insbesondere waḥḥābitischer Prägung. Die Abkehr vom Schleier im frühen 20. Jahrhundert steht im Kontext allgemeiner Demokratisierungs- und Emanzipationsbestrebungen. Daraufhin wird der Schleier ein Kernanliegen fundamentalistischer Akteure, die in enger Verbindung mit dem Nationalsozialismus stehen und nach dem 2. Weltkrieg weiter als antikommunistische Macht aufgebaut werden. Anders als oft kolportiert weisen diese Akteure selbst starke westliche Einflüsse auf: Die Darstellung des Schleiers als identitätsstiftendes Kulturmerkmal kann somit als invented tradition charakterisiert werden – und die Vorstellung, jede Muslimin verschleiere sich gern, als naiv-pauschalisierendes Stereotyp.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
[119]
Jahrbuch Wissenschaftsfreiheit, 1 (2024): 119 – 151https://doi.org/10.3790/jwf.2024.1431501
Wie islamisch ist das Kopftuch?Eine Textilanalyse
Von Agnes Imhof*
Abstract
Ist der Schleier Kennzeichen der islamischen Kultur? Angesichts der Entwicklungen im Iran wird die Frage wieder aktuell. Eine Analyse zeigt: In der Bibel finden sich konkretere Hinweise auf ein Verschleierungsgebot als im Koran. Verschleierung ist sowohl diachron als auch synchron auch in anderen Kulturen bekannt. Im Islam ist sie primär Phänomen der zunehmend patriarchalischen Ordnung im Kontext der entstehenden Rechtsschulen. Die Gleichsetzung von Religion und religiösem Recht geht auf Ibn Taimiyya zurück und ist charakteristisch für den Fundamentalismus insbesondere waḥḥābitischer Prägung. Die Abkehr vom Schleier im frühen 20. Jahrhundert steht im Kontext allgemeiner Demokratisierungs- und Emanzipationsbestrebungen. Daraufhin wird der Schleier ein Kernanliegen fundamentalistischer Akteure, die in enger Verbindung mit dem Nationalsozialismus stehen und nach dem 2. Weltkrieg weiter als antikommunistische Macht aufgebaut werden. Anders als oft kolportiert weisen diese Akteure selbst starke westliche Einflüsse auf: Die Darstellung des Schleiers als identitätsstiftendes Kulturmerkmal kann somit als invented tradition charakterisiert werden – und die Vorstellung, jede Muslimin verschleiere sich gern, als naiv-pauschalisierendes Stereotyp.
[120]
I. Textilkunde
Zwei Bilder muslimischer Frauen. Welche ist hochangesehen und kann den Koran rezitieren?
Bildquelle: links: https://mirfaces.com/umm-kulthum-the-voice-of-egypt/; Bild rechts: eigene Aufnahme.
Natürlich die linke: Die ägyptische Sängerin Umm Kulthūm (ca. 1904– 1975) gilt vielen als Inbegriff der arabischen Kultur. Angefangen hat sie mit Koranrezitationen. Sie besuchte eine Koranschule und hat sich stets als gläubige Muslimin betrachtet.1 Und doch: „Entschleiert euch, meine Schwestern!“, soll sie bei ihrem letzten Auslandskonzert ihren Assistentinnen gesagt haben.2 Die Ikone der arabischen Kultur stellte sich gegen den so oft als kulturspezifisch angesehenen und im Namen der Religionsfreiheit eingeforderten Schleier? Tatsächlich war es vor wenigen Jahrzehnten alles andere als üblich, dass sich Frauen in der islamischen Welt verschleierten. Damals waren sie genauso Musliminnen wie heute. Aber sie betrachteten das Kopftuch nicht als Ausdruck ihrer Religion.
Die anhaltenden Proteste gegen die Schleierpflicht im Iran haben die Frage nach dem Schleier neu aufgeworfen. Zeit, noch einmal wissenschaftlich auf Tuchfühlung zu gehen.
[121]
II. Der Schleier – eine kurze Geschichte
Die Verschleierung von Frauen ist erstmals in Assyrien belegt (ca. 1300 BCE), als Ausdruck eines Rechtsstatus. Quelle ist ein assyrischer Rechtskodex: Frauen werden hier als Besitz betrachtet, und die Verschleierung ist Ausdruck dieses Status. Verschleiert werden freie Frauen, Konkubinen und verheiratete Hierodulen (Tempelsklavinnen). Der Schleier zeigt an, dass die Frau schon einem Mann gehört und daher sexuell nicht verfügbar ist. Unverschleiert sind folgerichtig Sklavinnen, unverheiratete Hierodulen und Prostituierte, ihnen ist der Schleier sogar verboten.3 Jastrow sieht entsprechend im Schleier den Ausdruck des Besitzanspruchs eines Mannes auf sein Eigentum, wie auf sein bewegliches Gut („chattels“).4 Frauen sind also Besitz und zeigen durch die Verschleierung an, ob sie jemandem gehören oder verfügbar sind.
Auch Persien (seit den Achämeniden, 550 BCE – 330 BCE), kennt die Frauenverschleierung. Griechische Autoren wie Plutarch berichten von Polygynie und Abschottung der Frauen. Noch unter den Sassaniden (also bis zum Islam, 224/6–642/51) ist Frauenverschleierung bekannt. Allerdings gingen die Frauen hier offenbar nicht mehr zwangsläufig verschleiert und hatten auch Zugang zu Bildung und Öffentlichkeit. Rechtlich gesehen waren aber auch sie eine Sache.5
In Griechenland sind Formen der Frauenverschleierung seit Solon bekannt.6 Frauen wie Männer trugen das sogenannte Himation: einen rechteckigen Überwurf, der um die Schultern, übers Haar und sogar ganz um den Körper gewickelt werden kann und meist über einem Chiton getragen wird, einer Tunika, die aus einem mit Fibeln und einem Gürtel zusammengehaltenen Tuch besteht.7 Das Himation entspricht der römischen Palla bzw. dem Pallium.
[122]
Auch das rabbinische Judentum und das Christentum kennen Verschleierung. Bis heute tragen strenggläubige Jüdinnen Perücken, um ihr Haar nicht zu zeigen. Auch im christlichen Europa sind Schleier bekannt: Durchsichtige Gesichtsschleier, etwa Brautschleier, des weiteren Nonnenschleier, Trauerschleier bzw. Witwenschleier. In Europa ist die Verhüllung des Haars der verheirateten Frau – meist durch eine Haube – Jahrhunderte lang üblich gewesen: Noch heute erinnert die Redewendung „unter die Haube kommen“ daran. Lokal begrenzt gab es auch im katholischen Europa eine allgemeine Verschleierung, etwa in Spanien oder auf Malta. In Spanien war der Schleier unter dem Namen Mantilla bekannt und ist heute noch bei Festtrachten zu sehen, etwa anlässlich der Semana Santa in Sevilla. Die Vollverschleierung von Vejer de la Frontera in der andalusischen Provinz Cádiz ist ebenfalls nur noch als historische Tracht zu sehen8 – ähnliches gilt für die maltesische Għonnella („Röckchen“), die sich bei älteren Frauen bis in die 1980er Jahre hielt.9
Tertullian (ca. 150–220), der erste lateinische Kirchenschriftsteller, begründet seine Forderung nach dem Schleier beim Gebet für alle Frauen10 mit der Anweisung durch Paulus (1 Kor 11, 2–15) Auch hier wird also Verschleierung religiös begründet. Der Text aus dem ersten Korintherbrief lautet: