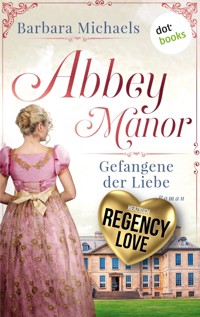Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine stürmische Liebe – ein Band für die Ewigkeit: Der Familiengeheimnisroman »Wilde Manor – Im Sturm der Zeit« von Barbara Michaels jetzt als eBook bei dotbooks. Traumhaft schön steht die alte Villa inmitten blühender Gärten – doch sie verbirgt ein düsteres Erbe … Williamsburg, Virginia: Als die junge Jan Wilde in die Heimat ihrer Familie zurückkehrt, fühlt sie sie sich von dem Haus ihrer Vorfahren wie magisch angezogen. In ihren Träumen sieht sie Wilde Manor plötzlich im 18. Jahrhundert vor sich – und begegnet dort zwei Männern, zu denen Jan sofort eine tiefe Verbundenheit spürt: der geheimnisvolle Jonathan und der ungestüme Charles. Nacht für Nacht kehrt Jan zu ihnen zurück – und schon bald muss sie sich entscheiden, wo ihr Herz zu Hause ist … Jetzt als eBook kaufen und genießen: Das Romantik-Highlight »Wilde Manor – Im Sturm der Zeit« von Bestseller-Autorin Barbara Michaels – für alle, die »Outlander« lieben. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Traumhaft schön steht die alte Villa inmitten blühender Gärten – doch sie verbirgt ein düsteres Erbe … Williamsburg, Virginia: Als die junge Jan Wilde in die Heimat ihrer Familie zurückkehrt, fühlt sie sie sich von dem Haus ihrer Vorfahren wie magisch angezogen. In ihren Träumen sieht sie Wilde Manor plötzlich im 18. Jahrhundert vor sich – und begegnet dort zwei Männern, zu denen Jan sofort eine tiefe Verbundenheit spürt: der geheimnisvolle Jonathan und der ungestüme Charles. Nacht für Nacht kehrt Jan zu ihnen zurück – und schon bald muss sie sich entscheiden, wo ihr Herz zu Hause ist …
Über die Autorin:
Hinter der US-amerikanischen Bestsellerautorin Barbara Michaels steht Barbara Louise Gross Mertz (1927–2013), die auch unter dem Pseudonym Elizabeth Peters erfolgreich Kriminalromane schrieb. Die Autorin promovierte an der University of Chicago in Ägyptologie. So haben auch ihre Romane, für die sie zahlreiche Preise gewann, meist einen historischen Hintergrund.
Eine Übersicht über weitere Romane von Barbara Michaels bei dotbooks finden Sie am Ende dieses eBooks.
***
eBook-Neuausgabe März 2020
Dieses Buch erschien bereits 1990 unter dem Titel »Spuren der Vergangenheit« bei Heyne
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1976 by Barbara Michaels
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1976 unter dem Titel »Patriot’s Dream« bei Berkley, New York.
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1990 bei Heyne
Copyright © der Neuausgabe 2020 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Loocmill, Frame Art, Somyk Volodymyr und Period Images/Dunraven/Mary Chronis
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (tw)
ISBN 978-3-96655-174-8
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Wilde Manor« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Michaels
Wilde Manor – Im Sturm der Zeit
Roman
Aus dem Amerikanischen von Hilde Linnert
dotbooks.
Für Sandy,
in deren entzückendem Salon mir die Idee zu Patriot’s Dream zum ersten Mal kam.
Prolog
I. Leah
Der Mann, der sie kaufte, nannte sie Leah. Ihren wirklichen Namen hatte sie längst vergessen. Sie hatte auch den Namen ihres Stammes vergessen, falls sie ihn je gewußt hatte; einem modernen Anthropologen wäre es allerdings nicht schwer gefallen, sie einzuordnen. Die braune Haut, das lange, lockige, dunkle Haar, die schmalen Lippen und die Adlernase waren typisch für die Fulani, die im Inneren des Senegal leben.
Die Reise nach Amerika war Leahs zweites Zusammentreffen mit Sklavenhändlern. Sie war sechs Jahre alt, als sie zusammen mit drei anderen Kleinkindern zum ersten Mal gestohlen wurde; ihre Mütter hatten sie unter einem Baum zurückgelassen, während sie auf dem Feld arbeiteten. Die Sklavenhändler waren Mandingos. Das große Mandingoreich mit seiner Universitätsstadt Timbuktu befand sich im Niedergang, aber die Mandingos waren immer noch mächtige Plantagenbesitzer und Händler. Zu den Handelsgütern gehörten Sklaven, denn für die riesigen Plantagen benötigte man Hunderte Feldarbeiter. Die Wirtschaft dieses Landes besaß eine gewisse Ähnlichkeit mit jener, die sich in einem anderen Land auf einem weit im Westen liegenden Kontinent entwickelte.
Leah wurde Haussklavin und gebar ihrem Herrn zwei Kinder. Beide starben. Sie war ungefähr sechzehn, als der nächste Trupp Sklavenhändler ihr Leben veränderte. Ihr Herr kämpfte tapfer, um sein Eigentum zu schützen, jedoch vergeblich. Die Sklavenhändler waren Profis, die ausgezeichnet davon lebten, daß sie den Schiffen, die in immer größerer Zahl die Küsten Afrikas aufsuchten, menschliche Fracht lieferten.
Die Menschenräuber machten ungefähr fünfzig Gefangene, darunter Leah. Der Marsch zur Küste dauerte fünf Tage. Dort wurden die Neuen in die mit mehreren hundert Gefangenen vollgestopften Baracken getrieben. Leah verbrachte nur eine Nacht bei ihnen, denn außerhalb der Bucht lag bereits ein Schiff vor Anker. Es war ein englisches Schiff, hätte aber genausogut ein holländisches oder schwedisches sein können, oder sogar ein amerikanisches, obwohl die Yankeehändler erst später forciert in Guinea auftraten, nachdem der Sklavenhandel gesetzlich verboten worden war und die Gewinne entsprechend größer waren.
Am frühen Morgen wurden 250 Sklaven aneinandergekettet und zum Strand getrieben. Das Dröhnen der Brandung klang für die Gefangenen, von denen viele den Ozean noch nie gesehen hatten, wie die Stimme eines großen, zornigen Tieres. Sie begannen, vor Angst zu schreien, und einige versuchten wegzulaufen. Als die Panik um sich griff, wurden die Schwächeren von den Stärkeren mitgerissen, weil sie aneinandergefesselt waren. Das Gebrüll und die Schläge der Treiber stellten die Ordnung bald wieder her, und die Gefangenen gingen weinend und stöhnend weiter. Als sie die Kuppe eines niedrigen, sandigen Hügels erreichten, erblickten sie den Ozean.
Keines von Leahs Erlebnissen machte einen größeren Eindruck auf sie als dieser Anblick. Sie beschrieb ihn später oft ihren Kindern. Berge aus Wasser brachen sich an der öden Küste. Das Geräusch der Brandung klang wie Donner, und der Wind fühlte sich auf ihrer nackten Haut kalt an. Leah warf sich zu Boden und grub die Nägel in den Sand; aber grobe Hände zogen sie in die Höhe, lösten die Ketten und zwangen sie ins Wasser. Der Schaum wirbelte um ihre Knöchel, als sie in eines der wartenden Kanus geworfen wurde. Die Besatzungen der Kanus waren erfahrene Seeleute, die die Tücken der trügerischen Wellen kannten. Genau im richtigen Augenblick wurden die Paddel eingesetzt, und unter triumphierenden Rufen flogen die kleinen Boote über die Barre hinweg zum wartenden Sklavenschiff.
Zwei großen, starken Männern in Leahs Boot gelang es, über Bord zu springen und sich so zu ertränken, aber sie unternahm keinen Fluchtversuch. Sie war vor Entsetzen wie betäubt, denn sie wußte, was sie erwartete. In der vorhergehenden Nacht hatten die Sklaven einander Gerüchte zugeflüstert. Das Schiff kam aus einem fernen Land, das Jong sang doo hieß, »das Land, in das die Sklaven verkauft werden«. Die Menschen in Jong sang doo waren Wilde, die Menschenfleisch aßen.
Es war eine schlechte Überfahrt. Der Kapitän war nicht daran schuld; er ergriff alle erforderlichen Maßnahmen. Die männlichen Sklaven wurden jeden Tag an Deck gebracht, um zu »tanzen«. Die Bewegung war für die von den Ketten wundgeriebenen Hand- und Fußgelenke schmerzhaft, aber man nahm an, daß sie Skorbut und die selbstmörderische Melancholie verhinderte, die beinahe genauso viele Leben forderte wie die Krankheiten. Die Frauen und Kinder durften sich frei bewegen und wurden nur nachts wie Klafterholz im Laderaum verstaut. Wie alle Frauen erhielt Leah einen Platz, der 160 cm lang und 35 cm breit war. Den Männern stand etwas mehr Raum zur Verfügung – 180 mal 40 cm. Unglücklicherweise geriet das Schiff in Schlechtwetter, und die Sklaven mußten zwei Wochen lang Tag und Nacht in ihren sargförmigen Unterkünften bleiben. Ruhr und Pocken grassierten.
Es wäre für Leah kein Trost gewesen, wenn sie gewußt hätte, daß auf den englischen Sklavenschiffen die Sterblichkeit bei der schwarzen Fracht sogar etwas geringer war als bei der weißen Besatzung. Die Sklaven bedeuteten für den Kapitän bares Geld, die Matrosen nicht. Sie wurden ausgepeitscht, hungerten, wurden durch Skorbut und Syphilis arbeitsunfähig und wurden so schlecht behandelt, daß die Sklaven manchmal hungernden Matrosen aus Mitleid einen Teil ihrer eigenen, kargen Ration gaben.
Als das Schiff endlich Virginia erreichte, hielten sich nur noch sechs Besatzungsmitglieder auf den Beinen. Von den ursprünglich 250 Sklaven waren noch hundert am Leben. Ein Gefühlsmensch würde vielleicht sagen, daß Leah zu jenen gehörte, die Pech hatten. Leah war kein Gefühlsmensch und daher froh, daß sie lebte und dem Laderaum entronnen war.
Sie wurde in Jamestown versteigert und von einem Tabakpflanzer namens Johnson gekauft. Ihre Fulani-Hautfarbe und ihr Körperbau, den mehrere Wochen unzureichender Ernährung vergeistigt hatten, entsprachen Johnsons Geschmack. Mrs. Johnson, eine blasse Dame mit langer Nase, die aus einer Seitenlinie der Byrds kam, war genauso wenig erstaunt wie die Nachbarn, als Leahs Kind um etliche Schattierungen heller war als seine Mutter und das typische Johnsonkinn aufwies. Das zweite Kind, ein Mädchen, sah seinem Vater erstaunlich ähnlich, was ihn aber nicht daran hinderte, es zu verkaufen, als er Geld brauchte.
Leah wurde beinahe sechzig Jahre alt, und als sie starb, hatte sie den Überblick über die Zahl ihrer Enkel verloren. Es ist bedauerlich, aber wahr, daß sie das Leben in der Neuen Welt als nicht besonders angenehm empfand. Es unterschied sich nicht sehr von ihrem Leben in Afrika – sie diente einem Mann und brachte seine Kinder zur Welt. Aber in Virginia blieben ihre Kinder am Leben.
II. Charles
Charles Wilde war nach einem König benannt worden, weil sein Vater es für eine gute Idee hielt. Doch das war im Jahr 1630 gewesen. 1649 verlor Charles von England seinen Thron und dann seinen Kopf. Zugegebenermaßen hatte er nur sehr wenig zu verlieren. Später erklärten die stolzen Nachkommen der royalistischen Familien das Nichtvorhandensein des Silbergeschirrs damit, daß es für die Sache des Königs eingeschmolzen worden war. Auch die Wildes behaupteten es, doch in Wirklichkeit hatten sie weder Geschirr noch einen Tisch besessen, auf den sie es stellen konnten. 1630 war das Herrenhaus nur noch eine baufällige Ruine, und die Pächter waren längst zu fetteren Weiden fortgezogen. Die Umwälzungen durch den Bürgerkrieg lieferten Charles’ Vater den ersehnten Vorwand, um sein Zuhause und die peinlichen Schulden hinter sich zurückzulassen, deretwegen die Familie finanziell noch etwas schlechter gestellt war als die eines fleißigen Handwerkers.
Francis Wilde begab sich zuerst mit seinem Sohn auf den Kontinent; als er feststellte, daß es hier bereits übergenug Männer gab, deren einzige Talente im Trinken und Spielen bestanden, reiste er in Seiner Majestät Kolonie Virginia weiter. Die gesetzgebende Versammlung der Kolonie war über die Hinrichtung des Königs entsetzt gewesen und hatte seinen Sohn Charles II. zum König ausgerufen; Gouverneur Berkeley gewährte fliehenden Royalisten Schutz und Trost.
Die Wildes mochten das neue Land, was nicht erstaunlich war, da Berkeley und seine Freunde ihr Bestes taten, um das alte System des Landadels wieder herzustellen. Da Wilde offiziell ein »Gentleman« war, wurde ihm Land zugewiesen, so daß er sich den seiner Stellung entsprechenden Beschäftigungen widmen konnte – Trinken und Spielen.
Es wäre erfreulich, wenn man berichten könnte, daß Francis Wilde so starb, wie es seiner Position geziemte. Seine Nachkommen verbreiteten die Legende, daß er in einem Duell getötet wurde. In Wirklichkeit ertrank er in 15 cm tiefem, schlammigem Wasser, als er nach einem längeren Trinkgelage bei einem Freund mit dem Gesicht nach unten in einen Bach fiel.
1660, als die Engländer Charles II. wieder auf den Thron setzten, war Charles Wilde dreißig Jahre alt. Er besaß eine Frau, die ihm 300 an den von seinem Vater ererbten Besitz grenzende Acres mit in die Ehe gebracht hatte. Er dachte nicht daran, nach England zurückzukehren, denn es ging ihm sehr gut.
Berkeley war ein kluger, alter Aristokrat und hatte ruhig abgewartet, bis Cromwells Herrschaft zu Ende ging. Als die Monarchie wieder eingesetzt wurde, bekannte er Farbe. Er und seine Anhänger besetzten die Ratsversammlung mit ihren eigenen Leuten und entzogen der untergeordneten gesetzgebenden Körperschaft, dem House of Burgesses, beinahe ihre gesamte Macht. Die Ratsherren schanzten einander Ländereien und große Gehälter zu. Charles war ein Ratsherr. Als er 1670 starb, war sein Besitz von 500 auf beinahe 7000 Acres angewachsen.
Sein Sohn Nicholas war nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt. Charles haßte den Jungen, den er unter anderem »Wechselbalg« und »Tugendbold« nannte. Nicholas war schlank und blond und hatte die feinen Gesichtszüge seiner Mutter geerbt. Er war eine Leseratte, und Charles wies bei jeder Gelegenheit darauf hin, daß dies ein verderbliches Laster sei. Trotzdem ist es nicht ganz erklärlich, warum Nicholas später eine so seltsame Entscheidung traf. Sein Vater war zu jener Zeit bereits tot, also konnte er es nicht getan haben, weil er den Alten ärgern wollte.
Über die Gründe für Bacons Rebellion ist viel diskutiert worden. Berkeley und seine Freunde hatten den Männern, die sich 1676 Nathaniel Bacon anschlossen, ihre schwer erarbeiteten Ländereien gestohlen; sie waren Grenzer, deren verzweifelte Forderungen um Hilfe gegen die Massaker der Indianer der sicher in Jamestown sitzende Gouverneur nicht beachtete. Man kann die Rebellion als Protest »des Volkes« gegen die Aristokratie sehen. Bacon war zwar ein »Gentleman«, aber er gehörte nicht zu Berkeleys Günstlingen, also waren seine Motive vielleicht nicht ganz selbstlos. Nicholas hatte jedenfalls keinen Grund, sich ihm anzuschließen. Aber er tat es.
Die Rebellion wurde niedergeschlagen. Berkeley, der zuvorkommende, zivilisierte Aristokrat, ließ zwanzig Rebellen hängen. Er wurde deshalb von Charles II. getadelt, der verärgert bemerkte: »Dieser alte Narr hat in dem öden Land mehr Männer gehängt als ich für die Ermordung meines Vaters.« Das stimmte, aber es war für die Gehenkten kein großer Trost.
Nicholas wurde weder gehängt noch wurde sein Besitz konfisziert, wie es vielen Rebellen erging. Die Versammlung verhängte folgende Strafe über ihn: »Nicholas Wilde, Gentl., soll mit einem Strick um den Hals den Gouverneur und die Ratsversammlung auf den Knien um sein Leben bitten, und in der gleichen Haltung seine Verbrechen der Rebellion und des Hochverrats vor Gericht eingestehen, und er soll Seiner Majestät dem König eine Strafe von 50000 Pfund in handelsüblichem Tabak und Brandy bezahlen …«
Diese Erfahrung übte auf Nicholas offenbar eine erzieherische Wirkung aus. Er wurde einer von Berkeleys Ratsherren und bezahlte nicht nur die Strafe, sondern gelangte zu Wohlstand. Seine Nachkommen besaßen im Tidewater über 200 000 Acres. Zur Zeit einer anderen Rebellion, die ein Jahrhundert nach Bacons Aufstand erfolgte, war der Name Wilde in Virginia genauso bekannt wie die Namen Byrd oder Carter. Nicholas’ Erben besaßen ein Haus in Williamsburg und eines der schönsten Herrenhäuser im Tidewater, das Nicholas aus nur ihm bekannten Gründen The Folly (Die Torheit) genannt hatte.
III. Johann
Der »Mordwinter« des Jahres 1705 wurde in Deutschland sprichwörtlich. Angeblich erfroren die Vögel in der Luft und fielen zu Boden – vermutlich schlugen sie hörbar auf und verbreiteten einen Schauer von Eissplittern. Das ist wahrscheinlich übertrieben, aber es war tatsächlich ein sehr kalter Winter. So vollendete die Natur, was die Menschen begonnen hatten, und im Dorf Bergstein bestand die Familie des Johann Müller schließlich nur noch aus Johann.
Er war ungefähr siebzehn, als er sich an einem Dezembertag aus seiner knienden Stellung erhob. Er hatte neben der Leiche seines Vaters, der an Hunger und Kälte gestorben war, gebetet. Johanns Mutter war fünf Jahre zuvor getötet worden, als Anhänger des katholischen Herzogs durch das protestantische Dorf ritten und nach einem Zeitvertreib sowie Ungläubigen Ausschau hielten – in dieser Reihenfolge. Seine Brüder und Schwestern waren auf verschiedene Arten ums Leben gekommen, und es würde zu weit führen, sie hier zu schildern. Das Dorf lag in einem durch die Religionskriege verwüsteten Landstrich. Die glücklosen Bauern bekamen nur selten Gelegenheit, sich für den Papst oder Luther zu entscheiden, weil sie schon vorher von der zufällig im Dorf anwesenden Partei massakriert wurden.
Unterdrückung war für Johanns Familie nichts Unbekanntes. Fünf Generationen zuvor war einer seiner Vorfahren beim Blutbad von Münster getötet worden, weil er die Kindstaufe verweigerte. Andere hatten ihr Leben nicht ihres Glaubens wegen verloren, sondern weil sie ihn zu langsam gewechselt hatten. 1555 war im Frieden von Augsburg das Prinzip festgelegt worden »Cuius regio, eius religio«, was bedeutete, daß die Bauern sich den religiösen Vorlieben ihrer Herren anschließen mußten. Aber die Kurfürsten wechselten die Religion während ihrer Regierungszeiten alle vier Jahre, wodurch es für ihre Untertanen etwas schwierig wurde, sich für eine sichere Religion zu entscheiden.
Nicht alle Müllers starben heldenhaft für ihren Glauben. Es gab auch genügend nicht-religiöse Kriege, auf die logischerweise jedesmal Hungersnöte, Seuchen und ähnliche, dem Leben nicht förderliche Zustände folgten – während Freiheit und Streben nach Glück für europäische Bauern nach wie vor unbekannte Begriffe blieben. Wenn gelegentlich ein Müller überlebte, dann deshalb, weil sie so zahlreich waren.
Lange Leiden stumpfen glücklicherweise ab. Als sich Johann an diesem Dezembertag steifbeinig aufrichtete, bewegte ihn nur die Frage, was er jetzt tun sollte.
Er war flachsblond und hatte derbe Gesichtszüge; eigentlich sollte er stämmig gebaut sein, aber er war halb verhungert, und seine kräftigen Knochen schienen sich durch die schlaffe Haut seines Gesichts und seiner Arme bohren zu wollen. Ihn schwindelte vor Hunger; als er aufstand, drehte sich alles um ihn, und er stützte sich mit der Hand gegen die rohe Holz wand. Ein Splitter, der ihm in die Handfläche drang, vertrieb die Benommenheit ein wenig, und er blickte auf das erstarrte Gesicht seines Vaters hinunter, das so weiß war wie der lange, wirre, weiße Bart, der Herrn Müllers Brust bedeckte – weiß wie Eis und bereits halb gefroren. Die Kälte des Todes war nicht kälter als das ungeheizte Haus.
Johann drückte die starrenden Augen zu, drehte sich um und verließ das Haus. Er nahm nichts mit und schloß nicht einmal die Tür.
Nur der strenge protestantische Gott, an den er einmal geglaubt hatte, weiß, wie er sich im Winter und noch dazu zu Fuß durch halb Europa durchschlug. Er wußte, wohin er ging. Einige seiner Nachbarn hatten sich bereits auf die Reise nach Amerika gemacht, nachdem die Agenten Penns, des Quäkers, die ausgedehnten, fruchtbaren Äcker beschrieben haften, die jeder umsonst erhielt, der bereit war, sie zu bearbeiten. Penn versprach auch, daß jeder Gott auf seine Weise verehren konnte. Das hielt Johann für unmöglich, aber in diesem Augenblick war es für ihn unwichtig. Während er Meile um Meile hungrig durch den Winterwald stolperte, setzte sich in seinem Geist ein einziger Wunsch fest. Es war eine der wenigen abstrakten Vorstellungen, zu denen er jemals fähig gewesen war. Vielleicht wurde sie deshalb im Lauf der Zeit zur fixen Idee.
Er besaß kein Geld für die Überfahrt nach Amerika, aber er hatte nicht angenommen, daß dies ein Problem darstellen würde, und damit hatte er recht. Der Kapitän in Rotterdam nahm ihn nur zu gerne für sieben Jahre Knechtschaft in seine Dienste.
Auf der Good Intent befanden sich vierhundert Passagiere. Das Wasser war so knapp, daß die Ratten den schlafenden Auswanderern den Schweiß vom Gesicht leckten und Löcher in die Decke der Wasserfässer nagten. Gegen Ende der zwei Monate dauernden Überfahrt nützte ihnen das auch nichts mehr; der Wasserstand war zu niedrig. Aber es gab genügend Schweiß.
Als das Schiff in Pennsylvanien anlegte, waren noch 250 Passagiere am Leben, die meisten von ihnen waren Schuldner des Kapitäns. Ein reicher Spekulant erwarb die ganze Schar, marschierte mit ihnen von Stadt zu Stadt und verschacherte Stück für Stück seiner Ware. Johann wurde um zehn Pfund – den üblichen Betrag – von einem Kaufmann in Philadelphia erworben, der westlich der Stadt einen großen Landsitz besaß. Es wäre zutreffender zu sagen, daß seine Dienste gekauft wurden, denn er besaß Leah gegenüber einen eindeutigen Vorteil: Wenn er nicht vor Erschöpfung oder an einer Krankheit starb, war er eines Tages frei. Er betrachtete die Situation allerdings nicht so optimistisch und lief zweimal davon. Er wurde beide Male wieder eingefangen, und beim zweiten Mal ließ ihn sein Herr, der sich über seine Unabhängigkeit ärgerte, auspeitschen. Johann lief nicht wieder davon. Es waren nicht so sehr die Peitschenhiebe, die ihn dazu bewegten, sondern die Tatsache, daß die Wochen der Freiheit seiner Dienstzeit hinzugefügt wurden. Er gab Frieden und wurde ein ausgezeichneter Arbeiter. Sein Herr stellte fest, daß er gut mit Holz umgehen konnte, und ließ ihn zum Zimmermann ausbilden.
Nachdem Johann seine Zeit abgedient hatte, erhielt er ein Zeugnis und alles, was ihm für seine Freiheit zustand. Wäre er einige Jahre früher eingetroffen, so hätten fünfzig Acres Land dazugehört. Um 1700 wurde Land bereits knapp. Johanns Bezahlung für sieben Jahre Knechtschaft waren zwei Anzüge (einer davon neu), ein Ochse, eine Hacke zum Roden und eine zum Jäten. Er machte sich auf den Weg, um Land zu suchen, auf dem er die letzten drei Gegenstände verwenden konnte. Der Gedanke, der sich während der Wanderung nach Rotterdam in seinem Gehirn festgesetzt hatte, war durch die Jahre der Knechtschaft zur verbissenen Entschlossenheit geworden. Er würde nie wieder das Land eines anderen pflügen.
In Westvirginia gab es bereits deutsche Ansiedlungen, die Gouverneur Spotswood zur Verteidigung der Grenze gegen die Indianer in Piedmont gegründet hatte. Johann blieb eine Zeitlang bei den Siedlern in Germanna, doch ihr wackeliges Fort und die beiden kleinen Kanonen gaben ihm nicht das Gefühl der Sicherheit. Außerdem stellte er beunruhigt fest, daß der Gouverneur ihn und die übrigen Siedler als seine Pächter betrachtete, denn Spotswood hatte etwa 300 Acres als seinen persönlichen Besitz beansprucht. Johann zog weiter, nahm seinen Ochsen und seine Hacken mit, aber auch seine Neuerwerbungen – einen Wagen, ein Pferd und eine Frau, Tochter aus einer der Germannafamilien. Daß seine Frau Lutheranerin, also nach den strengen Maßstäben des mennonitischen Glaubens eine Ketzerin war, störte ihn nicht. Er hatte auf gehört, viel an Gott zu denken.
Weiter im Süden fand er Land und blieb einige Jahre dort. Warum er weiterzog, weiß man nicht. Vielleicht hatte der Tod seiner Frau und zwei seiner Kinder damit zu tun; dazu kam, daß er wieder einmal erfuhr, er besitze keinen gesetzlichen Anspruch auf das Land, das er mit so schwerer Arbeit gerodet hatte. Die Aristokraten des Ostens, die Berkeleys und Fairfaxes, hatten in den westlichen Gebieten riesige Ländereien erhalten, und sogar die Siedler, die ihr Land von Spekulanten gekauft hatten, waren in Gefahr, gewaltsam vertrieben zu werden oder noch einmal zahlen zu müssen.
Johann drängte sich der Schluß auf, daß er die falschen Methoden angewendet hatte, um an sein Ziel zu gelangen. Er ließ sein einziges am Leben gebliebenes Kind bei Nachbarn zurück und zog nach Osten. Auf einer Plantage am James suchte er Arbeit als Handwerker. Die Plantagenbesitzer errichteten zu jener Zeit schöne Häuser im Stil der englischen Herrensitze, und Johanns Künste als Holzschnitzer waren sehr gefragt.
Zu dieser Zeit war er fünfunddreißig und gebaut wie Herkules. Die unablässige schwere Arbeit, die so viele Einwanderer tötete, hatte ihn nur stärker gemacht, und sein flachsblondes, dichtes Haar bildete einen auffallenden Gegensatz zu der tiefen Bräune, die er der Sonne von Virginia verdankte. Er war auf sein Aussehen nicht stolz, aber er konnte nicht die Blicke übersehen, die ihm die Frau seines Arbeitgebers zuwarf, und auch nicht die durchsichtigen Ausreden, die sie erfand, um mit ihm zusammenzukommen und zu sprechen. Als der Herr der Besitzung starb, kam es Johann vor, als hätte Gott ihm beifällig zugenickt. Er kehrte sogar im Alter zu seinem ursprünglichen Glauben zurück und wurde beinahe bigott. Er war kein großer Denker, er bemerkte nicht die Ironie, die in der Tatsache lag, daß er seinen Traum von Land und Unabhängigkeit nicht durch Tugend und harte Arbeit verwirklicht hatte, sondern dank einer Eigenschaft, die er und sein Gott mißbilligten – bei anderen Menschen.
IV. Anne
1642 nahm die gesetzgebende Versammlung von Virginia ein Gesetz an, das Schuldner von der Verfolgung durch ihre Gläubiger in England befreite. Anne Brown hatte nichts von diesem Gesetz gehört, aber sie wußte, daß Virginia weit von England entfernt war, und daß es den Gläubigern ihres Vaters schwerfallen würde, ihn hier zu finden, selbst wenn er den Namen beibehielt, den er in den letzten Jahren verwendet hatte. Dieser Name war nicht Brown.
Frederick entstammte einer tugendhaften Bauernfamilie im Grenzgebiet zwischen Schottland und England, und war eines jener Kinder, die die Erbgesetze Lügen strafen. Er sah bemerkenswert gut aus, hatte lange, schlanke Hände und zarte Knochen und nicht die geringste Ähnlichkeit mit seinen vierschrötigen Geschwistern. Als Frederick immer größer und schöner wurde, hatte seine Mutter unter dieser Tatsache zu leiden – vollkommen ungerechterweise, denn Frederick war wirklich der Sohn seines Vaters. Er war einfach ein Rückfall in eine längst vergessene Sammlung aufdringlicher Gene; aber es ist nicht erstaunlich, daß seine Mutter, die ihre blauen Flecken rieb, ihn allmählich genauso wenig mochte wie sein Vater. Frederick verließ sein Vaterhaus, sobald er alt genug war, daß er die Aufmerksamkeit einer Lady erregte, die auf dem Weg nach London durch sein Dorf kam.
Er besaß eine rasche, wenn auch oberflächliche Auffassungsgabe, und innerhalb eines Jahres hatte er gelernt, die Sitten jener Klasse nachzuahmen, in die er aufgenommen werden wollte. Als er seine erste Beschützerin verließ, nahm er einen anderen Namen an. Er leugnete bescheiden jede Verbindung mit den edlen Fairfaxes, aber seine Zuhörer bekamen jedesmal den deutlichen Eindruck, daß er von diesem großen Clan grausam verstoßen worden war. Zu seinem Pech fehlte ihm die Skrupellosigkeit, die ihm wenigstens einen bescheidenen Erfolg beschert hätte; die Schönheit, die die Aufmerksamkeit der Lady erregte, trug ihm nicht die Sympathie des Ehemannes der Lady oder anderer Ehemänner ein. Sein gutes Aussehen schwand bald. Als er einmal während eines kurzen Zeitraums reich war, heiratete er die hübsche Tochter eines Händlers aus Bristol. Das Paar lebte einige Jahre von ihrer Mitgift. Zu ihrem Glück starb die junge Frau im Kindbett, bevor das gesamte Geld verbraucht war.
Frederick hätte das Kind auch im Stich lassen können. Er tat es nicht, denn seine Freundlichkeit war genauso echt wie seine Unfähigkeit, den Menschen, die er liebte, wirklich von Nutzen zu sein. In späteren Jahren segnete er seine Barmherzigkeit mit gutem Grund, denn seine Tochter hielt ihn viel länger am Leben, als er von Rechts wegen erwarten konnte.
Anne hatte das Aussehen ihres Vaters geerbt, auch seine Augen, die allein genügt hätten, um das Gesicht einer Frau schön zu machen. Die Wimpern waren dicht und dunkel, die Augen leuchtend grün und genauso hart und undurchsichtig wie Jade. Sie war fünfzehn, als sie zu der Erkenntnis gelangte, daß die einzige Hoffnung der Fairfaxes die Emigration war, aber sie sah um etliche Jahre älter aus, und ihre Figur bestätigte, was die jadegrünen Augen versprachen. Die Augen und die Figur hatten Frederick aus etlichen Klemmen geholfen, und die langen, schlanken Beine hatten Anne vor den Folgen gerettet. Sie konnte sich aus Schwierigkeiten heraus winden wie ein Aal.
Sie holte ihren Vater aus Newgate, wo er etliche Zeit verbracht hatte, mit der unfreiwilligen Hilfe eines Edelmannes heraus, der ein Frettchengesicht und böse Absichten hatte, und dessen Namen sie nie erfuhr. Er hatte sich von ihrem unschuldigen Gesicht und ihren kupferroten Locken verführen lassen, hatte sie zu sich eingeladen und seinem Diener für diesen Abend freigegeben. Als Anne ihn verließ, lag er schnarchend auf dem Boden seines üppigen Schlafzimmers, dessen Decke mit nackten Göttinnen verziert war. Sie nahm den silbernen Kerzenhalter, mit dem sie ihn eingeschläfert hatte, sowie sein gesamtes Bargeld mit. Sie befürchtete nicht, daß er sie verfolgen lassen würde, denn das Geständnis, daß ihn ein Mädchen niedergeschlagen hatte, das halb so groß war wie er, wäre zu demütigend gewesen; aber sie ging kein Risiko ein. Sie verstand es gut, sich zu verkleiden; das war eine der nützlichen Fähigkeiten, die sie während ihrer kurzen, aber hektischen Laufbahn erworben hatte; und wenn sie ausging, versteckte sie von nun an die Locken unter einem Kopftuch und die üppigen Kurven unter einem zerrissenen Dienstbotenkittel.
Sie brauchte eine Woche, um die Freilassung ihres Vaters zu erreichen und Schiffskarten für die Deliverance zu erhalten. Für diese Transaktion tauchten die Locken und die Kurven wieder auf. Das Ergebnis waren gewisse Schwierigkeiten, aber mit denen wurde Anne mühelos fertig. Sie schloß sich an die einzige vornehme Dame an, die sich auf dem Schiff befand, die Frau eines Plantagenbesitzers in Virginia, und dieses leichtgläubige Frauenzimmer ließ sich von Annes tränenfeuchten Augen und gerungenen Händen behexen und schaffte es, den Kapitän von ihrer süßen kleinen Freundin fernzuhalten. Anne hatte keineswegs die Absicht, ihren wertvollsten Besitz so billig zu verkaufen. Sie hatte gehört, daß in den Kolonien Mangel an Frauen herrschte und daß ihnen nur eine einzige achtbare Laufbahn offenstand.
Der Schutz der edelmütigen Dame endete nicht, als das Schiff anlegte. Sie überredete ihren Mann dazu, die Dienste von Vater und Tochter zu kaufen, und da es einem so zarten, kultivierten Mann offensichtlich unmöglich war, auf den Tabakfeldern zu arbeiten, wurde Frederick zum Aufseher ernannt. Für diese Aufgabe war er vollkommen ungeeignet, aber sein Herr hatte keine Zeit, das herauszufinden. Die Plantagen lagen an Flüssen, weil die Tabakernte nur auf dem Wasserweg transportierbar war, und die Moskitos, die in den Sümpfen gediehen, saugten gierig das Blut der von der langen, anstrengenden Reise erschöpften Männer. Frederick starb innerhalb eines Monats, so wie vier Fünftel der frisch importierten Diener.
Anne betrauerte seinen Tod aufrichtig, aber sie hatte keine Zeit, sich dieser Trauer hinzugeben. Ihre Herrin bedauerte bereits ihre Großzügigkeit, denn sie hatte mißtrauisch beobachtet, wie bereitwillig ihr Mann das nutzlose Paar auf genommen hatte. Da sie keine raffinierte Frau war, bot sie Anne an, ihre Schulden zu streichen und ihr eine nette, kleine Aussteuer zu geben, damit sie einen der Männer heiraten konnte, die sich allmählich um sie drängten. Anne hatte richtig kalkuliert: Es gab nur sehr wenige Frauen, und sie hatte die Wahl zwischen einem halben Dutzend kleiner Farmer. Aber ihr Ehrgeiz ging höher, und ihre Hoffnungen gründeten auf kluger Berechnung. Ihre Herrin gehörte zu den Unglücklichen, die in diesem ersten Jahr starben, bevor sie sich an das Klima gewöhnen konnten. Kurz darauf heiratete Anne ihren ehemaligen Herrn. Sie war ihm eine gute, wenn auch ein wenig verschwenderische Frau, und schenkte ihm zwölf Kinder. Außerdem überlebte sie ihn. Gerüchte behaupteten, daß sie ihn vergiftet hätte, aber natürlich konnte nichts bewiesen werden. Ihre Kinder waren nach den Maßstäben jener Zeit recht wohlerzogen, aber Annes Gene waren noch aktiv und kamen bei späteren Nachfahren manchmal sehr überraschend zum Vorschein. Die alten Gerüchte über Annes Giftmischerei lebten wieder auf, als eine ihrer Enkelinnen ebenfalls dieser Tat beschuldigt wurde. Mary hatte angeblich ihren alten, lasterhaften Ehemann ins Jenseits befördert, und niemand bezweifelte, wo er gelandet war, denn wenn es jemand verdiente, vergiftet zu werden, dann war er es. Dennoch mieden Marys Nachbarn sie danach, und als sie einen ihrer Angestellten heiratete, nickten die Männer vielsagend und wunderten sich darüber, daß sie sich zu einem Mann von niedrigem Stand herabgelassen hatte. Die Frauen nickten ebenfalls, wunderten sich aber nicht.
Diese Männer und Frauen waren die Gründer der ersten Familien in Virginia. Die meisten Emigranten kamen aus der dienenden Klasse – bis 1700 waren es beinahe hunderttausend. Zur Zeit der Revolution machten die schwarzen Sklaven fast vierzig Prozent der Bevölkerung der Kolonie aus. »Gentlemen« wie Charles Wilde waren selten, und »edles Blut« – was immer man darunter verstand – war für die wachsende Nation kein Aktivposten. Allen Familiengründern war eine Eigenschaft gemeinsam: nicht Träume von Freiheit, nicht Gottesfürchtigkeit, sondern die hochentwickelte Fähigkeit zu überleben. Die Träume kamen später.
Kapitel 1
Sommer 1976 – Frühjahr 1774
Jan schreckte hoch, und jeder Muskel in ihrem Körper bebte. Das Zimmer war dunkel und still, wie immer in den frühen Morgenstunden, aber sie war hellwach, als hätte sie volle acht Stunden geschlafen. O nein, dachte sie angewidert, nicht die verdammte Schlaflosigkeit, nicht ausgerechnet hier.
Sie war nach Williamsburg gekommen, um sich ein wenig auszuruhen. »Um sich ein wenig auszuruhen« waren die Worte und die Idee ihrer Mutter; aber Jan kannte Ellens wahre Motive. Allerdings hatte es keinen Sinn, darauf hinzuweisen. Ellen hätte sie nur aus großen, blauen Augen angesehen und geweint. Sie weinte anmutig und hübsch, wie es sich für eine Schönheit aus den Südstaaten gehörte – das hatte sie immer sein wollen. Niemand wäre auf die Idee gekommen, daß sie als Betty Jo Billings in Wichita, Kansas, zur Welt gekommen und daß ihr Vater Maurer gewesen war. Als sie in die Familie Wilde in Virginia einheiratete, nahm sie die gesamte Anmaßung dieser Klasse an.
Jan wußte, daß sie nicht an ihre Mutter denken sollte, schon gar nicht, wenn sie wieder einschlafen wollte; aber sie erinnerte sich unwillkürlich immer wieder an die unzähligen Streitigkeiten, die ihrer Abreise aus New York vorausgegangen waren. Sie hatte darauf hingewiesen, daß Williamsburg kaum ein Ort war, an dem man sich erholen konnte, und schon gar nicht im Sommer 1976, in dem der zweihundertste Jahrestag der Unabhängigkeitserklärung gefeiert wurde. »Die Stadt wird vor Touristen wimmeln«, hatte sie protestiert. »Und wenn die alte Dienerin – wie heißt sie noch? – im Krankenhaus liegt, werde ich mich zu Tode arbeiten müssen. Deshalb haben mich Tante Camilla und Onkel Henry nämlich für den Sommer eingeladen – sie wollen ein Gratisdienstmädchen. Bis jetzt haben sie sich um unseren Zweig der Familie einen Dreck geschert.«
Ellens hochgezogene Augenbrauen deuteten damenhafte Entrüstung über die vulgäre Ausdrucksweise ihrer Tochter an. Wie üblich beantwortete sie die unwichtigste Frage zuerst.
»Bess. Die liebe, alte Tante Bess. Sie ist bei der Familie, seit sie ein winziges Negermädchen war. Sie hätte deine Großtante und deinen Großonkel nie im Stich gelassen, wenn sie sich nicht den Oberschenkel gebrochen hätte.«
»Es ist ein Wunder, daß sie sich nicht den Hals gebrochen hat«, erwiderte Jan. »Sie muß siebzig sein – und ein Idiot, wenn sie ihr Leben lang die alte, treue Dienerin der beiden gespielt hat. Sie ist übrigens nicht so alt wie Tante Camilla – und Onkel Henry muß fünfundachtzig sein. Sie brauchen eine Ganztagskrankenschwester, nicht mich.«
Sie erwartete, daß Ellen die gleichen Argumente Vorbringen würde wie bisher – die offensichtlichen Gründe, hinter denen sie ihr wahres Motiv verbarg. Das schöne, alte Herrenhaus war im Begriff, nach zweihundertfünfzig Jahren aus dem Familienbesitz in fremde Hände überzugehen; Jan mußte es unbedingt sehen, bevor es Staatseigentum wurde. Man mußte sich nur vorstellen, daß sie von nun an eine Eintrittskarte brauchen würde, um das Haus ihrer Vorfahren zu sehen!
Das hatte Ellen bisher ins Treffen geführt, aber sie war klüger, als Jan angenommen hatte. Diesmal zog sie nur die zarten Augenbrauen in die Höhe und fragte sanft: »Wohin willst du denn sonst reisen?«
Es gab keine Alternative. Nur Ellens von Möbeln überfüllte kleine Wohnung, in der ständig Ellens Freundinnen herumsaßen, die zum Bridge, zum Tee, zum Lunch ein- und ausflatterten und schrill schnatterten wie ein Schwarm mausernder Vögel, denen sie ähnlich sahen. Wenn Jan während des Schuljahres unterrichtete, konnte sie ihnen aus dem Weg gehen. Wenn sie an den heißen New Yorker Sommer und ihre zum Zerreißen gespannten Nerven dachte, dann waren sogar das von Touristen heimgesuchte Williamsburg und zwei altersschwache Verwandte vorzuziehen.
Williamsburg war weniger schrecklich, als sie erwartet hatte. Tagsüber war es allerdings überbevölkert. Es war während des größten Teils der Revolution die Hauptstadt von Virginia gewesen, und die Geschichte der Stadt war faszinierend. Washington, Jefferson und Patrick Henry hatten in der Raleigh-Taverne zu Abend gegessen, und im aus Backsteinen errichteten Capitol über die Unabhängigkeit debattiert. Lafayette hatte vor der entscheidenden Schlacht bei dem nur dreizehn Meilen entfernten Yorktown mit seinem Oberkommandierenden hier gelebt. Doch der Faktor, der Williamsburg zum Touristenmecka machte, war nicht so sehr seine Geschichte als die Tatsache, daß man sich seiner geschichtlichen Vergangenheit mit einer Sorgfalt angenommen hatte, wie es in keiner anderen Stadt Amerikas der Fall war.
Als John D. Rockefeiler 1922 begann, sich für die Stadt zu interessieren, standen dort noch über achtzig Gebäude aus der Kolonialzeit. Der Verlauf der Straßen hatte sich seit 1776 nicht verändert. Trotzdem war es weder ein einfaches, noch ein billiges Projekt gewesen. Die alten Gebäude waren so restauriert worden, daß sie den gleichen Anblick boten wie im achtzehnten Jahrhundert, und bedeutende Bauwerke, die verschwunden waren, wie das Capitol und der Gouverneurspalast, waren nach sorgfältigen Forschungen Ziegel um Ziegel wieder auf gebaut worden.
Das Wilde-Haus lag an der Duke of Gloucester-Street, der Hauptverkehrsader, und wenn seine Bewohner es tagsüber verließen, standen sie regelmäßig einem Halbkreis neugieriger Touristen gegenüber, die allesamt Stadtführer in der Hand hielten. Aber um Mitternacht waren die Straßen praktisch leer, und von der ersten Nacht an hatte Jan nicht mehr unter der Schlaflosigkeit gelitten, die sie in New York im Winter und Frühjahr geplagt hatte. Sie schlief wie ein Kind tief und traumlos.
Bis heute nacht.
Sie war rasch eingeschlafen. Etwas mußte sie geweckt haben – falls sie überhaupt wach war. Jan kniff die Augen zusammen, um in der drückenden Dunkelheit wenigstens etwas zu sehen, und dabei wurde ihr klar, daß der Raum sich anders anfühlte. Zum Beispiel herrschte vollkommene Stille. Das Haus besaß eine Klimaanlage, also hielt sie die Fenster geschlossen, um sich vor der sommerlichen Schwüle zu schützen, aber selbst dann vernahm sie das Motorengeräusch eines vorüberfahrenden Wagens oder das ferne Summen des Verkehrs auf der Überlandstraße 60. Heute vernahm sie überhaupt nichts, und die Stille war so intensiv, daß sie in ihren Ohren dröhnte.
Obwohl sie nichts sah, war ihr der Raum inzwischen vertraut. Das alte Himmelbett mit den Vorhängen und dem Betthimmel aus Chintz; die Chippendale-Kommode an der rechten Wand, der Kamin an der linken. Zwischen den beiden Fenstern, die dem Bettende gegenüberlagen, hing das Porträt, das sie vom ersten Augenblick an fasziniert hatte. Ohne daß sie sich bewußt darum bemühte, tauchten die Gesichtszüge jetzt in ihrem Geist auf: das Gesicht eines Mannes mit Stupsnase und hoher Stirn, dessen mausbraunes Haar zurückgekämmt und im Nacken zusammengebunden war.
Jan wurde allmählich unruhig. Sie war jetzt hellwach und konnte bestimmt nicht wieder einschlafen. Sie tastete in der Dunkelheit herum, fand aber nicht, was sie suchte – das Nachtkästchen und die Lampe. Als sie schlafen ging, hatte sie das Nachtkästchen weggeschoben, weil sie befürchtete, daß sie die zarte Porzellanlampe im Schlaf auf den Boden fegen würde, und stand jetzt fluchend auf. Warum hatten leblose Gegenstände die scheußliche Gewohnheit, in der Nacht spazierenzugehen, so daß man sie nicht fand?
Während sie zur Tür ging, stieß sie mit der Zehe an einen Gegenstand, der dort, wo er lag, nichts verloren hatte. Für gewöhnlich brannte im Korridor Licht, weil das für die beiden alten Bewohner des Hauses bequemer war; aber heute Nacht war der Korridor genauso dunkel wie ihr Zimmer. Nein – an seinem Ende bemerkte sie in der Nähe der Treppe einen schwachen Lichtschein, und jetzt vernahm sie auch murmelnde Stimmen.
Jans nackte Füße verursachten kein Geräusch, als sie durch den Korridor zur Treppe ging. Es war Mitternacht gewesen, als sie das Licht ausgeschaltet hatte; jetzt mußte es bereits früher Morgen sein. Vielleicht litt nicht nur sie an Schlaflosigkeit; alte Menschen schliefen oft schlecht.
Die schön geschnitzte Treppe aus Walnußholz war eines der Prunkstücke des Hauses. Jan stützte sich auf den Endpfosten und blickte hinunter. Das Licht und die Stimmen kamen aus der Bibliothek rechts von der Eingangshalle. Was zum Teufel war da unten los? Die Bibliothek war Tante Camillas Stolz, einer der schönsten Räume des Hauses, der noch die ursprüngliche Eichentäfelung und einen Kamin aus importiertem Marmor besaß. Mit Hilfe der Williamsburg-Stiftung hatte Camilla einen Großteil der ursprünglichen Einrichtung des Hauses ausfindig gemacht, und die Bibliothek war ihr Meisterwerk. Onkel Henry durfte dort Schach spielen, aber der Raum wurde nie für normale gesellschaftliche Anlässe verwendet.
Jan ging die Treppe hinunter. Sie war eher neugierig als beunruhigt; Einbrecher würden nicht das Licht einschalten und miteinander plaudern. Und wenn einer der beiden Alten erkrankt wäre, hätte man sie geweckt. Wer würde sich überhaupt um diese Zeit in der Bibliothek aufhalten?
Wäre sie nicht so ausschließlich mit diesen Grübeleien beschäftigt gewesen, so hätte sie vielleicht etwas bemerkt, das ihr erst zu Bewußtsein kam, als sie in der offenen Tür stand. Das flackernde Licht stammte nicht von einer Glühbirne, sondern von Kerzen in einem silbernen Leuchter in der Mitte des runden Tisches. Am Tisch saßen drei Männer; zwei wendeten Jan das Profil zu, der dritte den Rücken. Der Raum war reines achtzehntes Jahrhundert, vom farbigen Sommerteppich auf dem Boden bis zu den roten Moire-Wollvorhängen und -volants am Fenster. Die Kleidung der Männer stammte aus der gleichen Zeit.
Jan kannte diese Kostüme; sie sah sie jeden Tag an den Angestellten der Stiftung, die die Besucher im restaurierten Teil der Stadt herumführten. Doch keiner dieser Angestellten trug einen so eleganten Anzug wie der Mann zu ihrer Rechten. Der Stoff war dunkelgrün und plüschartig, die breiten, umgeschlagenen Manschetten waren mit Goldknöpfen verziert. Unter den Manschetten fielen Spitzen hervor, und auch die Rüschen unter seinem Kinn waren mit Spitzen besetzt. Entweder waren seine Haare gepudert, oder er trug eine Perücke. Sie war zu schneeweißen Locken frisiert, drei ordentlichen, waagrechten Rollen über jedem Ohr. Der Rest war zurückgebunden, und die Enden steckten in einem schwarzen Satinbeutel.
Der Mann, der links von Jan dem ersten gegenübersaß, war jünger, beinahe noch ein Knabe, und sah außergewöhnlich gut aus. Seine blonden Haare schimmerten im Kerzenlicht wie gelbe Seide. Die widerspenstigen Locken wurden im Nacken von einem schwarzen Band zusammengehalten, und einzelne Strähnen ringelten sich um Schläfen und Ohren. Seine Kleidung entsprach genau der Aufmachung der jungen Männer, die in der restaurierten Stadt als Kellner oder Handwerker arbeiteten: ein weißes, hochgeschlossenes Hemd, dessen weite Ärmel an den Gelenken von Bündchen zusammengehalten wurden, und eine ärmellose, purpurrote Jacke. Jan konnte seine untere Körperhälfte nicht sehen, nahm aber an, daß er die üblichen Kniehosen, weißen Strümpfe und Schnallenschuhe trug.
Der dritte Mann, der Jan den Rücken zukehrte, hatte dichtes, braunes Haar, das das Band nicht bändigen konnte. Seine lange, ärmellose Weste hing über der Rückenlehne des Stuhls, und die Ärmel seines blauen Hemdes waren über die Ellbogen hinauf gerollt. Weitere Einzelheiten konnte Jan nicht erkennen; ihr fielen nur die ungewöhnlich breiten Schultern auf, die den gerafften Hemdrücken ausfüllten.
Hätte Jan sich in einer beliebigen anderen Stadt befunden, dann hätte sie spätestens zu diesem Zeitpunkt gewußt, daß sie träumte. Dieser Verdacht war ihr bereits gekommen; aber der Raum und die Kostüme waren in diesem Jahr in Williamsburg durchaus alltäglich. Daß sie die Gesichter nicht kannte, hatte nichts zu bedeuten.
Aber ihre Vernunft verwarf diesen Gedanken. Die beiden alten Leutchen würden niemals um drei Uhr morgens Besuch empfangen.
Sie hatte diese Einzelheiten blitzschnell erfaßt und genauso schnell daraus Schlüsse gezogen. Als sie zur Tür gekommen war, hatte Stille geherrscht; jetzt sprach der gut aussehende blonde Jüngling.
»Wie lange müssen wir noch warten? Um Himmels willen, ich könnte in der Zeit, die eure Freunde brauchen, um einen Krieg zu planen, einen ganzen Feldzug allein durchführen.«
»Deine Ausdrucksweise«, ermahnte ihn der alte Mann.
»Entschuldige, Vater.« Der blonde Junge warf dem Mann, der Jan den Rücken zuwendete, einen raschen Blick zu. Offenbar fand er dort stillschweigende Unterstützung, denn um seine Mundwinkel spielte ein Lächeln, als er fortfuhr: »Wenn dieser alte Puritaner nichts gegen meine Redeweise einzuwenden hat –«
»Es ist nicht die Redeweise eines Gentleman«, unterbrach ihn sein Vater. »Und was deine Frage betrifft – die das gleiche vorschnelle Wesen verrät wie deine Redeweise – eine Eigenschaft, die zu beherrschen du lernen mußt …« Er unterbrach sich lächelnd, als der Jüngere das Gesicht verzog. »Ich erspare dir den Rest der Predigt, du hast sie oft genug gehört.«
»Allerdings«, bestätigte sein Sohn aus tiefstem Herzen.
»Aber du hast nichts daraus gelernt«, meldete sich der dritte Mann zum ersten Mal zu Wort. Seine Stimme verriet, daß er trotz seines beeindruckenden Körperbaus genauso jung war wie sein junger Freund. »Wenn Charles sich von meinem Beispiel leiten ließe –«
Er verstummte, weil seine beiden Zuhörer laut auflachten. Der ältere Mann beherrschte sich rasch, als befürchte er, daß er seinen Gast beleidigen würde, aber der Junge namens Charles lachte so schallend, daß er sich gefährlich zur Seite neigte und sich rasch am Tischrand festhalten mußte.
»Jonathan der Hitzkopf«, rief er immer noch lachend. »Jonathan der Radikale, der für die vollen Bürgerrechte für Atheisten, Papisten und Sklaven eintritt –«
Jonathan richtete sich auf, und seine breiten Schultern verkrampften sich. Als er seinen jungen Freund unterbrach, war der fröhliche Ton aus seiner Stimme verschwunden.
»Mit solchen Sachen scherzt man nicht, Charles.«
»Wirklich nicht«, stimmte der Ältere ernst zu. »Ihr seid beide jung. Die Jugend neigt zu radikalen Meinungen, und die Rebellion liegt weiß Gott in der Luft.«
»Wenn Sie meinen, Mr. Wilde, daß meine Ansichten auf die Unerfahrenheit der Jugend zurückzuführen sind, dann irren Sie sich«, widersprach Jonathan.
Der Ältere klopfte ihm väterlich auf die Schulter.
»Ich habe nichts gegen deine Ansichten, mein lieber Junge. Ich bitte dich nur, vorsichtiger zu sein, wenn du sie äußerst.«
Jonathan antwortete nicht, aber seine Körperhaltung verriet, daß er nur aus Höflichkeit dem Älteren gegenüber schwieg.
Charles lehnte sich zurück und betrachtete seinen Freund amüsiert. Seine Augen waren leuchtend grün, und die dunklen Wimpern bildeten einen auffallenden Gegensatz zu seinem blonden Haar.
»Deine Sorge ist unbegründet, Vater. Wenn du letzten Monat gesehen hättest, wie er drei bärenstarke Gesellen zu Boden schickte, würdest du nicht daran zweifeln, daß er fähig ist, sich zu verteidigen. Für einen Pazifisten hat er sehr harte Fäuste.«
Jonathan vergrub stöhnend das Gesicht in den Händen, aber sein Freund fuhr erbarmungslos fort: »Sei kein solcher Heuchler, Jon. Deine Vorstellungen von Gewaltlosigkeit sind reine Theorie; ein Mann muß sich verteidigen. Und was deine Ansichten betrifft, so unterscheiden sie sich nicht wesentlich von den Vorstellungen von Männern wie Mason, Wythe und Jefferson. Sogar Oberst Washington …«
Er sah seinen Vater nicht an, aber es war klar, daß dieser Vortrag ihm und nicht seinem Freund galt. Mr. Wilde runzelte zornig die Stirn.
»Oberst Washington speist noch diese Woche mit Gouverneur Dunmore zu Abend. Er ist kein Radikaler.«
»Genau«, stimmte Charles eifrig zu. »Er ist kein Radikaler, aber selbst er findet Britanniens neueste Verordnungen unerträglich. Wenn du nur –«
Er unterbrach sich, als leise an die Tür an der anderen Seite des Raums geklopft wurde. Nach einer kurzen Pause ging sie auf.
Jan wußte, daß diese Tür in den hinteren Korridor führte, der das Eßzimmer mit dem Anrichteraum verband. Das Mädchen, das zögernd in der Tür stehenblieb, kam offensichtlich aus diesem Teil des Hauses, denn sie hielt ein Tablett mit einer Karaffe und mehreren Gläsern in den Händen. In dem gedämpften Licht leuchtete die Flüssigkeit in der Karaffe granatrot.
Sie war sehr jung, beinahe noch ein Kind, aber das einfache blaue Baumwollkleid und die weiße Schürze verbargen nicht, daß sie heranreifte und daß sie einmal eine außerordentlich anziehende Frau sein würde. Ein gefaltetes Häubchen bedeckte ihr Haar beinahe zur Gänze; die Locken, die unter ihm hervorlugten, glänzten haselnußbraun. Ihre glatte Haut leuchtete wie Elfenbein, und ihre dunklen Augen blickten besorgt.
»Ach, Leah«, sagte der ältere Mann freundlich., »Du beginnst also mit deinen neuen Pflichten. Ich nehme an, daß Mrs. Wilde zu Bett gegangen ist. Das ist schon recht; stell das Tablett nur auf den Tisch.«
Das Mädchen gehorchte und seufzte erleichtert auf, als sie ihre Bürde unversehrt abgesetzt hatte. Während sie vom Tisch zur Tür zurückging, hielt sie die Augen züchtig gesenkt. Als sie an Jonathan vorbeikam, sprach dieser sie an.
»Ich könnte schwören, Leah, daß du im letzten Monat um zwei Zoll gewachsen bist. Ich hoffe, daß es deiner Mutter besser geht.«
In seiner Stimme lag ein Lächeln; das Mädchen erwiderte es, und Jan sah ihre gleichmäßigen Zähne und ein entzückendes Grübchen.
»Danke, Mr. Jonathan, sie ist wieder gesund. Es war pur ein Schüttelfrost. Und geht es Ihrer Großmutter gut, Sir?«
»Wie immer«, erwiderte Jonathan. »Sie läßt mich anscheinend immer dann zurückkommen, wenn sie sich langweilt. Dadurch habe ich einen Monat lang meine Studien und dich versäumt. Aber ich befürchte, Leah, daß es mit unseren Spielen vorbei ist; du bist jetzt zu alt und würdevoll, um Fangen zu spielen.«
Charles, der dem Gespräch lächelnd zugehört hatte, zog spielerisch an Leahs Schürzenband. Das Mädchen griff mit einem Aufschrei nach ihrem Rock, und Mr. Wilde mischte sich rasch ein.
»Danke, Leah, du kannst jetzt Schlafengehen, wir brauchen dich nicht mehr.«
Das Mädchen hastete mit feuerroten Wangen hinaus.
»Charles«, sagte Mr. Wilde.
»Ich weiß, Vater, ich weiß. Aber es kommt mir wie gestern vor, daß sie ein mageres, kleines Ding mit Zöpfen und langen Beinen war, das wie ein Hündchen hinter uns herlief.«
»Das hinter dir herlief«, stellte Jonathan richtig. »Du hast sie unbarmherzig geneckt, wenn du überhaupt geruhtest, sie zur Kenntnis zu nehmen.«
»Mrs. Wilde hängt sehr an ihr«, sagte der ältere Mann. »Sie lernt sehr schnell; du hast ja bemerkt, wie schön sie spricht. Du mußt aufhören, sie wie ein Kind zu behandeln, Charles.«
Charles begann, vollkommen unbußfertig zu lachen.
»Erinnerst du dich, Jon, wie sie einmal auf den Apfel-, bäum geklettert ist, weil ich behauptet habe, daß sie sich nicht trauen würde, und wie sie dann nicht –«
»Fällt dir auf, daß es spät geworden ist?«, unterbrach ihn sein Vater. »Es ist höchste Zeit, daß ihr euch an eure Bücher bequemt.«
»Aber du hast gesagt, Vater, daß wir aufbleiben und mit Mr. Jefferson sprechen dürfen«, protestierte Charles.
»Du tätest besser daran, seinem Beispiel zu folgen«, grinste Charles, »denn er hat ganz bestimmt nicht nur studiert. Als Mitglied des Angeber-Clubs … Außerdem haben sich die Zeiten geändert, Vater, und mit ihnen Mr. Jeffersons Interessen.«
»Das stimmt allerdings. Sein letzter Plan könnte Gouverneur Dunmore sehr wohl dazu zwingen, die gesetzgebende Versammlung aufzulösen.«
»Das wäre nichts Neues. Glaubst du, daß die Mitglieder der Versammlung als Rache den Ball absagen werden, den sie für Lady Dunmore geben?«
»Bestimmt nicht«, antwortete sein Vater empört. »Ich hoffe, daß meine Kollegen Gentlemen sind.«
Charles blinzelte Jonathan zu, als fordere er ihn auf, über einen Witz zu lachen, den sein Vater nicht verstand. »Und worin besteht der neue Plan?«, fragte er. »Ich nehme an, daß es sich um etwas handelt, wozu Mr. Jefferson deine Unterstützung braucht.«
Mr. Wilde zögerte kurz, dann zuckte er die Schultern.
»Es gibt keinen Grund, warum ihr es nicht erfahren solltet. Morgen werden es alle wissen. Er und einige Kollegen wollen in der Versammlung eine Resolution beantragen, durch die als Reaktion auf die Schließung des Hafens von Boston ein Fast- und Bettag beschlossen wird.«
Charles pfiff leise vor sich hin.
»Das wird dem Gouverneur überhaupt nicht gefallen. Wirst du für die Resolution stimmen, Vater?«
»Ein wenig Beten wird uns bestimmt nicht schaden«, erwiderte Mr. Wilde trocken. «Ich habe gegen die Resolution nichts einzuwenden, aber Henry hat etwas damit zu tun, und ich mißtraue seinen Motiven.«
»Mr. Henry kann nichts für sein Aussehen«, wandte Charles ein. »Sein langes, hageres, fahles Gesicht … Ich bin bestimmt nicht der erste, der an Cassius denken muß, wenn er ihn sieht. Aber er spricht angeblich wie Domesthenes. Du hast ihn ja gehört, Vater – die Rede zum Stempelgesetz.«
»Er spricht wie ein Schauspieler«, brummte Mr. Wilde. »Ich gebe zu, daß er mich damals beeindruckt hat, doch er versteht es zu gut, mit Worten umzugehen. Also schön, ihr könnte noch eine Weile bleiben. Doch ich muß dich ersuchen, Jonathan, Mr. Jefferson nicht wieder so peinliche Fragen zu stellen wie letztes Mal. Für einen Jungen deines Alters gehört es sich nicht, einen solchen Mann zu verhören, als wärst du ein Anwalt und er ein Zeuge der Gegenseite. Und das Thema ist – hm –«
Ihm fehlten ausnahmsweise die Worte. Jonathan war zu wohlerzogen, um zu antworten, aber seine Körperhaltung drückte eigensinnige Ablehnung aus. Charles versuchte, die Atmosphäre zu entspannen. »Das ist unwichtig. Schließlich bewegen uns bedeutendere Angelegenheiten, es geht um nichts Geringeres als –«
»Freiheit?« Jonathan wandte sich erleichtert seinem Freund zu; er konnte zu einem Gleichaltrigen viel unbefangener sprechen als zu einem Älteren. »Darum geht es doch, Charles: ›die Kolonisten sind durch das Gesetz der Natur frei geboren, wie es alle Menschen sind, seien sie weiß oder schwarz.‹«
»Wen zitierst du denn jetzt wieder?«, wollte Charles wissen. »Für einen mittelmäßigen Studenten hast du ein ausgezeichnetes Gedächtnis für unbequeme Zitate.«
»Aber Mr. Jefferson ist auch meiner Meinung«, erklärte Jonathan unbefangen. »Er hat in dieser Angelegenheit bereits Stellung bezogen. Vor fünf Jahren hat er einen Mulatten verteidigt, der seine Freilassung mit der Begründung verlangte, daß seine Urgroßmutter eine Weiße gewesen war.«
»Und er hat den Prozeß verloren«, warf Mr. Wilde scharf ein. »Er hat seinem Klienten keinen guten Dienst erwiesen. Wenn er seine Argumentation auf das Gesetz beschränkt hätte, laut dem der Status der Mutter den Status des Kindes bestimmt, statt radikalen Gefühlen Ausdruck zu verleihen –«
Jonathan vergaß sich soweit, daß er den Älteren unterbrach. Seine Stimme zitterte vor Erregung.
»›Nach dem Gesetz der Natur sind alle Menschen frei geboren, und jeder Mensch kommt mit dem Recht auf die eigene Person auf die Welt.‹ Dies sind doch genau die Gefühle, Sir, denen unsere Staatsmänner heute Ausdruck verleihen, um unsere Beschwerden gegen Großbritannien zu rechtfertigen. Wenn Männer wie Mr. Wythe und Mr. Mason glauben, daß alle Menschen vor Gott gleich sind, wie können sie dann die natürlichen Rechte auf die Weißen beschränken?«
Charles hatte sich aus der Diskussion herausgehalten und blickte zu Boden. Mr. Wilde setzte zu einer scharfen Antwort an, entspannte sich jedoch sofort und lächelte geduldig.
»Du hast in den letzten beiden Jahren wenigsten Rhetorik gelernt, mein Junge. Wenn du etwas älter bist, wirst du begreifen, daß alle diese Probleme nicht so einfach sind.«
»Ich bitte um Vergebung, Sir, aber das Alter hat nichts mit der Wahrheit zu tun«, widersprach Jonathan mit erstickter Stimme.
»Vielleicht.« Mr. Wilde betrachtete den jungen Mann mit liebevollem, tolerantem Lächeln. »Aber es hat viel mit der Vorstellung von dieser vielgestaltigen Göttin zu tun. Ich meine es gut mit dir, Jonathan. Du wirst eines Tages im Stock stecken und mit verfaultem Gemüse beworfen werden, wenn du nicht –«
Jonathan schob seinen Stuhl zurück und stand auf. »Entschuldigen Sie, Sir. Sie können mich kritisieren – dieses Recht steht Ihnen zu; Sie können mich verurteilen, dieses Privileg steht Ihnen zu; aber machen Sie sich um Himmels willen nicht über mich lustig.«
Mr. Wilde schüttelte mitleidig den Kopf und wollte etwas erwidern, aber Charles war schneller. »Hebe dir deine Fragen für Jefferson auf, Jon; er wird bald hier sein.«
Jonathan hörte nicht auf ihn, sondern ging zur Tür.
Jan sah sein Gesicht zum ersten Mal; er war tatsächlich sehr jung. Sie hatte aus seinem zerknitterten Anzug und Leahs Bemerkungen geschlossen, daß er erst kürzlich in der Stadt eingetroffen war und sich in letzter Zeit nicht rasiert hatte. Der Flaum auf seinem Kinn und seiner Oberlippe schimmerte im Kerzenlicht weich wie das Fell eines Kätzchens. Seine geröteten Wangen und das vorgeschobene Kinn bewiesen ebenfalls, wie jung er war – er war zu alt, um zornige Tränen zu weinen, aber noch so jung, daß es ihn schwer traf, wenn man sich über ihn lustig machte. Doch es war nicht seine Jugend, die Jan einen Schock versetzte, sondern sein Gesicht – das Gesicht des Mannes auf dem Porträt, das in ihrem Zimmer hing.
Sie klammerte sich wie gelähmt an den Türstock – und er ging durch sie hindurch.
Kapitel 2
Sommer 1976
Eins
Es war ein schöner Morgen. Das Sonnenlicht frischte die Farben des alten Teppichs auf und ließ die polierte Oberfläche der Möbel leuchten. Vögel sangen. Jemand klopfte hartnäckig an die Tür.
Jan öffnete die Augen, warf einen Blick auf die Uhr und setzte sich mit einem Ruck auf. Das Klopfen hörte nicht auf.
»Tante Cam?«, rief Jan. »Bist du es? Komm herein.«
Sie wußte, daß ihre Tante nicht hereinkommen würde. Seit Camilla entdeckt hatte, daß Jan au naturel schlief, wie sie sich ausdrückte, betrat sie das Zimmer am Morgen nicht mehr. Jan trug seither zwar ein Nachthemd, hatte es ihrer Tante jedoch verschwiegen.
»Es tut mir leid, daß ich dich wecken mußte, Liebling«, sagte Camilla hinter der geschlossenen Tür. »Aber es ist acht Uhr. Fühlst du dich nicht wohl?«
»Doch, mir geht es großartig, ich habe nur verschlafen. Ich komme sofort.«
»Du mußt dich nicht beeilen, Liebling. Das Frühstück ist fertig. Ich habe nur befürchtet, daß du krank bist.«
Jan sank stöhnend in die Kissen zurück. Im Haushalt der Wildes wurde um punkt acht Uhr gefrühstückt, und Zuspätkommen war beinahe eine Sünde – vor allem, wenn man die Köchin war.
Sie sprang aus dem Bett und griff nach ihren Sachen. Das Duschen mußte bis nach dem Frühstück warten. Die Mahlzeit würde wahrscheinlich aus kalten Getreideflocken und Camillas schrecklichem, wäßrigem Kaffee bestehen. Aber es geschah ihr recht, warum hatte sie auch verschlafen.
Nicht nur Williamsburg, sondern auch Tante und Onkel hatten sich als weniger unangenehm entpuppt, als sie erwartet hatte. Sie waren beide liebevoll, obwohl Tante Camillas Fürsorge so klebrig sein konnte wie ein Löffel Sirup. Camilla war zweifellos betagt, aber der dreiundzwanzigjährigen Jan kam sie so alt vor wie Methusalem und so zart wie Spinnweben. Jan hatte vor, Camillas alten Knochen jede Mühe abzunehmen, und es war wirklich schlimm, daß sie verschlafen hatte. Aber der Traum …
Es war nicht erstaunlich, daß sie von ihren Vorfahren träumte, die in diesem Haus gelebt hatten. Camilla sprach oft genug von ihnen. Jan hatte kaum hingehört, weil Ahnenforschung sie überhaupt nicht interessierte, aber ihr Unterbewußtsein hatte offenbar viel davon auf genommen. Das Gerede über Washington, der mit dem Gouverneur zu Abend gespeist hatte, und die Resolution der gesetzgebenden Versammlung, einen Trauertag für Boston abzuhalten … Sie hatte sich entschieden geweigert, in Williamsburg etwas zu besichtigen, und sie hatte sich seit Jahren nicht mehr mit amerikanischer Geschichte befaßt. Ihr Unterbewußtsein war anscheinend mit Fakten vollgestopft. Ein Jammer, daß man so etwas nicht nach Belieben anzapfen konnte.
Der Traum war noch in anderer Hinsicht ungewöhnlich gewesen. Sie sah die Einzelheiten so klar und deutlich vor sich, als hätte sie das alles tatsächlich erlebt. Zu Beginn, als sie den Korridor entlang und die Treppe hinunter ging, war ihr gar nicht klar gewesen, daß sie träumte.
Jan runzelte die Stirn. Vielleicht war sie tatsächlich eine Schlafwandlerin? Sie hatte zwar bis jetzt nie etwas Ähnliches erlebt, aber es gab immer ein erstes Mal … Der Gedanke war nicht angenehm. Nein, sie hatte bestimmt das Ganze geträumt, von dem Augenblick an, als sie scheinbar aufwachte. Im Lauf des Traums war ihr eigenes Ich in den Hintergrund getreten, weil die drei Männer sie interessierten. Erst am Ende hatte sie wieder an sich gedacht und sich vorgestellt, daß sie eine unsichtbare Zuschauerin war.
Doch sie war nicht nur unsichtbar, sondern auch körperlos gewesen. Es war ein alptraumhafter, entsetzlicher Anblick gewesen, als der Mann namens Jonathan direkt durch sie hindurchzugehen schien.
Jan sah zu dem Porträt hinüber. Es war in jeder Hinsicht ein schlechtes Porträt. Wie klug war ihr träumender Geist, wenn er diese hölzernen, ausdruckslosen Gesichtszüge mit einer solchen Persönlichkeit ausstatten konnte.
Jan gehörte nicht zu den Menschen, die die amerikanischen Primitiven bewundern. Das Porträt gehörte in diese Kategorie; es war wahrscheinlich von einem Autodidakten gemalt worden, einem der anonymen Handwerker, die über die schlammigen Straßen der Kolonie wanderten. Für das Bild sprach ausschließlich die Tatsache, daß die Details pedantisch genau ausgeführt waren. Die Kamee, die der Mann als Krawattennadel trug, war unglaublich exakt wiedergegeben, und man konnte beinahe die Haare auf seinem Kopf zählen.
Auf dem Porträt war er formeller gekleidet als in ihrem Traum – er trug einen dunkelblauen Rock und ein weißes Halstuch. Der Maler hatte die breiten Schultern übertrieben, so daß der Kopf zu klein wirkte. Die großen, dunklen Augen stimmten perspektivisch nicht, beinahe wie auf einem ägyptischen Wandgemälde. Das Gesicht war stumpf, und von einer Persönlichkeit war nichts zu bemerken. Die Nase war dem Maler gänzlich mißlungen, sie war schmaler und nicht so knollig.
Jan schüttelte lächelnd den Kopf und riß sich zusammen. Sie konnte nicht wissen, ob der Maler die Nase des Unbekannten richtig wiedergegeben hatte oder nicht. Der Jonathan in ihrem Traum war ein Produkt ihrer Phantasie und wies wahrscheinlich überhaupt keine Ähnlichkeit mit dem längst verstorbenen Original auf dem Gemälde auf. Trotzdem wäre es interessant herauszufinden, wer der Mann auf dem Porträt war. Wenn sich herausstellte, daß er Jonathan hieß … Aber so hieß er bestimmt nicht.
Als sie in die Küche kam, saßen ihre Tante und ihr Onkel am Tisch. Die blasse Flüssigkeit in ihren Tassen bestätigte Jans schlimmste Befürchtungen, aber sie setzte sich und griff ergeben nach ihrer Tasse.
Die Küche des 1754 erbauten Hauses hatte sich natürlich in einem eigenen Nebengebäude befunden. Im Sommer wäre die durch das Kochen und Backen verursachte Hitze unerträglich gewesen, und es gab genügend Sklaven, die mit den Speisen hin- und herlaufen konnten. Um 1900 war ein Küchenflügel an das Haus angebaut worden, und Jan vermutete, daß er sich in den darauf folgenden 60 oder 70 Jahren nichts sehr verändert hatte; nur an die Stelle des ursprünglichen Herdes und des Eiskastens waren moderne Geräte getreten. Der Raum war groß und unbequem, mit Geschirrschränken und Anrichten statt eingebauter Möbel ausgestattet, und die Spüle war sehr abgenützt. Die Stiftung, die für die Erhaltung des alten Herrenhauses zuständig war, interessierte sich nicht für spätere Anbauten. Sobald die derzeitigen Bewohner nicht mehr am Leben waren, würde der Küchenflügel wahrscheinlich abgerissen werden, um dem Haus sein ursprüngliches Aussehen wiederzugeben.