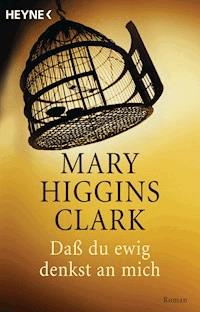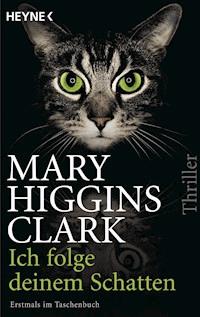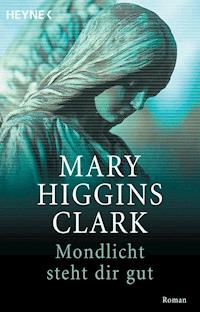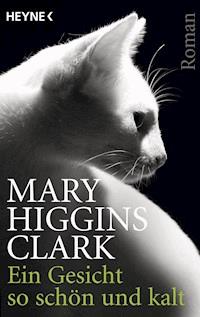6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Der Frauenarzt Dr. Highley unterhält eine renommierte Privatklinik in New Jersey. Er ist Spezialist für komplizierte Schwangerschaften, aber er mißbraucht seine Patientinnen auch für wissenschaftlich nicht fundierte Experimente. Eine Reihe von mysteriösen Todesfällen in der Klinik alarmiert schließlich die Polizei. Da macht die junge Richterin Katie DeMaio eine Beobachtung, die für sie höchst gefährlich wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 432
Ähnliche
Das Buch
Der Frauenarzt Dr. Edgar Highley gilt seit Jahren als Kapazität auf seinem Gebiet. Als Spezialist für Risikoschwangerschaften ist er die Hoffnung für viele Frauen, die sich verzweifelt ein Kind wünschen. Dr. Highleys Ruf als Arzt und Mensch ist ausgezeichnet, und er gilt als einer der wenigen hochkarätigen Gynäkologen, die sich persönlich um das Wohlergehen ihrer Patientinnen bemühen. Daß auf seiner Station an der Westlake-Klinik in den vergangenen acht Jahren sechzehn Patientinnen bei der Entbindung starben, hat niemanden mißtrauisch werden lassen. Alle Patientinnen waren vor dem hohen Risiko einer Schwangerschaft gewarnt worden. Eines Abends wird die junge Staatsanwältin Katie DeMaio nach einem Unfall in die Westlake-Klinik eingeliefert. Was sie in dieser Nacht von ihrem Fenster aus beobachtet, kommt ihr zunächst wie ein Alptraum vor: Auf dem Parkplatz des Krankenhauses versteckt ein Mann die Leiche einer Frau im Kofferraum eines Wagens und fährt anschließend davon. Daß sie nicht nur schlecht geträumt hat, wird Katie DeMaio erst später bewußt – als sie selbst Patientin von Dr. Highley ist ...
Ein atemberaubender Thriller aus der Welt der Medizin, der dem internationalen Ruf der Spannungsautorin Mary Higgins Clark Ehre macht.
Die Autorin
Mary Higgins Clark wurde 1928 geboren. Mit ihren Spannungsromanen hat sie weltweit Millionen von Leserinnen und Lesern gewonnen, und mit jedem neuen Roman erobert sie die Bestsellerlisten. Beinamen wie »Königin der Spannung« und »Meisterin des sanften Schreckens« zeugen von ihrer großen Popularität. Die Autorin lebt in Saddle River, New Jersey.
Inhaltsverzeichnis
Für Ray, in Liebe...
Werde mit mir alt.Das Beste steht uns noch bevor,der Abend des Lebens,für den der Morgen ward gemacht.
Robert Browning
»... denn manche Patienten erholen sich,obwohl sie um ihren kritischen Gesundheitszustand wissen,einfach deshalb, weil die Güte ihres Arztessie zu gewinnen vermag.«
Hippokrates
1
Wäre Katie nicht mit ihren Gedanken bei dem heutigen Prozeß gewesen, hätte sie die Kurve vielleicht nicht so scharf genommen. Aber sie war die starke Selbstzufriedenheit nicht los geworden, daß sie ihn gewonnen hatte und der Angeklagte schuldig gesprochen worden war.
Die Entscheidung hatte auf Messers Schneide gestanden. Roy O’Connor war schließlich einer der Starverteidiger von New Jersey. Das Geständnis des Angeklagten hatte das Gericht wohlwollend zur Kenntnis genommen, ein schwerer Schlag für die Staatsanwaltschaft. Aber Katie war es gelungen, die Geschworenen doch noch zu überzeugen, daß Teddy Copeland bei dem Einbruch auch die achtzigjährige Abigail Rawlings auf eine abscheuliche Weise umgebracht hatte.
Margaret Rawlings, Miß Rawlings Schwester, hatte der Verhandlung beigewohnt und Katie nach der Urteilsverkündung angesprochen: »Sie waren wunderbar, Mrs. DeMaio. So, wie Sie aussehen, könnte man Sie ja noch für eine Studentin halten, und ich hätte nie gedacht, daß Sie das fertigbringen. Als Sie aber dann Ihr Plädoyer hielten, haben sie ihm den Mord Punkt für Punkt nachgewiesen. Alle konnten richtig spüren, was er Abby angetan hat. Was wird nun geschehen, Mrs. DeMaio?«
»Bei seinem Vorstrafenregister bleibt nur zu hoffen, daß ihn der Richter für den Rest seines Lebens einsperrt«, war ihre Antwort gewesen.
»Gott sei Dank«, hatte Margaret Rawlings geseufzt. Ihre Augen, vom Alter ausdruckslos und stets feucht, hatten sich mit Tränen gefüllt. Ruhig hatte sie sie abgewischt und gesagt: »Ich vermisse Abby so sehr. Wir beide waren die einzigen unserer Familie, die noch lebten. Und nun bin ich ganz allein. Ich hätte es nie ertragen können, wenn sie ihn hätten laufen lassen.«
›Aber sie haben ihn nicht laufen lassen‹, dachte Katie zu Ende und trat dabei das Gaspedal durch. Dann kam die vereiste Kurve.
»Oh,... nein!« In panischer Angst umklammerte sie das Lenkrad. Der Wagen schoß über den Mittelstreifen und drehte sich. Von Ferne sah sie ein Scheinwerferpaar auf sich zukommen. Sie versuchte gegenzulenken, doch das Auto schlidderte auf die vereiste Böschung, verharrte dort wie ein Skispringer kurz vor dem Absprung einen Augenblick lang und stürzte dann den steilen Abhang hinunter ins Gebüsch.
Vor Katies Augen tauchte etwas Dunkles auf: ein Baum. Sie spürte das markerschütternde Krachen, als sich das Metall in die Rinde bohrte. Der Aufprall schleuderte Katie gegen das Lenkrad, dann sackte ihr Körper zurück. Instinktiv hatte sie die Arme vor das Gesicht gerissen, um sich vor den Splittern der zerberstenden Windschutzscheibe zu schützen. Ein heftiger, stechender Schmerz jagte durch ihre Handgelenke und Knie. Dann erloschen Scheinwerfer und Armaturenbeleuchtung. Eine tiefe wohlige Dunkelheit begann sie zu umschließen, als sie irgendwo in weiter Ferne eine Sirene hörte. Das Geräusch einer aufgehenden Wagentür; ein kühlender Lufthauch. »O Gott, es ist Katie DeMaio.«
Sie kannte diese Stimme. Tom Coughlin, der freundliche junge Polizist. Letzte Woche hatte er in einer Verhandlung ausgesagt.
»Sie ist bewußtlos.«
Sie versuchte zu widersprechen, doch kein Wort wollte ihr über die Lippen. Nicht einmal die Augen konnte sie öffnen.
»Sie blutet am Arm. Sieht aus, als hätte es eine Arterie erwischt.«
Jemand hielt ihren Arm und drückte etwas fest dagegen.
Eine andere Stimme klang besorgt: »Vielleicht hat sie innere Verletzungen, Tom. Das Westlake liegt gleich am Ende der Straße. Ich rufe einen Krankenwagen, bleib du bei ihr.«
Ich schwebe, ich schwebe. Mit mir ist alles in Ordnung, ich kann es euch nur nicht mitteilen.
Hände hoben sie auf eine Tragbahre. Sie spürte die Decke, die man über sie gebreitet hatte. Graupelkörner fielen ihr ins Gesicht.
Man trug sie. Ein Auto fuhr an. Der Krankenwagen. Dann gingen Türen auf und zu. Wenn sie sich doch nur verständlich machen könnte! Ich kann euch hören, ich bin nicht bewußtlos!
Coughlin gab ihren Namen an. »Kathleen DeMaio, wohnhaft in Abbington. Sie ist stellvertretende Staatsanwältin. Nein, nicht verheiratet, sie ist verwitwet. Die Witwe von Richter DeMaio.«
Johns Witwe. Plötzlich fühlte sie sich schrecklich einsam. Zögernd wich die Dunkelheit. Jemand leuchtete ihr ins Auge. »Sie kommt wieder zu sich. Wie alt sind Sie, Mrs. DeMaio?«
Die Frage war so alltäglich, so leicht zu beantworten. Schließlich konnte sie doch sprechen. »Achtundzwanzig.«
Der Druckverband, den Coughlin ihr am Arm angelegt hatte, wurde wieder abgenommen. Die Wunde mußte genäht werden. Sie verbiß sich ein Stöhnen, obwohl der Schmerz durch Mark und Bein ging.
Sie wurde geröntgt. Zum Ergebnis sagte der Unfallarzt: »Da haben Sie aber ganz schön Glück gehabt, Mrs. DeMaio. Ein paar ziemlich schlimme Quetschungen, aber keine Brüche. Ich werde Ihnen eine Transfusion geben lassen, Ihre Blutwerte sind recht niedrig. Keine Angst, bald sind Sie wieder okay.«
»Es ist nur wegen...« Sie biß sich auf die Lippe. Fast hätte sie sich mit ihrer schrecklichen, unvernünftigen und kindischen Angst vor Krankenhäusern blamiert.
Coughlin fragte: »Sollen wir Ihre Schwester benachrichtigen? Man wird Sie heute nacht hierbehalten.«
»Nein, Molly hat eben erst eine Grippe gehabt. Ihre ganze Familie hatte sie.« Ihre Stimme klang so dünn. Coughlin mußte sich vorbeugen, um sie verstehen zu können.
»Gut, Mrs. DeMaio. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Ihren Wagen werde ich auch herausziehen lassen.«
Man rollte sie in einen durch Vorhänge abgetrennten Raum der Unfallstation. Das frische Blut rann durch eine Kanüle, die man ihr am rechten Arm angebracht hatte. Allmählich ordneten sich ihre Gedanken.
Der linke Arm und beide Knie taten ihr wahnsinnig weh. Alles tat ihr weh. Jetzt war sie doch in einem Krankenhaus. Allein.
Eine Schwester strich ihr das Haar aus der Stirn. »Bald sind Sie wieder gesund, Mrs. DeMaio. Warum weinen Sie denn?«
»Ich weine nicht.« Aber sie weinte doch.
Man brachte sie in ein Krankenzimmer der zweiten Etage. Die Schwester reichte ihr einen Pappbecher mit Wasser und eine Tablette. »Damit schlafen Sie leichter, Mrs. DeMaio.«
Das war sicherlich eine Schlaftablette, dachte Katie. Sie hatte sie eigentlich nicht gewollt, förderte sie doch nur ihre Alpträume, aber dann doch eingenommen.
Die Schwester löschte das Licht und verließ das Zimmer. Katie vernahm ihre leisen gedämpften Schritte.
Es war kalt in dem Raum; das Bettzeug eisig und hart. Typisch für alle Krankenhäuser? Katie sank in den Schlaf und wußte, daß sich nun unausweichlich ihr Alptraum einstellen würde.
Doch diesmal lief alles anders ab. Sie fuhr Achterbahn. Es ging immer höher, immer steiler hinauf. Sie konnte nichts dagegen tun. Sie versuchte, das Gefährt zu steuern. Da raste es in eine Kurve, entgleiste und stürzte in die Tiefe. Kurz bevor es am Boden aufschlug, wachte Katie zitternd auf.
Graupelkörner prasselten gegen das Fenster. Sie quälte sich an die Bettkante; stand dann auf wackligen Beinen. Das Fenster war einen Spalt breit geöffnet, so daß die Innenjalousie klapperte. Daher also war es in dem Zimmer so zugig. Sie brauchte nur das Fenster zu schließen und die Jalousie hochzulassen, dann konnte sie vielleicht schlafen. Und am Morgen durfte sie ja heim. Katie haßte Krankenhäuser.
Unsicher machte sie sich auf dem Weg zum Fenster. Das Krankenhausnachthemd reichte ihr gerade bis ans Knie. Sie fror. Und dieser entsetzliche Schneeregen, er schien ihr immer mehr in Regen überzugehen. Aufatmend stützte sie sich auf das Fensterbrett. Katie griff nach der Jalousie. Zwischen den Lamellen hindurch erkannte sie einen Parkplatz.
Der Kofferraumdeckel eines Autos öffnete sich ganz langsam. Ihr wurde schwindlig. Sie schwankte, ließ die Jalousie los, die sofort hochschnappte. Sie klammerte sich ans Fensterbrett und zwang sich hinunter zu sehen, in diesen Kofferraum. War da nicht etwas Weißes, das dort niedersank? Eine Decke? Ein großes Bündel? War das wahr oder träumte sie das alles nur? Plötzlich preßte sie vor Entsetzen die Hand auf den Mund, um den Schrei zu ersticken, der ihr die Kehle zu zerreißen drohte. Sie starrte auf den Kofferraum des Autos.
Die Kofferraumbeleuchtung brannte. Durch den Regenvorhang, der gegen das Fenster klatschte, beobachtete sie, wie in diesem weißen Ding dort unten etwas zum Vorschein kam. Und während sich der Kofferraumdeckel wieder schloß, hatte sie’s erkannt: ein Gesicht – ein bleiches Frauengesicht mit verzerrten Zügen. Es waren die gleichgültigen Züge des Todes.
2
Pünktlich um zwei Uhr klingelte der Wecker. Er besaß jahrelang Übung darin, bei Notfällen sofort aufzuwachen; auch diesmal war er auf der Stelle hellwach. Er stand auf und ging ins Untersuchungszimmer, wo er sich am Waschbecken kaltes Wasser über das Gesicht laufen ließ. Dann rückte er seine Krawatte zurecht und kämmte sich. Seine Socken waren noch immer feucht. Sie fühlten sich naß und kalt an, als er sie vom lauwarmen Heizkörper nahm. Unwillkürlich verzog er das Gesicht, als er sie überstreifte und in die Schuhe schlüpfte.
Er griff nach seinem Mantel, und wieder durchfuhr ihn ein Schauer. Auch der Mantel war völlig durchnäßt. Er hatte ihn umsonst an die Heizung gehängt. Wenn er den jetzt anzog, riskierte er am Ende noch eine Lungenentzündung. Außerdem konnte es sein, daß noch ein paar Fusseln von der weißen Decke auf dem blauen Stoff hängengeblieben waren, für die er dann womöglich eine Erklärung haben mußte.
Im Schrank hing ja noch sein alter Regenmantel. Den würde er anziehen und den nassen hierlassen, bis er ihn morgen zur Reinigung geben konnte. Aber der Burberry war ungefüttert. Er würde frieren. Aber eine andere Möglichkeit gab es nicht. Der Regenmantel war unauffällig, ein helles Oliv. Seit er abgenommen hatte, war er ihm zu weit. Wenn jemand den Wagen und ihn darin sah, war die Gefahr, erkannt zu werden, nicht mehr so groß.
Schnell ging er zum Kleiderschrank und riß den Regenmantel heraus, der unordentlich auf einem Drahtbügel hing. Den schweren nassen Chesterfield hängte er – hinter anderen Kleidungsstücken versteckt – in den Schrank. Ein unangenehmer, staubiger Geruch erinnerte ihn, daß er den Regenmantel lange nicht getragen hatte. Er rümpfte die Nase, als er ihn anzog und zuknöpfte.
Er trat ans Fenster und schob den Vorhang ein winziges Stück beiseite. Auf dem Marktplatz standen immer noch zahlreiche Autos, so daß es nicht auffiel, wenn sich sein Wagen unter ihnen befand oder wenn er fehlte. Mißbilligend sah er, daß die defekte Straßenlaterne, die immer dafür gesorgt hatte, daß der hintere Teil der Parkfläche im Dunkeln lag, repariert worden war. Das Heck seines Wagens war jetzt zur Hälfte beleuchtet. Er mußte sich im Schatten der anderen Autos bewegen und die Leiche so schnell wie möglich in den Kofferraum schaffen.
Es war höchste Zeit.
Er öffnete den großen Wandschrank, in dem normalerweise Arzneimittel lagerten. Dann beugte er sich nieder und tastete rasch die Decke nach dem darunter verborgenen Körper ab. Mit einem leisen Brummen schob er die rechte Hand unter den Nacken, die linke in die Kniekehlen der Frau. Als sie noch gelebt hatte, war sie nicht einmal 50 Kilo schwer gewesen, obwohl man während der Schwangerschaft zunimmt. Jedes Gramm schien nun an seinen Muskeln zu zerren, als er den Körper zum Untersuchungstisch trug. Im schwachen Schein seiner Taschenlampe, die er sich dort zurechtgelegt hatte, wickelt er den Leichnam wieder in die Decke.
Bevor er wieder zuschloß, suchte er den Boden des Arzneimittelschrankes gründlich ab. Geräuschlos öffnete er die Tür zum Parkplatz. Den Schlüssel zum Kofferraum hielt er schon zwischen Daumen und Zeigefinger bereit. Dann schritt er ruhig vor den Untersuchungstisch und hob erneut die tote Frau auf. Die nächsten zwanzig Sekunden – sie konnten vernichtend für ihn werden.
Achtzehn Sekunden später stand er bei seinem Wagen. Der Körper unter der Decke lastete schwer auf seinen Armen; er versuchte, das ganze Gewicht mit dem linken Arm zu halten, um mit der Rechten den Kofferraumschlüssel ins vereiste Schloß zu bekommen. Ungeduldig kratzte er die Eisschicht ab. Wenig später steckte der Schlüssel, und der Kofferraumdeckel hob sich langsam. Sichernd blickte er zu den Fenstern der Krankenzimmer, als plötzlich auf der zweiten Etage eine Jalousie hochschnappte. Schaute dort – es war das mittlere Zimmer – jemand herunter? Seine Ungeduld wuchs. Er mußte diesen verdammten Körper schnellstens in den Kofferraum schaffen. Doch nicht zu hastig, denn kaum hatte er seine Last mit einer Hand losgelassen, blies der Wind die Decke beiseite und enthüllte das Gesicht der Toten. Erschrocken ließ er die Leiche hineinfallen und schlug den Kofferraumdeckel zu.
Ihr Gesicht war im Licht gewesen. Hatte es jemand gesehen? Wieder blickte er zu dem Fenster hinauf, hinter dem die Jalousie hochgegangen war.
Stand da jemand? Er war sich nicht sicher. Wieviel konnte man von diesem Fenster aus erkennen? Er würde herausfinden müssen, wer sich in diesem Zimmer befand.
Er ging zur Fahrertür. Fuhr zügig vom Parkplatz. Die Scheinwerfer schaltete er erst ein, als der Wagen schon ein gutes Stück auf der Ausfallstraße war. Kaum zu glauben, daß er in dieser Nacht schon das zweite Mal nach Chapin River fuhr.
Nur einmal angenommen, er hätte nicht gerade das Krankenhaus verlassen wollen, als sie aus Fukhitos Sprechzimmer stürzte und ihn auf ihre Art begrüßte? Vangie war einem hysterischen Anfall nahe gewesen. Bewußt hatte sie das linke Bein nachgezogen, als sie ihm in der Vorhalle entgegenkam. »Ich kann mit Ihnen in dieser Woche keinen neuen Termin mehr ausmachen, Herr Doktor, ich fahre nämlich morgen nach Minneapolis. Ich gehe wieder zu meinem früheren Arzt, zu Dr. Salem. Vielleicht bleibe ich sogar dort und lasse mich von ihm entbinden.«
Wäre sie ihm nicht in die Arme gelaufen, alles wäre verpfuscht gewesen.
Deshalb hatte er sie überredet, kurz in sein Sprechzimmer zu kommen, wo er sie beruhigt und ihr ein Glas Wasser angeboten hatte. Im letzten Augenblick war sie doch noch mißtrauisch geworden und hatte hinausschlüpfen wollen. Auf ihrem schönen, launischen Gesichtchen hatte helle Angst gestanden.
Und danach dieser schreckliche Gedanke, daß man ihm, obwohl er sie zum Schweigen gebracht hatte, dennoch auf die Schliche kommen könnte. Kurzentschlossen hatte er die Tote im Arzneimittelschrank eingesperrt und überlegt.
Ihr hellroter Wagen war als unmittelbare Gefahr anzusehen. Er hatte ihn unbedingt vom Krankenhausparkplatz wegschaffen müssen. Dort wäre er aufgefallen, sobald die Besuchszeit vorüber war – das Spitzenmodell von Lincoln, der Continental mit seiner arroganten protzigen Chromfront. Alles an dem Fahrzeug erregte Aufmerksamkeit.
Er hatte genau gewußt, wo sie in Chapin River wohnte, durch ihre Erzählung, daß ihr Mann Pilot bei United Airlines war und vor morgen nicht zurück sein würde. Es war das beste gewesen, ihren Wagen auf dem Grundstück abzustellen und ihre Handtasche in irgendeinem Zimmer liegen zu lassen, damit es so aussah, als sei sie nach Hause gekommen.
Wider Erwarten war alles ganz leicht gegangen. Wegen des scheußlichen Wetters war nur wenig Verkehr gewesen. Die Raumordnungsbehörde hatte in Chapin River nur Grundstücke mit einer Mindestfläche von achttausend Quadratmetern ausgewiesen. Daher lagen die Häuser ein gutes Stück von der Straße weg und waren nur über gewundene Auffahrten zu erreichen. Die Garage hatte sich mit Hilfe einer Fernbedienung am Armaturenbrett des Lincoln öffnen lassen.
Der Hausschlüssel war am selben Ring gewesen wie die Wagenschlüssel, er hatte ihn aber nicht gebraucht, da die Tür von der Garage zum Arbeitszimmer offen stand. Im ganzen Haus hatte Licht gebrannt, wahrscheinlich schaltete es sich automatisch ein, sobald ein Auto in die Garage fuhr. Er war durch das Arbeitszimmer und den Flur in den Schlaftrakt geeilt, in dem das Elternschlafzimmer liegen mußte. Es war nicht zu verfehlen, die letzte Tür rechts. Zwei weitere Schlafzimmer lagen in diesem Flügel. Eines war schon als Kinderzimmer hergerichtet, denn von den frisch tapezierten Wänden, einem offenbar neuen Kinderbett und Schränkchen blickten bunte Elfen und knuddelige Lämmchen.
Da war ihm die Idee gekommen, Vangies Tod als Selbstmord darzustellen. Wenn sie schon drei Monate vor der Geburt ihres Babys mit der Ausstattung des Kinderzimmers begonnen hatte, wäre die Prophezeiung einer Totgeburt ein überzeugendes Motiv für einen Freitod.
Er hatte das Elternschlafzimmer betreten. Das übergroße Ehebett war nur flüchtig gemacht, der schwere weiße Chenilleüberwurf unordentlich über die Bezüge gebreitet worden. Ihr Nachthemd und ihr Kleid hatten auf einer Chaiselongue daneben gelegen. Wenn er die Leiche nur hierher schaffen und sie auf das Bett legen könnte! Es war sicher gefährlich, aber weniger riskant, als die Tote irgendwo im Wald abzuladen, denn dann hätte die Polizei umfangreiche Nachforschungen in die Wege geleitet.
Ihre Handtasche hatte er auf die Chaiselongue gestellt. Solange der Wagen sich in der Garage und die Tasche sich hier befanden, sah es wenigstens so aus, als sei sie vom Krankenhaus nach Hause gefahren.
Danach war er die sieben Kilometer zur Klinik zu Fuß zurück gegangen. Das war nicht ungefährlich gewesen – es hätte ja sein können, daß ihm in dieser vornehmen Wohngegend ein Streifenwagen entgegengekommen wäre und angehalten hätte.
Er hatte keinerlei Veranlassung gehabt, sich dort länger als nötig aufzuhalten. Immerhin hatte er die Strecke in weniger als einer Stunde zurückgelegt, den Vordereingang des Krankenhauses gemieden und war statt dessen durch die Hintertür, den direkten Zugang zum Parkplatz, hineingeschlüpft, Punkt zweiundzwanzig Uhr.
Mantel und Socken waren klatschnaß gewesen. Ihn hatte gefröstelt. Er hatte eingesehen, daß das Risiko zu groß war, die Leiche zum Wagen zu tragen, solange man noch relativ vielen Leuten begegnen konnte. Um vierundzwanzig Uhr lösten sich die Nachtschwestern ab. Deshalb hatte er es für das Beste gehalten, bis lange nach Mitternacht zu warten, bevor er wieder hinausging. Der Noteingang lag auf der Ostseite der Klinik. Also brauchte er keine Störung zu befürchten, weder von den Patienten in der Unfallstation noch von Polizeibeamten, die einen Verletzten einlieferten.
Er hatte seinen Wecker auf zwei Uhr gestellt und sich auf den Untersuchungstisch zum Schlafen gelegt.
Nun fuhr er über die Holzbrücke, hinter der die Winding Brook Lane abzweigte. Vangies Haus lag auf der rechten Straßenseite. Abblendlicht ausschalten, in die Auffahrt einbiegen; den Wagen um das Haus herum und dann rückwärts vor die Garage fahren; Lederhandschuhe aus-, Gummihandschuhe überziehen; Garagentor öffnen, Kofferraum aufmachen, den verhüllten Körper an den Vorratsregalen vorbei zur inneren Tür tragen. Er trat in das Arbeitszimmer; im Haus war es still. In wenigen Minuten hatte er es geschafft.
Unter der Last leise ächzend, eilte er durch den Flur zum Schlafzimmer. Dort legte er die Tote auf das Bett und zerrte die Decke unter ihr hervor.
Im angrenzenden Badezimmer warf er ein paar Zyankalikristalle in das geblümte Zahnputzglas, ließ Wasser hineinlaufen und goß den ganzen Inhalt wieder ins Waschbecken, das er anschließend gründlich ausspülte. Dann ging er ins Schlafzimmer. Das Glas stellte er unmittelbar neben die Hand der Toten, verschüttete vorher aber noch die letzten Tropfen auf den Bettüberwurf. Sicher waren Vangies Fingerabdrücke auf dem Glas. Die Totenstarre setzte ein. Sorgfältig legte er die weiße Decke zusammen.
Vangie lag auf dem Bett mit dem Gesicht nach oben, stieren Blicks und mit zusammengepreßten Lippen, als hätte sie sich noch im Todeskampf wehren wollen. Gar nicht schlecht. Die meisten Selbstmörder überlegten es sich noch einmal – wenn es schon zu spät war.
Hatte er irgend etwas vergessen? Nein. Ihre Tasche mit den Schlüsseln stand auf der Chaiselongue, in dem Zahnputzglas würde man Spuren von Zyankali finden. Was machte er mit ihrem Mantel? Sie würde ihn wohl anbehalten haben. Je weniger er jetzt noch korrigierte, desto besser.
Ihre Schuhe! Hätte sie die durchs Zimmer geschleudert?
Er hob den Kaftan hoch, den sie seit der Schwangerschaft trug, und spürte, wie ihm das Blut aus dem Gesicht wich. Der geschwollene rechte Fuß trug einen ausgebeulten Mokassin. Am linken sah er – einen Strumpf.
Den anderen Schuh mußte sie verloren haben. Aber wo? Auf dem Parkplatz, im Sprechzimmer oder hier im Haus? Er stürzte aus dem Schlafzimmer und suchte den ganzen Weg zurück zur Garage ab. Nichts, weder im Haus noch in der Garage. Die zeitraubende Suche machte ihn wütend. Auch im Kofferraum lag er nicht!
Wahrscheinlich war dieser blöde Schlappen heruntergefallen, als er die Tote über den Parkplatz getragen hatte. Im Sprechzimmer hätte er ihn fallen hören und im Arzneimittelschrank war er auch nicht liegengeblieben, dessen war er sich absolut sicher.
Wegen ihres angeschwollenen Fußes hatte Vangie nur noch diese Mokassins getragen. Er hatte gehört, wie seine Sprechstundenhilfe mit ihr über die alten Schuhe gewitzelt hatte.
Er mußte zurück und auf dem Parkplatz suchen. Er mußte diesen Schuh finden. Wenn jemand den Mokassin entdeckte, der ihn an Vangie gesehen hatte? Es würde viel über ihren Tod geredet werden, sobald man die Leiche gefunden hatte. Wenn dann jemand auftrat und sagte: »Wieso, ich habe den Mokassin, den sie immer trug, auf dem Parkplatz liegen sehen. Sie muß ihn am Montagabend auf dem Heimweg verloren haben.« Aber selbst wenn sie nur ein paar Meter ohne Schuh über den Asphalt gegangen wäre, müßte ihr Strumpf an der Unterseite schmutzig sein. Der Polizei würde so etwas auffallen.
Schnurstracks ging er wieder ins Schlafzimmer und öffnete den begehbaren Schrank. Völlig durcheinandergeworfen lagen hier ihre Schuhe. Die meisten hatten unmögliche, hohe Absätze. Kein Mensch würde glauben, daß sie in ihrem Zustand und bei diesem Wetter solche Schuhe angezogen hätte. Drei oder vier Paar Stiefel waren darunter, aber ein Stiefel wäre nie über Vangies geschwollenen Fuß gegangen.
Dann fand er sie, ein Paar flache Schuhe, die nicht ungewöhnlich aussahen; Schuhe, wie sie die meisten Schwangeren anhatten. Sie schienen ziemlich neu zu sein, waren aber auf alle Fälle schon einmal getragen worden. Erleichtert griff er danach. Er ging zurück zum Bett, zog der Toten den Mokassin aus und steckte die neuen Schuhe an ihre Füße. Der rechte saß zwar sehr eng, aber er konnte ihn immerhin noch zuschnüren. Bevor er sich wieder davonmachte, packte er den Mokassin in die weite, tiefe Tasche seines Regenmantels und nahm seine weiße Decke unter den Arm.
Als er den Wagen auf den Parkplatz des Krankenhauses lenkte, hatte zwar der Schneeregen aufgehört, aber es stürmte immer noch und war bitterkalt. Er hielt in der hintersten Ecke. Wäre jetzt zufällig der Wachmann vorbeigekommen, hätte er einfach angegeben, er habe einen Anruf aus der Klinik bekommen. Er müsse zu einer Patientin, bei der die Wehen eingesetzt hätten. Und wenn jemand auf die Idee kam, dies nachzuprüfen, würde er den Entrüsteten spielen und konstatieren, dann habe es sich offenbar um einen üblen Scherzanruf gehandelt.
Natürlich war es sicherer, wenn ihn niemand sah. Während des ganzen Weges, bis zur Tür, die in seine Praxis führte, hielt er sich im Dunkel der Büsche, die man als Abgrenzung zwischen die Parkreihen gepflanzt hatte. Höchst wahrscheinlich war der Schuh heruntergefallen, als er die Leiche auf seinen linken Arm genommen hatte, um mit der Rechten den Kofferraum zu öffnen. Tief gebückt suchte er den Boden ab. Lautlos arbeitete er sich bis an die Kliniktür heran. Er sah hoch. Im Ostflügel waren alle Fenster dunkel; genauer fixierte er das mittlere im zweiten Stock. Die Innenjalousie war jetzt ganz herabgelassen. Wie ein Spürhund bewegte er sich über den Asphalt. Wenn ihn jemand so sah! Wut und Enttäuschung ließen ihn die bittere Kälte vergessen. Wo war nur dieser idiotische Schuh? Er mußte ihn finden.
Plötzlich Autoscheinwerfer, die sich durch die Büsche fraßen. Ein Auto kurvte auf den Parkplatz. Bremsen quietschten. Doch offenbar wollte der Fahrer zur Unfallstation. Er wendete und raste zur richtigen Einfahrt.
Er mußte hier weg; es war zwecklos. Doch als er sich aufrichten wollte, glitt er aus. Mit der Hand schrappte er über den vereisten Asphalt.
Und dan spürte er es – das Leder zwischen seinen Fingern. Er griff danach, hielt es hoch. Selbst bei dem trüben Licht war er sich ganz sicher. Es war der Mokassin. Er hatte ihn gefunden!
Eine Viertelstunde später schloß er seine Wohnung auf. Er trat ein, schlüpfte aus dem Regenmantel; als er ihn im Garderobenschrank verstaute, fiel ihm aus dem mannshohen Spiegel sein Bild entgegen. Zum Fürchten! Die Hose war an den Knien naß und schmutzig. Völlig zerzauste Haare. Die Hände waren dreckverschmiert, die Wangen stark gerötet, und seine ohnehin schon vorstehenden Augen sprangen fast aus ihren Höhlen. Eine Karikatur seiner selbst glotzte ihn an.
Rannte dann die Treppe hinauf. Oben zog er sich aus, warf das Zeug in die beiden Säcke für Wäscherei und Reinigung; badete. In Pyjama und Morgenmantel stand er später in der Diele. Schlafen konnte er noch nicht, die Anspannung war noch viel zu groß und außerdem hatte er Hunger.
Seine Haushälterin hatte kalten Hammelbraten gerichtet. Auf dem Küchentisch stand das Käsebrett mit frischem Brie. Im Kühlschrank lagen ein paar saftige saure Äpfel. Er packte alles säuberlich auf ein Tablett und trug es in die Bibliothek. An der Bar schenkte er sich einen mächtigen Whisky ein und setzte sich am Schreibtisch nieder. Während er aß, rief er sich die Ereignisse dieser Nacht noch einmal ins Gedächtnis. Wäre er nicht umgekehrt, um seinen Terminkalender durchzusehen, hätte er sie verpaßt. Vangie wäre abgereist und dann...
Er schloß seinen Schreibtisch auf, öffnete das große mittlere Schubfach und zog den doppelten Boden heraus, unter dem er immer die Sonderakte der betreffenden Patientin aufbewahrte. Dort lag ein einzelner, großer brauner Umschlag. Er suchte sich ein frisches Blatt Papier und machte seine abschließende Eintragung:
15. Februar
Um 20.40 Uhr schloß besagter Arzt die hintere Tür in seiner Praxis ab, als die betreffende Patientin aus Fukhitos Sprechzimmer kam. Patientin trat vor behandelnden Arzt und teilte ihm mit, sie fahre heim nach Minneapolis, um sich von ihrem früheren Frauenarzt, Dr. Emmet Salem, entbinden zu lassen. Patientin war hysterisch und wurde überredet, ins Sprechzimmer zu kommen. Verständlicherweise konnte der Patientin das Weggehen nicht mehr gestattet werden. Zu seinem großen Bedauern mußte behandelnder Arzt Vorbereitungen treffen, um das Leben der Patientin zu beenden. Unter dem Vorwand, für ein Glas Wasser zu sorgen, löste er Zyankalikristalle darin auf. Exitus der Patientin genau 20.51 Uhr. Fetus war 26 Wochen alt. Behandelnder Arzt ist der Meinung, daß er im Falle einer Geburt unter Umständen lebensfähig gewesen wäre. Der vollständige und tatsachengetreue ärztliche Bericht liegt bei dieser Akte. Durch ihn wären alle Aufzeichnungen in der Westlake-Klinik zu ersetzen und somit null und nichtig.
Mit einem Seufzer der Erleichterung legte er den Füllfederhalter nieder, steckte den Abschlußbericht in den Umschlag, den er anschließend versiegelte. Er stand auf und trat vor das Bücherregal. Im letzten Regalfach griff er hinter ein Buch und drückte auf einen Knopf. Das ganze Regal schwang seitlich herum und gab den Wandsafe frei. Er öffnete ihn geübt und legte die Ake hinein; beiläufig registrierte er die wachsende Zahl der Umschläge. Er hätte die dazugehörigen Namen auswendig aufsagen können: Elizabeth Berkeley, Anna Horan, Maureen Crowley, Linda Evans... Es waren weit über siebzig: Erfolge und Mißerfolge eines medizinischen Genies.
Er schloß den Safe. Das Bücherregal schwang zurück. Gelöst ging er nach oben, legte den Bademantel über einen Stuhl, stieg in sein riesiges Himmelbett und schloß die Augen.
Nun, da er die Sache hinter sich gebracht hatte, fühlte er sich total erschöpft. War etwas übersehen oder vergessen worden? Das Reagenzglas mit dem Zyankali stand im Safe. Die Mokassins! Morgen nacht würde er sie schon irgendwo loswerden. Doch die Vorfälle während der letzten Stunden wühlten seine Gedanken wieder auf. Vorher, als er getan hatte, was er hatte tun müssen, war er ganz cool gewesen. Jetzt aber ging es ihm wie in all den anderen Fällen: Sein Nervensystem schien zu kollabieren.
Morgen würde er seine eigenen Sachen selbst in die Reinigung geben, auf dem Weg zur Klinik. Hilda konnte man nicht gerade einfallsreich nennen, doch die feuchten, schmutzigen Knie an seiner Hose würden ihr auffallen. Dann mußte er noch herausfinden, wer in dem mittleren Krankenzimmer im Ostflügel lag und ob man etwas gesehen hatte. Nur jetzt nicht den Kopf voll machen damit! Er mußte schlafen. Er öffnete die Nachttischschublade. Das leichte Beruhigungsmittel war jetzt genau das Richtige für eine Mütze Schlaf. Ohne Wasser schluckte er die Kapsel hinunter, lehnte sich zurück und schloß erneut die Augen. Während er auf die Wirkung des Mittels wartete, redete er auf sich ein, daß ihm nichts passieren konnte. Dennoch wurde er die Ahnung nicht los, daß der Hauptbeweis seiner Schuld sich seinem Zugriff entzog.
3
»Wenn es Ihnen nichts ausmacht«, sagte die Schwester, »nehmen Sie doch bitte den Hinterausgang. Die vordere Auffahrt ist eisglatt und ein paar Männer sind noch dabei, sie zu räumen. Ihr Taxi wartet hinter der Klinik.«
»Ich würde sogar aus dem Fenster klettern, wenn ich nur nach Hause darf«, antwortete Katie. »Das Schlimme ist nur, daß ich am Freitag schon wieder herkommen muß.«
»Oh, was haben Sie denn?« fragte die Schwester und blickte auf Katies Krankenblatt.
»Anscheinend kommt jetzt das gleiche Problem auf mich zu, das meine Mutter auch immer hatte: Jeden Monat, wenn ich meine Periode habe, verblute ich beinahe. Und das soll am Samstag behoben werden.«
»Deshalb waren wahrscheinlich Ihre Blutwerte so niedrig, als man Sie gestern eingeliefert hatte. Aber seien Sie ohne Sorge, eine Ausschabung ist nichts Tragisches. Wer ist Ihr Arzt?«
»Dr. Highley.«
»Der beste, den wir haben. Aber Sie kommen dann auf ein Zimmer im Westflügel. Dort liegen alle seine Patientinnen. Es ist wie ein Luxushotel. Sie müssen wissen, Dr. Highley ist der führende Mann hier.« Sie sah immer noch auf Katies Patientenkarte. »Sie haben aber nicht besonders lange geschlafen.«
»Leider nein.« Katie rümpfte die Nase, als sie sich die blutige Bluse zuknöpfte. Den linken Ärmel mußte sie lose über ihren dick verbundenen Arm herunterfallen lassen. Die Schwester half ihr in den Mantel.
Es war ein bewölkter und bitterkalter Morgen. Für Katie war der Februar zum hassenswertesten Monat geworden. Sie fröstelte, als sie auf den Parkplatz hinaustrat. Der Alptraum fiel ihr ein. Genau auf diesen Platz hier hatte sie von ihrem Fenster aus herabgeschaut. Das Taxi fuhr vor. Erleichtert ging sie ihm entgegen, obwohl sie sich vor Schmerzen in den Knien kaum bewegen konnte. Die Schwester war ihr beim Einsteigen behilflich, verabschiedete sich vor ihr und drückte die Tür zu. Der Taxifahrer trat aufs Gaspedal. »Wohin bitte?«
Vom mittleren Fenster des Krankenzimmers im zweiten Stock aus beobachtete ein Mann die Abfahrt. In der Hand hielt er die Patientenkarte, die die Schwester auf den Nachttisch gelegt hatte. KATHLEEN N. DEMAIO, 10 WOODFIELD WAY, ABBINGTON, ARBEITGEBER: STAATSANWALTSCHAFT VON VALLEY COUNTY lauteten die ersten beiden Zeilen.
Ein Schreck durchzuckte ihn. Katie DeMaio!
Aus ihrem Krankenblatt ging hervor, daß ihr ein starkes Schlafmittel verabreicht worden war.
Laut ihren Angaben zur Krankengeschichte nahm sie keine Medikamente ein, in der Regel nicht einmal Schlaftabletten oder Beruhigungsmittel. Ein Gewöhnungseffekt traf in ihrem Fall also nicht zu, und sie würde von dem Mittel, das man ihr gestern nacht gegeben hatte, ziemlich benommen sein.
Auf der Karteikarte fand er noch eine kleine Notiz. Hiernach war sie von der Krankenschwester um 2.08 Uhr völlig aufgelöst auf dem Bett sitzend angetroffen worden und hatte über Alpträume geklagt.
Die Innenjalousie ihres Fensters war hochgerollt. Also mußte sie dort gestanden haben. Wieviel hatte sie sehen können? Wenn sie irgend etwas beobachtet hatte, und dessen war er ganz sicher, würde, selbst wenn sie es auch jetzt noch für einen Alptraum hielt, ihr beruflicher Spürsinn die Fährte aufnehmen. Die Frau war ein Risiko. Ein zu großes Risiko.
4
Schulter an Schulter saßen sie in der hintersten Ecke eines Cafes am Central Park. Das Gebäck hatten sie gar nicht angerührt. Düster blickend tranken sie ihren Kaffee. Ihre ineinandergeschlungenen Finger bildeten ein unentwirrbares Knäuel.
»Du hast mir gefehlt«, begann er vorsichtig.
»Du mir auch, Chris. Deshalb tut es mir ja auch so leid, daß Du mich schon heute früh gesehen hast. Das macht alles nur noch schlimmer.«
»Joan, gib mir Zeit. Ich schwöre bei Gott, daß wir das schaffen werden. Wir müssen es einfach.«
Sie schüttelte resigniert den Kopf.
Er blickte sie genauer an, und es gab ihm einen Stich ins Herz, als ihm auffiel, wie unglücklich sie aussah. Tiefe Schatten zogen sich um ihre Augen und ihr kastanienfarbenes Haar, das sie am Morgen zu einem Knoten hochgesteckt hatte, ließ ihre makellose Haut nur noch blasser erscheinen.
Zum hundertstenmal fragte er sich, warum er nicht schon im letzten Jahr eine saubere Trennung von Vangie vollzogen hatte, als er nach New York versetzt wurde. Weshalb nur war er auf ihre Bitte eingegangen, es noch einmal miteinander zu versuchen, obwohl es eigentlich schon seit zehn Jahren vergebens gewesen war. Und jetzt bekam sie auch noch das Baby. Er dachte an die häßliche Szene vor seiner Abfahrt. Sollte er damit Joan belasten? Nein, lieber nicht.
Sie war Stewardeß bei der PanAm. Vor einem halben Jahr hatten sie sich in Hawaii auf Jack Lanes Party getroffen. Lane war wie er Pilot bei United Airlines.
Auch Joans Heimatflughafen war New York; ihre Wohnung in Manhattan teilte sie mit zwei Kolleginnen.
Seltsam, fast unglaublich, wie sich manche Menschen vom ersten Augenblick an so glänzend verstehen können. Er hatte ihr erzählt, daß er verheiratet war, aber auch ehrlich zugegeben, daß er sich von Vangie hatte trennen wollen, als man ihn von Minneapolis nach New York versetzte. Auch von ihrem allerletzten Versuch, diese von Anfang an kaputte Ehe zu retten, hatte er berichtet. Und nun erwartete Vangie auch noch ein Kind.
»Du bist schon gestern abend hier angekommen?« fragte Joan beiläufig.
»Ja. In Chicago fiel eine Düse aus, daher wurde das letzte Stück des Fluges gestrichen. Wir sind dann mit einer anderen Maschine zurückgeflogen worden und gegen sechs gelandet. Im Holiday Inn habe ich mir ein Zimmer genommen.«
»Warum bist Du dann nicht nach Hause gegangen?«
»Weil ich dich seit zwei Wochen nicht gesehen habe und dich sehen wollte. Ich mußte dich wiedersehen! Vangie rechnet mit mir erst gegen elf.«
»Chris, du weißt, daß ich eine Versetzung zur Südamerikaroute beantragt habe. Sie ist genehmigt worden. Nächste Woche ziehe ich nach Miami.«
»Joan, nein!«
»Was sollte ich denn sonst machen in meiner Situation? So leid es mir tut, Chris, aber ich bin nicht deine Gespielin und vor allem will ich kein Eheschreck sein.«
»Aber wir sind doch nur Freunde.«
»Wer würde uns das jetzt noch glauben? Allein, daß du in der nächsten Stunde deine Frau anlügen mußt, wenn du ihr erzählst, wann du gelandet bist, spricht doch Bände, oder?«
Sie trank ihren Kaffee aus. »Ich weiß, was du jetzt sagen willst, Chris, aber ich könnte mir denken, daß ihr beide wieder zusammenfindet, sobald es mich hier nicht mehr gibt. Ich dränge mich immer in deine Gedanken, mit denen du besser bei Vangie wärest. Du wirst noch staunen, wie leicht ein Baby zwei Menschen wieder zusammenbringt.«
Sanft machte sie ihre Hand frei. »Ich gehe jetzt heim, Chris. Der Flug war lang, und ich bin müde. Du fährst jetzt besser auch nach Hause.«
Sie blickten sich an. Joan strich ihm über die Stirn, als könnte sie die tiefen Falten etwas glätten: »Wir hätten unheimlich gut zusammengepaßt.« Dann sagte sie noch: »Du siehst schrecklich müde aus, Chris.«
»Ich habe gestern nacht nicht sonderlich viel geschlafen.« Er versuchte zu lächeln. »Ich gebe nicht auf, Joan. Ich verspreche dir, eines Tages komme ich zu dir nach Miami, und dann werde ich frei sein.«
5
Das Taxi hatte Katie abgesetzt. Unter Schmerzen humpelte sie rasch die Eingangstreppe hoch, steckte den Hausschlüssel ins Schloß, drehte ihn herum und stöhnte leise: »Gott sei Dank zu Hause.« Es kam ihr so vor, als sei sie nicht eine Nacht, sondern wochenlang weggewesen. Sie sah ihr Zuhause mit neuen Augen. Sie mochte die ruhigen wohltuenden Brauntöne, in denen der riesige Flur und das Wohnzimmer gehalten waren und all die Hängepflanzen, die ihr gleich aufgefallen waren, als sie erstmals das Haus betreten hatte.
Sie hob eine Schale mit Usambaraveilchen hoch und roch den scharfen Duft der Blätter. Sie hatte noch immer den Geruch von Desinfektionsmitteln und Arznei in der Nase. Die Gelenke waren noch ganz steif und alles tat ihr weh. Die Schmerzen hatten sich seit heute früh verschlimmert.
Doch wenigstens war sie zu Hause.
John! Wäre er noch am Leben, wäre er gestern nacht dagewesen, hätte sie ihn rufen lassen...
Katie hängte ihren Mantel auf und ließ sich auf die aprikosenfarbene Samtcouch im Wohnzimmer sinken. Sie blickte zu Johns Bild hinüber, das über dem Kaminsims hing. John Anthony DeMaio, der jüngste Richter in ganz Essex County. Sie konnte sich noch so gut an den Tag erinnern, an dem sie ihn zum erstenmal gesehen hatte. Er war zu den Vorlesungen über Schadenersatzrecht an das juristische Seminar von Senton Hall gekommen, wo Katie studierte.
Nach Vorlesungsende scharten sich die Studenten um ihn: »Richter DeMaio, hoffentlich lehnt das Gericht die Berufung im Fall Collins ab.«
»Richter DeMaio, ich teile Ihre Entscheidung im Fall Reicher gegen Reicher.«
Dann war sie an der Reihe gewesen. »Herr Richter, Ihr Urteil im Fall Kipling halte ich nicht für angemessen.«
John hatte lachen müssen. »Dazu sind Sie durchaus berechtigt, Miß...«
»Katie... Kathleen Callahan.«
Sie hatte sich nie erklären können, warum sie in jenem Augenblick ihre ›Kathleen‹ herausgekehrt hatte. Aber so hatte er sie dann immer genannt: Kathleen Noel.
Noch am selben Tag hatte er sie zu einem Kaffee eingeladen. Tags darauf führte er sie ins Restaurant Monsignor II in New York zum Abendessen aus. Als das Violintrio zu ihrem Tisch kam, hatte er sich ›Wien, Wien, nur du allein... ‹ gewünscht. Er summte leise mit, bis das Lied zu Ende war, und dann fragte er sie: »Waren Sie schon einmal in Wien, Kathleen?«
»Wir haben mal eine Klassenreise auf die Bermudas gemacht. Und damals regnete es vier Tage lang.«
»Ich werde Sie zu einer Reise einladen. Mit Italien würde ich beginnen, es ist ein herrliches Land.«
Als er sie an jenem Abend nach Hause brachte, sagte er: »Sie haben die schönsten blauen Augen, die ich jemals gesehen habe. Wenn es nach mir ginge, sind die zwölf Jahre, die uns trennen, eigentlich kein Grund, uns nicht zusammenzutun. Meinen Sie nicht auch, Kathleen?«
Drei Monate später – sie hatte gerade ihr Examen bestanden – hatten sie geheiratet.
Dieses Haus! John war darin aufgewachsen und hatte es dann von seinen Eltern geerbt.
»Ich hänge ziemlich an dem Haus, Kathleen, aber du sollst dich auch darin wohlfühlen. Vielleicht wäre dir ein etwas kleineres lieber.«
»Ich bin in Queens in einer kleinen Dreizimmerwohnung großgeworden, John. Im Wohnzimmer habe ich auf einer Liege geschlafen. Was ›Intimsphäre‹ bedeutet, habe ich aus dem Lexikon erfahren. Ich liebe dieses Haus.«
»Wie schön, Kathleen.«
Sie waren so richtig verliebt gewesen und sehr offen zueinander. Sie hatte ihm von ihren Alpträumen erzählt.
»Ich warne dich«, hatte sie gesagt, »alle paar Monate wache ich einmal auf und schreie wie am Spieß. Das hat angefangen, als ich acht Jahre alt war und mein Vater starb. Man hatte ihn wegen eines Herzinfarkts ins Krankenhaus eingeliefert. Es ging ihm schon wieder besser, als er einen zweiten bekam. Zwar hatte anscheinend der alte Mann, der mit ihm auf dem Zimmer lag, immer wieder nach der Schwester geklingelt, aber niemand kam. Als die Schwester dann endlich hereinschaute, war es schon zu spät.«
»Und dann haben bei dir die Alpträume angefangen?«
»Ich glaube, John, es kam daher, daß ich die Geschichte zu oft zu hören bekommen habe. Weißt du, in diesen Alpträumen wandere ich im Krankenhaus von Bett zu Bett und suche Dad. In allen Betten sehe ich Gesichter von Menschen, die ich sehr oft kenne. Sie schlafen. Manchmal sind es meine Klassenkameradinnen, manchmal Cousins von mir oder irgendwelche Leute. Ich versuche immer noch, Dad zu entdecken. Ich wußte, daß er mich braucht. Schließlich sehe ich eine Schwester, laufe zu ihr hin und frage sie, wo er liegt. Lächelnd sagt sie: ›Ach, der ist doch tot. Alle diese Leute hier sind tot. Und du wirst auch hier drinnen sterben!‹ So geht das Nacht für Nacht.«
»Mein armes Mädchen.«
»O John, ich weiß natürlich, daß es unsinnig ist, nicht damit fertigzuwerden. Aber du kannst mir glauben, schon beim Gedanken, ins Krankenhaus zu müssen, fange ich an durchzudrehen.«
»Wir schaffen das schon, daß du darüber hinwegkommst, Kathleen.«
Sie fühlte sich wohl. Sie hatte sich getraut, John von der Zeit zu erzählen, als Vater tot war.
»Ich habe ihn so sehr vermißt. Dad nannte mich immer ›seine Tochter‹. Molly war damals sechzehn und ging schon mit Bill, ich glaube, es hat sie nicht so sehr getroffen. Während meiner ganzen Schulzeit habe ich mir immer wieder vorgestellt, wie schön es wäre, wenn Dad bei den Aufführungen und Abschlußfeiern dabeisein könnte. Jedes Jahr im Frühling waren alle Väter mit ihren Töchtern zu einem Essen eingeladen. Oh, ich haßte jenen Abend.«
»Gab es da keinen Onkel, oder so etwas, der dich hätte begleiten können?«
»Nur einen einzigen. Aber bei dem hätte ich zu lange gebraucht, um ihn wieder nüchtern zu kriegen.«
»Ach, Kathleen!« Sie hatten beide lachen müssen, und John hatte gesagt: »Man muß das Übel bei der Wurzel packen. Ich werde alles dafür tun, daß du nie mehr traurig bist.«
»Das haben Sie bereits getan, Herr Richter.«
In ihren Flitterwochen hatten sie eine Italienreise gemacht. Damals hatte es mit den Schmerzen angefangen. Rechtzeitig zu seinem ersten Gerichtstermin waren sie wieder zurückgekehrt. John führte den Vorsitz im Gericht von Essex County. Sie arbeitete als Referendarin bei einem Strafrichter in Valley County.
Einen Monat nach ihrem Urlaub hatte sich John untersuchen lassen. Aus dem einen Tag im Mount-Sinai-Krankenhaus waren drei geworden. Am zweiten Abend hatte er sie dann vom Lift abgeholt, todchic in seinem eleganten Bademantel aus dunkelrotem Samt. Sie war ihm entgegengeflogen. Er bemühte ein Lächeln: »Ich mache uns Kummer, Liebling.«
Wie er sich damals ausgedrückt hatte: »Ich mache uns Kummer.« Dieser Satz hatte ihr klargemacht, wie innig ihre Verbindung in diesen wenigen Monaten schon geworden war. Auf seinem Zimmer hatte er es ihr dann mitgeteilt: »Es ist ein bösartiger Tumor. Angeblich in beiden Lungenflügeln. Und dabei rauche ich doch nicht einmal, Kathleen.«
Sie hatten beide einen Lachanfall bekommen, denn es schien unglaublich – eine Ironie des Schicksals. John Anthony DeMaio, oberster Richter in Essex County, der frühere Vorsitzende der Anwaltschaft von New Jersey, war im Alter von noch nicht einmal 38 Jahren zu einer Lebenserwartung von noch genau sechs Monaten verurteilt. Und es gab keinen Aufschub, keine Möglichkeit zur Revison.
Er war sogar noch einmal ins Gericht gegangen. »Warum nicht in der Robe sterben«, hatte er achselzuckend gesagt.
»Versprich mir, daß du wieder heiratest, Kathleen.«
»Eines Tages schon. Aber so einen Mann wie dich werde ich nie wiederfinden.«
»Das ist lieb von dir, Kathleen. Wir werden jede Minute auskosten, die uns noch bleibt.«
Selbst in jenen Tagen, unter dem Schatten des Todes, hatte ihre Liebe geblüht wie nie.
Eines Tages war John aus dem Gericht gekommen und hatte gesagt: »Ich fürchte, das war mein letzter Fall.«
Der Krebs hatte sich ausgebreitet. Die Schmerzen waren ständig schlimmer geworden. Er hatte sich gleich für ein paar Tage zur Chemotherapie in die Klinik begeben.
Ihre Alpträume waren wiedergekommen. Ab dem dritten Tag ohne John sogar regelmäßig. Als John wieder nach Hause kam, hatte sie ihre Arbeit aufgegeben. Sie wollte jede Minute bei ihm sein.
Zuletzt hatte er gefragt: »Meinst du, es ist besser, wenn deine Mutter herkommt und bei dir wohnt?«
»Um Himmels willen, nein. Mam ist großartig, aber wir haben zusammengewohnt, bis ich aufs College ging. Das war genug. Außerdem liebt sie Florida.«
»Jedenfalls bin ich froh, daß Molly und Bill nicht weit weg wohnen.«
Dann hatten sie beide geschwiegen. Bill Kennedy war Facharzt für Orthopädie. Molly und er hatten sechs Kinder. Sie wohnten in einer Nachbarstadt, in Chapin River. Ihnen gegenüber hatten Katie und John geprahlt, daß sie diese Zahl absolut übertreffen würden. »Bei uns werden es sieben«, hatte John erklärt.
Als er wieder zur Chemotherapie mußte, hatten sie ihn gleich in der Klinik behalten. Noch ein paar kurze Worte, dann war das Koma eingetreten.
Und sie hatten beide so gehofft, daß das Ende zu Hause käme! Noch in jener Nacht war John im Krankenhaus gestorben.
In der Woche nach der Beerdigung hatte sich Katie bei der Staatsanwaltschaft beworben und die Stelle erhalten. Es war eine kluge Entscheidung gewesen. Die Behörde war ständig unterbesetzt, und Katie hatte immer mehr Fälle, als sie in Ruhe bearbeiten konnte. Es blieb ihr gar keine Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Von Montag bis Freitag, oft sogar noch am Wochenende, mußte sie sich auf ihre Akten konzentrieren, die sie manchmal stapelweise mit nach Hause schleppte. Dennoch empfand sie dies als eine gute Therapie. Ihren Zorn, der sich in ihre Trauer mischte, das Gefühl, selbst betrogen worden zu sein, ihre Wut, daß John um so viel Leben betrogen worden war, lenkte sie auf die Fälle ab, die sie bearbeitete. Wenn sie die Aufklärung eines schweren Verbrechens erfolgreich betrieben und den Täter der gerechten Strafe zugeführt hatte, spürte sie, daß sie auf diese Weise wenigstens ein Übel wirksam bekämpfte, das Leben zerstörte.
Sie hatte das Haus behalten. John hatte ihr alles vermacht; dennoch kam es ihr albern vor, daß eine Achtundzwanzigjährige mit einem Jahresgehalt von zweiundzwanzigtausend Dollar in einem Haus wohnte, das eine Viertelmillion wert war und auf einem Grundstück von etlichen Quadratmetern lag.
Molly und Bill hatten sie immer gedrängt, es zu verkaufen. »Erst wenn du es los hast, wirst du wieder leben können wie vorher.«
Wahrscheinlich hatten sie recht. Katie schüttelte sich und stand vom Sofa auf. Sie war wieder einmal auf dem besten Wege, sentimental zu werden. Jetzt rief sie besser Molly an. Wenn Molly gestern abend versucht hatte, sie zu erreichen und niemand den Hörer abnahm, jubelte sie sicher insgeheim, wenn ihr Standardspruch, Katie müsse ›mal mit jemandem ausgehen‹ doch noch Wirkung gehabt haben sollte. Aber Katie wollte auch verhindern, daß Molly sie im Büro anrief und dort von ihrem Unfall erfuhr.
Vielleicht kam Molly auch bei ihr vorbei, und sie konnten zusammen zu Mittag essen. Sie hatte alles für einen Salat im Haus und für eine Bloody Mary war auch gesorgt. Molly hielt Diät, aber ihre Bloody Mary am Mittag mußte sie haben. »Wie um Himmels willen soll jemand mit sechs Kindern ohne Mittagsdrink auskommen können, Katie?« entschuldigte sich Molly immer; wenn sie vorbeikam, würde sie mit ihrer Frohnatur bestimmt Einsamkeit und Trauer vertreiben.
Katie fiel ein, daß sie immer noch die blutbespritzte Bluse trug. Erst wollte sie mit Molly telefonieren und sich dann duschen und umziehen, bevor ihre Schwester kam.
Sie blickte in den Spiegel. Der Bluterguß unter dem rechten Auge hatte sich bereits lila gefärbt. Ihr Gesicht war fahl und gelblich und das nackenlange dunkelbraune Haar, sonst voll und duftig in einer weichen Welle herabfallend klebte im Gesicht und am Hals.
»Du solltest es mal wieder mit einem Mann versuchen«, murmelte sie resigniert.
Der Arzt hatte ihr geraten, den Arm vor Nässe zu schützen. Am besten stülpte sie eine Plastiktüte über den Verband, wenn sie duschte. Als sie zum Telefonhörer griff, klingelte der Apparat. Bestimmt Molly, dachte sie.
Aber es war Richard Carroll, der Gerichtsmediziner. »Grüß dich, Katie, wie geht’s dir? Ich habe gerade gehört, du hättest einen Unfall gehabt?«
»Nichts Schlimmes. Nur ein kleiner Umweg über den Straßengraben. Leider hat sich ein Baum in den Weg gestellt.«
»Wann ist das passiert?«
»Gestern abend gegen zehn. Ich war auf dem Nachhauseweg vom Büro; hatte noch zu arbeiten, um ein paar Akten abzuschließen. Die Nacht habe ich im Krankenhaus verbracht. Ich bin gerade heimgekommen, sehe zwar gräßlich aus, aber sonst ist alles in Ordnung.«
»Wer hat dich abgeholt? Molly?«
»Nein, sie weiß es noch gar nicht. Ich habe ein Taxi kommen lassen.«
»Du spielst also mal wieder die einsame Heldin, was?« fragte Richard. »Und mich anzurufen ist dir wohl auch nicht in den Sinn gekommen!«
Katie mußte lachen. Die Besorgnis in seiner Stimme erschien ihr schmeichelhaft und erpresserisch zugleich. Richard war ein guter Freund von Mollys Mann. Im letzten halben Jahr hatte Molly sie und Richard gleich mehrmals mit eindeutigen Absichten zum Abendessen eingeladen. Für Katie war Richard zu direkt und zynisch. In seiner Gegenwart war ihr eigentlich nie richtig wohl. Außerdem war sie noch nicht darauf aus, eine nähere Bekanntschaft zu schließen und schon gar nicht mit jemandem, der ihr beruflich dauernd über den Weg lief. »Wenn mir das nächste Mal ein Baum in die Quere kommt, werde ich an dich denken.«
»Du machst doch jetzt sicher ein paar Tage Urlaub, oder?«
»Nein, nein«, wehrte sie ab, »ich frage jetzt Molly, ob sie auf einen kleinen Happen rüberkommt, und dann fahre ich ins Büro. Noch mindestens zehn Akten sind durchzugehen, und am Freitag ist einer meiner wichtigsten Fälle dran.«
»Es ist ja wohl zwecklos, wenn ich dir sage, daß das verrückt ist. Okay, ich muß Schluß machen, das andere Telefon klingelt. So um halb sechs schaue ich mal bei dir rein, und dann gehen wir noch zusammen etwas trinken.« Er legte auf, bevor sie etwas entgegnen konnte.
Katie wählte Mollys Nummer. Die Stimme ihrer Schwester klang erschüttert. »Hast du’s schon gehört, Katie?«
»Was denn?«
»Die Polizei ist schon im Haus.«
»In welchem Haus denn?«
»Nebenan, bei Lewis. Das Ehepaar, das letzten Sommer eingezogen ist. Der Ärmste! Er kam von einem Nachtflug heim und hat sie gefunden. Vangie, sie hat sich umgebracht. Sie war im siebten Monat, Katie!«
Bei Lewis. Katie hatte Chris und Vangie Lewis bei Mollys und Bills Silvesterparty kennengelernt. Sie eine hübsche Blondine, er war Pilot.
Benommen preßte sie den Hörer ans Ohr. »Katie, warum sollte jemand Selbstmord machen, der sein Baby haben will?«