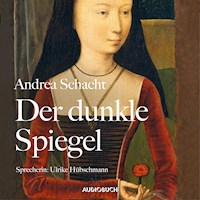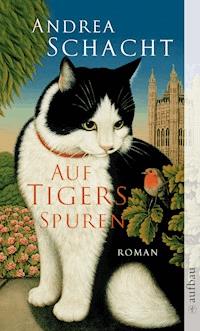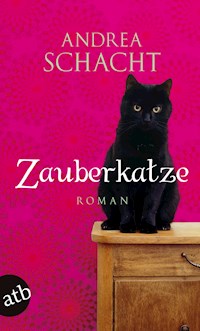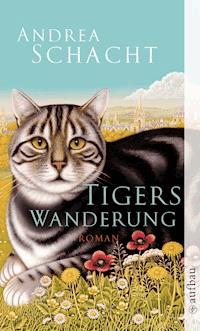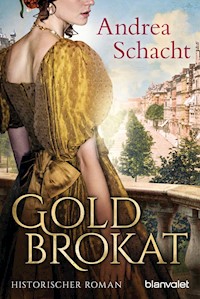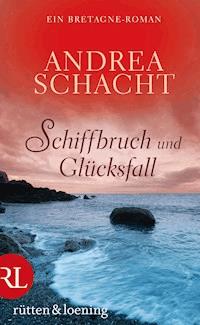8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Weihnachten ist das Fest der Liebe – und der Katzen. So bringt Raufer, ein ausgewiesener Straßenkater, Kris, seinem neuen Herrn, bei, was Weihnachten ist. Und die Katzen Plüsch und Plunder behalten in dem Antiquitätenladen, den sie hüten, selbst im größten Weihnachtsstress die Übersicht.
Weihnachten mit Plüsch und Plunder.
Ginger, eine junge rothaarige Frau, erbt von ihrer Patentante einen Antiquitätenladen – und eine Menge Probleme. Doch zum Glück hat sie ihre Katzen Plüsch und Plunder, die auch im größten Weihnachtsstress immer die Übersicht behalten. Und dann taucht kurz vor dem Fest auch noch ein Mann im Laden auf, der nicht nur die beiden Katzen hinreißend findet ...
Weihnachtskatz und Mäusespeck.
Als Kris sich kurz vor Weihnachten auf einen handfesten Streit einlässt, hat der junge
Mann plötzlich ein Problem: Bei der Schlägerei wird Raufer, ein Straßenkater, verletzt, und er muss sich um das Tier kümmern. Was soll Kris mit einer Katze anfangen? Doch bald erkennt er, dass Raufer kein gewöhnlicher Kater ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Über Andrea Schacht
Andrea Schacht lebt als freie Schriftstellerin in der Nähe von Bad Godesberg. Neben erfolgreichen historischen Romanen hat sie etliche Bücher veröffentlicht, in denen Katzen eine Hauptrolle spielen. Bei Rütten & Loening liegen von ihr vor: »Die keltische Schwester« sowie die Weihnachtsbücher: »Das doppelte Weihnachtskätzchen«, »Weihnachtskatze gesucht« und »Der fliegende Weihnachtskater«.
Im Aufbau Taschenbuch veröffentlichte sie »Der Tag mit Tiger«, »Auf Tigers Spuren«, »Tigers Wanderung«, »Hexenkatze«, »Die Katze mit den goldenen Augen« sowie »Katzenweihnacht« und »Morgen Katzen wird’s was geben«.
Informationen zum Buch
Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Katzen. So bringt Raufer, ein ausgewiesener Straßenkater, Kris, seinem neuen Herrn, bei, was Weihnachten ist. Und die Katzen Plüsch und Plunder behalten in dem Antiquitätenladen, den sie hüten, selbst im größten Weihnachtsstress die Übersicht. Weihnachten mit Plüsch und Plunder – Ginger, eine junge rothaarige Frau, erbt von ihrer Patentante einen Antiquitätenladen und eine Menge Probleme. Doch zum Glück hat sie ihre Katzen Plüsch und Plunder, die auch im größten Weihnachtsstress die Übersicht behalten. Und dann taucht kurz vor dem Fest auch noch ein Mann im Laden auf, der nicht nur die beiden Katzen hinreißend findet. Weihnachtskatz und Mäusespeck – Als Kris sich kurz vor Weihnachten auf einen handfesten Streit einlässt, hat der junge Mann plötzlich ein Problem: Bei der Schlägerei wird Raufer, ein Straßenkater, verletzt, und er muss sich um das Tier kümmern. Was soll Kris mit einer Katze anfangenő Doch bald erkennt er, dass Raufer kein gewöhnlicher Kater ist.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Andrea Schacht
Zwei Katzen unterm Weihnachtsbaum
Inhaltsübersicht
Über Andrea Schacht
Informationen zum Buch
Newsletter
Weihnachten mit Plüsch und Plunder
1. Weihnachtsduft
2. Staubige Ecken
3. Elende Tage
4. Hilfe aus der Nachbarschaft
5. Von ungehaltenen Katzen
6. Zu viel Plunder
7. Samtpfoten-Ideen
8. Ein traumhafter Entschluss
9. Schicksalhafte Begegnung
10. Kassensturz
11. Heimliche Gelüste
12. Ein überraschendes Angebot
13. Eine königliche Lektion
14. Der Wert der Dinge
15. Nächtliche Umtriebe
16. Katzenleid
17. Die Macht des Schnurrens
18. Spurensuche
19. Ungehörige Behandlung
20. Nächtlicher Besuch
21. Der Weg des Herzens
22. Das grüne Sofa
23. Katzenwunsch
Anmerkung der Autorin
Weihnachtskatz und Mausespeck
Personen
1. Eine Schlägerei
2. Übles Erwachen
3. Ablieferung
4. Katzenpille
5. Ratloser Raufer
6. Inas Hilfe
7. Tierarztbesuch
8. Flucht vor dem Ungeheuer
9. Anjas Kontrollbesuch
10. Fenstergucker
11. Der Streuner-Clan
12. Begegnung mit der Ehrwürdigsten
13. Süße Überredung
14. Weihnachts-Fitness
15. Zusammenstoß mit dem Hausverwalter
16. Handyschnurren
17. Tumult auf dem Weihnachtsbasar
18. Bande und Bindungen
19. Der Katzen-BH
20. Nimoues Lektionen
21. Krötenschlucken
22. Hoher Besuch
23. Weihnachtsfeier
Impressum
Weihnachten mit Plüsch und Plunder
1. Weihnachtsduft
Ich liebe Weihnachten. Vor allem der Geschenke wegen. Allerdings nicht wegen der Gaben, die ich selbst erhalte. Nein, ich liebe es, schöne Dinge so zusammenzustellen, dass sie einander in ihrer Wirkung ergänzen und ein stimmungsvolles Bild ergeben. Diese Leidenschaft habe ich schon als Kind entwickelt, und Tante Juliane hat sie mit großem Vergnügen gefördert. Sie sagte, eine schöne Dekoration helfe den geplagten Menschen, die glücklich aufseufzend zu einem wirklich passenden Präsent greifen und damit dem Weihnachtsstress ein wenig entkommen. In ihrem Antiquitätenladen habe ich meine schönsten vorweihnachtlichen Stunden verbracht. Was hatte sie nicht alles in ihrem Fundus! Handbemalte Christbaumkugeln aus dem vorigen Jahrhundert, silberne Kerzenleuchter mit blinkenden Kristallgehängen, kleine Spieluhren, die Weihnachtslieder klimperten, liebevoll geschnitzte Engelchen mit Spanholzlocken, Modeln für Spekulatius und vieles mehr fand sich in ihren unordentlichen Lagerräumen. Sie zeigte mir, wie man aus immergrünen Zweigen Girlanden flocht, so wie sie früher gerne über die Türen und Kamine gehängt wurden. Wir stellten phantasievolle Gestecke aus Stechpalmen und alten Parfümflakons her, dekorierten alten Granatschmuck in Tannenreisern, und in einem Korb mit Mistelzweigen hingen wir alte Perlenohrringe. In einem kleinen Weihnachtsbaum klingelten Porzellanglöckchen, und Rauschgoldengel schwebten lächelnd in den Zweigen, vergoldete Pinienzapfen hingen an farbenfrohen Bändern von einer knorrigen Rebwurzel, Sterne aus geschliffenem Kristall funkelten auf Samtkissen, und feinstes, altes Leinen mit gestickten Weihnachtsmotiven drapierten wir über Sandelholztischchen.
Von Tante Juliane lernte ich zudem, aus Seidenpapier und Unmengen von goldenen, grünen und roten Bändern prachtvolle Verpackungen zu zaubern. Aus getrockneten Orangenschalen, Zimtstangen und Nelken konnte ich bald duftende Potpourris herstellen, die wir in antike Silberschalen füllten. Daneben aber wies sie mich auch in die Kunst der Bratapfelzubereitung und des Glühweinkochens ein, so dass wir unsere Kunden mit diesen kleinen Leckereien verwöhnen konnten. Die Leute dankten es ihr, indem sie ihren Freunden und Bekannten von dem originellen Antiquitätengeschäft vorschwärmten. Und so kamen natürlich auch nach den Feiertagen Neugierige vorbei, die sich für die wundervollen alten Dinge interessierten, die sie mit so viel Geschick zusammenstellte.
Und noch eines verdankte ich Tante Juliane – meine Liebe zu Katzen. Denn solange ich denken konnte, war immer eines dieser sanften, klugen und liebevollen Tiere ihr Begleiter.
Meiner Kindheit und Jugend war ich inzwischen entwachsen, Ausbildung und Beruf hatten mich fortgeführt aus Tante Julianes Zauberhöhle, und der Kampf um Aufstieg und Anerkennung hatte mich von der traulichen Weihnachtsstimmung entfernt, die ich immer bei ihr empfunden hatte.
Bis ich die Botschaft von ihrem plötzlichen Tod erhielt.
2. Staubige Ecken
Schneiders Anti uitäten stand über dem blinden Schaufenster. Das S hing schief herunter, das q fehlte, und das ä würde sich auch bald verabschieden. Ein verblichener Vorhang, einst grün und orange gemustert, war vor die Auslage gezogen, an der Ladentür, deren Lack ebenfalls recht antiquiert wirkte, hatten sich schmierige Hamburger-Tüten und ein paar Orangenschalen versammelt.
Ich betrachtete die Schlüssel in meiner Hand und seufzte. Es war wohl auch meine Schuld. Zwei Jahre lang hatte ich mich kaum um meine Patin gekümmert. Dabei verdankte ich ihr viel. Nun war sie tot, unerwartet und schnell war sie gestorben, und ich hatte Haus und Laden geerbt. Juliane Schneider war das gewesen, was man guten Gewissens eine schrullige, alte Tante nennen konnte. Die Formulierung in ihrem Testament bestätigte das nur: Kümmere Dich gut um meinen Plunder!, hatte sie angeordnet.
Das sollte ich dann jetzt wohl endlich tun.
Die Türangeln gehörten geölt, das melodische Glockenspiel, das früher die Kunden mit einem fröhlichen Klingklang begrüßt hatte, war verschwunden, und eine muffige, staubige Luft brachte mich erst einmal zum Niesen. Drei Wochen lang hatte niemand den Laden betreten, nur die darüberliegende Wohnung war von einer Nachbarin aufgeräumt worden. Mich hatte die Nachricht von Tante Julianes Tod und dem Erbe nach meiner wütenden Flucht nach Teneriffa erst vergangene Woche erreicht, sonst hätte ich mich sicher schon früher um alles gekümmert.
Plunder! Das war mein erster Eindruck, als ich das Taschentuch sinken ließ. Großer Gott, was für ein Plunder! Dabei hatte ich diesen Laden einst für das Paradies auf Erden gehalten. Damals, als ich oft nach der Schule hier ausgeholfen hatte. Aber das war zehn Jahre her, und seitdem schien sich meine Patentante weniger auf Antiquitäten als auf Sperrmüll spezialisiert zu haben. Wo früher Perlenhandtäschchen und Spitzenfächer keuscher Biedermeierdamen, Zigarettenspitzen und Satinhandschuhe verruchter Jugendstil-Vamps, zierliche Tänzerinnen auf Spieluhren und Meißner Liebespaare miteinander gepflegte Konversation hielten, türmten sich jetzt verbeulte Kupferkasserollen, verbogene Emailschöpflöffel, angerostete Bügeleisen, abgesplitterte Spanholzkörbe und angeschlagene Schliffkaraffen auf den Borden.
Abgesehen von einigen Ansichtskarten, Geburtstags- und Weihnachtsgrüßen hatten Tante Juliane und ich in den vergangenen Jahren nicht viel Kontakt miteinander gehabt. Das letzte Mal hatte ich sie vor zwei Jahren bei der Beerdigung meines Großvaters getroffen. Damals machte sie noch einen agilen Eindruck und wurde dem Titel, den ich ihr als Kind verliehen hatte, völlig gerecht: meine Patent-Tante. Doch dann war sie eines Tages gestürzt, hatte sich den Oberschenkel gebrochen und war in der Folge davon auf fremde Hilfe angewiesen. Das hatte sie aber aus Gründen, die in ihrer Schrulligkeit zu suchen waren, ihren Verwandten verschwiegen.
Hätte ich sie nur früher besucht …
Traurigkeit und Schuldgefühle übermannten mich, als ich mich in dem angehäuften Gerümpel umsah. Die alte Ladeneinrichtung, eine wunderschöne Mahagoni-Theke mit einer mechanischen Registrierkasse, wirkte völlig deplatziert inmitten der staubigen Gegenstände. Wie faszinierend hatte ich einst diese Kasse gefunden, die man noch mittels Kurbel zum Rechnen bringen konnte! Neue Technik hatte selbstverständlich bei Tante Juliane nicht Einzug gehalten.
Ich zog den Vorhang an dem großen Schaufenster ein Stück zur Seite, und im Licht der leuchtenden Oktobersonne wirkte der Laden noch schäbiger, aber nicht mehr ganz so trübsinnig. Zumindest blitzte der Kristalllüster wieder auf, und aus einer Ecke schimmerten mir juwelengleiche Farben entgegen.
Es versetzte mir einen Stich, als ich erkannte, woher diese Farbenpracht rührte. Zwei schlanke Karaffen waren es, die eine aus violettem Glas, in dem ein blauer Innenfang glomm und die von einem klaren Überzug umfasst war, die andere grün, innen gelb mit aquamarinfarbenem Überfang. Meisterwerke, Unikate aus einer Werkstatt in Murano. Ich selbst hatte sie für Tante Juliane während der vier Jahre gekauft, die ich für ein italienisches Unternehmen in Venedig gearbeitet hatte. Sie mochten ihr nicht gefallen haben, daher hatte sie versucht, die Karaffen in ihrem Laden zu verkaufen. Oder hatte es ihr an Geld gefehlt? Ihre Finanzen waren nicht besonders üppig, so hatte mir der Notar es dargestellt, aber ein kleines Sparguthaben gab es noch.
Je nun, was sollte ich mich grämen! Kunst ist Geschmackssache. Mir gefiel diese beinahe archaisch anmutende Farbzusammenstellung, aber Tante Juliane hätten möglicherweise dezentere Objekte mehr zugesagt.
Eine Tür führte vom Verkaufsraum zu dem Büro mit einer kleinen Teeküche, einem winzigen Bad und dem Lagerraum. Ich suchte den passend beschrifteten Schlüssel heraus und öffnete die Tür. Ein unangenehmer Geruch schlug mir entgegen. Offensichtlich war irgendetwas im Kühlschrank verrottet, oder die Toilette war verstopft.
In der Erwartung, dass mir ein Stück Käse entgegenkriechen würde, machte ich die Kühlschranktür auf und fand lediglich eine Flasche Wasser darin. Dankbar schloss ich ihn wieder, aber zu einer weiteren Inspektion fehlte mir der Mut. Morgen würde ich mich mit scharfen Putzmitteln, Staubsauger und den üblichen Reinigungswaffen an die Arbeit machen. Jetzt wollte ich in die Wohnung nach oben gehen. Darum kehrte ich in den Verkaufsraum zurück, um den Vorhang wieder zuzuziehen und abzuschließen. Doch bevor ich den Raum wieder in seinen verschlafenen Halbdämmer hüllte, sah ich mich noch einmal um, und meinen Lippen entfloh der Seufzer: »Meine Güte, was für ein Plunder!«
Es klang wie ein Echo — das leise, seltsam heisere Wimmern.
Ich blieb mitten im Raum stehen und lauschte. Dann schaute ich aus dem Fenster, aber vor der Tür winselte kein verlassener Hund oder ein Schulkind mit schlechten Noten.
»Ist hier jemand?«, fragte ich vorsichtig.
Es jammerte wieder heiser — sehr leise und von irgendwo unter einem Möbel an der Wand.
Das Geräusch kam mir vage bekannt vor.
»Wo bist du? Komm, zeig dich!«, forderte ich mit leiser Stimme.
Das Jammern wurde zu einem kläglichen Maunzen.
Ich ging auf alle viere und schaute unter einen hässlich geblümten Sessel.
Verschreckte Augen aus einem hellen Gesicht blickten mich an.
»Wie bist du denn hier reingekommen? Bist du vorhin hinter mir hergeschlichen?«
Das Tierchen zog sich weiter an die Wand zurück. Da konnte es nicht bleiben. Wenn es von draußen gekommen war, durfte ich es hier nicht einschließen. Also stand ich auf und wuchtete den Sessel beiseite. Ein zerzauster Flauschball drückte sich in die Ecke.
Beherzt griff ich zu.
»Maumaumau!«, klagte es leise, und eine Unzahl von Krallen klammerte sich in meinem Sweatshirt fest.
»Ach, du liebes bisschen. Du bestehst ja nur noch aus Fell und Knochen. Und außerdem siehst du aus, als hätte man mit dir hier drinnen Staub gewischt.«
Zitternd barg die kleine Katze ihr Gesicht an meiner Schulter.
3. Elende Tage
Er wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren, seit die Männer seine Menschenfreundin auf einer Trage aus dem Haus gebracht hatten. Vor ihren polternden Schritten hatte er sich unten im Laden versteckt. Dann war die Tür zugefallen, das schreckliche blaue Blinklicht war verschwunden, und danach hatte die Einsamkeit begonnen.
Erst in der zweiten Nacht hatte er sich hinter den Ordnern hervorgewagt. Der Hunger hatte ihn hinausgetrieben. Doch viel war es nicht, was sich da noch zu beißen fand. Die Schüssel mit dem Trockenfutter war bald leer, und die Mäuse hielten auch nur für wenige Tage vor. Zum Glück tropfte im Badezimmer ein Wasserhahn, so dass er wenigstens etwas Flüssigkeit zu sich nehmen konnte. Einige Stunden verbrachte er auf dem Beckenrand und leckte jedes bisschen Flüssigkeit auf, die aus der undichten Armatur quoll. Den Rest der Zeit verbrachte er damit zu dösen und zu schlafen. Und zu warten, dass seine Freundin wiederkam.
Aber sie kam nicht.
Auch die andere Frau kehrte nicht zurück, die sich seit dem Sommer um seine alte Dame gekümmert hatte, weil sie nicht mehr richtig laufen konnte. Darüber war er im Grunde ganz froh, denn diese Frau mochte er nicht. Sie hatte versucht, ihn zu treten und von dem Bett seiner Freundin fernzuhalten, aber vor allem fand er sie widerlich, weil sie nach Hund roch. Und vor Hunden fürchtete er sich noch mehr als vor hinterhältigen Tritten und polternden Stiefeln.
Diese Angst stammte aus der Zeit, da er noch ein ganz kleiner Kater gewesen war, Mitglied einer angesehenen Familie, wie ihm seine Mutter versichert hatte. Die Menschen würden ihm zu Füßen liegen, ihn mit allerlei Leckerbissen verwöhnen, sein Körbchen mit samtenen Kissen auspolstern und ihm täglich mit sanften Bürstenstrichen das Fell pflegen. Niemand würde von ihm verlangen zu mausen, nie würde er von Regen und kalten Schneeschauern durchnässt werden, nie verzweifelt an geschlossenen Türen kratzen müssen.
Fast hätte es sich auch so ergeben. Ein Menschenpaar hatte ihn zu sich genommen und in ein wunderschönes Heim gebracht, das ganz nach seinen Wünschen ausgestattet war. Schon nach wenigen Tagen hatte er einen ausgesuchten Gefallen daran gefunden, sich dekorativ auf die Rückenlehne des dunkelblauen Sofas zu drapieren. Besonderen Beifall fand der elegante Schwung, mit dem er seinen Schwanz dabei einzusetzen wusste.
Ja, gut, es war seine Schuld, er hätte an jenem schönen Spätsommerabend nicht hinter seinen Leuten hinaus in den Garten schlüpfen dürfen. Er hätte wachsamer sein müssen, misstrauischer.
Der Hund des Nachbarn, ein großer, muskulöser Kerl ohne Rasse, aber mit ausgeprägter Mordlust und bedauerlich scharfen Zähnen, hatte ihn aufgescheucht. Eine wilde Verfolgungsjagd begann, vom Schreien und Kreischen seiner Menschen, dem Bellen des Köters und seines Herren untermalt. Völlig außer Atem hatte er sich auf einen niedrigen Ast retten können, glaubte sich in Sicherheit – und dann …
Sie brachten ihn zum Tierarzt. Ein heftiger Piks, und gnädig verstummten die grellen Schmerzen.
Als er wieder aus der Dunkelheit erwachte, war ihm sofort klar geworden, dass ihm etwas fehlte.
Seine Leute sah er nie wieder. Die beiden Tierarzthelferinnen, junge, schwatzhafte Geschöpfe, mitleidig die eine, die andere grausam, hörte er sagen, dass sie sich einen neuen Kater gekauft hatten.
»Ich verstehe nicht, warum der Doktor ihn nicht gleich eingeschläfert hat«, sagte die Grausame.
»Er ist ein gesundes Tier, die Wunde wird wieder heilen. Es ist ja nichts Lebenswichtiges, was er verloren hat.«
»Ein Rassekater ist nichts mehr wert, wenn er nicht vollkommen ist.«
»Als Zuchtkater hätten sie ihn noch immer halten können. Aber ich glaube, die suchten nur ein Dekorationsstück. Na, mir tut er leid. Er ist so ein süßer Flederwisch.«
»Willst du ihn denn nehmen?«, fragte die Grausame verächtlich.
»Ich wünschte, ich könnte es, aber noch ein Tier mehr in meinem Zoo, und mein Vermieter wirft mich aus der Wohnung. Wir werden ihn wohl ins Tierheim geben müssen.«
So kam es auch – und damit war Schluss mit dem angenehmen Leben.
Der tägliche Überlebenskampf war eine schockierende Erfahrung für ihn. Er musste sich gegen größere, gewandtere Katzen durchsetzen, um etwas vom Fressen zu ergattern, scheußliches Zeug übrigens, weit entfernt von den Leckereien, die er gewohnt war. Er fing sich Flöhe von den Streunern und Schläge von den Raufbolden ein, wurde von jedem weichen Kissen vertrieben, das er versuchte für sich zu erobern, und musste mit der beständigen Häme leben, die die anderen über ihn ergossen.
Er magerte ab, verzog sich eingeschüchtert unter ein zerfetztes Sofa und wurde weitgehend vergessen.
Bis die alte Dame in Begleitung eines Jungen im Tierheim erschien und nach einem kompetenten Mauser fragte. Ganz gewiss stellte sie sich einen strammen Kater mit Fangqualitäten vor, denn sie sprach von einer Mäuseplage im Garten. Der Junge und die Dame entschieden sich für einen kräftigen Tiger, der sich dem Jungen freundlich genähert hatte. Doch als die Formalitäten abgewickelt waren, fiel der Blick der alten Dame auf die eine weiße Pfote, die er vergessen hatte, unter sein Versteck zu ziehen.
»Das ist aber kein Mauser, Frau Schneider«, erklärte die Angestellte des Tierheims. »Das ist unsere Problemkatze.«
Die Besucherin ächzte ein wenig, als sie auf die Knie ging, aber ihre Stimme war sanft und zärtlich.
»Ich wollte auf meine alten Tage eigentlich keine Katze mehr aufnehmen, aber dieser hier – ich kann ihn nicht hierlassen.«
Und auch er hatte Vertrauen gefasst – und er wurde nicht enttäuscht.
Das Leben wurde wieder lebenswert, auch wenn er nie über den Verlust seines Stolzes hinweggekommen war und vor allem, was ihm fremd war, eine Heidenangst hatte.
Er hätte wissen müssen, dass sein Glück nicht von Dauer sein konnte.
Seine Menschenfreundin hatte ihn verlassen, und seit Tagen war er nun alleine. Rettung gab es keine, die Türen waren verschlossen, das Futter aufgefressen, der langsame Hungertod rückte näher und näher.
Just als er sich damit abgefunden hatte, trat eine junge, rothaarige Frau in sein Heim.
Und sagte seinen Namen.
Das erste Maunzen klang erbärmlich leise.
Das zweite schon lauter.
Dann hatte sie ihn entdeckt.
Zwischen Angst und Hoffnung schwankend, klammerte er sich an ihr fest.
4. Hilfe aus der Nachbarschaft
Das Kätzchen war ganz still geworden, während ich es mit einer Hand streichelte und mit der anderen sein Hinterteil festhielt. Ein wenig ratlos stand ich so in dem Laden, als plötzlich die Tür quietschend aufging.
Mein Findling begann zu zappeln und versuchte, sich aus meinem Griff zu winden. Ich packte fester zu und drehte mich zur Tür um. Ein schlaksiger Junge in ausgebeulten Jeans und einem überdimensionalen Sweatshirt, die Baseballkappe verkehrt herum auf dem Kopf, stand da und grinste mich an.
»Fein. Sie haben den Plunder gefunden!«, stellte er fest.
»Das kann man wohl sagen«, erwiderte ich nüchtern und zuckte ebenfalls zurück, als er näher kam und seine Hand ausstreckte.
»Er hat Angst, wissen Sie, aber mich mag er. Ich habe mich schon gefragt, was mit ihm passiert ist, wo doch die Frau Schneider gestorben ist.«
Es brauchte eine Weile, bis ich endlich begriff.
»Plunder? Das ist der Name dieser Katze?«
»So hat sie ihn genannt. Darf ich?«
Verdutzt nickte ich und ließ es zu, dass der Junge über das verfilzte Fell strich. Das Tier schien ihn wirklich zu kennen, das Zittern ließ endlich nach, und ein ganz, ganz leises Vibrieren durchdrang den mageren Körper.
»Sie müssen ihn bürsten. War er hier im Laden?«
»Ich denke, ja.«
»Er braucht Futter und was zu trinken. Ich heiße Olli. Sind Sie die neue Besitzerin?«
Ein bisschen sprunghaft der Konversationsstil des Jungen, aber er hatte ein nettes Lächeln.
»Zumindest habe ich Haus und Laden von meiner Tante geerbt. Ich heiße Ginger Valenti.«
»Geil!«
»Na ja, Papa stammt aus Italien, Mamma mia aus Irland.«
»Meine Mama ist von hier. Oben gibt’s bestimmt noch Katzenfutter.«
»Gute Idee, dann werde ich mal sehen, ob ich etwas für das arme Wurm finde.«
»Kann ich Ihnen helfen? Ich meine, hier aufräumen oder so?«
Grüne Augen, begeistert über den Krimskrams streifend, sahen mich nun fragend an, und ich las die Botschaft dahinter.
»Willst du dir ein Taschengeld verdienen?«
»Rasenmähen ist jetzt bald nicht mehr, wissen Sie.«
»Ich überleg’s mir, Olli.«
»Fein. Ich wohne nebenan. Mama hat oben aufgeräumt. Ich meine, wenn Sie Fragen haben.«
»Wie heißt deine Mutter?«
»Irmela Dietz. Wir mochten Ihre Tante. Aber jetzt muss ich weg. Meine Mutter will, dass ich pünktlich zum Mittagessen da bin. Kümmern Sie sich gut um Ihren Plunder! Er hat’s nicht leicht gehabt.«
Weg war er.
Plunder klammerte sich noch immer an meine Schulter, und mit einer Hand schloss ich den Vorhang, dann die Ladentür und ging durch das Treppenhaus nach oben.
In den Ferien hatte ich damals bei Tante Juliane gewohnt, sie hatte mir ein eigenes Zimmer eingerichtet. Darin wollte ich auch heute übernachten. Doch mein erster Gang führte mich nun in die Küche. Plunder zappelte und wollte auf den Boden gelassen werden.
Verständlich, denn da stand der leere Futternapf. Er setzte sich davor und hob ein klagendes, krächzendes Geheul an.
Ich hätte beinahe mit eingestimmt, aber nicht, weil ich hungrig war, sondern weil ich jetzt endlich merkte, was dem armen Tier neben einer klangvollen Stimme wirklich fehlte.
Bevor ich das jedoch näher untersuchen konnte, öffnete ich erst einmal die Schranktüren. Schon im zweiten Fach fand ich die Dosen und füllte den Napf reichlich.
Plunder fiel heißhungrig darüber her.
Ich verließ ihn für einen weiteren Rundgang durch die Wohnung. Das Gästezimmer war so geblieben, wie ich es in Erinnerung hatte, Tante Julianes Schlafzimmer aufgeräumt, das Bett abgezogen, alle Spuren von Krankheit und Verfall beseitigt. Irmela Dietz hatte gründliche Arbeit geleistet. Im Wohnzimmer dominierte ein grünes Plüschsofa, das neu dazugekommen war. Ein furchtbar wuchtiges Möbel, das offensichtlich mit Vorliebe von Plunder besetzt worden war, wie die weißen Haare darauf bewiesen. Obwohl zwei Samtkissen einen farbenprächtigen Akzent auf dem Tannengrün bildeten, erschien mir dieses Möbel monströs.
Aber ich wollte ja nur zwei Tage hierbleiben und nicht in die Wohnung einziehen, also brauchte ich mich nicht daran zu stören.
In einem flachen Weidenkorb mit einer ebenfalls dunkelgrünen Decke fand ich eine Bürste und etwas Katzenspielzeug, was mich daran erinnerte, dass ich Plunder das Fell säubern musste. Etwas skeptisch nahm ich die Bürste in die Hand. Nicht alle Katzen, so hatte ich erfahren können, liebten es, wenn ein Mensch ihnen die Schönheitspflege abnehmen wollte.
Der verwahrloste Kater hatte den Napf klinisch rein geputzt und drückte sich jetzt wieder mit dem Hinterteil an den Schrank, als ich in die Küche trat.
»Na, Plunder, kommst du mit?«
Er hatte blaue Augen, wie ich jetzt bemerkte, und in ihnen spiegelten sich Furchtsamkeit und Kummer. Erst nachdem ich eine Weile auf ihn eingeredet hatte, machte er einen vorsichtigen Schritt auf mich zu. Ich nahm ihn wieder hoch und brachte ihn zu dem grünen Sofa. Er ließ es ohne Murren und vor allem ohne mich zu kratzen zu, dass ich sein verfilztes, staubiges Fell ausbürstete. Tatsächlich schlief er darüber sogar ein, und ich konnte mir in Ruhe sein hinteres Ende ansehen. Es war kein Geburtsfehler, nein, es war eine saubere Narbe dort, wo sich sein Schwanz hätte befinden sollen.
Armer Kerl. Wie mochte Tante Juliane an ihn geraten sein? Sie hatte früher Katzen gehabt, meist solche, die einfach bei ihr auftauchten und dann blieben. Streuner, Verirrte, Vergessene.
Auch Plunder gehörte wohl zu dieser Klientel – ein weißer Perserkater ohne Schwanz, das war ein Ausgestoßener.
Wie seidig sein Fell war, jetzt, da es sich glatt und sauber um ihn flauschte. Er hatte auch ein hübsches Gesicht, nicht so eine eingedrückte Schnauzernase wie üblicherweise die Vertreter seiner Rasse aufwiesen, sondern eine normale Stupsnase.
Ich würde mich nach einem guten Zuhause für ihn umsehen müssen.
Aber kaum hatte ich diesen Entschluss gefasst, flüsterte mir mein Unterbewusstsein den Text aus dem Testament zu: Kümmere Dich gut um meinen Plunder!
Jetzt wusste ich, was das zu bedeuten hatte.
Und damit wurde die Angelegenheit schwierig.
Richtig schwierig.
5. Von ungehaltenen Katzen
»O nein!«, heulte die Frau auf und betrachtete das künstlerische Werk der kreativen Gestalterin, die sich zufrieden mit der Ausführung oben im Regal verborgen hielt. Es war eine Lust gewesen, den glatten Sesselbezug in Frottee zu verwandeln. Und es war ebenfalls die reine Freude gewesen, die Blumentöpfe von der Fensterbank zu fegen und das Grünzeug zu zerfetzen. Ach ja, und dann die Gardinen! Es hatte sie zwar eine Kralle gekostet, aber nun hingen sie in gefälligen Fetzen von der Decke.
Rache war definitiv süß.
»Wo bist du Aas! Verdammt, komm heraus!«, tobte die Frau unten.
Sollte sie nur! Sie würde das Versteck nie finden. Aber in der Küche würde sie eine weitere Bescherung entdecken. Hah!
Genau das trat nun ein, und ein weiterer Entsetzensschrei drang an die gespitzten Ohren der Lauscherin.
»Du Mistvieh hast auf den Küchentisch gepinkelt!«
Stimmt, hatte sie. Ein deutlicher Hinweis, dass das Futter nicht ihren Gefallen gefunden hatte. Menschen waren ja so schwer von Begriff.
Na, nicht alle. Ihre erste Frau war so weit in Ordnung. Sie hatte ihr die Achtung entgegengebracht, die einer Katze ersten Ranges gebührte. Dann jedoch hatte sie eine Freundin gebeten, ihr für ein paar Tage Obdach zu gewähren, und die war ihr weit weniger ehrfürchtig begegnet. Tatsächlich hatte sie sogar versucht, sich ihr mit Schmusereien zu nähern. Bah! Das war doch kein Benehmen einer königlichen Hoheit gegenüber. Sie hatte ihr eine Lektion mit der Kralle erteilt. Das brachte die Menschin dann schnell zu der Einsicht, dass eine Katze ihrer Herkunft nicht unaufgefordert angefasst zu werden wünscht.
Jetzt war die dritte Menschenfrau aufgetaucht, um ihr die Dosen aufzumachen, weil die zweite das Heim verlassen hatte. Unbeständigkeit und Wechsel waren etwas, das sie hasste. Und aus diesem Grund hatte sie ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Nun telefonierte die dritte Frau mit der zweiten Frau und stieß hektische Laute aus.
Schön.
Vielleicht lernten sie etwas daraus, beispielsweise, ihr endlich die Tür aufzumachen, damit sie einen Ausflug in die Gärten machen konnte.
Obwohl – wenn man so aus dem Fenster schaute, waren da nicht viele Gärten. Ein paar traurige Geranien auf der Balkonbrüstung, ein verkümmerter Buchsbaum nebenan, ein paar verblühte Rosen, die ihre Blätter auf die Fliesen rieseln ließen, und ein rostiger Grill untendrunter. Die wenigen Ausflüge, die ihr auf den Balkon gestattet worden waren, zeigten eine befahrene Straße, gegenüber hohe Häuserwände und oben nur einen kleinen Schnipsel freien Himmel. Keine Bäume, keine Sträucher, keine Mäuse.
Wie anders war es bei der ersten Frau. Die hatte einen Garten mit einem Komposthaufen, einer dichten, lebhaft bewohnten Hecke, einen Baumstamm, ideal zum Krallenschärfen, und viele andere schöne Dinge, die einer Katze das Leben angenehm machten.
Und dann hatte die erste Frau sie einfach an die zweite Frau abgeschoben. Mit der Ausrede, sie könne sie nicht mitnehmen.
Dann hätte sie eben hierbleiben müssen.
Man konnte doch wohl von einem Menschen erwarten, dass er die richtigen Prioritäten setzt. Was bedeutete schon eine Karriere, wenn man sich Gastgeber einer geborenen Majestät nennen durfte?
Aber Menschen – pffft.
Jetzt hockte sie hier eingesperrt in einer kleinen Wohnung und musste die dritte Frau zu einer einigermaßen funktionierenden Dienerin erziehen. Die Lästigkeiten nahmen kein Ende.
»Ja, ja, natürlich«, hörte sie die Elevin resigniert ins Telefon seufzen. »Ja, ganz bestimmt die Dose Schleckerkatz mit Soße. Und ein Katzenwürstchen.«
Wie von selbst spitzten sich ihre Ohren, und der Geifer sammelte sich in ihrem Maul.
Würstchen! Hatte die Menschin es etwa endlich kapiert? Würstchen!
Mit einem Satz katapultierte sie sich vom Regal, landete auf dem frottierten Sessel und schoss in die Küche.
»Ach, wenn’s Futter gibt, tauchst du wieder auf«, war der ätzende Kommentar der Dosenöffnerin. Dann machte sie sich an dem Napf zu schaffen. »Verdient hast du es meiner Meinung nach nicht, du mieser Rattenpelz. Aber Ginger meint, nur so könnte man dich besänftigen.«
Der Teller mit Huhn in weißer Soße wurde ihr vor die Nase gestellt. Sie erlaubte sich lediglich einen hochmütigen Blick und setzte sich regungslos daneben.
Von Würstchen war die Rede gewesen.
»Das willst du nicht, du verzogenes Biest?«
Eine Antwort darauf erübrigte sich doch, oder?
Die Frau wuselte in dem Vorratsschrank herum und zog eine Packung mit diesen komischen Stangen hervor, riss sie auf, brach ein Stück ab und warf es vor ihr auf den Boden.
Was war das denn für ein Benehmen? Ungeheuerlich!
Normalerweise mochte sie diese Sticks ganz gerne, wenn sie auch mit echten Würsten nicht vergleichbar waren, aber dann bitte höflich mit den Fingerspitzen gereicht und nicht VOR DIE PFOTEN geknallt.
Sie versammelte ihre ganze königliche Energie, ließ sie vom Schwanz über den Rücken bis in den Kopf aufsteigen und dann durch die Augen austreten.
Das dumme Huhn bemerkte noch nicht einmal, dass ihm gerade die Federn abgesengt wurden.
Na gut. Dann noch deutlicher.
Als die Frau an ihr vorbeiging, hob sie einmal schnell die Pfote.
Schrapp – durch die zerfetzte Strumpfhose quoll das Blut.
Der Schrei fiel auch befriedigend aus.
Mit hochaufgerecktem Schwanz schlenderte die rote Königin aus der Küche.
Und in der Stille ihres hohen Verstecks hinter blutigen Krimis und Psychothrillern bedachte sie die Strategien, die sie einsetzen würde, wenn die zweite Frau – jene Ginger – wieder nach Hause kam.
6. Zu viel Plunder
Nach dem Anruf meiner Catsitterin brauchte ich erst einmal etwas Bewegung. Diese hochnäsige, missgünstige und undankbare Katze hatte meine Wohnung offenbar nach allen Regeln der Kunst zerlegt. Warum hatte ich dieses arrogante, selbstgefällige Tier nur übernommen? Es war doch von Anfang an klar, dass wir uns nicht verstehen würden.
Ich ging mit schnellen, wütenden Schritten die Straße entlang.
Hilka war meine Freundin, und als ich vor zwei Jahren aus Italien zurückgekommen war, hatte sie mir beim Einstieg in den neuen Job und das neue Leben ohne Marco aufopferungsvoll geholfen. Natürlich revanchierte ich mich damit, dass ich ihre vornehme Katze versorgte, wenn sie auf Dienstreisen ging. Peluche hatte sie die schlanke Schönheit mit dem roten Samtfell genannt und sprach es auch immer französisch aus. Nie wäre sie auf die Idee gekommen, das edle Geschöpf einfach »Plüsch« zu rufen, obwohl das die korrekte Bedeutung des Namens war.
Nachdem ich mich an die Eigenarten von Majestät gewöhnt hatte – kein unaufgefordertes Streicheln, nur Futter der höchsten Preisklassen, Leckerchen immer von gepflegten Fingerspitzen gereicht und so weiter –, kam ich mit ihr, so dachte ich zumindest bisher, einigermaßen friedlich aus. Darum tat ich Hilka auch den Gefallen, Peluche ganz zu mir zu nehmen, als sie ihren Job bei einem amerikanischen Fernsehsender antrat. Seit einem halben Jahr lebten die Katze und ich zusammen, und bis auf einige kleinere Versuche, gewisse Dinge auf meinen Bücherborden umzudekorieren, war es bislang zu keinen größeren Ausschreitungen gekommen.
Vor meinen Augen entstand eine Horrorszene dessen, was passieren könnte, wenn ich den armen, verschüchterten Plunder mit nach Hause bringen würde.
Tief in unerquickliche Gedanken versunken war ich einmal um den Block gegangen und erstand dann eine Tüte mit – passenderweise – Plunderteilchen beim Bäcker, die ich zu einer Tasse Kaffee verspeisen wollte. Zucker beruhigt aufgewühlte Nerven. Als ich wieder an dem Laden angekommen war, trat Olli mit einem Skateboard unter dem Arm aus dem Nachbarhaus.
Eine Idee funkelte in mir auf.
»Hallo, Olli!«
»Ja, Frau Valentino?«
»Valenti, aber lassen wir es bei Ginger. Ich muss dir eine Frage stellen. Hast du einen Moment Zeit?«
»Klar.«
»Bei Milchkaffee und Teilchen.«
»Au ja. Gerne.«
Plunder öffnete schreckhaft die Augen, als wir eintraten, beruhigte sich aber sofort, als Olli sich neben ihn setzte und ihn kraulte.
»Haben Sie super hingekriegt. Jetzt sieht er wieder wie früher aus.«
»Der Kater war nur staubig und hungrig. Weißt du, wie meine Tante zu ihm gekommen ist?«
»Mhm. Aus dem Tierheim. Ich wollte für uns einen Mauser, und da ist sie mit mir hingefahren. Ich habe Marzan gefunden, und sie hat den Wuschel hier mitgenommen. Er tat ihr leid.«
»Ja, das kann ich mir vorstellen. Was ist mit deinem Mauser?«
»Der war klasse, aber … Ist im Sommer unter ein Auto gekommen.«
Tiefe Trauer zeichnete sich in seinem Gesicht ab, und obwohl er mir leidtat, regte sich die Hoffnung nur noch mehr.
»Olli, ich habe schon eine Katze, eine ziemlich anspruchsvolle Dame. Ich fürchte, wenn ich Plunder mit ihr zusammenbringe, wird das für ihn kein Spaß werden. Und da habe ich mir überlegt …«
»Ob ich ihn nehme? Könnte ich machen. Obwohl er ja kein Mauser ist. Glaube ich wenigstens nicht. Er ist nie rausgegangen, wissen Sie.«
Ich teilte in dieser Hinsicht Ollis Zweifel. Vermutlich würde der arme Plunder vor einer Maus weglaufen, wenn sie ihn nur aus ihrem Loch angrinste.
»Und drinbleiben kann er bei euch nicht, nehme ich an.«
»Ist ein bisschen schwierig, aber ich frage meine Mutter mal. Es ist wegen ihrer Arbeiten. Sie macht nämlich diese Kissen und so’n Zeug.«
Er wies auf die bunten, kunstvoll mit Perlen und Spitzen bestickten Samtkissen. Ich verstand, eine Werkstatt voll mit Perlen, Stoffen, Borten, Garnrollen – und dazwischen eine gelangweilte Katze … Hübsches Szenario!
»Was wollen Sie denn mit dem Laden machen?«, holte mich Olli aus meinen Gedanken zurück in die Gegenwart.
»Ich weiß noch nicht. Ich werde ihn wohl auflösen und das Haus verkaufen müssen. Das wird ein Haufen Arbeit. Tante Juliane hat da unten eine Menge Zeug angesammelt, und ich habe so wenig Ahnung davon, was wertvoll ist und was wirklich nur Plunder ist.«
»Mein Bruder jobbt manchmal bei einem Entrümpler. Sie wissen schon, Haushaltsauflösungen und so. Der weiß inzwischen ganz gut, was die Sachen so wert sind.«
»Du meinst, er würde auch hier entrümpeln?«
»Bestimmt, aber Frau Schneider hat früher immer aufgeschrieben, wenn sie was von ihm bekommen hat. Ich glaube, sie hat irgendwo einen Ordner.«
Natürlich! Wie vergesslich ich war! Meine Patentante hatte selbstverständlich Inventarlisten geführt, oder besser, es gab da einen Kasten, in dem sie für jedes Stück eine Karteikarte angelegt hatte – heute würde man eine Datei erstellen, aber wie gesagt, moderne Technik hatte bei ihr keinen Einzug gehalten.