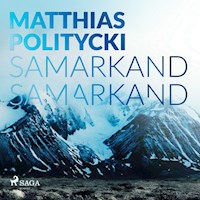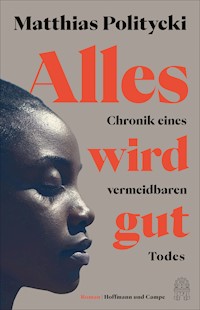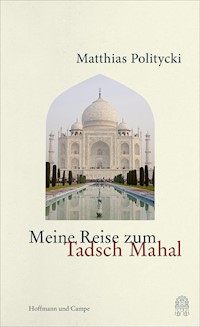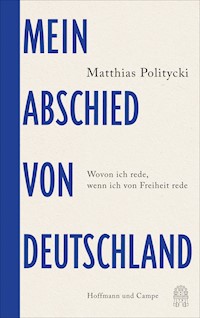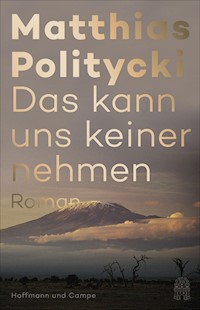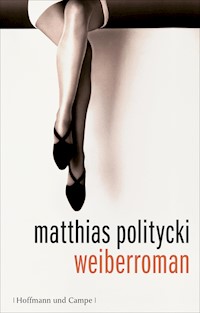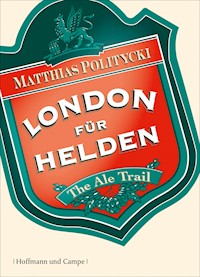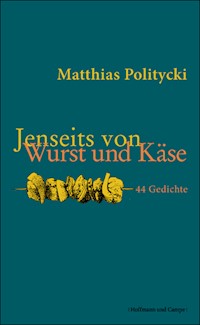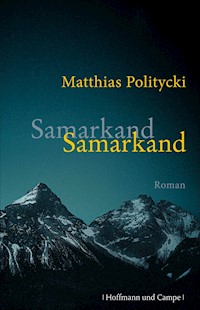9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der Schriftsteller als Marathonläufer - in 42,195 Kapiteln. Was ist das, was uns seit Jahren an- und umtreibt, das uns regelmäßig hinaustreibt aus der Geborgenheit unserer Behausungen. Was geht in uns vor, wenn wir laufen, was denken wir dabei und danach und darüber? Und was sagt das womöglich über uns aus und die Gesellschaft, in der wir leben? Matthias Politycki betrachtet einen Sport, der viel mehr ist als eine Freizeitbeschäftigung. In einer globalisierten Welt ist das Laufen zum Minimalkonsens der neuen Weltgemeinschaft geworden. Für ihn selbst ist sein Leben und Schreiben ohne Laufen längst nicht mehr denkbar. In 42,195 Kapiteln denkt Politycki über das Laufen nach und erzählt aus dem eigenen Laufleben, welches mit seiner Schriftstellerexistenz verknüpft ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Matthias Politycki
42,195
Warum wir Marathon laufen und was wir dabei denken
Hoffmann und Campe
Starterbereich
Seit über vierzig Jahren laufe ich. Zunächst nur um den Häuserblock herum und in meinen Adidas Rom, mit denen ich auch zur Schule ging, auf den Bolzplatz oder eine Party. Irgendwann auf Wald- oder Feldwegen und mit speziell gedämpften Laufschuhen, Nike Air, die damals noch längst nicht von der HipHop-Szene entdeckt waren. Seit einigen wenigen Jahren schließlich auf amtlich vermessenen Marathonstrecken1 und in, nunja, mal diesem, mal jenem Schuh, mittlerweile besitze ich so ziemlich für jeden Anlaß das passende Paar. Obwohl ich das früher nicht mal im Traum für möglich, ja, geradezu für abwegig gehalten hätte.
Seit über vierzig Jahren schreibe ich. Zunächst nur Gedichte auf irgendwelchen herausgerissenen Seiten meiner Schulhefte. Irgendwann … Und schließlich … Erst im Rückblick fällt mir auf, daß ich beides gleichzeitig angefangen habe, das Laufen und das Schreiben. Wobei ich die ersten Jahrzehnte nur nebenbei lief, Fußball war wichtiger, Skifahren, Squash oder Tauchen. Dennoch lief ich. Mal mehr, mal weniger, ohne Ambitionen. Die kamen erst mit Mitte fünfzig – wahrscheinlich weil ich mit all meinen Lieblingssportarten »durch« war und in einem Alter, in dem man es noch mal neu und anders wissen will. Wie intensiv ich aber auch lief, die Nichtläufer stellten mir Fragen: Warum ich das denn tue? Was mir das am Ende bringe? Ob es nicht furchtbar langweilig sei? Und obendrein ungesund?2 Von den frühen Siebzigern, wo ich mit mir und meiner Leidenschaft alleine war, bis heute, wo das Laufen zum globalen Breitensport geworden ist, die Fragen blieben im Prinzip die gleichen. Und kamen so regelmäßig, daß ich sie mir über die Jahre auch immer wieder selber stellte, in letzter Zeit dann auch meinen Laufkumpeln. Bei einem unsrer langen Läufe im Frühjahr 2013, wir trainierten für den London-Marathon, entstand die Idee zu diesem Buch.
Nein, eine weitere Lauffibel wollte ich nicht schreiben; dazu fehlen mir dann doch einige zehntausend Kilometer an Erfahrung, und statt Pokalen und Legenden habe ich nur Teilnehmermedaillen und Anekdoten gesammelt. Ich bin nicht mal einer dieser Aficionados wie Günter Herburger oder Haruki Murakami, beide Ultramarathonis und entsprechend drauf, wie man in ihren Büchern nachlesen kann. Nein, ich lebe nicht fürs Laufen. Aber ohne Laufen wäre mein Leben nicht mein Leben, das schon.
Gerade als »ambitionierter Freizeitläufer«, wie man mich und meinesgleichen in der Fachliteratur nennt, bin ich wahrscheinlich kein ganz untypischer Vertreter unsrer Zeit, in der Laufen fast so etwas wie den Minimalkonsens einer neuen Weltgemeinschaft gestiftet hat. Wo auch immer ich gerade bin, sobald ich aus der Haustür trete, kommen mir Läufer entgegen. Wo auch immer ich Leute treffe, kommen sie irgendwann aufs Laufen zu sprechen. Jeder dritte ist bereits infiziert, der Rest fragt sich, ob das alles nur ein besonders erfolgreicher Hype ist oder ob er nicht vielleicht doch etwas verpaßt. Etwas Entscheidendes womöglich.
Ja, was ist »das alles« denn, so frage auch ich mich, das uns seit einigen Jahren so an- und um- und bei jedem Wetter hinaustreibt aus der Geborgenheit unsrer Behausungen? Was geht in uns vor, wenn wir laufen, was denken wir dabei und danach und darüber, wie gehen wir mit unsern Schmerzen um, mit unsern Hoffnungen? Was kommt zur Sprache, wenn wir unter uns sind? Was treibt uns an und läßt uns nicht mehr los, was lieben oder hassen wir am Laufen, und was erzählt das über uns selbst?
Wir, das sind zunächst einmal all jene, mit denen ich während der letzten Jahre lief und weiterhin laufe. Auch durch dies Buch laufen sie mit, zumindest als Figuren gleichen Namens. Indem sie mit ihren Ansichten gegenhalten oder beipflichten, stehen sie freilich für etwas, das über das begrenzte »Wir« einer konkreten Läufergruppe hinausweist: Mögen die Meinungen in andern Läufergruppen anders verteilt und gewichtet sein, der Austausch darüber wird ähnlich unverblümt und ehrlich ablaufen – das abzubilden war mir wichtig. Laufen ist gut und schön; mit Freunden laufen ist besser und schöner. Insofern liegt im Untertitel des Buches ein Bekenntnis, das niemanden vereinnahmen will, jedoch all jene gern mit einschließt, die sich vom Wir-Gefühl der virtuellen Läufergemeinschaft angesprochen fühlen.
Wir, das ist in meinem konkreten Fall ein ziemlich heterogener Haufen, vom Werbedesigner bis zum Handelsvertreter, vom Bauleiter bis zum … ach, das ist doch eigentlich egal. Sobald wir unsre Laufschuhe schnüren, zählen ganz andre Kriterien. Wir, das ist dann ein ziemlich heterogener Haufen mit ziemlich krassen Thesen. Manche sprechen mir aus dem Herzen. Manche regen mich auf. Doch selbst dort, wo ich andrer Meinung bin, zeigen sie, wie offen kontrovers unter Läufern diskutiert wird. Weswegen sie unbedingt in dies Buch hineingehören.
Bei einem unsrer Trainingsläufe für London stand ein paar Kilometer lang sogar die These im Raum: Wer sich mit dem Laufen beschäftige, nämlich all dem, was man als Randparameter dieses Sports bezeichnen könne, der beschäftige sich unweigerlich mit der Verfaßtheit des Menschen schlechthin, des Menschen in der postmodernen Eventgesellschaft. Man müsse vielleicht nur mal ein Protokoll dessen anfertigen, was uns während eines solchen 30 km-Laufs, besser noch: während eines Marathons so alles durch den Kopf gehe, schon hätte man womöglich … Wahrscheinlich liefen wir an der anaeroben Schwelle und wollten uns mit derlei Thesen zum Durchhalten animieren.
Was nun gedruckt vorliegt, ist bestimmt kein Buch für ambitionierte Läufer, die wissen wollen, wie sie noch schneller werden. Derlei gibt es, und auch ich, als Läufer, war eine Zeitlang scharf darauf. Als Schriftsteller interessiert mich etwas andres: eine Phänomenologie des Laufens, wie man es früher vielleicht genannt hätte. Ein Buch auch für all jene, denen schon beim Lesen der Schweiß ausbricht. Die kopfschüttelnd an der Strecke stehen, wenn wieder mal die Innenstadt eines Marathons wegen gesperrt ist. Die uns anfeuern, obwohl sie’s gar nicht begreifen können, wie man sich 42,195 km freiwillig antun kann.
In erster Linie geschrieben habe ich freilich für diejenigen unter uns Läufern, die sich nicht nur mit Trainingsplänen, Nahrungsmittelzusätzen und der neuesten Generation an Wettkampfschuhen beschäftigen, sondern auch damit, was hinter all dem Laufzirkus, dem Laufzauber und -zinnober stehen mag als unser Antrieb und unsre Sehnsucht. Die sich mit mir fragen, worauf wir eigentlich zulaufen, jenseits aller Ziellinien. Geschrieben habe ich auch für alle, die uns als Ehepartner oder Freunde auf unsern Wegen begleiten, ohne selbst mitzulaufen, auf daß sie (noch) besser verstehen mögen, warum wir nicht lassen können, was wir tun. Nicht geschrieben habe ich für all jene, die bei einem Rennen in der ersten Welle starten; sie laufen und leben in einer andern Welt, die ich mit PB31:40 und 3:524 gar nicht beurteilen kann.
MP, 30/12/14
Start
Dem Tod davonrennen
Monatelang hast du darauf hingelebt, nun ist es soweit. Wenn der Startschuß fällt, beginnt das Rennen deines Lebens. Jedes Rennen ist das Rennen deines Lebens, auch wenn du zuvor überall herumposaunt hast, du gingest es diesmal locker an. Aber du bist Läufer, umgeben von Läufern, und jeder von euch will’s heute wissen. Du auch, du kannst gar nicht anders. Hast dein Lauftempo auf die Sekunde genau vorher ausgerechnet, hast dir die Zwischenzeiten auf den Unterarm geschrieben, hast einen Plan. Doch dann passiert jedes Mal dasselbe, laufen die andern viel zu schnell los. Du hast dir vorgenommen, sie diesmal einfach nicht zu beachten, stur dein Tempo zu halten. Aber schon bist du selbst einer der andern und Teil des Problems – wer hätte je eine Stampede aufgehalten? Wenn du nicht mitziehst, treten sie dir die Hacken ab. Dreißig Kilometer später werden sie es büßen, aber das wissen sie jetzt nicht. Keiner weiß in diesen ersten Minuten wirklich was außer … daß er dabei ist, mittendrin im prallen, schnellen, wilden Leben.
Wer heute stehen bleibt, setzt sich morgen hin und sieht den fallenden Blättern zu, ist übermorgen tot. Du nicht. Solange du rennst, kannst du nicht sterben. Du kannst nicht einmal daran denken, der Tod ist schlechterdings undenkbar geworden. Wo andre fallende Blätter sehen, siehst du an einem Tag wie diesem nur Sonnenstrahlen, wie sie mit Macht durchs Geäst fahren. Ist es nicht großartig? Der Start, das Rennen, das Leben? Und hat es nicht gerade erst angefangen? Zigtausend Läufer können nicht irren, und wenn die Sonne tatsächlich mitspielt, sind diese ersten Minuten des Rennens so voller Energie, als wäre man gerade eben erst ein ganzer Kerl geworden und forever young.
Der Tod ist das große Skandalon des Lebens; seitdem ich schreibe, schreibe ich dagegen an. Und bin es oft genug selber, der sitzt und den fallenden Blättern zusieht. Habe ich Glück, packt mich die Wehmut darüber irgendwann so stark, daß ich’s gar nicht anders aushalte – und losschreibe. Es ist wie ein Startschuß, mit einem Mal löst sich all das, was sich in mir aufgestaut hat, und will so schnell wie möglich heraus, drängt mich beim Schreiben regelrecht voran. Das Tempo, in dem ich dabei loslege, ist hoch; ich büße es später, indem ich lange korrigieren muß, nicht selten jahrelang. Aber ohne diese ersten eruptiven Notationen hätte sich der Knoten gar nicht erst gelöst, wäre der Text überhaupt nicht entstanden. Dann wäre ich mit zugeschnürter Kehle sitzen geblieben. Im Leben eines Läufers fallen vergleichsweise wenig Startschüsse; im Leben eines Schriftstellers bleibt das meiste ungeschrieben. Dann gilt es, sich mit seiner Zuschauerrolle abzufinden und dem Leben zumindest auf stille Weise zuzujubeln.
Am schönsten ist der Start womöglich beim Berlin-Marathon, der ansonsten reich an Enttäuschungen ist. 40000 Läufer auf der Straße des 17. Juni, im Rücken das Brandenburger Tor und vor ihnen die golden schimmernde Siegessäule, das allererste Ziel, die allererste Belohnung. Schon vor dem Start ein Anblick, der in Worten nicht zu fassen ist. Dazu erstaunlich gute Rockmusik.5 Das gemeinsame Herunterzählen der letzten zehn Sekunden, die Weltgemeinschaft der Läufer beim Gebet. Dann der erste von drei Startschüssen, darüber plötzlich ein Geschwader an roten und weißen Luftballons. Oder war das in –? Egal, der Moment ist heilig, ob mit, ob ohne Luftballons. Und schon hörst du den Sound von 80000 Schuhen auf dem Asphalt, Weltmusik, die mit ihrem gnadenlosen Rhythmus noch den härtesten Rocksong übertönt. Aber ja, jetzt geht es ums Ganze. Du kannst es hören.
Vielleicht sind früher, sehr viel früher Armeen so zum Angriff übergegangen. Nun ist es die Weltgemeinde der Läufer, offensiv friedlich, und auch wenn sie sich schon nach wenigen hundert Metern wieder in lauter Individuen aufgelöst haben wird, die alle ihren eignen Kampf führen, so ist sie doch in diesen kostbaren Sekunden vereint. Berauschend großartiges Gefühl. Vorwiegend teilst du es mit deinesgleichen, sprich mehr oder weniger älteren Herrschaften. Als ob es einige Jahre, Jahrzehnte dauert, bis man sich an die Marathondistanz herangelaufen hat. Aber was heißt das schon, »älter«, und in welchem Alter beginnt das Ältersein genau? In der Sekunde des Startschusses seid ihr, ob 35, ob 65, alle gleich jung und unsterblich. Hartgesottne Marathonis6 erzählen nicht selten, daß sie mit Überschreiten der Altersgrenze von, sagen wir: M55 zu M607 eine bessere Plazierung erhofft hätten, sofern sie ihr Tempo würden halten können. Das Tempo hätten sie zwar gehalten, nur: Die Läufer über 60 seien noch ehrgeiziger als die unter 60, die Konkurrenz sei in der neuen Altersgruppe viel größer als in der früheren, man sei in der Plazierung sogar abgerutscht.
Und nun denk noch mal kurz an all die Wochenkilometer zurück, die du für diesen Tag der Tage heruntergelaufen hast. Stell dir deinen Kumpel Jörg vor und wie er das Phänomen während eurer Trainingsläufe gern auf den Punkt gebracht hat. Nämlich wenn du einen besonders guten Tag erwischt und das vereinbarte Lauftempo vergessen hast: »Der ist heut wieder nicht zu halten!« hat sich dann stets wer beschwert, denn nichts ist einer Laufgruppe so heilig wie das vereinbarte und über die gesamte Distanz einzuhaltende Tempo. Genau genommen war’s nicht irgendwer, der sich da beschwerte, sondern immer wieder und ausschließlich Seb, nicht wahr? Und er sagte auch nicht, daß du heut wieder nicht zu halten seist, sondern: »Mann, der geht heut wieder ab wie ein Zäpfchen!« »Laß ihn!« beschwichtigte Jörg dann jedes Mal scheinheilig: »Der ist ein paar Jahre älter als du, dem läuft die Zeit davon.« Heute freilich ist nicht Training, heute ist Wettkampf. Und da bist du es, der der Zeit davonläuft.
Km 1
Alles richtig gemacht? Alles richtig gemacht.
Die Einsamkeit des Langstreckenläufers beginnt schon auf dem ersten Kilometer, mitten im Pulk der Mitläufer. Kannichalleshabichalles? Als Erstkläßler war’s verhältnismäßig einfach, beherzt in den Tag aufzubrechen, stets gab es jemanden, der Sorgen und Selbstzweifel mit festem Ja davonfegte. Diese Instanz fehlt euch nun, der Trainer ist Chef, nicht Mutter, und außerdem ist er sonstwo, bei seinem eignen Rennen oder, schlimmer noch, online, um euren Lauf anhand der live abrufbaren Zwischenzeiten zu verfolgen. Im Gleichklang der Schritte neben dir Onkel, aber den kannst du jetzt nicht mehr fragen. Hoffentlich lauft ihr nicht zu schnell und nachher zu langsam, JP ist ein strenger Trainer, das würde er tadeln. Dermaßen viele Fehler, die man machen kann. Was andre empfohlen haben, kann einen selber vollkommen aus der Bahn werfen: Schuhe mit zu niedriger Sprengung,8 Koffein-Gel, Trinkgürtel beim Rennen … Dermaßen viele Fehler, die ihr schon gemacht habt! Hoffentlich ausreichend viele, heute wollt ihr keine neue Erkenntnis gewinnen, sondern eine neue Medaille. Durchpusten und Puls runter, so kurz nach dem Start könnt ihr noch gar nichts falsch gemacht haben. Und davor erst recht nicht, das war ja alles hundertmal durch- und abgesprochen: Drei Monate vor dem Rennen habt ihr mit dem Training begonnen. JPs Trainingspläne sind … eine permanente Herausforderung, und ihr habt kein einziges Mal gekniffen, nicht mal während der 80 km-Wochen. Habt eure langen Läufe am Wochenende länger und länger gemacht, die Tempoeinheiten dazwischen härter. Naja, so hart es eben ging, mittelhart vielleicht. Aber Alkohol habt ihr wirklich keinen getrunken – abgesehen von den unumgänglichen Anlässen. Verdammt, hör auf zu denken, laß es laufen! Aber ja doch, abgesehen von der einen oder andern Völlerei habt ihr euch vollkommen gesund ernährt, absurd gesund! Sogar Eiweißpulver habt ihr morgens ins Müsli gerührt, als wolltet ihr nebenbei auch noch Bodybuilder werden, und abends Walnüsse geknabbert oder Bitterschokolade mit mindestens 70 % Kakaoanteil. Drei Monate lang laufen, laufen, nichts als laufen. Nachdenken übers Laufen an sich, Diskutieren des letzten Laufs, Vorbereiten des nächsten. Dazwischen schwimmen, dehnen, Hanteln heben. Zielvorgaben ausgeben und widerrufen. Ab heute ist Schluß damit, heute werdet ihr endlich wieder richtiges Bier trinken! Und zwar mit umgehängter Medaille. Nur deshalb seid ihr hier unterwegs, und alles läuft nach Plan. Hoffentlich. Ihr habt euch die letzten Tage geschont, bis euch jeder Muskel weh tat,9 seid rechtzeitig angereist und auch brav im Hotel geblieben – naja, bis auf den kleinen Ausflug eben. Gestern abend habt ihr euch jeder einen halben Liter Energiedrink angerührt,10 habt die Herzfrequenzanzeige der Uhr abgestellt, damit ihr heut ohne Brustgurt laufen könnt.11 Seid früh zu Bett gegangen und noch früher wieder aufgestanden, damit ihr drei Stunden vor dem Start gefrühstückt hattet. Ja, das kleine Läufer-Einmaleins beherrscht ihr mittlerweile – jeder von euch und am besten beide zusammen. Nein, Onkel hat auch kein Auge zubekommen, ist normal, ein gutes Zeichen. Wäre Onkel so drauf wie Seb, hätte er sogar die Kaffeemaschine von zu Hause mitgenommen, damit ihr den gewohnten Espresso trinken könnt, bloß keine Experimente mit Hotelkaffee, mit Hotelsemmeln, Hotelobst. Seb übertreibt vielleicht ein bißchen; aufs Hotelfrühstück habt aber auch ihr lieber verzichtet, ein Starter12 von Dr. Feil genügt. Oder wäre eine doppelte Portion Starter doppelt so gut gewesen? Eine Banane dazu? Ein Energieriegel? In jedem Fall richtig: die nächste Flasche Energiedrink. Eine halbe Stunde später habt ihr euch gezwungen, nur noch in kleinen Schlucken zu trinken, damit ihr während des Rennens nicht irgendwo wild urinieren müßt. Alles schon vorgekommen, kostet Zeit und Nerven, typischer Anfängerfehler. Auf dem Weg zum Start habt ihr euch sogar fast zehn Minuten warmtraben können. Bei der Anmeldung hattet ihr eine verdammt gute Zielzeit angegeben, und prompt seid ihr im richtigen Startblock gelandet. Großartig! Wenn man im richtigen Startblock startet, ist das ganze Rennen viel einfacher. Wie im Leben, sagt Seb. Der hat gut reden, sitzt zu Hause und wartet darauf, daß die Ergebnislisten ins Netz gestellt werden. Soll er! Ihr seid im richtigen Startblock gestartet, alle laufen exakt euer Tempo. Vielleicht einen Tick zu schnell, egal. Immerhin seid ihr beide mit Idealgewicht an den Start gegangen – ihr habt euch vor der Kleiderbeutelabgabe jeder ein Dixi-Klo angesehen und danach jeder noch eines, perfektes Timing. Irgendein Hubert aus der 7:00er-Gruppe13 hatte irgendwann angefangen, sich vor den langen Läufen auf die Waage zu stellen und euch mit seinen Ergebnissen zu behelligen: Ergebnissen nach dem ersten Klogang und nach dem zweiten, der Unterschied habe bis zu 800 Gramm betragen. »Und jetzt stellt euch mal vor«, so der 7:00er-Hubert, »die würdet ihr ’n paar Stunden mit euch rumtragen!«14 Andre finden das peinlich. Läufer finden es bedenkenswert. Wenn Hersteller damit werben, daß ihre Wettkampfschuhe 100 g leichter sind als herkömmliche Laufschuhe, dann sind 800 g leichter … sogar sehr bedenkenswert. Der Russe in der Warteschlange vor den Toiletten hat euch ungebeten auch noch ein Stück seiner Lebensweisheit mit auf den Weg gegeben: Alle, die man hier sähe, täten nur so cool und locker. Unten, in den Dixi-Klos, liege die Wahrheit! Nun gut, du warst auch einer von Zigtausend Schissern. Aber nun bist du tatsächlich cool und locker unterwegs, fall endlich in deinen Rhythmus! Eine Viertelstunde vor dem Startschuß hast du dein erstes Gel genommen und vier weitere dabei, sogar einen Gel-Chip, falls du am Ende noch was extra brauchen solltest. Ihr werdet euer Tempo drosseln, sobald euch der Pulk freigegeben hat, ihr werdet jede zweite Verpflegungsstation anlaufen, aber nur am Becher nippen, niemals austrinken, wieder so ein Anfängerfehler, ab und zu stirbt einer dran, sagt JP, am Zuviel-getrunken-Haben, muß man sich mal vorstellen. Ihr werdet euch das restliche Wasser höchstens übern Kopf kippen. Werdet an den Verpflegungsstationen keine Banane nehmen und erst recht kein Cola, wie’s Seb beim Hamburg-Marathon gemacht hat, legendärer Fauxpas bei Km 37 oder 38, angeblich sorge Cola dann für den letzten Kick. Wenige hundert Meter später war er im erstbesten Klo-Häuschen an der Strecke verschwunden. Das wird ihm nie mehr passieren und euch auch nicht. Konzentriert euch endlich, reißt die Augen auf, schaut genau hin, genießt es. Später werdet ihr nichts mehr genießen können, da genießen es nur noch eure Uhren – auf daß ihr euch den Rest der Strecke wenigstens nachträglich auf dem Bildschirm ansehen könnt.15 Und jetzt, jetzt grinst dich Onkel auch noch von der Seite an, zeigt auf das erste Kilometerschild am Streckenrand, und da spürst du’s endlich: Ja, ihr habt alles richtig gemacht, ihr werdet alles richtig machen, ihr könnt alles und ihr habt alles. Nur noch laufen müßt ihr, immer geradeaus.
Km 2
Geradeaus denken
Die Gerade ist die Idee der Laufstrecke schlechthin, die Bewegungsabfolge des Läufers dann in ihrer Schlichtheit reinstes Zen. Läuft man lang genug geradeaus, wird man selber gerade. Natürlich nur metaphorisch gesprochen, aber was heißt hier »nur«? Alles reduziert sich, wird wesentlich. Und plötzlich ganz einfach – das hier ist der Weg, das dort das Ziel. Mehr braucht es nicht, um wieder einen unverwirrten Menschen aus mir zu machen. Schluß mit den komplizierten Gedanken, den komplexen Lösungen. Das Gute ist nicht gut, weil es interessant, sondern weil es einfach gut ist.
Als Schriftsteller gefällt man sich oft in einer Haltung, die das Einfache zu übertrumpfen sucht. Man denkt um mehrere Ecken gleichzeitig, jongliert mit Nebeneinfällen, wiegelt am Ende vorsichtig ab. Dabei ist es viel schwieriger, wesentlich zu werden. Heißt: einen Gedanken auf die einfachstmögliche Weise zu Ende zu denken. Und entsprechend zu Papier zu bringen. So sehe ich es jedenfalls heute, nachdem ich es, zugegeben, eine geraume Zeitlang anders gesehen habe. Aber erst heute bzw. seit einigen Jahren weiß ich, daß »einfaches« Erzählen wesentlich schwieriger ist als experimentelles. Klar, auf einer Gedankenkurve könnte man brillieren. Eine Ellipse zu schreiben brächte mehr Bewunderung ein. Und erst ein schön geschwungener Achter! Es hilft nichts, die Wahrheit liegt auf der Geraden.
Vor Anbruch der Moderne – also in etwa bis zur Renaissance – studierten bildende Künstler ihr Leben lang das Gute, wie sie es bei Vorgängern und Zeitgenossen fanden. Sie wollten nicht originell sein, sie wollten ihren bescheidnen Platz in der Abfolge des Guten finden. Jeder, der sich in der Tradition dieser (als unendlich gedachten) Geraden bewegte, verlängerte die Strecke um einen, um seinen Millimeter. Damit war er zufrieden, darauf war er stolz. Alles, was von der Geraden wegführte, galt als Abweichung, die letztendlich in der Sackgasse münden würde. Heute weiß niemand mehr so recht, wo die Gerade eigentlich ist, ja, ob es überhaupt noch eine gibt. Wo man in der Moderne irgendwann vor lauter Originalität und Komplexität vielleicht nur noch Sackgassen gesehen hat, sieht man in der Postmoderne erst mal nur noch Mainstream. Und ebensowenig von der Geraden.
Wer lange Läufe macht, will weder originell sein noch gar sich originell geben. Er glaubt an die Strecke, und er will sie in der bestmöglichen Zeit absolvieren, er will am Ende »gut« gewesen sein, was immer das für ihn bedeutet. Nichts darf in einer Sackgasse münden. Rennt er mit andern, will er sie nicht mit Gejammer vom Guten abbringen, und zurückfallen will er erst recht nicht. Marathon ist eine ganz einfache Disziplin, deshalb ist sie so schwer. Schon das Training dafür. Klar, an die zahllosen Geraden, die wir in all den Jahren gerannt sind, werden wir uns kaum erinnern – außer an die wirklich langen wie die 4th Avenue in Brooklyn oder die 1st Avenue in Manhattan, die man beim New-York-Marathon jeweils eine halbe Ewigkeit lang zu absolvieren hat. Oder an die existentiellen Geraden auf Fünen, die alle in die Unendlichkeit zu führen scheinen, jedoch auf völlig unromantische Weise: Kein einziges Hindernis im Weg, und trotzdem kommt man dem Horizont mit keinem Schritt näher, eine echte Herausforderung, nicht nur für die Beine.
Auf der Geraden wartet nicht das Wunder, sondern dessen Gegenteil, die permanente Wiederholung – und damit die Sache selbst. Laufen wird zu einer Art kathartischem Läuterungsprozeß, wir werden zurechtgeruckelt durch Tausende an Schrittimpulsen, um einige krautige Gedanken erleichtert und nicht selten um diese oder jene neue Erkenntnis bereichert. Sobald man sich nicht mehr auf den Parcours konzentrieren muß, geht der Lauf konsequent nach innen. Alles Überflüssige bleibt auf der Strecke – man kehrt stets als ein andrer zurück.
Im Lauf der Jahre wird man ein andrer. Dann ist jede der Geraden, an die wir uns nie erinnern werden, Teil von uns selber geworden. Und mit allen andern Geraden zusammengewachsen zu unserm Charakter. Natürlich nur metaphorisch gesprochen, aber was heißt hier »nur«? Versteht sich, daß auf der Hausstrecke auch Kurven als Gerade gelten, hier laufen wir im Zweifelsfall blind, wir kennen jeden Baum und jeden Himmel darüber – die Welt, durch die wir laufen, braucht uns gerade nicht und wir brauchen sie ebensowenig. Schon nach wenigen Schritten sind wir ganz bei uns oder kommen uns zumindest entgegen. Von da an laufen wir immer nach Hause.16
Beim Marathon selbst gelten andre Gesetze. Da muß man den Kopf so schnell wie möglich leerlaufen, um zur Maschine zu werden, zum Laufwerk. Das gelingt beileibe nicht an jedem Tag. Aber wenn es gelingt, wird es ein grosses Rennen. Eines, das ganz aus Rhythmus besteht und eine Art hellwache Trance erzeugt, wie in den besten Momenten beim Schreiben. Da ist es in beiden Fällen nicht mehr »ich«, der vorankommt, sondern »es«.
Bei Km 2 ist es freilich noch längst nicht soweit. Jetzt ist erst mal Showtime, das große Wir feiert sich selbst. Falls es den magischen Augenblick während eines Marathons gibt, da wir, jeder für sich, in den Anderen Zustand hinüberlaufen, dann 10 oder 15 Kilometer später, frühestens. Aber genau dafür laufen wir schon jetzt.
Km 3
Himmelpforten
Das große Wir feiert sich selbst: All die Anspannung, die sich vor dem Start angestaut hat, sie entlädt sich in Geplapper, Gelächter, waghalsigen Überholmanövern. Die Musik spielt dazu. Man könnte glauben, auf einem Volksfest zu sein.
Kaum je setzt die Werbung der Veranstalter auf den sportlichen Charakter eines Marathons, stattdessen auf seinen Unterhaltungswert – zig Bands an der Strecke, das Fernsehen live dabei, Hunderttausende an Zuschauern. Toben und kreischen diese dann auch nur annähernd so wie die in London, werden 42,195 km durchgehend zur Bühne, und jeder, der sich darauf präsentiert, darf sich als jemand fühlen, dem die Massen zujubeln. Das muß man erlebt haben.
Muß man’s? Marathonläufer, die öfter an solchen Großereignissen teilgenommen haben, sehen den Event-Charakter eines Laufs nicht selten kritisch. Von den angekündigten 80 Bands an der Strecke hat Seb gerade mal 30 gezählt, und er habe auch all die Flöte übenden Mädchen und einen Hausfrauenchor mitgezählt. Onkel: Und dann der ganze Rummel um die Eliteläufer. Wenn man da an Himmelpforten denke …
Himmelpforten ist unser Zauberwort, mit dem jede Debatte beendet werden kann. Der Halbmarathon dort war das Gegenteil eines Events. Er war ein Ereignis. Himmelpforten ist ein Kaff jenseits der Elbe, etwa 60 km von Hamburg entfernt, und wenn der Winter lang und kalt ist und die Temperaturen auch am Wettkampftag unter Null liegen, kann man während der Anreise trefflich streiten, ob man überhaupt antreten soll. Wir traten an, und mit uns taten’s 35 weitere Männer und sieben Frauen. Der örtliche Sportverein hatte geladen, und wir wollten das Ganze als Testlauf angehen, ca. vier Wochen vor einem Marathon gehört ein Halbmarathon in jeden Trainingsplan. An der Startnummernausgabe mißmutige Erkundigungen, ob die Strecke überhaupt schnee- und eisfrei sei. Oder ob wir lieber Ketten anlegen sollten.17 Dann der Rennleiter auf der Hauptstraße des Dorfes, er zieht einen Kreidestartstrich quer vor unsern Schuhspitzen, hält eine kurze Ansprache: Richtig, Sportsfreunde, kalt sei’s auch heute. Auf der langen Geraden bergauf komme ein tüchtiger Gegenwind dazu. Dafür nach der Wende dann Rückenwind bergab, darauf sollten wir uns schon mal freuen. Ob wir bereit seien? Er hob die Pistole übern Kopf. Wir waren bereit. Es war das erste und wahrscheinlich letzte Mal, daß wir alle drei aus der ersten Reihe heraus starteten. Dann die Strecke des Grauens, aus dem Ort hinaus und durch die Felder, bergauf. Mit uns gestartet nur Lauftreff- und Vereinsläufer umliegender Ortschaften, hartgesottne Burschen, die uns alles abverlangten. Kein Zuschauer an der Strecke. Als Wendemarke am Berg ein Klapptisch, an dem die Nummern der Läufer notiert wurden. Zurück zum Vereinsgelände, dort ein Topf heißer Tee mit Zitrone, ungemein köstlich. Und dann die zweite Runde. Beim Zieleinlauf nicht mal eine Kreidelinie auf dem Boden, dafür ein weiterer Klapptisch, daran zwei Offizielle: Man mußte ihnen die eigne Startnummer zurufen, damit der eine auf die Stopuhr blickte und dem andern die Zeit diktierte.18 Die Siegerehrung danach in der Turnhalle: Selbstgebackner Kuchen für einen Euro das Stück, der Rennleiter ruft jeden Teilnehmer nach vorn, drückt ihm die Hand, überreicht ihm seine Urkunde. Jeder ein Sieger heute, jeder ein König.
Größtmöglicher Gegensatz dazu: der New-York-Marathon mit tagelanger Vorab-Animation. Genau genommen fängt es schon Monate zuvor mit einem Mail-Bombardement der New York Road Runners an, jeden zweiten Tag stellen sie als Veranstalter eine Wundertüte an guter Laune, frischer Luft und Gesundheit in die Eingangsordner der registrierten Teilnehmer. Ob sie dann im weiteren Verlauf der Mail die Marathon-Schmuckkollektion von Tiffany anpreisen oder einen ihrer zahllosen Charity-Läufe, am Ende geht es stets darum, den Läufern Geld aus der Tasche zu ziehen.19
Ja, auch der New-York-Marathon wird vom örtlichen Sportverein ausgerichtet. Aber überschlägt man zum Beispiel, daß 2013 die Startgebühr für Ausländer 415 Euro betrug20 und daß von den 50740 gemeldeten Startern mindestens die Hälfte aus dem Ausland kam, dann ist bereits ohne Berücksichtigung der einheimischen Starter klar, daß ein Marathon der »Major Six«21 vor allem eines ist: Big Business. Entsprechend bombastisch ist das Setting des Ganzen, von der »Parade of the Nations«, der Eröffnungszeremonie im Central Park mit abschließendem Feuerwerk, über den »5k Dash to the Finish Line«, einen Lockerungslauf am Vortag des Rennens, bei dem bereits Zehntausende mitmachen,22 bis hin zur Pasta Party im Schichtbetrieb. Dann das riesige Areal, das auf Staten Island als Starterbereich eingerichtet ist, überhaupt schon die Transportlogistik, die bis spätestens 7 Uhr morgens dafür gesorgt haben muß, daß alle Läufer ebendorthin chauffiert wurden23 … und so geht’s weiter, (angeblich) 135 Musikbands an der Strecke24 und Celebrities wie Pamela Anderson oder Christy Turlington auf der Strecke,25 Tausende an Helfern, an die 25 Verpflegungsstationen, alles perfekt organisiert bis zum ernüchternden Zieleinlauf und der ganz und gar rüden Art, mit der man danach von den Ordnungshütern weitergescheucht wird zur Kleiderbeutelabholung, »keep moving, keep moving«, und auch von dort gleich weiter, hinaus aus dem Central Park. Der einzelne Läufer ist nur Mittel zum Zweck, was wirklich zählt, ist die Choreographie der Massen, ist die Show. Klar, das trifft mehr oder weniger auf jeden professionell durchgeführten Großstadtmarathon zu. Aber nirgendwo ist es so schmerzhaft deutlich zu spüren wie in New York. Statt eines Händedrucks gibt es tagsdrauf immerhin die New York Times mit einer Extra-Beilage, in der die Ergebnisliste bis zur Zielzeit 4:40 abgedruckt ist.
Keine Frage, New York ist das Mekka für jeden, der einmal im Leben bei einem ganz großen Marathon dabeigewesen sein will. Vielleicht ist Himmelpforten dann aber so was wie das Medina des Straßenlaufs. Zwischen beiden Extremen liegt unsre Welt, wie wir sie tagtäglich nicht nur beim Laufen, sondern in vielen weiteren Lebensbereichen erleben – zwischen regionalem Ereignis und globalem Event, Authentizität und Spektakel, Händedruck und Goodies-Tüte irgendwelcher Großsponsoren. Weil man das aber begrüßen, achselzuckend hinnehmen oder verdammen kann, werden wir auch in Zukunft nach jedem Rennen streiten, ob’s nun zuviel in die eine Richtung ging oder zuwenig in die andre. Majorna: »Ein Großstadtmarathon pusht einfach mehr als so ’n trostloser Parcours übers leere Land!« JP: »Nicht jeder! Paris zum Beispiel zieht dich richtig runter, dort gibt’s überhaupt keine Stimmung.« Marion: »Wenn du auf PB laufen willst, kannst du die Dorfrennen genauso vergessen wie die Großevents, dann mußt du in ’ner mittleren Stadt antreten, Essen zum Beispiel.« Bis einer von uns den Finger hebt, »Also ich sage nur …«, und für Ruhe sorgt. Himmelpforten ist und bleibt unser Zauberwort.
Km 4
Das Rennen lesen
Das einzige, was bei jedem amtlich vermessenen Straßenrennen vorab feststeht, ob in Himmelpforten oder New York, ist die Streckenlänge. Falls man nicht in Wien startet, wo sich bei der Nachmessung eines Hallenmarathons herausstellte, daß die Strecke um 1760 m zu kurz abgesteckt war – »Zuschauer und Sportler wunderten sich über die tollen Laufleistungen«26 –, dann weiß man, worauf man sich einläßt: 5 oder 10 km, 21,0975 oder 42,195 km, 43,527, 5628 oder 100 km29 undsoweiter, bis hin zu all den Etappen-Ultramarathons, die sich über 230 Wüstenkilometer hinziehen können.30 Doch mit der schieren Streckenlänge weiß man eigentlich noch gar nichts.
Jede Strecke stellt dem Läufer Fragen, jeder Läufer muß ihr darauf seine Antworten geben. Bei einem Halbmarathon läßt sich gewiß noch improvisieren, im Grunde ist man diese Distanz zu Trainingszwecken hundertmal gelaufen, auch ein überraschend deftiger Anstieg in der Zielgeraden wird einen kaum aus dem Konzept bringen. Ein Marathon ist eine andre Sache. Ihn zu rennen heißt, sich auf alles vorbereitet zu haben, was dabei erwartungsgemäß passieren wird, was da oder dort schlimmstenfalls passieren könnte, was da oder dort keinesfalls passieren darf. Wer Marathon läuft, liebt keine Überraschungen. Er will, daß alles nach Plan läuft. Dazu muß er aber wissen, wo der Zufall an der Strecke lauert. Er muß seine Antworten schon vorab durchgespielt haben, bevor ihm die Fragen tatsächlich gestellt werden. Sobald er sich für einen bestimmten Marathon angemeldet hat, verhält er sich damit wie ein Schriftsteller, der beschlossen hat, diesen oder jenen Roman anzupacken. Beide wissen, daß sie mit bloßem Drauflosrennen oder -schreiben höchstwahrscheinlich nicht bis zum Ziel durchhalten werden und daß sie gut daran tun, sich erst einmal gründlich mit den Besonderheiten und Tücken der Wegstrecke auseinanderzusetzen, die vor ihnen liegt.
Wer die Strecke kennt, kennt bereits das Rennen, das er darauf laufen wird – jedenfalls bis zu einem gewissen Grad. Vielleicht können Marathonis ohne Trainingsplan leben, ohne Streckenplan könnten sie es kaum. Zumindest wenn sie das anstehende Rennen als Wettkampf laufen wollen – ihr Erfolg hängt ganz wesentlich von einer intelligenten Renneinteilung ab, einer Festlegung des Lauftempos pro Streckenabschnitt. Manche laufen den Parcours zuvor sogar in Teilstücken ab (wie Abebe Bikila, der äthiopische Barfußläufer, vor seinem Sieg bei den Olympischen Spielen 1960). Andre fahren sie mit dem Auto ab, studieren sie im Video des Veranstalters oder per Google Earth als Satellitenbild. Beim Bebrüten des Streckenplans, mit dem sie als Rennstrecke erst in drei oder vier Monaten konkret konfrontiert werden, sind sie mindestens so sehr am Laufen wie draußen auf ihrer Hausstrecke. Das führt in wechselnder Abfolge zu tiefster Sorge, zu Zweifel und Zerknirschung, aber auch immer wieder zu neuer Entschlossenheit.
Ähnlich heftig auf und ab geht es mit mir auch in den Monaten vor der Niederschrift eines Romans. Immer wieder aufs neue laufe ich die Strecke ab. Erst so entwickelt sich überhaupt eine Art Entschlossenheit. Das Romanschreiben beginnt, lange bevor man den ersten Satz zu Papier bringt.
Ein Marathon beginnt, lange bevor der Startschuß fällt. Schon der Streckenplan kann die ganze Palette menschlicher Emotionen hervorrufen. Keiner liest ihn der bloßen Orientierung wegen – auf einer Marathonstrecke kann man sich beim besten Willen nicht verlaufen.31 Man liest ihn, lernt ihn, verinnerlicht ihn, um all das zu erfahren, was hinter dem Plan steckt – Euphorie und Verzweiflung, Triumph und Tragödie. Der Streckenplan eines Marathons ist ein Roman mit einer Folge starker Anfangsszenen und, hoffentlich, mit Happy End. Aber dazwischen? Dazu muß man ihn gelesen haben.
Auch die langen Läufe, die man während des Trainings an den Wochenenden absolviert, wollen vorab gelesen werden. Mehr noch, sie wollen stets aufs neue überhaupt erst erfunden, festgelegt, geschrieben werden. Selbst wenn man seine Hausstrecke lieben gelernt hat, man will ja nicht immer nur drei Stunden um den Dutzendteich oder die Donau rauf- und runterlaufen. Sofern man sich nicht die entsprechende topographische Karte gekauft hat, muß man sich mit Google Maps behelfen.
London, die schier unfaßbare Megacity, habe ich mir auf diese Weise systematisch erlaufen, von Richmond im Westen bis zur Thames Barrier im Osten. Als mein Flugzeug bei einem Landeanflug über der Stadt kreisen mußte, erkannte ich von oben nicht nur Themse, River Lee, Union Canal und überhaupt all die Kanäle und Parks, an denen und durch die ich gelaufen war. Jede meiner Strecken hatte ich anschließend mit Leuchtmarker auf einem Stadtplan eingezeichnet, im Lauf der Wochen hatten sie sich als mein persönliches Netz über die Stadt gelegt. Jetzt konnte ich dieses Netz von oben erkennen: Sobald ich meine Leuchtmarkerspuren hineindachte, lag das ganze riesige Häusermeer wohlgeordnet wie mein Stadtplan unter mir. Zwar konnte ich nur vergleichsweise wenige Bauwerke wiedererkennen, umso deutlicher jedoch sah ich die Struktur der Stadt. Ich war nicht nur ein paar Monate durch London gelaufen, ich hatte London dabei auf meine Weise begriffen. Das war das Glück.
Aber auch München und Hamburg habe ich, obwohl ich dort ja seit Jahrzehnten lebe, erst durchs Laufen richtig kennengelernt. Und nicht etwa nur das Wunderschöne an beiden Städten, isarab- oder elbaufwärts, sondern gerade auch ganz unspektakuläre Ecken und Wohngegenden, einfach deshalb, weil sie auf der Strecke lagen. Man kommt nicht nur als ein andrer von jedem dieser Läufe zurück, auch die Welt, in der man lebt, ist danach nicht mehr ganz die gleiche wie zuvor.32
Aber dann, endlich, das Rennen selbst. Endlich die Strecke, wie man sie hinter und durch den Plan schon seit Monaten vor dem inneren Auge gesehen hat. Wenig ist beflügelnder, als im Verlauf eines Marathons an Stellen vorbeizukommen, die man erkennt. Man hakt sie gewissermaßen fast forward ab. Das müssen keine Highlights sein, beim Hamburg-Marathon ist eine der zentralen Wegmarken der Ohlsdorfer Bahnhof, Km 31, ganz unspektakulär. Passiert man ihn, ist das Rennen auch für die Zuschauer schon in fortgeschrittnem Zustand, liegen einige von ihnen bereits als Bierleichen knapp neben der blauen Linie: jede für sich ein Kontrapunkt zu den weiß gedeckten Tischen, die man auf der Uhlenhorst direkt an der Strecke aufgebaut hat, Km 19–20, um das Zuschauen mit einem Champagnerfrühstück zu verbinden. Danach erwartet einen nurmehr Ödland namens Maienweg oder Alsterkrugchaussee, bevor man am Eppendorfer Baum wieder auf menschliches Leben stößt. So turbulent es dort dann auch zugeht, die Wende in Ohlsdorf ist für mich der wichtigste Punkt dieses Marathons; hat man ihn erreicht, geht es – ja, erst mal durch trostlose Kulissen, aber vor allem, jetzt deutlich zu spüren, Richtung Ziel. Weil jedoch zum Streckenplanlesen immer auch das Lesen des Streckenprofils gehört, weiß man auch, daß es hinter Ohlsdorf zwar konsequent nach Hause gehen wird, auf der Rothenbaumchaussee freilich noch mal bös bergan.33 Daß man also auf der (abschüssigen) Alsterkrugchaussee die Hacken besser etwas höher ziehen sollte, um im Schwung der Unterschenkel nach vorne Kraft zu sparen. Eigentlich ganz einfach, sofern man beide Pläne miteinander abgeglichen hat.
Seltsamerweise hört die Auseinandersetzung mit einer Marathonstrecke auch nach dem Rennen nicht auf. Wenn ich auf dem Sterbebett liegen werde, so stelle ich’s mir vor, werde ich all meine Strecken mit geschlossenen Augen noch ein letztes Mal ablaufen. Manchmal tröstet dieser Gedanke. Manchmal versetzt er mir aber auch einen Stich, dann blicke ich beim Laufen schnell noch einmal dorthin, wo etwas Besonderes am Wegrand zu sehen war. Ich will mir ja alles gut einprägen. Doch für wehmütige Gedanken ist dabei keine Zeit, wer läuft, kann nicht gleichzeitig wehmütig sein.
Km 5
Die blaue Linie
Wehmut ist bei einem Rennen so ziemlich das letzte, was man empfindet. Im Gegenteil, ihr könntet fast ein bißchen wütend werden, weil sich das Feld noch immer nicht sortiert hat. Weil ihr nach wie vor in haargenau derselben Kohorte lauft, in der ihr gestartet seid. Ganz außen am rechten Rand, ihr hattet euch ausgerechnet, dort etwas mehr Bewegungsfreiheit zu haben. Die habt ihr keineswegs, außerdem müßt ihr in jeder zweiten Kurve weite Wege gehen, das kostet wertvolle Sekunden. Wo ist eigentlich die blaue Linie?
Die blaue Linie kann zur Obsession werden. Ich liebe sie, suche sie während eines Marathons ständig im Blick zu behalten. Seb findet das grotesk, fordert mich selbst bei unsern Trainingsläufen gern auf, die blaue Linie zu laufen, im Duvenstedter Brook zum Beispiel oder in den Harburger Bergen. Onkel lacht mich einfach nur aus. Jörg findet sie überbewertet. Ilka hält sich dran und läuft eine PB nach der andern.
Die blaue Linie. Majorna findet sie vor allem schön, sie mache einen selber so wichtig.34 Peter empfindet sie als zusätzliche Motivation, man brauche sich ihr nur anzuvertrauen, sie sei der von der Rennleitung für uns alle vorgezeichnete Weg zum Erfolg. Wohingegen sie in andern Bereichen – beruflicher Werdegang, Liebesleben usw. – vollkommen unsichtbar sei, dort könne man sie nur erahnen, liege meist falsch, müsse ständig neu nach ihr suchen. Peter will damit nicht mehr und nicht weniger sagen als: Das Leben spiele oft mit gezinkten, ein Marathon hingegen stets mit offnen Karten, er zeige jedem, wie er idealerweise gerannt werden will. Wer sich nicht daran halte, sei selber schuld, seine Zielzeit nichts andres als die faire Quittung dafür, wie er sich seit dem Startschuß verhalten habe. Wohingegen das Leben jenseits des Marathons …
In jedem Fall ist die blaue Linie für alle ein klare Ansage. Spätestens am Vorabend des Rennens wird sie von der Rennleitung über die gesamte Länge der Strecke gezogen, sie stellt – sofern man nicht verbotnerweise über Bordsteinkanten oder Verkehrsinseln läuft – die kürzeste Verbindung zwischen Start und Ziel dar.35 Damit ist sie nichts Geringeres als das Prinzip des Marathons. Seine sichtbar gewordene Idee.
Natürlich tritt sie nur bei einem Stadtlauf in Erscheinung, und selbst dort im seltensten Fall komplett durchgezogen. Sondern in regelmäßigen Abständen auf den Straßenbelag gesprüht, die ersten Kilometer nach einem Massenstart wird man sie bestenfalls bemerken, falls man zufällig direkt auf ihr läuft.36 Trotzdem sollte man bereits hier die Augen offen halten. Nur wer die ganze Strecke über auf dieser Ideallinie bleibt, ist tatsächlich am Ende 42195 m gerannt und keinen einzigen Meter zuviel. Doch wer von uns kann das schaffen? Wir sind keine Spitzenläufer, wir laufen die ersten Kilometer im Pulk und viele weitere Kilometer im dicht besetzten Feld. Im Ziel zeigt unsre Uhr stets eine Streckenlänge an, die wir gar nicht hätten laufen müssen, mein Rekord liegt bei 42,97 km.
Um ein Haar hätte Seb die blaue Linie doch noch zu schätzen gelernt. Er hatte während des London-Marathons plötzlich Probleme mit seiner Hüfte, mußte das Tempo drosseln und kam mit der denkbar unglücklichen Zeit von 4:01:15 ins Ziel. Wenn es etwas gibt, das den »ambitionierten Freizeitläufer« so richtig um- und antreibt, dann ist es die Vier-Stunden-Hürde. Sie zu nehmen, träumen viele vergeblich. Seb war einige Tage lang eine tragische Figur, obwohl er sich tapfer einzureden suchte, daß 4:01 de facto fast dasselbe sei wie 3:59. Aber eingedenk der Tatsache, daß er Monate trainiert hatte, um am Ende 76 Sekunden zu langsam zu sein, war es ganz und gar nicht dasselbe. Schließlich kam ihm die rettende Idee: Seine GPS-Uhr hatte den Londoner Lauf mit 43,1 km festgehalten. Er mußte bloß noch ausrechnen, was er netto für 42,195 km gebraucht hatte – nämlich gebraucht hätte, sofern er die blaue Linie gelaufen wäre –, schon kam er unter vier Stunden.
Einige Wochen später stellten wir allerdings fest, daß die Meßgenauigkeit unsrer Uhren zu wünschen übrig ließ. Sogar Modelle des gleichen Herstellers zeigten nach gemeinsamen Läufen um mehrere hundert Meter voneinander abweichende Streckenlängen an. Höchste Zeit, auch das Kleingedruckte in der Gebrauchsanweisung unsrer Uhren zu lesen! In meinem und Sebs Fall einer Polar RC3; unter »Technische Spezifikationen« fanden wir den Passus, daß die GPS-Genauigkeit dieser Uhr bei ±2 % liegt. Das entspricht auf der Länge von 43,1 km gerade mal … herrje, das entspricht immerhin 862 m. Womit Seb also auch nur 42,238 km gerannt sein könnte – was der offiziell vermessenen Marathondistanz leider schon sehr nahe kommt. Mindestens die verbleibenden 43 Extra-Meter dürfte er wirklich gerannt sein, und zwar … ganz genau, weil er nicht permanent auf der blauen Linie bleiben konnte. Oder wollte. Wie man die Berechnung auch dreht und wendet, unter vier Stunden Zielzeit kommt man damit nicht mehr.
Eine besondere Pointe bekam Sebs Berechnung ein Jahr später, als wir am Vortag eines Marathons zufällig mit einem offiziellen Streckenvermesser ins Gespräch kamen. Er erzählte uns, was wir zunächst gar nicht glauben wollten: Bei der Vermessung eines jeden Marathons gebe man pro Kilometer einen Meter dazu, als Sicherheitsreserve, falls man sich irgendwo vermessen hätte. Weil dann nach Überprüfung der Strecke die Ergebnisse trotzdem weiterhin gültig bleiben könnten. Heißt nichts anderes als: Jeder Marathon ist – mindestens, sofern man ihn nämlich konsequent auf der blauen Linie laufen kann – 42 m länger als 42,195 km, jeder! Vielleicht hatte Seb in London also das Kunststück fertiggebracht und war konsequent die blaue Linie gelaufen, und seine Uhr hatte die Strecke auf einen Meter genau – ±2 %! – angezeigt?
Wie auch immer, beim Marathon kann man nicht mal sich selber in die Tasche lügen, das ist der Unterschied zum Leben. Ein amtlich vermessener Parcours bleibt trotz GPS