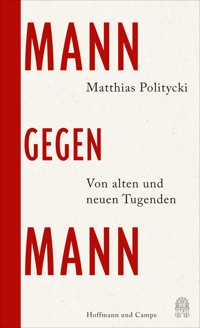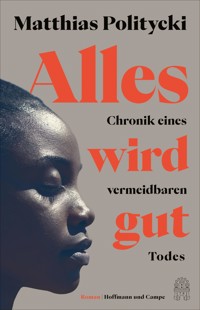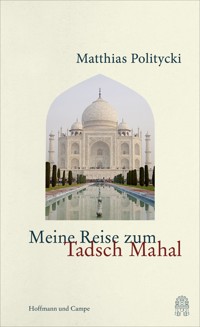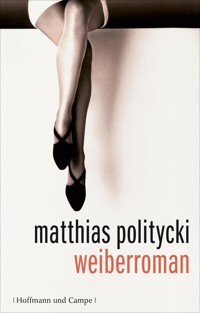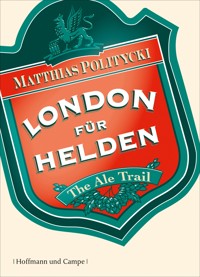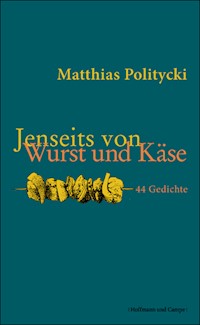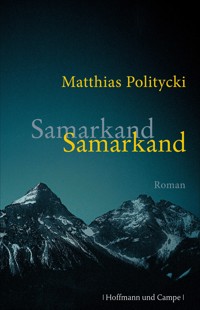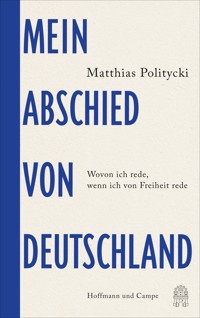
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen so gründlich zu betreiben, bis alle schlechte Laune haben." Im Frühjahr 2021 hatte Matthias Politycki genug vom deutschen Debattensumpf und zog nach Wien. In diesem fulminanten Buch begründet er seine Entscheidung und rechnet mit den Restbeständen unsrer Streitkultur ab – ein leidenschaftliches Plädoyer gegen die Restriktionen einer grassierenden Gegenaufklärung, vor allem aber auch eine Einladung zum wilden Denken über weltanschauliche Gräben hinweg. Als klassischer Linker steht Politycki für eine (fast) unbegrenzte Freiheit der Meinung, der Phantasie und der Literatur. Seine Verteidigung einer über Jahrhunderte gewachsenen Sprache gegenüber all jenen, die sie für ideologische Zwecke zu instrumentalisieren suchen, ist das Bekenntnis eines überzeugten Demokraten und Stilisten zugleich. "Nichts Geringeres wird gerade in der westlichen Welt verhandelt als unser Begriff von Freiheit. Wo manche noch glauben, es ginge lediglich um die Verbannung gewisser Wörter und Formulierungen, geht es in Wirklichkeit um die Art und Weise, wie wir in Zukunft leben wollen."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 129
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Matthias Politycki
Mein Abschied von Deutschland
Wovon ich rede, wenn ich von Freiheit rede
Hoffmann und Campe
»Und warum habt Ihr denn Deutschland verlassen?« fragte ich diese armen Leute. »Das Land ist gut und wären gern dageblieben«, antworteten sie, »aber wir konntens nicht länger aushalten –«
(Heinrich Heine, Vorrede zu Salon I, 1833)[1]
Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen so gründlich zu betreiben, bis alle schlechte Laune haben. Das war schon immer so, oder jedenfalls immer mal wieder. Trotzdem war ich mein Leben lang auf eine, heute würde man vielleicht sagen: postnationale Weise gern ein Deutscher und habe mich in Deutschland zu Hause gefühlt.
Doch vor einem Jahr war das Maß dann voll. Als einer, der von der Freiheit des Gedankens und der Schönheit der Sprache als seinen täglichen Grundnahrungsmitteln lebt, hatte ich genug von kuratierter Wortwahl und vorstrukturierten Haltungsketten, wollte nicht länger zusehen, wie sich die Debattenräume Tag für Tag verengten. Und zog nach Wien. Ich wollte eine Grenze zwischen mir und all dem wissen, was mir die Freude am öffentlichen Gespräch und schließlich die am Schreiben verdorben hatte.
Wien ist freilich nicht aus der Welt, die Debatten, die ich eigentlich hatte verlassen wollen, holten mich wieder ein. Wenn es nach den Broschüren gehen sollte, die von den städtischen Behörden für ihre Mitarbeiter herausgegeben werden, will man hier sogar die Schafe gendern – als »tierische MitarbeiterInnen« –, offenbar um keine Hammel zu diskriminieren. Auf Nachfrage läßt der Bürgermeister jedoch über sein Büro versichern, daß ihm diese Broschüre nicht geläufig sei.[2] Nicht etwa »nicht bekannt«! Sondern halt »nicht geläufig«. Das ist Wien. Dieselben Themen wie in Berlin, aber kräftig abgemildert durch einen komödiantischen Einschlag und durch kultivierte Renitenz an der entscheidenden Stelle. Und ansonsten übrigens auch durch den alles beherrschenden Konjunktiv, eine Kulturerrungenschaft des gesamten deutschsprachigen Südens, die weit über das rein Sprachliche hinausgeht und manches erträglicher macht, was man in der Unerbittlichkeit indikativischer Verlautbarungen kaum auszuhalten glaubt.
Schon seit einigen Jahren fühlte ich mich in Deutschland nicht mehr wohl. Zunächst war es nichts weiter als ab und an ein plötzliches Unbehagen, und weil ich einen Großteil meiner Zeit in Asien, Afrika oder sonstwo verbrachte, vergaß ich es schnell. Nach meiner Rückkehr stellte es sich jedoch verläßlich wieder ein. Irgendwann war es dauerhaft präsent, kein vorübergehendes Unbehagen mehr, sondern schleichende Bedrückung. Erst mit Verhängung des Corona-Lockdowns im Frühjahr 2020, der mich in deutschem Alltag, deutscher Befindlichkeit und deutschen Diskursen festsetzte, wurde mir klar, was mir seit Jahren abhanden gekommen war: die beruhigend selbstverständliche Gewißheit, in einem der freiesten Länder zu wohnen, in das ich von jedweder Ecke der Welt immer gern zurückgekehrt war.
Kann es sein, fragte ich mich, daß die grenzenlose Freiheit, wie wir sie noch in den Debatten der Neunzigerjahre genossen, verloren gegangen ist? Damals hatte ich sie gar nicht sonderlich geschätzt, nicht einmal als solche erkannt. Die Freiheit der Meinung, die Freiheit der Sprache, die Freiheit der Kunst waren nicht nur verbürgte Grundrechte einer demokratischen Gesellschaft, sondern wurden auch lustvoll und ohne gegenseitige Verdächtigungen oder Diskreditierungen bis an Tabugrenzen und gelegentlich sogar darüber hinaus ausgeschöpft.
Heute erlebe ich immer öfter Situationen, in denen sich einer empört, weil ein anderer irgendwas gesagt hat, oder eigentlich: weil er es auf eine Weise gesagt hat, die dem einen nicht paßt, oder ganz eigentlich: weil er es vielleicht so gesagt haben könnte, wenn man den Quellen Glauben schenkt, und weil allein der Verdacht Anlaß genug ist, sich von ihm zu distanzieren. Dabei geht es oft nur um ein einziges Wort, offensichtlich ist es einem Verdikt anheimgefallen. Aber was heißt »nur«? Jedes Wort ist Teil der Sprache, in der ich schreibe. Hier verschwinden Bausteine meines Arbeitsmaterials, das macht mich umso hellhöriger. Gleichzeitig driften Teile unsrer Gesellschaft weiter und weiter auseinander, zunächst hören sie einander nicht mehr zu, irgendwann scheinen sie sich zu verachten, schließlich zu hassen. Daß einem Gemaßregelten kurzerhand das Recht abgesprochen wird, sich öffentlich zu äußern, ist inzwischen schon eine freundliche Form der Ausgrenzung. Besonders perfide, wenn sie sich als Ratschlag tarnt und pastorenhaft vorgibt, sie wolle eine arme Seele von ihrem schlechteren Selbst erretten, wo sie sie doch in Wirklichkeit verdammt.
Nachdem ich meinen Abschied von Deutschland in der FAZ begründet hatte,[3] meldeten sich auch bei mir ein paar Wokisten und versuchten, mich gönnerhaft über meine neue Heimat zu belehren (»fast schon sowas wie Ungarn«) und dabei nonchalant auszugrenzen. Offenbar wußten sie nicht, daß »das Rote Wien« auch nach 1945 ununterbrochen von der SPÖ regiert wurde. Ihre Mails machten mir noch einmal klar, wie richtig es war, dem deutschen Debattensumpf zu entfliehen: nicht nur den Scharfmachern, sondern auch den opportunistischen Mitläufern. Letztere sind im Grunde nichts weiter als eine neue Version des Spießers. In ihrem permanenten Pochen auf Moral und Anstand ähneln sie den Sittenwächtern der Nachkriegszeit, auch wenn sie sich in ihrer Selbsteinschätzung als deren »linkes« Gegenteil wahrnehmen.
Wenn es demnächst vielleicht auch eine »MeToo«-Bewegung gibt, in der sich Opfer von Stigmatisierung und Ausgrenzung melden, so ist dies schon mal mein Beitrag. J’accuse …? Eher: Ab dafür!
Freiheit
Jede Zeit frönt ihren speziellen Irrtümern, in manchen Zeiten scheinen sie sich zum allgemeinen Irrsinn zu ballen. Momentan ist die Intoleranz auf dem Vormarsch, freilich im Zeichen der Toleranz. An den Rändern der Gesellschaft herrscht eine große Gereiztheit, in ihrer Mitte eine große Verunsicherung. Mit jeder öffentlichen Äußerung riskieren wir, daß jemand einen Halbsatz aufschnappt, ihn auf seine Weise versteht oder gezielt mißversteht und über die sozialen Medien verbreitet. Gedanken werden aus dem Zusammenhang gelöst, damit sie knallen – und Klicks generieren, Quote machen, Auflage. Und das keineswegs nur bei Personen des öffentlichen Lebens, sondern bei allen, die in kleineren oder größeren Gruppen kommunizieren. Oft kommt Haß von rechts, keine Frage. Aber leider auch von links,[4] dazu ein gut organisiertes Mißtrauen gegen alles, was nicht exakt auf der eigenen Linie liegt. Immer wieder wird jemand erst durchs mediale Dorf getrieben und am Ende geschlachtet für etwas, das mißverständlich war oder schlicht »politisch inkorrekt«. Das bringt Menschen zum Schweigen, ob in der Wissenschaft, im Kulturbetrieb, im Alltag.
Mit unsrer Streitkultur, auf die wir so stolz sind, ist es offensichtlich nicht mehr weit her. Das geistige Klima hat sich in Deutschland im Verlauf der letzten Jahre auf paradoxe Weise verschlechtert, die Sichtweise auf Probleme verengt, die Positionen polarisiert. Beides, die Belehrungsimpertinenz von links wie die Pöbelei von rechts, sind zwei Seiten ein und derselben Bankrotterklärung. Der Überdruß an unserem öffentlichen Gespräch scheint inzwischen weite Teile der Bevölkerung erfaßt zu haben, vor allem das, was wir »die Mitte der Gesellschaft« nennen. Wir halten uns selbst nicht mehr aus.
Zumindest einen Teil unsrer Freiheit haben wir dadurch verloren: die Freiheit, so offen miteinander zu reden und zu diskutieren, wie ich es in meiner Jugend als urdemokratische Tugend beigebracht bekam. Eine Freiheit, die an keine Vorbedingung geknüpft und schlechthin unlimitierbar ist, abgesehen davon, daß sie dort aufhört, wo die Freiheit des anderen beginnt. Sie beinhaltet die Verpflichtung, sich redlich und respektvoll auseinanderzusetzen, andererseits auch das Recht, sich nicht auf die Art und Weise äußern zu müssen, die der Gesprächspartner erwartet.
Gerade auch dann, wenn zu einer gewissen Zeit in den herrschenden Kreisen Konsens zu bestehen scheint, auf welche Weise gelebt, miteinander gesprochen und am Ende auch gedacht werden sollte. Zu einer anderen Zeit wird es einen anderen, davon abweichenden Konsens geben – darin besteht Geistesgeschichte und, wenn man so will, Kultur. Gemeinschaften zeichnen sich nicht zuletzt dadurch aus, daß sie abweichende Meinungen – und eine abweichende Art und Weise, sie in Worte zu fassen – aushalten, solange sich diese im Rahmen der Gesetze verorten. Selbstredend auch Meinungen und Formulierungen, die aus der Vergangenheit überliefert und jetzt Teil unsres kulturellen Erbes sind. Sie mit eigenen Ansichten und Formulierungen kritisch zu konterkarieren, steht jedem frei. Ist eine demokratische Gesellschaft nicht willens, diese grundsätzliche Toleranz zu leben, drängt sie jede nichtkonforme Äußerung hinter vorgehaltene Hand und die wichtigen, die kontroversen Debatten vom öffentlichen in den vermeintlich geschützten privaten Raum. Spätestens dann ist ihr Fundament erschüttert, ihr Fortbestand gefährdet.
Davon rede ich, wenn ich von Freiheit rede und wie sie sich derzeit – absurderweise unter dem Versprechen, es ginge um die Befreiung der Menschheit schlechthin – zunehmend in Unfreiheit verwandelt. Nichts Geringeres wird gerade in der westlichen Welt verhandelt als unser Begriff von Freiheit. Wo manche noch glauben, es ginge lediglich um die Verbannung gewisser Wörter und Formulierungen, geht es in Wirklichkeit um die Art und Weise, wie wir in Zukunft leben wollen. Allerdings befindet darüber nur eine kleine Elite. Für die überwiegende Mehrheit ist es rabulistisches Geplänkel, weil sie sich von den Vorgaben eines politisch korrekten Sprachgebrauchs (noch) nicht persönlich betroffen fühlt. Als ob mit der Maßregelung der Sprache nicht auch eine Maßregelung der Gedanken einherginge. Wer hier einfach nur »auf die Sprache vertrauen« will, die derlei Vorgaben im Lauf der Zeit schon von alleine abschleifen werde, verharmlost das Problem.
Realsatire
»Die Deutschen bestehn aus Leidenschaft und politischem Defekt. […] Deutschlands Geschichte heißt: Spaltung. Scheelsucht; Hemmnis; Hass.« So der große Kritiker der Weimarer Republik, Alfred Kerr.[5]
Nun ist die Spaltung der Gesellschaft ein Phänomen, das man derzeit überall in der westlichen Welt beobachtet; die Gründe für die Polarisierung in der Weimarer Republik waren andere als heute. Dennoch, ist es vielleicht auch unser Nationalcharakter, der uns in periodischen Abständen aufeinander losgehen läßt? Und ist es mit Blick auf unsere Geschichte also ganz normal, was wir derzeit als Disruption und Parzellierung erleben?
Die zunehmenden Forderungen der politischen Korrektheit an unsre Sprache beschäftigen mich seit Jahren. Als Schriftsteller, der die deutsche Sprache nicht nur liebt, sondern ihrer mitsamt allem Wildwuchs ungeharkt und ungejätet bedarf, um daraus etwas Literarisches zu gestalten, sah ich mich immer öfter gezwungen, sie gegen Diskreditierungs- wie Vereinnahmungsversuche weltanschaulicher Eiferer in Schutz zu nehmen. Anfangs noch voller Hoffnung: Aufgewachsen in den linksgrünen Biotopen der Siebzigerjahre, in denen alles mit allen ausdiskutiert wurde, fühle ich mich der Idee einer permanenten Aufklärung verpflichtet und bin überzeugt, daß jeder These jederzeit von jedem widersprochen werden kann, sogar sollte, um den dialektischen Prozeß der Erkenntnis voranzutreiben. Auch was den zunehmenden Haltungsdogmatismus der letzten Jahre betrifft, war ich lange der Meinung, daß nur jeder gut gelaunt gegenhalten müsse, bis auch diesmal alles mit allen geklärt und zum Kompromiß gebracht sein würde, durch den sich demokratische Gesellschaften seit je beglaubigen. Von heute aus betrachtet, mag diese Einschätzung naiv erscheinen.
Irgendwann hat mich nichts mehr überraschen können – nicht die These, daß die Musik der Deutschen Klassik rassistisch ist;[6] nicht die, daß zwei plus zwei nicht unbedingt vier ergibt, wenn man Diversität wirklich ernst nimmt;[7] nicht die, daß es reicht, sich als Frau zu fühlen, um auch eine zu sein, selbst mit sämtlichen Geschlechtsmerkmalen eines Mannes – und daß Frauen nicht unbedingt Frauen sind, sondern »menstruierende Personen«, weil man mit der Bezeichnung »Frau« Frauen beleidigt, die sich nicht als Frau fühlen wollen.
Worüber man früher als Satire gelacht hätte, wurde Realsatire.[8] Zum Lachen war mir dabei immer weniger zumute, eine kulturelle Revolution ist kein Spaß, und nichts Geringeres erleben wir derzeit: Eine vergleichsweise kleine Gruppe, die sich als Elite versteht, ist angetreten, uns im Zeichen der Wokeness das Sprechen, das Denken und den Umgang miteinander neu beizubringen und, um ihr moralisierendes Narrativ durchzusetzen, auch unsre Vergangenheit neu zu bewerten beziehungsweise gleich zu übermalen, vom Sockel zu stürzen oder umzuformulieren.
Wokeness, das ist Ausweitung der Political Correctness auf alle Lebensbereiche. Ihre Protagonisten sind auch hierzulande extrem umtriebig und finden immer neue Anlässe, um unseren Alltag mit ihrer Terminologie zu besetzen und neu zu strukturieren. Was anfangs wie die Selbstbeschäftigung universitärer Eliten anmutete, entpuppte sich mehr und mehr als eine mit jakobinischem Eifer betriebene Selbstzerstörung unsrer intellektuellen Republik.
Längst habe ich einen Gutteil meines Optimismus verloren, daß sich die Errungenschaften der Aufklärung durch beharrliche Widerrede gegen die Absurditäten einer grassierenden Gegenaufklärung verteidigen lassen. Längst frage ich mich, ob der Vormarsch derer, die bei jeder Gelegenheit Haltung zeigen oder, sofern es keine Gelegenheit gibt, kurzerhand Gelegenheit schaffen, noch zu stoppen ist. Hat nicht alles, was wir sagen, denken, tun, seine Unschuld verloren, ist zum Erkennungszeichen einer Ideologie hochstilisiert und gleichzeitig entwertet worden? Stehen wir aufgrund solcher, vor kurzem hätte man noch gedacht, Kleinigkeiten nicht alle längst in irgendeinem weltanschaulichen Lager, selbst gegen unseren Willen, und unter permanenter Beobachtung, wenn nicht Generalverdacht: ehemals »mündige Bürger«, jetzt beigepreßte Söldner dieser oder jener Kleingeisterei, die, jede auf ihre absolutistische Weise, den liberalen Westen sukzessive rückabwickelt zum Flickenteppich identitätspolitisch befestigter Duodez-Fürstentümer?
Die Alternative, vor der wir täglich aufs neue stehen, ist: mitmachen und uns dieser oder jener Haltung anschließen – oder, trotz allem, erst mal selber denken, unabhängig denken. Auch wenn man dabei verläßlich schlechte Laune bekommt und immer wieder Angst, daß sich der ganze Irrsinn demnächst in einem großen Knall entlädt. Sofern wir zu den Straßenschlachten, wie sie zwischen den verfeindeten Lagern und mit Vertretern der Staatsgewalt geführt werden, die Gesinnungsschlachten auf den Datenstraßen der sozialen Netzwerke rechnen, hören wir schon, wie der Boden bebt, auf dem wir stehen.
Querendes Getier
Als ich im Frühjahr 2021 das Editorial eines Newsletters las, in dem die Rückkehr der »Störchinnen und Störche« aus dem Winterquartier vermeldet wurde, fragte ich mich reflexhaft: Und was ist mit Fröschinnen und Fröschen, Krötinnen und Kröten und all den andern Tierinnen und Tieren? Machen sie sich nicht auch in diesen vorfrühlingshaft milden Tagen auf den Weg? Ich begann, ein Gedicht darüber zu schreiben, und als das lyrische Ich in den Schlußversen »Autofahrende, Radfahrende und Fußgehende« bat, achtsam mit querendem Getier umzugehen, merkte ich: Ich war drauf und dran, verrückt zu werden, wenn ich weiter versuchen wollte, gegen die Verrücktheiten unsrer Zeit anzugehen.
Was sich im Lauf der Zeit als Unbehagen und schließlich als Bedrückung angestaut hatte, entlud sich in plötzlicher Ernüchterung: Hier mit Argumenten – oder Gedichten – gegenzuhalten, ist für den, der Geist und Sprache liebt, entwürdigend.
Ich verstehe jeden, der sich in die innere Emigration zurückzieht und schweigt. Aber für einen Schriftsteller ist Schweigen auf Dauer keine Option, ich hatte Konsequenzen zu ziehen. Einige Monate später war ich nach Wien umgezogen; die Schafe auf der Donauinsel – unter ihnen übrigens kein einziger Hammel – grasten damals noch ungegendert. Wenn ich gedacht haben sollte, daß ich hier wieder zur Arbeit am nächsten Roman zurückfinden würde, so … kam immerhin die Lust am Schreiben zurück.
Dazwischen
Denn wie könnte man einen Roman schreiben, wenn die Basis aller Kreativität bedroht ist, die Freiheit der Sprache und der Phantasie? Nicht meine persönliche Freiheit. Ich habe mit meinem Verleger gesprochen und weiß, daß eine vorauseilende Selbstzensur im Sinne des Zeitgeists auch bei künftigen Veröffentlichungen nicht von mir erwartet wird; ein Verlag sei ja geradezu die Inkarnation der Meinungsfreiheit. Was sind das für Zeiten, wo man für diesen Satz, der noch vor zehn Jahren eine Selbstverständlichkeit gewesen wäre, dankbar ist? Ich weiß von Schriftstellern wie von Journalisten – von Wissenschaftlern ganz zu schweigen –,[9] die kaum noch oder nur in entsprechend redigierter Form publizieren können.
Wenn die Freiheit bedroht ist, kann es nichts Wichtigeres geben, als für sie einzutreten. Aber Sie können sich doch frei äußern, erwidert man hier gern, wenn man die Bedrohung herunterspielen möchte. Ja, das kann ich in der Tat. Und indem ich mich äußere, tue ich es vielleicht auch für all diejenigen, die es nicht mehr können. Der Verweis auf die formaljuristisch garantierte Meinungsfreiheit in unserem Land klingt ihnen wie eine Verhöhnung, weil sie für ihre Ausübung der Meinungsfreiheit zwar nicht vom Gesetzgeber, wohl aber von ihrem beruflichen oder privaten Umfeld mit Mobbing, Aufkündigung der Zusammenarbeit oder sozialer Ächtung abgestraft wurden.
Dem gegenüber steht eine überwiegende Mehrheit, die eigentlich nicht