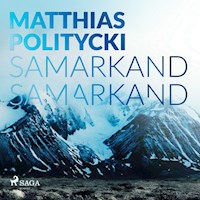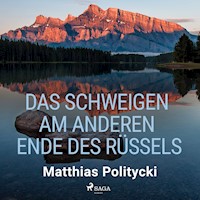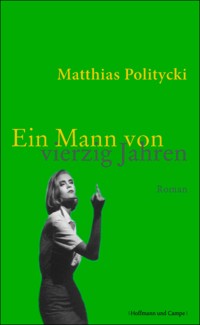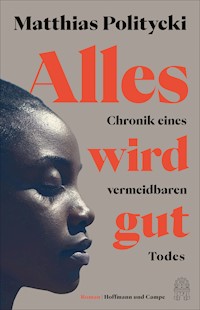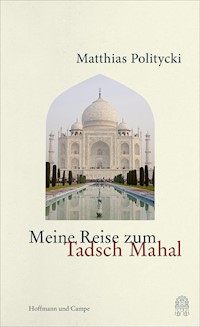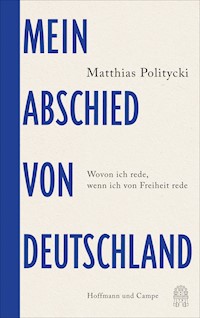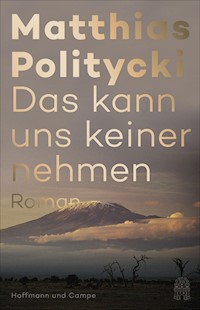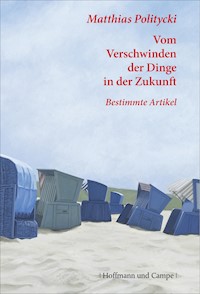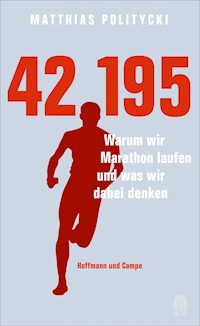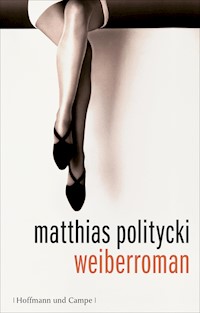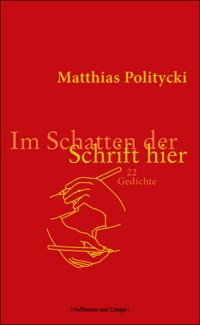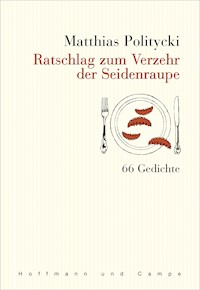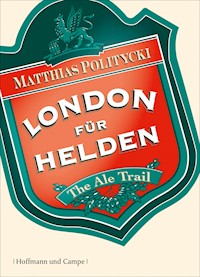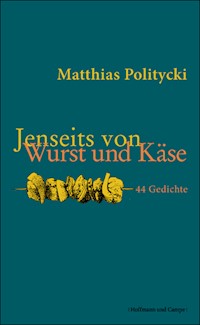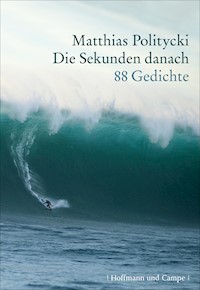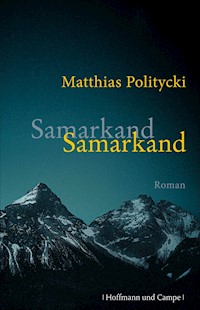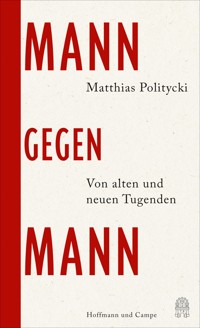
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Angesichts der Bedrohung durch Kriege und Gewalt geraten unsere Überzeugungen und gesellschaftliche Werte zunehmend ins Wanken. Die Frage: Wer verteidigt im Ernstfall unser Land, unsere Freiheit?, lässt bestehende Männerbilder plötzlich in anderem Licht erscheinen. Brauchen wir jetzt vielleicht Männer, die sich klassischer Rollenmuster erinnern, ohne neue Interpretationen ihrer Rolle preiszugeben? Matthias Politycki macht sich auf die Suche nach einer NEUEN ALTEN Männlichkeit. Bei der Lektüre von Borges und Hemingway fördert er überraschende Erkenntnisse zutage, und durch Verknüpfung von Literatur, Gegenwartsdebatte und persönlich Erlebtem gelingt ihm ein bestechend kluger Essay zu einer der drängenden Fragen unserer Zeit. »Eine gelehrte Auseinandersetzung mit den Männlichkeitskonzepten der Schriftsteller Jorge Luis Borges und Ernest Hemingway.« DER SPIEGEL
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Matthias Politycki
Mann gegen Mann
Essay
Zeitenwende, Männlichkeit
Wieder einmal sind wir in einer Zeit der Kriege angekommen, und obwohl wir noch nicht unmittelbar betroffen sind, hat die konkrete Bedrohung schon vieles ins Wanken gebracht, was wir uns im Lauf der letzten Jahrzehnte an Überzeugungen und an gesellschaftlichen Werten erarbeitet hatten. Dazu gehören auch Lebenskonzepte und Rollenerwartungen, maßgeblich geprägt von einer ganzen Reihe an Generationen, die sich in Sicherheit wähnten.
Selten geht es in bewaffneten Konflikten nur um ökonomische Interessen und territorialen Gewinn, meist geht es auch um ideologische und kulturelle Hegemonie, nicht zuletzt zur Legitimation der Gewalt. Selbst ein offensichtlicher Aggressor wie Rußland begründet seinen Angriff auf die Ukraine unter anderem als »Verteidigung« gegen das Vordringen westlicher Werte. Ein maßgeblicher Teil der islamischen Welt tut dies nicht minder, auch wenn es ihm in erster Linie um Auslöschung Israels geht. Das Massaker der Hamas vom 7.10.2023 wurde bis Malaysia und Indonesien gefeiert und, als ob das nicht genug wäre, als Aufstand gegen einen angeblichen israelischen Kolonialismus gerechtfertigt.
Was bedeutet das Näherrücken des Krieges für eine Bevölkerung, deren unterschiedlichen Fraktionen und Interessensgruppen vielleicht als letzter gemeinsamer Nenner die Parole »Nie wieder Krieg!« geblieben ist? Für eine Bevölkerung, die ernsthaft glaubte, sich nie wieder verteidigen zu müssen, und die Aussetzung der allgemeinen Wehrpflicht als Beitrag zum ewigen Frieden verstand? Eine Bevölkerung, die sich jetzt vermutlich nicht mal darauf einigen könnte, was überhaupt verteidigt werden sollte – etwa unser Land? Freiheit und Demokratie und die damit verbundenen Lebensformen? Oder doch nur unser Wohlstand?
Und schließlich: Wann müßten wir mit dem Verteidigen denn beginnen – wenn Rußland im Baltikum »bedrohten russischen Minderheiten zu Hilfe eilen« würde? Oder schon in künftigen Silvesternächten, wenn wir nicht nur Frauen schützen wollten, sondern damit auch unsre Vorstellung vom Zusammenleben der Geschlechter? Gewalt ist Gewalt, in welcher Dimension auch immer, und wir sollten sie zumindest abwehren wollen. Aber wären wir dazu noch in der Lage? Ja wären wir dazu überhaupt bereit, notfalls sogar in der direkten Auseinandersetzung, Mann gegen Mann?
Plötzlich gibt es Fragen, auf die wir rasch Antworten finden müssen. Mir wird schon mulmig, indem ich sie mir stelle. Es geht ja nun nicht mehr nur um Marathonläufe, Hochgebirgstouren oder sonstige sportliche Herausforderungen, in denen man sich bewähren muß. Es geht um den Ernstfall, um das Finden einer Haltung für Tag X. Jeder einzelne, welchen Geschlechts auch immer, muß mit diesen Fragen für sich ins Reine kommen. Ich kann es nur als Mann, fühle mich dazu als Mann auch besonders in der Pflicht. Das mag altmodisch sein, aber vielleicht bin ich mit dieser Haltung weniger allein, als es scheint. Immerhin können Frauen – Gleichberechtigung hin oder her – bei uns nicht zum Kriegsdienst eingezogen werden. Und das sogenannte »Selbstbestimmungsgesetz« regelt, daß im Falle einer Einberufung auch Männer mit geändertem Geschlechtseintrag dem Dienst an der Waffe nicht entgehen. Mann bleibt Mann.
Ich werde mich also bei meiner Suche nach Antworten auf eine männliche Perspektive und überhaupt auf Männer begrenzen und wie wir uns plötzlich wieder neu in Frage stellen müssen.
Oder dürfen? Mehr oder weniger offen wendet man sich in der panrussischen wie der panislamischen Welt, aber auch in einer ganzen Reihe von Staaten des globalen Südens gegen den Westen und seinen immer kleinteiliger ausdifferenzierten Freiheitsbegriff, nicht zuletzt im Umgang mit Geschlecht und Geschlechterrollen. In den Debatten des Westens fördert man seit Jahren alles, was vom bisherigen Konsens der Mehrheitsgesellschaft abweicht. Ja, man stellt den Begriff des »Normalen« selbst in Frage und versteht ihn als ein Instrument kultureller Hegemonie und Ausgrenzung all derer, die davon (angeblich) abweichen.
In Rußland und in Ländern, die vom Islam geprägt sind, verachtet man uns gerade deshalb – so hat man’s mich auf meinen Reisen seit Jahren immer wieder wissen lassen. Da wie dort inszeniert man sich als moralisch überlegen, als Beschützer der Familie und Bewahrer traditioneller Geschlechterrollen. Man »verteidigt« die eigenen Vorstellungen von Normalität. Abweichungen von den Überzeugungen des Mainstreams werden nicht etwa gefördert, sondern geahndet – vom Verprügeln bis zur Verbannung in Todeslager oder öffentlichen Hinrichtung.
Wer sich mit Zukunftshoffnungen und -ängsten von Gesellschaften beschäftigt, muß sich zwangsläufig auch mit den divergierenden Erwartungen an Geschlechterrollen auseinandersetzen. Insbesondere Männer und »Männlichkeit« werden in Kriegszeiten fast zwangsläufig anders beurteilt als in Friedenszeiten, da unsere Vorstellung davon mit Ausübung und Verhinderung von Gewalt verbunden ist. Und Kriegszeiten haben ja gerade wieder begonnen – auch für uns. Brauchen wir jetzt vielleicht Männer, die sich klassischer Rollenmuster erinnern und dennoch die neuen Interpretationen ihrer Geschlechterrolle nicht preisgeben?
Die Konfrontation der Werte, die in den verschiedensten Regionen der Welt zunehmend mit Gewalt ausgetragen wird, läßt sich seit Jahren auch in Europa verfolgen: als »Kampf der Kulturen«. Schon den Begriff hat man oft als maßlose Übertreibung zurückgewiesen, dabei ist dieser Kampf in seiner hybriden Form längst auch bei uns im Gange. Auf unseren Straßen spielen sich mitunter Szenen ab, die uns einen Vorgeschmack davon geben, wie »Pariser Verhältnisse« auch hierzulande anbrechen könnten, etwa wenn arabischstämmige Jugendliche Böller auf Polizisten abfeuern, um sie zu einem Kräftemessen herauszufordern. Oder wenn propalästinensische Demonstranten den Polizeibeamten »Wir hauen euch Kartoffeln« zurufen, »Wir schlachten euch ab wie die Zionisten«.[1]
Nein, das ist gewiß nicht repräsentativ für die Mehrheit in den verschiedenen migrantischen Milieus. Aber Ausdruck relevanter Minderheiten ist es schon. Was wir auf unseren Straßen dann sehen, sind randalierende oder skandierende Machos, die sich hemmungslos austoben – alte Männer in des Wortes übertragener Bedeutung, auch wenn sie erschreckend jung sind. Sie wollen es drauf ankommen lassen, sie wollen kämpfen, und sie fordern uns sogar expressis verbis dazu auf. Wir können es nicht länger verdrängen: Überkommene Geschlechterstereotype sind in unsre Gesellschaft eingewandert und bedrohen sie ganz konkret.
Sie treffen auf eine verunsicherte Gesellschaft, die selbst noch im Findungsprozeß ist, was etwa Männlichkeit im 21. Jahrhundert bedeuten könnte. In ebenjenem Prozeß entdecken wir immer weitere Abweichungen von der »Norm«, entstanden ist auf diese Weise eine Gesellschaft von Singularitäten und identitären Minderheiten.
Eine Ausweitung des persönlichen Freiheitsspielraums ist natürlich immer zu begrüßen. Doch der Fortschritt hat eine Kehrseite: Im postmodernen Diversitätsstrudel gelten Männer, an denen die aktuellen Debatten vorbeigegangen sind, als »sehr bösartig, gefährlich, schädlich, zermürbend« – so die aktuelle Definition des Wortes »toxisch« durch den Duden. Der »alte weiße Mann« ist zur Inkarnation von Rassismus, Sexismus und Gewalt erklärt worden. Übriggeblieben ist der gebändigte Mann, ein in alle Richtungen empathisches Männchen, das immer auch die bessere Feministin sein will.
Dem herrschenden Zeitgeist zum Trotz finden sich zunehmend Männer auf den Straßen zusammen, die sich in aufwendigen Abklatschritualen ihrer Virilität versichern und auch in ihrem sonstigen Gebaren vor allem das eine darstellen wollen: daß sie ganze Kerle sind. Deutlich subtiler, in seinem Sendungsbewußtsein jedoch nicht weniger entschieden war der Mann, dem ich unlängst auf der Straße begegnete: Er trug ein schwarzes T-Shirt mit der Aufschrift »Homme«. Man muß erst einmal begreifen, daß das keine Selbstverständlichkeit mehr ist, daß es sich hier um ein »Outing« mit Botschaft handelt.
Wann ist ein Mann ein Mann? Die einen tragen der Gesinnungswärme wegen auch im Sommer Mütze und würden am liebsten sogar Haushaltsgegenstände gendern, die andern machen Krafttraining oder lassen sich zumindest beim Friseur ein Image als böser Bube verpassen. Die einen wollen um jeden Preis geliebt werden, die andern respektiert oder gar gefürchtet. Die einen halten nicht mal mehr biologische Tatsachen für verbindlich, die andern setzen ein bewußt inszeniertes Macho- und Proletentum dagegen. Karikaturen von Männlichkeit da wie dort.
Dreißig, vierzig Jahre lang hatten die Befürworter einer neuen, differenzierten, emanzipierten – man möchte fast sagen: einer feministisch verstandenen – Männlichkeit alle guten Argumente auf ihrer Seite. Männer, die sich nicht als »neue«, sondern als herkömmliche Männer begreifen wollten, hatten es »noch immer nicht begriffen«, man unterstellte ihnen, daß sie »abgehängt« waren und sich deshalb »in patriarchale Ersatzklischees flüchten« mußten. Selbstredend galten sie als misogyn, sprich, als erledigt. Und wer es anders sah, war gut beraten, den Mund zu halten – habe den Mut, dich deiner eigenen Feigheit zu besinnen.
So hat sich die Diskussion über Männlichkeit im Lauf der Jahre auf »toxische« Männlichkeit fokussiert; die Beschäftigung mit »herkömmlicher« Männlichkeit (in all ihrer Ambivalenz) ist hingegen fast ganz aus dem öffentlichen Gespräch verschwunden. »Man darf nicht einmal das Wort Männlichkeit verwenden, ohne als Faschist zu gelten«, sagte der französische Philosoph Michel Onfray vor gar nicht so langer Zeit im Interview.[2]
Doch das ändert sich gerade. Angesichts der Kriege, die gefährlich nah an unseren Alltag herangerückt sind, und einer immer häufiger sichtbaren maskulinen Gewalt im Inneren wankt der ideologische Überbau, den sich der Westen auf zunehmend selbstzerstörerische Weise verordnet hat, lösen sich jahrzehntelang dekretierte Selbstverständlichkeiten wie von selbst auf. Nachdem wir immer mehr Grenzen durchlässig gemacht haben, weltanschauliche wie real existierende, stellen wir plötzlich fest, daß man sie unter gewissen Umständen doch aufrechterhalten und verteidigen muß. Genauer gesagt: verteidigen können muß.
Der Appell an ein ominöses »Wir« in einem ebenso ominösen »Zusammenland« wird aber vermutlich nicht reichen, um den drohenden oder auch nur heraufbeschworenen Gefahren etwas Konkretes entgegenzusetzen. Der gehäufte Gebrauch solcher Schlüsselwörter weist auf einen plötzlich verspürten Mangel hin; je lautstärker man einander gemeinsamer Werte und Überzeugungen versichert, umso größer werden die Zweifel, ob es sie überhaupt noch gibt.
Beruhigender wirkt da allemal die Grundsteinlegung zu einer neuen Fabrik des Waffenherstellers Rheinmetall, Kanzler und Verteidigungsminister wohnten bei, das Presse-Echo in Deutschland war enorm und keineswegs kritisch, vor kurzem noch völlig undenkbar.[3] Seit einem Jahr spricht niemand mehr von »feministischer Verteidigungspolitik«, stattdessen sogar prominente Grüne von »Wehrhaftigkeit«, die man gegen die Bedrohung durch die russische Aggression entwickeln müsse, ja von »Kriegstüchtigkeit«. Selbst der Cunctator Olaf Scholz verkündete am 24.2.2024, dem zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine, »Abschreckung« müsse wieder oberstes Primat der Staatsräson werden – ein Wort, das man seit 1989 völlig vergessen hatte.
Freilich wird Abschreckung mit beschleunigter Aufrüstung allein nicht zu bewerkstelligen sein. Wehrhaftigkeit ist vor allem eine Haltung, sie beginnt beim einzelnen und nicht erst im Krieg. Gewaltbereitschaft kann man nicht, wie wir jetzt langsam auch in Deutschland begreifen, mit bloßen Argumenten entgegentreten. Man muß Gewalt abwehren können. In vielen Fällen reicht ein Kräftemessen per Imponiergehabe wie im Tierreich, danach dreht der Schwächere ab. Aber auch zu einem solchen Kräftemessen muß man erst mal willens und in der Lage sein. Während wir ein paar Jahrzehnte an einem neuen, gewaltfreien Männerbild gearbeitet haben, sehnen sich viele jetzt nach Männern – kaum je nach Frauen –, die dem Vormarsch aggressiver Männlichkeit Paroli bieten wollen, bei Konfliktsituationen im Alltag, aber auch an den Grenzen Deutschlands und der NATO.
Der Mann, der »alte Mann«, in dessen Bändigung wir so viel investiert haben, zeigt sich bereits ganz unverhohlen mit all seinen überwunden geglaubten Schrecknissen, die freilich, sofern der Kontext stimmt, zu heftig erhofften Tugenden umgedeutet werden: zum Stereotyp geronnen als böser Mann (Putin) versus guter Mann (Selenski). Der eine posiert mit nacktem Oberkörper auf dem Rücken der Pferde – in Photomontagen bezeichnenderweise auch auf dem Rücken eines Bären oder eines Killerhais –, der andre, nicht weniger viril, aber deutlich lässiger, im soldatischen Oliv, tapfer dem übermächtigen Aggressor die Stirn bietend. Schlechte Gewalt, gute Gewalt. Angriff und Eroberung versus Verteidigung des eignen Landes und der Freiheit. Beides mit demselben Impetus inszeniert, derselben Strahlkraft, derselben Botschaft: Entschlossenheit.
Auch auf unseren Straßen ist eine andere Entschlossenheit zu spüren, in unseren Gesprächsrunden, in zufälligen Bemerkungen, die ich da und dort aufschnappe. Derartige Mikro-Evidenzen sammle ich nicht nur gezielt bei der Recherche für einen neuen Roman, sondern eigentlich immer, sozusagen auf Halde. Es sind Puzzlestücke an Welterfahrung, die sich im Lauf der Zeit zu einem Bild fügen, das nicht selten von dem abweicht, was aktuell in den Medien zirkuliert. Und auch jetzt ist aus einer diffusen Ahnung, die mich vor drei, vier Jahren befiel, die Gewißheit geworden, daß wir binnen kurzem eine Renaissance überkommener männlicher Tugenden (und Untugenden) erleben werden, aus der Not geboren und von grassierender Zukunftsangst befeuert. Schon mehren sich die Stimmen, die bei den Worten »Mann« und »Männlichkeit« nicht mehr gleich »toxisch« oder »schuldig« assoziieren, die Männlichkeit nicht länger pauschal diskreditieren, sondern eine differenzierte Rückbesinnung auf das fordern, was Männlichkeit alles – auch im guten Sinne – bedeuten kann: nicht zuletzt Mut bis hin zur Bereitschaft, für den Schutz etwa der eignen Familie oder, abstrakter, der eignen Wertegemeinschaft das Leben zu riskieren.
Neue Männer braucht das Land, Verteidiger unserer Kultur und ihrer Werte. Oder besser: Menschen mit alten, traditionell den Männern zugeschriebenen Tugenden braucht das Land, welchen Geschlechts auch immer. Was keineswegs heißen soll, daß wir auch im Westen einer Renaissance der längst überwunden geglaubten Geschlechterklischees bedürfen. Daß Diversität von Geschlecht und gelesenem Geschlecht, aller öffentlichen Beschwörung zum Trotz, nicht länger als zentrales Anliegen unsrer Gesellschaft bewirtschaftet werden kann, macht das Rollenmodell einer herkömmlichen, womöglich »stereotypen«, gar machistischen Männlichkeit ja nicht plötzlich weniger problematisch.
Ja, wir brauchen Männer, die sich klassischer Rollenmuster erinnern und dennoch die neuen Interpretationen ihrer Geschlechterrolle nicht preisgeben. Also keine virilen Großsprecher, aber auch keine ideologischen Kleinsprecher. Gerade erst ist eine Zeit angebrochen, in der »Wokeness«, also Wachsamkeit gegenüber gesellschaftlichen Problemfeldern, nicht mehr im Vordergrund steht. Wenn Dogmen, die über Jahre gegolten haben, nun wieder hinterfragt werden dürfen, lassen sich womöglich neue und alte Tugenden von Männlichkeit zusammendenken.
Diese neue alte Männlichkeit wäre weiterhin emanzipiert und mit ihr der neue alte Mann, nicht zuletzt verteidigt er ja auch Errungenschaften unsrer westlichen Diskurse. Im Fall des Falles freilich – und ich meine hier nicht nur Polizisten und Berufssoldaten im Einsatz – nicht bloß mit Argumenten.
Im Fall des Falles … versuchsweise nennen wir es Zeitenwende, Epochenbruch, Systemwechsel. Noch ist es begrifflich schwer zu fassen, doch umso deutlicher zu ahnen: das Ende von etwas, der Anfang von etwas. Tag für Tag verschiebt sich unsre Gestimmtheit als Gesellschaft ein Stückchen weiter weg von der dekonstruktivistischen Euphorie der letzten Dekaden hin zur Sorge, was von unseren Werten, unseren diversen Lebensformen demnächst noch zu bewahren sein wird – bis hin zur diffusen Angst vor dem Untergang unserer Kultur.
Und damit einher geht die nächste Sorge: Eine Gesellschaft, die von Angst getrieben ist, neigt bekanntlich nicht zu demokratischen Lösungen. Ein befreundeter Handwerker erzählte mir, die älteren Bewohner seines Dorfes in Mecklenburg würden durch die Bank versichern, die Stimmung sei derzeit ähnlich derjenigen vor dem Zusammenbruch der DDR. Mein Hamburger Freund Mehmet drückte es unlängst so aus: »Der Bach geht runter.« Aber er lachte dabei, er hatte keine Angst. Müßig zu sagen, daß er einer dieser Männer ist, auf die wir uns im Fall des Falles verlassen können. Er wartet nicht einfach ab, er stimmt sich ein.
All das war 2020 noch unvorstellbar weit weg. Keiner rechnete damals mit Krieg und was er bereits als Drohkulisse für unsere Gesellschaft auslösen würde. Warum griff ich da ausgerechnet zu meiner seit Jahrzehnten gemiedenen Borges-Gesamtausgabe, warum war ich – ein anerkannter Kriegsdienstverweigerer – bald fasziniert von seinem Werk, in dem Gewalt und Krieg einen solch prominenten Platz einnehmen?
Wenn ich jetzt lese, was ich damals, unter dem unmittelbaren Lektüreeindruck stehend, geschrieben habe, frage ich mich: Lösten Borges’ Texte ähnliche Befürchtungen bei mir aus, wie ich sie 2013 im Roman »Samarkand Samarkand« als Dystopie ausbuchstabiert hatte? Als eine erste Niederschrift des vorliegenden Essays im Herbst 2020 vorlag, reagierten meine Freunde freilich ihrerseits besorgt: Ein Buch über Männlichkeit? Und das willst du heutzutage veröffentlichen? Ja bist du denn verrückt?
War man das, wenn man 2020 über Männlichkeit nachdachte? In zahlreichen meiner Bücher habe ich mich mit den wechselweisen Rollenerwartungen von Männern und Frauen und den damit verbundenen Sehnsüchten und Verzweiflungen beschäftigt. Am offensichtlichsten im »Weiberroman« samt seinem als eigenständigem Roman unter dem Titel »Ein Mann von vierzig Jahren« erschienenen vierten Teil. Oder in »Weißer Mann – was nun?«, einem Essay, der schon im Jahr 2005 unsre Erwartungen an Männer mit jenen kontrastierte, wie sie in anderen Weltgegenden herrschen. Zuletzt 2023 im Äthiopienroman »Alles wird gut – Chronik eines angekündigten Todes«, in dem das Scheitern einer Liebe ganz maßgeblich in den inkompatiblen Vorstellungen vom jeweils anderen Geschlecht gründet.
Inzwischen sehe ich, daß meine Borges-Lektüre und der Text über Männlichkeit, der daraus entstand, auch eine Vorstudie zu ebenjenem Roman war. Und ich frage mich, ob damals schon der richtige Zeitpunkt für eine Veröffentlichung gewesen wäre oder ob der Text jetzt besser paßt, da sich das gesellschaftliche Klima so dramatisch verändert hat.
Seit Jahrzehnten vermarktet man Borges als versponnenen Weltenbauer, als blinden Seher inmitten einer sich ins Unendliche dehnenden Bibliothek, als magischen Realisten weit jenseits der Niederungen konventioneller Plots und gar solcher über männliche Gewalt. Ich begann zu lesen und war bald regelrecht wie vor den Kopf geschlagen – also begeistert? Oder doch eher abgestoßen? Jedenfalls verwirrt, daß hinter dem eifrig kolportierten Vorzeigeintellektuellen ein ganz anderer Borges verborgen ist, ein eminenter (Möchtegern-)Macho, vor dessen literarischem Personal man Angst bekommen kann. Angst, weil seine Protagonisten einer Männlichkeit huldigen, gegen die sich einer wie ich in der realen Welt kaum würde zur Wehr setzen können: Messerstecher, Mörder, Eroberer, Krieger.
Irgendwann wurde ich den Verdacht nicht mehr los, daß man diesen Borges aus dem kulturellen Diskurs gehalten und fast schon aus dem kulturellen Gedächtnis getilgt hatte, weil der versponnen scharfsinnige und nahezu geschlechtslos anmutende Borges – den es zweifellos gibt – viel besser zu unsrer Zeit paßte. Auch andere Schriftsteller haben sich mit einem archaischen Männerbild auseinandergesetzt und nicht selten entsprechend gelebt. Daß sich ausgerechnet ein Feingeist wie Borges nicht etwa kritisch damit beschäftigte, sondern dafür begeisterte und in unzähligen Texten daran abarbeitete, das ließ sich mit seiner filigranen Intellektualität immerhin so perfekt kaschieren, daß es auch nicht im entferntesten in sein Image einfloß.
»Ehre« und »Mut«, ausgerechnet bei Jorge Luis Borges habe ich diese beiden Begriffe wiederentdeckt, nachdem ich sie jahrzehntelang zwar nicht völlig vergessen, jedoch allenfalls im Stillen als Handlungsmotiv erwogen hatte. Nämlich solange ich in deutschen Debatten und Befindlichkeiten verortet war. Sobald ich Europa hinter mir gelassen hatte, wurden Ehre und Mut schlagartig wieder von mir gefordert, anders wäre ich gar nicht ernstgenommen worden und mitunter auch nicht unbehelligt geblieben.
Früher hatte ich meine männliche Identität einfach mit den Kontinenten gewechselt, so war ich da wie dort bestens klargekommen. Herausgefordert durch Borges, wollte ich endlich für mich und in mir selbst zusammenbringen, was ja vielleicht zusammengehört: den »neuen Mann«, der ich als Teil des großstädtischen Akademikermilieus seit Studententagen bin, und den traditionellen »alten Mann«, der ich in der Karibik, in Südamerika, Afrika, Zentralasien und erst recht im arabischen Raum sein muß. Ich wollte eine, meine Vorstellung von Männlichkeit gewinnen, die sowohl im mitteleuropäischen Kontext funktioniert als auch in jedwedem »härteren« Winkel der Welt.
Es lief nicht auf ein Entweder-oder hinaus, sondern auf ein Sowohl-als-auch, auf eine Melange von Tugenden und Untugenden »alter« und »neuer« Männlichkeit bei wechselnder Akzentuierung je nach Gegebenheit. Denn davon will ich auch in postwoken Zeiten nicht lassen, von einem spielerischen Verständnis von Männlichkeit, das über eine Bandbreite an Männlichkeiten verfügt einschließlich einer etwas breitbeinigeren, die man einnimmt, um nicht verlacht oder vermöbelt zu werden. Und um schon in der nächsten Sekunde über sich selbst den Kopf zu schütteln, weil das geläuterte Selbstverständnis als Mann wieder die Oberhand gewinnt.
Es geht mir um das Umkreisen einer Mitte, die kein fest fixiertes Zentrum hat und dennoch das Gegenteil von beliebig ist. Einer Mitte, in der die Tugenden herkömmlicher wie neuer Männlichkeit(en) – also etwa Mut und Empathie – als beständig changierende Schnittmenge zusammenfinden und einander die Waage halten, auf daß sie sich nicht vereinseitigen und zu Untugenden radikalisieren. Bis aufs erste glaube ich zu wissen: Auch ich selbst will kein »neuer Mann« mehr sein, sondern ein »alter neuer«, wahlweise ein »neuer alter Mann«.
Der Versuchung, das Buch aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen noch einmal neu zu schreiben, habe ich widerstanden. Und auch derjenigen, etwa durch nochmalige Lektüre von Klaus Theweleits »Männerphantasien« mein Thema als einen wissenschaftlichen Forschungsgegenstand zu begreifen und abzusichern. Schon erscheinen in den Medien erste Artikel über die sich wandelnde Wahrnehmung von Männern, doch auch in dieser Hinsicht habe ich darauf verzichtet, nachträglich Verbündete für meine Thesen in den Text einzuarbeiten. Denn de facto war ich während der Niederschrift allein.
MP, 10/6/24
Kühn
Beginnen wir mit Hemingway, denn er gilt, anders als Borges, von jeher als Macho. Als ich ihn das erste Mal las, war ich enttäuscht. Ich war Anfang zwanzig und stand auf Gedichte von Brentano und die Dramolette des jungen Hofmannsthal. Ein Text wie »Der alte Mann und das Meer«, der bewußt ganz einfach daherkommt, konnte meinen schwärmerischen Geist nicht berühren. Ich wußte damals noch kaum zwischen den Zeilen zu lesen und liebte Texte, die expressis verbis viel zu bieten hatten, die Satz für Satz funkelten oder zumindest leuchteten. Es zog mich dann weiter zur expressionistischen Lyrik, zu Mallarmé, Laurence Sterne und wie sie alle hießen.
Vielleicht war ich schlichtweg zu jung für Hemingway gewesen, ein romantischer Träumer, der reichlich abgehoben von der wirklichen Wirklichkeit einer Vision vom absoluten Text hinterherschrieb.
Als ich Jahrzehnte später wieder zu Hemingway fand, konnte ich seine Komplexität unter scheinbar simpler Textoberfläche schon besser begreifen. 1987 hatte ich meinen ersten Roman veröffentlicht, »Aus Fälle/Zerlegung des Regenbogens«, die Presse sah ihn einhellig in der Tradition von Joyce und Arno Schmidt. Was als Lob gemeint war, machte mich eher mißtrauisch, schließlich hatte ich von beiden Autoren keine Zeile gelesen. Als ich es dann tat, um zu sehen, was an dem Vergleich dran sein mochte, war ich verstimmt. Nein, in dieser Ecke der Literatur wollte ich mich nicht sehen! Vielleicht war es auch das, was mich Anfang der neunziger Jahre weglockte von den aufwendig bearbeiteten Textoberflächen – all dem Glitzernden, das man leichthin als »experimentell« oder »avantgardistisch« bezeichnet –, hin zum realistischen Erzählen. Und im Lauf der Jahre immer weiter in Richtung eines »Relevanten Realismus«, wie ich ihn 2005, zusammen mit drei Schriftstellerkollegen, in einer gemeinsamen Standortbestimmung nannte.[4]
Da kam Hemingway nur allzu recht. Vor allem seine Romane verschlang ich, er prägte mein Verständnis von gut geschriebener Literatur radikal um. Gut nämlich nicht nur für den Autor, sondern auch für den Leser. Gleichzeitig haderte ich mit ihm; was ich über sein Leben in Erfahrung gebracht hatte, stieß mich eher ab. Zog mich insgeheim jedoch auch wieder an. Es lag etwas in diesem Leben, nach dem ich mich ebenfalls sehnte, es schmeckte nach Abenteuer und Gefahr. Selbst wenn es um Leben und Tod und Töten ging, schreckte ich zumindest als Leser nicht davor zurück, ihm zu folgen.
1997 veröffentlichte ich den »Weiberroman«, der nicht selten als Männerroman rezensiert wurde. Das war damals durchwegs positiv gemeint. Gregor Schattschneider, die Hauptfigur, ist natürlich kein Macho. Er entspricht eher dem (überforderten) deutschen Durchschnittsmann, der an den Ansprüchen seiner wechselnden Partnerinnen, aber auch des Lebens, immer wieder scheitert.
Im Roman »Herr der Hörner« (2005) scheitert ein Hamburger Banker, diesmal im kubanischen Oriente – der exemplarische Untergang des weißen Mannes in einer Welt, deren rätselhafte Grausamkeit er immer weniger begreift. Im Roman »Samarkand Samarkand« (2013) ist die Hauptfigur zwar deutlich robuster, ein ehemaliger Gebirgsjäger, aber ob er seinen Weg durchs zentralasiatische Hochgebirge wirklich überlebt, bleibt am Ende offen.
Durch eine ganze Reihe meiner Veröffentlichungen, so scheint es mir im Rückblick, zieht sich das Thema Männlichkeit. Und natürlich auch durch mein Leben. Das wurde mir in den letzten Jahren durchaus schmerzhaft bewußt, als die Debatte um die »alten weißen Männer« von den USA nach Europa überschwappte und Männlichkeit plötzlich als Problem per se gesehen wurde. Mittlerweile hatte ich selber ein paar Abenteuer überstanden, vor allem in Asien und Afrika, und einige davon um Haaresbreite. Ganz zwangsläufig entwickelte ich ein Gespür dafür, daß ich in den richtig aufregenden Ecken der Welt besser nur mit Freunden unterwegs war, die auch mal etwas holzschnittartiger auftreten konnten, bestimmter im Ton, klarer in der Sache und dennoch alles andere als großmäulig und platt. Sondern eher entspannt und, wann immer möglich, mit Humor. Wenn man diese Rolle nicht einnehmen kann, muß man sie spielen; eine dritte Option, mit Würde zu bestehen, gibt es dort nicht. Vielleicht ist ja gerade das spielerische Moment nicht unwichtig, wenn es um ein neues Verständnis von Männlichkeit geht, das dem alten, latent gewaltbereiten Rollenmodell in der direkten Auseinandersetzung ebenbürtig entgegentreten kann?
Ob gespielt oder nicht, die wiederkehrende Erfahrung, daß man auf bestimmten Reisen eine andere Körperhaltung braucht als zu Hause und eine andere Art zu reden, hat auch Auswirkungen darauf, wie man schreibt. Vor allem, wenn man einen Großteil der Sätze bereits vor Ort notiert und nicht in der geschützten Komfortzone des eignen Arbeitszimmers.
Männlichkeit, ein großes Thema, das mich bis heute nie anhaltend interessiert und offensichtlich doch ein Leben lang beschäftigt hat, zumindest immer wieder. Darüber jetzt zu schreiben – und über eine Spielart von Männlichkeit, die mittlerweile in Verruf geraten ist –, mag angesichts des herrschenden Zeitgeists kühn, um nicht zu sagen: vermessen sein.
Und das ausgerechnet deshalb, weil ich Borges gelesen habe.
Um anschließend ein weiteres Mal Hemingway zu lesen.
Und schließlich mit mir selbst ins Gericht zu gehen und mich zu befragen, was mir »Männlichkeit« all die Jahre bedeutet haben mag und heute bedeutet. Ein wie auch immer forciertes Rollenverhalten, um einen Status zu beanspruchen oder gar um Macht zu demonstrieren, da bin ich mir sicher, bedeutet es mir nicht. Es geht mir nicht um Imponiergehabe, Gewaltausübung, Machismo oder jede andere Form einer explizit zur Schau gestellten Männlichkeit auf Kosten anderer. Daß ich all diese meist primitiv, mitunter auch ziemlich raffiniert inszenierten Zerrbilder von Männlichkeit ablehne, versteht sich von selbst. Es geht mir um eine Männlichkeit, mit der ich mich – um hier wenigstens schon mal diesen Aspekt anzusprechen – in der Lage weiß, im Fall des Falles auch außerhalb der eignen intellektuellen Filterblase zu bestehen, ohne daß ich dabei meine Einstellungen verrate.
Es geht mir um eine angemessene, vielleicht nur mir auf diese Weise angemessene Männlichkeit. Eine, die ich ganz unabhängig von anderen immer spätestens dann erneut anstrebe, wenn ich in einer mir fremden, eher unwirschen Umgebung etwas suche, das ich in meinem Alltag nicht bekomme. Das kann schon in einem entlegeneren Viertel meiner Heimatstadt sein, in dem ich die guten Wege nicht kenne und die Spielregeln, die dort herrschen. Es geht mir darum, daß ich mich – selbst angesichts von Konfrontationen, wie sie in gewissen Konstellationen manchmal unvermeidbar sind – wohl fühlen kann in meiner Haut. Und in meiner Haltung.
Warum gelingt mir das in der Fremde eher als daheim? Ob es damit zusammenhängt, daß es im Verlauf der letzten Jahrzehnte zunehmend schwerer geworden ist, sich als Mann zu begreifen, in schlichter Gegenüberstellung zum Weiblichen als dem »anderen«? Für den, der sich den Postulaten der Gender Studies nicht von vornherein verschließt, sind Geschlechtergrenzen durchlässig geworden, sind klassische Geschlechterrollen zur Disposition gestellt und durch eine Unzahl weiterer Zuschreibungen, Lesarten, Optionen ergänzt worden. Das, was als Jugendlicher verwirrend war und im Lauf des Lebens überraschend einfach wurde, nun ist es erneut verwirrend geworden. Im Hinblick auf wen oder was kann ich mich je wieder so selbstverständlich als Mann begreifen wie vor fünfzig Jahren, als ich es schlagartig tat, nur weil ich zum ersten Mal in ein Mädchen verliebt war?
Anscheinend kann ich es, und sogar regelmäßig aufs neue, im Hinblick auf das andere, wie es die Fremde nach wie vor bietet – zumindest in den Gegenden, die von der Globalisierung bislang weitgehend verschont blieben.
Es geht mir um eine Männlichkeit, in der ich mich, zurück zu Hause, wieder eine Weile so wohl fühle wie in einem perfekt geschnittenen Anzug: den ich gar nicht spüre und der also nicht weiter der Rede wert ist.
Ausgerechnet Borges hat mir in dieser Hinsicht die Augen geöffnet. Ganz sicher nicht, weil er mir aus der Seele gesprochen hätte! Im Gegenteil. Die Männlichkeit, die er in seinen Texten darstellt, ist vielleicht das Extremste, was ich diesbezüglich – nicht etwa nur in der Literatur, sondern auch in der Welt, die extremsten Ecken eingeschlossen – kennengelernt habe. Ich werde mich bemühen, sie im Folgenden aus den Quellen heraus darzustellen. Der Standpunkt, den ich selber einnehme, wird sich en passant verdeutlichen, indem ich mich an Borges abarbeite, als Leser, als Schriftsteller und, aber ja, als Mann. Ich frage mich, ob all jene, die seinen Namen rühmen, überhaupt ahnen, was ihn hinter seiner weltfremd versponnenen Fassade wirklich umtrieb. Denn so viel sei schon hier gesagt: Ein »alter weißer Mann« war auch er – oder wär’s zumindest verdammt gern gewesen.
Barockes Erzählen, direktes Erzählen
Jorge Luis Borges hatte ich schon seit 1999 im Visier, als ich, im Vertrauen auf den großen Namen des Verfassers, gleich eine Gesamtausgabe in zwölf Bänden subskribierte.[5] Jedesmal, wenn ein neuer Band erschien, las ich ihn voll Neugier an, um nur immer wieder zum selben Ergebnis zu kommen: Oje, warum hatte ich mir ausgerechnet den verordnen wollen und dann gleich als Gesamtpaket?
Zwanzig Jahre lang hatte ich einen Bogen um ihn gemacht; nun wollte ich mich der Sache stellen. Ich nahm mir den ersten Band von Borges’ Erzählungen aus dem Regal und war entschlossen, die Sache durchzuziehen.
Borges gilt als einer der größten Intellektuellen des 20. Jahrhunderts und als Erfinder des magischen Realismus. Man kennt ihn als Bewohner von Bibliotheken, der noch als Blinder nicht von Büchern lassen konnte. Er lebte in der Literatur, von der Literatur, für die Literatur, und ansonsten den größten Teil seines Lebens bei seiner Mutter, die ihn bis zu ihrem Tod im Alter von 99 Jahren versorgte. Zu lesen begann er angeblich mit vier, recht bald die Werke der Weltliteratur, zu schreiben mit sechs. Als Sechsjähriger verkündete er seinen Eltern auch schon, daß er Schriftsteller werden wolle.[6] Seine erste Veröffentlichung war die Übersetzung eines Oscar-Wilde-Gedichts ins Spanische, da war er gerade mal neun,[7] sein erstes eigenes Gedicht publizierte er mit zwanzig.[8] Was für ein überprallvoll gesegnetes, was für ein beklemmend einseitiges Leben schon in diesen frühen Jahren!
Und so blieb es dann mehr oder weniger, bis er sich mit 86 Jahren zum Sterben nach Genf zurückzog.
Das ist nicht polemisch gemeint. Der reife Borges urteilte weit drastischer: »Leben und Tod haben meinem Leben gefehlt. Dieser Armut ist meine beflissene Liebe zu diesen Spitzfindigkeiten entsprungen.«[9] Mit »diesen Spitzfindigkeiten« meint er seine essayistischen Untersuchungen, er hätte es auch über sein Gesamtwerk sagen können. Ausgerechnet der Mangel an Leben ist es und wie er ihn literarisch kompensiert, der mich bei meiner Lektüre später in Bann schlagen wird.
Soweit meine vage Ahnung, was und wer Borges sein könnte. Dann schlage ich den ersten Band seiner Erzählungen auf und beginne … nicht ganz vorne, sondern gleich mit einem seiner berühmtesten Werke, ich will ihn von Anfang an auf maximaler Flughöhe erleben: »Fiktionen«, erschienen 1941/44. Das von Borges anläßlich der Gesamtausgabe von 1954 verfaßte Vorwort dazu ist kokett, um nicht zu sagen: eitel. Es fährt gleich eine These wie ein schweres Geschütz auf:
»Ein mühseliger und strapazierender Unsinn ist es, dicke Bücher zu verfassen […]. Ein besseres Verfahren ist es, so zu tun, als gäbe es diese Bücher bereits, und ein Résumé, einen Kommentar vorzulegen.«[10]
Hier erklärt ein weltberühmter Erzähler, daß er nicht eigentlich erzählen, sondern – »aus größerer Gewitztheit, größerer Unbegabtheit, größerer Faulheit«[11] – dem Leser lediglich Zusammenfassungen von Erzählungen präsentieren wird. Fürs »eigentliche« Erzählen hält er sich zu intelligent, vor allem aber gar nicht befähigt;[12] er verspricht, das ästhetisch-sinnliche Defizit durch intellektuellen Surplus wettzumachen. Aus seinen Quellen macht er kein Hehl, ausgerechnet eine seiner bekanntesten Erzählungen, »Die Bibliothek von Babel«, will er nur aus verschiedenen Vorlagen und Anregungen kompiliert und komprimiert haben. Oder leitet er seine Leser hier schon in die Irre, beginnt das Labyrinth seiner Texte bereits im Vorwort?
Ich habe selber lange gebraucht, um zum direkten Erzählen zu finden. Zum Erzählen um des zu Erzählenden willen. Die Wendung vom direkten Erzählen beziehungsweise von der direkten Erzählung stammt von Borges,[13] andernorts spricht er von »richtigen«, »wirklichen«, »gültigen Erzählungen«, von »einfache[n], unmittelbare[n] Geschichten«,[14] zu denen er sich erst spät, Mitte dreißig, und »mühsam« hingearbeitet habe.[15]
Sämtliche dieser Äußerungen sind gegen sein Frühwerk gerichtet. Er kaufte Exemplare seiner ersten Veröffentlichungen, wo immer er sie entdeckte, um sie dann zu verbrennen.[16] Selbst an den (frühen) Texten, die er später in die Gesamtausgabe aufnahm, moniert er den »barocken Stil«, »der seine Möglichkeiten ausschöpft«, »zur Schau stellt und verschleudert«.[17]
Vernichtender noch sein knappes Eingeständnis: »Der Barockismus ist intellektuell.«[18] Sofern Intellektualität ein Einwand ist – weil sie vom direkten Erzählen abhält –, gilt er im Fall von Borges fürs Gesamtwerk, also selbst dann noch, als er von »stilistischem Barock« auf den elegant kühlen Stil umgeschaltet hatte, für den er zu Recht berühmt wurde. Hinter den frühen wie den späten Texten steht derselbe intellektuelle »Macher«, als der er sich – so der Titel einer seiner Gedichtbände[19] – begriff.
Es gibt jedoch einige bemerkenswerte Ausnahmen, auf die ich gleich zu sprechen komme, frappierende Ausnahmen, von denen man vermuten könnte, ein ganz anderer Borges hätte sie geschrieben. Es sind genau diese Ausnahmen, die mich begeistern. Die gängige Borges-Rezeption hat bisher seine intellektuellen, die nicht direkt erzählten Erzählungen in den Fokus gerückt. Vielleicht weil sie interessanter sind für Intellektuelle, deren Erfahrungshorizont von den verschieden hoch aufzackenden Spitzen der internationalen Gipfelliteratur bestimmt wird.
Ich will das eine nicht gegen das andre ausspielen, erinnere nur noch mal daran, daß Borges’ intellektuelle Erzählungen für ihn selbst keine gültigen Erzählungen sind. Sondern etwas, das er rückblickend als »Unsinn und Pseudo-Essays« abtut, als »Mittelding zwischen Essay und richtiger Erzählung«.[20]
Auch ich distanzierte mich von der Artistik meines Frühwerks, sobald ich den Reiz – und die Schwierigkeit – des direkten Erzählens erkannt hatte. Wo sich Borges ein Vergnügen daraus gemacht hatte, »Geschichten anderer zurechtzustutzen und zu verdrehen«,[21] hatte ich das meine vor allem in rhythmischer Lyrifizierung der Satzperioden gefunden, die mit Musik wetteifern wollte. Ich war der Sprache verfallen gewesen, nicht den Inhalten – eine nicht minder hochmütige Haltung, weit entfernt von der Demut des tatsächlichen Erzählers vor seinem Stoff. Ganz gewiß hatte ich in meiner Selbstberauschung am schieren Sound ebenso gewaltig übertrieben wie der junge Borges in der seinen, sich mit Hilfe von »Gewitztheit« beim Schreiben zu unterhalten.[22] Leser bekommt man auf diese Weise nicht.
Borges jedenfalls bekam sie (außerhalb eines elitären Zirkels Gleichgesinnter) lange nicht. Zum direkten Erzählen fand er spät und – möchte ich ergänzen, nachdem ich alle seine Erzählungen gelesen habe – nur dann, wenn er sich an seinem Lebensthema abarbeitete. Leser bekommt man lediglich, sofern man sie ernst nimmt, als gleichrangige Partner beim Erzählen. Borges war vielleicht der Leser par excellence, gelegentlich stellte er Lesen – als die intellektuellere Tätigkeit – sogar übers Schreiben.[23] Seine enorme Belesenheit ist fast immer präsent in seiner Literatur, doch in dem Maße, in dem sich der Leser Borges in seinen Texten ausbreitet, verliert der Schriftsteller Borges – jedenfalls für einen Leser wie mich.
Die Erkenntnis, daß man erst Schriftsteller ist, wenn man für ein Lesepublikum schreibt, und daß alles andere unter Fleiß- und Vorarbeit fällt, durchaus vonnöten und eine feine Schule des Stilisten, diese Erkenntnis entschlackt jeden Text ungemein. Und macht ihn schnell: Man will den Stoff, den man früher mitsamt allen Nebensträngen als fortwährendes Feuerwerk an Formulierungen und Reflexionen präsentiert hätte, in maximalem Tempo »runtererzählen«, will Stoff und Form zur Deckung bringen, so daß der Leser gespannt dem Plot zu folgen glaubt, während er tatsächlich vom Rhythmus der Satzperioden vorangetrieben wird.
Ähnlich Hemingway, der »rhetorische Schriftsteller« ablehnt, in deren Texten das Wissen um die »wirklichen Dinge« »von Rhetorik eingehüllt [ist] wie Rosinen im Kuchenteig«. »Naturalistische Schriftsteller« hingegen wie er selbst seien immer gut, »wenn sie außergewöhnlich exakt und unliterarisch sind«. Wenn sie sich strikt auf den Stoff konzentrieren und sich jeden gedanklichen oder stilistischen Schlenker verkneifen: »Ganz gleichgültig, wie gut ein Satz oder ein Gleichnis ist, das er [der Schriftsteller] parat hat, wenn er es einfügt, wo es nicht absolut notwendig und unersetzbar ist, verdirbt er seine Arbeit durch Selbstgefälligkeit.«[24] Eine solche Prosa »ohne Tricks und Schwindel« zu schreiben, sei »viel schwieriger als Poesie«.[25]
Die Komplexität des Textes, die man bis dahin virtuos an der Oberfläche ausgestellt hat, wird dabei in seine Tiefe verlagert. Das klingt einfach und ist doch ziemlich schwer. Jedenfalls funktioniert direktes Erzählen meiner Meinung nach auf diese Weise; und wenn mir jemand gleich im Vorwort eröffnet, daß er gar nicht erzählen will und daß das, was er hier als Sammlung zusammengestellt hat, entsprechend barock und also alles andere als direkt erzählt ist, dann … bin ich im Rückblick froh, daß sein Urteil allzu pauschal war. In seinen besten Erzählungen ist Borges verdammt schnell. Und verdammt unintellektuell, ungewitzt, unbarock. Nämlich immer da, wo besagter Mangel literarisch verarbeitet und kompensiert wird.
Der Mangel an Leben.
Der Mangel an Leben, wie es ein Mann in Borges’ Vorstellung hätte führen müssen.
Der Mangel an Männlichkeit.
»Das kraftvolle Mischblut«
Die erste Erzählung der »Fiktionen« heißt … Oje, sie heißt »Tlön, Uqbar, Orbis Tertius«. Und sie macht ihrem sperrigen Titel alle Ehre. Es geht um das Eindringen einer fiktiven in die reale Welt und deren schrittweise Verwandlung, weiß Gott ein aufregendes Thema, und ein Ray Bradbury, beispielsweise, hat es auch aufregend erzählt.[26]