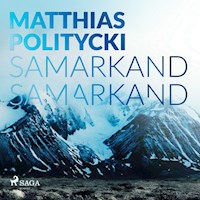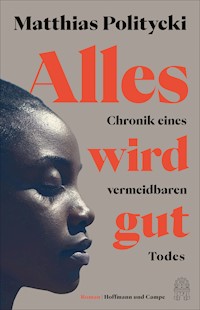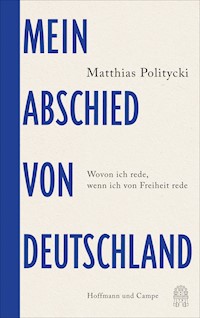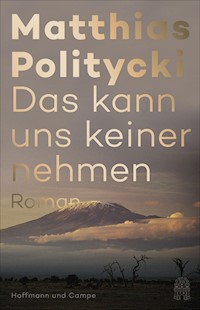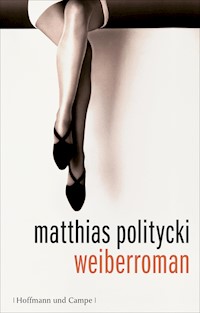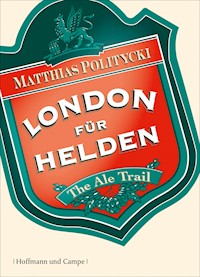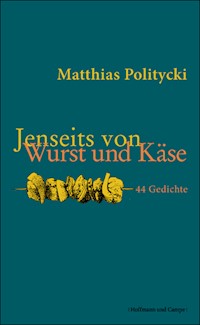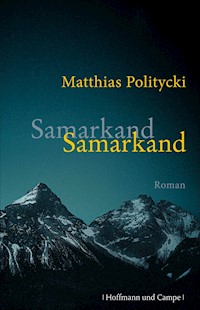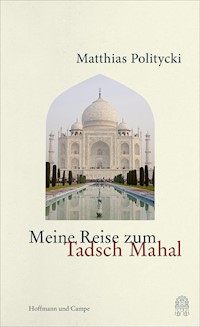
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Matthias Politycki zum ersten Mal vor dem Tadsch Mahal steht, meint er, das schönste Gebäude der Welt zu sehen. Er begibt sich auf eine weitere Reise zum Tadsch Mahal, um dem Geheimnis näher zu kommen, das auch der Touristentrubel nicht zu zerstören vermag. Welche Abenteuer werden riskiert, um am Ende wieder mit dem Glück des reinen Anblicks beschenkt zu werden? Zusammen mit seinem indischen Freund Sanjay reist Politycki weit hinter die Kulissen Indiens. Sie erkunden die Straßenimbisse im Basar und der Maharadscha-Palast, aber auch die Besuche beim Barbar und den winzigen Werkstätten der Marmorschneider sind Teil der Entdeckungsreise. Diese Annäherungen an den indischen Alltag lassen den großen Horizont entstehen, vor dem das Tadsch Mahal erst wirklich sichtbar wird. Es wird auch die berühmte Geschichte der romantischen Liebe erzählt, die sich darum rankt – neu und anders, als man sie bislang kennt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Matthias Politycki
Meine Reise zum Tadsch Mahal
Hoffmann und Campe
Unzählige Male reiste ich zum Tadsch Mahal. Anfangs am Tag, bald auch des Nachts, ich stand nach dem Zubettgehen einfach wieder auf und puzzelte weiter. Genauso oft fuhr ich in diesen Nächten nach Paris und New York, doch das waren für mich nur Zwischenstationen. Immer schüttete ich alle drei Puzzles auf dem Teppichboden zusammen, das ergab einen Haufen von 1500 Teilen. Die Straßenszene in Saint-Germain und die Wolkenkratzer von Manhattan wuchsen im Schein einer kleinen Leselampe zwar ebenso schnell oder langsam heran, aber mein Eifer galt allein dem Tadsch Mahal. Ich fand es so unvorstellbar schön, daß ich mir nicht ganz sicher war, ob es tatsächlich existierte. Allenfalls als Luftschloß oder so weit weg, daß man nicht mit dem Zug oder Flugzeug hinkommen konnte, sondern bloß durch Träumen.
Genau besehen träumte ich nicht mal. Ich puzzelte nur, von einer fieberhaften Rastlosigkeit getrieben, mit halbem Ohr auf Geräusche lauschend. Die Holztreppe, die in den ersten Stock unsres Hauses hochführte, knackte bei jedem Schritt, ich kannte ihre Stufen und wußte, wann ich das Licht ausschalten mußte. Dann saß ich eine Weile im Dunkeln, ließ meine Eltern passieren, wartete sicherheitshalber, bis sie aus dem Bad und endgültig im Schlafzimmer waren. Augenblicklich ging es genau dort weiter, wo ich unterbrochen hatte, mit derselben unermüdlichen Zielstrebigkeit. Erst wenn das letzte Teil seinen Platz gefunden hatte – irgendein Stück des wolkenlos blauen Himmels überm Tadsch, der stets bis zum Schluß übrigblieb –, erst wenn Kuppeln und Minarette und auch der strahlende Himmel darüber in voller Pracht auf dem Teppich vor mir lagen, kam ich zur Ruhe.
Wenn man gelegentlich hört, daß die Kindheit ein Paradies sei, dann denke ich an jene Momente, da alles als getan gelten durfte und erneut in seiner unglaublichen Schönheit bestätigt: Ich regte mich nicht mehr, dachte nichts, wollte nichts, vermißte nichts, war einfach nur da. Und schaute hin.
Als ich 1997 zum ersten Mal nach Indien aufbrach, beschränkte ich mich auf den Süden, vielleicht wollte ich das Tadsch sogar bewußt vermeiden. »Die meisten großen Enttäuschungen im Leben beginnen mit einem Traum«, schreibt Paul Theroux. Indem ich meinen Traum nicht gleich bei der ersten Gelegenheit an der Realität überprüfte, konnte ich ihn weiterträumen – und zunächst, so redete ich mir ein, die Rahmenbedingungen des Traums kennenlernen: den indischen Alltag. Über den in meiner Jugend derart wilde Gerüchte kursierten, daß ich dann fast erleichtert war, wie normal und mitunter geradezu beschaulich es in Südindien tatsächlich zuging.
Der Weg zu unserm Sehnsuchtsort ist nicht selten eine Aneinanderreihung von Umwegen. Manchmal sind sie so voller überraschender Wendungen und neuer Verlockungen, daß ein Leben nicht ausreicht, unsern Ort zu erreichen. Immer sind sie – auch – voller Enttäuschungen; irgendwann glaubt man, gegen jede weitere Enttäuschung auf Reisen gewappnet zu sein. Dann ist es höchste Zeit, sich seinem Traum zu stellen, will man ihn nicht nur noch als Zyniker erleben. Ich war fünfzig, als ich im Juli 2005 endlich zu einer Reise nach Nordindien aufbrach, als deren abschließender Höhepunkt das Tadsch Mahal eingeplant war. Rajasthan entpuppte sich schnell als ein ganz anderes und weit anstrengenderes Land als Kerala und Tamil Nadu im Süden; ein Glas Bananen-Lassi oder gesalzener Limonensaft ab und an reichte nicht aus, um sich davon zu erholen. In Mandawa waren die Straßen vor den alten Havelis vom Monsun überschwemmt, nachts schrien Pfaue. Die Straße nach Bikaner verschwand immer wieder unter Sandverwehungen. Im Rattentempel von Deshnok herrschte ein unglaubliches Gewusel um die Milchschalen, die von den Pilgern permanent neu aufgefüllt wurden. Und plötzlich war Schluß, ich mußte die Reise abbrechen und so schnell wie möglich heim.
Erst im April 2007 kam ich in Agra an. Es war der absurdeste Kurztrip meines Lebens. Im Rahmen eines dreitägigen Ausflugs, der während meiner Fahrt als Writer-in-non-residence auf der MS Europa angeboten wurde, flogen wir von Cochin nach Delhi, nahmen frühmorgens den Zug nach Agra, hatten zwei Stunden Zeit fürs Tadsch Mahal, fuhren zurück nach Delhi und anderntags weiter nach Bombay, um wieder an Bord unsres Schiffes zu gehen. Welch ein Aufwand an Geld, Zeit und Organisation für so wenig Tadsch Mahal, könnte man meinen. Natürlich wäre ich unter normalen Umständen niemals auf diese Weise gereist. Doch die Umstände auf einer Kreuzfahrt sind nicht immer normal. Und gerade deshalb kam ich nun dorthin, wohin ich es in eigner Regie nie geschafft hatte.
Als ich das Tadsch, das real existierende Tadsch, zum ersten Mal sah, wußte ich fast nichts von seiner Bau- noch von der Liebesgeschichte, die es erzählt. Wie vor Jahrzehnten als Kind sah ich nur einfach hin. Sah mit der Gier dessen, der sich den Anblick so tief wie möglich einprägen möchte, weil er bereits innerhalb eines Sekundenbruchteils überzeugt ist, den Rest seines Lebens keinen vergleichbaren Anblick zu erhaschen. Das weitläufige Geviert des Gartens – an seinem Ende silhouettenhaft das Mausoleum mit seinen Kuppeln und Minaretten, als wäre es auch in Wirklichkeit ein bloßes Bild ohne konkrete Tiefendimension – lag so selbstverständlich vor mir, als hätte es hier seit Ewigkeit auf mich gewartet, ein letztes auf Erden verbliebenes Stück vom Paradies.
Ich empfand alles andre als interesseloses Wohlgefallen. Nie zuvor hatte ich ein dermaßen weißes, ein dermaßen reines Gebäude gesehen. Es hätte mich nicht gewundert, wenn es sich vor meinen Augen von allem Irdischen gelöst und in den Himmel emporgehoben hätte, es war ohnehin nicht von dieser Welt. Irgendwann wurde mir bewußt, daß mir die Zeit davonlief, wenn ich mehr davon sehen wollte als das, was ich als Kind gesehen hatte. Sogleich wurde ich vom versunken Schauenden zum Getriebenen, wollte schnell noch jede seiner Marmorplatten berühren, über jedes seiner Blumenornamente streichen, um mich ihrer zu versichern. Schließlich rannte ich kreuz und quer durch den Garten, um nur ja keine Perspektive zu versäumen.
Das Schöne überzeugt auch den, der keinerlei ästhetische Kriterien an der Hand hat. Es wirkt unmittelbar auf die Anschauung, zwingt zur Bewunderung, ehe der Geist mit dem sukzessiven Begreifen beginnt. Selbst für einen wie mich, der ohne jede Vorbereitung den Abstecher zum Tadsch Mahal gemacht hatte, war es auf den ersten Blick in seiner Bedeutung zu erkennen. Der Traum, den ich seit meiner Kindheit geträumt hatte, war in Erfüllung gegangen. Enttäuscht wurde ich dabei nicht, im Gegenteil: Das konkrete Tadsch schlug sämtliche Fotos, die ich im Verlauf der Jahrzehnte zu sehen bekommen hatte, schlug sie um Längen – sogar dasjenige, das ich beim Puzzeln so verehrt hatte. Schon auf der Rückfahrt nach Delhi glaubte ich, nichts Geringeres als das schönste Gebäude der Welt gesehen zu haben.
Als ich zehn Jahre später erneut aufbreche, will ich es anders machen, besser machen, will auf meinen Sehnsuchtsort vorbereitet sein. Noch in Deutschland frage ich jeden, den ich treffe, nach seiner Meinung zum Tadsch, und obwohl es in meinem Bekanntenkreis kaum einer aus eigner Anschauung kennt, hat fast jeder sofort ein Leuchten in den Augen: Es sei ein heiliger Ort trotz aller Touristen, in seiner Vollendung habe es sich vom menschlichen Schaffensakt gelöst. Was so vollkommen symmetrisch sei wie das Tadsch, habe immer recht. Der bloße Anblick stimuliere die Phantasie mehr als alles, was man darüber schreiben könne. Schon allein sein Name sei ein Gedicht, ein Gedicht auf die Liebe.
Erstaunlich viele kennen das Tadsch vom Puzzeln. Und zwar ausnahmslos in ebenjener Frontalansicht, die auch mich in den Bann schlug. Als ob es von seinem Architekten vornehmlich wegen dieses ersten Anblicks erbaut wurde, der sich nach dem Passieren des Südtores wie ein Phantasiegebilde aus 1001 Nacht zeigt: sechs, acht, zwölf, 16 oder 22 Jahre Bauzeit, je nach Quelle, für diesen einen Moment. Gehört der Anblick, ob als Puzzlemotiv oder mittlerweile als Bildertapete im Netz, zum kollektiven Gedächtnis der Menschheit? Ist das Tadsch Mahal vielleicht ein Archetypus ästhetischer Erfahrung?
Oh ja, Spaßvögel gibt es bei meiner kleinen Rundfrage auch. Der eine findet Schloß Neuschwanstein zumindest lustiger, der nächste assoziiert einen Hamburger Lieferservice namens Taj Mahal, der dritte gibt die Frage nach dem Tadsch an mich zurück: »Ist das nicht pleite gegangen?« Er meint das »Trump Taj Mahal«, ein Luxushotel in Atlantic City. Tatsächlich wurde es 2016 nach Insolvenz geschlossen, inzwischen als »Hard Rock Hotel & Casino« neu eröffnet, also der alte Mythos im Namen durch einen aktuelleren Mythos ersetzt. Als Chiffre, die für irgendeine Verheißung von der Nobeldisco bis zum Schnellimbiß steht, ist »Taj Mahal« bis in die Trivialzone der Alltagskultur hinabgesunken. Es gibt sogar einen (großartigen) Bluesmusiker, der sich aufgrund eines Traumes Taj Mahal nennt; die Art und Weise, wie er seinen Künstlernamen erklärt – das Tadsch stehe für einen Bezug zu Gandhi und dessen praktizierter Toleranz –, ist freilich absurd.
Einige Hamburger Lokalpatrioten geben zu bedenken, die Elbphilharmonie sei möglichweise schöner. Zur Sicherheit überfliege ich noch mal die euphorischen Berichte von ihrer Eröffnung, fast jeder nennt den Bau »spektakulär«, schwärmt von seiner »stadträumlichen Präsenz« oder sieht ihn als Verkörperung eines »utopischen Traums«. Niemand bezeichnet ihn als »schön«. Vielleicht ist es gerade die Selbstverständlichkeit der Schönheit, die sie über das Atemberaubende und Spektakuläre stellt, denke ich. Dann fahre ich los.
Diesmal habe ich einiges über das Tadsch Mahal gelesen, habe mir zwei Wochen Zeit genommen und Sanjay als Begleiter. Er möchte von Delhi aus eine Schleife durch Rajasthan drehen, um mir einige der architektonischen Vorläufer des Tadsch zu zeigen und mich auf die indoislamische Baukunst einzustimmen. Ein letzter Umweg. Weil wir uns bei unserem eng getakteten Programm keine unvorhergesehenen Verzögerungen leisten können, reisen wir nicht mit Fernbus und Zug, wie ich es gerade in Indien liebe, sondern mit Auto und Chauffeur. Unsre Fahrt gilt der Beantwortung der Frage: Habe ich vor zehn Jahren übertrieben, als ich das Tadsch Mahal in meiner Begeisterung zum schönsten Gebäude der Welt erklärte?
Nein, ich will mir nicht anmaßen, mit den Urteilen der Kunsthistoriker mithalten, womöglich weitere Bezüge zu früheren Bauten oder Gartenanlagen aufspüren zu wollen. Ich bin auch kein Indienfreak, der sich ein Leben lang mit dem Subkontinent beschäftigt hat. Alles in allem war ich, verteilt auf fünf Reisen, einige Monate lang im Süden, Norden und insbesondere Osten Indiens unterwegs. Von ungebrochener Begeisterung konnte dabei keine Rede sein. Allerdings hat mich Indien häufiger als jedes andre Land an meine Grenzen gebracht – in meiner Verzweiflung, meiner Abscheu und eben auch in meiner Bewunderung.
Jetzt will ich eigentlich nicht viel mehr als die Augen offen halten und sammeln, was meine spontane These von einst bestätigen oder widerlegen könnte: Kunsthistorisches, Historisches, aber auch Alltägliches, vor dessen Hintergrund sich das Tadsch vielleicht noch klarer als Ausnahme der Regel erkennen läßt – all das will ich wie ein Puzzle zusammentragen. Ohne mich dabei zu fragen, welchen Wert das einzelne Puzzleteil haben und was es, im Verbund mit andern Teilen, einmal darstellen könnte.
Das wird ohnehin erst zu beurteilen sein, wenn sich die letzten Teile des Puzzles zusammengefügt haben. Sofern sie ein Stück des Himmels überm Tadsch ergeben sollten, mit dem schon meine kindliche Puzzelei stets beendet wurde, weiß ich immerhin von meinem Kurzbesuch im Jahr 2007: Dieser Himmel wird nicht unbedingt knallblau ausfallen wie der auf den gängigen Fotos. Eher verwaschen trüb, verhangen, opak, so jedenfalls habe ich ihn in Erinnerung.
Jodphur, die blaue Stadt am Rand der Wüste Thar. Die Treppe zu meinem Hotelzimmer ist steil und dunkel, jede Stufe so hoch und so schmal, wie ich’s eher von UNESCO-Welterbe in Mexiko oder Kambodscha kenne. Oben, im ersten Stock des ehemaligen Haveli, beginnt eine ganz andre, eine üppige Welt, dort geht man auf weißen Marmorfliesen, und wenn man’s barfuß tut, fühlt man die Sinnlichkeit des Materials. Kein Wunder, denke ich, daß Marmor in Rajasthan seit Jahrhunderten eine solch bedeutende Rolle spielt. Als ich vom Fenster aus die erste Kuh im Straßenverkehr entdecke, wie sie zwischen den wartenden Tuk-Tuks nach Nahrung sucht und dabei den einen oder andern Tritt bekommt: da weiß ich nicht mehr nur, daß ich wieder in Indien bin, da spüre ich’s. Und habe mich bereits in die Stadt verliebt.
Wir sind des Forts wegen gekommen, das 1459 zum Schutz der neuen Hauptstadt eines Rajputen-Reiches erbaut wurde. Seitdem werden hier jeden Tag die Geier gefüttert, dem Rat eines Heiligen folgend, angeblich noch heute. Zu sehen sind allerdings nur Milane und Mauersegler. Imposant thront das Fort auf einem Felsmassiv hoch über der Stadt, es scheint uneinnehmbar. Doch das täuscht. Was so wuchtig wirkt, eine Kraftprotzerei aus Stein, zeugt vor allem vom wechselhaften Geschick des Herrscherhauses im ständigen Bruderkrieg mit benachbarten Rajputenfürsten. Mal wurde das Bollwerk von diesem, mal von jenem belagert, berannt, erstürmt. Nur deshalb konnten sich die Moguln, von Zentralasien aus sukzessive das westliche und südliche Indien erobernd, als Schutzmacht etablieren – bis sie Jodhpur 1678 selbst einnahmen, plünderten und die Überlebenden gewaltsam zum Islam bekehrten.
Mit klassischer Mogularchitektur, der unsre Reise ja gilt, hat das Fort nichts zu tun. Schön ist es sowieso nicht. Es ist mächtig. Derart mächtig, daß es keine Burg mehr ist, sondern eine Festung. Wäre auch das Felsmassiv, auf dem sie errichtet wurde, gewaltiger – de facto ragt es nur 120 Meter über die Stadt –, der Anblick würde dem Betrachter den Atem verschlagen. So aber sitzt die Feste auf dem schroffen Felsen wie auf einem Sockel und wirkt erhaben.
Weil sie jedoch so breit hingestreckt ist, auch ein bißchen behäbig? Je länger ich sie von der Dachterrasse meines Hotels aus taxiere, desto häufiger frage ich mich, ob die Burganlage erhaben ist. Das Erhabene erzeugt eine Aura der Unerreichbarkeit, eine gewisse Ohnmacht des Betrachters. Tatsächlich war die Burg erreichbar, waren seine Eroberer alles andere als ohnmächtig. Wenn sie freilich nicht erhaben ist, was ist sie dann? Ein wuchtiger Klotz in der Landschaft, »beeindruckend«?
Ich stehe gerade mal auf dem Dach meines Hotels, und schon fehlen mir Begriffe, die Trennschärfe und Erkenntnis bringen könnten. Ich habe nurmehr Wörter. Vielleicht muß ich einfach hinauf und hinein in die Burg, um die Anschauung zu schärfen?
Zunächst gehe ich aber erst mal zum Barbier. Das habe ich mir im Verlauf meiner Reisen angewöhnt, man mischt sich dort beiläufig ins Alltagsleben einer fremden Kultur, und ein großes Vergnügen ist es (meist) obendrein. Der Barbier, den man mir empfohlen hat, betreibt sein Geschäft am Uhrturm, wie er auch in Jodhpur von Britisch-Indien übriggeblieben ist. Mit seiner Rechten schert er mir den Kopf, mit der Linken telefoniert er. Am Schluß holt er einen Handbesen mit roten und weißen Plastikborsten, um mir damit die Haare vom Oberkörper zu kehren, schließlich ebenso nonchalant aus dem Gesicht. Danach schlägt er mir mit einem Handtuch auf Schultern und Brust, um noch die letzten Härchen wegzubekommen. Sodann massiert er meinen Kopf. Er weiß, daß auch die Performance zählt, darin ist er ein Meister. Dafür schneidet er mir bei der anschließenden Rasur ins Ohrläppchen, ich verlasse seinen kleinen Salon mit einem kräftigen Schorf auf der Wunde.
Ob er versucht habe, mich umzubringen? frage ich ihn zum Abschied.
In der Tat, antwortet er und entschuldigt sich noch immer nicht, aus seinem Blick spricht sogar ein gewisser Stolz auf sein Malheur. Ein Gast, der als nächstes an der Reihe sein wird, mischt sich ein: Er kenne den Barbier seit Jahren, der habe einen Killerinstinkt.
Genau das sind die Erlebnisse, deretwegen ich Indien und seine schlagfertigen Bewohner so mag. Auch in den Gassen draußen fühle ich mich sofort wohl, niemand ruft mir zu, verstellt mir den Weg, will mir seine Dienste aufnötigen. Vielleicht liegt es an der Hitze, 35 Grad im Schatten. In weiten Schleifen durchstreife ich den Basar am Fuß des Burgbergs, plötzlich klingt es von weitem wie eine gequälte Kuh. Es ist dann aber ein Mensch. Er liegt am Rand der Gasse, beide Arme amputiert, und brüllt. Jeder steigt über ihn hinüber, keiner bleibt stehen und spendet.
Es wird also auch auf dieser Reise, die so dezidiert dem Schönen gewidmet ist, immer mal wieder aufs Schreckliche hinauslaufen. Daß die beiden Begriffe einander rätselhaft bedingen, habe ich gerade in Indien oft erfahren. Womöglich ist das die kürzestmögliche Charakterisierung des Landes – schrecklich schön.
Durch enge Gassen steige ich bergauf Richtung Fort. Alle paar Minuten kommt mir derselbe Hochzeitszug entgegen, angeführt durch einen Pritschenwagen, so alt, daß er wahrlich noch kein Pick-up ist. Auf seiner Ladefläche riesige Boxen, ein Mischpult, ein DJ, einige herumalbernd tanzende Jugendliche. Der ganze Straßenzug vibriert im Takt der Bässe. Dahinter die Hochzeitsgäste, zunächst ein Pulk johlender Jungs und Mädchen, paarweise gefolgt von den Erwachsenen. Es geht zum Haus der Brauteltern, das mit bunten Glühlampen und Tüchern geschmückt ist, geht dann doch erst mal dran vorbei und weiter.
Als ich endlich den Fußweg gefunden habe, der aus der Stadt hinaus- und zur Burg hochführt, rufen mich die Bewohner der letzten Häuser zurück – die Burg ist für heute bereits geschlossen. So bleibt mir die Stadt. Wenn ich mich verlaufen habe, muß ich nur auf die Musik lauschen. Bald stoße ich dann erneut auf den Festzug, der es überhaupt nicht eilig hat, sein Ziel endgültig zu erreichen – wahrscheinlich bringt er aus den verschiedenen Straßenzügen immer neue Gäste zum Fest.
Vor Jahren habe ich am Trubel einer solchen Feier teilgenommen, spontan hereingewunken und gleich bis zum Brautpaar weitergereicht, um mit ihm gemeinsam fotografiert zu werden. Der Bräutigam lachte mich dabei so herzlich an, als sei ich sein bester Freund. Da er kein Pidgin sprach, konnten wir uns nur wieder und wieder voreinander verbeugen, dann mußte er sich ernsteren Pflichten zuwenden. Den Rest des Abends hatte ich ständig irgendwen an meiner Seite, der mich zum Kosten der verschiedenen Speisen drängte, dabei ging’s treppauf, ohne daß es etwa weiter oben leerer wurde. Ich war ein staubiger Kerl von der Straße, in alten Laufschuhen und Trekkinghosen, und alle andern hatten sich fein gemacht, die Männer im Anzug, die Frauen im Sari, ich gehörte schon aufgrund meiner Kleidung nicht dazu. Aber das ließ mich niemand spüren, im Gegenteil. Viel zu spät stellte ich fest, daß ich in den oberen Stockwerken allein unter Frauen war, die Männer feierten parterre. Doch als ich mich entschuldigen wollte, forderte man mich auf zu bleiben. Mit Händen und Füßen ging die Unterhaltung weiter, und wenn trotzdem keine Verständigung möglich war, wurde ich einfach noch herzlicher angestrahlt und -gelacht. Irgendwann saß ich in einem Séparée und trank Tee mit den Brauteltern, deren jüngste Tochter auf Oxford-Englisch eine artige Konversation vermittelte. Auch hier mußten Fotos gemacht werden. Die Brautmutter hatte eine Art, die Teetasse zu ergreifen und zum Mund zu führen, die mich schwer beeindruckte; sie war nicht unbedingt schön, jedoch von natürlicher Anmut, neben der selbst die Schönheit ihrer Töchter verblaßte.
Das war am andern Ende von Indien gewesen, in einer kleinen Stadt in Meghalaya. Ich stelle mir vor, daß die heutige Feier ähnlich verlaufen wird. Nach Anbruch der Nacht reitet inmitten des Festzuges der Bräutigam auf einem Schimmel, gewandet wie ein Maharadscha aus einem prächtigeren Jahrhundert. Dazu der immergleiche Indienpop, die immergleichen Tanzeinlagen rund um den Pritschenwagen, Bollywood live.
Auf der Dachterrasse des Blue Turban bin ich dann fast allein. Ich trinke einen Tea masala, was sonst, und warte auf mein Shahi-Panir