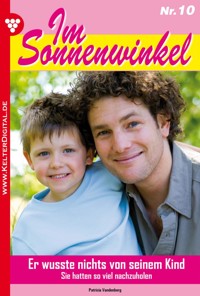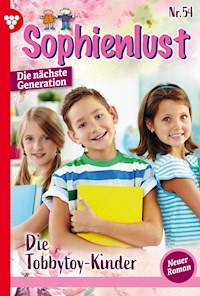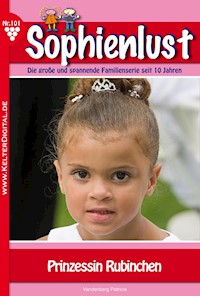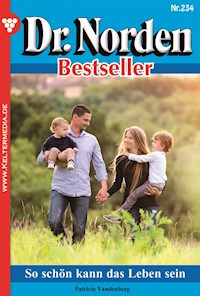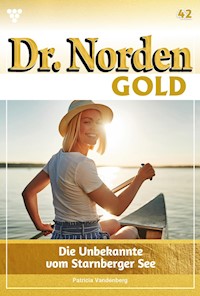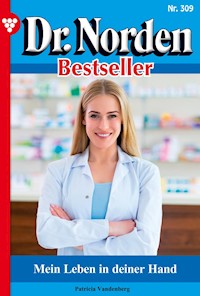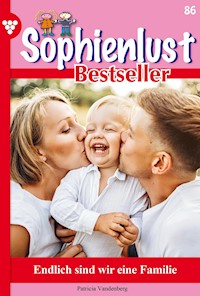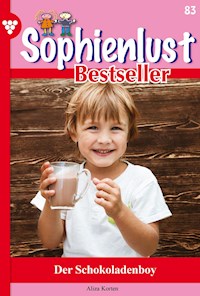14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Im Sonnenwinkel Box
- Sprache: Deutsch
Im Sonnenwinkel ist eine Familienroman-Serie, bestehend aus 75 in sich abgeschlossenen Romanen. Schauplätze sind der am Sternsee gelegene Sonnenwinkel und die Felsenburg, eine beachtliche Ruine von geschichtlicher Bedeutung. Wundervolle, Familienromane die die Herzen aller höherschlagen lassen. Keine Leseprobe vorhanden. E-Book 1: Setzt das Glück nicht aufs Spiel E-Book 2: Natalie, das Findelkind E-Book 3: Eine neue Mutter für Lausbub Dieter E-Book 4: … doch ich bleibe bei dir E-Book 5: Ein kurzer Traum vom Glück E-Book 6: Ich suche nur ein bisschen Liebe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 847
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Setzt das Glück nicht aufs Spiel
Natalie, das Findelkind
Eine neue Mutter für Lausbub Dieter
… doch ich bleibe bei dir
Ein kurzer Traum vom Glück
Ich suche nur ein bisschen Liebe
Im Sonnenwinkel – Jubiläumsbox 5 –6er Jubiläumsbox
E-Book: 23-28
Patricia Vandenberg
Setzt das Glück nicht aufs Spiel
Was erleben die Auerbachs mit dem Austauschschüler Pierre?
Roman von Patricia Vandenberg
Hannes Auerbach kam an diesem ersten Frühlingstag in einem Tempo von der Schule heim, daß seine Mutter sogleich ahnte, es müsse etwas in der Luft liegen.
»Bitte, Mami, ihr müßt es erlauben!« rief er atemlos. »Ich bin jetzt doch schon groß genug!«
»Was müssen wir erlauben, und wozu bist du groß genug?« fragte Inge Auerbach.
»Für den Schüleraustausch. Nach Frankreich können wir fahren. Sechs Wochen. Ist das nicht toll?«
Inge war einigermaßen aus der Fassung gebracht. Nach Frankreich wollte er fahren? Und diese Begeisterung dazu? Es versetzte ihrem Mutterherzen einen Stich, aber sie ließ es sich nicht anmerken. »Darüber werden wir mit Papi erst einmal in aller Ruhe reden müssen«, beschied sie.
»Fabian wird es euch schon sagen, daß alles Hand und Fuß hat. Sie informieren sich ganz genau, in welche Familien wir kommen, und außerdem sollen die Franzosen erst hierher kommen. Wir haben schon die Adressen, und wir sollen uns schreiben, damit wir uns vorher kennenlernen. Fabian hat das auch gemacht. Das war schon früher Usus. Mit vierzehn Jahren kann man seine Nase ruhig mal ein bißchen in die Welt stecken.«
Du lieber Gott, dachte Inge, er hat es aber eilig damit. Sie mußte das erst verdauen, und die kleine Bambi, die an der Tür lehnte und ihren Bruder mit großen Augen anstarrte, auch.
»Wohin willst du deine Nase stecken?« fragte Bambi kleinlaut.
»Nach Frankreich«, erwiderte Hannes mit erhobener Stimme.
»Du willst von uns fortgehen?« flüsterte sie.
»Doch nur für sechs Wochen, Dummerchen.«
»Ich bin kein Dummerchen!« begehrte Bambi auf. »So dumm nicht, daß ich freiwillig weggehen würde von meiner Mami und meinem Papi, von Omi, Opi, Ricky, Fabian und Henrik!«
Sie zählte gleich alle auf, die zur Familie gehörten, um ihrem Widerspruch Nachdruck zu verleihen, und es hatte den Anschein, als würde dies nicht wirkungslos verpuffen, denn Hannes’ Gesicht wurde länger und länger.
Aber er besann sich darauf, daß er schon um einiges älter war als Bambi. Alt genug, um einmal allein zu verreisen.
»Sechs Wochen sind doch keine Zeit«, brummte er, »und die Adresse habe ich auch schon. Ich werde jetzt gleich an Pierre schreiben. Pierre Barnet heißt mein Brieffreund, und in Paris wohnt er.«
Er machte sich sehr stark, obgleich es doch ein bißchen schwieriger für ihn wurde, wenn Bambi ihn mit ihren großen nachtdunklen Augen so vorwurfsvoll anblickte.
»Dann schreib nur«, stieß sie hervor. »Ich bleibe bei meiner Mami.«
»Das ist auch meine Mami«, bemerkte er nun.
»Wenn du fortgehst, ist sie ganz allein meine Mami«, erklärte Bambi zornerfüllt.
»Bist ja ein Tschapperl«, sagte er gutmütig, denn ganz einerlei war es ihm doch nicht.
»Verstehst du das, Mami?« fragte Bambi mit tränenersticktem Stimmchen, als er sich in sein Zimmer zurückgezogen hatte.
»Laß nur, Bambilein, es wird nichts so heiß gegessen, wie es gekocht wird«, beschwichtigte sich Inge Auerbach selbst. »Dazu muß Papi auch seine Einwilligung geben.«
»Und wenn er sie nun gibt?«
»Dann wird er eben seine Nase in die Welt stecken, wie er es will. Vielleicht ist es ganz gut für ihn.«
»Es ist bestimmt nicht gut«, wisperte Bambi. »Es ist doch so weit fort. Ich bin sehr traurig, daß Hannes das so gern will.«
»Warten wir es ab«, meinte Inge. »Noch ist es nicht soweit.«
»Vielleicht schreibt der Pierre gar nicht«, äußerte Bambi hoffnungsvoll. »Vielleicht hat er es sich auch schon überlegt.«
»Zerbrich dir jetzt noch nicht dein Köpfchen, mein Kleines«, sagte Inge zärtlich, denn sie wußte, wie es Bambi ums Herz war, hing sie doch mit abgöttischer Liebe an dem großen Bruder, der nun mit seinen vierzehn Jahren gerade in einem Alter war, wo er das nicht verstehen wollte.
»Ich kann den Pierre gar nicht leiden, Mami«, fuhr Bambi fort. »Bestimmt ist er ein ganz böser Ausländer.«
»Wir wollen keine Vorurteile hegen, Bambi. Wir werden abwarten, was dabei herauskommt.«
*
Am Abend wurde Familienrat gehalten. Hannes hatte seinen ersten Brief an Pierre mühsam zusammengestoppelt, denn mit seinen französischen Sprachkenntnissen war es noch nicht weit her.
Gerade deshalb plädierte sein Schwager, Dr. Fabian Rückert, Studienrat an dem Gymnasium, das Hannes besuchte, für den Austausch.
Magnus und Teresa von Roth, die Großeltern, enthielten sich der Stimme.
Sie mischten sich grundsätzlich nicht ein, wenn es um solche Entscheidungen ging. Sie waren die idealen Großeltern mit einer sehr modernen, wenn auch diplomatischen Einstellung.
»Meinetwegen«, sagte Professor Werner Auerbach. »Natürlich werde ich mich noch erkundigen, was das für eine Familie ist.«
»Darüber bin ich informiert«, erklärte Fabian. »Maurice Garnet ist Fabrikant. Außer Pierre hat er noch eine achtzehnjährige Tochter. Es werden grundsätzlich nur Schüler aus intakten Familien vermittelt. Außerdem werdet ihr Pierre ja vorher kennenlernen. Die Gruppe trifft in vier Wochen ein.«
Professor Auerbach klopfte seinem Sohn auf die Schulter.
»Na ja, dann ist ja alles in bester Ordnung, Hannes. Pierre kann das Zimmer von Jörg haben.«
»Das mag ich aber gar nicht gern«, mischte sich Bambi ein. »Wenn ich das sagen darf.«
»Jörg ist doch jetzt verheiratet, Schätzchen«, meinte Werner Auerbach. »Es ist doch ganz nett, wenn man mal Besuch aus dem Ausland bekommt.«
»Ich mache so was nie!« äußerte Bambi aggressiv.
»Und wenn ihr meine Meinung wissen wollt«, bemerkte Ricky, »ich würde mir diesen Fremdling schon ganz genau anschauen, bevor Hannes nach Paris fahren darf.«
Diesbezüglich herrschte bei den weiblichen Mitgliedern der Familie völlig Übereinstimmung. Und Hannes sah so aus, als hätte er am liebsten schon jetzt einen Rückzieher gemacht.
*
Doch im Verlauf der folgenden Wochen flogen die Briefe zwischen Hannes und Pierre hin und her.
Pierre schrieb ein so drolliges Deutsch, daß selbst Bambi sich für ihn erwärmte.
Und dann kam auch schon der Tag, an dem die Schülergruppe aus Frankreich in Hohenborn erwartet wurde. Mit dem Mittagszug sollte sie eintreffen.
Fabian war vom Lehrerkomitee dazu bestimmt worden, sie zu empfangen.
Aber auch die Familie Auerbach stand am Bahnhof, um Pierre gleich mitzunehmen.
Pierre hatte kürzlich eine Fotografie von sich geschickt. Sehr genau hatte Bambi sie betrachtet, um festzustellen, daß dieser blonde Junge gar nicht wie ein Franzose aussähe.
Inge hatte gemeint, daß es genauso blonde Franzosen gäbe wie schwarzhaarige Deutsche.
Jedenfalls wollten sie beweisen, daß auch ihnen die Gastfreundschaft heilig sei.
Der Zug lief ein. Bambi schaute mit weit offenen Augen den zwanzig Buben und Mädchen entgegen, und sie entdeckte Pierre als erste.
»Da ist er, Mami!« flüsterte sie. »Ganz am Ende!«
Er stieg als letzter aus, ein schmaler, ernster Junge, der sich schüchtern im Hintergrund hielt.
»Nun geh doch zu ihm, Hannes!« drängte Bambi. »Du mußt ihn zuerst begrüßen!« Ihr weiches Herz hatte gesiegt.
»Komm mit«, sagte Hannes und faßte sie bei der Hand.
»Wie heißt’s auf französisch gleich?« fragte Bambi.
»Was?«
»Na, guten Tag!«
»Bonjour«, raunte er ihr zu.
Bambi zeigte sich weitaus geistesgegenwärtiger als ihr Bruder. Sie ging auf den blonden Jungen zu und sagte: »Bonjour, Pierre!«
»Bonjour«, entgegnete er verwirrt. »Wie heißen du?«
»Bambi – Bambi Auerbach«, erklärte sie eifrig. »Ich bin die Schwester von Hannes.«
»Annes«, wiederholte Pierre, und Bambi fand es lustig, wie er das H verschluckte.
Sie war nicht mehr böse, daß Pierre kam, wenn sie sich auch noch lange nicht mit dem Gedanken vertraut machen konnte, daß Hannes in sechs Wochen mit Pierre nach Frankreich fahren sollte. Aber sechs Wochen waren doch eine ziemlich lange Zeit.
»Da bist du ja«, sagte Hannes und klopfte ihm auf die Schulter. »Ich freue mich.«
»Isch freuen misch auch«, erwiderte Pierre. »Es sein schön, daß ihr kommt misch olen.«
»Ist doch klar«, meinte Hannes. »Die ganze Familie ist da. Großer Bahnhof für dich, Pierre.«
Mit Grausen dachte er dabei, daß er in Frankreich nur französisch reden sollte, was er bei weitem nicht so gut konnte wie Pierre schon die deutsche Sprache beherrschte.
»Ihr aber eine gute Familie«, äußerte Pierre, und dann machte er eine tiefe Verbeugung vor Inge und Werner Auerbach.
*
Sie waren daheim im Sonnenwinkel. Hannes zeigte seinem Freund das Zimmer.
Bambi saß bei ihrer Mami in der Küche.
»Er ist sehr nett, Mami«, bemerkte sie, versöhnlich gestimmt. »Er ist gar nicht frech.«
»Ich habe dir doch gesagt, daß man keine Vorurteile haben darf, mein Kleines.«
»Er sieht aber ein bißchen traurig aus«, meinte Bambi tiefsinnig. »Ob er schon Heimweh hat?«
»Dann werden wir ihm darüber hinweghelfen, Bambi. Er soll sich doch gern an uns erinnern.«
»Jetzt ist er ja erstmal hier«, sagte Bambi.
Ja, nun war Pierre da, und es schien nicht so, als hätte er Heimweh.
Von seinen Eltern sprach er nur ganz nebenbei. Als Inge anregte, daß man ihnen vielleicht ein Telegramm schicken solle, erklärte er, daß sie beide nicht daheim wären.
»Papa ist in England und Maman an der Riviera.«
»Und wenn Hannes zu dir kommt, wo seid ihr dann?« wollte Bambi wissen.
»In Paris und sischer auch an der Riviera«, erwiderte er. »Aber bei euch ist es sehr, sehr schön«, fügte er schnell hinzu.
Und da dachte Inge Auerbach sich schon ihr Teil. Aber sie hatten ja noch sechs Wochen Zeit, Pierre näher kennenzulernen.
Acht Tage waren vergangen, bis der erste Brief für ihn kam.
Bambi hatte ihn gleich an der fremden Marke erkannt, und sie konnte es kaum erwarten, bis die beiden Buben kamen und sie Pierre den Brief aushändigen konnte. Sie meinte, daß er sich sehr freuen würde.
Aber Pierre sah ihn nur an und steckte ihn in die Tasche.
»Von Aimee«, bemerkte er.
Daß Aimee seine Schwester war, wußte Bambi schon, aber daß Pierre den Brief nicht gleich las, befremdete sie sehr.
»Ich finde es schon sehr komisch, daß seine Mama noch nicht geschrieben hat«, sagte Bambi empört zu ihrer Mami. »Du hättest unserem Hannes schon längst geschrieben.«
»Sie ist an der Riviera. Da braucht die Post sicher länger«, erklärte Inge, aber sie machte sich auch ihre Gedanken.
Am Abend dieses Tages war Pierre auffallend still und in sich gekehrt.
Zum ersten Mal nahm Hannes dazu Stellung.
»Irgendwas ist mit ihm los, Mami«, äußerte er zu seiner Mutter. »Ich weiß bloß nicht, was. Wenn ich ihn nach seinen Eltern frage, ist er gleich ganz komisch. Ob sie nicht einverstanden sind, daß ich nach Frankreich komme?«
»Du mußt ja nicht hinfahren, Hannes«, entgegnete Inge.
»Wenn da nicht alles klar ist, will ich auch gar nicht«, erklärte er. »Ich lerne auch hier eine ganze Menge Französisch von ihm. Aber Pierre ist gern bei uns. Jeden Abend sagt er: Schon wieder ist ein Tag vorbei. Und dann ist er ganz traurig.«
»Dann werden wir herausfinden müssen, warum er traurig ist, Hannes.«
»Ich werde es versuchen, Mami, aber von sich sagt er ja nichts.«
*
Am nächsten Tag hatte Hannes noch mehr Anlaß, über Pierre nachzudenken.
Während der Schulpause fragte er plötzlich, wo denn die Post sei.
»Brauchst du Briefmarken?« erkundigte sich Hannes. »Wir haben doch genügend zu Hause.«
»Ich muß etwas anderes tun«, sagte Pierre. »Bitte, nicht fragen, Hannes.«
Jetzt konnte er das H schon aussprechen, wenngleich es ihm noch Mühe bereitete.
Die Post war nicht weit entfernt. Hannes zeigte ihm das Haus.
Aber als Pierre losrannte, obgleich die Pause schon fast zu Ende war, folgte er ihm. Und er sah, daß Pierre ein Telegramm aufgab.
Schnell entfernte er sich, bevor Pierre merken konnte, daß er ihm gefolgt war. Im Schulhof wartete er auf ihn.
Natürlich kamen sie zu spät, aber sie hatten Unterricht bei Dr. Jaleck, und der drückte ein Auge zu. Pierre war unaufmerksam.
»Drückt dich was, Pierre?« fragte Hannes, als sie den Heimweg antraten. »Was eißt das?« fragte Pierre. »Hast du Kummer?«
»Kummer? Ja, isch aben Kummer«, erwiderte Pierre. »Aber bitte, nicht sprechen davon zu deine liebe Maman.«
»Du kannst dich auf mich verlassen, Pierre. Wir sind doch Freunde.«
»Gute Freunde? Für immer?« fragte Pierre.
»Auf Gedeih und Verderb«, versicherte Hannes, und weil Pierre dies nicht verstand, erklärte er es ihm sehr umständlich auf französisch.
Man mußte Hannes zugestehen, daß er wirklich schon eine Menge gelernt hatte, denn Pierres Augen leuchteten auf, wenn er begriffen hatte, wie Hannes diese Freundschaft verstand.
»Isch werden disch brauchen sicher an einem Tag«, äußerte er nachdenklich.
Und nun wartete Hannes darauf.
Bambi ahnte nichts von Pierres Problemen. Wenn sie mit ihm plauderte, war er ganz gelöst.
»Der Dr. Allard kommt auch aus Frankreich«, erzählte er ihm.
»Dr. Allard?« fragte er.
»Von der Sternsee-Klinik. Das ist ein Kinderkrankenhaus. Wir können ja mal hingehen, und dann kannst du dich mit ihm unterhalten, in französisch. Dr. Fernand ist nämlich auch Franzose.«
»Und sie sind immer hier?« fragte Pierre.
»Ihnen gefällt es sehr gut bei uns.«
»Mir gefällt es auch serr gutt bei uns«, erklärte Pierre, »isch meinen, hier.« Bambi schenkte ihm einen herzerwärmenden Blick.
»Es ist auch nirgendwo schöner, auch an der Riviera nicht. Da hat Dr. Allard früher auch mal gewohnt. Aber jetzt bleibt er immer hier.«
»Und er spricht Französisch?« hakte Pierre noch einmal nach.
»Und wie! Aber du kannst doch schon sehr gut Deutsch.«
Welche Gedanken ihn jetzt bewegten, konnten sie nicht ahnen.
Ihre Unterhaltung wurde nun auch wieder durch Hannes bereichert, der schnell noch mal französische Vokabeln gelernt hatte, damit er sich nicht zu sehr blamierte, wenn dann die Reise nach Frankreich losging.
Aber zu seiner Beruhigung waren es bis dahin noch fünf Wochen.
*
Es war schon verwunderlich, daß Pierre nicht über seine Eltern sprach und auch nicht über seine Schwester Aimee, von der er nur erzählt hatte, daß sie bis vor einem halben Jahr in einem Internat gewesen sei.
Inge Auerbach, mit ihrem feinen Empfinden für die seelische Verfassung von Kindern, gelangte immer mehr zu der Überzeugung, daß es Pierre zwar materiell an nichts mangelte, aber doch wohl an Liebe und Fürsorge.
An diesem Abend nun kam ein Anruf für Pierre. Es war ein Ferngespräch.
Pierre blieb lange am Telefon. Als er sich wieder zu ihnen an den Tisch setzte, war er noch blasser.
»Es war nur Aimee«, erklärte er beiläufig.
»Sie hat wohl Sehnsucht nach dir?« fragte Hannes.
»Es möchte sein«, erwiderte Pierre. »Sie kann doch auch kommen«, meinte Bambi.
Pierre sah sie irritiert an.
»Nein, das geht nicht. Sie spricht auch nicht viel Deutsch«, lenkte er rasch ab.
»Hast du kein Bild von ihr?« wollte Bambi wissen.
Pierre schüttelte den Kopf. Als er Inges forschenden Blick auf sich ruhen fühlte, errötete er.
»Ein Bild habe ich von meinen Eltern und Aimee«, sagte er leise. »Soll ich holen es?«
Wie empfindsam ist er, dachte Inge. Sie hätte ihm gern geholfen in seinem Kummer, der nicht zu übersehen war.
Aber die Zeit des Kennens war wohl doch noch zu kurz, um sein ganzes Vertrauen zu erringen.
Pierre brachte das Bild. Inges Blick fiel auf eine sehr attraktive Frau, die es gewohnt zu sein schien, sich fotografieren zu lassen.
»Maman«, bemerkte Pierre mit rauher Stimme.
Der Mann, der hinter ihr stand, hatte das Gesicht zur Seite gewandt. Man konnte ihn nicht richtig erkennen, und auch das zierliche Mädchen an seiner Seite war etwas verwackelt.
»Es ist schon zwei Jahre her«, äußerte Pierre. »Ich haben fotografiert und konnte es noch nicht gut. Wir werden jetzt auch machen viele Aufnahmen von euch allen, n’estce pas? Ich darf doch?«
»Wir haben ja noch viel Zeit«, erklärte Inge herzlich.
*
Am nächsten Morgen fuhren Hannes und Pierre wie immer mit dem Bus zur Schule, den auch andere Kinder von Erlenried benutzten.
Es ging immer lebhaft zu, und Pierre kam nicht dazu, ein paar Worte mit Hannes allein zu sprechen. Als sie in Hohenborn ausstiegen, hielt er ihn am Ärmel zurück.
»Hannes, ich habe eine große, sehr große Bitte«, sagte er. »Du bist doch mein Freund.«
»Na klar! Mit mir kannst du reden, wie dir der Schnabel gewachsen ist.«
Als Pierre ihn verständnislos anblickte, korrigierte er sich.
»Ich meine, du kannst mir alles sagen.«
»Gut, ich werden das sagen, aber du mußt schweigen. Darfst nicht verraten mich. Ich will heute nicht zur Schule gehen.«
»Warum denn nicht?« fragte Hannes verdutzt. »Du brauchst doch keine Angst zu haben vor schlechten Noten.«
»Ich fühle mich nicht wohl«, murmelte Pierre.
»Himmel, warum bist du dann nicht zu Hause geblieben?« wunderte sich Hannes.
»Ich werde gehen etwas spazieren. Es ist besser. Ich will nicht machen deiner lieben Mami Sorgen.«
»Du machst ihr aber Sorgen, wenn du nicht sagst, was dir fehlt. Unserer Mami kannst du alles sagen. Sie ist prima.«
»Sehr prima.« Pierre nickte. »Darum du verraten mich nicht.«
Hannes fand das unlogisch, aber Pierre mußte es schließlich wissen.
»Ich sage nichts«, versicherte er. »Aber verlauf dich bloß nicht, sonst bekomme ich eins auf den Deckel, ich meine, auf den Kopf.«
Ein bißchen merkwürdig kam ihm das schon vor. Aber er hatte auch schon mal die Schule geschwänzt, und Pierre war ja nur Gastschüler.
Aber Hannes hätte sich schon sehr gewundert, hätte er noch gesehen, wohin Pierre seine Schritte lenkte. Nämlich zum Bahnhof.
Ganz gewiß hätte Hannes dann nicht mit einer Unschuldsmiene dem Lehrer verkündet, daß Pierre sich plötzlich nicht wohl gefühlt hätte und wieder heimgefahren sei.
*
Pierre hatte viel Zeit. Er lief vor dem Bahnhofsgebäude hin und her und schaute immer wieder auf die Uhr. Die Minuten schlichen dahin.
Endlich fuhr ein Zug ein. Pierre lief zur Sperre und ließ seine Blicke schweifen.
Dann sah er das junge Mädchen. Bildhübsch und sehr elegant gekleidet. Es mußte auffallen. Nur gut, daß nicht viele Reisende ausstiegen.
Das Mädchen wartete auch, bis alle die Halle verlassen hatten, bevor es Pierre um den Hals fiel.
Ein französischer Wortschwall ergoß sich über ihn.
»Mein Kleiner, wie geht es dir? Ich bin so froh, dich zu sehen! Ich bin so unglücklich, Pierre, so schrecklich unglücklich!«
»Pst!« machte er. »Komm, wir gehen in den Park, da können wir reden. Hast du nur den einen Koffer?«
Sie nickte. Dann tupfte sie ein paar Tränen aus den Augen.
Pierre nahm ihr den Koffer ab. Wenig später hatten sie den kleinen Stadtpark erreicht. Sie setzten sich auf eine Bank.
»Ist es wirklich wahr, Aimee, daß Maman sich scheiden läßt?« fragte Pierre mit gepreßter Stimme.
»Ja, sie wird es tun. Der arme Papa! Oh, ich hasse sie! Ich will sie nie wiedersehen!«
»Was willst du jetzt tun?« fragte er ernsthaft.
»Ich werde hierbleiben. Irgendwo in deiner Nähe, Pierre. Ich habe doch nur noch dich.«
»Aber hier wird dich jeder gleich finden, Aimee. Du kannst dich doch gar nicht verständigen. Und Papa wird nach dir suchen. Ganz bestimmt.«
Er hatte die Hand seiner hübschen Schwester ergriffen und sah sie flehend an.
»Du bist ganz heiß«, stammelte er. »Hast du Fieber?«
»Ich bin nur unglücklich, so sehr unglücklich.«
»Auch wegen Marcel?« fragte er. »Ich kann ihn nicht leiden. Du bist viel zu schade für ihn.«
»Ich mag ihn auch nicht mehr, aber ich will nicht wieder nach Hause. Ich werde schnell die deutsche Sprache lernen. Ich habe genügend Geld, Pierre. Ich kann in ein Hotel gehen. Ich kann auf deutsch sagen: Guten Tag, auf Wiedersehen, bitte, danke und noch ein bißchen mehr. Im Land lernt man es schnell.«
»Hier in der Nähe gibt es zwei Franzosen«, äußerte Pierre gedankenvoll. »Ärzte. Dr. Allard und… Wie der andere heißt, habe ich vergessen. Ich habe es mir überlegt, daß du dorthin gehen kannst. Sie sind sehr nett, sagt Bambi. Aber du darfst nicht von mir sprechen. Ich will nicht, daß meine Freunde Schwierigkeiten bekommen. Sie sind sehr gut und lieb zu mir. Am liebsten möchte ich auch immer bei ihnen bleiben. Aber wir müssen erst abwarten, wann sie dich suchen. Papa wird dich bestimmt suchen.«
»Er ist in England«, erklärte Aimee trotzig.
»Und was hast du zu Louise gesagt?«
»Daß ich zu meiner Freundin Susanne fahre. Du meinst, ich soll zu dem Arzt gehen?«
»Ja, ich weiß jetzt nichts anderes. Du mußt dir eine Geschichte ausdenken. Das kannst du besser als ich. Ich muß erst noch überlegen, ob ich es erzählen kann. Tante Inge ist sehr lieb.«
»Tante Inge?«
»Frau Auerbach. Ich darf sie so nennen. Es ist eine Familie… es ist ganz anders als bei uns… Ich kann Hannes doch gar nicht mitnehmen nach Paris, wenn Maman nicht mehr da ist. Es ist doch sehr fatal.«
»Ja, es ist sehr fatal«, sagte Aimee zornig. »Maman denkt nur an sich, an ihren Schmuck, an ihr Vergnügen, ihre Kleider, nicht an Papa und ihre Kinder, und… Aber das brauchst du nicht zu wissen«, flüsterte sie. »Mir ist kalt, Pierre.«
Es war nicht kalt, aber die Zähne schlugen ihr aufeinander.
»Du bist krank, Aimee, du hast dich erkältet«, äußerte Pierre besorgt. »Es ist gut, wenn du zu einem Arzt kommst. Dr. Allard hat eine Kinderklinik.«
»Ich bin aber kein Kind mehr.«
»Aber es ist eine Klinik, und er ist Arzt.«
»Und wie komme ich dahin?«
»Mit dem Bus. Nein, das geht nicht. Mit dem fahren die Schulkinder. Wir müssen ein Taxi finden. Hoffentlich sind sie mir nicht böse, wenn alles herauskommt.«
»Hast du sie lieber als deine Schwester?« begehrte Aimee auf.
»Ich bin sehr gern hier und ich möchte auch bleiben.«
Es war nicht so einfach, ein Taxi aufzutreiben. So gut wußte Pierre doch noch nicht in Hohenborn Bescheid. Schließlich fanden sie doch eines, aber zu Pierres Erschrecken erkannte ihn der Fahrer.
»Du bist doch der Franzose von den Auerbachs«, bemerkte er. »Hast du dich verlaufen?«
»Nein, ich habe nur dieser jungen Dame geholfen. Sie spricht nicht Deutsch. Sie möchte zur Sternsee-Klinik.«
»Ach, Besuch für Dr. Allard?« äußerte der Mann freundlich. »Na, da hat die junge Dame aber Glück gehabt, einen zu finden, der ihre Sprache versteht.«
»Merci, Pierre«, sagte Aimee. »Ich werde dir bald Nachricht geben.«
Verloren stand er da und blickte dem Taxi nach. Maman will uns verlassen, dachte er, sie will uns wirklich verlassen.
Er war nicht so böse auf sie wie Aimee. Und alles, was sie gesagt hatte, stimmte auch nicht.
Gewiß liebte Maman schöne Dinge, aber sie war auch eine schöne Frau.
Und Pierre liebte seine schöne Mutter. Er war todunglücklich.
*
Dr. Nicolas Allard untersuchte gerade einen kleinen Patienten, als Aimee die Sternsee-Klinik betrat.
Leo Thewald hatte auf ihr Läuten das große Tor geöffnet und sie bis zum Klinikeingang begleitet.
Dort wurde sie von Sabine von Jostin in Empfang genommen, der sofort die fieberheißen Augen des jungen Mädchens auffielen.
Zu dem Fieber gesellte sich ein so heftiges, angstvolles Herzklopfen, daß Aimee kein Wort über die Lippen brachte.
»Andre, würdest du bitte mal kommen?« rief Sabine dem jungen Arzt zu, der gerade aus dem Labor kam. »Das Mädchen ist krank.«
»Welches Mädchen?« fragte Andre Fernand verwirrt.
»Dieses Mädchen.«
»Dr. Allard?« stammelte Aimee nun, und dann brachte sie auch noch eine Erklärung über die Lippen.
Doch die beiden Gesichter verschwammen vor ihren Augen, und ihre Hände griffen in die Luft, nach einem Halt suchend, den sie schließlich bei Andre fand, der sie kurzerhand emporhob und in den Behandlungsraum trug. Sabine folgte ihm.
»Eine Französin, wie es scheint. Man wird sie möglicherweise zu uns geschickt haben, weil sie Verständigungsschwierigkeiten hat.«
Er fühlte ihren Puls.
»Hol doch bitte mal das Stethoskop, Sabine«, bat er. »Das sieht mir ganz nach einer beginnenden Lungenentzündung aus.«
Mühsam öffnete Aimee die Augen, als er sie abhorchte. Dann mußte sie wieder husten.
»Wie ist Ihr Name, Mademoiselle?« fragte Andre. »Wer hat Sie geschickt?«
»Suzanne«, flüsterte Aimee, dann wurde sie wieder von einem Schüttelfrost erfaßt.
»Schwester Selma möchte ein Bett fertig machen«, sagte Dr. Fernand zu Sabine. »Die Fragen muß sie uns halt später beantworten.«
*
Niedergeschlagen wartete Pierre indessen an der Bushaltestellte auf Hannes. Der kam als erster angerannt, und man sah ihm an, wie erleichtert er war, Pierre zu sehen.
»Na, geht es dir wieder besser?« fragte er.
»Etwas. Hast du geschwiegen, Hannes?«
»Na klar, ist doch Ehrensache!«
»Aber wenn deine Eltern erfahren, daß ich nicht in der Schule war, werden sie böse sein mit mir.«
»Sie werden nicht böse sein. Ist doch keine Affäre. Aber wenn dir wirklich was fehlt, mußt du es sagen. Wir haben schließlich die Verantwortung für dich. Deine Eltern würden uns schön die Leviten lesen, wenn du krank nach Hause kommen würdest. Schmeckt dir unser Essen vielleicht nicht?«
»Es ist alles sehr gut und sehr schön«, versicherte Pierre. »Ich werde sehr traurig sein, wenn ich wieder weg muß von euch, Hannes. Und vielleicht, das muß ich dir sagen, vielleicht kann ich dich gar nicht mitnehmen nach Paris. Nun wirst auch du mir böse sein.«
»I wo! Gott bewahre«, bemerkte Hannes heiter. »Wenn es nicht klappt, ist es auch nicht schlimm. Ist jemand krank bei euch? Machst du dir deshalb Gedanken?«
»Ja, es ist jemand krank. Meine Schwester ist krank«, erwiderte Pierre bekümmert.
»Das kannst du doch ruhig sagen. Wir sind auch traurig, wenn von uns einer krank wird.«
Im Bus konnten sie nicht miteinander sprechen, und als der im Sonnenwinkel hielt, wartete Bambi schon.
»Heute hat Mami ganz französisch gekocht«, erzählte sie. »Da mußt du aber auch tüchtig essen, Pierre.«
Wenn er nur Appetit gehabt hätte. Alle waren so nett zu ihm, und wie die Dinge lagen, konnte er sich dafür nicht einmal revanchieren. Und immerzu mußte er an Aimee denken.
*
Maurice Barnet war ein paar Tage früher von seiner Geschäftsreise zurückgekommen. Eine merkwürdige Unruhe hatte ihn getrieben.
Madeleine war so eigenartig gewesen vor seiner Abreise, und auch Aimee war mit einer Leichenbittermiene herumgelaufen.
Er betrat sein schönes Haus in St. Cloud mit gemischten Gefühlen. Louise stand in der Halle und starrte ihn bestürzt an.
»Monsieur sind schon zurück?« stammelte sie.
»Sie sehen es, Louise«, erwiderte er ironisch. »Ist meine Frau nicht da?«
»Madame war gestern noch einmal da und hat zwei Koffer geholt«, berichtete Louise, »dann ist sie gleich wieder gefahren.«
»Wohin ist sie gefahren?«
Louise zuckte die Schultern.
»Ich weiß es nicht. Sie hat mir nichts gesagt. Sie hat einen Brief für Monsieur dagelassen.«
Er fand diesen Brief auf seinem Schreibtisch. Jener enthielt nur wenige Zeilen.
Maurice, ich habe es satt, ständig allein zu sein. Es ist besser, wenn wir uns trennen. Du wirst von mir hören, wenn ich mit dem Anwalt gesprochen habe. Madeleine.
Das konnte doch nicht wahr sein! Das konnte nicht Madeleine geschrieben haben.
Sie konnte doch nicht einfach fortgehen von ihm und den Kindern! Was war da geschehen?
Hatte er sie wirklich so vernachlässigt, daß sie eine Kurzschlußhandlung begangen hatte?
Guter Gott, er hatte geschäftliche Sorgen gehabt, wegen eines Auftrages, den eine andere Firma ihm wegschnappen wollte.
Aber man hatte nun mal Sorgen, wenn man ein paar hundert Angestellte beschäftigte. Konnte Madeleine das nicht verstehen?
Sie war doch auch wochenlang an der Riviera, während er das Geld für seine Familie verdiente.
Zorn wallte in ihm empor, der dann aber tiefer Resignation wich.
Madeleine gab nicht so schnell alles auf, was sie besaß. Da mußte es schon einen ganz besonderen Grund geben, und was konnte das sein als ein anderer Mann.
Er rief nach Louise. Mühsam beherrschte er sich.
»Wo ist Aimee?« fragte er. »Ist sie mit Madame gefahren?«
»Nein, Mademoiselle Aimee ist schon vorgestern zu ihrer Freundin Suzanne Lebrus gefahren. Sie hat Madame gar nicht mehr gesprochen«, erwiderte Louise.
Maurice Barnet sank in seinen Schreibtischsessel und starrte grübelnd vor sich hin. Wo sollte er Madeleine suchen?
Vielleicht wußte es Aimee. Er wählte die Nummer der Lebrus, die in der Nähe von Versailles wohnten. Und nun bekam er den zweiten Tiefschlag. Aimee war nicht dort. Sie war auch in letzter Zeit nicht dort gewesen. Suzanne weilte bei Freunden in Belgien. Ob Aimee dort sein könnte, fragte er.
Nein, das bestimmt nicht. Sie hätten erst vor einer Stunde mit Suzanne telefoniert, und das hätte sie bestimmt gesagt. Außerdem hätte Aimee ja gar nicht gewußt, daß Suzanne verreist sei.
Aber wo war Aimee, und wo befand sich Madeleine?
Pierre – ob Pierre etwas wußte? Vielleicht war Madeleine zu ihm gefahren, weil sie die Sehnsucht nach dem Jungen gepackt hatte. Sie hing doch an ihrem Sohn. Sie war keine schlechte Mutter.
Warum hatte sie auch nur zugestimmt, daß Pierre für sechs Wochen nach Deutschland ging. Oder war ihr das willkommen gewesen?
Die Gedanken überstürzten sich, aber er fand keine Erklärung.
Wieder rief er nach Louise.
»Hat Pierre schon geschrieben?« fragte er.
»Ja, Mademoiselle Aimee hat den Brief an sich genommen, und es ist auch ein Telegramm von ihm gekommen«, sagte Louise.
Vielleicht ist etwas mit Pierre, dachte Maurice Barnet. Ja, das wird es sein.
Er hatte ein paar Tage Urlaub machen wollen mit Madeleine. Nun würde er zu seinem Sohn fahren. Wahrscheinlich fühlte Pierre sich unglücklich bei dieser deutschen Familie, oder er war krank.
Die Adresse wußte er. Er hatte sie sich notiert, und er hatte Pierre auch eine Karte aus Schottland geschrieben.
»Ich verreise, Louise. Wenn Madame anruft, sagen Sie ihr, daß ich Pierre besuche«, erklärte er.
Louise sagte gar nichts mehr. Was in den letzten Tagen hier geschah, kam ihr sehr bedenklich vor.
Sie hatte auch ein wenig Mitleid mit Monsieur Barnet, denn sie wußte, daß es in Madames Leben einen anderen Mann gab.
Louise mißbilligte das sehr, und sie hätte sich eher die Zunge abgebissen, als daß sie es Monsieur gesagt hätte.
Während Maurice Barnet mit seinem schnellen Wagen der deutschen Grenze entgegenfuhr, traf Madeleine Barnet wieder in St. Tropez ein.
Marcel Lazar umarmte sie überschwenglich.
»Meine angebetete Madeleine, wie habe ich dich vermißt! Hast du alles geregelt?«
»Ich habe ein paar Koffer gepackt und Maurice einen Brief hinterlassen«, erwiderte sie. »So einfach ist es gar nicht nach zwanzig Ehejahren«, fügte sie leise hinzu. »Ich komme mir schäbig vor, auch wegen der Kinder. Maurice hat seine Fabrik, aber die Kinder. Gerade Aimee ist bestimmt sehr enttäuscht von mir. Ich habe ihr den Freund genommen.«
»Hast du sie gesprochen?«
»Nein, sie ist jetzt zu einer Freundin gefahren. Sie war sehr verliebt in dich, Marcel.«
»Sie ist ein kleines Mädchen, aber du bist eine schöne, bezaubernde Frau. Ich kann ohne dich nicht leben, Madeleine.«
Sie hörte es gern. Er war so charmant, so unwiderstehlich: Er gab ihr die Jugend zurück, die ihr schon zu entgleiten drohte.
Marcel sah blendend aus, und er war ein Kavalier vom Scheitel bis zur Sohle. So jedenfalls kannte ihn Madeleine. Doch bald sollte sie ihn von einer anderen Seite kennenlernen.
»Du mußt dich ausruhen, Cherie«, sagte er fürsorglich. »Ich habe noch einiges zu erledigen. Ich muß zur Bank. Wir wollen doch unsere Tage genießen.«
Lächelnd ließ Madeleine sich zurücksinken. Sie glaubte wirklich, um ihrer selbst willen von Marcel geliebt zu werden.
Marcel verließ das Chalet sehr eilig. In einem Restaurant traf er mit einem anderen Mann zusammen, der ihm mit einem süffisanten Lächeln zunickte.
»Hast du die Mäuse, Marcel?« fragte er.
»Madeleine ist gerade erst zurückgekommen. Ich kann doch nicht gleich von Geld anfangen. Ich habe ihr gesagt, daß ich zur Bank gehe.«
Der andere lachte höhnisch.
»Und was willst du ihr dann sagen?«
»Daß die Überweisung noch nicht eingetroffen ist. Warte noch bis morgen, Jean. Dann kommt alles in Ordnung.«
»Das will ich sehr hoffen. Länger warte ich nicht, dann komme ich selbst kassieren bei Madame Barnet.«
»Du wirst mir das nicht verderben!« zischte Marcel.
»Du wirst es ja sehen. Mit Zwanzigtausend stehst du bei mir in der Kreide. Meine Geduld ist am Ende.«
*
Aimee warf sich in wilden Fieberträumen hin und her.
»Nein, nicht Marcel«, stöhnte sie. »Maman…« Die anderen Worte waren unverständlich.
»Es ist schlimmer, als ich dachte«, stellte Andre fest. »Es ist nicht nur die Lungenentzündung. Sie leidet auch psychisch.«
»Man wird sich Sorgen um sie machen«, äußerte Sabine gedankenvoll. »Aber wie sollen wir erfahren, wie sie heißt und woher sie kommt?«
»Wir sollten zum Beispiel einmal in ihre Handtasche schauen«, schlug Andre mit einem flüchtigen Lächeln vor. »Es wird uns wohl nichts anderes übrigbleiben. Sie kommt nicht von irgendwo. Ihre Kleidung ist kostspielig. Pariser Modelle. Und sehr gepflegt ist sie auch.« Und sehr, sehr hübsch, dachte er.
Auch die Handtasche war aus teurem Leder, und als Sabine sie öffnete, sah sie zuerst ein Bündel Geldscheine.
»Allmächtiger«, rief sie, »sie schleppt ja ein Vermögen mit sich herum! Es sind fast zehntausend Euro.«
»Wie eine Diebin sieht sie eigentlich nicht aus«, bemerkte Andre.
»Das wollte ich auch nicht sagen, aber man trägt doch nicht so viel Geld einfach mit sich herum, Andre.«
»Hat sie einen Paß?« fragte er ablenkend.
Sabine hatte ihn aufgeschlagen. »Aimee Barnet«, las sie laut. »Sie ist erst achtzehn.«
»Älter habe ich sie auch nicht geschätzt. Barnet… Barnet… Etwa der Stoffabrikant?«
»Das steht nicht im Paß«, erwiderte Sabine geistesabwesend.
»Gib ein Telegramm auf, damit die Eltern Bescheid wissen. Weiß der Himmel, wie sie ausgerechnet hierhergekommen ist. Vielleicht ist sie durchgebrannt.«
»Und was soll ich telegrafieren?« fragte Sabine verwirrt.
»Die Wahrheit. Aimee Barnet schwer erkrankt. Sternsee-Klinik über Hohenborn«, erklärte Andre. »Wir werden ja sehen, wie man reagiert.«
Darüber sprach Sabine noch einmal mit Nicolas, aber auch er hatte keinen anderen Vorschlag. Sabine gab das Telegramm auf.
Nicolas ging im Zimmer hin und her. »Was denkst du, Nicolas?« fragte Sabine.
»Es ist doch sehr merkwürdig, daß sie ausgerechnet in unsere entlegene Gegend gekommen ist«, sagte er nachdenklich.
»Na, hinter dem Mond sind wir auch nicht gerade.«
»Aber welcher Franzose kennt schon Hohenborn oder gar die Sternsee-Klinik. Sie muß jemanden kennen, der hier wohnt. Du, da fällt mir ein, seit einiger Zeit sind doch französische Austauschschüler in Hohenborn. Sollte es da eine Verbindung geben?«
»Das wäre herauszubringen. Da brauche ich nur Carla zu fragen. Die weiß es bestimmt.«
»Dann frage sie.«
Und so geschah es, daß Sabine von Jostin schnell entschlossen zum Gasthof Seeblick fuhr, um Carla Richter aufzusuchen, mit der sie befreundet war.
*
Carla Richter, die junge Gastwirtin, strahlte über das ganze Gesicht, als Sabine eintrat.
»Das ist aber mal eine freudige Überraschung«, rief sie. »Wir haben uns lange nicht gesehen, Sabine.«
»Vierzehn Tage genau. So lange ist es nämlich her, daß wir Michaels und Lisannes Hochzeit gefeiert haben«, erwiderte Sabine.
»Und wann feiern wir deine?« fragte Carla lächelnd.
»Nicht vor Mai. Wir müssen doch die Feste hübsch über das Jahr verteilen. Außerdem stecken wir mitten in der Arbeit.«
»Na, ihr seht euch ja jeden Tag. Da ist es zu ertragen«, meinte Carla.
»Was macht Toni?« fragte Sabine ablenkend, da sie nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen wollte.
»Derzeit hält er noch Mittagsschläfchen. Aber so können wir uns einmal in aller Ruhe unterhalten. Er ist ein richtiger Wildfang.«
»So hast du es dir doch gewünscht.«
»Ja. So richtig gesund und munter ist er, und er wird immer goldiger. Aber zur Zeit spielt Papi die erste Geige bei ihm.«
»Wie es sich für einen richtigen Jungen gehört.«
Carla Richter hatte keine eigenen Kinder bekommen können, und so hatten sie den kleinen Toni adoptiert. Er war ihr ganzes Glück.
»Apfelkuchen mit Kaffee, Sabine? Oder lieber Käsekuchen?« fragte Carla.
»Am liebsten beides. Ich habe einen Mordshunger«, erwiderte Sabine lächelnd. »Gerade mittags wurde eine Patientin eingeliefert, und da bin ich nicht zum Essen gekommen.«
Schon ein paar Minuten später standen Kaffee und Kuchen vor ihr.
Nun konnte Sabine endlich, langsam und mit aller Vorsicht, auf den Grund ihres Besuches zu sprechen kommen.
»Habt ihr in Erlenried eigentlich auch französische Austauschschüler?« fragte sie.
»Auerbachs haben einen. Ein netter Junge. Sieht gar nicht aus wie ein Franzose.«
»Wieso nicht?« fragte Sabine belustigt.
»Er ist ganz blond. Ich habe mir die Franzosen immer schwarzhaarig vorgestellt.«
Aimee Barnet war auch blond. Sabine war gleich ganz bei der Sache.
»Frau Auerbach ist wirklich bewundernswert«, sagte sie. »Hat selbst vier Kinder und holt noch andere ins Haus.«
»Ach, sie macht das aus dem Handgelenk. Dafür soll Hannes dann ja nach Paris. Na, ich glaube, daß es ihm da nicht so gut gefallen wird wie dem Pierre hier bei uns.«
»Und in Hohenborn sind auch noch Schüler?« fragte Sabine. Doch nun wurde Carla stutzig.
»Noch neunzehn. Aber sag mal, warum interessierst du dich so dafür?«
»Weil wir seit heute auch eine Französin haben«, erwiderte Sabine wahrheitsgemäß. »Sie war plötzlich da und liegt nun mit einer Lungenentzündung bei uns. Und wir rätseln, welcher Wind sie zu uns verschlagen hat.«
»Wenn sie mit einem der Schüler verwandt wäre, würdet ihr es doch bald erfahren. Hat sie denn nichts gesagt?«
»Nein, sie hat uns sogar einen falschen Namen angegeben, und da sie erst achtzehn ist, machen wir uns natürlich Gedanken. Sie heißt Aimee Barnet.«
»Barnet? Meine Güte, so heißt doch Pierre auch, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich komme da nicht ganz mit.«
»Vielleicht wollte sie ihren Bruder besuchen und ist an der falschen Seite des Sternsees gelandet«, überlegte Sabine. »Sie war schon sehr fiebrig. Vielleicht wußte sie auch die Adresse nicht mehr.«
»Da sollten wir aber gleich mal bei den Auerbachs nachfragen«, schlug Carla vor.
»Nein, einen Schrecken will ich ihnen auch nicht einjagen. Aber ich werde mal vorbeischauen. Vielleicht lerne ich Pierre kennen.«
Und das tat sie dann auch.
*
Sabine traf zuerst jedoch nur Inge Auerbach und Bambi an.
»Wie nett, daß Sie uns auch mal wieder besuchen, Frau von Jostin«, wurde sie herzlich begrüßt.
»Da freuen wir uns aber«, warf Bambi ein. »Habt ihr viele Kinder in der Klinik?«
»Eine ganze Menge. Wir sind voll belegt. So hatten wir es uns gar nicht vorgestellt«, erwiderte Sabine. »Wie geht es denn der übrigen Familie?«
»Gut«, erwiderte Inge. »Trinken Sie eine Tasse Kaffee mit uns?«
Eigentlich hatte Sabine schon bei Carla genug Kaffee getrunken. Aber sie wußte, daß sich bei den Auerbachs die ganze Familie um den Tisch versammelte, und bei dieser Gelegenheit konnte sie ganz unauffällig auch Pierre kennenlernen. Grundlos wollte sie keinen Wirbel hervorrufen.
»Ruf mal die Buben, Bambi«, sagte Inge Auerbach. »Wir haben nämlich noch einen kleinen Gast«, erklärte sie Sabine.
»Ich habe es schon von Carla gehört. Er soll sehr nett sein.«
»Ja, das ist er.«
Gleich darauf stand Sabine Pierre gegenüber.
»Das ist Frau von Jostin von der Sternsee-Klinik«, übernahm Bambi in ihrer unbefangenen Art die Vorstellung.
Pierre wurde gleich noch blasser, und das entging Sabine nicht.
»Man stellt den Herrn zuerst vor, Bambi«, sagte Hannes mahnend.
»Pierre ist doch kein Herr«, lachte Bambi.
»Mein Freund heißt Pierre Barnet und ist aus Paris, Frau von Jostin.«
»Gefällt es dir?« fragte Sabine in französischer Sprache.
»Sehr gut«, erwiderte Pierre mit bebender Stimme.
»Das freut mich. Wir haben jetzt auch eine Französin in der Sternsee-Klinik. Sie ist leider sehr krank.«
»Sehr krank?« fragte Pierre angstvoll. »Oh… Tante Inge, bitte, nicht böse sein! Ich muß etwas sagen. Ich muß dir etwas sagen.«
Inge war seine eigentümliche Reaktion nicht entgangen.
»Jetzt gleich, Pierre?« fragte sie liebevoll.
»Ja, jetzt gleich. Ich muß es dir allein sagen, Tante Inge.«
»Dann komm, mein Junge.«
Hannes schüttelte verwundert den Kopf, und Bambi blickte ihnen sehr nachdenklich nach.
»Pierre ist schon den ganzen Tag traurig«, stellte sie bekümmert fest. »Ob er Heimweh hat?«
»Heimweh bestimmt nicht«, erklärte Hannes.
Nein, Heimweh war es nicht, nur Angst um Aimee, die Pierre sich nun von der Seele schluchzte.
Mütterlich legte Inge den Arm um ihn.
»Das alles ist doch gar nicht so schlimm«, meinte sie tröstend. »Es kommt schon wieder in Ordnung.«
»Nichts kommt in Ordnung. Maman will sich von Papa scheiden lassen«, flüsterte er niedergeschlagen.
Das war allerdings sehr schlimm, und darauf wußte Inge augenblicklich auch nichts zu sagen.
»Nun sagst du auch nichts mehr, Tante Inge. Es ist sehr schlimm, nicht wahr?«
»Es ist gut, daß ich es weiß, Pierre. Jetzt können wir darüber sprechen und uns auch um Aimee kümmern. Du sollst doch Vertrauen zu uns haben. Wir sind deine Freunde.«
»Verzeihst du mir, daß ich es nicht gesagt habe?«
Sie strich ihm weich durch das Haar.
»Da gibt es nichts zu verzeihen, Pierre. Wenn man so großen Kummer hat, fällt es schwer zu sprechen.«
»Und ich möchte euch doch keinen Ärger bereiten«, flüsterte er.
»Du bereitest uns doch keinen!« beruhigte sie ihn. »Möchtest du jetzt mit Frau von Jostin sprechen?«
»Nicht so gern. Wenn sie nun Aimee wieder fortschicken?«
»Das tun sie bestimmt nicht. Sie ist doch krank. Dr. Allard wird sie erst gesund pflegen.«
»Aimee will aber auch nicht mehr heim, Tante Inge«, sagte Pierre scheu.
Da stand sie nun vor einem schwierigen Problem, und dieses war nur mit den Eltern von Pierre und Aimee zu lösen.
»Wir werden darüber noch sprechen, Pierre«, erklärte sie liebevoll. »Jetzt gehen wir aber zurück zu den anderen.«
*
Von alldem wußte Madeleine Barnet nichts, und während sie schlief, machte sie sich auch keine Gedanken. Als sie dann aber erwachte, kamen doch Gewissensbisse. Sie wollte sie sich ausreden, aber es gelang ihr nicht.
Sie nahm ein Bad, mit aller Vorsicht, damit sie ihre Frisur nicht zerstörte, und betrachtete sich darauf lange im Spiegel.
Ihr Gesicht war glatt und schön, die winzigen Fältchen in den Augenwinkeln fielen kaum auf.
Niemand glaubte ihr, daß sie dreiundvierzig Jahre alt war, und sie wollte es nicht wahrhaben.
Marcel liebte sie. Sie war heraus aus ihrem Alltag und wollte ihr Leben nun richtig genießen. Immer hatte sie Rücksicht auf Maurice genommen, dann natürlich auch auf die Kinder.
Nein, an die Kinder wollte sie nicht denken, jetzt nicht. Sie strich die steile Falte glatt, die sich zwischen den Augen gebildet hatte.
Die Kinder waren schon fast erwachsen. Aimee würde bestimmt bald wieder einen Freund finden, und Pierre konnte noch ein paar Jahre in ein Internat gehen.
Er hatte doch ohnehin so gedrängt, von zu Hause wegzukommen und an diesem Schüleraustausch teilzunehmen.
Aber hatte er nicht nur deswegen so gedrängt, weil er fühlte, daß sich etwas in ihrem Familienleben geändert hatte?
Das ist nur darum gekommen, weil Maurice ständig unterwegs war, redete sie sich wieder ein. Dann klopfte es, und Marcel trat ein.
Er lächelte etwas gequält, aber das bemerkte sie nicht. Sie war jetzt nur darauf bedacht, ihm zu gefallen.
»Was soll ich anziehen, mon chér?« fragte sie. »Wohin gehen wir?«
»Ich fürchte, wir können nicht ausgehen, mon bijou«, erwiderte er. »Leider ist meine Überweisung noch nicht eingetroffen, und hier auf der Bank stellen sie sich ziemlich an.«
Um Geldangelegenheiten hatte sich Madeleine nie gekümmert. Das war Maurices Aufgabe, denn er hatte überall Kredit.
»Oh, ein bißchen Geld habe ich schon noch«, sagte sie leichthin. »Heute können wir jedenfalls ausgehen. Tausend Franc werden es noch sein.«
»Tausend Franc, damit kommen wir nicht weit.«
Er lachte blechern auf, weil er sich erst von seiner Bestürzung erholen mußte.
»Morgen wirst du dein Geld erhalten, und eines Tages werde ich auch meine Aktien freibekommen. Auf Maurice werde ich wohl nicht rechnen können. Diesmal hat er auch kein Geld im Safe gelassen.«
Sie wußte nicht, daß Aimee dies an sich genommen hatte. Aber gerade dieser Umstand sollte ihr schnell die Augen über Marcel öffnen.
»Du willst doch nicht sagen, daß du nur tausend Euro bei dir hast?« fragte er fassungslos.
»Vielleicht etwas mehr. Aber warum starrst du mich so an? Du willst doch nicht mein Geld? Viel können wir damit ohnehin nicht anfangen, Marcel.«
»Willst du auf meine Kosten leben?« fuhr er sie an.
Unwillkürlich wich sie einen Schritt zurück.
»Aber wir wollen doch heiraten«, sagte sie mit der Naivität der verwöhnten Frau.
Er lachte höhnisch auf.
»Heiraten? Haben wir von Heirat gesprochen? Mein liebes Kind, du bist mehr als töricht. Wir wollten uns ein paar schöne Wochen machen, aber eigentlich bin ich es gewohnt, daß ich dafür nicht bezahle.«
Madeleine sah ihn sprachlos an. Anfangs hatte sie noch geglaubt, daß er Witze mache.
Aber nun wurde ihr doch klar, daß dies bitterer Ernst war und seine charmante Maske fiel.
»Wie schätzt du mich ein!« stieß sie empört hervor.
»Wie schon. Als eine Frau, die sich gern mal amüsieren möchte und sich das auch was kosten läßt. Ja, glaubst du etwa, daß ich mich mir dir eingelassen hätte, nur um deines noch ganz hübschen Gesichtes willen, Madeleine? Du gehst auf die Fünfzig zu. Du kannst bald Großmutter sein. Himmel, hätte ich doch nur… wäre ich doch nur bei der süßen kleinen Aimee geblieben. Sie hätte wenigstens eine Mitgift von ihrem Vater bekommen.«
Das war zuviel für Madeleine. Sie schämte sich zwar in Grund und Boden, aber das war jetzt nicht das dominierende Gefühl.
Sie war eine überaus temperamentvolle, manchmal sogar unbeherrschte Französin.
»Du bist widerlich!« schrie sie ihn an. »Du Gigolo, läßt dich von Frauen aushalten und meinst gar, daß mein Mann Aimee gestattet hätte, dich zu heiraten! Da bist du aber auf dem Holzweg! Er fand dich schon immer mies, aber ich dachte… ich dachte…«
Ja, was hatte sie eigentlich gedacht? Daß ein Mann wie Maurice eifersüchtig sein könnte auf einen solch miesen Burschen?
Wie oberflächlich ihre Gefühle für Marcel waren, spürte sie erst jetzt. Sie verstummte und starrte ihn verächtlich an.
»Oh, mein Gott, ich Närrin!« stöhnte sie dann.
»Ja, eine Närrin bist du, und ich habe mir alles versaut. Sieh zu, wie du weiterkommst.« Mit einem lauten Knall fiel die Tür hinter Marcel ins Schloß.
Madeleine warf sich aufs Bett und weinte voller Wut. Doch dann kamen andere Gedanken.
Maurice hatte ihren Brief wahrscheinlich noch gar nicht. Er wollte doch erst übermorgen zurückkommen. Noch war alles gutzumachen, wenn sie gleich wieder nach Paris zurückfuhr.
Es war eine weite Fahrt, und in der Nacht fürchtete sie sich, wenn sie allein fuhr, aber heute mußte es sein.
Der Gedanke, ihren schrecklichen, unverzeihlichen Fehler noch gutmachen zu können, trieb sie vorwärts. Gut, daß sie die Koffer noch nicht ausgepackt hatte.
Ihre Schuldgefühle versuchte sie zu unterdrücken. Verzeihen würde Maurice ihr nie. Aber wenn es ihr gelang, sich vor dem Schlimmsten, vor seiner Verachtung, zu bewahren, dann konnte sie gutmachen an ihm und den Kindern, was sie getan hatte.
*
Pausenlos war Maurice Barnet durchgefahren. Nur an der Raststätte hatte er, weil er sowieso tanken mußte, schnell eine Tasse Kaffee getrunken.
Er wußte, daß er noch fünf Stunden zu fahren hatte. Wenn er Glück hatte und dieses Hohenborn gleich fand, würde er gegen acht Uhr abends dort sein.
Er hatte Glück, oder ein guter Geist begleitete ihn, um das auszugleichen, was ihm Madeleine angetan hatte.
Je näher er dem Sonnenwinkel kam, desto ruhiger wurde er. Die abendliche friedliche Landschaft dämpfte seine Erregung.
Wenigstens seinen Pierre, seinen Sohn, würde er nun bald wiedersehen. Es gab ihm Trost in dieser deprimierten Verfassung.
Und dann hielt er vor dem Haus der Auerbachs, dessen Fenster hell erleuchtet waren.
Ein Hund begann zu bellen, kam zum Gartentor geschossen und sprang an dem Zaun empor.
Von der Haustür, die sich auftat, tönte eine Bubenstimme an sein Ohr: »Was führst du dich so auf, Jonny. Komm herein, aber dalli!«
»Komm, Jonny, mein Guter«, schloß sich ein Kinderstimmchen an.
Aber Jonny wollte doch mit seinem Bellen verkünden, daß jemand vor der Tür stünde.
Dann kamen drei Gestalten aus der Tür, und die eine kannte Maurice Barnet.
»Pierre!« rief er.
»Papa! Oh, Papa!« rief Pierre zurück.
Und dann hielt Maurice seinen Jungen auch schon in den Armen, und Jonnys Kläffen ging in freundliches Winseln über.
Hannes blieb draußen, aber Bambi sauste ins Haus zurück.
»Jetzt werdet ihr aber staunen«, stieß sie atemlos hervor. »Pierres Papa ist nämlich gekommen!«
Es war für den wohlerzogenen Franzosen eine recht heikle Situation, als er von der ganzen Familie Auerbach empfangen wurde.
Aber bei ihm überwog jetzt das Gefühl, daß Pierre hier gut aufgehoben gewesen war.
Er entschuldigte sich mit aller Höflichkeit und bat, mit Pierre sprechen zu dürfen.
Pierre sah seinen Vater aufmerksam an.
»Wenn es wegen Aimee ist, Papa, das wissen alle. Sie ist in der Sternsee-Klinik. Sie ist plötzlich krank geworden.«
»Krank? Ist sie…« Er fiel schwer in einen Sessel.
»Es wird schon wieder«, brummte Hannes, aber dann scheuchte Inge Auerbach die Kinder mit einer Handbewegung aus dem Zimmer.
»Ruhen Sie sich erst einmal aus, Monsieur Barnet«, sagte sie in ihrer herzlichen Art. »Werner, bring einen Drink. Oder möchten Sie lieber etwas essen? Natürlich müssen Sie etwas essen, Sie sind ja lange unterwegs gewesen. Wir können dann in aller Ruhe sprechen. Sie können wegen Aimee unbesorgt sein. Ich habe eben noch mal mit Dr. Allard telefoniert. Sie schläft jetzt.«
»Sie sind zu gütig«, stammelte Maurice Barnet. »Ich bin etwas verwirrt.«
Und völlig aus dem Gleichgewicht geraten, dachte Inge.
*
»Nun ist dein Papa da«, meinte Bambi zu Pierre. »Er ist ein lieber Papa, der sich viele Sorgen um euch macht. Jetzt sind wir aber sehr froh, daß wir ihm sagen können, daß Aimee hier ist, nicht wahr, Pierre?«
»Ja, jetzt bin ich froh darüber«, erwiderte er leise und streichelte ihre Wange. »Ihr seid alle sehr lieb zu mir.«
»Er wird dich doch nicht mitnehmen wollen, Pierre?« fragte Hannes dagegen skeptisch.
»Ach, wir sagen ihm schon, daß Pierre bei uns bleiben soll«, erklärte Bambi. »Wo wir uns doch so gut verstehen.«
Währenddessen bekam Maurice Barnet einen echten französischen Kognak, der seine Lebensgeister weckte.
Während Werner Auerbach – Inge war der Meinung, daß in diesem Fall ein Mann das besser konnte – ihn in kurzen Zügen aufklärte, bereitete sie schnell ein Essen für ihn.
Es ging blitzgeschwind, und als die hübsch angerichtete Platte vor ihm stand, merkte er erst, wie hungrig er war.
»Sie sind wirklich zu gütig«, sagte er wieder. »Ich weiß nicht, wie ich mich erkenntlich zeigen soll.«
»Oh, da werden wir schon etwas finden«, meinte Inge unbefangen. »Zum Beispiel könnten Sie Pierre noch länger bei uns lassen, anstatt Hannes mitzunehmen.«
Sie wollte ihm gleich eine Brücke bauen, damit er seine Verlegenheit überwand. Und ihr gelang es auch, seine Zunge zu lösen.
Er wußte nun also, warum Aimee hergekommen war, und sie wußten, was ihn beschwerte. Er hatte offen gesagt, daß seine Frau ihn verlassen hatte.
»Warum – ich weiß es nicht. Bin ich schuld? Ich frage es mich ständig. Ich sollte Sie nicht mit meinen Problemen behelligen.«
Werner Auerbach, sonst nicht gerade mitteilsam, lächelte.
»Oh, meine Frau befaßt sich ständig mit den Problemen ihrer Mitmenschen«, entgegnete er leichthin. »Sie sind nicht der erste und werden auch nicht der letzte sein. Darüber sollten Sie sich die wenigsten Sorgen machen, Monsieur Barnet.«
»Ich mache mir jetzt sehr große Sorgen um meine Aimee«, murmelte er. »Wann werde ich sie können sehen?«
»Morgen«, sagte Inge.
»Ich werde mir ein Hotelzimmer besorgen müssen. Es ist schon sehr spät.«
»Sie können im Gästezimmer schlafen«, bemerkte Inge. »Das ist doch selbstverständlich.«
»Aber das kann ich nicht annehmen. Sie haben Mühe mit Pierre, Sie haben noch Mühe mit mir.«
»Keine Mühe«, lächelte Inge. »Es ist uns eine Freude. Wir haben Pierre gern, sehr gern. Er ist ein sehr lieber Junge. Wir freuen uns wirklich, seinen Vater kennenzulernen.«
»Sie sind gütig, zu gütig, Madame«, sagte Maurice Barnet. »Sie, Herr Professor Auerbach, können sich sehr, sehr glücklich schätzen, eine solche Frau zu haben.«
»Ich schätze mich glücklich, aber Sie brauchen deswegen nicht so offiziell zu werden«, erklärte Werner Auerbach in seinem besten Französisch, damit der andere ihn auch ja richtig verstehen sollte. »Trinken wir noch ein Gläschen, dann lockert sich die Stimmung.«
Ein sehr müder, aber im Innern wieder ruhig gewordener Maurice Barnet sank an diesem Abend in dem hübschen Gästezimmer ins Bett.
Ihm fielen die Augen zu, nachdem sein Sohn ihm einen Gutenachtkuß gegeben hatte. Und das war schon lange nicht mehr der Fall gewesen. Er war beinahe glücklich. Pierre mußte das hier wieder gelernt haben, aber die Auerbach-Kinder taten es ja auch. Es war beglückend. Mit diesem Gedanken schlief er ein.
*
Ricky Rückert hatte Charly noch einmal in den Garten gelassen, während ihr Mann Schulaufgaben korrigierte.
Charly war auch ein Collie und der Vater von Jonny. Er war schon viel behäbiger als sein Sohn, und ihn konnte nichts mehr aus der Ruhe bringen, kein Besuch, kein Auto, nicht mal das Kläffen seines Sohnes, das Ricky vorhin gehört hatte.
Sie warf einen Blick über den Zaun und sah ein fremdes Auto vor dem Haus ihrer Eltern stehen. Das war Grund genug für sie, ihren Mann zu stören. Aber er ließ sich solche Störungen ja gern gefallen.
»Du, Schätzlein, die Eltern haben Besuch«, sagte Ricky.
»Wen denn?«
»Weiß ich nicht. Es ist ein fremdes Auto. Ein toller Wagen. Einfach riesig.«
»Und nun brennt mein holdes Weib in lodernder Neugier«, scherzte er.
»Sie haben gar nicht gesagt, daß sie Besuch kriegen. Ich war doch nachmittags noch drüben.«
»Meine Süße, ich liebe dich sehr, aber meine sehr geschätzten Schwiegereltern brauchen nicht jedesmal gleich gerannt zu kommen, wenn sie Besuch kriegen.«
»So meine ich es doch auch nicht, Fabian. Ich dachte nur, wegen Aimee, weißt du, wegen Pierres Schwester… Ich bin nicht neugierig«, verteidigte sie sich.
Er strich ihr mit dem Finger zärtlich über die Nase.
»Geh doch rüber, Kleines. Ich habe noch zu tun, und Henrik schläft. Ich möchte, daß auch du ruhig schlafen kannst.«
»Du machst dich über mich lustig«, sagte Ricky kleinlaut.
»Gott bewahre! Ich mache mir auch Gedanken um den Jungen. Ausgerechnet ihn mußte ich bei der Familie unterbringen. Man soll doch nie…« Er unterbrach sich.
»Was soll man nie?« fragte Ricky.
»Na, ich habe doch gedacht, daß wir für Hannes den besten Platz aussuchen müßten, wenn er schon mit nach Frankreich will. Aber siehe da, ich stürze die Familie wieder einmal in Ungemach. Wir haben schon ein besonderes Talent, die Probleme anzuziehen, Rickylein.«
»Ach, das wird Mami schon ausbügeln. Da bin ich nicht bange«, erwiderte Ricky. »Pierre ist ein goldiger Junge. Hannes lernt direkt Anstand von ihm. Es wäre doch schrecklich gewesen, wenn er in so eine Familie gekommen wäre, wo selber dauernd Krach ist.«
»Na, ehrlich gesagt, reine Engel sind auch nicht alle von unseren Austauschschülern. Mit Pierre haben wir schon Glück, nur das Drumherum will mir nicht so recht schmecken. Na, schau mal rüber, aber bleib nicht so lange.«
*
Inge Auerbach räumte gerade ihre Küche auf, als Ricky ans Fenster klopfte.
Klingeln wollte sie nicht, um die Kinder nicht aufzuwecken.
»Kleines, so spät noch?« fragte Inge, aber sie freute sich doch, ihre Ricky noch mal zu sehen.
Es tröstete sie immer, daß sie so dicht bei ihnen wohnte, da Jörg mit seiner jungen Frau so fern von ihnen in Kanada lebte.
Bei ihrer Mami machte Ricky keine Umschweife. »Ich habe gesehen, daß ein fremder Wagen vor der Tür steht, und da mußte ich doch mal gucken, was los ist.«
»Pierres Papa ist gekommen. Ein netter Mann. Ich bin ja froh, daß er da ist. Da gibt es Schwierigkeiten im Familienleben. Seine Frau ist auf und davon. Weißt du, Ricky, mich beruhigt es, daß Hannes nun nicht nach Frankreich fahren kann. Und ihn beruhigt es anscheinend auch«, fügte sie lächelnd hinzu.
»Ich habe es auch schon gemerkt, daß er Angst vor der eigenen Courage bekommen hat«, sagte Ricky. »Du hast uns halt zu sehr verwöhnt, Mami. Wir kommen nicht von deinem Kochtopf los.«
»Nur vom Kochtopf nicht?« fragte Inge.
»Natürlich nicht nur. Du bist halt die beste Mami der Welt. Ich bin ja auch froh, daß ich immer zu dir kommen kann. Wenn ich in Stellas Haut stecken würde, na, ich weiß nicht.«
»Apropos Stella, das habe ich ja ganz vergessen, dir zu sagen. Rosmarie hat mich vorhin angerufen. Stella hat geschrieben, daß sie nächsten Monat vierzehn Tage kommen will.«
Rosmarie war Stellas Mutter und Jörg Auerbachs Schwiegermutter, genauso wie Rickys, denn Stella war Fabian Rückerts jüngere Schwester und seit ein paar Monaten mit Rickys Bruder Jörg verheiratet.
»Davon hat Mutti mir aber nichts gesagt«, meinte Ricky nachdenklich.
Inge war die Mami, und Rosmarie war die Mutti. Auch das wußten die, die die verschlungenen Familienverhältnisse kannten.
»Sie macht sich wohl Sorgen«, äußerte Inge nachdenklich. »Für Stella ist es eben doch nicht so einfach, sich in dem fremden Land zurechtzufinden. Und wir kennen ja unseren Jörg. Ein sehr nachsichtiger Ehemann wird er nicht gleich sein.«
»Machst du dir auch Sorgen, Mami?« fragte Ricky.
»I wo! Die brauchen halt ihre Zeit um sich zusammenzuraufen. Bei ihnen geht es nicht so einfach wie bei euch, Ricky. Bei euch hat von Anfang an alles gestimmt. Da gab es keine anderen Mädchen und keine anderen Männer.«
»Da muß ich aber Stella in Schutz nehmen, Mami. Für sie gab es auch immer nur Jörg.«
»Ja, sie hat ihn zu sehr angehimmelt und nicht erkannt, daß man die Auerbach-Männer an der langen Leine laufen lassen muß. Ich mache mir auch meine Gedanken, Ricky, aber ich weiß auch, daß Jörg im Grunde doch treu ist.«
»Vielleicht kriegt Stella ein Baby und will es hier zur Welt bringen«, überlegte Ricky.
»Du liebe Güte, das würde dann aber eine lange Trennung von Jörg werden. Na, wir werden ja sehen. Weiß Fabian es auch noch nicht, daß sie kommen will?«
»Das hätte er mir bestimmt gesagt.«
Nun waren sie auf ein ganz anderes Thema gekommen. Aber da Ricky sich nicht lange aufhalten wollte, mußte auch dieses beendet werden.
Doch Werner Auerbach, der die Stimme seiner Tochter gehört hatte, kam auch noch in die Küche, gerade als Ricky sich verabschiedete.
»Na, hör mal«, bemerkte er gekränkt, »du bist da und sagst deinem alten Vater nicht mal guten Abend?«
»Schöner alter Vater«, lachte Ricky. »Paps, du bist ein Goldschatz. Aber jetzt muß ich zu meinen beiden Männern, sonst werden sie grantig.«
»Ich bringe dich nach Hause«, erklärte Werner Auerbach.
»Damit mich keiner wegfängt«, meinte Ricky lächelnd. »Tschüs, Mami, schlaf schön. Bis morgen.«
Ein paar Minuten hatte Werner Auerbach seine Tochter noch für sich. Er genoß es. Ricky war Inges Ebenbild. Er erlebte in ihr immer wieder die Zeit, in der Inge so jung gewesen war, und es machte ihn glücklich, daß Ricky sich genauso entwickelte wie ihre Mutter.
Bambi war zwar das Glück seiner reifen Jahre, aber sie konnte ja gar nicht so werden wie seine Inge, da sie ein Adoptivkind war. Zwar ein von allen heißgeliebtes, aber doch das Kind anderer Eltern.
»Mami machte sich Sorgen um Jörg und Stella«, sagte er.
»Ja, ich weiß, Paps, aber sie gibt es ja nicht zu. Warum mußten sie auch nach Kanada gehen. Wenn man so jung ist, braucht man halt Nestwärme. Ich bin doch auch froh, wenn ich wenigstens auf einen Guck zu euch hineinschauen kann.«
»Und Jörg ist wie ich«, gab er zu. »Er meint auch, daß sich die Frau dem Mann anpassen müsse.«
»Darin hast du ja ein enormes Glück gehabt, Paps. So eine Frau findet nicht jeder.«
»Fabian hat sie in dir ja auch gefunden«, bemerkte er zärtlich. »Gute Nacht, mein Mädchen. Bleib so, wie du bist.«
»Ich bin auch erst so geworden durch meinen Mann, Paps«, äußerte Ricky gedankenvoll. »Du hast wohl schon ganz vergessen, wie ich früher war.«
»Du bist glücklich«, sagte er leise.
»Ja, ich bin glücklich. Ich habe genau den Mann bekommen, der zu mir paßt. Mehr Glück kann man ja nicht haben.«
Zärtlich küßte sie ihren Vater auf die Wange, und dann ging sie in ihr Haus zurück, zu ihrem Mann und ihrem kleinen Sohn.
Fabian stand schon an der Tür und fing sie in seinen Armen auf.
Ihre Welt war ganz in Ordnung, und sie wünschte sich nichts mehr, als daß es immer so bleiben möge.
*
Bei Madeleine Barnet war genau das Gegenteil der Fall. Sie war so brutal auf den Boden der Wirklichkeit zurückbefördert worden, daß sie vor sich die Hölle zu sehen vermeinte.
Mit jedem Scheinwerfer, der ihr bei ihrer nächtlichen Fahrt entgegenkam, glaubte sie von einem Blitzstrahl getroffen zu werden.
Allein durch die Angst, die sie während dieser endlos dünkenden Fahrt bewegte, büßte sie schon einen Teil ihrer Sünden ab.
Sie mußte zu konzentriert auf die Straße achten, um an anderes denken zu können.
Nur ab und zu schickte sie ein Stoßgebet zum Himmel, daß Maurice noch nicht zurückgekehrt sein möge und sie den Brief vernichten könnte, diesen unseligen Brief, den sie in einer so zwiespältigen Stimmung geschrieben hatte.
Feige war sie gewesen. Ins Gesicht hätte sie es Maurice nicht sagen können, daß sie sich ihm trennen wolle. Wegen dieses Gigolos? hätte er wahrscheinlich sarkastisch gefragt.
Ja, Maurice hatte Marcel gleich als Gigolo bezeichnet, zu Aimees und auch ihrer Verbitterung. Aber er hatte damit seine bessere Menschenkenntnis bewiesen. Maurice war unbestechlich.
Er kannte auch die Schwächen seiner Frau, aber er hatte sie mit ihrem Schwächen geliebt.
Eigentlich hatte es zwischen ihnen nie Differenzen gegeben, obgleich sie immer gern geflirtet hatte. Doch es war stets nur bei einem Flirt geblieben. Betrogen hatte sie ihn nie, bis Marcel kam, in den Aimee sich verliebt hatte, die bezaubernde, junge Aimee.
Aber Marcel hatte dann seine ganze Aufmerksamkeit nur Madeleine geschenkt, und sie hatte in einer Stimmung, die sie heute nicht mehr begreifen konnte, ein ungeheures Triumphgefühl verspürt, ihre erwachsene Tochter noch ausstechen zu können.