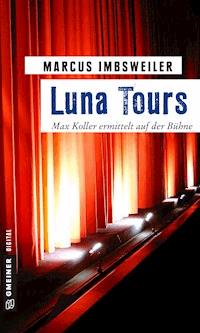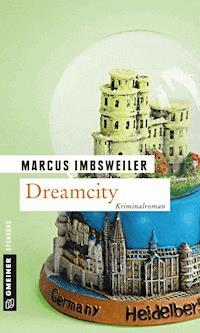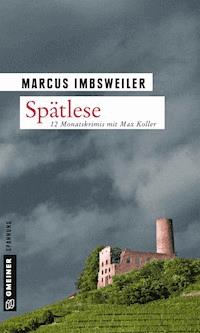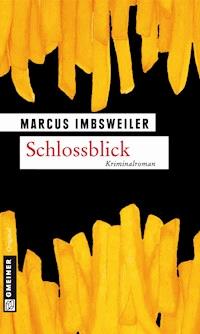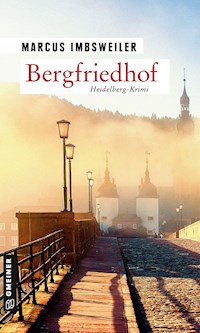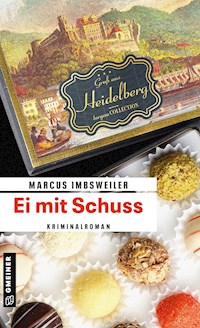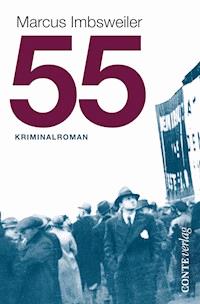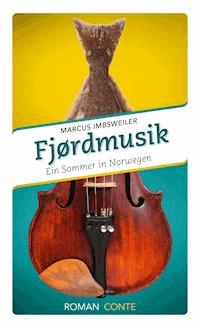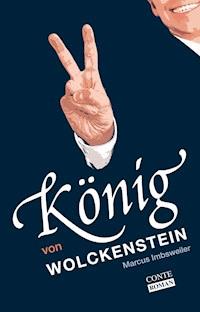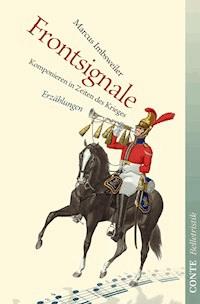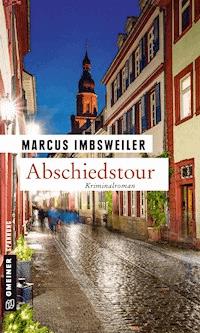
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Privatdetektiv Max Koller
- Sprache: Deutsch
Prominenz am Neckar: US-Präsident Obama besucht Heidelberg. Entsprechend groß sind die Sicherheitsvorkehrungen. Da wird der Mord an einem Privatmann fast zur Nebensache - aber eben nur fast. Denn Harald C. Schmider, das Opfer, hatte ein Verhältnis mit Christine, der Ex von Privatermittler Max Koller. Und nun steht Koller selbst unter Mordverdacht. Eine abenteuerliche Flucht durch die Rhein-Neckar-Region beginnt, die schließlich auch Max Koller vor die existenzielle Frage stellt: Hat er Schmider getötet?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcus Imbsweiler
Abschiedstour
Kollers achter Fall
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2015 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2015
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © eyetronic – Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-4740-2
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Prolog
Eine Handvoll Häuser, irgendwo im Kraichgau. Flimmernde Hitze verwischte die Konturen.
Keine Menschenseele unterwegs.
Windstille. Mittagsruhe.
Ein Gasthof mit Blumenkästen vor den Fenstern. Parkende Autos neben einer Linde. Getreidefelder, die in der Sonne leuchteten. Ein Kapellchen, schmal wie ein Handtuch.
Und: eine Telefonzelle.
Ich wartete. Eine Katze strich langsam an den Autos vorbei. Ihre Bewegungen waren fließend, der Schwanz stand senkrecht in die Höhe. Einmal blieb sie stehen und streckte sich. Dann streunte sie weiter, ohne Eile, ohne Jagdtrieb. Als sie die Telefonzelle erreichte, schnupperte sie kurz. Bog um die Ecke und verschwand.
Erneut versank alles in Stille.
Mit einem Ruck löste ich mich aus dem Schatten einer Scheune und schlenderte über den Parkplatz. Aus den geöffneten Gasthoffenstern drangen gedämpfte Stimmen. Weit oben auf einem der Hügel zog ein Traktor seine Runden. Über ihm kreisten zwei Raubvögel.
Die Telefonzelle war gelb, wie alle Telefonzellen früher. Bevor sie magenta wurden oder farblos oder gleich ganz abgeschafft. Es war ein Wunder, dass es in diesem Nest überhaupt so einen Kasten gab. Ein Zeichen des Himmels, könnte man sagen.
Die Tür der Zelle öffnete sich mit einem hässlichen Quietschen. Drinnen herrschten Temperaturen wie in einer Sauna. Der schwarze Telefonhörer glühte förmlich. Ich legte ihn oben auf den Metallkasten, hielt die Tür mit einem Fuß auf und durchsuchte meine Hosentaschen. Trotz offener Tür brach mir sofort der Schweiß aus allen Poren. Mein T-Shirt saugte sich an den Schulterblättern fest. Der Parkplatz war noch immer menschenleer.
Ich fummelte ein 20-Cent-Stück aus der Tasche. Zwei Mal fiel es durch, bevor der Apparat es akzeptierte. Ein paar Sekunden hielt ich den Telefonhörer unschlüssig in der Hand, dann wählte ich die Privatnummer von Kommissar Fischer.
Das Freizeichen ertönte. In einer Ecke der Zelle hing ein riesiges Spinnennetz mit vertrockneten Fliegen darin. Das Telefonbuch lag zerfleddert auf dem Boden.
»Fischer?«
»Max Koller.«
»Sie?« Er schnappte nach Luft. »Wo stecken Sie, Mann?«
»Irgendwo.«
»Sind Sie wahnsinnig, einfach durchzubrennen? Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Das bringt doch nichts!«
Ich schwieg. Poltern war Fischers Lieblingsbeschäftigung, vor allem mir gegenüber. Also ließ ich ihn schimpfen, was die alte Lunge hergab. Irgendwann würde er fertiggepoltert haben.
»Sie kommen jetzt sofort zurück und erzählen meinen Kollegen, was an diesem Abend passiert ist. Hören Sie? Wir brauchen Ihre Aussage. Sie reiten sich immer tiefer in die Scheiße! Herrgott noch mal, Koller, wir können doch über alles reden. Was ist? Hat es Ihnen die Sprache verschlagen?«
Sein Gepolter ging in Husten über. Ich wartete, bis er sich gefangen hatte, dann räusperte ich mich. »Herr Fischer …«
»Was denn?«
»Ich war’s.«
»Was?«
»Ich habe Schmider umgebracht.«
Wieder vernahm ich seine unkontrollierten Atemgeräusche. »Reden Sie keinen Quatsch, Koller!«
»Doch.«
»Hören Sie auf!«, brüllte er mit überschlagender Stimme. »Aufhören! Kapieren Sie eigentlich nie, wann Schluss mit lustig ist? Hier geht es um Mord, da haut man nicht einfach so ab und spielt seine Spielchen mit der Polizei!«
»Es ist kein Spiel.« Mit dem freien Arm wischte ich mir den Schweiß von der Stirn. »Tut mir leid, Herr Fischer. Es ist kein Spiel. Ich habe diesen Schmider umgebracht. Ich weiß es. Seit heute.«
»Das meinen Sie nicht ernst.« Das Gebrüll hatte Fischers Stimme nicht gut getan. Er klang heiser.
»Schön wär’s.« Ich stieß die Tür noch ein wenig weiter auf. »Wissen Sie, ich habe in den letzten Tagen einiges über mich erfahren. Dinge, die mir nicht gefallen. Die ich verdrängt habe, einfach weggeschoben in einen versteckten Winkel. Es ist kein Spaß, sich so kennenzulernen, ehrlich nicht. Aber ich will nicht jammern. Ich bin nicht das Opfer, ich bin der Täter.«
Auf der anderen Seite der Leitung war es ganz still. So still, dass ich in der Ferne Motorengeräusch hörte. Ich warf ein 10-Cent-Stück nach. Mehr passende Münzen hatte ich nicht. War ja auch egal. Was hatten wir noch groß zu bereden? Das Wichtigste war gesagt.
»Wo sind Sie?«, fragte Fischer schließlich.
»Unterwegs. Auf dem Weg nach Heidelberg.«
»Und ist das wirklich wahr, was Sie da sagen? Sie sind Schmiders Mörder?«
»Ja.«
Er stöhnte auf.
Ich nahm den Hörer in die andere Hand. »Wie viele Jahre kriege ich für Totschlag? Ich glaube nicht, dass es Mord war. Nicht im juristischen Sinn. Dazu hatte ich viel zu viel getrunken. Naja, ist auch egal.« Das Motorengeräusch kam näher. Ich schaute nach draußen.
»Stellen Sie sich, Koller …« Mein Kommissar pfiff aus dem letzten Loch. Ein Reifen, der Luft verlor. Mensch, Herr Fischer, reißen Sie sich zusammen! Ich bin am Ende, nicht Sie. Wenn Sie jetzt in Tränen ausbrechen, kann ich Sie nicht trösten.
»Ja«, erwiderte ich und schaute hinaus. Hinter den Bäumen blitzte es silber-blau auf. Ein Streifenwagen.
Reflexartig zog ich den Fuß aus der offenen Tür, lehnte mich an die Wand der Telefonzelle und ging langsam in die Knie. »Ja«, wiederholte ich, während ich gen Boden sank. »Ich stelle mich. Aber nur bei Ihnen.«
Er seufzte. »Ich bin nicht mehr zuständig.«
Der Wagen rollte auf den Parkplatz. Während sich die Tür der Zelle quietschend schloss, machte ich mich klein und immer kleiner. Bis das Kabel des Hörers straff gespannt war. Ich linste hinaus. Zwei Polizisten entstiegen dem Wagen und blickten sich um. Wachsamkeit pur, Witterung aufnehmend. Rechte Hand immer in Hüftnähe. Die suchten jemanden! »Herr Fischer«, flüsterte ich. »Damit eines klar ist: Ich komme nur zu Ihnen.« Dann begann es im Hörer zu piepsen, und ich verstand nicht, was Fischer sagte. Seine Kollegen verdrehten die Hälse, vergewisserten sich, kontrollierten. Der eine zückte ein Handy.
»Verstehen Sie?«, sagte ich noch, dann brach die Verbindung ab. Vorsichtig ließ ich den Hörer los. Er baumelte noch eine ganze Zeit lang am Kabel.
In der Zelle war es jetzt ganz ruhig. Gesprächsfetzen von draußen, undeutlich. Ströme von Schweiß liefen mir über das Gesicht. Die vor Hitze berstende Landschaft. Die stillen Gebäude. Ich sah, wie sich der eine der beiden Bullen in Bewegung setzte. Langsam schritt er über den Parkplatz Richtung Gasthaus. Der andere beendete sein Telefonat und folgte ihm.
Ich wartete, bis die beiden nicht mehr zu sehen waren. Danach wartete ich noch ein bisschen. Und erst dann stieß ich, immer noch kniend, die Tür der Zelle auf. Mit einer Hand, ganz behutsam. Sie quietschte trotzdem. Der Platz vor dem Gasthaus blieb menschenleer. Ich richtete mich auf, schlüpfte ins Freie und rannte los. Die Katze von vorhin kam mir in die Quere und flüchtete panisch. Ich rüber zur Scheune, wo mein Fahrrad stand. Mein gutes altes Rennrad, Treuestes der Treuen. Draufschwingen und Vollgas. Gummi. Pedale. Wie man so sagt bei Fahrrädern. Nach 200 Metern schon das Ortsausgangsschild mit dem Namen: Oberhof, durchgestrichen. Die Straße wurde zum Feldweg. Rechts und links loderten die Ähren, vor mir ging es bergauf. Steil bergauf. Ich schwitzte wie ein Ochse. Und doch hörte ich nicht eher auf zu treten, bis ich die Hügelkuppe hinter mir gelassen hatte. Bis ich außer Sicht war und sicher sein konnte, nicht verfolgt zu werden.
Kapitel 1
»Maria!«, brüllte Tischfußball-Kurt durch die Kneipe und reckte den Hals. »Maria, verdammt noch mal!«
Na, da schauten wir aber. Schauten, starrten ihn an, warfen die Stirn in Falten. Sogar seine beiden Dackel, die in einer Ecke dösten, riskierten einen Blick. Hatte der Kerl tatsächlich nach Maria gerufen? Heute?
Jetzt fiel es ihm auch auf. Er wurde rot. Dampfend rot gewissermaßen. Kurt kann nicht erröten wie ein normaler Mensch. Nicht allmählich, meine ich. Wenn, dann immer gleich Vulkan. Immer knapp vor der Eruption. Seine Augen traten hervor, während er sich schämte. Er versuchte es mit einem Ablenkungsmanöver und hob sein Orangensaftglas zum Mund, aber das war leer. Genau deshalb hatte er ja nach Maria gerufen. Auch wenn Maria an diesem Abend fehlte.
»Kann doch passieren«, zischte er und fuchtelte mit dem leeren Glas herum. »Gewohnheit! Ist euch auch schon passiert, oder?«
»Nö«, sagte der schöne Herbert, während wir anderen mit den Achseln zuckten.
Kurt warf ihm einen vernichtenden Blick zu.
Maria war nicht da, weil sie krank war. Nicht irgendwie krank, sondern richtig. Es geht zu Ende, hatte jemand behauptet. Und wenn nicht mit ihr, dann mit ihrer Kneipe, dem ›Englischen Jäger‹. Der Mietvertrag lief aus, deshalb war Maria jetzt krank. Oder umgekehrt. In den letzten Jahren hatte die Kneipe immer mal wieder vor dem Aus gestanden, aus den verschiedensten Gründen, und jetzt war es so weit. Totgesagte leben länger? Vielleicht. Endlos leben sie deswegen noch lange nicht.
»Ich besorge Nachschub«, erbot ich mich. »Ein Orangensaft und wie viel Bier?«
Ungefähr ein Dutzend Finger reckten sich. Ich kniff die Augen zusammen und versuchte zu zählen, aber zählen war nicht. Zählen wird eh überschätzt. Bis du da durch bist, haben die, die sich jetzt nicht melden, längst wieder Durst. Bring mir gleich zwei mit, Max. Und eins für den Weg. Der schöne Herbert meldete sich überhaupt nicht, er besaß nämlich nur eine Hand, und die klammerte sich am Bier fest. Dafür wackelte er mit einem Ohr. Außerdem sah ich manche Finger doppelt. Also kämpfte ich mich zur Theke durch und orderte eine ganze Kiste. Plus einmal O-Saft.
»Echt?«, fragte der Junge, der bediente. Er schwitzte über das ganze Gesicht.
»Wie, echt? Was soll der Scheiß?«
Wortlos verschwand er in der Küche. Als er wieder auftauchte, schwitzte er noch mehr. Er wuchtete die Kiste auf die Theke und drückte mir eine Bierflasche in die Hand.
»Schreib’s auf«, sagte ich und wollte los. Aber dann hielt ich inne. Irgendetwas stimmte nicht. Wieso hatte der Typ mir eine Flasche Bier …? Ich schaute die Kiste genauer an.
»Idiot! Was soll ich mit einer ganzen Kiste O-Saft? Willst du uns vergiften? Eine Flasche, Mann! Und eine Kiste Bier, nicht umgekehrt.«
Unter dem Gelächter und den Kommentaren der Umstehenden tauschte der Jüngling die Getränke aus.
Ist doch wahr. Eine Kiste Orangensaft, und das zum Abschied vom ›Englischen Jäger‹! Sakrileg.
Vor ein paar Wochen hatte ein Zettel an der Eingangstür geklebt. Zum Soundsovielten schließe der ›Englische Jäger‹ endgültig und unwiderruflich. Maria selbst hatte unterschrieben, andernfalls hätten wir an einen Scherz geglaubt. An einen verdammt schlechten Scherz. Wie unsere Stimmung war, kann man sich denken. Ich meine, es hatte sich angedeutet. Schon seit Jahren. Maria wurde nicht jünger, irgendwann ließ sie sich vertreten, dann kam ihre Krankheit. Trotzdem. Zu fünft oder sechst hingen wir um den Tisch rum und schwiegen uns an. Immer, wenn ich etwas sagen wollte, spürte ich, dass ich nur zu Plattitüden fähig war. Tischfußball-Kurt starrte mit roten Augen gegen die Decke. Einer hustete wie Kafka in seiner übelsten Zeit. Leander, unser Wald- und Wiesen-Philosoph, hielt den bärtigen Schädel gesenkt. Auf der Tischdecke vor ihm breitete sich ein kleiner runder Fleck aus. Später noch einer. Und noch einer.
»Das ist ja verheerender als damals«, murmelte Herbert mit kurzem Seitenblick auf den leeren Ärmel seines Sakkos.
Von der einen knappen Ankündigung abgesehen, machte Maria um das Ende ihrer Kneipe kein Aufhebens. Sie hatte wohl andere Sorgen. Ein paar Tage später jedoch hingen überall Zettel in der Stadt, die zum Abschiedsabend des ›Englischen Jägers‹ luden. Mit der Folge, dass der Gastraum jetzt brechend voll war. Voll mit Leuten, die noch einmal billiges Bier trinken, die noch einmal an die guten alten Zeiten erinnert werden wollten. Stühle und Tische gab es nicht; in weiser Voraussicht war alles vorher weggeräumt worden. Trotzdem standen die Gäste dicht an dicht. Es war laut, es war drückend, Trotz und Ausdünstungen lagen in der Luft, und von den Einnahmen allein dieses Tages ließ sich Marias Ruhestand hoffentlich etwas erträglicher gestalten.
»Prost«, sagte einer und hob seine Flasche. Wir knallten unsere dagegen, riefen ebenfalls Prost und legten den Kopf in den Nacken. Viel mehr passierte nicht. Wenn wir uns nicht zuprosteten, schwiegen wir oder sagten einen Satz, der im Großen und Ganzen dasselbe ausdrückte. Ein Prost mit Subjekt, Objekt und Prädikat gewissermaßen. Die reinste Beerdigungsstimmung.
Und was tut man, wenn man sich auf einer Beerdigung langweilt? Man lästert über die anderen Gäste. Anschauungsmaterial gab es reichlich. Es war ein Kommen und Gehen im ›Englischen Jäger‹, man sah Leute, die noch nie oder seit Dekaden nicht mehr hier gewesen waren, die von der Kneipe bloß gehört hatten und sie wenigstens einmal live erleben wollten, bevor sie für immer schloss. Nostalgiker. Neugierige, Eventsüchtige. Leichenfledderer!
»Jetzt kommen sie und halten Maulaffen feil«, brummte Herbert mit aller Verachtung, zu der er fähig war. »Jetzt, wo alles zu spät ist.«
Leander, der heute aussah wie Harry Rowohlt in seinen bärtigsten Zeiten, nickte versonnen.
Auch der Nächste, der zur Tür hereinwalzte, hatte den ›Englischen Jäger‹ seit Jahren gemieden. Und wohl schien er sich immer noch nicht zu fühlen. Tischfußball-Kurt saß bereits in den Startlöchern, um über den neuen Gast herzuziehen. Aber da war ich vor.
»Fatty!«, brüllte ich und verschluckte mich fast am Bier. »Ich fasse es nicht. Friedhelm Sawatzki! Wirklich, das haut mich um.«
Das war natürlich Quatsch; eher haute und rempelte ich alle anderen um, die mir im Weg standen. Fatty schaute denn auch skeptisch, als ich auf ihn zustürmte wie Moses durch das Rote Meer, und noch viel skeptischer schaute er, als ich ihm um den Hals fiel.
»Ganz schön hacke, unser Ermittler, was?«
»Mensch, Fatty, das ist echt ein feiner Zug von dir, heute zu kommen. Daran erkennt man den wahren Freund.«
»Schon gut.«
Vor ewigen Zeiten, in unseren Heidelberger Anfangsjahren, war Fatty ab und zu mit mir im ›Englischen Jäger‹ gewesen. Am Puls des Proletariats, wie er sagte. Um die antikapitalistische Theorie an der trinkfreudigen Praxis zu erproben. Aber irgendwie hatte seine Theorie nicht zur Praxis der Kneipe gepasst, nicht zu unserem sinnfreien Gelaber, zu Herberts Weltschmerz und zu Kurts Cholerik. Die übliche Zersplitterung der Linken, man kennt das. Außerdem erzählen sie im ›Englischen Jäger‹ gern Witze über Dicke. Irgendwann also war Fatty meiner Lieblingskneipe fern geblieben, um stattdessen in überteuerten Altstadtlokalen bürgerlich-gepflegt sein Weizenbier zu schlürfen. Bis heute.
»Echt, Fatty, ich könnte heulen vor Rührung!«
Entsetzt sah er mich an. »Wenn du das tust, bin ich sofort wieder draußen.«
»Na komm, nimm dir erst mal was zu trinken, dann sehen wir weiter. Es gibt sogar Weizenbier!«
»Muss das sein?«, knurrte Tischfußball-Kurt, als ich mit meinem dicken Freund in die Runde zurückkehrte. »Da kriegt man doch Platzangst, wenn so einer reinkommt.«
Viel Bewegungsfreiheit blieb nicht, da hatte er recht. Was aber keinesfalls an Fatty allein lag. Und plötzlich wurde es noch enger. Ich hatte Fatty gerade eine Flasche Weizenbier in die Hand gedrückt (»Kein Glas?« – »Quatsch nicht, trink!«), als Gedränge am Eingang entstand. Einen richtigen Aufruhr gab das. Wir spürten es als Druckwelle, die durch die Menschenmasse hindurch bis zu uns schwappte und uns zusammenpresste. Ich steckte zwischen Fatty und Herbert fest, an meinen Beinen drängten sich Kurts Dackel.
»Finger weg, du Schwuchtel!«, brüllte Kurt, ohne dass ersichtlich war, wen er meinte.
»Nicht so drücken!«, schrien einige. »Raus mit denen!«
»Ist das hier immer so?«, ächzte Fatty.
»Verpisst euch!«
Und dann sah ich rosa. Rosa im ›Englischen Jäger‹? Das geht gar nicht, hätte unsere Kanzlerin gesagt, und in diesem Fall gab ich ihr Recht. Nichts gegen ein rosa T-Shirt, jeder leistet sich mal einen Fehlgriff – aber gleich fünf, sechs, sieben von der Sorte? Dazu geknotete Luftballons als Kopfbedeckung und um den Hals eine Fliege in XXL. So enterten die Jungs das Gasthaus, mit einer heiteren Unverfrorenheit, wie man sie sonst nur von Fußballfans kannte. Dass sie besoffen waren – geschenkt. Dass sie sich zum Affen machten in ihrem infantilen Outfit – ebenfalls geschenkt. Aber dass sie unsere heilige Zeremonie störten, den Abschied vom ›Englischen Jäger‹, das war unverzeihlich. Als Polonaise in Pink quetschten sie sich durch die Menge, grüßten, sangen, pfiffen. Und filmten, klar. Abwechselnd hielten sie ihre Smartphones hoch in die dunstige Kneipenluft. Es gab wütenden Protest, doch das störte unsere Helden nicht. Die ließen an ihrer Teflon-Lustigkeit einfach alles abprallen.
»Ich hasse diese Junggesellenabschiede«, stöhnte Herbert.
»Ah«, sagte ich. »Ah ja.«
»Faschisten«, plärrte Tischfußball-Kurt. »Neofaschisten! An die Wand mit ihnen!«
Keine Ahnung, ob die rosa Jungs Faschisten waren. Vermutlich nicht. Kurt hat auch Herbert schon als Faschisten bezeichnet, nur weil der in einer schwachen Stunde seinem rechten Arm hinterhertrauerte. Mich sowieso, aus den verschiedensten Gründen. Wenn ich seinen Orangensaftkonsum ekelhaft fand oder mich über seine Dackel lustig machte. Faschismus pur! Wie auch immer, politisches Irrläufertum konnte man den frohgemuten Eindringlingen kaum unterstellen. Alles andere schon.
»Widerlich, so was«, meinte einer.
Sein Nebenmann ergänzte: »Fragt sich ohnehin, was es zu feiern gibt, wenn einer heiratet.« Ich schickte ein Prost in seine Richtung.
»Warum kommen die überhaupt hierher?«, sagte Herbert. »Sollen sie doch in der Hauptstraße bleiben oder in der Unteren, da finden sie genug Idioten für ihre Spielchen.«
Kurt sagte nichts, sondern fletschte die Zähne, als sei Kannibalismus die einzige Sprache, die Junggesellen verstünden.
Fatty rempelte mich an. Ob versehentlich oder um meine Aufmerksamkeit zu gewinnen, ließ sich in dem Gedränge nicht sagen. »Kannst du dir vorstellen, dass ich demnächst auch so rumlaufe?«
»Ist nicht wahr!«
»Doch. Ein Kumpel von mir heiratet. Der freut sich schon seit Wochen auf die Polonaise durch die Altstadt.«
»Und du machst da mit?«
Er zuckte mit den Achseln. »Die Zeiten ändern sich. Als du damals geheiratet hast …«
»Hab ich nicht«, unterbrach ich ihn.
»Ich meine, gebechert wurde da auch, Ehrensache. Aber still und für uns, ohne andere Leute damit zu behelligen. Stimmt’s?«
»Hab nie geheiratet.«
»Weiß Christine das?«
»Welche Christine? Kenne keine Christine. Falls du meine Mitbewohnerin meinst …«
»Genau die.«
»Und wo ist die heute? Wenn sie meine Frau wäre oder etwas von der Sorte, würde sie mir ja wohl an so einem Abend Beistand leisten. Das müsste sie doch, oder? Aber das«, ich legte einen Arm um seinen Nacken, »tun nur die echten Freunde. Die hundertprozentigen, verstehst du?«
»Mann, du bist wirklich besoffen, Max.« Er schüttelte den Kopf.
Und dann hatten sie uns umzingelt. Die gutgelaunten Abschiedler. Ein Schwall von Ausgelassenheit überrollte uns. Monsterwelle in Rosa! Sie hatten einen Bauchladen dabei und zig Spielideen, und dass wir uns entnervt wegdrehten oder mit den Augen rollten, scherte sie kein bisschen.
»Kondome zwei Euro! Hey, ist für’n guten Zweck.«
»Himbeergeschmack!«
»Nun macht euch mal locker, Leute!«
»Wollen doch nur’n bisschen Spaß haben.«
»Deinen Spaß kannst du dir sonst wohin stecken«, knurrte Tischfußball-Kurt, während Leander, unser Philosoph, interessiert in dem Bauchladen herumkramte.
»Ihr habt euch im Stadtteil geirrt«, sagte ich. »Hauptstraße ist da hinten, weit weg. Einmal quer durch den Neckar, klar?«
»Aber hier isso schön!«, strahlte der mit dem Bauchladen.
»Wer ist eigentlich euer Heiratskandidat?«, wollte ein Bärtiger mit Brille wissen.
Na, da verlachten sie sich vielleicht. Das ganze halbe Dutzend hielt sich die rosa Wampe. »Den haben wir unterwegs verloren!«, kicherte einer, und ein anderer zeigte an, wo. »Dort hinten … drüben … weg isser!«
Weil er sich dabei umdrehte, konnte man die Aufschrift auf seinem T-Shirt lesen: »Die rammelnden Eber«.
»Eber seid ihr?«, fauchte Herbert. »Dann suhlt euch gefälligst woanders!«
»Eber«, nickte der Bauchladentyp. »Aus Eberbach. Deshalb.«
»Damit wir nach Hause finden, falls wir vergessen haben, wo wir her sind. Kann ja passieren.«
»Kann passieren«, echoten die anderen. Große Heiterkeit.
»Mann, schiebt ab!«, zischte Kurt.
»Heiraten ist echt das Letzte«, meinte der Brillenträger.
Aber sie trollten sich erst, nachdem sie Leander eine rote Clownsnase verscherbelt hatten. (Kondome habe er genug, sagte Leander.) Im Zickzack ging es rosa durch den ›Englischen Jäger‹. Irre, mit welcher Leichtigkeit diese Typen sich den Weg bahnten, trotz Alkohol und Bauchladen.
»Heiraten!« Der Bärtige mit der Brille winkte verächtlich ab. »So was von vorgestern. Dass dich die eigene Frau nach Strich und Faden betrügt? Nicht mit mir.«
»Genau«, sagte ich und brachte meine Flasche in Stellung. »Auf das Junggesellendasein! Für immer und ewig.«
Fatty kratzte sich am Kopf.
Kapitel 2
Ich stelle mein Rad am Neckar ab. Eine Besuchergruppe aus Fernost zuckelt vorbei. Als der Letzte von ihnen Richtung Steingasse verschwunden ist, überquere ich die Straße. Niemand beachtet mich, und doch fühle ich mich beobachtet. Es liegt an den Häusern. Den Häusern der Altstadt. Sie haben Augen, alle. Argusaugen. Ich hasse sie.
Bis auf eines.
Bevor ich in die Hasengasse biege, sehe ich mich um. Keine Polizei, kein Sicherheitsdienst. Die Luft ist rein. Glotzt nur, ihr verdammten Häuser! Vor der Nummer 7 bleibe ich stehen. Zehn Namensschilder. Das dritte von oben: Fahrenschon. Mit dem Zeigefinger streiche ich kurz darüber, dann klingle ich. Mein Herz klopft.
»Ja?«
»Die Post«, sage ich mit meiner tiefsten Stimme. Wie bescheuert ich klinge. Es kann nicht klappen. Es kann einfach nicht.
Der Türöffner summt.
Ich stoße die Tür auf und trete ein. Links geht es ins Treppenhaus, zu den Wohnungen. Ich husche geradeaus weiter, in den Hof, bis zu einem zweiflügeligen Holztor. Dahinter führen grob gehauene Stufen in die Tiefe. Leise ziehe ich das Tor wieder zu und steige die Stufen hinab. Vor mir liegt ein gewaltiger Gewölbekeller, der in mehrere Verschläge unterteilt ist. Seitlich an der Decke fällt Licht durch steile Schächte. Welcher Verschlag ist es noch? Der ganz hinten? Er ist nicht verschlossen. Ich erkenne das Fahrradreparaturset, das wir damals gesucht haben. Es liegt noch am selben Platz. Alles hier liegt an dem Platz, an dem es zu liegen hat. Es dauert keine Minute, bis ich die Taschenlampen gefunden habe. Zwei Stück sind es, ich nehme sie beide mit.
Raus aus dem Verschlag, kurz lauschen, ob niemand den Hof betritt. Auf der Suche nach dem Postboten, auf der Suche nach mir. Nichts. Also zurück. Am Ende des Gewölbekellers gibt es eine Tür, die zu einem tiefer gelegenen, deutlich kleineren Gewölbe führt. Hier sind Paletten gestapelt, ein altes Fass modert vor sich hin, Müll liegt in einer Ecke, es riecht nicht gut. Noch eine Tür, niedrig, grün gestrichen. Auf den Holzbrettern ein Metallschild: Zutritt verboten. Der Eigentümer.
Ich meine, was soll auch sonst dort stehen. Zutritt verboten. Das Übliche.
Aber eigentlich steht hier etwas anderes. Und nur ich weiß es. Es ist eine Botschaft für mich, eine Mahnung.
Erinnere dich, lese ich.
Erinnere dich, Max!
Ein Schauer kriecht mir über den Rücken. Wenn man die Erinnerung packen könnte wie ein Tier, wie einen Gegenstand. Aber sie ist ungreifbar. Ein dunkles Loch, eine Leerstelle. Sie ist weniger in dir als du in ihr. Du musst dich in sie hineinbegeben. Musst dich ihr überlassen. Mit ungewissem Ausgang.
Ich trete ein.
Mit ungewissem Ausgang.
Zutritt verboten.
Erinnere dich!
*
Dass ein Telefon läutet, kommt in Romanen dauernd vor. Besonders in Krimis. In guten Krimis oft, in schlechten viel zu oft. Am Anfang, in der Mitte, am Ende: Telefonläuten. Der Held hat gerade eine Messerklinge am Hals: Bimmelimm. Es dudelt, klingelt, fiept. Als Cliffhanger ist so ein Anruf perfekt, aber auch, um neue Motive einzuführen, einen weiteren Verdächtigen, eine brandheiße Spur. Inflationäre Telefonitis.
Ich hasse das.
Aber was soll ich machen? Es war nun einmal so, dass Tag eins ohne den ›Englischen Jäger‹ mit einem Läuten begann. Davor war nichts. Weder Tag noch Nacht, sondern bloß ein großes schwarzes Nichts. Komplettbetäubung. Existenzielles Kaumleben. An diesem nachtfinsteren Block begann das Signal zu kratzen. Nicht eben gewaltig, aber ausdauernd. Das Läuten bohrte sich in mich hinein wie ein Borkenkäfer in eine 1000-jährige Eiche, wie eine Zecke in gesundes Gewebe, wie …
Lassen wir das. Keine weiteren Vergleiche. Irgendwann, nach dem 100. Klingeling vielleicht, reagierte etwas in mir. Eine Gehirnzelle sprang gähnend aus den Federn und weckte die paar anderen, die noch funktionstüchtig waren. Dann kam der Schmerz hinzu, die Dumpfheit, Trockenheit des Gaumens, Käsigkeit der Glieder, einfach alles, was man für einen gediegenen Kater braucht.
Meine Fresse, ging es mir dreckig!
Ich wusste nicht einmal, wo ich mich befand, so dunkel war es um mich herum. Mein Arm machte sich selbständig. Er fuchtelte durch die Luft, als sei ich am Ertrinken, und patschte plötzlich gegen das Telefon. Hörer packen, wahllos Tasten drücken.
»Ja?«, sagte ich.
Nichts. Waren wohl die falschen Tasten. Neuer Versuch.
»Ja?«
»Können Sie kommen?«, hörte ich jemanden fragen. Es war Kommissar Fischer, allerdings in einer mir völlig unbekannten Tonlage. »Jetzt.«
»Ich?«
»Es gibt ein Problem.«
»Wenn Sie das sagen.«
Pause. Meine Tonlage war auch nicht von schlechten Eltern. Die jedoch kannte mein Lieblingskommissar zur Genüge. Die Tonlage, nicht die Eltern.
»Gestern versackt?«, folgerte er messerscharf. »Darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Ich brauche Sie hier. Schmeißen Sie sich schwarzen Kaffee oder ein Aspirin oder beides ein und kommen Sie nach Handschuhsheim. Und zwar so schnell wie möglich.«
Das war der Moment, in dem ich die Augen aufschlug. Hatte ich es mir doch gedacht. Es war überhaupt nicht dunkel! Hellster Morgen war es, man musste nur die Rollläden vor den Pupillen hochziehen. Was den Kopfschmerz schlagartig vervielfachte. Ich lag in meinem Büro, auf dem Feldbett, das meiner harrte, wenn ich es nachts mal wieder nicht bis hoch in die Wohnung schaffte. Wie ich dorthin gekommen war, wusste ich nicht. War auch egal.
Viel interessanter war die Frage, was Kommissar Fischer mit seiner Stimme gemacht hatte. Kein Grollen darin, kein Brummen, nicht das übliche misslaunige Fischer-Poltern. Entweder war er fachmännisch sediert, oder er hatte sich auf seine alten Tage ein Paar neue Stimmbänder geleistet.
»Was ist denn los?«, fragte ich.
»Sage ich Ihnen, wenn Sie da sind.«
»Aber ich habe seit Ewigkeiten keinen … ich bin …«
»Es geht nicht um Sie, Koller. Kennen Sie einen Schmider? Harald C. Schmider?«
»Glaub nicht.«
»Das habe ich befürchtet.« Er nannte mir eine Adresse in Handschuhsheim und bat mich noch einmal um Eile. Ohne jeden Grant. Gespräch beendet.
»Nur ein kleines Pfefferminzblättchen«, murmelte ich und legte das Telefon zur Seite. Dann versuchte ich aufzustehen und kippte um. Einfach so. Die Beine versagten, mein Kreislauf spielte Karussell. Auf allen Vieren krabbelte ich zum Klo, kam aber zu spät. Was ich im Magen hatte, landete auf dem Boden. Gut, dass ich mich letzte Nacht nicht zu Christine geschleppt hatte. Beim Kotzen ist man lieber alleine.
Eine Dusche und 20 Minuten später saß ich auf dem Fahrrad Richtung Handschuhsheim. Sommerlich glühte der Asphalt. Und auf dem Asphalt: Menschen. Böse, böse Menschen. Alle bis an die Zähne bewaffnet. Mit kreischenden Bremsen, detonierenden Hupen, Blicken wie ein Parteiausschlussverfahren. Sie wussten, was ich getan hatte, sie sahen es mir an, und deshalb quälten sie mich. Jedes Kindergartenkind kapierte, dass ich gereihert hatte. Guck mal, Mama, der Onkel fällt gleich vom Rad! – Nicht hinschauen, Lenalisaleah, der ist ganz, ganz bäh, der Mann.
Und dann hatte ich nicht mal einen Helm auf.
Max Koller, der Outsider der Kurpfalz.
Aber hey, wenn ich einen Helm getragen hätte, dann hätte ich auch niemals diese blitzartige Erkenntnis gehabt. Die schoss mir nämlich, als ich vor einer grellroten Ampel wartete, durch den schmerzenden Schädel mitten ins Hirn. Wie ein Meteorit, so ein ganz kleiner. Ich stand also da, blinzelnd in der Sommersonne – und plötzlich fiel es mir ein. Aua. Natürlich kannte ich diesen Schmider! Klarer Fall, so einen Namen vergisst man nicht. Aber wer war das noch mal? Wo war ich ihm begegnet, in welchem Zusammenhang? Dazu reichte es nicht, Meteorit hin oder her. Um weitere Fragen beantworten zu können, hätte ich zwei bis drei Promille nüchterner sein müssen.
Schmider … Da war doch was. Schmider … Verdammte Sauferei!
Und wieso stand mir jetzt ein kariertes Sakko vor Augen? Abgeschmackt, so was.
Dann wurde die Ampel grün, und ich fuhr weiter.
Kommissar Fischer trug kein kariertes Sakko, sondern einen seiner üblichen altmodischen Knitteranzüge. Seine Augenbrauen waren zusammengezogen, das Gesicht leuchtete ungesund gelb. Alles wie immer also. Einziges Zugeständnis an die sommerlichen Temperaturen: der Verzicht auf eine Krawatte. Er empfing mich im Vorgarten eines älteren Häuschens im Handschuhsheimer Süden, wo sich die Straßen im rechten Winkel kreuzen, wo normale Leute in normalen Häusern wohnen, wenn auch nicht zu normalen Immobilienpreisen, aber das ist ein anderes Thema. Ohne auf die missbilligenden Blicke eines Uniformierten zu achten, der am Hauseingang Wache schob, dirigierte mich der Kommissar zur Tür. Auf dem Klingelschild stand ›Schmider‹, und ich hätte mich ohrfeigen können, dass mir nicht einfiel, woher ich diesen Namen kannte. Bevor ich ins Haus durfte, musste ich mir Plastikhüllen über die Schuhe streifen. Schon im Flur kamen uns die Spurensicherer in ihren weißen Burkas entgegen.
»So allmählich wird mir klar, was Sie mit Problem meinten«, sagte ich zu Fischer.
Der schwieg. Seit meiner Ankunft hatte er überhaupt noch kein Wort gesprochen.
Es ging geradeaus, an einer nach oben führenden Treppe vorbei bis zu einer Tür, an der sich ein weiterer weiß Verhüllter zu schaffen machte. Dahinter lag das Wohnzimmer. Es war ein hundsgewöhnliches Wohnzimmer mit Tisch und Stühlen und Sitzecke und Flachbildschirm. An den Wänden Bilder und Vitrinen mit Krimskrams. Eine Glastür führte in den Garten.
Nur eines war nicht gewöhnlich an diesem Raum. Das war der Mann im Pyjama, der zusammengekrümmt auf dem Boden lag. In seiner Kehle klaffte ein großer, geradezu obszön wirkender Spalt. Davor war eine riesige Lache aus schwarzem Blut. Die Leiche wurde eben fotografiert. Im Hintergrund wuselten noch zwei Typen von der KTU herum.
Ich fühlte, wie sich meine Nackenhaare aufstellten. Jedes Härchen einzeln. Es lag an der klaffenden Wunde, natürlich. An dem vielen Blut, am Geruch nach Tod.
Vor allem aber lag es an der Hand des Toten. Mein Blick heftete sich an ihr fest. Ich hatte diese Hand berührt. Geschüttelt hatte ich sie. Nicht gestern, nicht vorgestern, sondern schon vor Monaten. Und trotzdem wusste ich noch genau, wie sie sich angefühlt hatte, diese Hand. Warm, fleischig und ein wenig feucht. Wie ein gut genährtes Tier.
Schmider, richtig. So hieß er, so sah er aus. Wir hatten miteinander gesprochen, Smalltalk, nichts von Belang. Ein Name, ein Gesicht, ein Körper. Und was war mir von all dem in Erinnerung geblieben? Ein feuchtwarmer Händedruck.
Und noch etwas. Aber dazu später.
Kommissar Fischer tippte mich an.
»Ich kenne den Mann«, flüsterte ich. »Jetzt, wo ich ihn sehe.«
Wortlos führte er mich in eine Ecke des Zimmers. Zu einer niedrigen Kommode, auf der Bücher und Zeitschriften lagen und ein paar Fotos. Sein Gesichtsausdruck war unergründlich. Hatte er die Sprache endgültig verloren? Erst das Granteln, jetzt die ganze Stimme?
Ein Handy klingelte. Wieder mal! Einer der Spurensicherer nestelte in seinem Plastiküberzug herum und nahm das Gespräch an. Der Tatortfotograf blitzte munter weiter. In all dem Geblitze und Geplauder richtete Kommissar Fischer einen Zeigefinger auf eines der herumliegenden Fotos und sah mich an.
Und ich?
Mir wurde schon wieder schlecht.
Bei dem Bild handelte es sich um ein Porträt Christines. Meiner Exgattin. Im Fotostudio gemacht, mit Weichzeichner und einem saumäßig verlogenen Lächeln. So eine Art Bewerbungsfoto. Mein erster Schultag, fehlte nur die Schultüte. Stattdessen gab es ein dickes rotes Herz, schwungvoll in eine Ecke gekringelt.
»Oh nein«, stöhnte ich.
»Das hier ist unser Problem«, sagte Fischer.
Kapitel 3
Erinnere dich, Max!
Gebückt betrete ich den Gang, lasse die Gewölbe, das Verbotsschild, die gesamte Oberwelt hinter mir. Das Licht meiner Taschenlampe fällt auf gemauerte Wände. Auf Wände, die zu schwitzen scheinen. Zwischen den geschwärzten Sandsteinen wuchern Moospolster. Dünne weiße Fäden hängen von der Decke. Auf dem Boden breitet sich eine Pfütze aus.
Dann eine Engstelle. Die Wand auf der rechten Seite ist ausgebeult, schiebt sich in den Gang wie eine Nase. Sie hat Schnupfen; unter der Nasenspitze liegt ein Haufen Steine. Er schimmert und glänzt im Licht. Auch die Decke kommt mir entgegen, sie hängt durch. Ich quetsche mich vorbei, Zähne zusammengebissen. Meine Hand schmerzt, so fest halte ich die Taschenlampe. Ich darf sie nicht verlieren. Darf sie nicht fallen lassen, egal was passiert.
Ohne die Lampe bin ich verloren!
Ich bleibe stehen. Beruhige dich, Max. Nur die Ruhe. Keine Panik jetzt. Der Gang ist sicher, er besteht schon seit Jahrhunderten. Den kümmert es nicht, ob du in ihm herumspazierst oder nicht. Die Wand hat eine triefende Nase, aber auseinanderbrechen wird sie nicht.
Meine Hand schmerzt noch immer. Ich nehme die Lampe in die andere Hand. Die Panik bleibt. Mein Herz schlägt bis zum Hals. Was soll ich tun?
Ich schalte die Lampe aus.
Siehst du? Es passiert nichts. Die Wände sind ganz nahe, oder sie sind weit entfernt, aber du bleibst unbehelligt. In der Dunkelheit zeigt sich, dass dir nichts geschehen kann. Da ist nur Stille um dich her. Luft von früher, eine Ahnung vergangener Zeiten. Totale Stille. Du kannst das ändern – wenn du willst. Willst du? Dann bewege dich. Atme hörbar. Vergewissere dich, dass du existierst. Lass deine Kleider wispern, deine Fingergelenke knacken. Hörst du sie? Hörst du dich? Du bist allein. Dein Herz schlägt schon ruhiger.
Und jetzt die Finsternis. Beende sie – oder lass sie bestehen. Du kannst dich auch im Dunkeln weiterbewegen. Du kannst tasten. Auf die anderen Sinne vertrauen. Willst du?
Ich schalte die Lampe an.
Ich habe mich wieder im Griff. Das Herz schlägt gleichmäßig, der Atem geht ruhig. Es ist nur ein Gang. Schief, uneben, hin und wieder eng. Ich kann jederzeit umkehren.
Aber ich will nicht. Ich will wissen, wohin er führt. Wohin er mich führt.
Erinnere dich!
*
Ein rotes Herz auf dem Bild meiner Ex?
Am liebsten hätte ich gleich noch einmal gekotzt, hätte Schmiders blitzblankes Spießerklo vollgespuckt mit schwarzer Galle – okay, Galle ist meines Wissens überhaupt nicht schwarz, bei dieser Formulierung stand mir wohl das eingedunkelte Blut des Toten vor Augen – egal wie, ich riss mich jedenfalls zusammen und musste mich nur ein bisschen an Kommissar Fischer festhalten, um nicht neben Schmider auf den Boden zu plumpsen. Die Spürhunde von der KTU warfen mir misstrauische Blicke zu. Nichts anfassen, ich weiß schon. Die Schulter eures Chefs wird ja wohl nicht unter das Verbot fallen, oder?
»Geht’s?«, fragte Fischer.
Ich zuckte die Achseln.
»Dann erzählen Sie mal. Was hat Ihre Frau mit dem Toten …?«
»Exfrau!«
»Jaja. Was hatte sie mit Schmider zu tun?«
»Sie ist meine Ex, okay? Wir sind nicht mehr zusammen, seit Ewigkeiten nicht. Mann, Herr Fischer, warum sagen Sie immer Frau, wo Sie doch genau wissen …«
»Nicht ablenken, Koller!«, bellte er.
Aha. Der Grantler in ihm erwachte zum Leben. Ich muss sagen, mit der gewohnten Garstigkeit in der Stimme war mir der Kommissar gleich viel sympathischer. Nicht auszudenken, wenn er sein präsidiales Mezzoforte nur mit Rücksicht auf mich verwendet hätte. Nach dem Motto: Sie müssen jetzt ganz stark sein, Herr Koller …
»Können wir rausgehen?«, sagte ich. »Ich brauche frische Luft.«
Er nickte. Wir verließen das Zimmer mit dem Toten und traten vors Haus. Der Uniformierte stand noch immer unnütz herum und starrte Löcher in den blauen Himmel. Das brachte mich auf einen Gedanken.
»Wo sind eigentlich Ihre beiden Rassehunde, Herr Fischer?«
»Wenn Sie meine Kollegen Greiner und Sorgwitz meinen …«
»Wen denn sonst?«
»Die habe ich nach oben geschickt. Und gebeten, in nächster Zeit nicht herunterzukommen.«
»Warum?«, wollte ich sagen, doch das Wort blieb mir im Hals stecken. Für den Stellungsbefehl an die beiden Kläffer gab es nur einen Grund: Sie sollten nicht Zeugen dieser dämlichsten aller Situationen werden. Max Koller und das Foto seiner Ex am Schauplatz eines Verbrechens …
Verfluchte Rücksichtnahme!
»Also?«, sagte der Kommissar und steckte sich einen kalten Zigarillo zwischen die Lippen.
Ich atmete tief durch.
Und dann fing ich an. Erzählte ihm, dass ich diesen Schmider genau einmal in meinem Leben gesehen hatte. Letzten Sommer bei einem Kneipenbesuch in der Altstadt. Wir waren uns zufälligerweise über den Weg gelaufen, er, Christine und ich. Nein, anders: er zusammen mit Christine – und ich war in das traute Paar hineingestolpert. Er hatte ein kariertes Sakko getragen. Kariert! Sein Händedruck unangenehm und er selbst … wie sollte ich es formulieren? Anwesend. Unauffällig. Zuvorkommend und langweilig. Christine hatte es genossen, von ihm hofiert zu werden. Und mir damit eins auswischen zu können.
»Ihre Frau hatte also eine Affäre mit dem Mann?«, brummte Fischer.
»Exfrau, verdammt! Sie ist meine Ex, geht das in Ihren Ermittlerschädel rein?«
»Noch ein bisschen lauter, und man hört Sie bis Dossenheim.«
»Mir doch egal. Mir ist auch egal, ob sie was mit ihm hatte oder nicht. Scheißegal! Das glauben Sie mir zwar nicht, meine Frau glaubt es übrigens auch nicht – Exfrau, meine ich natürlich –, also die denkt bis heute, ich wäre eifersüchtig auf ihre komischen Typen in karierter Herrenmode, aber ich bin es nicht. Hören Sie? Ich bin nicht eifersüchtig. Punkt. Nein: Ausrufezeichen.«
»Schon gut.«
»Eifersucht kann ich gar nicht. Das Gen fehlt mir.«
»Und seit dieser Begegnung vor einem Jahr haben Sie Schmider nicht mehr getroffen?«
»Weder getroffen noch gesprochen noch an ihn gedacht. Mein Gott, als hätte ich nichts Besseres zu tun! Wusste ja nicht einmal, dass er ein C. im Namen hat.«
Fischer nickte. »Das hört man gern.«
»Hört man?« Sein Gesichtsausdruck verkündete das Gegenteil.
»Ja. Wobei ich in Ihrem Fall keinerlei … also, es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, Sie mit diesem Mord in Verbindung zu bringen.«
»Echt nicht? Jetzt bin ich fast ein wenig beleidigt.«
»Was dagegen Ihre«, er nuckelte an seinem Glimmstängel, »Ihre Exfrau angeht, da sieht die Sache anders aus.«
»Christine? Sie glauben doch nicht … Herr Fischer, das ist lächerlich!«
»Nur die Ruhe. Dass es eine Verbindung zwischen ihr und dem Opfer gibt, haben Sie mir soeben bestätigt. Und wenn diese Verbindung durch ein Herzchen auf einem Foto symbolisiert wird, dann provoziert das Nachfragen. Bei allem Respekt. Bestand das Verhältnis zwischen Ihrer Exfrau und Schmider noch?«
»Keine Ahnung.«
»Herr Koller!«
»Ich weiß es wirklich nicht. Wir haben das Thema seit Ewigkeiten nicht mehr angeschnitten.«
»Seit Ewigkeiten?«
»Seit Ewigkeiten und einem Jahr. Mindestens.«
Schweigend bearbeitete er seinen Zigarillo. Dann sagte er: »Sie führen schon eine komische Ehe, Sie beide.«
»Exehe.«
»Selbstverständlich. Vielleicht verraten Sie mir trotzdem der Einfachheit halber, wie und wo Sie den gestrigen Abend zugebracht haben.«
»Gluck, gluck, gluck.«
Er seufzte. »Wo?«
»Im ›Englischen Jäger‹. Ich habe von meiner Kneipe Abschied genommen, wie es sich gehört. Dafür gibt es zig ebenso alkoholisierte Zeugen.«
»Schön. Und Ihre Frau?«
»War zu Hause. Nehme ich jedenfalls an. Ich habe unten in meinem Büro gepennt.«
»Sie hat nicht mitgezecht?«
»Christine doch nicht.« Ich versuchte es mit einem Lachen. »Hätte sie mal lieber, was?«
Fischer schüttelte den Kopf. »Das ist nicht lustig, Herr Koller.«
Nein, lustig war das nicht, und deshalb gingen wir auch wieder hinein, sobald der Kommissar fertig war mit seinem Zigarillogenuckel. Er besprach sich kurz mit einem seiner Leute, dann hielt er mir ein Paar Latexhandschuhe unter die Nase.
»Schauen Sie sich um, Herr Koller, vielleicht fällt Ihnen etwas auf, was uns weiterhilft. Aber rühren Sie nichts an.«
»Warum dann die Handschuhe?«
»Haben Sie sich je an meine Anweisungen gehalten? Handschuhe an, oder raus!«
Brav streifte ich das Gummizeug über. Er hatte ja recht. Schmiders Haus war nicht groß. Da stieß man schon mal versehentlich an. Oder berührte etwas. Einen Schrank im Flur zum Beispiel, der sich dann prompt öffnete. Versehentlich. Gut, dass ich in diesem Moment die Handschuhe trug. Und noch besser, dass Kommissar Fischer in diesem Moment nicht hersah. Andererseits befand sich in dem Schrank nichts Wichtiges. Bloß Aschenbecher, bestimmt 50 Stück. Gläserne, metallene, steinerne, runde, eckige. Vor allem hässliche.
Meines Wissens hatte Schmider nicht einmal geraucht.
Ich ging ins Wohnzimmer, passte einen Zeitpunkt ab, an dem ich nicht störte, und beugte mich über die Leiche. Das Vorbeugen tat meinem Kopf nicht gut, der Anblick des Kehlenspalts meinem Magen. Was sagen die Profis im Fernsehen zu einem solchen Schnitt? Saubere Wundränder, die auf Verwendung einer scharfen Klinge schließen lassen. Schärfer als alle Klingen, die ich zu Hause hatte, vermutete ich. Dann schaute ich Schmider ins Gesicht. Ich zwang mich dazu. Da lag der Mann, dem ich vor Jahr und Tag die Hand geschüttelt hatte, abgestochen wie Schlachtvieh in seinem eigenen Haus. Der Mann, mit dem Christine etwas gehabt hatte. Noch immer hatte? Schmiders Name war seit Ewigkeiten nicht mehr gefallen. Aber das musste nichts heißen. Schließlich hatte ich sie nie nach dem Würstchen gefragt. Die Haralds in ihrem Leben kamen und gingen. Verlorene Liebesmüh, sich eines dieser Gesichter zu merken.
Der hier war allerdings auf spezielle Weise gegangen. Und was sein Gesicht betraf … es war ein seltsamer Ausdruck, der auf seinen Zügen lag. Eine Mischung aus Entsetzen, Angst, Überraschung, Qual, ein schmerzliches Nichtwahrhabenwollen. Schmider war von seinem Tod überrumpelt worden. Er hatte nicht mit ihm gerechnet. Erst als sein Mörder plötzlich vor ihm stand, als er das Messer aufblitzen sah, da wurde ihm bewusst, dass es jetzt um alles ging. Dass ihm die Welt gleich abhandenkommen würde, wenn nicht noch ein Wunder geschah. Anscheinend war alles ganz schnell gegangen. Die Verwunderung – das Verstehen – der höllische Schmerz, es passierte innerhalb einer Sekunde. Deshalb dieser Mix an Gefühlen auf Schmiders Antlitz.
Stöhnend richtete ich mich auf. Vielleicht war es so. Vielleicht aber auch ganz anders.
Harald C. Schmider gäbe was drum, wenn er jetzt meine Kopfschmerzen hätte. Wenn er überhaupt noch einmal Schmerzen empfinden könnte!
»Sie kotzen mir aber nicht auf die Leiche«, knurrte einer der Spurensicherer.
Ich rollte mit den Augen.
»Alles schon erlebt! Und Sie sehen aus, als müssten Sie …«
»Ja«, unterbrach ich ihn. »Ich kann mir denken, wie ich aussehe. Liegt aber nicht an dem Toten. Da habe ich jede Menge Erfahrung. Mehr als Sie jedenfalls.«
»Ach.« Er stemmte die Fäuste in die Hüften und musterte mich. »Glaube ich nicht.«
»Doch.«
»Ich habe 15 Berufsjahre auf dem Buckel.«
»Einen Buckel haben Sie, das sieht man.«
»He, so nicht, Freundchen!« Gleich pumpte er sich mächtig auf.
»Was denn? Prügelei am Tatort? Dass unsere DNA kiloweise herumfliegt? Tolle Berufserfahrung haben Sie!«
Fischer trennte uns.
»Noch so ein Ding, und ich schicke Sie nach Hause«, knurrte er und schob mich außer Reichweite des Unholds.
»Der hat mich provoziert, Herr Fischer. Sie sollten Ihr Personalmanagement mal überdenken.«
»Jaja.«
Eine Weile stand ich sinnlos in der Küche herum. Schmiders Küche war eine ganz gewöhnliche Küche, mit Töpfen, Tellern und so weiter. Seine Messer nahm ich etwas genauer in Augenschein, aber natürlich hatte der Mörder die Tatwaffe nicht einfach in die Schublade zurückgelegt. Wenn das Messer überhaupt aus Schmiders Besitz stammte. In einer Ecke stapelten sich Kochbücher; auf gutes Essen schien er Wert gelegt zu haben. Unsere erste und vermutlich letzte Gemeinsamkeit – wobei ich zwar gern am Herd stehe, aber keine Hilfestellung von irgendwelchen Kochgurus brauche. Also doch keine Gemeinsamkeit.
Ob er schon mal für Christine gekocht hatte? So mit fünf Gängen und Kerzen und Prosecco-Schmuseklassik?
Als ich kurz darauf wieder das Wohnzimmer betrat, war der Spurensicherer verschwunden. Ich ging Schmiders Regale durch, seine Bücher, Bildbände, DVDs, Zeitungen. Alles, was offen herumlag. Für Geschichte hatte er sich interessiert, auch für Design, es gab sogar einen Prachtband über die Schönheit von Aschenbechern. Einige Wälzer beschäftigten sich mit Architektur, und irgendetwas in dieser Richtung schien er beruflich gemacht zu haben. Ein gerahmtes Foto an der Wand zeigte ihn mit dem Oberbürgermeister und dem Ministerpräsidenten vor einer frisch renovierten Villa in der Altstadt. War er nicht städtischer Beamter gewesen? Ich meinte mich zu erinnern, dass Christine so etwas erwähnt hatte.
Apropos. Wie würde Christine auf die Nachricht von Schmiders Tod reagieren?
Das war die Frage, die in meinem Nacken saß und Einlass begehrte. Die beantwortet werden wollte, hier und jetzt. Dabei konnte ich sie gar nicht beantworten. Ich wusste ja nicht, was zwischen den beiden noch gelaufen war, wie nahe sie sich gestanden hatten, ob überhaupt Gefühle im Spiel gewesen waren.
Gefühle … Ein Beamter der Stadt. Aschenbecher!
»Mann, Mann, Mann«, knirschte ich. Wenn sie sich wenigstens für einen richtigen Kerl interessiert hätte! Fitnessstudio, Finca, Tätowierung auf der Arschbacke, solche Sachen. Dann hätte man vielleicht eifersüchtig werden können. Aber so? Harald C. Schmider hatte nichts auf der Arschbacke, höchstens Haare. Und wenn, dann nur ganz wenige. So einer war doch keine Alternative, nicht mal zu mir.
Ach, schau einer in die Frauen rein …
»Schöne Fotos, nicht wahr?«, sagte jemand von der Tür her.
Ich drehte mich um. Da hing ein Grinsen in der Luft, und hinter dem Grinsen hatte Kommissar Sorgwitz Aufstellung genommen. Eine komische Formulierung, ich weiß, aber es sah tatsächlich aus, als habe Fischers Kampfhund sein Grinsen schon mal vorgeschickt und warte nun mit etwas Abstand auf meine Reaktion. Die Arme hatte er vor der Brust verschränkt, oben stand das Blondhaar Habtacht.
»Sie müssen die Aschenbecher untersuchen, Herr Sorgwitz«, sagte ich. »Jeden einzelnen, unbedingt. Was die für Geschichten erzählen können. Hammer.«
»Die Fotos finde ich interessanter. Vor allem das eine.«
»Fotos können Sie nicht. Gesichter und so – das überfordert Sie intellektuell. Aschenbecher ist genau Ihr Niveau.«
»Oh, der liebe Herr Koller«, kläffte es neben Sorgwitz. Die Rottweilerschnauze von Kollege Greiner kam in Sicht. »Hat er schon gestanden?«
»Er zappelt noch«, meinte der Blonde.
»Prima. Es gibt nichts Langweiligeres als ein Geständnis, ohne dass man angefangen hätte zu ermitteln.«
Bevor ich antworten konnte – und mir lag etwas auf der Zunge, wofür sie mich wahrscheinlich aus dem Haus geprügelt hätten, DNA-Spuren hin oder her –, bevor wir also handgreiflich wurden, kam Kommissar Fischer aus dem Flur gestürmt und schickte seine Wadenbeißer nach oben.
»Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie nicht herunterkommen sollen, bis …«
»Wir sind fertig, Chef!« Greiner, der alte Streber!
»Dann warten Sie oben!«
»Wir sollen Däumchen drehen? Wegen dem da? Auf Kosten des Steuerzahlers?«
»Wir könnten ihn befragen«, schlug Sorgwitz vor. »Zu gewissen Personen, die sich auf gewissen Fotos in diesem Raum befinden.«
»Längst passiert. Abmarsch!«
Irgendwann zogen sie tatsächlich Leine, die beiden, aber nicht, ohne mir vorher zuzuwinken und zu zwinkern und natürlich zu grinsen, dass ein Muskelkater drohte. Für Greiner und Sorgwitz war der heutige Tag wie gemalt. Die Ex ihres Erzfeindes hatte was mit einem Mordopfer! Sodom und Gomorrha im Hause Koller! Ein Fall für die Schmutzpresse. Begann jetzt die Schlammschlacht? Vielleicht gab es noch mehr: Nacktfotos, Liebesbriefe, Unterwäsche …
»Die zwei sind befangen«, sagte ich zu Kommissar Fischer, als die Luft rein war. »Ziehen Sie das Gesocks von dem Fall ab!«
»Unsinn.«
»Die hassen mich! Die wollen mir was anhängen. Oder meiner Frau.«
»Exfrau.«
»Also weg mit den beiden!«
»Dann dürfte ich auch nicht ermitteln. Reißen Sie sich zusammen, Koller, wir werden uns genau so verhalten, wie wir es immer tun.«
»Eben!«
»Eines allerdings ist klar: Ihre Frau Markwart wird nicht um eine Befragung herumkommen.«
Ich sah auf die Leiche hinab. Ein einziger Schnitt nur, und plötzlich änderte sich alles. Für Schmider, für Christine, sogar für mich.
»Dann hätte ich eine Bitte«, sagte ich. »Darf ich ihr die Nachricht überbringen?«
»Dürfen Sie.«
Ich nickte. »Danke.«
Kapitel 4
Ich ertappe mich beim Reden. Beim Gespräch. Mit mir – oder mit dem Gang? Ist er mein Gegenüber? Eine Unterhaltung in Dunkelheit und Tiefe. Wer hätte gedacht, dass ich die Stadt einmal von dieser Seite kennenlernen würde! Die Stadt von unten, aus der Perspektive der Vergangenheit. Das Licht der Taschenlampe führt mich, an ihm hangele ich mich durch den Untergrund. Wir sind eine Seilschaft, wir zwei.
Man könnte glauben, es sei langweilig hier unten. Langweilig, einen Gang zu durchschreiten. Das Gegenteil ist der Fall. Jeder Schritt ist anders, ständig gibt es etwas Neues zu sehen. Niemals geht es nur geradeaus. Da sind Biegungen, Kurven, Wendungen, ein Auf und Ab, holpriger Boden, ebener Grund. Steinbrocken ragen in die Höhe, unerwartet senkt sich die Decke. Vom Oval bis zum Rechteck bildet die Röhre alle nur denkbaren Formen aus. Auch die Farben wechseln. Hellrot sind die Wände, dann rostrot, ocker, mattbraun, ein Schiefergrau spielt hinein, Schwarztöne, von schimmernden Adern durchzogen. Immer wieder halte ich an und lasse meine Finger über das Mauerwerk gleiten. Spüre jede Verwerfung im Stein. Wie armselig tot sind dagegen Betonwände. Diese Mauern hier haben Ausstrahlung, Leben. Sie erzählen Geschichten – in ihrer Sprache. In der Sprache der Steine. Große, schöne Natursteine sind das, jeder Quader ein Kunstwerk. An einem entdecke ich noch das Steinmetzzeichen. Fahre auch seine Linien entlang, Hieroglyphen einer untergegangenen Epoche.
Untergegangen? Die Vergangenheit lebt doch, sie steht als Monument über dem Neckartal, zieht jährlich eine Million Besucher an, hält die Stadt am Leben. Was wäre Heidelberg ohne seine Steinmetze?
Nichts, über das sich zu schreiben lohnte.
Ob es noch ältere Gänge gibt als den, den ich gerade durchschreite? Noch weiter in der Tiefe liegende? Wenn eine Stadt viele Etagen in die Höhe wachsen kann, warum dann nicht auch in die entgegengesetzte Richtung? Die Geologie spricht dagegen, sicher, die Kombination aus hartem Felsgestein und Neckarschwemmland. Aber vorstellbar wäre es.
Ich gehe weiter. Eine Abzweigung. Es ist nur ein Nebengang, schmal und ganz anders gemauert. Trotzdem, ich will wissen, wohin er führt. Ich muss den Kopf einziehen, als ich ihn betrete. Nach wenigen Metern endet er an einer Eisentür. Sie ist verschlossen, die Klinke lässt sich kaum bewegen. Rost hat sich in giftigen Farben durch das Metall gefressen. Ich lausche, doch dahinter ist alles ruhig.
Unverrichteter Dinge kehre ich um.
*
Bevor Christine das Café in der Unteren Straße betrat, hatte ich den Aschenbecher auf meinem Tisch ungefähr 100 Mal von einer Seite zur anderen gerückt. Ich hatte ihn gedreht, auf die Seite gestellt, hin und her gerollt. Aus den Zuckerwürfeln hatte ich Hochhäuser gebaut und mit den Servietten Origami gespielt. Der Kaffee wurde kalt unterdessen, aber die Gedankenknoten in meinem Hirn entwirrten sich durch die Ablenkungsmanöver nicht.
Kopfweh hatte ich sowieso.
Als sie dann kam, setzte ich ein Lächeln auf, das mindestens so falsch war wie das auf ihrem Erinnerungsblatt für Schmider. Fehlte nur noch das rote Herzchen auf meiner Backe. Christine spürte die Verlogenheit meines Grinsens natürlich sofort, aber das spielte keine Rolle mehr. Schon die Einladung zu einem gemeinsamen Kaffee in ihrer Mittagspause musste sämtliche Alarmglocken in ihr ausgelöst haben.
»Das ist aber eine nette Überraschung, dass wir zwei uns mal …«, rief sie und gab mir einen Kuss. Es war eher ein Stempel als ein Kuss.
»Ich wollte eigentlich draußen sitzen«, sagte ich, »aber draußen zieht es, außerdem war nichts frei, wenn du lieber draußen sitzen willst, können wir natürlich warten, bis was frei ist, mir egal.«
Sie setzte sich. »Wirst du alt, Max?«
»Nee, wieso?«
»Weil es dir noch nie irgendwo gezogen hat. Ich fand es eher warm draußen, zu warm. Dass es zieht, habe ich nicht gemerkt.«
»Also wenn du nicht drinnen sitzen willst …«
»Doch, doch. Alles gut. Ist ja auch nichts frei draußen.«
Sie hängte ihre Handtasche über den Stuhl. Gleich darauf rückte die Bedienung an. Meine Ex bestellte einen Cappuccino und eine Gemüsetarte. Ein kurzer Blick auf meine Servietten-Zucker-Kunstwerke, ein längerer durch das halb gefüllte Café. Dann gab sie sich einen Ruck und wandte sich mir zu.
»Und? Was ist los, Max?«
Ich rührte in meinem Kaffee. »Wie war dein Tag?«
»Wie mein Tag war?«
Ich nickte.
»Du willst wissen, wie mein Tag war?«
Ich nickte.
Sie lachte. »Na, wie wohl? Super war er! Ich habe kopiert, eine Vorlage für den Gemeinderat Korrektur gelesen, Formulare ausgefüllt, von denen du nicht wissen willst, worum sie sich drehen, habe mich mit meinem Chef gestritten und die Pflanzen gegossen. Schwupp, neigte sich dieser spannende Vormittag im Leben der Christine M. schon wieder dem Ende zu. Zufrieden?«
Ich nickte.
»Moment, eines habe ich vergessen. Gewissermaßen die Krönung des Ganzen. Kurz bevor ich losging, habe ich nämlich«, sie kniff die Augen zusammen und sah mich scharf an, »noch einmal zehn Seiten kopiert. Wahnsinn, was?«
Cappuccino und Gemüsekuchen kamen. Ich sah ihr zu, wie sie der Bedienung ein Lächeln schenkte, an der Tasse schnupperte und ihre Gabel in die Tarte rammte. Alles dezent übertrieben. Alles eine Aufforderung an mich: Solange du nicht mit der Sprache rausrückst, du Idiot, ziehe ich hier meine Show ab. Gnadenlos.
Und ich? Dachte an Schmiders blutgetränkten Pyjama, an die vermummten Gestalten in Weiß, an das Herz auf dem Foto.
»War’s nett gestern Abend?«, hörte ich sie sagen.
Ich lehnte mich zurück. »Wir haben sie«, antwortete ich, jedem Wort eine eigene Betonung gebend, »zu Grabe getragen. Die beste Kneipe der Welt. Die einzige, die diesen Namen verdiente.«
Christine schaute mich an. Auf so viel falsch-echtes Pathos konnte man eigentlich nur mit Zynismus reagieren. Aber das tat sie nicht. Dafür war sie viel zu verständnisvoll. »Naja«, meinte sie, »vielleicht gehen wir zwei dann mal wieder etwas öfter zusammen aus.«
Nach diesen Worten herrschte erst einmal Stille. Mir fiel auf, dass ich schon wieder den Ascher in der Hand hielt. Diesen blöden, sauhässlichen Aschenbecher aus billigem Plastik. Dabei durfte hier überhaupt nicht geraucht werden! Oder nur abends oder an ungeraden Tagen, es änderte sich ja dauernd. Ich musste an den Schrank in Schmiders Wohnung denken, an all die unseligen Aschenbecher, die er gesammelt hatte, anstatt was zu machen aus seinem kleinen Leben. Rauchglas, Kristall, Goldrand, handbemalt, mundgeblasen, wertvoll, Nippes, selten – was war das für eine Welt? Und was hatte Christine in dieser Hölle zu suchen? Ich bekam eine solche Wut auf den netten, ermordeten Spießer, dass ich den Aschenbecher am liebsten einmal quer durch das Café gepfeffert hätte. Stattdessen zog ich die Hand zurück, ballte sie unter dem Tisch zur Faust und sagte: »Schmider ist tot. Ermordet. Das wollte ich dir sagen.«
Jetzt herrschte erst recht Stille.
Natürlich hatte ich mir vorher ausgemalt, wie Christine reagieren würde. Es gab zig Möglichkeiten, von Tränen bis Sarkasmus, von laut bis leise. Aber keine, die sich aufdrängte. Ich wusste es einfach nicht. Ich wusste ja auch nicht, wie nahe sie ihm wirklich gestanden hatte. Ob sie mir mit diesem Typen tatsächlich bloß eins auswischen wollte, wie ich immer behauptet hatte. Oder ob mehr dahinter steckte. Ich war also völlig ahnungslos. Auf alles und nichts gefasst.
Und wie reagierte sie nun?
Fast könnte man sagen: normal. Geradezu klassisch. Sie erstarrte. In der einen Hand hielt sie die Gabel, die Augen waren auf mich gerichtet, auf meinen Mund, der die entscheidenden Sätze gesprochen hatte. Man konnte förmlich sehen, wie sich die Nachricht zu ihrem Gehirn durchkämpfte. Gegen alle Widerstände. Gegen das Nichtglaubenwollen.
»Was?«, flüsterte sie schließlich.
»Schmider ist ermordet worden. Dein Harald. Ich wusste nicht, dass ihr noch Kontakt hattet. Du hast mir auch verschwiegen, dass er Harald C. heißt. Keine Ahnung, wofür das C steht. Kommissar Fischer hat mich angerufen. Wegen des Fotos in seiner Wohnung. Dein Foto. Das Herz und so, du weißt schon. Rot. Er wird mit dir sprechen wollen. Fischer, meine ich. Wahrscheinlich heute noch.«
Ich weiß nicht, ob das die richtigen Sätze waren. Sie enthielten alle wichtigen Informationen. Komplett daneben lag ich damit also nicht. Vielleicht hätte ich mehr Emotion hineinlegen sollen, Empathie oder so einen Quatsch. Aber es ist nicht leicht, Empathie zu zeigen, wenn man eine Hand unter dem Tisch zur Faust ballt, dass die Fingernägel ins Fleisch schneiden.
Als mir das klar wurde, öffnete ich die Hand und griff zum Kaffee. Der längst kalt war. Zum Trinken kam ich allerdings nicht.
Denn jetzt tat Christine etwas, womit ich nicht gerechnet hatte und was man beim besten Willen nicht als normal bezeichnen kann. Sie legte die Gabel neben die angefangene Tarte, putzte sich mit ihrer Serviette den Mund ab und stand auf.
Dann ging sie.
Kommentarlos. Emotionslos. Keine Tränen, kein Sarkasmus, kein gar nichts. Als wäre ich Luft, schnappte sich meine Ex ihre Handtasche und stiefelte zur Tür. Selbst die Bedienung wurde mit Missachtung gestraft.
Ich meine, das muss man sich einmal vorstellen: Sie verkniff sich sogar das Zahlen!
»He«, sagte ich und erhob mich ebenfalls. »Was soll denn das jetzt?«
Aber da war sie schon draußen. Mit meiner blöden Frage machte ich nur die anderen Cafégäste auf uns aufmerksam. Auf mich und Christines leeren Stuhl, genauer gesagt. Der Cappuccino dampfte in der Tasse, das Gemüseteil lag angeknabbert auf dem Teller, und Max Koller stand wie der Depp des Jahrhunderts da. Gleich würden sie sich über uns die Mäuler zerreißen an den anderen Tischen.
Fast hätte ich doch noch Aschenbecherweitwurf gespielt.