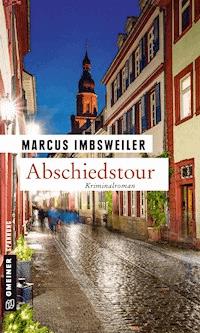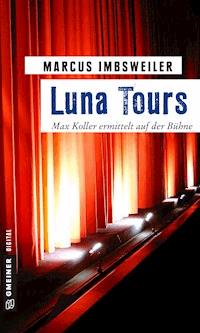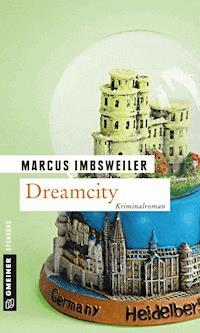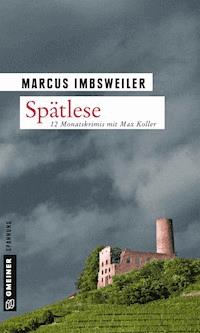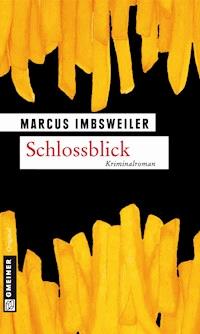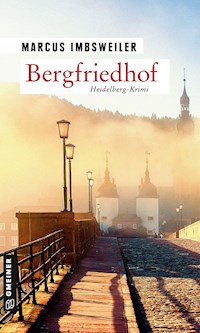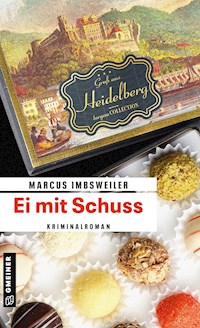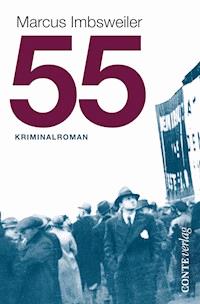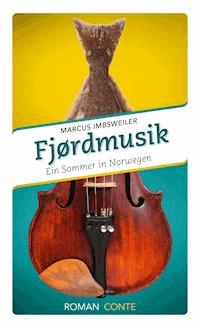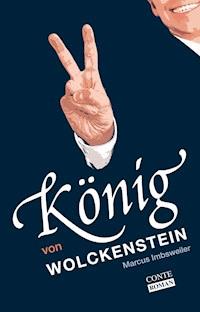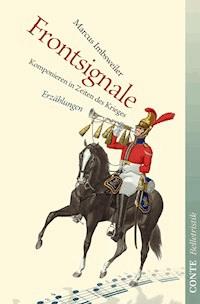Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Privatdetektiv Max Koller
- Sprache: Deutsch
An einem stürmischen Abend fällt der Heidelberger Start-up-Gründer Nicolas Greven aus dem fünften Stock seines Bürogebäudes und stirbt. Obwohl es keine Zeugen für ein Verbrechen gibt, gesteht die Reinigungskraft Antonia Kumpe sofort, Greven in die Tiefe gestoßen zu haben. Die Ermittlungen werden bald eingestellt. Nur Kumpes Sohn Sebastian ist von der Unschuld seiner Mutter überzeugt und schaltet Privatdetektiv Max Koller ein. Doch gerade als Koller erste Ergebnisse präsentieren kann, erhält er einen anderen, viel lukrativeren Auftrag …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcus Imbsweiler
Heidelberg-tief
Kriminalroman
Zum Buch
Tiefer Sturz Eigentlich ein glasklarer Fall: Die Reinigungskraft Antonia Kumpe hat gestanden, den Heidelberger Start-up-Gründer Nicolas Greven aus seinen Büroräumen im fünften Stock gestoßen zu haben. Auf Bitte ihres Sohnes Sebastian, der trotz des Geständnisses von der Unschuld seiner Mutter überzeugt ist, nimmt Privatdetektiv Max Koller Ermittlungen auf. Immerhin hatte sich Greven kurz zuvor von seinem wichtigsten Geschäftspartner getrennt. Auch eine Beziehungstat ist denkbar. Deckt Kumpe womöglich eine andere Person? Zusätzlich erschwert werden Kollers Nachforschungen durch das Sturmtief, das über der Stadt liegt. Gerade als er erste Erkenntnisse präsentieren kann, erhält er einen neuen, höchst lukrativen Auftrag: Jana, die Tochter von Grevens Investor Wetterstein, fühlt sich von einem Mitschüler bedroht. Und plötzlich spielt auch das aktuelle Weltgeschehen in den Fall hinein …
Marcus Imbsweiler, aufgewachsen im Saarland, arbeitet als freier Musikredakteur für Orchester, Festivals und Rundfunksender deutschlandweit. Seit 2005 ist er außerdem als Schriftsteller tätig. Seine Krimireihe um den Heidelberger Privatermittler Max Koller zählt inzwischen zehn Bände. Im Gmeiner-Verlag erschienen zudem der Liszt-Roman „Die Erstürmung des Himmels“, der fantastische Krimi „Himmelreich und Höllental“ (als Peter Paradeiser), die Kurzstücke „Luna Tours“ sowie der Osterkrimi „Ei mit Schuss“. Imbsweiler schreibt Romane, Erzählungen und Theaterstücke und gibt regelmäßig Einführungen in klassische Konzerte.
www.marcus-imbsweiler.de
Impressum
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © eyetronic / stock.adobe.com
ISBN 978-3-7349-3156-7
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
1
Und siehe: Heidelberg kam mit Donner und Blitz über die Welt.
Die es am Ende sogar verdient hatte. Ja, ganz bestimmt hatte sie es: eine Welt, die nichts gelernt hatte aus ihren Fehlern. Eine Welt, in der wieder einmarschiert, gebombt und befriedet wurde, die nur die Panzersprache kannte und Vokabeln aus Stahl. Eine Welt zum Vergessen war das. Also her mit Donner und Blitz, mit den nasskalten Ohrfeigen, den wuchtigen Sturmböen, den peitschenden Backenhieben! Der Menschheit einen Tritt in den Hintern! Ihr habt es nicht anders verdient. Bevor ihr euch gegenseitig abmurkst, sollt ihr lieber in der Flut ersaufen.
Aber ich, was hatte ich mit dem ganzen Mist zu tun?
Den Kopf über den Lenker gebeugt, stemmte ich mich gegen den Wind, der einen packte und durchschüttelte wie ein nasses Handtuch an der Wäscheleine. Wenn der Regen statt von oben direkt von vorn kam, und das tat er dauernd, hatte ich das Gefühl, in den Strahl eines bis zum Anschlag aufgedrehten Gartenschlauchs hineinzufahren. Auch von unten spritzte Wasser und hinten meinen Rücken hoch. Meine Regenjacke klebte an meinem verschwitzten Körper, alles an mir troff, ich trieb wie Strandgut durch die Straßen. Das Einzige, was garantiert keinen Tropfen durchließ, war der würfelförmige Rucksack, den ich trug. So ein Ding mit Spezialbeschichtung, Liefer-Hightech vom Feinsten. Mochten wir Fahrer auch absaufen – Hauptsache, die Pizza blieb trocken.
»Mit einer Extraportion Anchovis!«, brüllte ich in das Gewitter hinaus.
Ein kräftiger Donnerschlag war die Antwort. Irgendjemand da oben hatte meinen Hilferuf vernommen.
Aber vielleicht war es auch nur himmlisches Gelächter. Ich brüllte weiter; der Regen prasselte. Ich fluchte und spuckte; ein Blitz zuckte über die Stadt. Ich beschimpfte meinen Chef, die Kunden und vor allem Oleg; die Pfützen wurden immer tiefer. Und hinten in meinem Rücken schaukelten fröhlich zwei Pizzen in Gesellschaft einer eisgekühlten Flasche Weißwein. Pervers war das! Die Entmachtung des Menschen durch sein Essen. Der Anchovis-Aufstand!
Vor lauter Regen und Wut hätte ich fast die Abzweigung in die Bahnstadt verpasst. Sah ja nix, nur strömendes Wasser und verschwommene Lichter. Wetten, dass außer mir kein anderer unterwegs war an diesem Abend? Autos, klar. Amphibienfahrzeuge. Faradaysche Käfige, computergesteuert. Aber echte Menschen, Fußgänger, Radfahrer? Fehlanzeige.
»Ich bring dich um, Oleg«, knirschte ich. Die Worte sprühten durch die Dunkelheit.
Oleg war schuld. An allem. Eigentlich ein netter Kerl, Knopfaugen und Segelohren, so was in der Richtung, aber eben auch Besitzer einer wahnsinnig präzisen Wetter-App. KGB-Entwicklung wahrscheinlich, Oleg stammte nämlich aus Kasachstan. Jedenfalls hatte der Typ mich letzte Woche gebeten, seine heutige Schicht zu übernehmen, und ich, nichts ahnend, hatte eingewilligt. Jetzt lümmelte er sich unter Garantie warm eingehüllt auf seinem abgewetzten Sofa und schaute grinsend hinaus in die Apokalypse. Dass sich der Region ein Tief mit dem hübschen Namen »Heidelberg« näherte, hatte ich im Verlauf der Woche auch irgendwann mitgekriegt. Aber da wusste Oleg schon auf die Minute genau, wann es welches Stadtviertel treffen würde, welche Regenmenge zu erwarten war und unter welchem Baum man sich besser nicht aufhielt. Was für Flüche ich ausstieß, wusste er wahrscheinlich auch schon.
Es hätte mich nicht gewundert, wenn er die Pizza mit den extra Anchovis bestellt hätte!
Allerdings wohnte Oleg nicht in der Bahnstadt, sondern irgendwo draußen auf dem Boxberg. Ich wischte so lange über mein Smartphone, das am Lenker angebracht war, bis ich die Zieladresse erahnen konnte. Jetzt bewährte es sich, ein wasserdichtes Handy zu besitzen. Dafür hatte unser Chef sogar einen Zuschuss gewährt, jedem von uns. Ich sage ja, das Material war tipptopp – die einzige Schwachstelle bildete der Mensch.
Aber noch war ich nicht schwach, noch ließ ich mich von einem Biest namens Tiefdruckgebiet nicht kleinkriegen. Ich überholte einen zaghaft schleichenden Toyota, scherte nach links ein, bremste vor einem dunklen Riesenklotz und warf mein Rad gegen die Wand. Wer war eigentlich auf die lächerliche Idee gekommen, dieses Sturmtief »Heidelberg« zu nennen? Die hießen doch sonst Heiner oder Hilde. Wenn das eine neue Imagekampagne des Stadtmarketings sein sollte, war sie gründlich in die Hose gegangen. In die Windhose!
So, »Greven« spuckte mir das Handy als Kundenname aus. Und den Zusatz: »5. Stock, bei BioFuture klingeln«. Tat ich. Klingelte. Wartete. Es blitzte. Dann ein Knacken im Lautsprecher, ein Räuspern, alles Weitere wurde vom Donner geschluckt. Als ich im Nachhall des Donnerschlags ein Summen vernahm, drückte ich die Tür auf und stürmte ins Gebäude.
Mann, war das trocken! Und windstill! Daran musste man sich erst gewöhnen. Mit schmatzendem Geräusch schlurfte ich zum Aufzug hinüber, drückte die 5, zog während der Fahrt den Rucksack ab. Sogar dort, wo er gegen meinen Rücken gedrückt hatte, war alles nass.
Fünfter Stock, die Türen öffneten sich, direkt vor mir eine Glasfront mit knalliger Aufschrift: »BioFuture«. Auf der Schwelle ein Typ, der beide Brauen hochzog, als ich aus dem Aufzug trat. So was wie mich hatte der noch nicht gesehen. Höchstens in einer Taucherdoku.
»Draußen geht die Welt unter, und Sie bestellen Pizza mit doppelt Anchovis«, blaffte ich den Kerl an. »Wie können Sie das mit Ihrem Gewissen vereinbaren, Sie Dörrpflaume?«
Nee, tat ich natürlich nicht. Dachte ich bloß. Ich reichte ihm die beiden Pizzakartons, sagte, was drin war, schob die Flasche Weißwein hinterher und verabschiedete mich. Bezahlt war die Ware schon.
»Danke«, grinste der Typ. Den Buchstaben nach war es ein Danke, dem Sinn nach eher ein »Alter, hast du einen Scheißjob!« Egal, ich kannte diese Einstellung, und sie juckte mich schon lange nicht mehr. Auch nicht bei Sturzregen. Aber der Typ war noch nicht fertig. Er hielt die Flasche so, dass er das Etikett lesen konnte, dann zwinkerte er mir zu und sagte: »Nur gut, dass ich einen trockenen Weißwein bestellt habe.«
Okay, was will man von einem Anchovis-Fan auch anderes erwarten? Ohne mit der Wimper zu zucken, drehte ich mich um und drückte den Aufzugknopf, als er in meinem Rücken auflachte. »Hey, kleiner Scherz. Wie steht es mit Trinkgeld? Cash ist nicht, aber wenn Sie PayPal haben, lasse ich Ihnen ein paar Euro rüberwachsen.«
»Empfehlen Sie uns weiter«, sagte ich, ohne mich umzuwenden, und betrat den Aufzug. Sein Grinsen war das Letzte, was ich sah, bevor sich die Türen schlossen. Das Allerletzte.
Unten empfing mich der Regen mit unverminderter Wucht. Dafür donnerte es gerade nicht, weshalb man meinen Wutschrei ganz besonders deutlich hörte. Bestimmt hörte man ihn noch im fernen Boxberg, und spätestens jetzt würde Oleg wissen, dass seine nächste Begegnung mit mir kein Zuckerschlecken würde.
Und weiter ging es durch das Tief mit dem dämlichen Namen, von Stadtteil zu Stadtteil. Bergheim, Schlierbach, Altstadt, Neuenheim. Pizza, Asiatisch, Türkisch, Tutti Nazioni. Der Donner grollte, das Geschäft brummte. Anonyme Kunden und Kundinnen lotsten mich durch die Straßen, ich war die Figur auf einem Brettspiel, jede Bestellung bedeutete einen neuen Zug, eine neue Erfahrung von Nässe und Kälte. Koller, ärgere dich nicht!
Nein, ich ärgerte mich nicht. Schaltete auf emotionalen Autopilot, den Kopf gesenkt, strampelte die Arbeitszeit ab, war Maschine, Roboter, Fließband. Vor allem Letzteres. Floss, strömte, tropfte, dampfte. Auf das Heidelbergtief würde irgendwann ein Mannheimhoch folgen oder wenigstens ein Wanneeickelhoch. Dann würde ich in der Sonne sitzen und ein Bierchen köpfen. Nein, noch besser: Ich würde vor dem eingeschalteten Herd sitzen und zuschauen, wie die Anchovis-Pizza Blasen warf.
Mit solchen Gedanken hielt ich mich an diesem Abend – wo? Genau, über Wasser.
Es mochten vielleicht anderthalb Stunden seit der Begegnung mit dem Bio-Witzbold vergangen sein, als mich mein Weg erneut in die Bahnstadt führte. Der Regen war schwächer geworden, der Wind hatte eine Verschnaufpause eingelegt. Am Gadamerplatz rauschte ein Rettungswagen mit Blaulicht an mir vorbei und verpasste mir eine Breitseite Wasser. Er verschwand hinter einem Häuserblock, wo er abrupt zum Stehen kam, dem zuckenden Blaulicht nach zu urteilen. Moment, war das nicht meine Lieferadresse von vorhin? Musste einem jungen Schnösel jetzt der Magen ausgepumpt werden? Hatte ihm der Weißwein, haha, einen trockenen Haken versetzt? Das wollte ich genau wissen. Ich bog ebenfalls um den Häuserblock und sah eine Gruppe von Menschen unter Regenschirmen vor dem fünfstöckigen Klotz stehen. Daneben hielt der Rettungswagen. Niemand beachtete mich, als ich näherkam. Auf dem Asphalt lag ein Körper, um ihn herum wuselten die Sanitäter, einer der Gaffer zeigte in die Höhe, verhaspelte sich beim Sprechen, brach ab.
»Polizei«, sagte jemand.
»Schon informiert«, ein anderer.
Ich schaute nach oben. Trotz Regens und Dunkelheit konnte ich unter dem Dach des Gebäudes ein Geländer erkennen. Dort gab es also eine Art Terrasse oder Balkon. Und im selben Moment erschien ein Gesicht über dem Geländer, das Gesicht einer Frau mit weißem Haar.
»Da!«, machte es neben mir. »Da oben!«
Alle Augen richteten sich in die Höhe. Das Gesicht verschwand. Sofort brach das Geschnatter los, Hektik und Gefuchtel. Da war doch jemand! War da jemand? Und ob da jemand war! Handys wurden in den Regen gehalten, Fotos gemacht, ein Mann stürmte zur Eingangstür und rüttelte an ihr.
»Wo bleibt die Polizei?«, schrie jemand.
Als ich wieder nach unten schaute, sah ich, wie einer der Sanitäter leicht den Kopf schüttelte. Der Körper zu seinen Füßen bewegte sich nicht. Nennt es Karma, Schicksal oder Zufall, Leute: Es war der Kunde aus dem fünften Stock. Er lag auf dem Rücken, die Augen offen. Kein Grinsen mehr, kein lockerer Spruch, dafür ein Schleier von Verwunderung auf dem jugendlichen Gesicht. Aber auch der würde bald weggewaschen sein.
Und dann sah ich noch etwas: ein kleines, flaches Ding, vielleicht einen Meter von Greven entfernt. Außer mir ahnte wahrscheinlich niemand, dass es zu dem Toten gehörte. Heller Boden, rote Tomatensoße, gelblicher Käse. Und eine braune Anchovis, die im Regen glänzte.
2
Als ich am nächsten Morgen vom Läuten der Türklingel aus dem Schlaf gerissen wurde, wusste ich sofort, wer unten vorm Haus stand. Im Laufe der Zeit entwickelt man ja ein feines Gespür für die Nuancen des Läutens. Da gab es das knappe, verschämte Antippen der Klingel durch Christine, wenn sie mal wieder den Hausschlüssel vergessen hatte, das sachliche, unaufwendige Läuten des Heizungsablesers, das hektische, überlange Klingeling gestresster Paketboten – und es gab diesen bohrend schrillen Ton, der entsteht, wenn man den Knopf mit einem Übermaß an Testosteron in die Vertiefung drückt. Genau so eine akustische Kraftmeierei war es heute, und sofort blinkte ein Wort in meiner Hypophyse auf: POLIZEI. Es musste einer von Kommissar Fischers Wadenbeißern sein, der seine morgendliche Energie an einem harmlosen Klingelknopf ausließ.
Ich quälte mich aus dem Bett, fragte mich, warum es im Schlafzimmer so schlecht roch, und schlurfte zur Wohnungstür. Komisch, im Flur roch es auch nicht besser. Nachdem ich den Türöffner betätigt und die Tür einen Spalt aufgezogen hatte, trollte ich mich ins Bad, und was soll ich sagen? Der gleiche Gestank auch dort! Eine ekelhafte Duftnote von alten Socken und vergammeltem Fisch. Was dachte sich Christine eigentlich dabei?
Moment … Fisch? Ich hob einen Arm und brachte meine Nase in die Nähe der Achselhöhle. Verdammt, das war ich selbst, der so roch! Gestern Nacht hatte ich es nicht mehr geschafft, mich zu duschen, sondern meinen mehrlagig durchweichten, durchschwitzten Lieferantenkörper einfach seiner Bestimmung zugeführt. Liegen, schlafen, erholen. Und stinken. Wie hielt es meine Ex nur neben mir aus? Hatte sie Schnupfen?
»Platz nehmen, aber nichts anfassen!«, brüllte ich in den Flur hinaus. »Komme gleich!« Dann schloss ich die Tür und stellte mich unter die Dusche.
Kurz darauf erblickte ein komplett neuer Max Koller das Licht, einer, in den ich mich glatt hätte verlieben können. Nicht nur sauber, sondern porentief rein, so hieß es doch. Dieses Musterexemplar von blitzeblankem Privatermittler schwebte auf einer Wolke von Shampoo und Deodorant zu seinen Gästen, denen pflichtgemäß der Mund offen stand, als sie mich sahen. Wenn auch nur kurz.
»Ziehen Sie sich was an!«, schnarrte Kommissar Fischer in seiner unnachahmlichen Art.
»Sie haben ganz schön zugelegt«, meinte Kommissar Greiner mit Blick auf meinen Bauch.
Das fröhliche Pärchen hatte versucht, es sich in einem unserer Wohnzimmermöbel bequem zu machen. Jeder in einem eigenen natürlich; das Möbelstück, das zwei ausgewachsene Heidelberger Kommissare gleichzeitig aufnahm, musste erst noch erfunden werden. Abgesehen von unserem Sofa, logisch, aber das war von meiner Lieferantenmontur belegt, Jacke und Hose, die ich in der Nacht dort deponiert hatte. Sie waren zusammen mit der Pfütze, die sich auf dem Boden vor dem Sofa gebildet hatte, der Grund gewesen, warum sich Fischer und Greiner lieber in unseren Sesseln niedergelassen hatten, für die man allerdings eine ganz besondere Sitztechnik und viel Erfahrung brauchte, um nicht von den Polstern verschlungen zu werden.
»Ist ja gut«, sagte ich. »Andere Leute würden wer weiß was geben, um mich in Unterhose zu sehen.«
»Anziehen!«, blaffte Fischer. Na, der hatte ja eine Laune!
Zehn Sekunden später stand ich in Jeans und Hemd vor den beiden. Für Socken und Krawatte hatte die Zeit nicht gereicht.
»Was verschafft mir …«, begann ich, aber schon schnitt mir der Kommissar das Wort ab.
»Setzen Sie sich, wir müssen reden.«
Okay, mit Fischers Stimmungen konnte ich leben – aber nicht mit dem unverhohlenen Grinsen des Rottweilers an seiner Seite. Der war doch nur mitgekommen, um Zeuge zu werden, wie sein Chef mich kleinfaltete.
»Nach einem Kaffee immer«, sagte ich kühl und verschwand in der Küche. Mit grimmigem Gesicht holte ich eine Milch aus dem Kühlschrank, griff, ohne hinzusehen, nach der Tasse Kaffee, die mir Christine auf den Küchentisch gestellt hatte – und griff ins Leere. Verdammt, da stand nichts. Überhaupt nichts!
»Herr Koller«, kam es von nebenan. »Wir warten!«
»Wer war das?«, rief ich, ins Wohnzimmer stürmend. »Der war’s! Der da! Rück meinen Kaffee raus, sonst mach ich Gehacktes aus dir!«
Kommissar Greiner riss Mund und Augen auf. Schon zum zweiten Mal an diesem Tag!
»Herr Fischer«, zeterte ich weiter. »So geht das nicht. Der Kerl kann doch nicht einfach meinen Kaffee wegtrinken, den meine Frau mir mit viel Liebe …«
»Was?«, stotterte Greiner.
»Meine Ex-Frau, meine ich natürlich, mit viel Ex-Liebe … Also jedenfalls geht das nicht. Seit wann klaut die Polizei unbescholtenen Bürgern ihren Morgentrunk?«
Greiner warf seinem Chef einen Hilfe suchenden Blick zu. Fischers Gesichtsfarbe wechselte Richtung Avocado.
»Dort drüben«, sagte ich, zur Küche zeigend, »steht mein Kaffee. Jeden Morgen steht er da, seit Menschengedenken. Ich brauche das Zeug. Ohne Kaffee bin ich nur eine Wurst in der Pelle. Und wo ist er jetzt? Wenn Sie ihn nicht geklaut haben, Herr Fischer, dann muss es der da gewesen sein. Ich zeig den an.«
»Jetzt reicht’s mir aber!« Der Rottweiler sprang in die Höhe. »Sehen Sie hier vielleicht einen Kaffee, Sie Großmaul?«
Ich wich keinen Zentimeter. »Vielleicht haben Sie die Tasse gleich mit vertilgt. Um keine Spuren zu hinterlassen.«
»Herr Koller!«, donnerte Fischer aus der Tiefe. Er saß ja noch, während wir uns funkelnd gegenüberstanden. »Sie haben die Wahl: entweder einen Automatenkaffee bei uns auf dem Revier oder ohne alles hier bei Ihnen. Entscheiden Sie sich, aber schnell.«
In der folgenden Stille atomisierte ich Greiner mit meinem Blick. Als das erledigt war, setzte ich eine Miene größtmöglicher Verachtung auf und ließ mich aufs Sofa fallen. »Von eurer Bullenplörre kriege ich Ausschlag«, knurrte ich.
Auch Greiner nahm wieder Platz. Dem war das Grinsen vergangen.
»Warum«, stöhnte Kommissar Fischer mit Blick zur Decke, »warum können wir zwei nicht einfach miteinander plaudern? Vormittags-Small-Talk, ganz harmlos. Warum geht das nicht? Weil Sie Strolch nicht erwachsen werden wollen, darum.« Er schlug mit der flachen Hand auf die Sessellehne, was das Möbelstück plus Kommissar fast zum Kippen brachte. »Also kein Small Talk. Zur Sache! Erzählen Sie mir, was Sie gestern Abend getrieben haben.«
Ich wiegte den Kopf und überlegte, wie ich den Strolch finden sollte. Eigentlich ganz hübsch. Sagte ja kaum noch jemand. Und dann gesiezt! Alte Schule, der Kommissar. Trotzdem, jetzt ging es darum, den Bogen nicht zu überspannen.
»Gestern Abend?«, sagte ich.
Der Kommissar schwieg.
»Als es geregnet hat?«
Der Kommissar schwieg.
»Da habe ich gearbeitet. Bestellungen ausgeliefert. Unter anderem zu diesem Greven, deswegen sind Sie ja hier. Viel sagen kann ich Ihnen aber nicht. Ich drücke ihm das Zeug in die Hand, bezahlt ist es bereits, er will mir Trinkgeld geben, aber da bin ich schon wieder auf dem Weg nach unten.«
Fischer schwieg weiter.
»Was Sie vielleicht nicht wissen«, fuhr ich fort, »ist die Tatsache, dass ich später noch einmal vorbeikam. Ganz zufällig, als er tot auf dem Asphalt lag.«
Jetzt war Schluss mit der Schweigerei. »Wie bitte?«, brach es aus Fischer heraus. »Sie waren noch mal da?«
»Wie gesagt, reiner Zufall. Ich hatte eine weitere Lieferung in die Bahnstadt. Sah das Blaulicht, hab mich kurz zu den Gaffern gestellt und bin dann wieder los.«
»Verstehe ich das richtig? Sie sehen denselben Mann, dem Sie kurz zuvor eine Pizza gebracht haben …«
»Zwei Pizzen. Plus Wein.«
»Sie sehen ihn tot auf dem Pflaster liegen, schauen mal eben – und machen sich dann wieder vom Acker?«
»Was hätte ich denn sonst tun sollen?«
»Mit der Polizei reden! Ihre Aussage zu Protokoll geben!«
»Gestern war die Hölle los bei der Arbeit, die Leute haben bestellt wie irre. Ich hatte schlichtweg keine Zeit, Herr Fischer! Schon die eine Minute Glotzen hat mir einen Anschiss vom Chef eingebracht.«
»Sehr verdächtig«, murmelte Greiner.
»Nicht so verdächtig wie eine verschwundene Tasse Kaffee«, fauchte ich. »Der Mann war tot und kein Polizist in Sicht. Ich wäre heute schon noch zu Ihnen gekommen.«
»Und wann heute, bitteschön?«, grummelte Fischer. »Es ist nach zehn!«
»Ja, es ist nach zehn, Herr Fischer! Wissen Sie, wie lange ich heute Nacht unterwegs war? Ich muss erst wieder ins Menschsein hineinfinden, verstehen Sie? Und ohne Kaffee …«
»Glauben Sie, wir hätten viel geschlafen?«, fiel er mir ins Wort.
»Aber sind Sie bei Ihrer Arbeit nass geworden? Ich meine, so richtig nass, so fischmäßig unterseeisch nass? Hier«, ich warf Greiner meine Regenjacke zu, die er voller Ekel abwehrte, »nehmen Sie mal eine Nase voll! Ein Tauchgang war das gestern, die Durchquerung des Ärmelkanals.« Mit einem Fuß patschte ich in die Pfütze vor dem Sofa, dass es spritzte. »Mir sind Schwimmhäute gewachsen, wollen Sie mal sehen?« Ich spreizte meine Finger und streckte den Kommissaren beide Hände entgegen.
»Selber schuld, bei dem Job«, sagte Greiner.
»Zwischen den Zehen sind sie noch größer.« Zack, hielt ich ihm meinen nackten Fuß hin.
»Ist ja gut!«, rumpelte sein Chef. »Wir sind alle überarbeitet. Also konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Gegen 19.30 Uhr haben Sie diesem Greven seine Bestellung gebracht. Wie hat er auf Sie gewirkt?«
Ich zuckte mit den Achseln. »Anchovis doppelt.«
Fischer verdrehte die Augen. »Das wissen wir, Mann! Die Frage ist …«
»Wie er auf mich gewirkt hat, ja«, unterbrach ich. »Wie ein Typ, der Pizza mit doppelt Anchovis bestellt. Das sagt doch alles. So ein extravagantes Arschloch, dem die normale Speisekarte nicht fein genug ist. Der Salz braucht, viel Salz, ein richtiger Salzjunkie. Und der Wein, den ich ihm gebracht habe, war der teuerste auf unserer Liste.«
Das saß. Die beiden Kommissare starrten mich an, als hätte ich ein Gedicht von Hölderlin rezitiert.
»Sie beurteilen die Menschen nach ihrer Bestellung?«, kam es schließlich von Greiner.
»Wonach sonst? Man bekommt einen Blick für so was. Wenn einer drei Dönerpizzen ordert, betrete ich das Haus nur bewaffnet. Vegetarisch ist nie ein Problem, bei vegan muss man aufpassen. Und wenn der Parmaschinken vergoldet sein soll, weiß ich, da feiern die Hoffenheim-Profis wieder eine Party in der Weststadt.«
Fischer vergrub sein Gesicht in den Händen. Der Rottweiler schüttelte fassungslos den Kopf. »Ich hab’s geahnt, Chef. Der Typ ist ein Rassist. Dönerpizzen … Voll die Vorurteilskeule ist das!«
Ich nagelte ihn mit meinem Blick fest. »Bei Ihnen weiß ich genau, was Sie bestellen.«
»Und was?«
»Sag ich nicht. Am Ende zerlegen Sie mir die Einrichtung.«
»Sagen Sie’s!«
»Jedenfalls würden Sie einen Kaffee gratis dazu verlangen.«
»Ruhe!«, brüllte Kommissar Fischer.
Er bekam sie.
»Also«, fuhr er mit ebenso leiser wie drohender Stimme fort, »noch einmal: Wie wirkte der Mann? Koller!«
»Arrogant. Schnöselig. Er hat die ganze Zeit gegrinst.« Ich stand auf. »Aber das sind ja alles Vorurteile, können Sie nicht verwenden.«
»Wo wollen Sie hin?«
»In die Küche, ich brauche einen Kaffee.«
»Soll ich Sie vorladen lassen?«
»Wollen Sie auch einen?«
Ich hörte Fischer mit den Zähnen knirschen. Oder mit den Gelenken, der Kommissar war ja schon ein älteres Modell, und so ein Geknirsche tat ihm garantiert nicht gut. Aber es war nicht das, was mich zum Einlenken bewog. Sondern der Zettel, der auf dem Küchentisch lag und den ich bisher übersehen hatte. »Einkaufen«, hatte Christine dort notiert, und dahinter: »Kaffee. Dringend!!!« Ein kurzer Griff zur Kaffeedose, in der ein einsamer Löffel klapperte.
»Okay«, sagte ich und kehrte ins Wohnzimmer zurück. »Geht auch ohne. Was wollen Sie wissen?«
Fischer atmete aus. »Konnten Sie erkennen, ob noch jemand in der Wohnung war?«
»Nein.«
»Aber es waren zwei Pizzen, die Sie gebracht haben.«
»Die zweite war Quattro formaggi. Ganz klar eine Frau.« Greiners spöttisches Lachen wischte ich mit einer Handbewegung weg.
»Und danach?«, fragte Fischer. »Was haben Sie gesehen, als Sie wiederkamen?«
»Den Toten auf dem Asphalt. Eine Gruppe von Menschen, sechs oder sieben Personen, dazu die Sanitäter. Und dann oben unterm Dach ganz kurz das Gesicht einer älteren Frau. Danach bin ich gefahren.«
»Einfach so?«
»Wie gesagt: Termine.« Dass ein um die Ecke biegender Streifenwagen meinen Entschluss bestärkt hatte, erwähnte ich nicht.
»Aha.« Der Kommissar versank noch tiefer in den Polstern. Es sollen ja schon Bessere als er von Möbeln gefressen worden sein. Greiner beugte sich vor und spielte Klavier auf den Kniescheiben.
»War es ein Unfall?«, fragte ich. »Oder hat jemand nachgeholfen?«
»Vielleicht Suizid«, brummte Fischer.
»Kein Suizid. Neben der Leiche lag ein Stück Pizza. Wenn man sich aus dem fünften Stock stürzt, legt man vorher die Pizza aus der Hand.«
Er nickte. »Da ist was dran. Ja, da ist was dran.«
»Also? Unfall oder Mord?«
»Das möchten Sie wohl gerne wissen?«, grinste der Rottweiler. Ich würdigte ihn keines Blickes.
»Sie werden es ja doch erfahren«, seufzte sein Chef. »Wir haben ein Geständnis. Jemand hat Greven über die Brüstung gestoßen.«
»Wer? Doch nicht die Frau mit den weißen Haaren?«
»Genau die.«
»Und warum?«
»Wir arbeiten dran.« Er stand auf, wozu er drei Anläufe benötigte. »Wenn es wegen der Pizza war, kommen wir auf Sie zurück.«
3
»Apropos«, sagte Christine und stellte den Fernseher leise. »Eva hat uns zu Fattys Geburtstag eingeladen. Nächsten Samstag. Sie meinte, wir sollten endlich mal wieder gemeinsam feiern.«
Ich starrte auf den Bildschirm und begriff nicht. Wieso apropos? Worauf bezog sich dieses Apropos?
»Hast du eine Idee, was wir ihm schenken könnten?«, kam es von der Seite.
Mit dem, was in der Glotze lief, konnte es eigentlich nichts zu tun haben. Außer Krieg und Terror gab es in der Tagesschau mal wieder keine nennenswerte Meldung; dass irgendein Rüstungskonzern seinen Börsengang plante, war noch das Harmloseste. Wie kam Christine da auf Fattys Geburtstag?
»Ich meine, in seiner Situation, da frage ich mich wirklich …«
»Das ist scheiße«, sagte ich.
»Bitte was?«
»Das ist scheiße, was die hier bringen. Lauter deprimierendes Zeug. Leute, die sich in die Luft sprengen, Politiker, die lügen wie gedruckt … Hat so ein öffentlich-rechtlicher Sender keine Verantwortung dafür, dass man nicht jeden Abend komplett frustriert ins Bett geht? Gibt es denn keine positiven Nachrichten?«
Christine überlegte. »Welche denn?«
»Keine Ahnung. Vielleicht könnte man mal erwähnen, was für schlimme Sachen heute nicht passiert sind. Schon wieder keine Messerstecherei in Wilhelmsfeld! Überraschung: Deutschland ist immer noch keine Diktatur!«
»Du meinst, dann könntest du besser schlafen?«
»Da!«, rief ich und zeigte auf den Fernseher. »Selbst beim Wetter malen sie schwarz.«
Klar, keine Tagesschau ohne Wetterbericht. Ein jovialer Brillenträger kam ins Bild, aber was er zu verkünden hatte, klang überhaupt nicht jovial. Das Tief »Heidelberg« liege weiter über dem Westen der Republik, mit heftigem Niederschlag und starken Böen sei bis morgen Abend zu rechnen, erst in der Nacht lasse der Regen nach. Vorsicht vor herabstürzenden Ästen, Vorsicht vor Aquaplaning, vor steigenden Flusspegeln und der Übernahme der Regierung durch Amphibien. Okay, eine dieser Warnungen ist meine Erfindung, ich sage aber nicht, welche.
»Krass«, meinte Christine.
»Superkrass. Extrem krass. Wenn man das hört, möchte man sich die Kugel geben.«
»Aber du hast doch selbst erzählt, wie heftig es gestern war.«
»Na und? Trotzdem hätte man das anders bringen können. Warum berichten die nie über einen Fahrradboten, der jede Pizza pünktlich und trocken zum Kunden bringt, egal bei welchem Wetter? Da ist alles drin in der Story: Emotion, Hoffnung, Zuverlässigkeit, deutsche Tugenden …«
Christine sah mich skeptisch an. »Alles klar bei dir, Max?«
»Echt, wenn ich bei der Tagesschau wäre …«
»Okay«, unterbrach sie mich. »Zurück zum Thema. Was schenken wir Fatty?«
»Das ist so was von scheiße, das Programm. Wetten, dass die gleich … Egal.« Ich winkte ab.
Christine schwieg. Ihre Finger spielten mit der Fernbedienung in ihrer Hand, während sie mich nachdenklich anschaute. Aber nicht einfach so nachdenklich, sondern nachdenklich mit Hintersinn. Ich mochte diesen Blick nicht. Da kam immer etwas hintennach, etwas, mit dem man nicht rechnen konnte. Und überhaupt, was hatte sie vorhin mit ihrem Apropos gemeint?
»Meinst du, es wird wieder?«, sagte sie schließlich.
»Das mit dem Wetter?«
»Das mit Fatty.«
Ich starrte sie an. »Was ist denn das für eine Frage? Natürlich wird das wieder!«
»Auch wenn er schon so lange …«
»So was dauert. Fatty ist ein Kämpfer, der schafft das. Es geht ja auch aufwärts, nicht schnell, aber es wird.«
»Meinst du? Ich hatte diesen Eindruck nicht.«
»Doch. Kleinigkeiten, jeden Tag ein bisschen was. Oder jede Woche. Am Anfang hat er mich überhaupt nicht erkannt. Und jetzt, jetzt ist das … anders. Das kommt, glaub mir.«
Sie nickte, aber es war kein zustimmendes Nicken. Außerdem glotzte sie immer noch so komisch. Mensch, Christine, du solltest Tagesschau-Sprecherin werden, den passenden Blick hast du ja schon: Wir schalten nun direkt an die Front … live aus der Katastrophenregion … so viel für heute von den Krisengebieten der Welt.
»Sehr oft bist du ja nicht bei ihm«, sagte die Tagesschau-Sprecherin.
»Ich? Bei wem?«
Sie runzelte die Stirn. In diesem Moment brummte mein Handy. Schon witzig: In 99 Prozent der Fälle überhöre ich das Brummen, es ist ja auch sehr dezent. Aber hier drang es ganz deutlich an mein Ohr, obwohl das Handy auf der Kommode am anderen Ende des Raumes lag. Sofort schnellte ich vom Sofa in die Höhe und stürzte zum Telefon. Leg bloß nicht auf, Anrufer, hörst du?
Er hörte. In den nächsten Brummton hinein drückte ich das grüne Symbol und feuerte die drei Silben meines Namens ab.
Keine Reaktion. Nur eine undefinierbare Geräuschkulisse, eine Mischung aus Hintergrundgemurmel, Lachen, Gläserklirren und Musikgedudel. Schade, dass ich es noch nicht gelernt hatte, von der Art des Brummens auf den Anrufer zu schließen. Ein Handy war eben keine Türklingel. Diese doofe Digitalisierung macht alles kaputt.
»Hallo?«, hörte ich eine helle Männerstimme. Das O am Ende des Wortes wurde bis zur Decke hochgezogen.
»Max Koller«, wiederholte ich, nun etwas weniger kasernenhofmäßig.
»Ah, der! Genau!« Mein Heldentenor schien bester Laune. »Du, sag mal, Meister, ich hab was für dich. Was Fettes, aber so richtig fett. Wird dir gefallen!«
Etwas Fettes? Wovon sprach der? Drogen, Prostituierte, Schweinshaxe? Normalerweise habe ich nichts gegen Duzen, aber in diesem Fall fand ich es irgendwie unappetitlich.
»Was haben Sie für mich?«, sagte ich.
»Hä?«
»Was Sie für mich haben? Um welche Sache geht es?«
»Na, so’n … Na? Du bist doch dieser … dieser Dings.« Er bekam einen Hustenanfall. Aus dem Hintergrund schwappte gellendes Gelächter an mein Ohr.
»Wer sind Sie überhaupt?«, begann ich, doch da unterbrach er mich schon.
»Auftrag!«, brüllte er so laut, dass ich das Handy ein Stück weghielt. »Auftrag hab ich für dich, Meister. Das isses! Du bist doch der Typ, der Schnüffler, der …« Er röchelte. »O leck, ich muss brechen.«
Ich atmete tief durch. Eigentlich war es ganz einfach. Den roten Button drücken, Gespräch beenden, Ruhe im Karton. Gab es auch nur einen gescheiten Grund, sich den Feierabend mit so einem Geschwalle vermiesen zu lassen? Ich schaute Christine an. Na ja, einen Grund gab es durchaus.
»Kundschaft«, flüsterte ich ihr zu. »Wichtig!« Damit trollte ich mich nach draußen, verfolgt von ihrem vorwurfsvollen Blick. An welchem Ort hatte man seine Ruhe? Na klar, auf dem Klo. Außerdem musste ich. Nicht brechen, sondern anders. Also schloss ich mich ein, zog die Hose runter und setzte mich.
»Noch dran?«, fragte ich ins Handy.
»Boah, scheiße! Aber geht wieder. Muss ja. Meister, hast du’s dir überlegt?«
»Was?«
»Na, das mit dem … mit dem …«
»Auftrag.«
»Sag ich doch. Du wärst schön blöd, wenn du den nicht … Da kannst du dir echt einen Namen machen.«
»Apropos«, sagte ich.
»Hä?«
»Apropos Namen. Ich habe genau drei Fragen an Sie. Am besten schreiben Sie mit, wenn Sie was da haben.« Ich warf einen Blick auf die Klorolle neben mir. »Aber vielleicht geht es auch so. Frage 1: Wer sind Sie? Name, Adresse und so weiter. Frage 2: Was ist das für ein Auftrag, von dem Sie sprechen? Und drittens: Sind Sie nüchtern genug, um diese beiden Fragen beantworten zu können?«
Zack, das saß. Ich konnte mir die Verblüffung im Gesicht des Anrufers gut ausmalen, auch wenn ich dieses Gesicht überhaupt nicht kannte. Zwei, drei Sekunden hörte ich nur das am Horizont wogende Stimmenmeer der Kaschemme, in der sich der Typ herumtrieb, aber dann ging es los. Das Gelächter. Der Lachanfall. Herrje, der Idiot kriegte sich gar nicht mehr ein vor Heiterkeit! Hi-hi-ho, so ging es in endlosen Variationen die Tonleiter hoch und runter, ein paar Huster mischten sich hinein, Wortfetzen, Schluckauf, Rülpser, und was der Alkoholpegel noch alles hergab. Große Kneipenoper! Ich nutzte die Gelegenheit, um mein Geschäft zu verrichten, sauber und ohne Hektik. Sogar zum Abputzen reichte es noch. Wenigstens einer von uns beiden hatte die Zeit mit etwas Sinnvollem verbracht!
Irgendwann war es dann doch vorbei mit dem Gekichere.
»Du bist gut«, hörte ich am anderen Ende japsen. »Echt, Meister, du bist scharf drauf. Nüchtern! Alter, was ist das?«
»Antworten, oder ich lege auf. Kapiert?«
»Hey«, rief er, nicht mehr ganz so gut gelaunt. »Hey, hey. Nur keinen Stress, ja? Du willst doch in der Zeitung stehen, oder? So mackermäßig: Das ist der, der die Leute aus dem Gefängnis holt. Unschuldige Leute. Kann man doch nix gegen sagen, stimmt’s?«
»Ich will nicht in die Zeitung«, sagte ich müde. »Ich will bloß Geld verdienen.«
»Ja, aber in dem Fall kannst du es auch mal für die Dings machen, die Ehre. Ich sag dir, du kommst ganz groß raus, aber hallo. Meister, die werden dich …«
»Und tschüs«, sagte ich und legte auf. Ein Besoffener ist am Telefon nur schwer zu ertragen, ein Besoffener, der ums Geld streiten will, überhaupt nicht.
Mit gemischten Gefühlen kehrte ich ins Wohnzimmer zurück. Christine hatte einen Arm auf die Sofalehne gestützt, ihr Kinn lag in der Handfläche. Der Fernseher war noch immer auf halblaut gestellt.
»Ich hab abgelehnt«, sagte ich und deponierte das Handy wieder auf der Kommode. »Keinen Bock auf solche Typen.« Und als Christine nicht reagierte, fügte ich noch hinzu: »Muss ja nicht alles machen.«
Jetzt blickte sie auf. »Vielleicht sollten wir Eva etwas schenken.«
»Eva?«
Sie nickte.
»Wie, Eva? Am Geburtstag von Fatty?«
»Ja, eben. Ich meine, wer hat die ganze Arbeit mit ihm? Wer sorgt dafür, dass er seinen Geburtstag überhaupt feiern kann? Sie hat ihren Job gekündigt, damit sie sich um ihn kümmern kann. Ich finde, das sollte mal honoriert werden.«
»Klar, absolut.« Ich setzte mich. Irgendwie ging mir das zu schnell, dieser ständige Themenwechsel und die neuen Ideen. Das eine Geschenk war noch nicht in trockenen Tüchern, da kam Christine schon mit dem nächsten!
»Schön. Dann kümmere ich mich um ein Geschenk für Eva, und du übernimmst Fatty. Abgemacht?«
Ich nickte ergeben.
4
Am nächsten Morgen war ich gerade auf dem Weg in den Wäschekeller, wo meine Dienstkleidung auf der Leine trocknete, als das Handy brummte. Ich brummte ebenfalls, schaffte es aber, das Gespräch im Gehen entgegenzunehmen, ohne die Treppe hinunterzufallen.
»Koller.«
»Kumpe hier, guten Morgen.« Der Anrufer verhaspelte sich schier bei dem Versuch, höflich zu klingen. Kein Vergleich zu dem Rüpel gestern Abend! »Sebastian Kumpe. Guten Morgen. Herr Koller, ich würde Sie … hätten Sie Zeit für ein Gespräch? Jetzt gleich vielleicht? Aber nur, wenn es Ihnen passt. Wenn es jetzt passt, meine ich.«
»Worum geht es?«
»Einen Auftrag. Ich hätte einen Auftrag für Sie.«
»Okay.« Komisch, irgendwie kam mir die Stimme bekannt vor. Wann hatte ich die nur zuletzt gehört? »Wenn es sofort sein soll, dann am besten bei mir im Büro. Wo sind Sie gerade?«
»Vor Ihrer Tür.«
Reflexartig hob ich den Blick. War natürlich Quatsch, ich stand ja im Treppenhaus, und selbst wenn ich vor der Haustür gestanden hätte … egal. Jedenfalls musste es sich um einen dringenden Fall handeln, und was soll ich sagen? Dringende Fälle sind mir die liebsten.
»Ich komme runter«, sagte ich und legte auf. Beim Gang zur Haustür stellte ich mir vor, was für eine Art von Klient mich wohl erwartete. Frei nach dem Anchovis-Prinzip: Lass mich deine Stimme hören, und ich sage dir, wer du bist! Demnach stand der klassische Buchhalter vor meiner Tür, mittelalt und hypertonisch, sorgenvoller Blick im rasierten Gesicht, dazu Anzug. Krawatte? Unbedingt. Schon als Friedenszeichen, zur Besänftigung der Gemüter: Normalerweise bin ich nicht so aufdringlich. Aber in diesem Fall, geschätzter Herr Koller, das verstehen Sie doch?
Natürlich verstand das der geschätzte Herr Koller und öffnete milde gestimmt die Tür.
Okay, das mit dem Alter kam hin. Auch die Krawatte war da, aber es war die falsche. So ein Donald-Trump-Lappen, wie ihn nur Donald Trump tragen konnte, zu lang, zu breit, zu rot, außerdem fleckig und schlecht gebunden. Regelrecht verirrt hatte sich dieser Hals in den Schlips! Und auch sonst lag ich ziemlich daneben mit meiner Einschätzung. Von besorgter Miene keine Spur, der Mann strahlte eher Ablehnung aus, Widerwillen. Er war auf unangenehme Weise korpulent, sein Körper kündigte ihm den Dienst auf, an Kinn, Bauch und Hüften floss es nur so dahin, wie bei einem Gummibärchen, das zu lange im Wasser gelegen hat. Gut, in diesen Tagen konnte das schon mal passieren, wenn man sich im Freien aufhielt. Zur Krawatte trug Kumpe eine Lederjacke und ausgebeulte Jeans, Cowboystiefel sowie einen fusseligen dunklen Vollbart. Zwischen den untersten Fusseln und dem Hemdkragen lugten blauschwarze Runen hervor. War das wirklich der Typ vom Telefon?
»Herr Kumpe?«, fragte ich zur Sicherheit. Hätte ja auch ein Spendensammler sein können, Glasfaserverticker oder so was.
Er nickte.
»Dann mal rein in die gute Stube.«
Er gehorchte, und als ich die Tür schloss, hörte ich ihn sagen: »Tut mir leid.« Er räusperte sich. »Das mit gestern. Sorry.«
Kapierte ich nicht. Wieso gestern? Kannten wir uns? Und wenn ja, warum wich er dann meinem Blick aus?
»Reden wir in meinem Büro weiter«, schlug ich vor und ging voraus. Bei dem, was ich Büro nenne, handelt es sich um das streng riechende Innere eines Holzschuppens im Hof, der früher als Voliere gedient hat. Wegen des Geruchs und der Spinnweben in der Ecke sind mir Typen wie dieser Kumpe als Kunde gar nicht unlieb, jedenfalls lieber als damals der parfümierte Banker mit Einstecktuch, der sich partout nicht setzen wollte. Inzwischen sitzt der Kerl doch, und zwar drei Jahre. Bekam den Hals nicht voll mit seinen Cum-Ex-Geschäften. Aber Einstecktuch!
Nein, dann doch lieber teigige, schlecht gekleidete …
Ich dachte den Gedanken nicht zu Ende. Drehte mich stattdessen auf dem Absatz um und richtete den Finger auf meinen Besucher, der eben das Büro betrat.
»Sie waren das«, sagte ich. »Gestern Abend, der Anruf. Im volltrunkenen Zustand.«
War er zerknirscht? Nicht die Bohne. Seinem Mund entschlüpfte zwar eine weitere Entschuldigung, aber die klang eher nach: »Na und? Trinken ist Menschenrecht.«
»Und jetzt schauen Sie mal persönlich vorbei«, sagte ich.
»Bin ja nüchtern«, entgegnete er trotzig. »Keine Fahne, nix. Wollen Sie mal riechen?«
Nee, wollte ich nicht. Was ich stattdessen wollte: meine Ruhe haben. Eigentlich hätte ich diesen Sebastian Kumpe rausschmeißen sollen. Der Kerl war mir unsympathisch, ich ihm bestimmt auch, also tschüs und Auf Wiedersehen. So wie gestern Abend.
Aber gestern war gestern und heute ein anderer Tag. »Mann«, brach es aus Kumpe heraus, »mir geht’s halt scheiße. Ich steh voll unter Stress, voll.« Sein Gesicht wurde rot, die Stimme eng. Jetzt erinnerte sie wieder an den Heldentenor vom Abend zuvor. »Gestern musste ich mir einfach was hinter die Binde kippen. Hätten Sie an meiner Stelle auch getan.«
Ach, hätte ich das? Diplomatie gehörte nicht zu den Kernkompetenzen meines Besuchers. Aber gerade das war es, was mich davon abhielt, das Gespräch zu beenden. Denn wenn sich dieser Runenmensch trotz seiner Trampeligkeit und trotz seines Unwillens zu mir aufgemacht hatte, wenn er sich sogar eine Entschuldigung abgerungen und eine Krawatte umgebunden hatte, Letzteres garantiert zum ersten Mal seit der Konfirmation – dann musste es für all dies einen Grund geben. Und der interessierte mich.
»Okay«, sagte ich. »Viel Zeit habe ich nicht, aber nun sind Sie schon mal da. Also nehmen Sie Platz und erzählen Sie mir, was das für ein Stress ist. Und was für ein Auftrag, von dem Sie geredet haben. Aber eins sage ich Ihnen gleich: Ich nehme nicht jeden Auftrag an. Auch nicht von jedem. Und schon gar nicht für die Ehre oder wie Sie das gestern Abend genannt haben.«
»Ja, Mann«, murmelte er, wischte ein paar Regentropfen von der Jacke und ließ sich auf einem Stuhl nieder. Ich ging um den Schreibtisch herum und setzte mich ebenfalls.
»Schießen Sie los.«
»Es geht um meine Mutter, Antonia Kumpe.«
Stille. Ich verschränkte die Arme vor der Brust, lehnte mich zurück und ließ den Satz auf mich wirken. Um die Mutter, schau an. Mit der war mir noch kein Kunde gekommen, schon gar nicht Typen wie der da. Schien ja ein bemerkenswertes Exemplar von Mama zu sein, wenn sich der Sohnemann hierher bemühte. Ob sie tot war? Verschwunden? Betrugsopfer, in Schwierigkeiten?
»Sie ist«, er holte Luft, »im Gefängnis.«
»Ach?«
»Ja. Weil sie angeblich einen umgebracht hat. Deshalb.« Sein Körper straffte sich. »Aber das kann nicht sein, total irre. Meine Mutter hat noch nie … die macht so was nicht. Völlig ausgeschlossen! Das ist die feinste, die liebste, die friedlichste …« Er sah mich an. »Sie müssen beweisen, dass sie unschuldig ist. Dass es ein anderer war. Nicht sie. Oder keiner: Am Ende hat sich der Typ selbst …« Er sah mich hoffnungsvoll an.
»Umgebracht?«, half ich.
Er nickte. »Aus dem Fenster gestürzt.«
Ich schwieg. Mein Besucher war um die 40, seine Mutter also 60. Oder drüber. In dem Alter konnte man schon mal graue Haare haben. Oder weiße. Und wenn Kumpe sich eben etwas unpräzise ausgedrückt hatte …
»Aus dem Fenster?«, fragte ich. »Nicht vom Balkon? Aus dem fünften Stock, in der Bahnstadt?«
Verblüfft starrte er mich an. Irgendwo im Bartgestrüpp klappten Lippen auseinander. »Sie haben davon gehört? Dann wissen Sie ja … Stimmt, ein Balkon war’s. Kein Fenster. Genau.«
Also doch. Ich musste an das Gesicht denken, dass ich vorgestern Abend gesehen hatte. Wobei sehen zu viel gesagt ist. Mehr, als dass es sich bei der Person um eine Frau handelte, hatte ich nicht erkannt. Die weißen Haare, die schon. Das also war Kumpes Mutter gewesen. Ich dachte auch an den Regen, an das Pizzastück auf dem Asphalt und an das, was mir Kommissar Fischer gesagt hatte: Wir haben ein Geständnis.
»Wenn Ihre Mutter unschuldig ist, warum ist sie dann in Haft?«
Er starrte mich an. »Was weiß ich? Weil die bescheuert sind, die Bullen. Weil sie unbedingt einen Mörder brauchen, für die Quote oder so. Vielleicht gibt’s dann eine Beförderung oder mehr Kohle, keine Ahnung. Mit uns kleinen Leuten kann man es ja machen!«
»Herr Kumpe«, sagte ich kühl. »Wenn wir zwei zusammenkommen sollen, müssen Sie mir schon alles erzählen.«
»Mache ich ja! Alles. Das Wichtigste ist halt, dass es meine Mutter nicht gewesen sein kann. Ehrlich, die war’s nicht.«
»Warum ist sie dann in Haft?«, seufzte ich.
Er begann, mit den Handflächen über seine Oberschenkel zu streichen. »Weil, das ist so: Meine Mutter hat … jedenfalls behaupten die das … also angeblich hat sie denen gesagt, sie war’s. Sie hätte diesen Greven aus dem Fenster gestoßen. Vom Balkon, meine ich. Das hat sie so bestimmt nicht gesagt, aber vielleicht … vielleicht was in der Richtung. Sie war ja da, als es passierte, und die haben sie ganz schön in die Mangel genommen mit ihren Fragen und … und Dings, Unterstellungen … da hat sie dann …« Er schüttelte den Kopf. »Eine alte Frau kann man doch nicht so unter Druck setzen.«
»Hat sie …«
»Ich sag nicht, dass es Folter war«, fuhr er auf. »Aber vielleicht war es das. Man hört ja so Sachen.«
»Was für Sachen?«
»Keine Ahnung. Ich finde nur, bei alten Leuten muss man vorsichtig sein. Wie man die anpackt und so.«
»Wie alt ist Ihre Mutter denn?«
»72.« Bevor ich die nächste Frage stellen konnte, fiel er mir erneut ins Wort. »72, Herr Koller, und deswegen kann das nicht stimmen mit ihrem Geständnis. Der totale Fake ist das! Wissen Sie, warum sie den Greven da runtergestoßen hat? Also angeblich? Weil er sie vergewaltigt hat. Nicht richtig, aber fast. Angegrapscht und so! Idiotisch, oder? Ein junger Kerl meine Mutter!« Er stöhnte auf. »Wahnsinn! Der helle Wahnsinn ist das.«
»Moment, Moment, wer behauptet das? Ihre Mutter?«
»Die Bullen. Also die Polizei. Die sagen, das hätte meine Mutter gesagt.«
»Sie meinen, das ist der Inhalt ihres Geständnisses? Greven soll sie sexuell belästigt haben, woraufhin sie ihn über die Brüstung gestoßen hat?«
Er nickte.
Ich kratzte mich am Kopf. Dieser Greven hatte auf mich nicht den Eindruck gemacht, als würde er älteren Damen hinterhersteigen. Deutlich älteren Damen! Andererseits, wer kann schon in die Leute hineinschauen? Und wenn die Hormone erst mal ihr Recht einforderten … Anchovis, das neue Viagra! Aber für wen war dann die zweite Pizza?
»Mag Ihre Mutter Pizza Quattro formaggi?«, murmelte ich.
Kumpes Gesicht war ein einziges Fragezeichen.
»Vergessen Sie’s. War nur so ein Gedanke. Sie halten es also für eher unwahrscheinlich, dass das stimmt mit der sexuellen Belästigung?«
»Unwahrscheinlich? Völlig gaga ist das! Absurd.« Er tippte sich an die Stirn. »Meine Mutter, hallo?«
»Warum behauptet sie es dann?«
»Weil es ihr eingeredet wurde, weil sie gezwungen wurde, keine Ahnung. Vielleicht haben sie ihr Drogen eingeflößt, und plötzlich erzählt die was vom Weihnachtsmann!«
Stille.
Kumpe sah mich an, wartete, zog die Brauen hoch. Irgendwann hielt er das Schweigen nicht mehr aus und fragte: »Was ist los?«
»Quatsch«, sagte ich.
»Wie, Quatsch?«
»Das ist Quatsch, was Sie da von sich geben, Herr Kumpe. Ich kenne die Bullen, oder sagen wir: Ich kenne ein paar von ihnen, und die sind nicht besser oder schlechter als der Rest der Bevölkerung. Da gibt es Deppen und feine Kerle und alles dazwischen. Aber wenn ich Ihnen etwas garantieren kann, dann, dass bei Polizeiverhören keine Drogen im Spiel sind. Und gefoltert wird auch nicht. Wenn Sie auf dem Gegenteil bestehen, ist unser Gespräch ganz schnell zu Ende. Klar?«
Wieder trat eine kurze Pause ein. Kumpe verzog das Gesicht, als habe er in eine Zitrone gebissen. Hatte mich wohl ebenfalls für einen Anhänger von Verschwörungstheorien gehalten. So ein Privatermittler kämpfte doch einen ewigen Kampf gegen den Deep State und die Echsen in Polizeiuniform, nicht wahr? Aber sollte das seine Hoffnung gewesen sein, gab er recht schnell klein bei.
»Ist ja gut«, maulte er. »Ich sag ja nicht, dass es so war … Sag ich gar nicht. Aber warum erzählt die dann so bescheuertes Zeug? Denn bescheuert ist es, ich kenne meine Mutter. Ich bin schließlich ihr Sohn!«
Ich stand auf, ging zu einem der Fenster und öffnete es. »Ja«, sagte ich mit dem Rücken zu ihm, »Sie sind der Sohn. Fragen Sie Ihre Mutter, wie sie zu ihrer Behauptung kommt. Ob es stimmt, was sie sagt, oder nicht. Sie als Sohn sollten eine Antwort bekommen. Eher als ich jedenfalls.« Ich drehte mich um. »Wozu brauchen Sie mich dann überhaupt?«
Du lieber Himmel, jetzt ging es los. Fusselbart Kumpe begann sich zu winden, sprachlich wie körperlich. Während er vor meinen Augen auf dem Stuhl hin und her rutschte, beichtete er, dass das Verhältnis zwischen ihm und seiner Mutter vielleicht doch nicht so gut sei, wie es sein könnte, seine Mutter treffe da keine Schuld, ganz und gar nicht, es liege an ihm, er habe die großen Erwartungen, die sie in ihn gesetzt habe, nicht erfüllt, auch die kleinen nicht, weil, er sei mehr oder weniger arbeitslos, seine Frau ebenfalls, und dann die vielen Kinder, kein Geld, kaum Unterstützung, und wenn ihnen seine Mutter nicht ab und zu etwas zustecke … Sein Sermon mündete in den Satz »Ich brauche meine Mutter!«, und dieser dramatische Stoßseufzer hallte noch lange in der staubigen Luft des Schuppens nach.
»Aber Ihre Mutter braucht Sie nicht«, schloss ich messerscharf.
Er schüttelte den Kopf.
»Wie viele Kinder haben Sie denn?«
»Sechs.«
Sechs, na dann. Max Koller – also ich – hat ja keinen Nachwuchs. Und auch keine Ambitionen, daran etwas zu ändern. Insofern steht mir ein Urteil über die Familienplanung anderer Leute eigentlich nicht zu. Aber wenn ich dann sehe, mit welcher Nonchalance Typen wie dieser Kumpe großflächig ihre Gene übers Land verteilen, stellt sich mir die Frage, ob das der Menschheit weiterhilft. Schon klar: kein Sozialdarwinismus im Kellergeschoss der Weltgeschichte! Fällt alles auf einen selbst zurück. Aber wenigstens so seine Gedanken wird man sich noch machen dürfen. Auch wenn sie dämlich sind.
Kumpe jedenfalls schien genau sie lesen zu können. Meine Gedanken nämlich. Er fummelte ein Handy aus seiner Lederjacke und wischte darauf herum. Gleich darauf starrte ich in die Gesichter einer Handvoll Rotzbengel.
»Hier«, sagte Kumpe, und seine Stimme zitterte sogar ein wenig. »Das war beim Geburtstag der Kleinen, im Spaßbad. Der Joshua hatte Durchfall, deshalb ist er nicht mit drauf. Aber auf dem nächsten Bild. Und da, unsere Grace. Und der Dylan und die Bibi, die ist richtig gut in der Schule, ehrlich.«