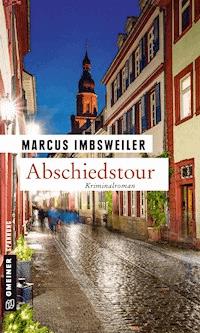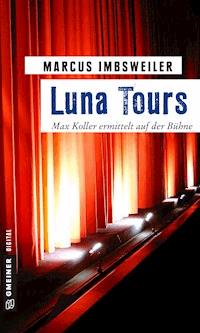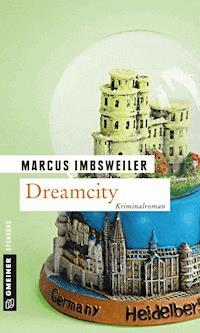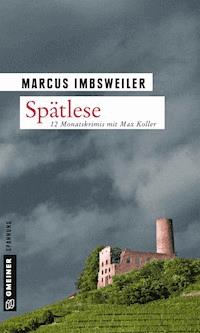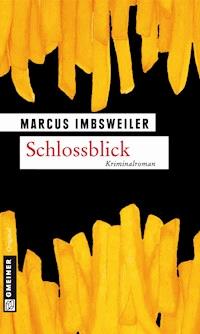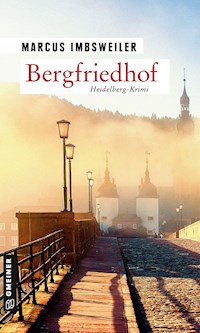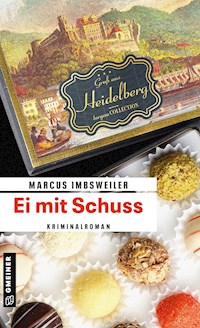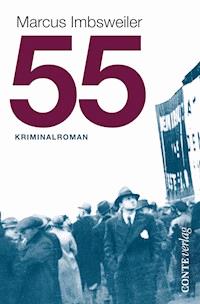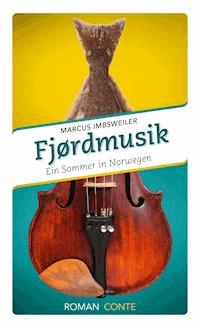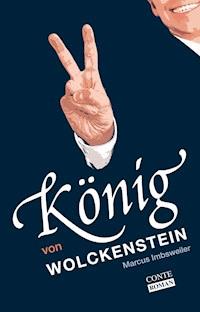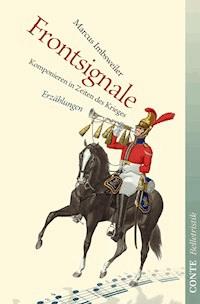Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Privatdetektiv Max Koller
- Sprache: Deutsch
Das Heidelberger Altstadtfest. Tausende drängen sich durch die Straßen des historischen Zentrums. Plötzlich fallen Schüsse auf dem Uniplatz, es gibt etliche Tote und Verletzte. Der Täter flüchtet unerkannt. Der Amoklauf eines Verwirrten? Ein Terroranschlag? Oder die Tat von Rechtsradikalen? Fieberhaft ermitteln Polizei und Geheimdienste. Und auch Privatdetektiv Max Koller wird in den Fall hineingezogen: Flavio Petazzi, italienischer Politiker und Vater eines der Opfer, betraut ihn mit eigenen Nachforschungen. Er soll Belege dafür finden, dass allein Petazzis Tochter Ziel des Anschlags war. Gegen seine Überzeugung nimmt Koller den Auftrag an. Und kommt am Ende zu einer unerwarteten Lösung ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcus Imbsweiler
Altstadtfest
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2009 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
PROLOG
Als dieser Verrückte auf dem Uniplatz um sich ballerte, stand mit einem Schlag das öffentliche Leben still. Die Würstchenbräter erstarrten hinter ihren Rosten, die Zuckerwatteverkäufer hielten im Zuckerwatteverkaufen inne, die Biertrinker setzten ihre Plastikbecher ab, und die guten Bekannten, die man nicht hatte treffen wollen, stoppten ihren Redefluss mitten in der Silbe. Auch die Musik verstummte. Drüben, auf der Bühne vor der Neuen Aula, blieben der Sängerin einer Volksmusikgruppe die Töne im Hals stecken. Die Gruppe nannte sich die Fidelen Odenthäler, und nie war ihr Name so unpassend wie in diesem Moment. Mitten unter ihnen stand der Attentäter, MP im Anschlag.
Ohne Musik keine Sicherheit. Als sie aussetzte, brach den Feiernden eine Stütze weg, eine Wand, an die sie sich, ohne es zu merken, gelehnt hatten. Statt ihrer breitete sich Stille aus: die Druckwelle einer tonlosen Explosion. Eine Sekunde lang war kein Laut zu hören. Ringsum sahen sich die Leute betroffen an. Waren das nicht Schüsse, die gerade …?
Ja, es waren Schüsse, und vor allen anderen hatten die Spatzen und Tauben des Uniplatzes ihre Botschaft verstanden. Mit dem Einsetzen der Salve stoben sie in die Höhe, über die Baumkronen, die Dächer der Altstadt, waren längst in die Dämmerung geflattert, als unter ihnen das Chaos losbrach.
War es so?
Beschwören kann ich es nicht, schließlich glänzte ich an diesem Abend durch Abwesenheit. Aber es gab Berichte, Interviews, Erzählungen, ich sprach mit Menschen, die vor Ort gewesen waren, und am Ende bekam ich sogar eine Filmvorführung, die mich mittelbar zum Augenzeugen des Anschlags machte. Für die Opfer spielte der exakte Ablauf im Übrigen keine Rolle, ihnen war egal, wer wo gestanden, eine Weinschorle gekippt oder eine Wurstsemmel in der Hand gehalten hatte. Jeder Besucher des Heidelberger Herbstes hatte seine eigene Version zu berichten, hatte sein persönliches Attentat erlebt. Es gab Hunderte Geschichten, die sich widersprachen, die von hundert verschiedenen Attentaten erzählten, und alle stimmten sie. Also lassen wir die Würstchenbräter und Zuckerwatteverkäufer an ihrem Ort, auch wenn ich gar nicht weiß, ob beim Heidelberger Herbst Zuckerwatte verkauft wird, und lassen wir das Chaos nach der Stille so losbrechen, wie es immer losbricht: Wir hören die Schreie, diese schrillen, der Todesangst geschuldeten Tierlaute, wir sehen Fluchtbewegungen, weg von der Konzertbühne, rennende, stolpernde, stoßende Menschenmassen, vielköpfige Hilflosigkeit, nackte Panik. Während die Hysterie auf den gesamten Uniplatz übergreift, bleiben auf dem Kopfsteinpflaster vor der Bühne menschliche Leiber liegen, manche reglos, andere zuckend, sich aufbäumend, man krümmt sich, hält sich den Bauch, den Kopf, wimmert, stöhnt, jault. Den Verletzten wird geholfen, aber nicht sofort, nicht in der Minute nach den Schüssen. Auch die Solidarität gehört zu den Opfern des Anschlags. Kinder werden von ihren Vätern aus dem Weg gestoßen, auf einer älteren Dame trampelt man herum, ein Mann bekommt Gulaschsuppe ins Gesicht geschüttet. Nicht zu reden von den Menschen, die sich aus Panik übergeben, denen die Angst in den Darm und von dort in die Unterwäsche schießt, die plötzlich riechen, wie sie noch nie gerochen haben. Nicht zu reden von dem verwirrten alten Herrn, der auf einen Baum klettert und spät in der Nacht von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht wird; nicht zu reden von dem Mädchen, das nach seiner Mutter ruft, immer wieder, auch am nächsten Tag noch, nach der Mutter, die vor Jahren bei einem Verkehrsunfall umgekommen ist.
Niemand war auf eine Tragödie dieses Ausmaßes vorbereitet. Höchstens die Wirte. In der Viertelstunde nach dem Anschlag wurde nicht ein einziges Bier auf dem Uniplatz verkauft. In der übernächsten Viertelstunde allerdings mehr als in sämtlichen Viertelstunden zuvor.
So ungefähr wird es gewesen sein, an diesem Abend auf dem Heidelberger Universitätsplatz, auch wenn ich persönlich nicht anwesend war. Auf dem Pflaster vor der Bühne lagen vier Tote und ein Dutzend Verletzte. ›Blutiger Herbst‹, schrie es eine Sonderausgabe der Neckar-Nachrichtennoch in derselben Nacht in die Welt hinaus, bevor die Sonntagszeitungen am nächsten Morgen sekundierten: ›Das Attentat von Heidelberg‹ – ›Amok auf dem Uniplatz‹ – ›Massaker in der Idylle‹. Auch bei der Bild-Zeitung ließ man sich nicht lumpen und widmete dem Vierfachmord die Titelseite; dafür rutschte ein zeitgleich im Irak erfolgter Selbstmordanschlag mit 37Toten in die Rubrik Vermischtes.
Und der Mörder? Von ihm fehlte jede Spur; er blieb unauffindbar, ein Phantom.
Der Heidelberger Herbst, das große Altstadtfest, wurde für beendet erklärt. Bis zum Sonntagabend hätte es noch dauern sollen. Nun strichen Verfassungsschützer durch die Gassen, Politiker aller Couleur legten Kränze am Tatort nieder, sogar der Bundespräsident ließ sich blicken. Es ging ja weniger um die Zahl der Opfer; vier Tote forderte die nahe A 5 fast jeden Monat. Es ging darum, dass sich niemand einen derartigen terroristischen Anschlag hatte vorstellen können, und wenn doch, dann in Berlin, in Ramstein oder am Frankfurter Flughafen. Vielleicht noch in Mannheim. Aber nicht in Heidelberg, nicht an einem milden Herbstabend, im Herzen der Kurpfalz, auf heiligem deutschem Boden, wo einst Luther und Goethe, Eichendorff und Schumann und wie sie alle hießen … »Diese Schüsse galten dem ganzen Land«, orakelte der Bundespräsident in jedes Mikro, das ihm vor die Nase gehalten wurde. Er war neben dem Generalbundesanwalt der meistinterviewte Mensch in diesen Tagen und sein Satz der meistzitierte der kommenden Wochen.
Diese Schüsse. Dem ganzen Land.
Je öfter ich sein Mantra vernahm, desto mehr ärgerte ich mich darüber. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die Schüsse jemandem wie mir gegolten haben sollten. Falls doch, gehörte ich zu den 80 Millionen Davongekommenen, und die vier, die es erwischt hatte, waren einfach Pechvögel. Pechvögel unterschiedlicher Herkunft übrigens. Eines der Opfer stammte aus Italien, ein anderes war mit einem Amerikaner verheiratet. Insofern hätte der Bundespräsident ebenso gut behaupten können, das Attentat habe der ganzen Welt gegolten. Was Attentate ja irgendwie immer tun.
Der Anschlag ereignete sich am Samstagabend um Viertel nach acht. Ich selbst genoss das Privileg der Unwissenheit noch bis zum nächsten Morgen, dann informierte mich mein Freund Fatty. Natürlich stellte ich sofort den Fernseher an und zappte durch die Sondersendungen auf allen Kanälen, um die Kommentare von Experten, Politikern und dem Mann auf der Straße in mich aufzusaugen. So verständlich die allgemeine Hilflosigkeit war, so erschreckend war das Geschwätz. Keiner wusste Genaueres, aber alle hatten etwas zu sagen. Der eine verurteilte das Attentat, der andere warnte vor Amokläufern, für den Dritten waren es islamische Terroristen, der Vierte hatte Angst vor einem Weltkrieg. Gesicherte Fakten, Hintergrundinformationen? Fehlanzeige. Wer sie besaß, hielt sich bedeckt; Polizei, Geheimdienste und Justiz bildeten eine große Koalition des Schweigens. Mit Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen, wie es hieß.
Nun, das war sicher vernünftig; hilfreich war es nicht. Nicht für einen Zuschauer, der sich durch das Geschehen in irgendeiner Form getroffen fühlte – und wer tat das nicht?–, den angesichts von vier Toten die eine Frage umtrieb: warum? Warum dieses sinnlose Sterben von Menschen, die keinem etwas Böses getan hatten, die kein Land überfallen, keine Minderheit unterdrückt hatten? Als ich vormittags zum Bäcker ging, um ein paar Laugenbrötchen zu kaufen, stand den Leuten genau diese Frage ins Gesicht geschrieben. Ihre Mimik sprach Bände. All der Fassungslosigkeit, des Kopfschüttelns und der betretenen Floskeln hätte es gar nicht bedurft. Die Leute wollten wissen, was passiert war. Und vor allem, warum.
Die Bild-Zeitung hatte jede Menge Antworten parat, man musste sich nur eine aussuchen. Ich blätterte sie kurz durch, ohne sie vom Stapel zu nehmen. Anschließend überkam mich das dringende Bedürfnis, mir die Finger zu waschen.
Warum? Diese Frage stellten sie sich in Bagdad seit Jahren. Und würden nie eine Erklärung bekommen. Nicht einmal auf Englisch.
Zurück im Haus, schaltete ich den Fernseher wieder ein und ließ mich vom Geschwätz der Nichtwisser einnebeln. Wenn die Informationen im Informationszeitalter aus Nichtinformationen bestehen, implodiert das System irgendwann. Ich merkte, wie Wut auf all die mikrobewaffneten Wichtigtuer in mir aufstieg. Als ich vier von ihnen zusammenhatte, die ich am liebsten umgelegt hätte, drückte ich den Aus-Knopf und stürmte aus der Wohnung.
Mein Rennrad trug mich hoch hinaus in den Odenwald. 300Meter über dem Niveau des Uniplatzes war die Luft frisch und klar. Niemand sprach, niemand belästigte einen mit Einschätzungen, Mutmaßungen, Spekulationen. Der Wald war wie immer, leer und groß und doch wunderschön. Ich fuhr einsame Wege, ohne Ziel, einfach kreuz und quer unter den Wipfeln hindurch. Laut keckernd warnten Eichelhäher vor mir und meiner Spezies. Wie recht sie hatten! Ich war nicht froh, nicht traurig, einfach nur Hülle für Gedanken und Erinnerungen und bescheidene Zukunftspläne. Heute Abend ein paar Bierchen, eisgekühlt. Schachspielen im Englischen Jäger. Mit Christine ins Kino, sobald sie aus Rom zurück war. Ja, sogar das. Wann meine Exfrau von der Schießerei wohl erfahren würde?
Hinter Heiligkreuzsteinach fuhr ich eine Gruppe von Wanderern fast über den Haufen. Wir entschuldigten uns gegenseitig, ohne uns in die Augen zu sehen. Die Sonne schien kräftig. Bergab summten meine Reifen gut gelaunt.
So verging der Sonntag. Ab und zu das Radio eingeschaltet, durch die TV-Kanäle mäandert. Die islamistische Gefahr. Kampf der Kulturen auf dem Heidelberger Uniplatz. Ein Einzeltäter, geistesgestört. Linksterror, Rechtsterror. Die vielen Gewaltvideos und der Fernsehkonsum. Hollywood hatte Schuld und die Wiedervereinigung und der Verlust der Werte. Das Ganze von vorn.
Um neun brachte das dritte Programm endlich eine akzeptable Sendung. Mit dem Vierfachmord vom Uniplatz hatte sie nur indirekt zu tun. Wenn man, so hatten sich die Redakteure gedacht, ratlos vor den gegenwärtigen Ereignissen stand, lohnte vielleicht ein Blick in die Vergangenheit: auf all die Attentate, die Heidelberg bereits hinter sich hatte. Und das waren nicht wenige. 1972 der Anschlag auf die US-Kasernen in der Südstadt. Drei Soldaten tot, fünf verletzt. 1981 der Beschuss von General Kroesen und seiner Frau, als ihre Limousine in den Königstuhltunnel fuhr. Außerdem Aktionen der Revolutionären Zellen, Farbbeutelattentate randalierender Studenten, Tomaten- und Eierwürfe. Ja, in Heidelberg war einiges los gewesen früher. Nur zu einem Attentat auf Hitler oder einen seiner Nazibonzen hatte es nie gereicht.
Erschlagen von all den Aufarbeitungen und dem Palaver, fiel ich um elf ins Bett. Ich hatte ein Bier getrunken, ohne darauf zu achten. Die Flasche war plötzlich leer gewesen, einfach so.
Ob der nächste Tag wieder so ein Scheißtag werden würde?
In jedem Fall wurde er anders. Ich stand ungewöhnlich früh auf, hörte beim Kaffeekochen die Acht-Uhr-Nachrichten, und die allererste Meldung ließ mich auf die Straße eilen und im Kiosk an der Ecke ein Exemplar der Neckar-Nachrichten erstehen. Tatsächlich, da stand es, so breit es das Zeitungsformat erlaubte: ›Neonazis laufen Amok‹.
Neonazis? Ich schaute mich um, ob das noch meine Stadt war, mein Land, meine Straße, in der ich wohnte. Es sah alles aus wie sonst. Der Himmel war blau, über mir stritt sich ein Elsterpärchen, die Jungs von der Müllabfuhr sammelten gelbe Wertstoffsäcke ein. Aber irgendwo in einer anderen Straße saß angeblich ein Rudel durchgeknallter Rechtsradikaler und heckte einen Anschlag auf den Heidelberger Herbst aus. Glauben wollte ich das nicht. Auch wenn es in der Zeitung stand. Papier ist schließlich geduldig.
Nein, ich glaubte nicht, was die Neckar-Nachrichten da in die Welt hinausposaunten. Das Ganze war eine Ente, und nicht einmal eine gelungene. Bis zum späten Vormittag dachte ich so. Dann gab es eine Pressekonferenz, bei der ein Sprecher des Generalbundesanwalts mit versteinerter Miene bestätigte: Es waren Neonazis.
Aber ich greife voraus.
1
Als der Verrückte auf dem Uniplatz um sich ballerte, wurde im Englischen Jägermal wieder die Welt gerettet.
Erst ging es um Außenpolitik, dann um Fußball. Was mitunter dasselbe ist. Wichtige, welterschütternde Themen wurden gewälzt, wie Sisyphos seinen Stein wälzte, immer hoch auf den Heiligenberg und wieder hinunter, und am Ende war jeder von uns ein Philosoph, der steile Theorien aus seinen kleinen grauen Zellen destillierte, bevor sie sich der Alkohol griff. Die Bedeutung Heidelbergs für den Rest der Welt: geklärt. Der 11. September: abgehakt. Ballacks Wade, die Wirtschaftskrise und das neue Stadion in Sinsheim: alle Fragen beantwortet, sämtliche Probleme beseitigt.
»Angriff ist die beste Verteidigung!«, rief einer. »Auch am Hindukusch!«
»Unsinn!«, ein anderer. »Die Null muss stehen. Haste hinten nix, biste vorne nix.«
»Keine Experimente!«
»Elf Freunde müsst ihr sein!«
»Oder zwölf, wenn der Schiedsrichter bestochen ist.«
»Ganz egal, auf die Abwehr kommt es an.«
Wer wollte da widersprechen? Ohne Abwehr lief gar nichts. Das war das Mantra aller gescheiterten Fußballer, und von denen gab es im Englischen Jägergenug. Rumpelfüßler, Kampfschweine, Knochenbrecher, Grasnarbentorpedos. Sie bevölkerten die Kneipe, brüllten ihre Weisheiten heraus und spülten sie mit Bier hinunter. Ich mitten unter ihnen. Nur der schöne Herbert verzog gelangweilt das Gesicht, wenn das Gespräch auf Sport kam, aber was will man von einem Einarmigen auch anderes erwarten.
Irgendwann stand Tischfußball-Kurt auf seinem Stuhl und bat wild fuchtelnd um Ruhe. »Wisst ihr, was mich rasend macht?«, brüllte er. »Na? Die schleichende Merkelisierung der Gesellschaft. Rasend macht mich das!«
»Die was?«, grölten wir.
»Die Merkelisierung unserer Gesellschaft. Steht mir bis hier. Kotzen könnt ich deswegen.«
»Max Merkel?«, fragte der schöne Herbert.
»Angela, du Depp«, fuhr ihn Kurt an und rollte mit den Augen. »Frau Bundeskanzler. Zonen-Angie. Da wächst was heran, ganz heimlich, im Stillen, wie ein Krebsgeschwür, und am Ende kriegen wir die Quittung. Wenn nix mehr zu machen ist. Dann sind wir alle erledigt.«
»Kapiere ich nicht«, sagte ich. »Wieso Merkelisierung?«
»Ist doch klar, Mann! Schau dir das Weib nur an. Wie die auftritt! Außenrum weiblich, betont weiblich, Kostümchen und so, anderer Stil, verstehst du? Aber innen …«
»Innen nicht weiblich?«
»Doch, auch. Aber hart wie Stein. Granit, klar? Die hat sich durchgesetzt, die steht oben. Jetzt will jeder so sein. Beziehungsweise jede.«
»Wie, jede?«
»Jede Frau natürlich. Die Weiber, alle. Ziehen Kostümchen an und machen einen auf Supermanager. Jungs, ich sage euch, da kommt was auf euch zu.«
»Das stimmt«, rief einer. »Die Weiber!«
»Zieht euch warm an!«
»Lass doch die Frauen, Kurti«, meinte Herbert. »Du findest wieder eine neue.«
»Dich hat keiner gefragt!«, brüllte Kurt von seinem erhöhten Standpunkt. Seine beiden Dackel kamen unter dem Tisch hervorgeschossen, um kläffend Beistand zu leisten. Herbert schüttelte den Kopf.
»Ist er seine Freundin schon wieder los?«, fragte ich vorsichtig. »Nach acht Wochen?« Tischfußball-Kurt ist eine Seele von Mensch, solange er nicht in Wut gerät. Und das passiert beim geringsten Anlass.
»Ich weiß nicht, von welcher Freundin du sprichst«, gab Herbert leise zurück, »aber die ist er los. Getürmt, was glaubst du.«
»Und was hat er gegen die Merkel?«
»Frag ihn.«
Das ließ ich lieber bleiben. Kurt stand immer noch über uns, wetterte gegen die Verrohung der Sitten und schüttelte beide Fäuste. Maria brachte eine neue Ladung Getränke. Hinten am Stammtisch lachten sie sich schlapp über uns. Der Englische Jäger bebte.
Urplötzlich kehrte Ruhe ein. Leander, der rauschebärtige Philosoph, trat freundlich lächelnd an unseren Tisch. Kurt stieg kommentarlos vom Stuhl, um sich hinter seinem Glas Orangensaft zu verkrümeln. Schluss mit dem Gebrülle.
Herbert und ich sahen uns verwundert an.
»Habt ihr das gehört?«, fragte Leander mit seiner sanften Stimme.
»Was?«
»Draußen, die vielen Lichter und Geräusche.« Er überlegte. »Erst dachte ich, das kommt vom Heidelberger Herbst, aber dann …«
»Dann?«
»Dachte ich es nicht mehr.«
»Ganz schön was los in der Altstadt, wie?«
Er nickte, holte Luft, als wollte er eine Ergänzung anbringen, schüttelte aber nur den Kopf. Leander ist auf die komplizierten Sachverhalte geeicht. Die einfachen bereiten ihm Schwierigkeiten.
Wir hätten ihn besser fragen sollen, was es mit den Lichtern und dem Lärm auf sich hatte. Oder wir hätten die Fenster öffnen sollen, warm genug war es ja. Dann hätten wir um halb neun eine Kolonne von Notarztwagen hören können, wie sie den Neckar entlangbrauste. Es muss ein infernalischer Lärm gewesen sein, das markerschütternde Geheul eines Chors von Martinshörnern. Alles, was an Nothelfern und Ordnungshütern in der Stadt verfügbar war, wurde wie von magnetischen Fingern auf dem Uniplatz zusammengezogen.
Doch wir öffneten die Fenster nicht. Niemand im EnglischenJäger wäre auf so einen Gedanken gekommen. Lieber die Vorhänge noch ein wenig zuziehen. Man will unter sich sein. Will auf den Grund leerer Schnapsgläser starren, sein Autogramm in Form dunkler Bierränder auf der Tischplatte hinterlassen, ungestört sein für jetzt und immer. Mochten die draußen sich die Köpfe einschlagen; solange hier drin Frieden herrschte, war alles gut. Die Außenwelt hatte Zutrittsverbot im Englischen Jäger.
Auch für den Heidelberger Herbst galt das. Nicht mit uns, liebe Stadtverwaltung! Wer hatte schon Lust, sich Schulter an Schulter mit Pfingstochsen aus dem Kraichgau und aufgehübschten Odenwaldstuten durch die Hauptstraße zu drücken? Um jeden Bierstand zog sich eine Wagenburg von Menschen, und das Bier war teuer. Dreimal so teuer wie im Englischen Jäger. Am Kornmarkt spielten sie Mittelalter, vom Rathausbalkon grüßte der Zwerg Perkeo. Winke winke. Auf den Ehrenplätzen neben dem Herkulesbrunnen schunkelte die Politprominenz. Die restlichen 10.000 Besucher hatten keine Sitzplätze, sie standen immer gerade dort, wo sie die Masse hinschob. Bei Tiefdruck wurde der Sauerstoff knapp, es gab reihenweise Kreislaufzusammenbrüche, aber man fiel wenigstens nicht um. Am Montag konnte man im Lokalteil der Neckar-Nachrichten lesen, die Stimmung sei wieder mal grandios gewesen beim Heidelberger Herbst. Ich brauchte das nicht. Wenn ich in Stimmung kommen wollte, schaltete ich zu Hause das Radio ein. Oder aus, je nachdem.
Außerdem war auch die Stimmung eine Sache der Stadtverwaltung. Punkt elf machten alle Buden dicht, die Bierfässer wurden weggerollt und die Musik abgedreht. So stand es in der Festverordnung. Wer dann noch schunkelte, bekam ein Knöllchen. Um fünf nach elf paradierte die Stadtreinigung durch die sich leerenden Straßen. Normalerweise.
Bloß an diesem Samstag war alles anders.
»Was?«, brüllte mein Freund Fatty in den Telefonhörer, dass die Widerstände ächzten. »Du weißt nichts davon? Es ist Sonntagmorgen neun Uhr, und du hast nichts von dem Amoklauf gehört?«
»Welcher Amoklauf? Hast du zu lange ferngesehen?«
»Max, wach auf! Das hier ist die Realität, 21. Jahrhundert, verstehst du? Gestern Abend hat es ein Massaker auf dem Uniplatz gegeben, einen Amoklauf mit zig Opfern.«
Das Telefon am Ohr, trat ich ans Schlafzimmerfenster, zog den Vorhang beiseite und öffnete es. Die Sonne spielte auf den Dächern, Vögel sangen, das Viertel dämmerte vor sich hin. »Im Ernst?«, fragte ich vorsichtig. Man wusste nie, zu welchen Scherzen ein Friedhelm Sawatzki aufgelegt war.
»Wie oft soll ich es dir noch sagen? Verdammt, du musst doch davon gehört haben! Es ist über zwölf Stunden her.«
»Ich war bei Maria. Wir hatten wichtige Probleme zu lösen. Die letzten Welträtsel sozusagen.«
»Das hätte ich mir denken können. Und Radio hörst du gar nicht mehr?«
»Nicht um diese Zeit. Außerdem habe ich doch dich.«
»Ich fasse es nicht«, stöhnte Fatty. »Wenn sie demnächst dein Nachbarhaus abreißen, kriegst du wenigstens das mit?«
»Nun erzähl schon. Was genau ist gestern passiert?«
Diese Worte wurden zum Schleusenöffner: für einen Katarakt von Bericht. Fatty malte das Attentat in all seinen düsteren Schattierungen aus: von der ausgelassenen Atmosphäre auf dem Uniplatz über das plötzliche Erscheinen des Schützen bis zur Panik danach. Dass er dazu neigte, sich in Erlebnisse anderer hineinzusteigern, wusste ich. Die Intensität jedoch, mit der er es an diesem Morgen tat, war neu. Da wurde jedes Detail beschrieben, jede Szene in ihre Einzelteile zerlegt. Fatty versetzte sich in die Beteiligten, litt und hoffte mit ihnen, lag selbst auf dem Kopfsteinpflaster, wurde gestoßen, getreten, kroch davon, rappelte sich auf, suchte Schutz hinter einer Platane, heulte, bekam Schüttelfrost.
Endlich schwieg er erschöpft.
»Wann hast du davon erfahren?«, wollte ich wissen.
»Gleich am Abend, gegen neun. Ich war bei Eva, als sich deren beste Freundin meldete. Vom Uniplatz.«
Natürlich, das erklärte einiges. Wenn Evas beste Freundin den Heidelberger Herbst besuchte, hätte genauso gut Eva ihn besuchen können. Oder Fatty selbst. Plötzlich waren die Schüsse ganz nahe. Plötzlich zischten sie nur um Haaresbreite an einem vorbei. Es sei denn, man saß im Englischen Jägerund scherte sich einen feuchten Dreck um den Rest der Welt.
»Und? Ist sie verletzt? Ich meine diese Freundin von Eva.«
»Nein, nein. Stand halt unter Schock, die Arme. Eva war auch ziemlich mitgenommen. Das musst du dir mal überlegen: ein Massaker mitten in Heidelberg!«
»Massaker? Ein großes Wort, Fatty.«
»Hast du ein besseres? Wie nennt man das, wenn ein Irrer mitten im Konzert ins Publikum feuert, einfach so, ohne Sinn und Verstand?«
»Amok nennt man das. Oder gibt es einen Bekennerbrief, eine Meldung im Internet?«
»Bisher nicht. Und wenn du mich fragst, wird es das auch nicht geben. Das war ein Verrückter, ein durchgeknallter Militarist. Wie in den USA oder in Finnland.«
»Oder in Winnenden. Hat man ihn schon gefunden?«
»Wie, gefunden?«
»Tot. Erschossen, von eigener Hand gerichtet. So enden sie doch alle, diese Amokläufer. Die wissen genau, was sie tun, und deshalb heben sie die letzte Kugel für sich selbst auf. In der Regel flüchten sie ja nicht einmal.«
»Der schon. Evas Freundin sagt, so schnell, wie er auftauchte, so schnell war er auch wieder verschwunden.«
»Dann wird man demnächst in irgendeiner trostlosen Bude eine Leiche finden, männlich, jung, kontaktscheu, unauffällig, und die fassungslosen Nachbarn werden sagen, das hätten sie nie vermutet, er war doch so ein harmloser Junge. Neben der Leiche ein Abschiedsbrief, im Zimmer ein Regal voll Gewaltvideos, ein Waffenarsenal, eine erschossene Dogge und die gesammelten Schriften eines Weltuntergangspropheten.«
»Hör auf, bitte!«, stöhnte Fatty.
»Und, nicht zu vergessen: eine Botschaft an alle Nachahmer im Internet.«
»Nachahmer? Sag nicht so was!«
»Wusstest du, woher der Begriff Amok stammt? Aus irgendeiner entlegenen Sprache, malaiisch oder mikronesisch, glaube ich. Von wegen Südseeparadies!«
»Trotzdem, wenn man das hört, wäre man lieber auf einer Insel. Weit weg von hier.«
»Auf der Insel der Seligen.«
»Warum nicht?«
Wir schwiegen. Die Insel der Seligen. War das nicht unsere Hausadresse gewesen? Weltweit stand eine Stadt wie Heidelberg für die Illusion, das Verbrechen sei abgeschafft. Oder ein Gegenstand universitärer Forschung. Terrorismus gab es nur im Fernsehen, und Amok war eine Erfindung der Südsee. Irgendein Linguist hatte bestimmt seine Magisterarbeit darüber verfasst. Solange uns keine Kokosnuss auf den Kopf fiel, konnte uns nichts passieren. Dachten wir. Nun war die Insel geentert worden, gekapert, über Nacht abgetrieben. In fremde Gewässer. Und wir? Suchten nach Erklärungen.
»Ein gezielter Anschlag war es nicht?«, fragte ich.
»Wo denkst du hin? Der Kerl feuerte wahllos in die Menge. In die erste Reihe vor der Bühne. Magazin leer, Rückzug. Evas Freundin hat es genau gesehen, wie tausend andere Besucher auch.«
»Wahnsinn.«
»Du sagst es. Da traut man sich kaum noch auf die Straße. Wie soll ich das morgen meinen Kleinen erzählen?«
Gute Frage. Ich war der Letzte, der eine Antwort darauf wusste. Wie erklärte man einem Vierjährigen, dass die Welt und das Verbrechen zusammengehörten? Pass auf, Kleiner, es gibt gute Menschen und böse Menschen. Die guten, das sind wir, die bösen die anderen. Reichte das? Für so einen Knirps waren wir zunächst einmal Erwachsene, wir alle. Wir schimpften mit ihm, wenn er die Ellbogen auf den Tisch legte oder zu viele Gummibärchen aß, anschließend kauften wir Waffen und schossen uns gegenseitig tot. Führten Kriege, ließen andere Kinder verhungern. Schöne Vorbilder waren wir! Und am Ende sollten es Erzieher wie Fatty wieder richten.
»Das kriegst du schon hin«, sagte ich. Es war ein alberner Satz, und doch meinte ich ihn ernst. Wenn es Fatty nicht gelang, den Kleinen Fröhlichkeit zu vermitteln, gelang es keinem.
»So einen Anschlag kannst du nicht verheimlichen«, sagte er düster. »Nicht in der heutigen Zeit. Ich sehe meine Zwerge schon vor mir, wie sie auf den Tisch klettern und die Szene nachspielen. Und da lass dir mal eine gescheite Reaktion einfallen.«
»Sehen wir uns heute?«
»Ich bin mit Eva unterwegs. Verwandtschaftsbesuch. Das hätte ich mir auch nicht träumen lassen: dass der Kaffeeklatsch mit ihrer Tante nur das zweitschlimmste Ereignis des Wochenendes sein würde.«
Nach dem Ende unseres Telefonats blieb ich noch einen Moment im Bett liegen. Ich versuchte, mich an den gestrigen Abend zu erinnern, an das, was wir zwischen acht und neun Uhr gesagt und getan hatten. Sinnfreies Zeug natürlich, wie immer. Mir fielen Leanders Worte ein, als er von den Lichtern und dem Aufruhr draußen berichtete. Beziehungsweise nicht berichtete. So nahe waren wir den tödlichen Schüssen gewesen. So nahe und so fern. Kein Gedanke daran, dass etwas Schreckliches passiert sein könnte.
Oder doch? Im Englischen Jäger wurden gerne martialische Reden geschwungen. Auch am gestrigen Abend, an dem es um Fußball ging. Ich erinnerte mich an einen hageren Kerl, dessen linkes Augenlid beim Sprechen zuckte. Sport sei die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln, und Fußball sowieso. In Hoffenheim vielleicht nicht, aber sonst. Überall. Tischfußball-Kurt stimmte zu, und er musste es wissen, schließlich forderten die monatlichen Kickerturniere in seinem Hobbykeller mehr Verletzte als ein Spieltag in der Verbandsliga. Ein junger Anarchist berichtete von seinen Erfahrungen mit Mannheimer Ultras, während der Hagere die legendären Glasgower Duelle zwischen den Celtics und den Rangers beschwor.
»Das waren keine Spiele mehr«, rief er, »das waren Schlachten! Ganze Stadtviertel gingen da aufeinander los. Katholiken gegen Protestanten, Irland gegen England. So war das!«
»Irland«, nickte Leander. »Ich fahre da wieder hin. Bald.«
»Und dann kam der Höhepunkt«, wollte der Glasgow-Experte fortfahren, wurde aber unterbrochen.
»Musst du so schreien?«, blaffte ihn Tischfußball-Kurt an.
»Ich schreie nicht.«
»Und ob du schreist. Das geht auch leiser.«
Irritiert beendete der andere seine Erzählung in halber Lautstärke. Sogar sein Lid zuckte nur noch bei jedem zweiten Satz. Maria kam an unseren Tisch, um zu kassieren. Kurt rutschte hinter seinem Orangensaft unruhig hin und her, dann murmelte er: »Sein Zeug geht auf mich.« Dabei zeigte er auf Leander, dessen rauschebärtiges Denkergesicht sich zu einem milden Lächeln verzog. Maria nickte.
»Was ist denn mit dem los?«, flüsterte ich dem schönen Herbert zu. »Der hat noch nie einen spendiert. Niemals.«
Auch Herbert ließ eines seiner seltenen Lächeln sehen. »Aus schlechtem Gewissen. Leanders Lieblingsinsel ist pleite, und Kurt glaubt, er sei daran schuld.«
»Wie bitte?«
»Erinnerst du dich an die Villa, die Kurt vor zwei Jahren von einem Onkel erbte? Er hat sie zu Geld gemacht und das Geld zu Aktien.«
»Und wenn man ihn darauf ansprach, ging er in die Luft.«
»Genau. Hochspekulativ, das Zeug. Kurt war plötzlich an Fonds beteiligt, die auf die verrücktesten Sachen wetteten. Unter anderem auf den Verfall der isländischen Krone. Und weil sie darauf wetteten, rauschte die Währung tatsächlich in den Keller, noch vor der globalen Finanzkrise. Die drei größten isländischen Banken gingen pleite und mit ihnen der Staat.«
»Ach, und daran ist Kurt schuld?«
»So sieht er es. Die Zusammenhänge wurden ihm erst vor Kurzem klar, als sich sein Finanzberater aus dem Staub machte. Jedenfalls ist ihm die Sache vor Leander megapeinlich.«
»Aber was hat Leander mit Island zu tun? Island ist nicht Irland.«
»Details«, sagte Herbert und winkte ab. »Um solchen Kleinkram hat sich Kurt noch nie gekümmert. Und keiner hier, weder Leander noch ich, hat ein Interesse daran, ihn über den Unterschied aufzuklären.«
»Was quatscht ihr da die ganze Zeit?«, herrschte uns Tischfußball-Kurt über den Tisch hinweg an, seine übliche Zornesröte im Gesicht. »Keine Heimlichkeiten, verstanden?«
»Ein bisschen handzahm wäre schon von Vorteil«, murmelte ich. »Er darf nur keine irische Euromünze in die Hand bekommen.«
»Max«, sagte Maria und setzte sich neben mich, den offenen Geldbeutel in der Hand. »Hast du mal Zeit? Muss mit dir rede.«
»Was gibts?«
»Probleme, Max. Große Probleme.« Sie zog ein Papier aus der Tasche und strich es glatt. Ein amtliches Schreiben der Stadt Heidelberg, vom Ordnungsamt. Darin wurde der Wirtin des Gasthauses Zum Englischen Jäger, Frau Maria de’ Angeli, mit dem Entzug der Schankerlaubnis gedroht, falls sie nicht in Zukunft die Einhaltung des Rauchverbots in ihren Räumen beachte und ihre Gäste beim Verlassen des Hauses nicht Rücksicht auf die Bedürfnisse der Nachbarn nähmen. So seien nächtliche Ruhestörungen zum wiederholten Male aktenkundig geworden.
»Aber niemand hat beschwert«, sagte Maria. »Keiner von den Nachbarn, die haben noch nie was gesagt oder Anzeige gemacht. Waren andere.«
»Andere? Wer?«
»Gleich. Lies zu Ende, Max.«
Auch das Gesundheitsamt, hieß es weiter, habe jüngst Bedenken gegen sie als Wirtin geäußert. Aus diesem Grund fordere man sie auf, zu den aufgeführten Missständen Stellung zu nehmen und zu erklären, wie sie Abhilfe schaffen wolle. Weitere Schritte behalte man sich vor. Mit freundlichen Grüßen.
»Kam das heute?«, fragte ich.
Sie nickte.
»Ich habs geahnt«, seufzte der schöne Herbert. »Irgendwann machen sie ihn dicht, unseren Garten Eden.«
»So schnell geht das nicht«, wiegelte ich ab. »Das ist ein Serienbrief, den erhält jede zweite Kneipe in Heidelberg.«
»Aber Gesundheitsamt war da«, klagte Maria. »Hat alles auf den Kopf gestellt. Das erste Mal seit 20 Jahr! Die wolle, dass ich das Haus räume.«
»Haben sie was gefunden?«
»No, no, niente. Nur zwei Fliege.«
»In der Suppe?«
»No. In der Küche. Also, ich dachte, sind Fliege. Aber ware Kakerlak.« Und dann verriet sie uns, wer ihrer Meinung nach hinter der Kontrolle und dem Brief steckte. Ein Bauträger, der sich anschickte, das umliegende Karree in eine Wohlfühlwohnlandschaft zu verwandeln. Einige der Nachbarhäuser waren bereits abgerissen, das Innere des Areals wurde von schweren Maschinen durchpflügt. Ich erinnerte mich, von dem Bauvorhaben gelesen zu haben. Es war nicht das einzige in Neuenheim, und es war mindestens so umstritten wie die übrigen. Schicke Hamsterkäfige wurden übereinandergestapelt, alles familienfreundlich, von den Preisen einmal abgesehen. Und wenn die Ausmaße dieser Wohnsilos den gesetzlichen Vorschriften nicht entsprachen, wurden sie eben angepasst. Die Vorschriften, nicht die Ausmaße.
»Sie haben mir Geld versproche, wenn ich wegziehe«, sagte Maria. »Viel Geld, mamma mia!«
»Wer? Leute von der Baugesellschaft?«
»Ja. Ist vorgestern so ein Mann gekomme, hat freundlich getan, aber war nicht freundlich. Hat gesagt, mein Lokal hat keine Zukunft, so nicht oder so nicht, und ich soll das Geld nehme. Aber wo soll ich hin, Max? Was soll ich arbeite?«
»Du hast abgelehnt?«
»Certamente! Was glaubst du? Hat er gesagt, schade, dass ich so stur bin. So dicken Kopf habe. Hat immer gegrinst. An seinem Hals eine dicke, dicke Narbe. Dann hat er gesagt, ich soll in Acht nehme, weil sie hätten auch andere Methoden. Geht auch ohne Geld, hat er gesagt.«
»Und du glaubst, die Baugesellschaft hat dafür gesorgt, dass dir das Gesundheitsamt auf die Pelle rückt?«
»Aber ja! Ist doch klar wie Brühe mit Kloß.«
»Meines Wissens«, mischte sich Herbert ein, »steckt der Bauträger in Schwierigkeiten. Die Arbeiten hier hinterm Haus gehen schon seit Wochen nicht voran. Angeblich springen die Investoren ab, weil sich immer noch Anwohner wehren. Und eine Kneipe wie der Englische Jäger ist nicht gerade das, was man in direkter Nachbarschaft zu Luxuswohnungen haben möchte.«
»Sie möchten uns nicht, wir möchten sie nicht«, sagte ich. »Eigentlich sind alle einer Meinung. Trotzdem gibt es Ärger. Warum?«
Maria schaute unglücklich drein.
»Seid ihr schon wieder am Mauscheln, ihr zwei?«, rief Tischfußball-Kurt wütend. »Immer stecken diese Geheimniskrämer die Köpfe zusammen und drehen ihr eigenes Ding. Jetzt auch noch mit Maria. Lasst uns an euren Weisheiten teilhaben!«
»Okay«, entgegnete ich. »Stell dir mal vor, Kurt, der Englische Jägerwürde von heute auf morgen geschlossen. Was würdest du dann tun?«
Er schaute mich an, wie er noch nie geschaut hatte. Seine Augen wurden kreisrund, die Unterlippe sank Richtung Boden. Selbst die Finger seiner rechten Hand lösten sich vom Orangensaftglas, um hilflos auf der Tischplatte herumzuzucken. Coppick und Hansen, Kurts Dackel, waren von der plötzlichen Stille so verstört, dass sie unterm Tisch hervorkrochen und zu winseln begannen.
Auch die übrigen Gäste glotzten mich an. Niemand von denen, die mit uns am Tisch saßen, hatte die leiseste Ahnung, was er ohne diese Kneipe mit seinem Leben anfangen sollte.
2
Die neue Woche begann mit lästigem Kleinkram. Ich spülte das Geschirr, das vom Sonntag herumstand. Ich machte einen Papierflieger aus dem Brief meines Vermieters. Jedes Jahr schrieb er mir, die Nebenkostenvorauszahlungen müssten erhöht werden, und jedes Jahr ignorierte ich ihn. Ich wechselte eine kaputte Glühbirne aus und brachte die leeren Mülltonnen in den Hof zurück. Auf meinem Schreibtisch lag die Ausgabe der Neckar-Nachrichten, die ich mir noch vor dem Frühstück gekauft hatte, und brüstete sich mit ihrem Aufmacher: ›Neonazis laufen Amok‹. Irgendwann deckte ich sie mit dem Telefonbuch ab.
Dann ging ich einkaufen. Ich ließ mir Zeit dabei, wollte mir mit aller Macht etwas Gutes tun, aber eine Idee, was ich kochen sollte, kam mir nicht. Vorm Pasta-Regal meldete sich mein Handy. Die Nummer auf dem Display begann mit 0039. Das passte zwar zu den Nahrungsmitteln, vor denen ich stand, trotzdem hatte ich jetzt keine Lust auf einen Anruf aus Italien. Ich drückte ihn weg.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!