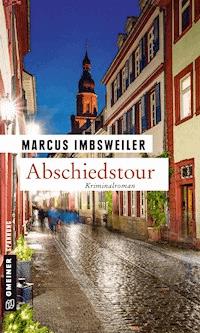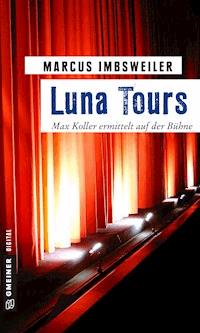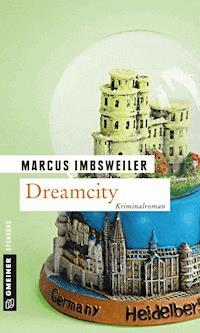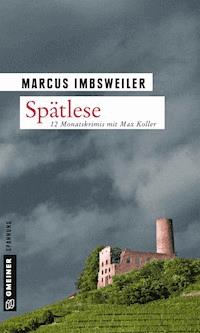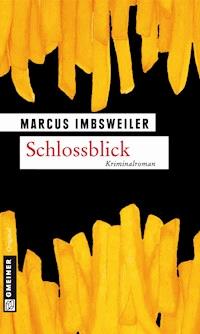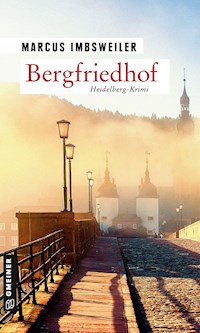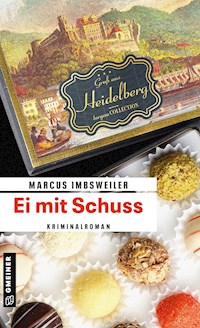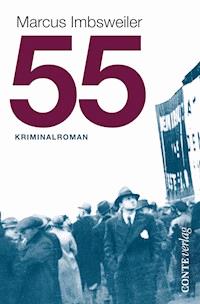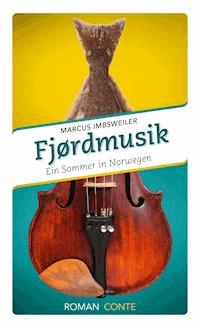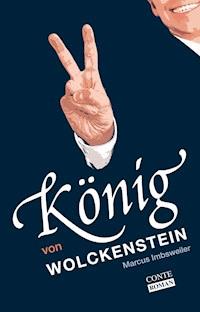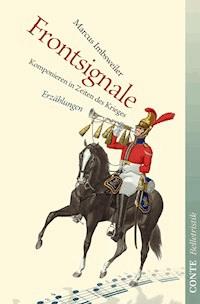Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Privatdetektiv Max Koller
- Sprache: Deutsch
Mord im Heidelberger Stadttheater: Während einer Opernaufführung wird die Garderobiere Annette Nierzwa erwürgt. Man findet sie im Zimmer von Bernd Nagel, dem Geschäftsführer des Philharmonischen Orchesters, der ihr Geliebter war. Daraufhin betrauen gleich zwei Personen den Privatdetektiv Max Koller mit Nachforschungen: der Journalist Marc Covet, der alles daran setzt, seinen Freund Nagel zu entlasten und die betuchte Opernliebhaberin Elke von Wonnegut, die sich um den Ruf Heidelbergs als Musikstadt sorgt. Die Indizien sprechen gegen Nagel: Er hat kein Alibi, die Beziehung zu Annette war nicht frei von Konflikten. Aber ist dem zögerlich-glatten Geschäftsführer ein Mord zuzutrauen? Koller lässt nicht locker. Er will diesen Fall lösen, und er wird ihn lösen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcus Imbsweiler
Schlussakt
Max Kollers zweiter Fall
Zum Buch
SCHLUSS MIT DEM THEATER Mord im Heidelberger Stadttheater: Während einer Opernaufführung wird die Garderobiere Annette Nierzwa erwürgt. Man findet sie im Zimmer von Bernd Nagel, dem Geschäftsführer des Philharmonischen Orchesters, der ihr Geliebter war. Daraufhin betrauen gleich zwei Personen den Privatdetektiv Max Koller mit Nachforschungen: der Journalist Marc Covet, der alles daran setzt, seinen Freund Nagel zu entlasten und die betuchte Opernliebhaberin Elke von Wonnegut, die sich um den Ruf Heidelbergs als Musikstadt sorgt. Die Indizien sprechen gegen Nagel: Er hat kein Alibi, die Beziehung zu Annette war nicht frei von Konflikten. Aber ist dem zögerlich-glatten Geschäftsführer ein Mord zuzutrauen? Seine Geliebte, soviel steht fest, unterhielt Kontakt zu mehreren Männern. So hatte der Dirigent Barth-Hufelang früher ebenfalls ein Verhältnis mit ihr. Nierzwas Ex-Gatte, der Klarinettist Woll, macht keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen die Ermordete, hat jedoch ein Alibi. Koller lässt nicht locker. Er will diesen Fall lösen, und er wird ihn lösen!
Marcus Imbsweiler, aufgewachsen im Saarland, arbeitet als freier Musikredakteur für Orchester, Festivals und Rundfunksender deutschlandweit. Seit 2005 ist er außerdem als Schriftsteller tätig. Seine Krimireihe um den Heidelberger Privatermittler Max Koller zählt bislang acht Bände. Im Gmeiner-Verlag erschienen zudem der Liszt-Roman „Die Erstürmung des Himmels“, der fantastische Krimi „Himmelreich und Höllental“ (als Peter Paradeiser), die Kurzstücke „Luna Tours“ sowie der Osterkrimi „Ei mit Schuss“. Imbsweiler schreibt Romane, Erzählungen und Theaterstücke und gibt regelmäßig Einführungen in klassische Konzerte.
Mehr Informationen zum Autor unter: www.marcus-imbsweiler.de
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2008 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © melancholie, photocase.de
ISBN 978-3-8392-3046-6
Prolog
In der Wüste läutete ein Telefon.
Das ist kein schlechter Anfang für einen Roman, außerdem stimmte es. Flimmernde Hitze über rostroten Sanddünen, hoch oben das glühende Sonnenauge, von links drängte eine berittene Gestalt ins Bild. Und das Telefon läutete. Mir egal, ich achtete nur auf den Reiter. Als er näherkam, sah ich, dass es sich um eine Reiterin handelte. Sie war barhäuptig, und nicht nur das. Sie war bar jeglicher Kleidung. Im Prinzip trug sie nichts als ein Lächeln auf den Lippen. Der Rappe, den sie zwischen ihre Schenkel nahm, hatte wenigstens sein Geschirr an. Ich war wie geblendet vom Glanz ihrer spiegelglatten Haut. Nur das Telefon störte.
»Gleich«, dachte ich. »Einen Moment noch.«
Dunkel gelocktes Haar wehte im Wüstenwind. Sie ritten in Zeitlupe: Langsam zog der Rappe seinen Vorderfuß an den Körper, setzte ihn langsam wieder auf. Und im gleichen sanften Rhythmus hob sich die Hüfte der Frau vom Pferderücken, glitt behutsam zurück. Hob sich, glitt zurück. Das Funkeln ihrer Brustwarzen hinterließ zwei parallele Sinuskurven in der Luft. Ich streckte meine Hand aus, in das Wüstenpanorama hinein, um dem Rappen in die Zügel zu greifen. Endlich gelang es, ich zog das Tier zu mir heran, kletterte mühsam auf seinen Rücken, hinter die kleiderlose Dame. Ihre Locken kitzelten mich in der Nase.
»Ist das Ihr Telefon, Herr Koller?«, fragte sie. Ihre Haut glühte.
»Ich habe kein Telefon«, sagte ich müde und schlang meine Arme um ihre Taille.
»Das ist Ihr Telefon, das da läutet.«
Ich schloss die Augen, lehnte meinen Kopf an ihren warmen Nacken. Er war so schwer, dieser Kopf, ich fühlte, wie er langsam zur Seite rutschte, ich konnte ihn nicht halten, hörte die Dame lachen, den Rappen wiehern, mein Kopf rutschte, die Schultern hinterher … das verdammte Telefon hörte nicht auf zu läuten, und dann plumpste der Kopf mit allem, was daran hing, auf den Boden.
Mühsam rappelte ich mich auf. Der Stuhl, auf dem ich gesessen hatte, war umgekippt, ich mit ihm, meine gute alte Kamelhaardecke noch über den Beinen. Der Fernseher lief. Eine leere Flasche Bier rollte langsam über den Boden und kam mit leisem ›Klack‹ an der Küchentür zum Stillstand.
Das Telefon läutete.
Ich schüttelte die Decke von den Beinen und stand auf. In der Glotze brachten sie einen haarsträubenden Bericht über einen Gorilla aus dem Heidelberger Zoo, der auf der Flucht erschossen worden war. Dazu eine orientalisch anmutende Musik. Gorillas leben nicht in der Wüste. Nackte Reiterinnen auch nicht. Ich ging zum Schreibtisch und griff nach dem Telefonhörer. Das Freizeichen. Gleichzeitig läutete es immer noch, irgendwo in meiner Bude. Ich legte den Hörer wieder auf, sah mich suchend um und fand mein Handy schließlich im Bücherregal. Letzten Sommer, nach meinem ersten größeren Fall, hatte ich es mir zugelegt.
»Koller.« Mir fiel ein, dass ich noch nie geritten war.
»Endlich!«, brüllte jemand, heiser vor Erleichterung. »Ich dachte schon, du wärst nicht da.«
»Ich bin da«, sagte ich.
»Kannst du kommen, Max? Sofort?«
»Wie, sofort?«
»Es hat eine Tote gegeben. Hier liegt eine Leiche, verstehst du? Wir brauchen dich dringend. Es geht um jede Minute.«
Ich nahm das Handy vom Ohr, blickte es prüfend an, hielt es wieder ans Ohr. Am Gerät lag es nicht.
»Hallo?«, sagte ich. »Das bist schon du, Marc, stimmts?«
»Natürlich bin ich das«, schrie der Anrufer. »Hast du nicht kapiert? Es muss schnell gehen. Gleich wird die Polizei im Haus sein.«
Marc Covet. Mein alter Freund, Journalist und Snob in einer Person, an normalen Tagen die Ruhe selbst, ein Mann, dem es gelingt, jeglichen Stress in den Tiefen schottischer Whisky-Seen zu versenken. Heute schien kein normaler Tag zu sein.
»Um was für eine Tote geht es?«
»Um Bernds Freundin. Bernd Nagel, du kennst ihn. Verdammt, Max, wir können nicht ewig quatschen. Tu mir den Gefallen, ich flehe dich an. Komm, so schnell du kannst. Bevor die Bullen anrücken. Nimm den Haupteingang, wir warten vor Bernds Zimmer.«
Mein Blick fiel auf den Fernsehapparat. Die Nachrichtensprecherin zwinkerte mir zu. Wahrscheinlich amüsierte sie sich prächtig über das Telefonat eines schlaftrunkenen Privatermittlers, gespielt von Max Koller, mit einem nicht im Bild befindlichen hysterischen Kumpeldarsteller.
»Ich könnte schon kommen«, sagte ich. »Wenn du mir noch …«
»Danke, Max«, rief Covet. »Vielen Dank! Und beeil dich.«
Gespräch beendet.
Kopfschüttelnd steckte ich das Handy ein. Zog mich an, schaltete den Fernseher aus, versuchte der leeren Bierflasche einen letzten Tropfen zu entlocken. Mein Freund Covet hätte sich wahrscheinlich ein stringenteres Vorgehen gewünscht, doch mich hielt das Gespinst aus Traum, Fernsehprogramm und Telefonat noch gefangen. Erst mal wach werden. Die Kälte draußen würde es schon richten. Außerdem musste ich nachdenken. Hatte Marc mit einem Sterbenswörtchen erwähnt, wo er sich gerade befand? Hatte er nicht.
Ich holte mein Rennrad aus dem Keller – es sollte ja schnell gehen, nicht wahr? –, schwang mich auf den Sattel und fuhr stadteinwärts. Es war lausig kalt. Nach 50 Metern sah ich eine gefrorene Pfütze im Licht der Straßenlampen glänzen. Keine Zeit mehr zu bremsen. Ich rutschte und flog hin, Gesicht voraus. Etwas knackte in meiner Brusttasche: das Handy.
Verwünschungen gegen Covet ausstoßend, sprang ich auf. Immerhin, nun war ich endgültig wach.
1
Auf der Theodor-Heuss-Brücke wurde ich von einer Straßenbahn überholt. Vereinzelte müde Gesichter darin, eingehüllt in Schals und Mützen. Blaue Funken sprühten in den Nachthimmel. Die Oberleitungen vibrierten. Ich kreuzte die Schienen und schlug den Weg in die Altstadt ein.
Dieser Bernd Nagel gehörte nicht zu meinen Bekannten, da hatte Marc unrecht. Er gehörte zu seinen Bekannten, zu den vielen Heidelberger Wichtigtuern, mit denen ich nichts anfangen konnte. Von Nagel wusste ich bloß, dass er etwas mit dem Städtischen Orchester zu tun hatte. Kein Musiker, sondern eine Art Manager. Und sein Zimmer, von dem Marc gesprochen hatte, musste sich im Verwaltungstrakt des Stadttheaters befinden. Wo genau, würde ich schon herausfinden.
Mein linker Ellenbogen schmerzte von dem Sturz. Hoffentlich hatte das Handy nichts abgekriegt. Es wäre ein herber Rückschlag für mein aufrichtiges Bemühen, mich den Erfordernissen der Zeit anzupassen. Covet würde eine sehr gute Begründung brauchen, warum er mich um diese Uhrzeit durch die Kälte jagte.
Nun ja, eine Leiche ist ein guter Grund.
Ich passierte die Stadthalle und bog vor dem Marstall rechts ab, Richtung Theaterplatz. Menschen in Abendgarderobe unter ihren Wintermänteln huschten vorbei, ein Taxi rollte an, vor dem Theatergebäude hing ein langes Banner bewegungslos herab. Die Hochzeit des Figaro, las ich. Unter dem Banner parkte ein Streifenwagen. Sie waren also schneller gewesen.
Ich schloss mein Rad an einen Laternenmast und öffnete eine der beiden gläsernen Flügeltüren, um ins Foyer zu gelangen. Das Foyer, ein kreisrunder Lichthof, bildet die Schnittstelle zwischen Bühnenhaus und Verwaltungstrakt; außerdem führen von hier aus Türen in die Unterwelt des Theaters, zu den Werkstätten, den Schminkzimmern, den Umkleideräumen und zum rückwärtigen Künstlereingang, der sich zur Friedrichstraße hin öffnet. Krakenartig ist alles durch Gänge und Treppen miteinander verbunden, ein Miniaturmodell der durchlöcherten, unterkellerten Heidelberger Altstadt.
Von einer Garderobendame ließ ich mir den Weg zu Bernd Nagels Zimmer beschreiben. Über eine Wendeltreppe ins Nebengebäude, durch einen Flur am Orchestersekretariat vorbei und noch ein Stockwerk höher. So menschenleer Treppen und Flure waren, so bevölkert war diese zweite Etage. Ich wurde angestarrt und starrte zurück. Ein Mann trug eine altertümliche Perücke, ein anderer war grellweiß geschminkt. Eine hoffnungslos magere Frau weinte an der Schulter ihrer Freundin. Das Entsetzen stand diesen Leuten ins Gesicht geschrieben, da konnten sie noch so viel Schminke auftragen. In der Enge des Flurs herrschte Sauerstoffmangel.
»Max!«, hörte ich Marc Covet rufen. Er stieß ein paar Leute beiseite, kam auf mich zu und packte mich an beiden Armen.
»Vorsicht«, sagte ich und entzog ihm meinen Ellenbogen. »Eben habe ich mich auf die Fresse gelegt, nur um dir …«
»Hier rein«, zischte er und drängte mich zu einer Tür mit der Aufschrift›Tonstudio‹. Sie war verschlossen. Ebenso die nächste Tür. Erst am entfernten Ende des Flurs ließ sich eine öffnen. Wir betraten einen mittelgroßen Raum, in dem sich ein Klavier, eine Stehlampe, ein mannshoher Spiegel und zwei Stühle langweilten. Covet schloss die Tür und lehnte sich mit dem Rücken dagegen. Das Stimmengewirr draußen war nur noch gedämpft zu vernehmen.
»Danke«, sagte Marc und atmete tief durch. »Danke, dass du gekommen bist.«
Noch nie hatte ich ihn so abgekämpft gesehen. Seine Stirn glänzte von Schweiß, sein Gesicht war bleich und fleckig, das Haar zerzaust. Mit einer Hand fuhr er sich über die Augen, seine Zunge befeuchtete die spröden Lippen. Um den Mann musste man sich Sorgen machen.
»Kein Problem«, sagte ich. »Man hilft doch gerne.«
Ausdruckslos sah er mich an. »Sie liegt in Bernds Zimmer.«
»Wer? Die Tote?«
Er begann, in dem kleinen Raum hin- und herzulaufen. »Annette Nierzwa heißt sie. Seine Ex-Freundin. Sie … Wir waren in der Figaro-Premiere, Bernd und ich. Annette arbeitet an der Garderobe. Nicht regelmäßig, aber heute war sie da. Und er hat sie gefunden, in seinem Zimmer, gleich nach Vorstellungsende. Ihre Stirn … die ist voll Blut.« Er sah auf. »Verstehst du?«
Ich setzte mich auf einen der Stühle und dachte nach. »Nein«, sagte ich schließlich. »Verstehe ich nicht.«
»Spreche ich undeutlich?«, rief er erregt. »Soll ich es noch mal erzählen?«
»Ich verstehe nicht, was ich hier soll. Warum du mich herzitiert hast.«
»Hergebeten«, verbesserte er. »Es war bloß eine Bitte. Verdammt, Max, soll vielleicht die Polizei …?«
»Dazu ist sie da. Bei Mord kommt die Polizei. Wenn es Mord war.«
»Kapierst du nicht? Hier geht es um einen Freund, um einen guten Bekannten.«
»Schon, aber was könnte ich tun, was die Polizei nicht viel besser …?«
»Pass auf«, unterbrach er mich hastig. »Es war so: Gleich nach der Vorstellung ging Bernd hoch in sein Zimmer. Ich kam erst einige Minuten später nach. Und sehe ihn neben Annette knien, leichenblass, wie weggetreten. Ich spreche ihn an; nichts. Plötzlich steht der Hausmeister in der Tür und zetert rum, der Idiot.«
»Und dann?«
»Ich habe ihn zur Pforte geschickt, um Zeit zu gewinnen; sagte ihm, wir sollten das Telefon im Zimmer besser nicht benutzen. Sobald er fort war, rief ich dich vom Handy aus an.«
»Ach so.« Allmählich verstand ich.
Covet hob verzweifelt die Schultern. »Was werden die Bullen wohl denken? Eine Frau, mit der Bernd einmal zusammen war, liegt tot in seinem Zimmer. Und wer findet sie? Er selbst.«
»Beziehungsweise du ihn, wie er fassungslos neben der Leiche kniet.« Ich nickte. »Nun fragst du dich, ob er es war, der sie …«
»Nein!«, rief Covet. »Auf keinen Fall. Bernd nicht, niemals. Trotzdem, jeder wird ihn verdächtigen, ist doch klar.«
»Wenn er es nicht war, wird man das herausfinden. Da brauchst du dir keine Sorgen zu machen.«
»Es geht auch nicht um die paar Minuten, die er vor mir hier oben war. Darum nicht.«
»Sondern?«
»Es gibt noch ein anderes Problem. Die Premiere.«
Ich schwieg.
»Wie gesagt, wir saßen beide in der Vorstellung. Nur dass Bernd seinen Platz zwischendrin verlassen hat. Für längere Zeit.«
»Wie lange?«
»Eine Dreiviertelstunde mindestens.«
Ich pfiff leise vor mich hin. »So lange? Was hat er in dieser Zeit gemacht?«
Covet zuckte die Achseln. »Ich habe ihn nicht gefragt.«
Wir schwiegen einen Moment, dann sprach er weiter. »Bernd kam ein wenig zu spät zur Aufführung und setzte sich auf einen dieser Klappsitze nahe der Tür. Eigentlich hatten wir Plätze nebeneinander. Es ist also möglich, dass kaum einer sein Wegbleiben bemerkt hat. Außer mir. Jedenfalls … Wenn ich tatsächlich der Einzige wäre …« Er sah mich erwartungsvoll an.
»Träum weiter«, sagte ich. »So etwas fällt auf. Du glaubst doch nicht, dass in der Oper ständig auf die Bühne gestarrt wird. Bloß keine falsche Zeugenaussage, sonst kommst du in Teufels Küche.«
»Wusste gar nicht, dass du so gesetzestreu bist«, brummte er.
»Bin ich nicht. Nur ein bisschen ängstlich. Und deshalb verrate mir, welche Rolle ich in diesem Stück übernehmen soll. Hier ist die Polizei zuständig, das weißt du.«
»Du könntest zusätzlich ermitteln. In andere Richtungen, andere Spuren verfolgen. Die Polizei wird Bernd verdächtigen, das war mein erster Gedanke, als ich Annette da liegen sah. Aber Bernd war es nicht, damit brauchst du dich nicht aufzuhalten.«
»Ach so. Ermitteln mit Vorgabe. Scheuklappen auf und durch.«
»Mir egal, wie du es nennst, aber tu was«, beschwor er mich. »Wir haben nur die eine Chance, Max. Die Kripo ist noch nicht im Haus, du hast alle Informationen, die du brauchst … Schau dich wenigstens ein bisschen um, ja?«
»Wie viele Polizisten sind schon hier?«
»Zwei. Die Verstärkung ist angefordert. Spurensicherung, Mordkommission, das ganze Programm.«
Seufzend kratzte ich mich am Kopf. Dass ein Abend, der zwischen Sanddünen begonnen hatte, so enden musste! »Versuchen kann ich es«, sagte ich. »Nicht mehr und nicht weniger, kapiert?«
Er nickte erleichtert.
Wir traten hinaus in den Flur. Gerade wurde der letzte Rest Sauerstoff von Zigarettenrauch verdrängt. Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden? Heute scherte sich keiner darum. Gedämpfte Gespräche, hin und wieder erregtes Zischeln, einzelne Schluchzer. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, um den Flur in seiner ganzen Länge zu überblicken.
»Wer sind diese Typen?«, fragte ich Covet.
»Leute vom Theater und vom Orchester, soweit ich sehe. Der Inspizient, zwei Geiger, ein Verwaltungsfritze. Besucher eher nicht. Aber der Graf ist da.«
»Welcher Graf?«
»Der aus der Oper.« Er zeigte auf den Burschen mit der Perücke, auf dessen Wange ein dicker Schönheitsfleck prangte.
»Und Nagels Zimmer?«
»Liegt am anderen Ende. Bernd ist mit den beiden Polizisten drin.«
»Wie war noch mal der Name seiner Freundin?«
»Nierzwa. Annette Nierzwa.«
»Dann mal los.« Marc im Schlepptau, bahnte ich mir einen Weg durch die Gaffer. Der Zigarettenrauch vermischte sich mit dem Duft dick aufgetragenen Parfüms und Rasierwassers; Alkoholschwaden vervollständigten die ungesunde Mixtur. Premierenaura eben. Ein kräftiger Mann im Arbeitskittel stank nach Schweiß.
»Es ist traurig«, hörte ich eine Frau in der Tracht fröhlicher Landleute sagen. Sie hatte rote Bäckchen und einen Kussmund. »Heulen könnte ich, nur noch heulen.«
»Vielleicht war es ein Unfall«, sagte eine andere.
»Es war kein Unfall. Unfälle sehen anders aus.«
»Zum Heulen ist es trotzdem.«
»Entschuldigung, Herr Graf«, sagte ich und tippte dem vor mir stehenden Perückenmann auf die Schulter. »Dürfte ich vorbei?«
Der Graf drehte sich um, sah mir ernst ins Gesicht und räusperte sich. »Und so vor dem Leben verblasst die Fiktion«, sagte er. »Altes Theatergesetz.« Er hatte die angenehme Stimme erfahrener Sänger.
Ich nickte und schob mich vorbei.
Die Tür zu Nagels Zimmer stand sperrangelweit offen. Um die Schaulustigen auf Distanz zu halten, hatten die eingetroffenen Polizisten zwei Stühle auf die Schwelle gestellt. Rechts an der Wand ein kleines Plastikschild: ›B. Nagel, Geschäftsführer‹. Ich stützte mich auf die Lehne des einen Stuhls und spähte ins Zimmer hinein. Einer der beiden Polizisten bemerkte mich.
»Draußenbleiben!«, schnauzte er mich an. Mir blieb die Luft weg.
Allerdings nicht wegen ihm. Ich hatte die Leiche gesehen, ich hatte ihr Gesicht gesehen, und ich hatte es wiedererkannt.
»Das ist Annette?«, flüsterte ich. »Das da?«
Covet nickte. Er stand einen Schritt hinter mir, die Lippen zusammengekniffen.
Annette Nierzwa war die Frau von vorhin. Die Reiterin, die mit den hüpfenden Brüsten. Jedenfalls glich sie ihr verblüffend. Sie hatte halblange, dunkle Locken, sie war attraktiv und fast ein wenig üppig. Vor allem die Hüften waren es. Das sah man, weil sie ihren nackten Hintern dem Betrachter entgegenstreckte.
»Was soll das?«, zischte ich. »Habt ihr sie so gefunden?«
Covet nickte erneut und wandte sich ab.
Ich brauchte einige Augenblicke, um mich von meinem Schrecken zu erholen. Natürlich war Annette Nierzwa nicht die Amazone auf dem Pferd gewesen. Ich hatte Bernd Nagels Freundin nie zuvor gesehen, sie war auch nicht nackt, sondern lag angezogen auf dem Boden, in dieselbe hellgraue Kluft wie ihre Kolleginnen von der Garderobe gekleidet. Nur ihr Rock war hochgerutscht, und sie trug keine Unterwäsche. Kein Wunder, dass ich sofort an meinen blöden Traum erinnert wurde. Es war aber auch eine Schande, wie sie da lag: halb auf der Seite, Gesicht nach links, das linke Bein angewinkelt, die Hinterbacken schräg in die Höhe gereckt. Was für eine makabre Peepshow! Da wurde jeder zum Voyeur.
Die Fiktion verblasst vor der Realität, hatte der Perückenheini orakelt. Es stimmte; meines Wissens gab es keine Oper mit derart arrangierter Leiche. Aber wie viele Opern kannte ich überhaupt?
Neben der Toten kniete der Polizist, der mich angeschnauzt hatte, und beschäftigte sich mit irgendetwas. Es kam mir vor, als schnüffelte er sie ab. Er schaute ihr ins Gesicht, in die offen stehenden Augen, begutachtete ihre Ohren, ihre Finger, sogar die Beine. In die Nähe der Pobacken traute er sich nicht. Unwillkürlich folgte ich seinen Blicken. Sie war eine hübsche Frau gewesen, diese Annette Nierzwa. Blut klebte an ihrer Stirn, war aus einem kleinen Riss über der linken Augenbraue auf die Dielen getropft. Ihre Bluse stand einen Knopf weiter auf als diejenigen ihrer Kolleginnen unten im Lichthof.
Der Polizist stand auf und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Ratlos sah er auf die Leiche hinab. Im Hintergrund des Raumes befragte sein Partner einen bleichen jungen Mann: Bernd Nagel, Geschäftsführer des Philharmonischen Orchesters der Stadt Heidelberg. Mittelgroß und schlank, mit zarten, fast weiblichen Gesichtszügen, das glatte schwarze Haar durch einen Seitenscheitel veredelt, um die braunen Augen ein Hauch von Melancholie. Eines dieser Glückskinder, die gut aussehen, ohne viel dafür zu tun, denen der Erfolg zufliegt wie anderen ansteckende Krankheiten und die dennoch von der Schlechtigkeit der Welt überzeugt sind. Keine Ahnung, was Marc Covet an solchen Typen findet.
Dem Polizisten an seiner Seite jedenfalls war schnuppe, wie gutaussehend oder erfolgreich der Mann war; er runzelte die Stirn, verzog die Lippen und vertraute alles, was Nagel ihm mit leiser Stimme diktierte, einem dicken Notizblock an. Beide standen hinter einem Schreibtisch, der Geschäftsführer stützte sich mit einer Hand auf die Lehne eines Drehstuhls. Der Tisch selbst war tipptopp aufgeräumt, da gab es nur ein Telefon, einen Flachbild-Monitor mit Tastatur, Schreibutensilien und einen Taschenrechner. Auch in den Regalen ringsum herrschte Ordnung, das musste man Nagel lassen. Bücher, Zeitschriften, Ordner wie in jedem Büro, dazu CDs und ein Notebook. An der Wand Konzertplakate, Dienst- und Besetzungspläne, eine Magnettafel mit aktuellen Aushängen des Opernbetriebs, dazwischen eine Geige ohne Decke. Außerdem eine kleine Sitzecke mit drei Sesseln. Über einem der Sessel hing Nagels Mantel.
Bevor ich mir mein weiteres Vorgehen zurechtlegen konnte, bekam ich einen Rippenstoß. Er ging auf das Konto eines feisten Kerls mit einem Knebelbart, wie sie seit der Weimarer Republik außer Mode waren. Die Rempelei geschah unabsichtlich, denn sein Blick galt nur der halbnackten Annette Nierzwa.
»Widerwärtig«, keuchte er, während er einen Stuhl zur Seite schob. »Ekelhaft ist das.« Mit einem Finger lockerte er seinen Hemdkragen, dann begann er zu rufen: »Hallo! Hallo, Sie da!« Er hatte eine gepresste Fistelstimme, ein Witz für einen Mann seiner Statur, wie überhaupt sein ganzes Gerufe albern war, schließlich stand der Schnüffelpolizist bloß einen Meter vor ihm.
Einen Augenblick später hatte sich die Entfernung zwischen den beiden um die Hälfte verringert. »Stellen Sie den Stuhl wieder an seinen Platz«, herrschte der Beamte den Feisten an. »Was fällt Ihnen ein?«
»Ich bin«, sagte der und pumpte seinen mächtigen Brustkorb voll Luft, »ich bin hier der Generalmusikdirektor. Mit anderen Worten: der Hausherr, solange der Intendant nicht anwesend ist. Ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was hier passiert ist.«
Der Geschäftsführer und der zweite Polizist unterbrachen ihr Gespräch und schauten zu uns herüber, Bernd Nagel mit der ausdruckslosen Miene eines Dulders. Dem Schnüffelpolizisten stand frischer Schweiß auf der Stirn. Wo blieb nur die Verstärkung? Er war an einem ereignislosen Samstagabend Streife gefahren, ohne zu ahnen, was hier auf ihn einprasseln würde: eine Leiche mit blankem Po, singende Grafen, ein musikalischer Generaldirektor. Und ein vorwitziger Privatdetektiv. Aber von dem wusste er noch nichts.
»Mir ist egal, wer Sie sind«, sagte der Beamte erregt. »Ich mache bloß meine Arbeit und habe dafür zu sorgen, dass niemand den Raum betritt. Was hier passiert ist, sehen Sie selbst. Dürfte ich Sie jetzt bitten?«
»Ihr Name?«, entgegnete der Dicke. Seine Fistelstimme hatte einen harten Klang bekommen.
Der Polizist schluckte. »Lassen Sie mich bitte meine Arbeit machen«, sagte er.
»Mein Name ist Barth-Hufelang, ich bin Städtischer Generalmusikdirektor, wie bereits erwähnt. Wären Sie nun so freundlich, mir den Ihren zu nennen?«
Der Typ mit dem Knebelbart war wirklich Gold wert. Ich zwinkerte Marc Covet zu, schob auch den zweiten Stuhl beiseite und setzte mich Zentimeter um Zentimeter von dem Grüppchen ab. Streckte erst meine Nase in das Zimmer des Geschäftsführers, dann den Kopf, den Oberkörper, bis zuletzt beide Füße auf der Schwelle standen.
»He!«, raunzte mich der überforderte Polizist an, um sich gleich wieder seinem Gesprächspartner zuzuwenden: wenn der Herr tatsächlich der Chef hier sei, möge er so kooperativ sein und die versammelten Herrschaften bitten, sich für die Fragen der Mordkommission zur Verfügung zu halten.
»Ach«, lachte der Feiste schrill. »Sie wollen den Gaffern diesen Anblick also weiterhin bieten?«
Das müsse man verstehen, mischte sich Covet ein. Es gehe um Zeugenbefragung. Und dann die Spuren. Die Beamten trügen schließlich die Verantwortung.
Ich stand nun direkt vor der Leiche. Annette Nierzwas Pobacken glänzten matt im Licht der Deckenlampen. An ihrem Hals zeichneten sich dunkle Flecken ab, die ich zuvor nicht bemerkt hatte. Die hätte ich mir gerne einmal näher angesehen.
»Das gilt auch für Sie, mein Herr!«, schrie der Schnüffelbeamte und machte einen Schritt in den Flur hinaus. Vielleicht meinte er Covet. »Finger weg von der Tür! Niemand betritt diesen Raum, verstanden? Niemand.« Murren antwortete ihm.
Meine Chance. Ich huschte in Nagels Zimmer und kniete mich neben die Leiche auf die hellen Dielen. Annettes hübscher Hals war von rot-violett schimmernden Würgemalen entstellt. Einzelne Blutergüsse ohne Abschürfungen. Da hatte jemand mit bloßen Händen zugelangt.
»He, Sie da!«, brüllte es aus zwei verschiedenen Richtungen gleichzeitig. Nagels Interviewer rührte sich nicht von der Stelle, fuchtelte bloß mit den Händen, als könne er mich wie eine Schmeißfliege vertreiben. Sein Kollege kam mit großen Schritten herbeigeeilt und packte mich beim Arm.
»Sind Sie taub?«, herrschte er mich an. »Raus hier!«
Annette Nierzwa war erwürgt worden. Die Wunde an der Stirn war nie und nimmer tödlich gewesen, und sonst entdeckte ich keine Verletzungen. Ihr Mund stand leicht offen, ein wenig Speichel war auf die Dielen geflossen. Aus den weit aufgesperrten Augen sprachen Entsetzen und Todesangst. An der Innenseite ihres linken Unterarms trug sie eine kleine Tätowierung in Form eines Schmetterlings.
All das registrierte ich, während ich mich langsam aufrichtete und versuchte, meinen schmerzenden Ellenbogen dem Griff des Beamten zu entziehen. Räuspernd wandte ich mich ihm zu.
»Ich habe eine Aussage zu machen«, sagte ich voll Würde.
»Wie bitte?« Er war so verblüfft, dass er mich losließ.
»Ich habe eine Aussage zu machen. Diese Frau ist mir persönlich bekannt. Ich kann Ihnen ihren Namen sagen.«
»Den kennen wir!«, brüllte der Polizist. »Den kennen wir längst. Raus mit Ihnen, Sie vernichten hier Spuren!«
»Annette Nierzwa«, sagte ich unbeeindruckt. »Eine junge Frau, die unten an der Theatergarderobe …«
»Raus!« Er packte wieder zu und zog mich zur Tür.
»Sie hat meinen Mantel entgegengenommen. Persönlich, vor der Vorstellung, verstehen Sie? Da hat sie noch gelebt.«
»Die sind balla balla hier«, stöhnte der Polizist, nachdem er mich endlich aus dem Zimmer bugsiert hatte. »Alle!«
»Das wird ein Nachspiel haben«, sagte der beleibte Musikdirektor finster. »So etwas lasse ich über mein Haus nicht sagen. Das nicht, mein Herr!«
Einige Minuten später wurden die Rufe des Beamten nach Verstärkung erhört. Eine ganze Mannschaft rückte an: Kriminaltechniker, Kripo, Zivile und Uniformierte. Der Ärger war vorprogrammiert. Die Spurensicherer beschwerten sich über die vielen Gaffer, die Gaffer meckerten über die Polizei, die beiden aus dem Streifenwagen klagten über die Verspätung und wurden umgehend aufgeklärt, was sie hätten tun und lassen sollen. Das Stockwerk räumen zum Beispiel, den Tatort großräumig sichern, sämtliche Zeugen möglichst weit weg vom Fundort der Leiche zusammenpferchen; das wäre ihre Aufgabe gewesen.
»Zu zweit?«, blaffte der eine Polizist zurück, und er hatte recht. Mitten in dem ganzen Trubel stand der dicke Generalmusikdirektor, plusterte sich auf und verlangte den Verantwortlichen zu sprechen. Auf der Stelle.
»Ich höre«, sagte ein etwas ungepflegt wirkender Mann mit gelblichem Teint und schütterem Haar. Von allen schlecht gelaunten Menschen vor Ort war er der am schlechtesten Gelaunte.
»Sie sind hier zuständig?«, fragte Barth-Hufelang ungläubig.
»Ich leite die Ermittlungen, wenn Sie nichts dagegen haben.«
»Dann möchte ich Sie inständig bitten …« Der Musikdirektor holte tief Luft. Die Beamten, sagte er, sollten die Untersuchungen diskret führen, auf die Seelenlage der Anwesenden Rücksicht nehmen, die Würde der Toten wahren, den Ruf seines Hauses nicht gefährden. Er hätte diese Bitten leise vorbringen können, doch er sprach mit schriller Fistelstimme, damit alle hören konnten, was für ein eloquenter, verantwortungsbewusster Chef er war.
»Ja«, beendete der Beamte den Redeschwall und wandte sich ab.
Seine Mitstreiter leisteten währenddessen ganze Arbeit, an vorderster Stelle zwei Jungspunde in Zivil. Sie ließen sich vom Hausmeister Schlüssel geben, um sämtliche Räume öffnen zu können, sondierten die Lage, trieben zusammen, kommandierten. Schauspieler und Sänger hatten sich im Tonstudio einzufinden, Orchestermitglieder eine Tür weiter, gegenüber die sonstigen Angestellten des Theaters und ganz hinten die Opernbesucher. Wer jetzt noch vor Ort war, hatte den Zeitpunkt zum Rückzug verpasst. Er wurde angeknurrt und in seine Koppel gescheucht. Es dauerte keine drei Minuten, bis die beiden Hitzköpfe den Flur freigeräumt hatten. Die reinsten Kettenhunde.
Marc und ich traten folgsam in den Überaum von vorhin. In unserem Schlepptau eine einzige Person, ein aufgeregtes Männlein im Lodenmantel, das sich jammernd auf einen Stuhl fallen ließ, nur um sofort wieder aufzuspringen und sich zu rechtfertigen.
»Ich bin rein zufällig hier«, erklärte uns das Männlein. »Wenn man es Zufall nennen will. Sehen Sie, mich ziehen tragische Ereignisse an. Magisch ziehen die mich an, und dass das hier ein tragisches … ich meine, das kann man doch so sagen, oder? Wenn ein Todesfall kein tragisches …« Der Kleine brach ab und schüttelte trübsinnig den Kopf. »Dann weiß ich auch nicht«, sagte er leise.
Marc nickte und setzte sich auf den anderen Stuhl. Ich nahm auf dem Klavierhocker Platz.
»Mein Bus«, fuhr das Männchen nach einem Blick zur Armbanduhr fort, »geht in einer halben Stunde. Nach Waldwimmersbach. Vielleicht lassen sie mich gleich gehen, wenn sie hören, dass ich nichts … Tragik hat etwas Faszinierendes für mich, verstehen Sie? Tragische Opern, Wagner, Puccini. Das zieht mich an. Wobei Mozart ja nun weniger …« Er unterbrach sich, um erneut zur Uhr zu schauen. »Hoffentlich, hoffentlich«, murmelte er.
Wir schwiegen. Durch die offene Tür drangen die Stimmen der beiden Wadenbeißer zu uns. Wir hörten, wie sie die Personalien der Anwesenden aufnahmen und Kurzverhöre durchführten. Besonders freundlich klangen sie nicht. Vielleicht hassten sie Musik und Musiker.
»Und jetzt?«, fragte Covet leise.
Ich zuckte die Achseln. Für mich gab es nichts mehr zu tun. Nur noch raus hier, ohne viel Staub aufzuwirbeln.
»Verstehen Sie das?«, sagte das Männchen, das wieder Platz genommen hatte. Seine Beine waren so kurz, dass die Füße den Boden nicht berührten.
»Was?«, brummte ich.
»Dass man von Tragik so fasziniert sein kann. Dass sie einen so packt. Bis man zuletzt einer echten Leiche …« Betreten sah der Kleine auf seine Füße. Schuhgröße 37, schätzte ich.
Meine Blicke wanderten über die Klaviertasten. Als ich neun war, hatte ich ein Jahr lang Unterricht gehabt. Das Einzige, an was ich mich noch erinnerte, war die Lage des mittleren C auf der Tastatur. Nicht einmal ›Alle meine Entchen‹ würde ich noch hinbekommen.
Bewegung an der Tür: Bernd Nagel, der bleiche Schönling. Jeglichen Blickkontakt meidend, trat er ein und zog ein Taschentuch, um sich den Mund abzutupfen. Mit ihm war einer der beiden scharfen Hunde gekommen. Er blieb auf der Schwelle stehen und stützte sich mit den Händen am Türrahmen ab.
»So«, knurrte er zufrieden. »Wen nehmen wir denn jetzt?«
Der kleine Lodenfreund sprang auf die Füße und bettelte darum, drangenommen zu werden. Bus nach Waldwimmersbach. Tragischer Blick. Bitte, bitte, Herr Kommissar.
Der Polizist sah dem Gezappel eine Weile zu, dann nickte er. Er war muskulös und braungebrannt und hatte tatsächlich etwas von einem Hund: dichtes, tiefschwarzes Haar, markante Augenbrauen, darüber eine Stirnpartie aus gemeißeltem Stein. Ein Rottweiler. Er legte seine dunkel behaarte Hand auf die Schulter des Kleinen und drängte ihn zur Tür hinaus.
Eine Weile herrschte Stille im Überaum. Nagel starrte regungslos in eine Ecke, von seinem Freund besorgt beobachtet. Irgendwann gab sich Covet einen Ruck, stand auf und tätschelte ihm aufmunternd den Rücken.
»Und?«, fragte er.
Nagel wandte ihm langsam das Gesicht zu. Er litt, aber selbst dieses Leiden war schön anzusehen.
»Scheiße«, sagte er.
Marc presste die Lippen zusammen.
»Das ist …«, begann Nagel, verstummte und drehte sich weg.
Marc senkte den Kopf. Seine rechte Hand blieb auf Nagels Schulterblatt liegen.
Gähnend drückte ich ein paar Klaviertasten. Man merkte, dass man sich in einem Theater befand. Jeder schauspielerte, was das Zeug hielt. Faust und Hamlet. Große Gefühle, hehre Gesten, edle Menschen. Meine Finger machten sich selbstständig und purzelten auf die Tasten nieder. Von den Tönen aufgeschreckt, schauten Nagel und Covet zu mir herüber.
»Das ist Max«, sagte Marc. »Max Koller. Ein alter Freund. Außerdem Privatdetektiv.«
Nagel nickte mir kurz zu.
»Sie war Ihre Freundin?«, fragte ich. »Mein Beileid.«
»Ex-Freundin«, sagte Nagel. Dann hob er plötzlich den Kopf. »Was sind Sie? Privatdetektiv?«
»Bin ich.«
Er starrte Marc an. »Ist das jetzt ein Zufall oder was?«
»Ich habe ihn angerufen«, erklärte Covet. »Damit er sich hier ein wenig umschaut. Vielleicht entdeckt er Dinge, die der Polizei entgehen.«
Nagel warf mir einen ungläubigen Blick zu. Verdenken konnte ich es ihm nicht. Ich wirkte nicht gerade wie ein Mann, der eine komplette Sonderkommission in den Schatten stellt.
»Ist das … ich meine, ist das legal?«, wollte der Geschäftsführer wissen. »Dazu ist doch die Polizei da, und ich weiß nicht recht, was ein …«
»Die Polizei«, sagte Marc, »wird sich nur auf das Nächstliegende stürzen. Da könnte es Sinn machen, noch jemanden einzubeziehen, der auch andere Wege verfolgt.«
»Das Nächstliegende? Was soll denn das heißen?«
Entweder war Bernd Nagel schwer von Begriff, oder es stank ihm, dass sein Kumpel so um den heißen Brei herumredete.
»Das Naheliegende«, sagte ich ruhig, »ist eine schlichte Frage: Wo haben Sie sich heute Abend zwischen acht und elf herumgetrieben?«
Da sperrte er Mund und Augen auf, der Gute. »Bitte?«, stotterte er. »Heute Abend? Ich war in der Premiere.«
»Haben Sie das zu Protokoll gegeben?«
»Natürlich.«
»Bernd«, beschwor ihn Covet leise. »Ich habe es ihm erzählt, verstehst du?«
Nagel schluckte. Er ging zum Fenster und schaute hinaus in die Dunkelheit. Eine Ader an seinem Hals trat hervor. »Musste das sein?«, fragte er schließlich.
»Es kommt doch sowieso raus«, antwortete ich an Covets statt. Für wie blöde hielt dieser Mensch eigentlich Kriminalbeamte? »Besser, Sie sagen von Anfang an die Wahrheit. Das macht Sie weniger verdächtig.«
»Danke für den Tipp«, fauchte er und funkelte mich böse über die Schulter an.
»Gern geschehen. Ist sogar honorarfrei. Und? Wo waren Sie nun?«
Nagel drehte sich um und warf seinem Freund Covet einen wütenden Blick zu. Marc machte eine entschuldigende Geste, die mich ärgerte. Seit wann genossen Musikmenschen das Privileg, mit Samthandschuhen angefasst zu werden?
Bevor Nagel antworten konnte, füllte sich der Türrahmen wieder mit den Umrissen des Rottweilers. Seine dunklen Äuglein fixierten mich. Wir saßen mucksmäuschenstill da, Schlachtvieh auf dem Weg in die Pelle. Dann hob er langsam eine Hand, fuhr ebenso langsam seinen Zeigefinger aus und stieß plötzlich zu.
»Sie«, sagte er. »Sie sind dran.«
Folgsam erhob ich mich. »Wie schade«, sagte ich im Hinausgehen, »dass unser gemeinsamer Opernbesuch so enden musste. Nicht wahr, Marc?«
Covet sah mich groß an, dann nickte er hastig.
Die Befragung fand auf dem Flur statt, im Stehen. Ich sah den Kollegen des Rottweilers auf den Grafen einreden, während der Typ im Arbeitskittel von einem Uniformierten interviewt wurde. Durch das Treppenhaus hallte der Jubel des Gartenzwergs auf dem Weg nach Waldwimmersbach.
Mein schwarzhaariger Begleiter blätterte in seinem Notizbuch. Dann zog er eine Lesebrille aus der Manteltasche und setzte sie auf. Ein Rottweiler mit Lesebrille, man lernt nie aus.
»Name?«
»Max Koller.«
Er schrieb.
»Mit Doppel-L«, sagte ich. »Und zwar der Koller. Nicht der Max.«
Er hielt inne und schenkte mir einen langen, stummen Blick über den Brillenrand. Ich lächelte ihn an. Der Typ war jünger als ich, aber weitsichtig.
»Adresse? Telefonnummer?«
Ich nannte sie ihm. Anschließend wollte er meine Staatsangehörigkeit wissen, mein Alter und zuletzt meinen Beruf. Der Notizblock füllte sich.
»Ich bin Sammler«, sagte ich.
»Sammler?«
»Exakt.«
»Sammler ist kein Beruf. Sammler von was?«
»Leichen. Ich sammle Verbrechensopfer, genau wie Sie. Allerdings nicht im Staatsdienst, sondern als freier Unternehmer.«
Der Typ verzog keine Miene. Wahrscheinlich hatte er heute Abend die unmöglichsten Berufe kennen gelernt: Chorsänger, Ersatzchorsänger, Premierengrafen, Generalmusikdirektoren, Inspizienten. Und wo es Leichen gab, konnte es auch Leichensammler geben. Vielleicht sogar freiberufliche.
»Ich bin Privatdetektiv«, erlöste ich ihn schließlich. »Schon mal gehört?«
Da fielen die Groschen. Wie im Spielautomaten. Der Rottweiler fing an zu grinsen, breit und immer breiter, setzte die Brille ab, setzte sie wieder auf und musterte mich von oben bis unten. Sollte er nur mustern! So einen wie mich bekam er auf keiner Bühne zu sehen.
»Chris«, rief er hohnlachend durch den Flur, »schau dir das an! Du glaubst nicht, wen ich da aufgegabelt habe.«
Der Angesprochene unterbrach die Befragung und sah zu uns herüber. Er war kleiner, gedrungener als sein Kollege, hatte ein flaches Gesicht mit winziger Nase, kurzgeschorenes weißblondes Haar und kleine, gerötete Augen. Ich kann mir nicht helfen, er erinnerte mich an einen Kampfhund, der mich bei einer meiner Radtouren mal gejagt hatte.
»Er sagt, er ist Privatdetektiv«, brüllte der Dunkelhaarige so laut, dass die Zeugen aus den Zimmern lugten. »Privatdetektiv, ich lach mich schlapp!«
Chris lachte nicht, er knurrte nur: »Schmeiß ihn raus.« Dann wandte er sich wieder dem Perückengrafen zu.
»Privatdetektiv«, wiederholte der Rottweiler, als könne er sich an diesem schönen Wort gar nicht satt hören. »Wusste gar nicht, dass Heidelberg einen hat. Geschweige denn braucht.«
»Dem Tourismus tut es gut, heißt es.«
»Und?«
»Was und?«
»Was wollen Sie hier? Rumschnüffeln?«
»Gott bewahre«, rief ich und hob abwehrend alle Hände, die mir zur Verfügung standen. »Da liegt ein Missverständnis vor. Ich bin ganz privat hier. Als Privatmann, nicht als Privatdetektiv. Figaros Hochzeit ist meine Lieblingsoper.«
Und dann begann ich zu erklären, so wortreich, dass er mit dem Schreiben kaum hinterherkam. Herr Covet sei ein alter Freund von mir und Herr Nagel ein alter Freund von Herrn Covet, wir wollten nach der Aufführung gemeinsam einen trinken, weshalb wir uns vor Herrn Nagels Zimmer eingefunden hätten, hier aber sei es zu der schrecklichen Entdeckung gekommen, die uns natürlich den Durst komplett verhagelt habe, und dann sei Annette auch noch die Freundin Herrn Nagels beziehungsweise die Ex-Freundin, manches geht eben auseinander, furchtbar sei es trotzdem, nicht einmal ich als Privatermittler hätte mich an den Anblick von toten Menschen gewöhnt, schon gar nicht nach so vielen Stunden herrlicher Musik.
»Der Graf hatte allerdings keinen guten Tag«, raunte ich ihm zu. »Keine Höhe, kein gar nix. Aber sagen Sie es ihm nicht.«
Schweigend klopfte der Rottweiler auf seinem Notizblock herum. Er nahm seine Brille ab, klappte sie zusammen und steckte sie in die Brusttasche zurück. Privatdetektiv und Opernbesucher gleichzeitig, das überstieg seine Toleranzschwelle.
»In diesem Aufzug waren Sie in der Premiere?«, fragte er schließlich.
Ich trug, was ich immer trage. Jeans, Hemd und Pulli, darüber meine dicke Winterjacke und einen rostroten Schal.
»Kunst kommt von innen«, lächelte ich.
»Sauber«, sagte er nur. »Sauber.« Dann klemmte er seinen Kugelschreiber hinters Ohr, um eine seiner großen Händefür mich frei zu haben. Die legte er mir auf die Schulter. So wie vorhin dem Tragiker aus Waldwimmersbach, nur hatte er da vermutlich weniger fest zugedrückt.
»Nun sage ich Ihnen mal was«, fing er an, freundlich wie eine Vogelspinne. »Ich sage Ihnen was, Herr Koller. Ob Sie nur zufällig hier sind oder herumschnüffeln wollen, ist mir egal. Das gilt auch für meine Kollegen. Scheißegal ist uns das. Und wissen Sie, warum? Weil Typen wie Sie uns scheißegal sind. Wir machen einfach unsere Arbeit. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, aber passen Sie gut auf. Wenn Sie uns in die Quere kommen, bekommen Sie Ärger. Ärger, der sich gewaschen hat. Ist das klar?«
Das war eine lange Rede für einen Mann seiner bescheidenen Eloquenz, und ich honorierte sie mit andächtigem Lauschen.
»Sie sollten öfter in die Oper gehen«, sagte ich.
»Hauen Sie ab«, entgegnete er. »Hauen Sie einfach ab.«
»Sehr gerne. Aber erst, wenn Sie mit meinem Freund Marc Covet durch sind. Machen Sie nicht zu lange, wir wollen alle ins Bett.«
Ich ging in den Überaum zurück. Hinter mir fletschte der Beamte die Zähne.
2
Ohne den Anruf am nächsten Morgen wäre es wohl bei dieser Stippvisite im Reich der Musik geblieben. Gegen zwei Uhr nachts verabschiedete ich mich von Marc und bestieg mein Rad. Den Schal fest um den Hals geschlungen, fuhr ich durch die Hauptstraße, ebenso müde wie entschlossen, mich aus dieser Geschichte herauszuhalten. Auch wenn mich interessierte, wer Nagels Freundin auf dem Gewissen hatte. Es gab zwei gute Gründe, vorsichtig zu sein. Da waren auf der einen Seite diese Leute, die so taten, als hätten sie etwas mit Kunst zu tun. Ein fetter Dirigent, Damen mit Kussmund, verschwitzte Bühnentechniker. Die konnten mir gestohlen bleiben. Von ihren Gepflogenheiten, Lebensverhältnissen, Redeweisen hatte ich keine Ahnung; ich misstraute ihnen. Sie trugen Perücken oder Frack, aber vor einem kleinen Polizeibeamten ließen sie den Direktor heraushängen. Wenn ich hier ermittelte, würde ich dauernd mit ihnen zusammenrasseln.
Erschwerend kam hinzu, dass ich nichts von Musik verstehe. Ich glaube, ich war mein Lebtag ein einziges Mal in der Oper und bin eingeschlafen. Aber bitte, man lernt ja gerne dazu.
Der zweite und entscheidende Grund für meine Zurückhaltung trug einen Namen: Marc Covet. Beruf und Privatangelegenheiten zu vermischen, ist immer riskant. Man stelle sich nur unsere Honorarverhandlungen vor! Schreib mir eine Rechnung; kann ich mit Karte zahlen? Absurder Gedanke, einem Freund Geld für einen Helferdienst abzuknöpfen. Und selbst wenn wir auf irgendeine utopische Weise zu einer Einigung kämen, würde es böses Blut geben. Schließlich war Covet persönlich in die Sache involviert, da konnte er mir erzählen, was er wollte. Es war sein Kumpel, der verdächtigt wurde, der vielleicht einen Totschlag im Affekt begangen hatte, der ihn möglicherweise belog – und damit war es die Freundschaft zu Bernd Nagel, die auf dem Spiel stand.
Und da sollte ich ermitteln? Mitten in einem Interessenkonflikt? Sollte meine Nase in Dinge stecken, die Marc am Ende peinlich waren, sollte den Geschäftsführer durchleuchten und abklopfen, bis sich herausstellte, dass er bloß ein larmoyanter Schönling war, der an seine Karriere dachte? Vielleicht war er das ausschließlich in meinen Augen, in den Augen eines neidischen Privatflics, der lieber vor der Glotze ein Bier köpfte, als bei einer Premierenvorstellung durch das Heidelberger Stadttheater zu flanieren. Mag sein; aber gerade dann sollte ich die Finger von dem Fall lassen. Bevor ich mit Marc aneinandergeriet, weil ich Erkenntnisse lieferte, die ihm nicht gefielen.
Und so stand mein Entschluss bereits fest, als ich durch die menschenleere Hauptstraße fuhr und die eiskalte Luft mir Tränen aus den Augen trieb: Den Mord an Annette Nierzwa würden der Rottweiler und seine Kollegen aufklären. Ohne meine Mithilfe. Diese Kröte würde Covet schlucken müssen.
Aber dann kam der Anruf.
Streng genommen waren es sogar zwei. Zunächst jaulte mein Handy. Ich ließ es jaulen und vergrub mich tief in den Kissen. Wer am Sonntagmorgen um acht Wünsche hatte, sollte sie meiner Mailbox diktieren. Eine Minute lang herrschte Stille, dann klingelte mein Telefon. Da meinte es jemand aber ernst! Nach viermaligem Klingeln übernahm der Anrufbeantworter die Regie, ich richtete mich langsam im Bett auf und lauschte.
Es war die Stimme einer Frau. Keine junge Stimme, auch gefiel mir ihr Tonfall nicht, aber was sie sagte, ließ mich aufhorchen. Sehr geehrter Herr Koller … muss Sie in einer dringenden Angelegenheit … der gestrige Todesfall im Theater … ob Sie wohl die Freundlichkeit besäßen, sich umgehend zurückzumelden?
Nun, der sehr geehrte Herr Koller besaß sogar die Freundlichkeit, sich umgehend aus den Federn zu schälen und nach dem Hörer zu greifen, bevor die Dame aufgelegt hatte. Die Nachricht vom Mord an Annette Nierzwa schien schnell die Runde gemacht zu haben.
»Guten Morgen«, brummte ich. »Wer spricht?«
»Herr Koller persönlich?«
»Um diese Uhrzeit bin ich der Einzige im Büro.«
»Oh, tut mir leid, Sie so früh stören zu müssen«, sagte die Frau mit der Andeutung eines Kicherns, das vermutlich so falsch war wie ihre Haarfarbe und ihre Entschuldigung. Ich stellte mir eine aufgetakelte 70-Jährige vor, die vom morgendlichen Fünf-Uhr-Geläute aus dem Bett getrieben wird und ihre übermüdete Umwelt mit Anrufen terrorisiert: ›Sei mir nicht böse, aber ich musste mit dir sprechen, Gertrud!‹
»Mein Name ist Elke von Wonnegut«, fuhr sie fort. »Herr Koller, ich möchte gleich zur Sache kommen. Es geht um den Vorfall gestern Abend im Theater. Während der Figaro-Aufführung.«
»Um welchen Vorfall?«
»Den Tod dieser Garderobiere. Dieses schreckliche Ereignis.«
»Ja?«
»Weiß man schon, wer dafür verantwortlich ist? Ich habe gehört, dass Sie mit der Polizei zusammenarbeiten.«
»Das haben Sie gehört?«
»Ja«, sagte sie und kicherte wieder.
Ich rieb mir den Schlaf aus den Augen. Abgesehen davon, dass mich ihre tüdelige Umschreibung des Mords ärgerte – ein Vorfall, für den jemand verantwortlich zeichnete –, fragte ich mich, woher die Alte ihre Informationen hatte.
»Ich arbeite nicht mit der Polizei zusammen«, sagte ich. »Die würde sich für meine Hilfe bedanken.«
»Also ermitteln Sie auf eigene Faust?«
»Nein.«
»Ach so? Ich dachte …«
»Wer hat denn behauptet, dass ich in diesem Fall ermittle?«
»Freunde von mir. Sehen Sie, mein Bekanntenkreis ist groß, und ich habe mit zahlreichen Menschen gesprochen, die Sie gestern vor Ort gesehen haben. Bei der Arbeit sozusagen. Wobei das natürlich ein falscher Eindruck gewesen sein kann.«
Ich sah zur Sicherheit noch einmal auf meine Armbanduhr. Fünf nach acht, und sie hatte bereits mit zahlreichen Menschen gesprochen. Mochte der von Wonnegut’sche Bekanntenkreis auch groß und illuster sein, ich wollte nicht dazugehören. Wahrscheinlich hatten einige ihrer Busenfreunde meine nächtliche Unterhaltung mit dem Rottweiler inklusive Erwähnung meines Berufs aufgeschnappt und ihren Erlebnisbericht damit gespickt.
»Sagen wir mal so«, meinte ich. »Gestern stand ich noch vor der Wahl, eigene Ermittlungen anzustellen, habe mich inzwischen aber dagegen entschieden.«
»Und warum, wenn man fragen darf?«
»Private Gründe.«
»Interessant«, sagte sie, und man merkte, wie in ihrem alten Kopf die Gedanken hin- und herschossen. »Das ist wirklich interessant, was Sie da erzählen, Herr Koller. Zumal ich gestern Abend selbst in der Premiere war, sofort nach Vorstellungsende allerdings gehen musste. Wissen Sie, die Oper ist meine zweite Heimat. Ich bin Vorsitzende des Fördervereins.«
Ich schwieg.
»Nun, mein lieber Herr Koller … Würde es Ihnen etwas ausmachen, zu mir zu kommen und mir Ihren Eindruck von der ganzen Angelegenheit zu schildern?«
»Jetzt?«
»Ich lasse Ihnen ein zweites Frühstück servieren. Kaffee oder Tee?«
»Moment, Frau von Wonnegut«, lachte ich überrumpelt und kratzte mich am Kopf. »Verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich wüsste nicht, wieso ich das tun sollte.«
»Ach so, ach so«, gurrte sie ins Telefon und überschlug sich fast vor Freundlichkeit. »Natürlich, Sie leben schließlich davon, dass man Ihre Informationen käuflich erwirbt. Bitte, Herr Koller, darüber lässt sich reden. Ich bin noch niemandem etwas schuldig geblieben, das ist mein Lebensmotto. Kommen Sie erst einmal vorbei, damit wir uns unterhalten können, anschließend klären wir das Finanzielle. Wie erwachsene Leute. Derweil erfahren Sie von mir, warum wir vom Förderverein wegen dieser Geschichte so besorgt sind.«
»Ich fürchte, ich kann Ihnen da nicht viel erzählen. Nicht mehr als Ihre Bekannten, die gestern vor Ort waren.«
»Aber Sie haben mit Herrn Nagel gesprochen, nicht wahr? Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht? Glauben Sie, er hat irgendetwas mit dem Mord zu tun?«
»Keine Ahnung.«
»Nun stellen Sie Ihr berufliches Licht nicht unter den Scheffel, Herr Koller. Sprechen wir einfach in Ruhe bei mir zu Hause darüber. Frau Stein wird Ihnen ein ausgezeichnetes Frühstück zusammenstellen.«
Mein Magen knurrte. Immer noch war mir ein Rätsel, warum mich die Alte sprechen wollte. Was erhoffte sie sich von einem netten Plausch bei frischen Brötchen und Orangensaft? Exklusivinformationen für den nächsten Kaffeeklatsch? Oder mehr?
»Um zehn muss ich in der Stadt sein«, sagte ich mit einem weiteren Blick zur Uhr. »Ein Termin, den ich unmöglich verschieben kann.«
»Ich wohne in der Altstadt, und es wird höchstens ein Stündchen dauern.«
»Na, dann …«
»Kaffee oder Tee, Herr Koller?«
»Kaffee. Und er darf ruhig stark sein.«
30 Minuten später stand ich vor einem blassgelb gestrichenen Altbau in der Neuen Schlossstraße und schwitzte. Ein pakistanischer Zeitungsausträger tappte pfeifend das steile Kopfsteinpflaster hinunter, ansonsten lag die Straße wie ausgestorben da. Ich schloss mein Rennrad ab und betätigte die obere von sechs Klingeln. Nach einer Weile summte der Türöffner. Mit dem Aufzug fuhr ich in den dritten Stock.
Oben gab es nur eine einzige Tür, geschlossen, ohne Namensschild. Ich klingelte wieder, wartete, hörte ferne Stimmen, dann ein Brummen und Schlurfen. Ein Mann öffnete, genauer gesagt ein Männchen, deutlich über das Pensionsalter hinaus und leicht bucklig. Seine gebeugte Haltung ließ mich rosige Kopfhaut sehen, um die ein wirrer Haarkranz lief. Er schaute mich aus großen Kinderaugen an und summte leise vor sich hin.
»Guten Morgen«, sagte ich. »Max Koller.«
Keine Reaktion, wenn man von dem unverdrossenen Summen einmal absah.
»Ihre Frau erwartet mich.«
Da strahlte der Kleine über sein ganzes faltiges Gesicht. Es war die reine, innige Freude, die mir entgegenlachte, so herzensinnig, dass ich sie ihm nicht abnahm. Wahrscheinlich strahlte er jeden Besucher so an, ob Trickbetrüger oder Krankenpfleger.
»Sie ist im Wintergarten«, flüsterte er und ließ mich eintreten. »Einmal ganz durch. Sehen Sie? Ganz durch, bis da hinten.«
»Danke«, sagte ich. Vielleicht hatte ich unrecht, und er war einfach ein netter, alter Mann mit krummen Knochen und fröhlichem Herzen.
Während er sich durch eine Seitentür verkrümelte, schritt ich den breiten, geräumigen Flur entlang. Er wurde von altertümlichem Holzmobiliar flankiert, darunter ein Klavier mit gedrechselten Beinen und Kerzenhaltern, und endete vor einer Doppelflügeltür, an die sich ein Wintergarten anschloss. Klassische Musik umfing mich, als ich eintrat.
»Guten Mo-horgen«, schallte es mir entgegen.
Die Dame des Hauses saß lächelnd in einem Korbstuhl, hatte die Last ihrer warm eingepackten Beine einem Fußbänkchen anvertraut und ließ sich die spärliche Wintersonne ins Gesicht scheinen. In Griffweite stand ein Telefon auf einem Schemel. Seitlich ein kleiner Tisch und ein Stuhl, ringsum Kübelpflanzen auf Marmorplatten, ein gluckernder Zimmerspringbrunnen, viel Nippes. Von der Decke glotzten mich zwei Lautsprecherboxen an, in einem Käfig schaukelte ein Papagei traurig vor sich hin. Das Beeindruckendste jedoch war die Glasfront des Wintergartens, die freie Sicht in drei Himmelsrichtungen bot. Die gesamte Altstadt lag einem zu Füßen, ein Spielzeugland aus Lebkuchenhäuschen, man musste nur noch zugreifen. Mit diesem Anblick vor Augen verstand sogar ich, warum die Touristen aus aller Welt nach Heidelberg kamen und Film um Film verknipsten. Die von Wonneguts bewohnten einen exklusiven Hochsitz, der sie beim Frühstück auf den Fluss sehen ließ, auf die Alte Brücke, auf den Philosophenweg und auf die Dachterrassen all der anderen Altstadtbewohner. Es war zum Heulen schön.
»Nehmen Sie doch Platz, Herr Koller«, sagte Frau von Wonnegut. »Und bitte entschuldigen Sie, wenn ich sitzen bleibe. Meine Beine können nicht mehr so, wie ich will.«
Ich reichte ihr meine Hand. »Eine schöne Aussicht haben Sie.«
»Wir wohnen seit 40 Jahren hier und genießen sie jeden Tag. Ich würde Sie gerne meinem Mann vorstellen, aber er sitzt bestimmt wieder an seinen Käfern.«
»Er hat mir geöffnet.«
»Paul?« Ihr Dauerlächeln verschwand. »Nicht Frau Stein?«
»Wie eine Frau sah er nicht aus«, sagte ich und setzte mich an den kleinen Tisch. Der Papagei gab ein hustendes Geräusch von sich, schüttelte sein Gefieder und drehte mir den Rücken zu.
»Frau Stein!«, rief meine Gastgeberin mit schriller Stimme. »Wo stecken Sie denn? Unser Gast ist da!«
Einen Servierwagen hinter sich herziehend, betrat eine magere, frostig dreinblickende Frau den Wintergarten. So karg sie in ihrem dunklen Kleid wirkte, so üppig präsentierte sich ihr Frühstück. Eine große Kanne Kaffee, Milch, Sahne, zwei Sorten Saft, Schinken, Käse, Marmelade, Honig, ein wachsweiches Ei und verschiedene Früchte, alle mundgerecht zugeschnitten. Und alle für mich, es gab nämlich nur einen Teller. Respekt, Frau Stein! Das sah nach harter, ehrlicher Sonntagmorgenarbeit aus.
»Haben Sie die Türklingel nicht gehört?«, fragte Frau von Wonnegut unerwartet scharf.
»Nein«, sagte Frau Stein und reichte mir mein Besteck.
»Sogar mein Mann hat sie gehört.«
Ohne auch nur mit einem Gesichtsmuskel zu zucken, schenkte Frau Stein mir Kaffee ein.
»Vielen Dank, ich glaube, unser Gast kommt alleine zurecht. Und stellen Sie bitte die Musik etwas leiser.«
Frau Stein tupfte einen Tropfen vom Ausguss der Kaffeekanne, dann schritt sie wortlos hinaus. Gleich darauf verstummte die Hintergrundsmusik bis fast zur Unhörbarkeit.
Meine Gastgeberin seufzte theatralisch auf, und es hätte mich nicht gewundert, wenn sie ein Lamento über das heutige Küchenpersonal angestimmt hätte. Stattdessen erblühte das zuvorkommende Begrüßungslächeln wieder auf ihren Lippen. Sie legte den Kopf ein wenig zur Seite und bedeutete mir mit einer Handbewegung zuzugreifen – so, wie früher die eigene Großtante einen aufforderte, wenn sie aufgetischt hatte. Lang zu, mein Junge, und nichts übriglassen!
Aber Elke von Wonnegut war keine hemdsärmelige Großtante, sondern ein kleines, selbstbewusstes Persönchen, das für klassische Musik schwärmte und durch Damen gleichen Alters ein Frühstück auftragen ließ, um einen Privatflic zu bezirzen. Sie trug eine Bluse mit Spitzenkragen und einen dunkelblauen Rock, um ihren schmalen, geröteten Hals wand sich eine rosa Perlenkette. Unter blondierten, leicht gewellten Haaren lugte das Gesicht eines klugen Nagetiers hervor, zu dem die makellose Reihe ebenmäßiger Zähne nicht recht passen wollte. Mein Blick blieb an ihren Ohrperlen hängen, die von gleicher Farbe wie die der Kette waren.
»Tja, Herr Koller«, begann sie heiter. »Wie schön, dass Sie gekommen sind.«
Ich probierte den Kaffee. Er hätte etwas stärker sein dürfen, aber er war in Ordnung. Wenn ich den Tisch komplett abräumte, brauchte ich vor heute Abend nichts mehr zu essen.
»Sie sind also Privatdetektiv. Man nennt es doch Privatdetektiv, oder?«
Ich nickte, zog meine Armbanduhr aus und legte sie neben meinen Teller.
»Und Sie haben um zehn Uhr einen wichtigen Termin, nicht wahr?«
»Genau«, sagte ich.
»Aber nicht mit einem Klienten, nehme ich an. Sie sagten doch am Telefon, dass Sie sich gestern gegen einen Auftrag entschieden hätten, richtig? Ich frage das nicht aus Neugier, Herr Koller, sondern weil es von entscheidender Bedeutung für unser Gespräch ist.«
»Ich bin derzeit ohne Auftrag, das ist korrekt.«
»Hervorragend«, rief sie aus und klatschte in die Hände. »Dann möchte ich Sie hiermit engagieren.«
»Sie?«, entfuhr es mir. »Mich engagieren?«
»Im Auftrag unseres Fördervereins. Der Freunde des Musiktheaters. Natürlich zu Ihren Bedingungen. In solchen Dingen pflegen wir nicht zu feilschen.«
Schweigend köpfte ich das Ei. Dass mich diese Frau engagieren könnte, wäre mir im Traum nicht eingefallen. Was interessierte sie so sehr am Tod einer Theaterangestellten, dass sie bereit war, sich dafür in Unkosten zu stürzen? In vermeidbare Unkosten zudem, denn es wurde ja ermittelt, die Polizei würde längst eine Sonderkommission zusammengestellt haben und den Mord, davon konnte man ausgehen, innerhalb weniger Tage aufgeklärt haben.
»Sie wollen mich engagieren«, sagte ich. »Gut. Wofür und warum ausgerechnet mich? Trauen Sie mir mehr zu als der Kripo? Oder soll ich etwas über die Ermordete herausfinden?«
»Über diese Frau?« Sie winkte ab. »Um Gottes willen. Verschonen Sie mich mit der. Mir geht es nur um eine Person, und das ist Herr Nagel.«
»Weil er mit ihr befreundet war?«
»Richtig. Und weil er sie gefunden hat, wie man mir sagte. Ist das Frühstück recht, Herr Koller? Fehlt noch etwas?«
»Alles bestens, Frau von Wonnegut. Erzählen Sie, was Sie von mir wollen, dann sage ich Ihnen, ob ich den Auftrag annehmen kann.«
»Sehr gut«, nickte sie und strich die Decke über ihren Beinen glatt. »Dazu muss ich ein wenig ausholen.«
Und das tat sie. Während sie mir eine Nachhilfestunde in Sachen klassische Musik gab, arbeitete ich mich durch die Köstlichkeiten, die mir Frau Stein aufgetischt hatte. Zum Ei trank ich den Grapefruitsaft, schmierte mir ein Marmeladebrötchen, spülte das Croissant mit viel Kaffee hinunter, probierte die Ananas und eine Kiwi, legte drei Lagen Schinken zwischen zwei Toastscheiben und schaffte sogar den Orangensaft. Als ich am Ende mit einem Eckchen Bergkäse in der Hand dasaß und mir behaglich über den Bauch strich, wusste ich mehr über die musikalischen Zustände in der Stadt, als mich jemals interessiert hatte.
Die Heidelberger Oper, so erfuhr ich, war klein, aber fein, das Theatergebäude schön, aber marode. Leute wie Frau von Wonnegut besuchten natürlich auch das Mannheimer Nationaltheater, fuhren nach Frankfurt, zu den Schwetzinger Festspielen oder gleich nach Salzburg, wenn ihre Knochen mitspielten, ihr Herz jedoch – bei diesen Worten legte sie beide Hände fest auf ihren Busen –, ihr Herz schlug ausschließlich für das altersschwache Haus in Heidelbergs Zentrum.
»Sie können es übrigens von hier aus sehen«, sagte sie. »Zumindest das Dach. Die Dächer, wenn man es genau nimmt.«
Ich nickte kauend. Dächer interessierten mich nicht.
Um dem finanzschwachen Opernbetrieb auf die Beine zu helfen, hatte man schon vor Ewigkeiten einen Förderverein gegründet und ihm den schönen Namen Freunde des Musiktheaters Heidelberg gegeben. Vorsitzende seit anderthalb Jahrzehnten: Elke von Wonnegut. Die Vereinsmitglieder waren sowohl Musikliebhaber als auch Lokalpatrioten, und zugunsten der Oper rissen sie sich sämtliche Beine aus. Verpflichteten Sponsoren, vermittelten Gastspiele, nutzten ihre weitverzweigten Kontakte zu Wirtschaft und Politik. Dass der Startenor X hier zuletzt seinen Schubert-Abend gegeben habe, sei nur dem rührigen Vereinsmitglied Y zu verdanken gewesen.
Wieder nickte ich. Der Name des Vereinsheinis sagte mir etwas, er stand alle naslang in den Klatschspalten der Regenbogenpresse. Von dem Sänger hatte ich noch nie etwas gehört.
Ohne die Freunde des Musiktheaters hätte die Stadt den Opernbetrieb längst eingestellt, behauptete Frau von Wonnegut. Dann wäre Heidelberg endgültig musikalische Provinz.
»Und wie wird man Mitglied in Ihrem Verein?«, wollte ich wissen. »Darf da jeder mitmachen?«
»Aber natürlich«, rief die Alte empört. »Jeder, dem das Wohl der Musik am Herzen liegt. Sicher achten wir darauf, dass man sich entsprechend einbringen kann. Man muss schon aktiv fördern können, wenn Sie verstehen, was ich meine. Karteileichen, die sich nur mit der Mitgliedschaft schmücken wollen, brauchen wir nicht.«
»Aktiv fördern heißt …«
»Aktiv heißt aktiv, Herr Koller«, entgegnete sie ungeduldig. »Vermitteln, unterstützen, ein Netzwerk bilden. Ohne das geht heutzutage nichts mehr im Kulturbereich. Die Erfolgsformel besteht in einer gelungenen Mischung: auf der einen Seite die künstlerisch Verantwortlichen, auf der anderen die Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaft. Dass uns die ehemalige Oberbürgermeisterin die kalte Schulter gezeigt hat, war eine Ausnahme. So etwas wird nie wieder vorkommen.«
»Und Bernd Nagel?«
»Als Geschäftsführer des Philharmonischen Orchesters ist er selbstverständlich eines der wichtigsten Mitglieder. Ich habe vergangenes Jahr persönlich dafür gesorgt, dass er in den Vorstand gewählt wird.«
»War Annette Nierzwa auch dabei?«
»Ich bitte Sie.« Indigniert wandte sie sich ab.
Eine Garderobiere war also offensichtlich nicht in der Lage, die Musik in Heidelberg aktiv zu fördern. Ihre Aufgabe bestand darin, den Vereinsmitgliedern nach einer Premiere in den Mantel zu helfen oder ein Stäubchen vom Jackett zu pusten. Und wenn ich Frau von Wonneguts pikierten Gesichtsausdruck richtig interpretierte, war die Tote dieser Pflicht nur ungenügend nachgekommen.
»Wie auch immer«, sagte meine Gastgeberin, nachdem sie sich ausgiebig geräuspert hatte. »Die Freunde des Musiktheaters haben sich in den letzten Monaten neue, ehrgeizige Ziele gesteckt. Den Anstoß gaben die Schreckensmeldungen über den Zustand der städtischen Bühnen. Dass hier investiert werden muss, ist offensichtlich, und dass unser Gemeinderat dafür kein Geld ausgeben möchte, noch viel offensichtlicher. Sie haben die Diskussionen sicher in der Presse verfolgt.«
»Sicher.«
»Vereinsintern sind wir uns einig, dass Heidelberg ein neues Opernhaus braucht. Das jetzige ist, wie erwähnt, ein Juwel, aber ein zu kleines, enges und nun auch noch sanierungsbedürftiges Juwel. Es gibt zwei Planungen: entweder ein Erweiterungsbau auf dem bestehenden Theatergelände oder ein Neubau an anderer Stelle.«
»Wo denn?«
Sie zuckte die Achseln. »Am Bahnhof, integriert in den geplanten neuen Stadtteil. Oder am Neckar, als repräsentatives Gebäude. Da ist vieles möglich. Wenn ich daran denke, dass sie in Hamburg die Elbphilharmonie genehmigt bekommen haben … Ausgerechnet Hamburg!«
Mir fiel nicht ein, was an Hamburg so außergewöhnlich sein sollte, dass es gegen einen Konzertneubau spräche. Also schwieg ich.
»Wissen Sie«, sagte Frau von Wonnegut, und ihre Stimme bekam eine melancholische Note. »Ich habe eine Vision. Und viele meiner Freunde teilen sie. Die Vision, dass hier in Heidelberg eines Tages der komplette Ring aufgeführt wird.«
Dabei blickte sie mich so zustimmungsheischend an, dass ich reagieren musste. »Welcher Ring?«, fragte ich.
»Der Ring des Nibelungen«, sagte sie kalt. Selbst von einem Privatflic hatte sie sich eine andere Reaktion erhofft. »Vier Abende Wagner im neuen Opernhaus am Neckar. Oder im Herzen der Altstadt, auf historischem Grund. Vielleicht halten Sie mich für sentimental, aber wenn ich nur einmal die Götterdämmerung in meiner Heimatstadt hören dürfte, dirigiert von Enoch Barth-Hufelang, dann könnte ich beruhigt sterben.«
Mir blieb der Käse im Hals stecken. Klein und zäh, wie die Alte wirkte, lag jeder Gedanke an ihren bevorstehenden Tod verdammt fern. »Verstehe«, log ich schließlich.
»Unser Projekt hat bereits einen Namen: der Heidelberger Ring 2012. Behandeln Sie das bitte als vertrauliche Information. Überhaupt habe ich Ihnen all dies nur erzählt, damit Sie sich ein Bild von unserem Förderverein machen können. Wir haben große Pläne, Herr Koller, und um sie zu verwirklichen, brauchen wir fähige Menschen. Die richtigen Personen am richtigen Platz, verstehen Sie?«
»Sie meinen mich«, grinste ich.
»Nein«, erwiderte sie, um sich sofort zu verbessern. »Doch, Sie brauchen wir auch. Entschuldigen Sie bitte. Ich dachte in diesem Fall an Menschen wie Herrn Barth-Hufelang, der ein ausgezeichneter Dirigent ist, der beste, den diese Stadt je hatte, und der deshalb über kurz oder lang attraktivere Angebote bekommen wird. Es sei denn, wir können ihm eine lohnende Perspektive in Heidelberg bieten.«
»Den Ring 2012.«
»Richtig. Und wir brauchen jemanden wie Bernd Nagel, der als Geschäftsführer ein Glücksfall ist, weil er eine außergewöhnliche Ausstrahlung hat und bei den Sponsoren hervorragend ankommt.«
Erst recht bei den Sponsorinnen, dachte ich.
Ein graues Etwas schob sich in den Raum. Frau Stein stand auf der Schwelle, die Hände gefaltet, die Lippen zu einem schmalen Strich zusammengepresst.
»Fehlt noch etwas, Herr Koller?«, säuselte die Hausherrin. »Kaffee, Brötchen, etwas anderes?«
»Danke, ich bin zufrieden. Es schmeckt hervorragend, wirklich. Vielen Dank, Frau Stein.«
Wortlos verließ die Frau den Wintergarten.
»Trotzdem dürfte die Musik etwas lauter sein«, rief ihr Frau von Wonnegut hinterher. »Ich hatte Sie nicht angewiesen, sie komplett auszustellen.«
Ich schüttelte einige Krümel von meinem Pullover. »Wenn ich Sie richtig verstanden habe«, sagte ich, »ist Herr Nagel ein wichtiger Bestandteil Ihrer Pläne. Beziehungsweise der Pläne Ihres Vereins.«