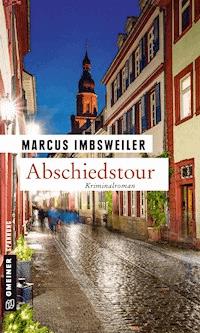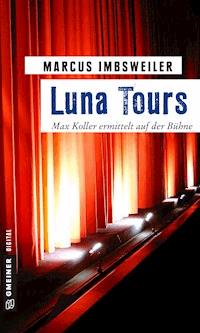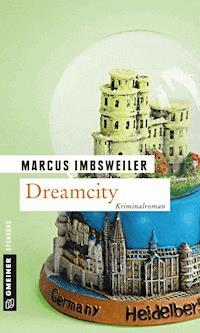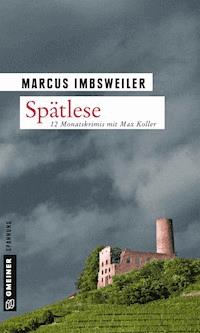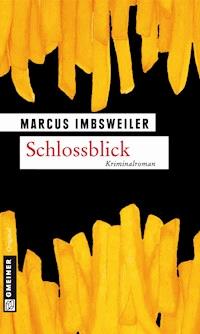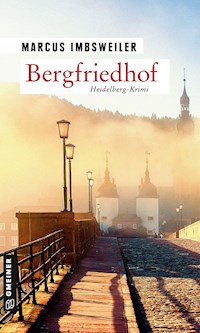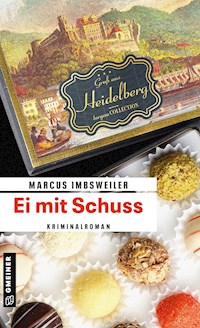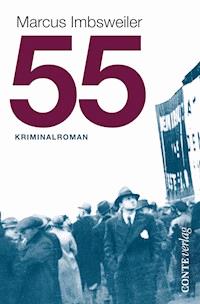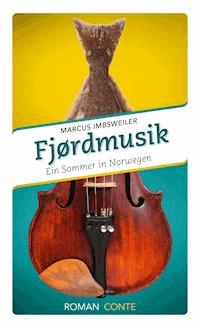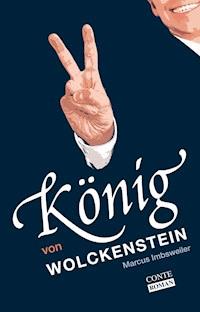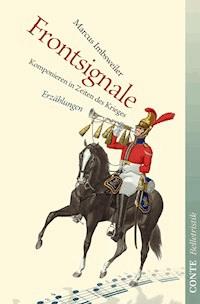Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conte Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
28. August 1988. Das Flugtagunglück auf der Ramstein Air Base in Rheinland-Pfalz wird zum Wendepunkt im Leben der Freunde Alwin, Sascha, Andreas und Franziska. Keiner der vier erleidet körperliche Verletzungen und doch wird nichts mehr sein, wie es war. Erst recht, nachdem sich noch am selben Abend eine weitere, folgenschwere Tragödie ereignet. 30 Jahre später, im Sommer 2018, ist es der Suizid einer jungen Frau, der den Polizisten Alwin Bungert vor ein Rätsel stellt. Ein Motiv ist nicht erkennbar, ein Abschiedsbrief, falls er je existierte, verbrannt. Doch das Wiedersehen mit seinen Jugendfreunden beim Jubiläumstreffen des Abiturjahrgangs '88 reißt alte Wunden auf und legt ein Geheimnis offen. Alwin ahnt, dass an jenem Tag vor drei Jahrzehnten weit mehr zerbrochen wurde als befürchtet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 337
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Sommer war heiß gewesen, heiß und vor allem trocken. Rund um Dürrweiler leuchteten die Wiesen in stumpfem Gelb, der Asphalt der Dorfstraße zeigte erste Risse. Auf den Feldern liefen Sprenger und Berieselungsanlagen praktisch ohne Unterlass, doch die Tropfen zerstoben zu nichts, bevor sie auf die ausgemergelte Erde trafen.
Ein neues Wort machte die Runde, eines, das sie in Dürrweiler bislang nur vom Hörensagen kannten, nicht aus eigener Anschauung: Waldbrandgefahr. Polizei und Feuerwehr wurden in Alarmbereitschaft versetzt. Alwin Bungert persönlich brachte Schilder an Waldparkplätzen und Wanderwegen an, die auf die aktuelle Gefahrensituation hinwiesen. Kein offenes Feuer entzünden! Brennende Zigaretten niemals fortwerfen!
»Waldbrandgefahr«, murmelte Bungert vor sich hin, während ihm der Schweiß über den Nacken lief. Das Wort hatte einen eigentümlichen Klang, fast hätte er gesagt: einen seltsamen Geschmack. Seit er Polizist war, nein, seit er denken konnte, hatte in Dürrweiler, hatte im gesamten Ostsaarland kein Wald gebrannt. Eher waren Wälder im Dauerregen ersoffen, vom Sturm umgelegt, vom Frost gesprengt. Aber in Flammen gestanden? Man lebte ja nicht in Griechenland oder Australien.
Und dann geschah es doch.
Auf Gemeindegrund, nur einen Steinwurf vom Ort entfernt. Drei Tage, nachdem Bungert, seine Kollegin und die Jungs von der Feuerwehr ihre Schilder angebracht hatten. Im Wald hinter dem Friedhof brannte es, die Flammen schlugen meterhoch in die Nacht. Es sah aus, als würde der Hügel Feuer spucken: der Vulkan von Dürrweiler.
Als Bungert die Information erhielt, jagten draußen bereits die Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr durch die Straßen. Er schüttelte den Kopf, wollte es nicht glauben. Wer konnte so dämlich sein …? In diesen Tagen! Eine Nachlässigkeit? Brandstiftung? Das Wort, das ihm so fremd vorgekommen war, hatte plötzlich einen neue, bittere Note.
Von seinem Haus brauchte er keine fünf Minuten mit dem Auto. Am Friedhof vorbei, raus aus dem Ort und dann gleich rechts in einen Feldweg, der zum Wald führte. Zwischen den Bäumen zuckte Blaulicht, der Nachthimmel glühte vom Widerschein des Feuers. Bungert stellte seinen Wagen ein Stück hinter der Einmündung des Feldwegs ab. Die Zufahrt musste frei bleiben. Beim Aussteigen rief er seine Kollegin an. Auch wenn die Feuerwehr den Brand wahrscheinlich bald unter Kontrolle hatte, brauchte er Jenny, um Gaffer fernzuhalten. Die Nähe zum Ort war Fluch und Segen zugleich. Das Feuer konnte erst vor Kurzem ausgebrochen sein; aber so schnell, wie es entdeckt worden war, würde es auch Neugierige anziehen. Und von denen gab es genug in Dürrweiler.
Er steckte das Handy wieder ein. Jenny war bei ihrem Freund im Nachbarort, in spätestens zehn Minuten wollte sie vor Ort sein. Bungert lief über den Feldweg Richtung Wald. Die Stille, die sonst hier herrschte, war wie weggefegt, das Prasseln des Feuers vermischte sich mit dem Motorenlärm, mit Kommandos und Arbeitsgeräuschen. In Bungerts Rücken kündeten Sirenen das Eintreffen weiterer Feuerwehren an.
Jetzt hatte er den Waldrand erreicht und mit ihm die wie an einer Perlenkette aufgereihten Autos, drei Löschfahrzeuge, ein Einsatzleitwagen. Menschen rannten hin und her, Schläuche wurden entrollt, Schaufeln und Hacken verteilt. Schon nach wenigen Metern öffnete sich der Wald zu einer Lichtung, auf der früher eine Jagdhütte gestanden hatte. Ihre Umrisse waren trotz des hohen Grases noch erkennbar. Und gleich daneben tobte das Feuer. Es hatte den gesamten nördlichen Rand der Lichtung erfasst und drohte sich in den Wald zu fressen. Der Wind, der hier oben deutlich stärker wehte als unten im Ort, drückte die Flammen nach Westen.
Bungert betrachtete das Wüten des Feuers mit einer Mischung aus Faszination und Grauen. Er konnte sich nicht erinnern, jemals einen so mächtigen Brand aus nächster Nähe erlebt zu haben. Die Hitzeentwicklung war enorm, das Gelb, Orange und Rot der Flammen ließ seine Augen tränen. Noch beklemmender aber waren die Geräusche, die das Feuer machte: Es knackte, zischte, stöhnte, grollte, röchelte. Wie ein eigener Organismus, fast wie ein Mensch. Manchmal drang ein tiefer Seufzer aus dem Inferno.
Bungert ging ein paar Schritte zur Seite, um die Löscharbeiten nicht zu behindern. Er schwitzte vom bloßen Hinsehen, aber einer wie Bungert schwitzte leicht. Plötzlich hörte er lautes Rufen von der entfernten Seite der Lichtung. Mehrere Feuerwehrleute in Schutzkleidung drangen unter Einsatz von Rückenspritzen bis dicht an das Flammenmeer heran. Dann bückten sich zwei von ihnen, um einen dunklen, rauchenden Gegenstand vom Boden aufzuheben oder eher wegzuziehen. Einer winkte Bungert zu.
Der Polizist zögerte. Auf seinem Gesicht brannte die Hitze. Als er sich schließlich doch in Bewegung setzte, achtete er darauf, dem Feuer nicht zu nahe zu kommen. Was konnte hier schon herumliegen, hier lag doch nie etwas herum, seit die Hütte nicht mehr stand. Er sah, dass die Feuerwehrmänner den Gegenstand weiter aus der Gefahrenzone heraus schleppten. Und er sah, dass der Gegenstand eine ungewöhnliche Form hatte: die Umrisse eines Menschen.
Bungert ging weiter. Er war Polizist, er hatte schon mehr als einen Toten gesehen. Darunter auch übel Zugerichtete, Opfer von Verkehrsunfällen oder einmal eine stark verweste Leiche. So schnell erschütterte ihn nichts. Aber dann änderte der Wind für einen kurzen Moment seine Richtung. Eine Bö trug den Geruch, der von dem Gegenstand ausging, zu Alwin Bungert hinüber.
Bungert wurde schwindlig. Er spürte, wie ihm die Knie wegsackten.
Im selben Moment, als sich der Polizist ins Gras der Lichtung übergab, begannen unten in Dürrweiler die Kirchturmglocken zu läuten.
Der Kirchturm von Dürrweiler ist so etwas wie das Wahrzeichen des Ortes. Weniger, weil er so markant wäre, sondern weil es kein anderes Gebäude gibt, das ihm diese Stellung streitig machen könnte. Von außen sieht man dem schmalen, hohen Turm nicht an, dass in seinem Inneren vier dickleibige Glocken auf ihren Einsatz warten, ein bronzenes Quartett, das seine Rufe weit über das Land schickt. Ihr Läuten begleitet die Bewohner von Dürrweiler ins Leben hinein und wieder hinaus. Auch jetzt, Stunden nach Entdeckung der Toten, zieht der Glockenschlag, den Bungert gehört hat, noch seine Kreise. In weiter Entfernung natürlich und kaum wahrnehmbar. Irgendwo schwingt etwas nach, flüstert ein Echo, zittert ein dünnes Blatt. Selbst die Wände des Dürrweiler Kirchturms vibrieren noch unmerklich. Wie ein ganz zarter Farbton senkt sich der Ton seiner vier Glocken über das Land, ein Hintergrundsrauschen, eine Melodie, die in jedem drin steckt, ob er sich dessen bewusst ist oder nicht.
Der Pfarrer von Dürrweiler hat diesen Glocken einmal einen ganzen Vortrag gewidmet. Lange her, inzwischen gibt es einen neuen Pfarrer, der über eine deutlich geringere Zahl von Schäfchen wacht. Was sein Vorgänger damals zum Kern seiner Ausführungen machte, war genau jenes Missverhältnis von außen und innen, das sich bei genauer Betrachtung des Kirchturms offenbart. So, wie der Turm unter seiner Hülle einen ungeahnten Schatz verbirgt, liegt auch beim Christenmenschen das Wertvollste tief in seinem Inneren. Sagte der Pfarrer. Ob einer hässlich ist oder entstellt, missgestaltet oder verkrüppelt – auf die Seele kommt es an! Und da nickten die Hässlichen und Entstellten seiner Herde, und alle anderen nickten auch. Nur die Eitlen senkten beschämt ihre Köpfe.
Das Referat des damaligen Pfarrers war Teil einer ganzen Vortragsreihe zum Thema »Glauben heute«, initiiert von der Volkshochschule. Im Jahr darauf lautete das Thema »Medizin heute«, und da fand die Diskussion um außen und innen eine Fortsetzung, wenn auch ungeplant. Referent war ein junger Assistenzarzt aus Norddeutschland, den es kurz zuvor ans Universitätsklinikum Homburg verschlagen hatte, und zwar an die Hautklinik.
Ein Dermatologe also. Ein Ortsunkundiger. Was durfte man da erwarten? Auskünfte zur Beschaffenheit und Funktion dieses größten aller menschlichen Organe. Warnung vor Krankheiten. Hautkrebs, Neurodermitis, Sonnenbrand. All das kam auch. Moderne Erkenntnisse, verständlich unters Volk gebracht. Irgendwann aber schob der Assistenzarzt sein Manuskript beiseite und strahlte die Zuhörer an. In seine Augen war ein sehr unwissenschaftliches Leuchten getreten.
Die Haut, sagte er, werde ja gemeinhin als Hülle betrachtet. Als Mantel, Umhang, Pelle. Was dem Tier das Fell und dem Baum die Borke, sei dem Menschen die Haut. Gewissermaßen dasjenige, was unser Organpuzzle vorm Auseinanderfallen bewahre. Die Verpackung also. Und genau das sei ein Irrtum. Eine total verkürzte Sicht der Dinge. Die Haut sei viel mehr. (Hier verstärkte sich das Leuchten.) Viel mehr! Die Haut sorge für den Flüssigkeitsaustausch, sie atme, sie transportiere Dinge von außen nach innen, von oben nach unten. Sie sei formbar, beweglich, passiv und aktiv zugleich, sie erneuere sich ständig. Von welchem anderen Bestandteil des Menschen könne man das sagen? Von den Zähnen vielleicht? Von den vielbeschworenen Augen, den Fenstern der Seele? Man möge einmal, nur versuchsweise, in ein Auge schneiden. Oder fest mit dem Daumen draufdrücken. Puh. Die Haut könne das ab, kein Problem. Oder das Herz, das angeblich Wertvollste, was der Mensch besitze, Zentrum und Lebenskern. Aus medizinischer Sicht eine Trivialität. Bloß Muskelfleisch, tock-tock. Ein Motor, aber ein ganz simpler. Dagegen die Haut! Auf kleinster Fläche mehr Rätsel als im dicksten Sportlerherzen. Kompliziert, durchdacht, eine Herausforderung noch für viele Forschergenerationen.
Und das, strahlte der junge Arzt, sei ja nur die wissenschaftliche Seite. Wir alle wüssten doch, wofür die Haut noch stehe. Man müsse sich bloß einmal selbst berühren, sanft über den Unterarm streicheln oder die Wangen. (Er machte es vor.) Das Feuerwerk an Emotionen, das dieser minimale Kontakt auslöse! Der Schauer, der uns ergreife, die Beschleunigung des Pulses, die Änderung der Körpertemperatur. Verursacht durch ein schlichtes Schaben an der Außenwand. Beim Herzen funktioniere das nicht, das lasse sich nicht streicheln. Augen und Zähne ebenso wenig. Haut aber habe nicht nur eine taktile Qualität, sondern auch eine olfaktorische. Haut riecht! Und wie sie rieche. (Hier verzog sich das Gesicht des Arztes in Verzückung.) Die eigene Haut, die Haut des Partners, des Kindes. Sie schmecke ja auch, ganz vorzüglich schmecke sie, nicht zu reden von den optischen Genüssen, die sie zu bieten habe – ob die geneigten Hörer schon mal ein Herz gesehen hätten? So einen blutigen, zuckenden Herzklumpen? –, ja, und wer feine Ohren habe, dem entgingen auch die akustischen Signale nicht, wie sie unsere Haut bei jeder Bewegung aussende, dieses ganz feine Raspeln und Rispeln.
Der junge Mann holte Luft. Und bei diesem Alleskönner, Allessymbolisierer solle es sich bloß um Verpackungsmaterial handeln? Nein, nein, die Haut sei etwas ganz anderes, viel Größeres, nämlich Spiegel unserer selbst, mehr Ich als Herz, Seele und Geist zusammen. Wer von sich spreche, meine in erster Linie seine Haut. Sie sei das wahre Gesicht des Menschen, Ausdruck seiner Gefühle. Ohne Haut kein Begehren. Ohne Haut keine Fortpflanzung. Dass der Mensch sich selbst lieben könne – im platonischen wie im erotischen Sinne –, sei der Haut zu verdanken.
Und deshalb, schloss der Mediziner, sollten wir sie schützen. Auf seiner Stirn standen Schweißtropfen.
Das Publikum applaudierte pflichtschuldig. Es bestand aus insgesamt drei Personen, allesamt Frauen, die sich im weitläufigen, für mindestens zehnmal so viele Hörer bestuhlten Nebenraum der Krone verloren. Eine der Damen sagte, wenn in der Uniklinik jetzt so nette Ärzte seien, könne man getrost krank werden, eine andere fragte, welchen Sonnenschutzfaktor der Herr Doktor für Mallorca empfehle.
Die dritte Zuhörerin, eine junge Frau mit einem auffälligen Muttermal am Hals, sagte nichts. Wegen ihres Muttermals war sie gekommen, aber weil sich der Referent über derartige Hautveränderungen ausgeschwiegen hatte, schwieg sie jetzt auch. Dann würde sie eben weiter damit leben. Wenige Monate nach dem Vortrag interessierte sich zu ihrer Überraschung doch ein Mann für sie, und als sie Jahre später eine Tochter bekam, hatte die ebenfalls ein Muttermal. An der gleichen Stelle wie ihre Mutter.
Aber da war der junge Hautarzt längst wieder nach Norddeutschland gezogen.
Bungert legte das Telefon beiseite und seufzte.
Er spürte Jennys Blick, die unausgesprochenen Fragen. Trotzdem sah er nicht auf, er sagte auch nichts. Starrte bloß auf seine Hände, von denen eine den Hörer gehalten hatte, minutenlang. Schwere Hände, die Finger kurz und kräftig, zupackende Polizistenhände. Kleine Narben zeugten von dem, was diese Hände schon alles mitgemacht hatten, hier ein Schnitt, da der Griff in einen rostigen Nagel.
Unerheblich. Nicht der Rede wert, wenn oben im Wald eine liegt, die so verbrannt ist, dass du sie nicht mehr erkennst.
»Und?«, sagte Jenny. »Ist es die Jasmin?«
Jetzt endlich blickte Bungert auf. Er nickte.
Jenny drückte sich vom Schreibtisch weg und schaute zur Seite. »Ach Mann«, flüsterte sie.
Bungert nickte wieder.
Danach schwiegen sie beide. Bungert stemmte sich in die Höhe, ging zum Fenster und sah hinaus. Gierte nach Leben, nach Normalität und wurde erhört: das stille Treiben auf der Dorfstraße, Passanten, Autos, eine Fahrradfahrerin mit wehendem Haar, die hoch stehende Sonne. Der Anblick beruhigte ihn.
Und trotzdem. Die Jasmin, was für ein Jammer. Sie hatten es sich schon gedacht gestern. Er, die Feuerwehrleute aus dem Ort, der Notarzt: Bei dem halbverkohlten Ding, das sie aus dem Feuer gezerrt hatten, könnte es sich um die Jasmin handeln. Könnte! Musste nicht. Wo doch der Oberkörper besonders übel zugerichtet war, das Gesicht verwüstet, die Haare komplett weggebrannt. Mann oder Frau? Von der Statur her eine Frau, eine junge. An den Füßen Sneakers, gerade noch erkennbar, Reste einer Jeans. Mehr nicht. Und doch. »Kann das die Jasmin sein?«, hatte einer der Feuerwehrleute gesagt. Einer aus dem Ort. Es fielen noch andere Namen, aber Bungert, nach einem flüchtigen Blick auf die Leiche, hatte innerlich genickt. Was da lag, war die Jasmin. Auch wenn es kein Muttermal mehr gab, an dem man sie hätte erkennen können.
»Ausgerechnet die Jasmin«, hörte er Jenny sagen.
Er wusste, was sie meinte. Jasmins Mutter, der Gudrun, hatte das Leben doch schon schlimm mitgespielt. Der Mann abgehauen, der Vater zum Krüppel geschlagen. Und jetzt die Jasmin, ihre einzige Tochter. Warum musste sie die auch noch verlieren?
»Eine Schande ist das«, sagte er und ging zum Schreibtisch zurück. Ließ sich in seinen Drehstuhl fallen und wartete ergeben auf Jennys Fragen.
»Wie weit sind sie in Saarbrücken?«
»Ermitteln. In alle Richtungen. Wollen nichts ausschließen.«
»Ach, komm.«
Bungert hob die Schultern. »Für Fremdeinwirkung gibt es derzeit keine Anzeichen.«
»Also Unfall? Oder Suizid?«
»Sieht so aus.«
»Und was von beidem?«
»Alles offen.«
»Glaubst du, dass die sich verbrannt hat? Selbst angezündet? Passt nicht zu der.«
»Kann man in die Leute reingucken?«
»Aber doch nicht die Jasmin!«
Bungert kratzte sich am Kopf. Die Jasmin nicht, das sah er genau so.
»Hat sie geraucht?«
»Die Jasmin und geraucht?« Bungert schüttelte den Kopf. Soviel er wusste, war das Mädchen eher das Gegenteil einer Raucherin. Kein Nikotin, kein Alkohol. Aus Prinzip! Konnte natürlich eine Phase sein, die Jasmin hatte so etwas Schwankendes, immer schon gehabt. Komisch übrigens, dass er das mit der Jenny besprach, die war ja kaum älter und hatte genau wie Jasmin lange, blonde Haare – aber damit endeten die Gemeinsamkeiten auch schon. Jenny war klein und stämmig, breit in den Hüften, die warf so schnell nichts um. Jasmin dagegen mit ihrer leisen Stimme und dem unsteten Blick … total anderer Typ.
»Vielleicht hat sie ein Feuer gemacht«, spekulierte Jenny weiter. »Zum Spaß, nur für sich.«
»Bei der Trockenheit? So blöd ist doch keiner.«
»Liebeskummer? Romantisches Plätzchen im Wald, kleines Feuerchen – sie schläft ein, und plötzlich steht alles in Flammen.«
»Wenn es so war, dann sieht es schlecht aus mit Spuren.«
»Jedenfalls finde ich es seltsam, dass wir sie ausgerechnet dort oben gefunden haben. Wo mal die Hütte vom Karlmann war.«
Bungerts Antwort bestand in einem vagen Brummen. Seine junge Kollegin sprach bloß aus, was ihm schon die ganze Zeit durch den Kopf ging. Die Hütte, die bis vor drei Jahren auf der Lichtung gestanden hatte, hatte dem Landrat gehört: Karl-Josef Brix, Spitzname Karlmann. Und was den Karlmann und die Jasmin anging, so hatte es Gerüchte gegeben. Damals. War die Jasmin bloß Aushilfskraft im Büro des Landrats, oder war da noch mehr? Vom Alter her hätte der Karlmann ihr Vater sein können, aber das hatte den ja noch nie gejuckt. Unklar, ob es die Jasmin gejuckt hatte. Der Schwitzgebel David, ihr damaliger Freund, hatte jedenfalls mit ihr Schluss gemacht. Oder sie mit ihm?
»Na ja«, sagte Bungert.
»Was, na ja?«
»Die Sache mit dem Karlmann ist lange vorbei. Kein Grund, sich jetzt im Wald zu verkriechen.«
»Trotzdem komisch.«
»Schon.«
»Und wie geht es weiter?«
»Die Saarbrücker machen ihre Arbeit. Das wird dauern. Spuren? Dort oben ist alles verbrannt. Eventuell bringt die Obduktion was.«
»Und wir?«, fragte Jenny.
Achselzucken. »Wir können uns umhören. Vielleicht hat jemand was gesehen oder vorher mit ihr gesprochen. Kann doch nicht sein, dass ein Mädchen aus unserer Mitte«, er zögerte und wählte dann eine weniger pathetische Formulierung, »ein Mädchen aus dem Ort so einfach verschwindet.«
Jenny sah auf den Kugelschreiber, den sie in der Hand hielt. »Warum sagst du Mädchen? Sie war 20.«
»Mein Gott, ich kenne die Jasmin, seit sie …« Bungert war plötzlich heiser. »Mädchen, junge Frau, egal.«
»Dich hat das gestern ziemlich angefasst, was? Ich hab gesehen, wie dir der Notarzt was gegeben hat.«
»Bloß der Kreislauf.« Bungert machte eine Handbewegung, als könne er Jennys Bemerkung so vom Tisch wischen. »Schlechter Tag. Bin halt auch nicht mehr der Jüngste.«
Der Wald hinter dem Friedhof war weiträumig abgesperrt. Über den Baumwipfeln standen schmutzig gelbe Rauchfahnen. Noch immer kokelte es an vielen Stellen. Bungert sprach mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr, der vor der Gefahr eines erneuten Aufflammens warnte. Am Nachmittag sollte der Wind auffrischen, außerdem gab es weiterhin Glutnester, auch verborgene. Tiefer im Wald waren Gräben gezogen worden, Bäume gefällt und Buschwerk beseitigt. Gegen Funkenflug kam Wasser zum Einsatz. Noch in der Nacht hatte man den Hydranten beim Friedhof angezapft und so den Nachschub gesichert.
An der Stelle, an der Jasmins Leiche gelegen hatte, waren Spurensicherer in feuerfesten Schuhen zugange. Bungert konnte sich nicht vorstellen, dass sie dort fündig werden würden. Die Lichtung selbst war weitgehend unversehrt, offenbar hatte der Wind das Feuer beständig Richtung Bäume gedrückt. Dort, wo einmal dichter Wald gewesen war, ragten jetzt verkohlte Stämme in die Luft. Das Unterholz war niedergebrannt, immer wieder wirbelte Asche auf.
»Es hätte schlimmer sein können«, meinte der Einsatzleiter. »Die Natur erholt sich schnell.«
Bungert schüttelte ihm die Hand und bedankte sich.
Vor der Absperrung herrschte ein reges Kommen und Gehen. Menschen aus Dürrweiler und den Nachbarorten wollten sich ein Bild der Lage machen, soweit es ihnen gestattet war, wollten erfahren, begreifen, verstehen. Der Handel mit Informationen blühte. Gibst du mir was über die Tote, gebe ich dir mögliche Brandursachen. Bungert war schon wieder auf dem Rückweg in den Ort, als er Schritte hinter sich hörte. Er blieb stehen und drehte sich um. Es war der Rütsch, der Hastenteufel Rüdiger, der rasch zu ihm aufschloss.
»Schreckliche Geschichte, Alwin.«
Bungert nickte. Seit der Rütsch ohne Job war, hatte er Zeit. Zeit zum Herumlaufen, zum Reden, zum Kümmern. 20 Jahre in der Deutschlandzentrale eines Baumarkts, top Bezahlung, breites Kreuz – und dann die Insolvenz, quasi von heute auf morgen. Dumm gelaufen für den Rütsch.
»Sag mal, stimmt das, Alwin? War das wirklich die junge Becker, die da …?« Er vollendete den Satz nicht.
»Wie kommst du darauf?«
»Erzählen sie hier.«
»Wer erzählt das?«
»Na, alle.«
Bungert zuckte die Achseln. »Ja, ist wohl so. Die Jasmin.«
»Furchtbar.«
»Ist es. Aber frag mich jetzt bitte nicht, warum und wieso. Erstens weiß ich nichts, und zweitens müsste ich mein Maul halten, wenn ich was wüsste. Momentan kann dir niemand sagen, was gestern geschehen ist. Die Ermittlungen laufen.«
»Logisch. Die arme Gudrun.«
Gemeinsam setzten sie ihren Weg fort. Die Sonne brannte auf dem Asphalt. Als sie den Friedhof passierten, räusperte sich Rütsch. »Weißt du, was ich mich frage, Alwin?«
»Was?«
»Wie die Gemeinde reagieren wird. Ich meine, wenn es brennt und eine aus dem Ort ums Leben kommt – müsste man da bestimmte Dinge nicht … also müsste man auf die nicht verzichten? Aus Respekt und so?«
»Worauf denn?«
»Na, zum Beispiel auf diese Steinbruch-Geschichte. Am Dienstag, das Konzert. Hab gehört, die ziehen eine Riesenshow ab, mit Feuerwerk und allem. Ausgerechnet Feuer, stell dir mal vor.« Unvermittelt blieb Rütsch stehen. »Kann man da rumgrölen und feiern, wenn kurz vorher …?« Auch dieser Satz blieb Fragment.
Bungert, der ebenfalls anhielt, blickte sich um. Irgendwo ganz in der Nähe brummte etwas, es klang wie ein Spielzeugauto. Zu sehen war allerdings nichts.
»Keine Ahnung, Rütsch, das muss der Bürgermeister entscheiden. Ich sehe da jetzt nicht so den Zusammenhang.«
Hastenteufel nickte. Bungert wollte weitergehen, aber der andere rührte sich nicht von der Stelle.
»Und … wie ist es mit unserer kleinen Feier morgen Abend? Das Abijubiläum? Dagegen spricht doch nichts, oder?«
›Ach so‹, dachte Bungert, ›daher weht der Wind. Daher.‹ Dem Rütsch ging es gar nicht um das Open Air im Steinbruch. Er hatte bloß Schiss, jemand könne ihm das Besäufnis mit den alten Schulkameraden übel nehmen. Und jetzt beantragte er sozusagen die behördliche Genehmigung bei der Polizei.
»Nö«, sagte er laut. »Dagegen spricht wirklich nichts. Wenn die Gudrun bei uns in der Stufe gewesen wäre, okay, aber so … Wem nicht nach Feiern ist, der braucht ja nicht zu kommen.«
»Korrekt«, nickte Rütsch. »Sehe ich genauso. Dann bleibt es also dabei. Übrigens, weißt du, wer sich angesagt hat?«
»Wart mal.« Bungert kniff die Augen zusammen. Während ihrer Unterhaltung war das Brummen stärker geworden, und jetzt sah er auch etwas. Hinter dem Friedhof stieg ein dunkler Gegenstand, eine Art Minihubschrauber, in die Höhe, um dann plötzlich Richtung Wald abzudrehen. Bungert ließ Rütsch einfach stehen und schritt zügig einmal um den Friedhof herum.
»Ach, du bist das«, sagte er unwirsch.
Der junge Kerl, der an der Friedhofsmauer lehnte, sah auf. Er trug eine Baseballkappe und weit geschnittene Shorts. In der Hand hielt er etwas, das entfernt an die Steuerung einer Playstation erinnerte.
»Was machst’n da?«, wollte Bungert wissen.
»Nix.«
»Mensch, Joris, red keinen Scheiß!« Es war immer das Gleiche, der Junge regte ihn auf mit seiner gespielten Bräsigkeit. Die reine Großstadtarroganz! »Du lässt hier eine Drohne fliegen.«
»Ja und?«
»Das darfst du nicht!«
»Hä? Ist das verboten? Seit wann?«
»Seit heute.«
»Warum denn? Hier gibt es doch nix zu spannen, und Flugzeuge kommen hier auch nie …«
»Das da«, schnitt ihm Bungert das Wort ab und zeigte zum Wald hinüber, den die Drohne eben erreichte, »ist ein Tatort. Da ist Kriminalpolizei zugange, da wird gearbeitet, und da hast du mit deinem Angebergerät nichts verloren.«
»Aber ich lasse es doch nur kurz drüberfliegen, und dann …«
»Lässt du nicht. Der Wald ist Sperrgebiet, heute und morgen auch noch. Hol das Ding sofort zurück.«
Joris zog eine Grimasse, in der mehr Verachtung als Ärger lag, gehorchte aber widerspruchslos. Bungert wartete, bis die Drohne vor den Füßen des Jungen gelandet war, danach ging er. Einen Schlusssatz konnte er sich allerdings nicht verkneifen.
»Im Ort lässt du das Ding nicht fliegen, verstanden? Nur außerhalb. Wenn ich dich damit erwische oder wenn sich jemand beschwert, landet es auf dem Müll.«
»Ist ja gut, Mann!«
Rüdiger Hastenteufel, der Rütsch, hat seinem Schulkameraden Alwin Bungert nicht mehr sagen können, wer zum Abitreffen am Freitag kommen wird. Als Bungert von seiner Begegnung mit Joris zurückkommt, ist Rütsch schon weitergegangen, nach Hause, in seine Wohnung, in der er so verdammt viel Zeit verbringt, seit er keine Arbeit mehr hat. Interessiert hätte Bungert schon, wer sich 30 Jahre nach Schulende in Dürrweiler blicken lässt, abgesehen von den üblichen Verdächtigen, die man ohnehin alle paar Wochen auf der Straße trifft. Wie den Rütsch zum Beispiel.
Der René jedenfalls, der wird nicht kommen. Wobei gerade das interessant gewesen wäre. Wie heute wohl einer ausschaut, den sie mal zum schönsten Schüler auf dem Gymi gewählt haben? Der schon in den Achtzigern ins Fitnessstudio gepilgert ist? Ob der immer noch dieses Lächeln aus der Zahnpastawerbung hätte, den Knackarsch, den kräftigen Händedruck?
Ein Strahlemann ist er gewesen, der René, immer schon. Sohn des Apothekers von Dürrweiler. Zuhause ordentlich Asche, zwei Autos, die der René auch gleich fahren durfte, sobald er 18 war. Ein Dialektwort ist dem René nie über die Lippen gekommen, wobei er nicht arrogant war, das nicht, höchstens so ein bisschen unbedarft. Ein wenig eindimensional, trotz seiner Dauerfröhlichkeit. Oder gerade deswegen. Ist ja nicht alles positiv im Leben.
Ja, der René. Während seine Schulfreunde, der Rütsch und der Bungert und viele andere, nach dem Abi ihren Grundwehrdienst leisten, fluchend und rotzend durchs Gelände robben, wird der René Berufssoldat. Verpflichtet sich für zehn Jahre. Wie der strahlt, der Kerl, als er den Bescheid bekommt. Marinefliegergeschwader 2, das kesselt, Leute! Sicher, es hat sich angedeutet, schon in der Schulzeit, wann war das, 12. Klasse vielleicht, als die gesamte Oberstufe frei bekam, um die große Bundeswehrausstellung drüben in Neunkirchen zu besuchen. Unsere Luftwaffe, Verteidigungs-PR vom Feinsten. Bei den Pazifisten unter den Schülern kam das natürlich nicht gut an, da wurde schon mal der Mittelfinger gestreckt. Den meisten war es egal irgendwie, Hauptsache, man konnte nach halbstündigem Pflichtschlendern noch ein Radler kippen. Statt Physikunterricht. Der René aber, der zieht von Zelt zu Zelt, quatscht mit den Offizieren, zeigt seine Blendamed-Fresse. Regelrecht angefixt ist der von den Waffen, von den Videos, von den Zukunftsaussichten. Dabei hat er mit Gewalt nichts am Hut, der René, überhaupt nicht, niemals würde der sich prügeln auf dem Schulhof oder beim Sport, der ist einfach nur überzeugt, dass Landesverteidigung eine gute Sache ist, nein, mehr als das, eine wichtige, absolut lebensnotwendige Sache, die Welt ist nun mal schlecht in Teilen, und hallo, sind die Russen nun in Afghanistan einmarschiert oder sind sie es nicht? Bei der Abifeier bekommt der René sogar einen Sonderpreis von der Schule, für außergewöhnliches Sozialverhalten. Weil er einen Mitschüler vorm Ertrinken gerettet hat.
Von so einem lässt man sich doch gern verteidigen, oder? Andererseits: Wer den René damals in Neunkirchen gesehen hat, beim Werberummel um die Luftwaffe, der hat merken können, dass da noch mehr dahintersteckt. Mehr als Verantwortung und Pflichtbewusstsein und wie die Vokabeln aus dem Reliunterricht alle heißen. Wenn der René sich in so ein Tornado-Cockpit setzt (die haben tatsächlich eins aufgebaut damals, war natürlich der Renner der Ausstellung), wenn er den Schaltknüppel umfasst, die Armaturen streichelt, wenn er aus den Fenstern schaut und die Welt zu seinen Füßen liegen sieht – dann schwingt da noch etwas anderes mit. Etwas Anarchisches, das aus dem Unterleib kommt oder aus sonst einer heiklen Körperregion, das zerstören und überwältigen will, wenigstens für die kurze Zeit eines Überschallflugs. Da erkennt man plötzlich, dass in René, dem Strahlemann, noch ein anderer René haust, der totale Gegenentwurf.
Aber vielleicht ist das unfair. Denn erstens geht es uns doch allen so, oder? Tagseite, Nachtseite, wer kennt das nicht? Und zweitens ist der René tot. Schon ziemlich lange ist er das.
Auf seinem letzten Flug – in Dürrweiler tritt gerade der Rütsch seinen neuen Job an, Alwin Bungert fährt Streife – ist eigentlich alles wie immer gewesen. Äußerlich. Der René gilt als erfahrener Pilot, einer der zuverlässigsten der Truppe. Kamikazeaktionen, wie mal eben unter der Kanalbrücke von Rendsburg durchbrettern, sind bei ihm tabu. Oder vorher ein paar Seconal einwerfen, wie es die Amis tun, weil man dann dicke Eier kriegt und die Welt im Flug in den Arsch fickt (sorry, Pilotensprech) – nee, Leute, nicht mit dem René. Start vom Fliegerhorst Eggebek, vorne der René, hinter ihm sein Co, blau wölbt sich der Himmel über ihnen, es ist Sommer, das Meer glitzert, und dann passiert etwas, was genau, wird man nie erfahren, denn der Tornado mit den beiden Männern darin verschwindet in der Ostsee, auf Nimmerwiedersehen. Er liegt immer noch dort unten, eine Bergung lohnt sich nicht. Den Schleudersitz haben die zwei nicht mehr auslösen können. Ging wohl alles sehr schnell.
Die Eltern vom René haben dann durchgesetzt, dass ihr Sohn ein Grab in Dürrweiler bekommt. Einen Gedenkstein, genauer gesagt, denn er selbst ruht ja auf dem Grund des Meeres. Aber wenigstens ist so sein Name nach Dürrweiler zurückgekehrt, die Erinnerung an ihn. Ein schöner Stein ist es geworden, schwarzgrau spiegelnd, und der steht nun, als sich Rütsch und Bungert über das Abijubiläum unterhalten, nur ein paar Meter entfernt hinter der Friedhofsmauer. Wie der René überhaupt nie ganz weg war. Auch wenn man nur noch selten an ihn gedacht hat.
Bungerts Finger brauchte zwei Anläufe, bis er den Knopf neben dem Namensschild Becker drückte. Das rasselnde Geräusch der Klingel war bis auf die Straße zu hören.
Eine ganze Weile tat sich nichts. Bungert wartete im Schatten des Vordachs, kontrollierte seine Achseln auf Schweißflecken, nickte einer Frau zu, die über den Gehsteig schlenderte, ohne ihn aus den Augen zu lassen. Von irgendwoher roch es nach Bratensoße. Dann endlich nahm er eine Bewegung hinter dem geriffelten Glas der Haustür wahr, die Tür wurde geöffnet.
»Hallo, Gudrun«, sagte er.
»Tag, Alwin.«
Jasmins Mutter streckte ihm die Hand hin. Sie trug ein leichtes Sommerkleid, das sogar eine Spur zu weit aufgeknöpft war, seinem Empfinden nach. Das Muttermal an ihrem Hals war jedenfalls nicht zu übersehen. Sie schien nicht geweint zu haben, ihre Züge waren hart, fast grimmig.
»Mein herzliches Beileid, Gudrun. Es ist furchtbar. Ich konnte es kaum glauben, als ich es gehört habe.«
Sie nickte. »Komm rein.«
Steif schritt er durch den Flur ins Wohnzimmer, das angenehm kühl und dämmrig war. Zum Schutz vor der Mittagssonne hatte Gudrun die Rollläden ein Stück heruntergelassen. Sie hängen auf Halbmast, schoss es ihm durch den Kopf.
»Magst du was trinken, Alwin? Bier, Apfelsaft?«
»Ein Wasser würde ich nehmen. Falls es keine Umstände …«
Die Frau war schon draußen.
Aufatmend ließ sich Bungert aufs Sofa fallen. Aber dann kam es ihm aus irgendeinem Grund unpassend vor, hier zu sitzen, und so stand er wieder auf, durchquerte den Raum und nahm drüben am Wohnzimmertisch Platz.
Gemessen an der Größe des Zimmers war der Tisch eher klein. Es standen auch nur drei Stühle daran. Genau so viele, wie Personen in dem Haus lebten.
Gelebt hatten, verbesserte sich Bungert. Hatten. Er fühlte, wie ihm der Schweiß ausbrach, trotz der Kühle hier drin.
Als die Tür zum Flur aufging, erhob er sich erneut, und zwar so hastig, dass es ihm kurz schummrig wurde. Unauffällig klammerte er sich am Tisch fest, bis der Schwindel nachließ. Gudruns Vater schloss die Tür hinter sich und kam ins Zimmer gehumpelt. Sein Gesichtsausdruck ähnelte dem seiner Tochter, allerdings hatte er schon immer eine gewisse Härte und Unbeweglichkeit zur Schau getragen.
»Tag, Erich«, sagte Bungert und streckte dem Mann die Hand hin. »Mensch, es tut mir so leid für euch.«
»Danke.« Gudruns Vater legte die Linke in Bungerts Hand und drückte sie kurz. Sein rechter Arm hing schlaff neben dem Oberkörper herab. Aus der Küche kam seine Tochter mit einer Flasche Wasser und einem Glas.
»Ich will euch nicht stören«, sagte Bungert. »Wenn es gerade nicht passt, bin ich sofort wieder weg. Ihr müsst ehrlich sein. Ich wollte euch bloß Hilfe anbieten, falls ihr welche braucht.«
»Sie sagen, es war Selbstmord«, fauchte der Alte.
»Sie?«
»Die Saarbrücker. Diese Kripoleute.«
»Setz dich doch, Alwin«, bat Gudrun.
Alle drei nahmen Platz. Die Frau schenkte dem Besucher Sprudel ein. Als sie die Flasche beiseitestellte, war es ein paar Sekunden so still, dass man das Platzen der Bläschen im Glas hörte. Erich griff mit der linken Hand nach der rechten und legte sie sich wie einen fremden Gegenstand in den Schoß.
»Wenn die in Saarbrücken von Suizid ausgehen, dann wird es Gründe dafür geben«, sagte Bungert, ohne den Mann anzublicken. »Trotzdem sollte man vorsichtig sein mit so einer frühen Festlegung.«
»Warum hat es gebrannt?«, fragte Jasmins Mutter. »Wer hat das Feuer gelegt?«
»Das ist alles noch ungeklärt. Ob es mit Absicht passierte oder versehentlich – die Kollegen sind dran.«
»Warst du dabei, als sie … als sie gefunden wurde?«
Der Polizist nickte. Eine Weile sprach niemand. Der Sprudel in Bungerts Glas perlte. Erst jetzt fiel ihm auf, dass an der Wand ein Porträt von Jasmin hing, ein großes, eher ungeschickt ausgeführtes Ölbild. Das hing bestimmt nicht erst seit heute hier. Ein Foto an der Wand gegenüber zeigte Jasmin im Konfirmationskleid, und auf einer Kommode standen weitere Fotos. Sie war Gudruns einziges Kind gewesen, Erichs einzige Enkelin.
Bungert spürte, wie sein Gaumen trocken wurde. Er nahm das Glas und trank es zur Hälfte leer. Dann sagte er: »Es ist schrecklich, wenn man nicht weiß, was da oben passiert ist. Aber die Kollegen werden es rauskriegen, das verspreche ich euch. Ihr müsst ihnen nur etwas Zeit geben, das soll ja alles hieb- und stichfest sein.«
»Ich wüsste nicht, warum sich meine Enkelin hätte umbringen sollen«, sagte Erich. Der Satz stand wie gemeißelt im Raum. Bungert suchte nach einer Entgegnung, doch der Mann sprach schon weiter. »Es gab keinen Grund, keinen. Wenn jemand so schlau ist, so begabt … sie hätte alles Mögliche werden können, du kanntest sie ja. So eine schmeißt doch nicht ihr ganzes Leben in einem Augenblick weg. Nicht die Jasmin.«
Bungert deutete ein Lächeln an. »Nun wart mal ab, was die Untersuchungen ergeben.«
»Wenn die es sich nicht zu einfach machen, Alwin. Selbstmord ist natürlich für alle die bequemste Lösung. Außer für die Verwandten, denn an denen bleibt es hängen. Weißt du, ich will nicht, dass sie im Ort mit dem Finger auf meine Tochter zeigen: Das ist die Mutter von der, die sich umgebracht hat. Du kennst doch die Leute. Jeder von denen meint, er wüsste ganz genau, warum und wieso. Und wer Schuld an der Sache hat. Das vor allem. Die Schuld, verstehst du?«
»Na ja.« Bungert starrte auf seine Hände. Als er vor dem Haus der Beckers stand, hatte er sich vor Tränen gefürchtet, vor einer Trauer, die keiner stillen konnte. Auf den Ton der Anklage war er nicht vorbereitet. »Ich weiß nicht, ob man in diesem Fall nach Schuld fragen sollte …«
»Es könnte doch auch einer oben gewesen sein. In der Nacht, bei der Jasmin. Einer, der das Feuer gelegt hat. Der ihr vielleicht was angetan hat. Ja, ja, ich weiß, das ist heutzutage nicht mehr opportun, so etwas zu unterstellen, da geht man immer nur vom Guten im Menschen aus. Aber es gibt auch die anderen. Ich weiß das, Alwin, ich weiß das.«
Bungert schwieg. Was blieb ihm auch übrig? Was erwiderte man einem Mann, dessen rechte Hand unfähig zur Bewegung auf den Oberschenkeln ruhte? Ihre Haut glänzte weiß oder eher farblos, wie die eines Fisches, die Fingernägel waren sauber geschnitten. Als Erich so alt war wie Bungert jetzt, hatte er sich längst umgestellt, von der rechten auf die linke Hand. Und Bungert fragte sich, wie komplett diese Umstellung gelungen war. Ob Erich zum Beispiel Gudrun und ihre Brüder irgendwann mit links geohrfeigt hatte. Das fragte sich Bungert, während er die Hand in Erichs Schoß betrachtete, und er schämte sich für diesen Gedanken.
Zum Glück ergriff jetzt Gudrun das Wort. »Wann dürfen wir sie beerdigen?«, fragte sie mit fester Stimme.
»Das können euch die Kollegen aus Saarbrücken sagen.« Bungert tastete nach dem Wasserglas. »Bitte habt Verständnis. Das muss ja untersucht werden, und zur Untersuchung gehört eben auch Jasmin.« Er zögerte. »Ihr Körper.«
Die Mutter sah ihn schweigend an. Dann stand sie auf und verließ das Wohnzimmer. In Bungert drängten die Bilder der gestrigen Nacht nach oben: das Feuer, die Einsatzkräfte, die verbrannte Mädchenleiche. Er setzte das Glas an und trank es in einem Zug aus. Neben ihm grummelte Gudruns Vater.
Schneller als erwartet war Gudrun wieder bei ihnen. In der Hand hielt sie einen durchsichtigen Plastikbeutel mit einem schwarzen Gegenstand darin. Sie legte den Beutel auf den Tisch und nahm Platz.
»Das hier«, begann sie. Dann versagte ihre Stimme. Sie schaute zur Seite und holte tief Luft.
Bungert zog den Beutel ein Stück zu sich heran. »Von Jasmin?«
»Ihr Tagebuch«, erklärte Erich. »Haben wir vorhin bekommen. Es steckte wohl in ihrer Hosentasche. Sonst hatte sie nichts bei sich.«
Vorsichtig nahm Bungert das Büchlein in die Hand. Es war so verkohlt, dass er fürchtete, es würde zu Asche zerfallen, wenn er fest zupackte. Vielleicht hatten sich im Inneren ein paar Seiten erhalten, Einträge, Notizen. Ja, die Versuchung war groß, das Buch aufzuschlagen und nach einer Erklärung für gestern zu suchen. Aber die Krümel und Brösel, die sich bei jeder Berührung lösten, hielten ihn davon ab.
Gudrun räusperte sich. »Du könntest mir einen Gefallen tun, Alwin.«
»Ja?«
»Schaust du nach, ob was Wichtiges drinsteht? Wichtig für mich, meine ich. Oder für die Ermittlungen.« Ihre Stimme war wieder so fest wie zuvor.
»Ich kann’s versuchen«, nickte Bungert. »Wobei ich bezweifle, dass da noch viel …« Er kratzte sich über den Handrücken. »Es ist das Tagebuch deiner Tochter. Willst du nicht selbst …?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich kann das nicht.«
Er schwieg.
»Ich kann nicht«, wiederholte sie.
Bungerts Blick fiel auf das Ölbild an der Wand. Es musste vor zwei, drei Jahren gemalt worden sein: die Verstorbene als junge Frau. An der Schwelle zum Erwachsenensein. Der verschlossene Zug rund um Jasmins Mund war ganz gut getroffen. Anderes eher geschönt: die Augen, die Ruhe in ihrem Blick, das Ebenmäßige ihres Gesichts. Und das Muttermal an ihrem Hals war wie hinweggezaubert.
Franziskas Rückkehr nach Dürrweiler begann mit einem kleinen, unscheinbaren Geräusch. Mit dem trockenen Laut, der entstand, als sie ihren Koffer auf dem Bürgersteig gegenüber der Krone abstellte. Alle übrigen Geräusche hatten noch zur Phase des Ankommens gehört: das Aussteigen aus dem Taxi, das Öffnen und Schließen der Türen, des Kofferraums, die Verabschiedung vom Fahrer, das erneute Türenknallen. Sie wartete, bis der Wagen gewendet hatte und außer Sicht war, erst dann stellte sie den Koffer ab.
Jetzt also. Sie war zurück.
Ohne nachzudenken, warum oder für wen sie das tat, suchte sie in ihrer Handtasche nach dem Lippenstift. Während sie sich die Lippen nachzog, musterte sie das Haus auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Es kam ihr kleiner vor, als sie es in Erinnerung hatte. Außerdem war es frisch renoviert: grellweißer Anstrich, sandsteinrote Fenstereinfassungen, und oben auf dem neu eingedeckten Dach glitzerten Solarmodule. Zum Eingang, der immer noch etwas erhöht lag, führte nun eine zusätzliche Rampe für Rollstuhlfahrer. Nur die Ausstrahlung des Hauses war die alte, dieses Geduckte, Verschlossene, trotz der drei Stockwerke und der vielen Fenster. Wahrscheinlich hätte man es abreißen müssen, um ihm neues Leben einzuhauchen. So wirkte die Krone bloß wie eine alte, geschminkte Frau.
›Wie ich‹, dachte Franziska. Sie steckte ihren Lippenstift wieder ein, packte den Koffer und überquerte die Straße. Cityhotel Krone stand auf einem Kunststoffschild, das fast die gesamte Breite der Fassade einnahm. Cityhotel – war das noch dreist oder schon wieder rührend? Vielleicht eine spezielle Art saarländischer Ironie. Als Franziska in Dürrweiler gelebt hatte, war die Krone Gasthaus gewesen, Mittelpunkt des Dorfes, eine Kneipe mit großem Saal. Gut, es gab ein paar Zimmer, in denen manchmal LKW-Fahrer und Arbeiter auf Montage übernachteten, doch auf die Bezeichnung des Hauses hatte das keine Auswirkung. Jetzt war der Hotelbetrieb wiedererstanden, aus den Trümmern der Renovierung gewissermaßen. Dafür hatte man die Kneipe eingespart. War ja auch kein Wunder, überall ging der Bierkonsum zurück. Sogar in Dürrweiler.
Und noch etwas fehlte im Cityhotel Krone: die Rezeption. Es gab lediglich einen Automaten im Foyer, der nach Empfang der Mastercard und Eingabe des zuvor übermittelten Codes eine Zimmerkarte auswarf. Die sanfte Automatenstimme, die einen durch das Labyrinth der Aktionen führte, erinnerte Franziska an jemanden, doch sie kam nicht drauf, an wen. Vielleicht verspürte sie auch bloß den Wunsch nach einem Verbündeten. Im Hotelflur war es still, der Teppichboden schluckte jedes Geräusch. Beim ersten Versuch, die Zimmertür zu öffnen, streikte Franziskas Karte. Falsche Zimmernummer? Chip defekt? Nein, bei der Wiederholung klappte es. Irrationalität der Technik.
Die Einrichtung so praktisch wie unpersönlich. Doppelbett, Flachbildschirm an der Wand, eine Flasche Wasser zur Begrüßung auf dem Tisch. Die Stille, irgendwie gespenstisch. Immerhin war das Zimmer größer als gedacht, man stieß sich beim Herumgehen nicht dauernd die Schienbeine an. Neben dem Telefon die Nummer für Notfälle. Ihren Frühstückswunsch hatte Franziska auf Band zu sprechen.
Nun gut, das war jetzt also das Dürrweiler von heute. Sie hatte die Veränderungen ja schon vom Taxi aus registriert. Oder besser: einen Teil der Veränderungen, das Offensichtliche, das auch dem flüchtigen Betrachter auffiel. Gleich am Ortseingang eine neue Tankstelle, der Zehnerpack Brötchen zum Schleuderpreis. Kurz dahinter ein Nagelstudio. Vor der katholischen Kirche der aufgehübschte Marktplatz, Naturstein und eingezäunte Bäumchen statt roter Erde und Riesenpfützen. Wo früher das Geisterhaus war, eine sich selbst überlassene Jugendstilvilla mit großem, verwunschenem Garten, stand jetzt ein mehrstöckiges Bürogebäude, und noch aus der Distanz von 30 Jahren hatte es Franziska einen Stich versetzt. So marode und unansehnlich die alte Villa auch gewesen war, die Würdelosigkeit des heutigen Baus hatte sie nie besessen.
Das Bett war okay. Der Fernseher funktionierte. Klimaanlage, W-Lan, alles da. Objektiv gesehen, ließ sich das Facelifting der Krone nur als gelungen bezeichnen. Aber wie objektiv war Franziska?