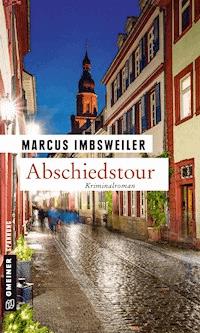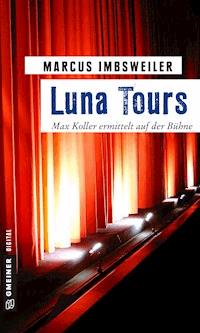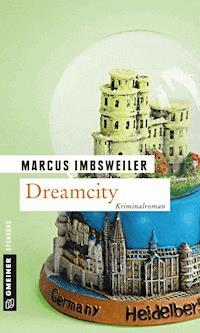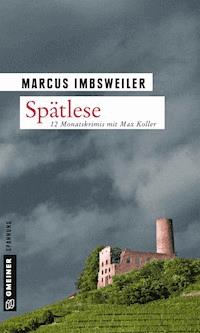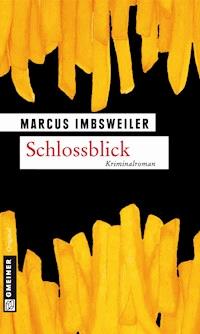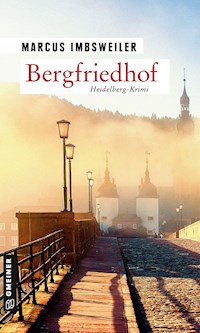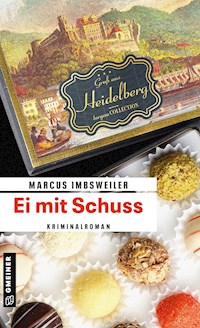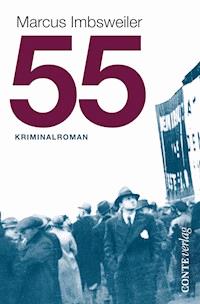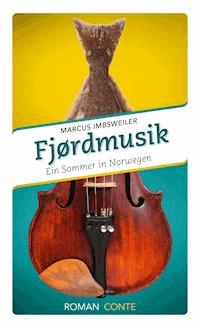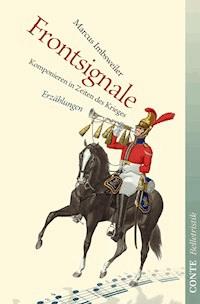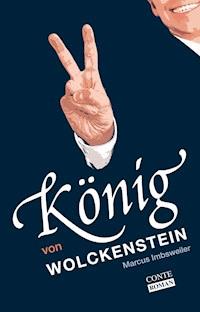
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Conte Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Wolckenstein-Chronik
- Sprache: Deutsch
Mal einen Schnaps zuviel, schon ist man Bürgermeister! Theo Tonseidel hat eine Versicherungsagentur. Und einen schlechten Tag gehabt. Doch die drei Feierabendschnäpse könnten ihn den Führerschein kosten. Zum Glück kennt man ja den Orts-Sheriff noch aus der Schule. Als Gegenleistung könnte er sich doch etwas politisch engagieren, meint der. Das hatte Tonseidel eigentlich überhaupt nicht im Sinn gehabt. Doch einmal mittendrin, geht's wie von selbst. In einer Ansprache trifft er, aus dem Augenblick formulierend, offenbar genau die Durchschnittsmeinung, die politische Mitte. Unter den verwunderten Augen seiner Frau Gabi, einer Ärztin im örtlichen Krankenhaus, dem Spott seines frühreifen Sohnes Tom, der Bewunderung seiner Tochter Mira und den Beschimpfungen seines sozialdemokratischen Vaters beginnt sein Aufstieg. In einem 70-seitigen Showdown bietet der vom örtlichen Großunternehmer Junkerath in seiner Industriellenvilla alljährlich ausgerichtete Wolckensteiner Abend die Kulisse für die Zusammenführung der kunstvoll angesponnenen Fäden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 743
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erster TeilBerufung
Wolckenstein ist in keinem Atlas zu finden.
Wer Wolckenstein sucht, braucht eine Karte von solcher Liebe zum Detail, dass dort auch das Lückenhafte, zu klein Geratene seinen Platz hat: Schönheiten, die sich jenseits des Augenfälligen erstrecken, verborgene Schätze, geheime Orte. Niemand kennt solche Karten. Gäbe es sie, würde Wolckenstein als tiefroter Punkt auf grünem Grund aufleuchten und eine knappe Legende uns belehren: W., bescheidener Marktflecken im Schatten eines deutschen Mittelgebirges, erstmals erwähnt im Jahre 1012, fünfzehntausend Einwohner unter schiefergedeckten Dächern, zerstört im Dreißigjährigen Krieg, entvölkert im 19. Jahrhundert (noch heute leben in North Carolina Nachfahren ausgewanderter Wolckensteiner, steinreich und ungebildet), gegen Ende des Zweiten Weltkriegs für wenige Wochen Schauplatz sinnloser Scharmützel, niedrige Kriminalitätsrate, durchschnittlicher Ausländeranteil, Arbeitslosigkeit steigend. Stammsitz der 1881 gegründeten Walter Junkerath GmbH, landesweit einer der größten Produzenten von Zinnfiguren. An der Spitze Wolckensteins ein gleichermaßen dicker wie beliebter Bürgermeister samt seiner mit absoluter Mehrheit regierenden Partei; außerdem eine in den sechziger Jahren erfolgreiche Fußballmannschaft, ein vielgelesenes Lokalblatt, ein nagelneuer Zubringer zur vierspurigen Bundesstraße 3.
Kein Grund also, dem Städtchen den fälligen Vermerk auf einer Karte zu verweigern. Und doch gibt es einen, wie es immer Gründe gibt, wenn sich das Zentrum an der Peripherie, die Metropole an der Provinz, der Fortschritt an der Reaktion rächen will. Nur Träumer glauben, dass Landkarten die Realität abbildeten. Naive, Unbelehrbare! Landkarten sind Sklaven des Zeitgeistes, in ihnen gerinnen die Vorurteile derer, die sie zeichnen, zum Gesetz. Wählerisch sind sie, ungerecht, so wählerisch und ungerecht wie wir selbst. Fort mit dem Mittelmaß, dem Abseitigen, dem Unzeitgemäßen! – das ist ihre Devise, und ihr unterliegt auch unsere Stadt. Denn Wolckenstein, es muss gesagt werden, ist kein weltoffener Ort, liegt versteckt, fast verschämt jenseits waldreicher Hügelkämme im Wurmfortsatz eines bedeutungslosen Bundeslandes, wie geschaffen, um von kettenrauchenden Kartographen und Landvermessern übersehen zu werden. Sie buckeln sich, so lästern prosperierende Nachbarn gerne über die mundfaulen Einwohner der Stadt und ihre sprichwörtliche Fähigkeit, im Schutz abweisender Schieferdächer noch jede Attacke der Gegenwart zu überstehen. Weiter hat Wolckenstein, auch dies ist leider richtig, an Sehenswürdigkeiten – »lohnt einen Umweg«, heißt es im Jargon der Kulturführer – kaum etwas zu bieten. Reste einer mittelalterlichen Raubritterburg, verfallen. Eine schmale Pfarrkirche aus dem 18. Jahrhundert, lutherisch. Im Rathaus jene angerostete Kanonenkugel, auf der einst Baron Münchhausen geritten sein soll. Und natürlich das hässliche, in all seiner Hässlichkeit gleichwohl beeindruckende Granitdenkmal für Rupert von Greiffen im Rupert-von-Greiffen-Park. Nichts, was einen Baedeker-Stern verdiente. Eine Handvoll windschiefer Fachwerkbauten, ein neues Veranstaltungszentrum, jede Menge Kneipen, Hallenbad und Krankenhaus. Industrie? Wenig. Die bereits erwähnte Walter Junkerath GmbH am Stadtrand, Stammsitz des Zinnsoldatenkönigs Junkerath, auf deren Gelände auch ein kleines Heimatmuseum eingerichtet ist. Kleine Allerweltsansiedlungen aus Bau- und Holzbranche, Supermärkte und Discounter. Östlich der Stadt die klaffende Wunde eines stillgelegten Steinbruchs. Fast wäre Goethe einmal im Ritterkrug eingekehrt, aber die Wolckensteiner Betten waren ihm zu hart. Selbst die Pest des 14. Jahrhunderts verschonte den Ort. Und als vor einigen Jahren der amerikanische Botschafter auf dem Marktplatz eine Gedenktafel zu Ehren gefallener Weltkriegssoldaten enthüllen wollte, verfuhr sich sein Chauffeur trotz nagelneuen GPS-Navigationssystems in den dichten Wäldern des Landes. Unverrichteter Dinge kehrte der Tross nach Berlin zurück.
Dennoch lohnt es sich, einen Blick auf diesen Ort zu werfen. Denn Wolckenstein ist die Heimat eines unserer bekanntesten und beliebtesten Politiker; eines Politikers, dessen denkwürdige Karriere mit ein paar Gläschen zu viel begann.
Vierundvierzig Jahre zählte Theobald W. Tonseidel damals, Jahre, auf die er voll milden Stolzes zurückblickte, obwohl sie keine herausragenden Leistungen enthielten. Er war in einem Alter, in dem andere Männer unruhig werden, als stünde eine wichtige Entscheidung bevor, als müssten sie plötzlich ihr Leben in Frage stellen oder ihm wenigstens eine neue Wendung geben. Theo verspürte keine Unruhe, im Gegenteil. Er war zufrieden. Ein Verfechter von Gewohnheiten, von rundgeschliffenen Ritualen, ein grundsätzlich zuversichtlicher, wenn auch zum Zögern neigender Zeitgenosse, der mit den meisten seiner Mitmenschen gut auskam, denn das gehörte zu seinem Beruf. Er arbeitete für einen weltweit agierenden Versicherungskonzern: das freundliche Gesicht der Globalisierung, Wolckensteiner von Geburt an, ein Mann, der sich nicht vorstellen konnte, an einem anderen Ort dieser Erde zu leben. Seine Kinder besuchten das örtliche Gymnasium, seine Frau war Ärztin im Kreiskrankenhaus, und von der Heckklappe seines Wagens grüßte das Stadtwappen den Rest der Welt. Der ihn im Übrigen nicht weiter interessierte. Auch wenn Theo Tonseidel kein Genussmensch war, liebte er es doch, sich am Abend zurücklehnen zu können und sich über nichts Gedanken machen zu müssen. Was dann noch drückte, was dann noch knirschte, wurde weich und fiel ab, und zur Not konnte man dem mit einem Gläschen Wein oder dem Griff zur Fernbedienung nachhelfen. Im Prinzip war Theo mit der Einrichtung des Lebens, speziell seines Lebens, einverstanden. Über etwaige Misshelligkeiten blickte er großzügig hinweg: wenn beispielsweise seine natürliche Vorrangstellung als Familienoberhaupt unterhöhlt wurde – was die Regel war – oder ihn berufliche Rückschläge ereilten. Letzteres kam selten vor, doch an einem gewissen Abend im April traf es ihn gleich doppelt und mit unvorhersehbaren Folgen.
An diesem Aprilabend, am Ende eines langen Arbeitstages, der Theo Tonseidel gleich zweimal nach Schnabelberg, nach Bernbach und sogar bis hinter Schnarrenfurt geführt hatte, wurde er eingangs der Stadt von zwei Polizisten angehalten. Groß war seine Überraschung: Seit wann fanden in Wolckenstein Verkehrskontrollen statt? Und wozu? Niemandem gelang es, in den verwinkelten Straßen zu schnell zu fahren, selbst wenn man es versuchte. Und sollte die Stadtverwaltung einmal gegen Parksünder im historischen Zentrum vorgehen, bat sie hierfür per Wolckensteiner Echo ausführlich um Nachsicht.
So berechtigt also Theos Überraschung war, so rasch wich sie einer anderen Empfindung: Panik. Es war nicht die plötzliche Angstattacke des braven Bürgers, der sich ohne jeden Anlass gegenüber der Ordnungsmacht rechtfertigen zu müssen glaubt, sondern jene kalte Furcht, die den jungen Haschischschmuggler an der holländisch-deutschen Grenze befällt, sobald er die Uniform eines Zollbeamten zu Gesicht bekommt. Wohin mit dem Päckchen? dröhnt es in seinem Kopf. Unter die Sitze? Aus dem Fenster? Wohin damit?
Theo Tonseidels Lage war noch ein wenig vertrackter, denn eine Alkoholfahne ließ sich weder unter den Sitzen verbergen noch aus dem Fenster befördern. Man konnte höchstens um Verständnis werben. An diesem Tag nämlich hatte der Versicherungsvertreter Theo Tonseidel keinen einzigen Neukunden gewonnen, es war ihm nicht einmal gelungen, eine alte Police nachzubessern. Einer seiner treuesten Kunden, der Rektor der Grundschule Bernbach, hatte ihn minutiös sämtliche Varianten einer privaten Standard-Feuerversicherung anhand von klassischen und weniger klassischen Fallbeispielen erklären, oder sollte man sagen: durchdeklinieren lassen, um ihm am Ende wie einem Prüfling zu verkünden, tut mir Leid, Theo, ich hab’s mir überlegt, aber vielleicht brennt’s ja doch woanders. Als er das sagte, saß der Rektor in Sichtweite eines Schwarzweiß-Fernsehers aus den siebziger Jahren, wie prädestiniert für einen Schmorbrand. Na denn, alles Gute, hatte Theo entgegnet und das Gegenteil gedacht. Brühwarm erzählte er seinem nächsten Kunden, einem Landwirt aus Schnabelberg, von dieser erfolglosen Grammatikstunde. Der Landwirt hasste Lehrer, das war allgemein bekannt, und er tröstete seinen Gast mit einem Selbstgebrannten. Gemeinsam lästerten sie, gemeinsam tranken sie, und als Theo nach dem dritten Glas wieder zufrieden dreinschaute, eröffnete ihm selbiger Landwirt, dass er zum Jahresende sämtliche Versicherungspolicen kündigen werde.
»Sämtliche?«, hatte Theo gerufen. »Du meinst, alle?«
»Ich wandere aus, Tonseidel. Dorthin, wo der Landwirt noch was zählt. Irgendwann reicht es.«
»Du haust einfach ab?«
»Wollte schon immer Schafe scheren. Und welche Versicherungen man in Australien braucht, werde ich sehen. Noch ein Schlückchen, Tonseidel?«
Nach diesem Schema war der ganze, vermaledeite Tag verlaufen. Theo hatte geredet und argumentiert – umsonst. In Schnarrenfurt war er an zögerliche Hausfrauen geraten, in Bernbach an argwöhnische Rentner: Menschen, denen die Phantasie fehlte, sich die überall lauernden Gefahren des Alltags auszumalen.
Wirklich überall? Womöglich war Wolckenstein ein zu sicherer Ort, es gab zu wenig Einbrüche, zu wenig Unfälle, zu wenig Wasserschäden. Nicht einmal Theos attraktive Werbegeschenke, Sportmützen und Gelenkschoner, funktionierten als Lockmittel. Und so endete dieser vertane Tag fast zwangsläufig in einem Landgasthof an der Straße nach Schnabelberg, an dessen Theke Theo Tonseidel seine Bitternis mit Kampfeslust, Verachtung und Wodka hinunterspülte.
Das also war die Lage.
Theo steuerte seinen Wagen vorsichtig nach rechts auf einen Parkplatz, stellte den Motor ab und wartete. Vom Rückspiegel baumelte ein großer roter Glückskäfer aus Schokolade. Wie viel er getrunken hatte, wusste er nicht. Um es zu wissen, hatte er zu viel getrunken. Das letzte, woran er sich deutlich erinnern konnte, war sein jäh gehemmter Urinierdrang, als er sich nach dem Verlassen des Gasthofs in den Schatten einer Litfaßsäule gestellt hatte. Er konnte nicht pinkeln, weil der Bürgermeister von Wolckenstein und die Kaiserin von Eschnapur ihm von großen Plakaten aus zusahen – ein zugegebenermaßen bizarres Zusammentreffen, über dessen Sinn oder Unsinn Theo sich zunächst keine Gedanken machte. Rechts oben lächelte der Bürgermeister in seiner feisten Jovialität, links bleckte die orientalische Schönheit eine weiße Zahnreihe. Unter den beiden stand Theo Tonseidel und fühlte sich beobachtet. Von einem Wolckensteiner und einer Asiatin. So wurde es nichts mit dem Wasserlassen. Seufzend suchte er sich einen einsamen Buchenstamm außer Sichtweite. Auf dem Rückweg aber zückte er einen Filzstift (noch so ein Werbegeschenk) und verpasste dem grinsenden Politiker einen Schnurrbart. Das Nachbarplakat verschonte er, um nicht als ausländerfeindlich zu gelten.
Die Kaiserin von Eschnapur … Manchmal kamen ihm Zweifel, ob die Menschheit tatsächlich die bestmögliche aller Welten bewohnte.
Käsig und bleich wie der Vollmond schob sich das Gesicht eines Polizeibeamten vors Seitenfenster. Theo kurbelte die Scheibe herunter und nickte in die laue Abendluft.
»Verkehrskontrolle«, sagte der Beamte. »Ihren Führerschein bitte.«
»Guten Abend.«
»Und die Fahrzeugpapiere.«
»Natürlich. Einen Moment.«
Theo begann zu suchen, wie so viele vor ihm gesucht hatten. In seiner Sakkoinnentasche. In seiner Sakkoaußentasche. In sämtlichen Hosentaschen und dann sogar hinter der Sonnenblende. Währenddessen warf er dem Polizisten vorwurfsvolle Blicke zu.
Der Polizist verzog keine Miene. Wenn man nach seiner Meinung fragte (was keiner tat), so war dieser Einsatz überflüssig wie ein Kropf, aber was sollte man machen. Dem Mann im dunkelblauen Golf hätte er auf den Kopf zusagen können, dass er nicht nach seinem Führerschein, sondern nach einer geeigneten Ausrede suchte. Wenn er etwas hasste, dann diese Art von Zeitschinderei. Seiner Ansicht nach (die aber, wie erwähnt, keinen interessierte) sollten die Leute einfach zugeben, dass sie ohne Lappen unterwegs waren, und dann würde ohnehin passieren, was passieren musste. Wie es eben so passierte. Nur bitte keine Ausflüchte und keine langatmigen Entschuldigungen.
Der Polizist machte ein paar gelangweilte Schritte zum Heck des Golfs und ließ seine Blicke über Nummernschild und Rücklichter schweifen, dann kehrte er wieder zu seinem Ausgangspunkt zurück. Zwei Aufkleber waren auf der Kofferraumklappe angebracht, ein Stadtwappen und das grüne Emblem von Werder Bremen. (Muss das sein, Tom?, hatte Theo seinen Sohn gefragt. Klar muss das sein, Papa. Denk doch mal, Werder Bremen!) Der Polizist war seit Jahren Fan von Borussia Dortmund. Aber das beeinflusste sein Verhalten gegenüber dem Verkehrsteilnehmer nicht, zu groß war seine berufliche Routine.
Er beugte sich wieder hinunter zu Theo Tonseidel.
»Kein Führerschein?«
»Was? Doch, doch. Meine Frau muss ihn … Ein Sekündchen bitte.«
Im Hintergrund tauchte ein zweiter Polizist auf, den Theo vom Sehen kannte. Feller hieß der junge Mann, oder Faller. Kein Kunde, aber der Sohn eines Kunden.
»Haben Sie etwas getrunken, bevor Sie sich ans Steuer gesetzt haben?«, fragte der Beamte mit dem Vollmondgesicht.
»Absolut nicht. Warten Sie, einen Moment, gleich habe ich ihn.« Wenn man nur sorgfältig genug im Handschuhfach kramte, dann musste doch irgendwann …
»Würden Sie bitte aussteigen und uns Ihre Fahrtüchtigkeit überprüfen lassen?«
Theo erstarrte. »Fahrtüchtigkeit? Wieso das denn?«
»Bitteschön, der Herr.«
»Ich bin fahrtüchtig. Das sieht man doch. Habe ich diese Parklücke getroffen oder nicht?«
Der Polizist schwieg. Er war die Neutralität in Person. Das fiel ihm nicht leicht, schließlich stand Bremen in der Bundesliga weit vor Dortmund.
»Hören Sie«, versuchte es Theo ein letztes Mal, »ich habe einen anstrengenden Arbeitstag hinter mir, da gab es überhaupt keine Gelegenheit, einen zu bechern. Fragen Sie Ihren Kollegen, der müsste mich kennen.« Er winkte dem anderen. »Hallo, Sie! Sie sind doch der junge Feller, nicht wahr? Ihr Vater ist bei mir versichert. Tonseidel mein Name. Könnten Sie nicht Ihrem Kollegen …?«
Keine Reaktion. Hieß wohl doch Faller, der junge Feller.
Fallers Kollege öffnete die Fahrertür. »Wären Sie jetzt so freundlich?«
Kreidebleich stieg Theo aus. Was war er bloß für ein Idiot … Diese Peinlichkeit! Diese Demütigung!
Auch seine Frau schimpfte ihn einen Idioten. Wortwörtlich! Als sei sie neuerdings in der Lage, Gedanken zu lesen. Und das Schlimmste: Er wagte nicht einmal zu widersprechen. Im Grunde hatte sie recht, da biss keine Maus und so weiter, außerdem war er seit einer Stunde nicht bloß ein Idiot, sondern ein führerscheinloser Idiot – und dennoch! Konnte er nicht trotz alledem … wie sollte er es ausdrücken? Durfte ein Mann seines Schlages … in dieser Situation … in einer Art Notlage … na? Wenn man die Sache mit etwas Abstand betrachtete, bestand die Welt nicht zu hundert Prozent aus korrektem Fahrverhalten und anderen Heldentaten, aus Wahrheiten und richtigen Lösungen; es gab auch das Gegenteil davon, das ganz Andere: verzeihliche Irrtümer und Zufälle aller Art. Die Geschichte war voller Fehlurteile und Fehlentscheidungen, und trotzdem drehte sich die Erde nach wie vor. Manchmal regnete es tagelang, jeder ärgerte sich, aber wem sollte man einen Vorwurf machen? Und nicht einmal die Politiker mit ihrem ganzen Atomwaffenquatsch und den Kindergeldkürzungen hatten es geschafft, eine Stadt wie Wolckenstein kaputt zu wirtschaften oder an die Amerikaner zu verkaufen.
Was er damit sagen wollte?
Ganz einfach: Man sollte das alles nicht so eng sehen, fand Theo Tonseidel. Nachsicht walten lassen. Er war ein vielbeschäftigter Mann, Familienoberhaupt, Ernährer seiner Lieben: Durfte er nach einem derartigen Missgeschick nicht auf ein bisschen partnerschaftliches Mitleid hoffen? (Dabei unterschlug Theo, dass er dem klassischen Bild eines Oberhauptes keineswegs entsprach und sich die Aufgabe des Ernährens mit seiner Frau Gabi redlich teilte.) Nein? Nun, es war ja nur eine Frage. Und Theo Tonseidel wagte sie nicht einmal laut zu stellen. Lieber seufzte er still vor sich hin. Ein Taxi hatte ihn nach Hause gebracht, und bei dem Fahrer hatte er ein Pfefferminzbonbon geschnorrt.
»Wieso ist Papa ein Idiot?«, erkundigte sich seine Tochter.
»Das soll er dir schön selbst erklären, Mira«, sagte ihre Mutter und setzte sich, um in einer großformatigen Zeitschrift mit Neuigkeiten aus der Welt der Ärzte zu blättern. Auch wenn das beiläufig, geradezu desinteressiert geschah, war es eine Geste mit Symbolkraft. Eine Demonstration! Ich arbeite, verlautete diese Geste; ich kenne meine Pflichten, selbst wenn ich es mir auf dem Sofa bequem mache.
»Wieso bist du ein Idiot, Papa?«
»Weil ich nicht genug Geld dabei hatte, um die Polizisten zu bestechen«, antwortete Theo, der sich unerträglich nüchtern fühlte. »Und weil ich mich nicht getraut habe, ihnen mit Kleingeld zu kommen.«
»Wärst du in der Lage gewesen, die Münzen zu zählen?«, murmelte seine Frau. Schien eine spannende Lektüre zu sein, diese Medizinerpostille.
»Ich hätte dir Geld leihen können«, sagte Mira. »Ich habe gespart. Für Notfälle. Nicht für Zigaretten wie Tom, dieser Depp.«
»Zigaretten?«, rief Theo.
»Eine Schachtel hat er sich schon gekauft. Ich hab’s gesehen, ehrlich.« Dass es eine Schachtel Schokoladenzigaretten war, ging keinen etwas an.
»Hast du das gehört, Gabi? Tom und Zigaretten!«
»Ich höre vor allem, wie jemand ablenken möchte. Erzähl deiner Tochter endlich, weshalb man dir den Führerschein abgenommen hat.«
»Könnte ich dabei wenigstens etwas zu essen haben?« Theo überkam Müdigkeit, bleierne Müdigkeit.
»Schau in die Mikrowelle«, schlug die Mutter seiner Kinder vor. »Falls du ihre Umrisse erkennst. Und falls du dich erinnerst, wie sie funktioniert.«
Mira folgte ihrem Vater in die Küche, wo sie ihm die Mikrowelle zu bedienen half (erst die Zeit einstellen, Papa!) und Generalabsolution erteilte (wir machen alle mal Fehler, Papa!). Für beides war er ihr dankbar. Wenigstens eine Verbündete hatte er in dieser Familie.
»Wenn man gestanden hat, fühlt man sich hinterher besser«, erklärte Mira. »Sagt Frau Hollerieth. Und die Strafe fällt dann auch milder aus.«
»Recht hat sie, deine Lehrerin«, sagte Theo. »Bloß dass es da nicht viel zu gestehen gibt. Was habe ich getan? Auf dem Rückweg zu euch nach Hause habe ich ein Gläschen … Moment: zwei Gläschen Wodka getrunken, weil ich von der Arbeit so erschöpft war. Und weil ich meine Familie den ganzen Tag vermisst habe. Verstehst du das?«
»Ohne dumme Ausflüchte wirkt ein Geständnis echter. Sagt …«
»Sagt Frau Hollerieth, ich weiß. Natürlich, ich hätte auf die zwei Gläschen verzichten sollen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich fahruntüchtig gewesen wäre. Du hättest mich einparken sehen sollen auf diesem blöden Parkplatz: rechts, links, lehrbuchmäßig. Nein, ich habe bloß ein schlechtes Gewissen, weil ich euch ein Vorbild sein möchte.«
»Warst du aber nicht, meint Mama.«
»Nein, war ich nicht. Mama hat Recht. Aber Mama hat auch schon Fehler gemacht.«
»Stimmt.« Die Mikrowelle gab einen Klingelton von sich. »Welchen denn?«
Theo zuckte die Achseln.
Nachdem er Mira zu Bett geschickt hatte, band er seine Krawatte ab, betrachtete sie prüfend und hängte sie sorgfältig zu den anderen in seine Hälfte des Kleiderschranks. Zweitoberste Reihe, dort wo die helleren, freundlich gemusterten hingen. Vielleicht hätte ihn eine der dunkleren, die Seriosität ausstrahlten, vor der heutigen Blamage bewahrt? Oder die Hüter des Gesetzes wenigstens zur Milde bewogen? Er seufzte. Man konnte noch so viele Krawatten besitzen, es waren beileibe nicht genug, um in den Fährnissen des Lebens zu bestehen.
Unzufrieden setzte er sich zu Gabi vor den Fernseher. Und anzusehen, was sie sich ansah, machte ihn nicht zufriedener. Was hatte sie eingeschaltet? Eine Krankenhaus-Soap, natürlich. In seinen Fingern kribbelte es. Da arbeitete seine Frau in der Ambulanz, nur um in ihrer Freizeit medizinische Fachblätter zu lesen, bevor sie sich bei einer Arztserie entspannte. Wenn es CDs mit Krankenhausmusik gäbe, Gabi besäße sie alle. Er räusperte sich missgelaunt. Seine Frau war ein grauenhaft perfekter Mensch, und ihm entzog man den Führerschein. Morgen würde er – zu Fuß natürlich – zum nächsten Kiosk spazieren und ihr einen dicken Arztroman kaufen. Als Entschuldigung. Oder als Strafe?
»Ich höre.«
»Was?«, sagte er verwirrt.
»Du hast dich geräuspert. Ich nehme an, das hieß: Schatz, du weißt doch, ich hatte einen anstrengenden Tag, da kann es schon mal vorkommen, dass man einen über den Durst trinkt.«
»Heißt es nicht.«
»Sondern?«
»Könntest du meinen Wagen morgen von diesem Parkplatz abholen?«
»Was war eigentlich der Zweck der Wodkavernichtung? Wolltest du ins Guinness-Buch der Rekorde?«
Er spielte mit der Fernbedienung und stellte versehentlich den Ton lauter.
»Glaub bloß nicht, dass ich dich nun herumkutschiere, Theo. Fahrrad fahren wird dir gut tun.«
»Im Anzug vielleicht?«, sagte er ärgerlich. »Das wird Eindruck bei meinen Kunden machen.«
Sie hob abwehrend die Hände. »Mein lieber Gatte, wie du vielleicht festgestellt hast, mache ich dir wegen deines hochprozentigen Missgeschicks nicht einmal Vorwürfe. Das ist deine Sache. Nur erwarte nicht, dass ich dir deswegen die Füße küsse.«
Er brummte ungehalten und dachte an das käsige Mondgesicht des Polizisten, der ihm den Abend versaut hatte. Was für eine Beamtenseele! Ein eiskalter Apparatschik, garantiert unterversichert. Aus Wolckenstein war der nicht.
Amüsieren würde sich nur einer über die dumme Geschichte: sein Sohn Tom.
»Ich gehe schlafen«, murmelte er, trat zu Gabi und beugte sich über sie.
»Mein Gott, Theo«, sagte sie und wich seinem Kuss aus. »Hast du in Wodka gebadet?«
»Tja, was soll man da machen, Theo? Da kann man im Grunde nichts machen. Das geht jetzt den gesetzlich vorgeschriebenen Weg.«
Rainer Schaffrath, der Polizeiobermeister von Wolckenstein, saß in einem Lehnstuhl, wie immer gut gepolstert, was weniger an der Sitzfläche des Stuhls lag als an der bequemen Fülle seiner Hüften. Er stützte den rechten Ellbogen auf die Stuhllehne und leckte angelegentlich über eine Daumenkuppe, wie das so seine Art war. Offensichtlich eine Folge seiner stadtbekannten Leidenschaft fürs Briefmarkensammeln, ohne weitere Bedeutung. Bloß ein Frankiertick des Polizeiobermeisters. Er duzte Theo, denn sie kannten sich aus der Grundschule.
»Den gesetzlich vorgeschriebenen Weg? Das klingt ja entsetzlich.«
»Findest du?«
»Ich meine …« – Theo gelang ein kleines Lachen – »… das klingt entsetzlich gesetzlich.«
Der Polizist tat ihm den Gefallen und schmunzelte mit.
»Was heißt das nun: den vorgeschriebenen Weg?«
»Das Übliche. Auf Grundlage des Protokolls wird Anzeige erstattet, du kannst innerhalb gewisser Fristen Einspruch erheben, und am Ende bekommst du das Strafmaß verkündet. Wird schon nicht so teuer werden. Billig aber auch nicht.«
»Und mein Führerschein?«
»Mit dem würde ich in nächster Zeit nicht rechnen.«
»Aber, Rainer, nun versetz dich mal in meine Lage. Was soll ich denn ohne Führerschein machen? Ohne Auto? Ich muss doch zu meinen Kunden.«
»Ich weiß.« Schaffrath unterdrückte ein Gähnen. »Man ist verdammt abhängig von dem Lappen. Wenn ich da draußen gestanden wäre, ich hätte natürlich ein Auge zugedrückt, aber so … Der betreffende Kollege war leider nicht aus Wolckenstein.«
»Das dachte ich mir.«
»Einer aus Greiffenhorst, du kennst die Typen ja.«
»Und der junge Faller? Steht dabei und tut, als hätte er mich noch nie gesehen!«
»Feller?«
»Ja, dieser Feller.«
»Zwei Komma zwei Promille, Theo. Respekt.« Schaffrath kippte seinen massigen Körper zur anderen Seite hin. Gleicher Winkel, gleiche Rücklage, linker Ellbogen auf linke Lehne. Langerprobt. Theo empfand wenig Sympathie für ihn. Sie waren vom selben Jahrgang, hatten aber Parallelklassen besucht. So etwas trennt mehr, als es verbindet.
»Ich kann doch nicht mit dem Fahrrad zu meinen Kunden, ich muss doch raus bis Marienborn und Schnarrenfurt. Rainer, wie soll ich da …?«
»Ich weiß.« Der Polizeiobermeister erhob sich ächzend, trat zum Fenster, stützte sich auf die Fensterbank und trommelte mit den Fingern auf ihr herum. »Jaja«, summte er leise vor sich hin. »Jaja … dada …«
Eine Fliege, aufgeschreckt von Schaffraths Erscheinen und seinem unmotivierten Getrommel, brummte durchs Zimmer und ließ sich auf der eingerahmten Fotografie des Bundespräsidenten nieder. Schaffrath beachtete sie nicht. Er schien überhaupt wenig Interesse für seine Umgebung aufzubringen, doch wer das glaubte, tat dem Manne Unrecht. Zum Beispiel bereitete es ihm großen Genuss, dass sein ehemaliger Schulkamerad Theo Tonseidel hier in seinem Büro aufkreuzte, bedrückt und verunsichert. Er hatte nichts gegen Theo, aber er hatte auch nichts dagegen, dass er vor ihm als Bittsteller erschien. Es war angenehm, in den wolkenlosen Wolckensteiner Vormittag hinauszublicken – die Eichen des Rupert-von-Greiffen-Parks beugten sich leicht im Wind, Kinder mit Schulranzen eilten vorbei – und hinter sich jemanden zu wissen, der auf ein Ja oder Nein des Polizeiobermeisters Rainer Schaffrath wartete. Sehr angenehm war das. So konnte man es eine Zeitlang aushalten.
Was Schaffrath nicht wusste: In der Stadt waren Gerüchte über ihn in Umlauf. Haltlose, aber hartnäckige Gerüchte. Sie speisten sich zum großen Teil aus seiner einzelgängerischen Lebensweise, der Tatsache, dass er trotz niedrigen Verdienstes ganz alleine ein geräumiges Haus in der Stettiner Straße bewohnte, dass er nie jemanden zu sich einlud, keine Freunde und schon gar keine Frau. Das einzige weibliche Wesen, das er jemals in seine Nähe gelassen hatte, war seine Mutter. Bis zu ihrem Tod im letzten Sommer hatten die beiden unter einem Dach gelebt. Seitdem stand die obere Etage von Rainer Schaffraths Haus leer, er selbst bewohnte das Erdgeschoss, und in den Kellerräumen, so wusste es die Wolckensteiner Fama, gingen seltsame Dinge vor sich.
Seltsame Dinge? Das provozierte Nachfragen. Doch da hüllte sich dieselbe Fama in vielsagendes Schweigen. Seltsame Dinge eben. Schaffrath war schließlich Junggeselle. Und er war Polizist, das sagte Einiges. Uniformen, Schlagknüppel. Vor allem Schlagknüppel. Ein dicker Polizist mit ungewöhnlichen Neigungen. Stichwort Daumenlecken. – Das alles war natürlich Unsinn, genauer gesagt: nebulöser Unsinn, aber den Wolckensteinern war nicht entgangen, dass Rainer Schaffrath es hin und wieder genoss, seine berufliche Machtposition für kleine Spielchen zu nutzen. Ihm deswegen Sadismus zu unterstellen, wäre allerdings übertrieben. Vielmehr dienten diese Spielchen dazu, das ungewöhnlich schwache Ego eines ungewöhnlich korpulenten Mannes zu stärken, und in einigen Fällen – so auch im Fall Theo Tonseidel – war die Demonstration amtlicher Hoheit nur ein Mittel zum Zweck. Zu welchem, würde man noch erfahren.
»Jaja«, summte Rainer Schaffrath und spitzte die Lippen. »Jaja … dada …«
Was im Übrigen die legendenumwobenen Kellerräume der Stettiner Straße betraf, so konnte Dr. Hammerschmidt, Wolckensteins beliebtester Allgemeinarzt, zwar von einer dortigen Perversität ersten Ranges berichten (so seine Formulierung), ob diese jedoch die üblichen bürgerlichen Maßstäbe sprengte, bleibe dahingestellt. Dr. Hammerschmidt hatte sich nach einem der letzten Besuche bei Schaffraths kranker Mutter in der Tür geirrt (behauptete er), war aus Versehen im Keller gelandet und dort über einen mit Kies und Erde gefüllten Quader aus Glas gestolpert.
Ein Terrarium, berichtete Dr. Hammerschmidt schaudernd. Einfach so, auf dem Boden. Ein Terrarium.
Auch seine Zuhörer schauderten.
Nicht nur eines, gleich ein halbes Dutzend davon gab es. Ein halbes Dutzend! In Reih und Glied, hintereinander gestellt.
Fassungslosigkeit allenthalben. Ob sie … nun ja, ob sie leer gewesen seien, diese Terrarien?
Natürlich nicht, sprach Dr. Hammerschmidt mit fester Stimme; nicht ein einziges war leer – und vor dem inneren Auge seiner Zuhörer füllten sich die Glaskästen mit Lagen von Giftschlangen und Riesenspinnen, mit gepanzerten Käfern und faltigen Echsen und Krebsen und Krokodilen und …
Bitte, sagte Dr. Hammerschmidt ernst, bitte lassen Sie uns das Thema wechseln. Ich möchte nicht … möchte nicht über einen ehrenwerten Mitbürger, dessen Verdienste außerhalb jeder … Bitte haben Sie Verständnis.
Natürlich haben wir. Natürlich, Herr Doktor.
Krokodile also. Riesenkrokodile! Die mit Riesenskorpionen kämpften. Mitten in Wolckenstein.
Von alledem wusste Rainer Schaffrath nichts. Er stand leise summend am Fenster seines Büros, während eine einsame Fliege (potentielle Nahrung für Riesenspinnen!) das Porträt des Bundespräsidenten verließ, um den verloren auf seinem Stuhl ausharrenden Verkehrssünder Theo Tonseidel anzusteuern.
»Es handelt sich ja nicht um ein kaputtes Auto«, stotterte Theo, von der Gesprächspause nachhaltig irritiert. »Das wäre etwas völlig anderes. Ich meine, dann leiht man sich eins oder man … und die Reparatur wird auch nicht allzu lange dauern, normalerweise. Aber wenn du überhaupt nicht mehr fahren darfst …«
Abrupt drehte sich Schaffrath um. »Wo stehst du eigentlich politisch, Theo?«
»Wie bitte?«
Stille. Der dicke Polizist stand mit dem Rücken zum Fenster und warf einen gewaltigen Schatten in den Raum.
»Politisch?«
Schaffrath nickte.
»Ja, du meine Güte, was soll das jetzt? Politisch … gar nicht. Neutral halt.«
»Neutral?«
»Mitte, meine ich. Ich bin kein Extremer. Kein Extremist. Warum fragst du?«
»Dein Vater ist Sozialdemokrat.«
»Und was für einer! Ich aber nicht, nie gewesen. Was hat das mit meinem Führerschein zu tun?«
»Nichts. Hat mich bloß interessiert.« Der Polizeiobermeister kehrte an seinen Tisch zurück und klemmte sich in den Lehnstuhl. »Du wirst lachen, Theo, aber ich war gestern Abend auch blau.«
Theo schwieg. Er sah keinen Grund zu lachen.
»Eine halbe Flasche Scotch beim Skatspielen und vorm Heimweg noch ein paar Bier«, zählte Schaffrath auf. »Ja, ich glaube, danach war ich blau. Auf dem Marktplatz habe ich mich mit einem Konzertplakat unterhalten.«
»Soso.«
»Und es hat mir geantwortet.«
Theo schwieg.
»Aber ich war zu Fuß unterwegs«, rief Schaffrath und schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Verdammt, Theo, was hast du dir dabei gedacht, dir erst die Hucke vollzusaufen und dich dann ins Auto … Du bringst mich in eine beschissene Lage, ist dir das klar? Einem alten Schulfreund würde ich ja gerne helfen, aber wie? Ich kann doch nicht …« Er schüttelte den Kopf und sah aus dem Fenster.
Theo schluckte. »Aber nein, Rainer, ich meinte bloß …«, begann er hilflos. Er hatte immer geglaubt, in Wolckenstein gingen die Uhren ein wenig anders, seien gewisse Dinge nicht starr, sondern beweglich, verformbar, anpassungsfähig … wenn man an der einen Seite drückte, täte sich auch auf der anderen etwas, ohne dass man gleich gegen sämtliche Gesetze verstieße. »Weißt du«, sagte er, »ich bin ja bereit, eine Geldstrafe zu akzeptieren, darum geht es nicht, auch die Punkte in Flensburg sind mir schnuppe. Gebt mir meinetwegen einen mehr, wenn es sein muss – aber meinen Führerschein brauche ich, das verstehst du doch. Nach Schnabelberg kommt man ja nicht einmal mit dem Bus.«
Schaffrath wandte Theo sein flaches, breites Gesicht zu und musterte ihn. »Pass auf, mein Junge«, sagte er und begann, so nachdenklich und zeitlupenhaft über seinen Daumen zu lecken, dass man eine geradezu dramatische Erklärung erwartete. »Pass mal auf … Ich kann in dieser Angelegenheit nichts für dich unternehmen. Punkt.«
Den Daumen sollte man dir abschneiden, dachte Theo. Und im Museum für Kriminalistik ausstellen, mit folgender Erläuterung: Abgeschleckter Daumen (rechts) eines linientreuen Apparatschiks; Wolckenstein/Deutschland, frühes 21. Jahrhundert.
»Aber manchmal«, fuhr der Polizeiobermeister fort, »manchmal geschehen ja Wunder. Vielleicht ist doch etwas zu machen.«
Theo sah verblüfft auf. Hatte er Schaffraths Daumen voreilig der Wissenschaft überlassen?
»Ich rufe dich heute Nachmittag an, verstanden?« Schaffrath stand auf und streckte seine Hand aus.
»Du rufst mich heute Nachmittag an, verstanden.« Theo hatte nichts verstanden. Aber auch er erhob sich, um seinem Schulfreund brav die Rechte zu schütteln. Schaffraths Daumen legte sich feucht auf seinen Handrücken.
Den Rest des Vormittags verbrachte Theo am Telefon. Sämtliche Termine außerhalb Wolckensteins galt es abzusagen und die in den entfernteren Stadtteilen gleich mit. Auf unbestimmte Zeit. Warum nicht einmal ein Päuschen einlegen? Er hatte es sich verdient, sein letzter Urlaub war die Woche Skifahren im Kleinwalsertal gewesen, lange her. Tut mir Leid, sagte er, Frühjahrsschnupfen. Ausgerechnet, wenn man gerade … Schwer zu sagen, wann es wieder … muss halt. Danke, wird schon. Ich melde mich. Vielen Dank. Er versuchte seiner Stimme einen rauen Klang zu geben.
»Waren Sie nicht gestern noch in Schnabelberg?«, fragte eine Frau. »Da sahen Sie putzmunter aus.«
»Neununddreißig Grad«, log Theo. »Heute Nacht.«
»Ich hab extra wegen Ihnen mein Yoga verlegt.«
»Sie können ruhig nachmessen, wenn Sie mir nicht glauben.«
Die Flunkerei zerrte an seinen Nerven. Er hasste es, zu solchen Ausflüchten greifen zu müssen. Vor dem nächsten Telefonat steckte er sich eine Wäscheklammer auf die Nase und dachte an etwas Trauriges. So klang der Schnupfen authentischer. Mitten in seinem letzten Gespräch läutete es Sturm. Das Telefon am Ohr, lief er zur Haustür, öffnete, warf die Tür aber sofort wieder zu, um die Wäscheklammer mit der linken Hand von der Nase zu pflücken und in eine Tasche zu stecken. Dann öffnete er erneut.
Draußen stand Herr Menge.
Herr Menge: eins neunundsechzig hoch, die geballte Kraft von achtundsiebzig Jahren, ein begabter Heimwerker, Vereinsmensch, Liebhaber von Gartenfesten, knorrig, kurz angebunden, außerdem Nachbar der Tonseidels. Manche Leute nannten ihn Herrn Mengele; zu ihnen gehörten Mira und Tom und bisweilen auch ihre Eltern. Herr Menge trug blaue Latzhosen und ein kariertes Hemd, seine tellergroßen Hände waren ölverschmiert.
»Alles in Ordnung?«, fragte er.
»Tut mir Leid«, sprach Theo in den Hörer. »Ich melde mich. Danke für Ihr Verständnis. Wiederhören.« Und dann, das Telefon vom Ohr nehmend: »Tag, Wolfhard.«
»Tag, Tonseidel. Schlägt deine Tür auch immer zu?«
»Meine Tür? Ja … manchmal.«
»Kann ich reparieren, wenn du willst. Hab ich bei mir auch hingekriegt. Herta behauptet zwar, dass die …«
»Danke, nicht der Rede wert. Sonst funktioniert sie eigentlich ganz gut.«
»Vorsicht, Nachbar, das kommt schleichend. Wird immer stärker. Und am Schluss klemmen irgendwelche Finger drin. Dann ist das Geschrei aber groß, sage ich dir.«
Theo kratzte sich am Ohr und warf der Tür einen schuldbewussten Blick zu. »Also, pass auf … Wenn es schlimmer wird, melde ich mich. Einverstanden?«
Herr Menge nickte zufrieden. Das war geregelt. Sehr gut.
»Wolltest du eigentlich was von mir?«
»Wollte ich. Könntest du mir deinen Wagenheber für ein Stündchen leihen?«
»Ja, natürlich. Kein Problem.«
»Was hast du eigentlich da an der Nase?«
»An der Nase? Schnupfen. Nicht schlimm, bloß eine kleine Frühjahrsgrippe. Geht schon wieder.«
»Schnupfen?«
Theo zuckte mit den Achseln.
Herr Menge trat näher heran und fuhr einen breiten, ölverschmierten Zeigefinger aus. »Das da meine ich, auf deinen Nasen… dings, Nasenflügeln: Da sind so weiße Flecken, einer rechts, einer links.«
»Ach, Quatsch.«
»Na, hör mal, ich spinn doch hier nicht rum, Tonseidel. Zwei weiße Flecken. Und die sehen gar nicht gut aus. Von wegen Schnupfen.«
Theos Nase wich vor dem sich nähernden Mengeschen Zeigefinger zurück. In seiner Hosentasche lag die Wäscheklammer, schwer wie Blei.
»Ich will dir ja keine Angst machen, Nachbar, aber hast du dich schon mal auf Hautkrebs untersuchen lassen?«
»Nein, Wolfhard, und es ist …«
»Damit würde ich nicht spaßen.«
»Das ist kein Hautkrebs! Ich habe vorhin ein bisschen an meiner Nase herumgedrückt … weil sie gejuckt hat. Gejuckt, verstehst du? Frühjahrsschnupfen. In einer Minute sind die Flecken weg, garantiert.«
»Also, ich würde zur Sicherheit …«
»Guck noch mal hin. Sind sie noch nicht weg?«
Herr Menge kniff die Augen zusammen und beugte sich vor. »Vielleicht sind sie ein wenig schwächer geworden, kann sein.«
»Na, siehst du? Also, was war das jetzt, was du von mir wolltest? Einen Schraubenzieher?«
»Nein, einen Wagenheber.«
»Ach, so. Meinen Wagenheber.« Theo schwieg. Ihm war etwas eingefallen. Siedend heiß. »Das … das geht leider nicht.«
»Geht nicht?«
»Ich habe keinen Wagenheber.«
»Wie, du hast keinen Wagenheber?« Herrn Menges Überraschung war mit Händen zu greifen. »Eben hast du noch … du hattest doch immer einen Wagenheber. Im Kofferraum deines Golfs.«
»Ich hatte nie einen Wagenheber. Und wenn ich mal einen hatte, ist er jetzt kaputt.«
»Ach, deiner auch? Diese Dinger taugen nichts mehr. Ich hab meinen noch aus der Firma, kleines Andenken an fünfzig Jahre Schufterei. Hab ich zum Abschied mitgehen lassen. Und jetzt: futsch!« Er schlug mit dem rechten Handrücken in die geöffnete linke Hand. Das Motorenöl glänzte in der Sonne. »Futsch! Bricht einfach durch, das scheiß Ding. Ohne Vorwarnung!«
Theo nickte und spielte gedankenverloren mit der Wäscheklammer in seiner Tasche.
»Und deiner? Auch futsch?«
»Ja … nein«, sagte Theo schnell. »Verliehen hab ich ihn. Und der, der ihn geliehen hat, hat ihn … ich weiß nicht, was. Jedenfalls ist er weg.«
»Wie, weg?«
»Was willst du eigentlich mit meinem Wagenheber?«
»Winterreifen abmontieren.«
»Im April?«
»Wann denn sonst? Im Dezember vielleicht? Ich mache das immer im April, seit ich mal an Ostern im Schnee steckengeblieben bin. Vorher kommen mir die Sommerreifen nicht drauf. Und im Oktober runter damit. Immer schön im Halbjahresrhythmus, verstehst du? Gestern sagt Herta zu mir, jetzt brauchen wir aber das Zeug, wenn wir Deutschlands Kleinod werden wollen, du musst mich zu den Schneiders fahren, da sag ich, erst müssen die Sommerreifen drauf, bevor ich …«
»Was für Zeug?«
»Na, die Blumen und der Kram. Was Herta in die Fenster stellen will und in den Vorgarten. Wegen dem Wettbewerb.«
»Ich weiß von keinem Wettbewerb.«
»Nun mach aber mal einen Punkt«, rief Herr Menge empört. »Liest du keine Zeitung? Hast du nichts von dem Aufruf gehört? Der war an alle Wolckensteiner gerichtet, also auch an dich, Nachbar!«
Theo zuckte die Achseln.
»Der Wettbewerb Kleinod Deutschlands. Und wir sind dabei, Wolckenstein. Da werden sich die Greiffenhorster aber umschauen.«
»Ach, das.«
»Jetzt kommt es auf uns an, Tonseidel. Jetzt sind die Bürger gefragt, verstehst du? Häuser rausputzen, Gärten aufräumen, Blumenschmuck vors Fenster. Zack, zack!«
»Und Sommerreifen aufziehen«, murmelte Theo.
»Da fällt mir auf …« Wolfhard Menge stellte sich auf die Zehenspitzen, um die Nase seines Nachbarn einer weiteren Musterung zu unterziehen. »Die Flecken sind weg.«
»Sag ich doch. Harmlos.«
»Trotzdem. Ich würde es Dr. Hammerschmidt zeigen. Ja, und wie gesagt, wir schmücken unser Haus, darauf kannst du dich verlassen. Von oben bis unten. Ich lass mir doch nicht nachsagen, dass Wolckenstein nur wegen mir nicht zu Deutschlands Dingens gewählt wurde.«
»Wo wolltest du die Blumen denn besorgen?«
»Herta, nicht ich. Ich kenn mich bei dem Zeug nicht aus. Bei den Schneider-Schwestern, wo denn sonst. Billiger als in der Gärtnerei Klopp, und man muss die zwei ja nicht heiraten, die zwei Furunkel.« Er lachte scheppernd.
»Soso«, machte Theo.
»Euer Vorgarten könnte auch eine Auffrischung vertragen, Nachbar.«
Das Telefon läutete.
»Bringt ihr uns ein paar Blumen mit?«, fragte Theo, zuckte entschuldigend die Achseln und betätigte die Gesprächstaste. »Hortensien oder so. Macht sich immer gut.«
»Wird erledigt«, rief Herr Menge. »Muss nur noch einen Wagenheber auftreiben.«
Dann ging er, die Stirn argwöhnisch gerunzelt. Er hatte seinen Nachbarn schon in allen möglichen Situationen erlebt und wunderte sich normalerweise über gar nichts mehr. Der Mann war schließlich jung und unerfahren. Es gab jedoch Grenzen. Diese Nervosität von Tonseidel, seine schuldbewussten Seitenblicke, und dann natürlich die wandernden Krebsgeschwüre in seinem Gesicht. Bei Tonseidels Sohn hätte er ja nichts gesagt, aber der Vater … Egal. Sollten selbst schauen, wohin das alles führte. Trotzdem würde er die Angelegenheit ausführlich mit Herta besprechen.
Finsteren Blickes verließ er das Anwesen der Tonseidels.
Theo schloss aufatmend die Haustür und ging zurück ins Wohnzimmer.
»Ach, du bist es, Rainer. Was gibt’s?«
Und dann telefonierte er eine ganze Weile.
Das Wolckensteiner Kreiskrankenhaus, Gabi Tonseidels Arbeitsplatz, wurde vor zwanzig Jahren an der Hangstraße nach Weiler und Roth errichtet, ein fünfstöckiger, funktionaler Bau, gesäumt von dichtem Nadelwald. Seine exponierte Lage außerhalb der Stadt verdankt sich dem Gutachten eines Experten für Medizinalarchitektur. Wer ins Krankenhaus muss, hatte der Mann damals erklärt, der ist so tief unten, dass er Höhe braucht. Raus aus dem Tief muss der, ab nach oben, über den Berg oder zumindest an den Hang. Gebt dem Kranken eine Aussicht, gebt ihm Zuversicht! Der Kreistag war beeindruckt und stimmte zu. Dem Krankenhaus schadete die Lage nicht, im Gegenteil, nur der Gutachter erhängte sich wenige Jahre darauf in seinem ebenerdigen Berliner Büro.
Gabi Tonseidel wusste nichts von diesem Schicksal; sie ging gerne zur Arbeit, auch wenn sie das Krankenhaus als Gebäude unansehnlich fand und die Anfahrt im Sommer, wenn sie das Rad benutzte, beschwerlich. Sie arbeitete im Erdgeschoss, verbrachte ihre Kaffeepausen aber in der Regel ein Stockwerk darüber, im Schwesternzimmer der chirurgischen Station 1, wo sie bis zu Miras Geburt tätig gewesen war. Der Kaffee auf Station schmeckte besser als der in der Ambulanz, außerdem ergab sich hier die Gelegenheit zu einem Schwätzchen mit Pierre.
Pierre: für die Patienten Dr. Pierre Brückle, ohne Zweifel der beste und attraktivste Chirurg der Stadt. Gerade eben sehen wir ihn Kurs auf das Schwesternzimmer der Station nehmen und hören eine Stimme traurig durch die spiegelblanken Flure des Kreiskrankenhauses hallen. Seine Stimme.
»Ich bin ein Moorsoldate«, sang Dr. Brückle. »Ich ziehe mit dem Spate … nach Wolckenstein!«
Wer den Chirurgen nicht kannte, den mochte der Widerspruch zwischen seinem guten Aussehen und seiner trüben Stimmung irritieren. Zu Unrecht. Ob Brückles Trübnis echt oder aufgesetzt war, ließ sich zwar nicht entscheiden; auf sein gutes Aussehen jedenfalls traf beides zu. Aufgesetzt war es, weil es aus harter morgendlicher Arbeit vor dem Spiegel resultierte; echt, weil man auch einem ungeschminkten, unrasierten und seine Kleidung vernachlässigenden Pierre Brückle ein Mindestmaß an natürlicher Attraktivität nicht absprechen konnte, einmal abgesehen von der Tatsache, dass es sich bei einem derartigen Gedanken um ein bloß theoretisches Konstrukt handelte.
Am Schwesternzimmer angelangt, lehnte sich Brückle mit der Schulter gegen die Tür und drückte sie auf, nicht ohne einen langen Seufzer hören zu lassen. Der Trübsal und dem Seufzer zum Trotz hatte er die Tür mit so viel Schwung geöffnet, dass lose Unterlagen von den Tischen flatterten und das Stationsbuch eine Seite weitergeblättert wurde. Gabi Tonseidel und Schwester Hilde saßen kaffeetrinkend nebeneinander und hoben nicht eine Braue.
»Die Hölle auf Erden«, sagte Dr. Brückle und lehnte sich gegen den Türpfosten. »Was für eine Nacht! Die leibhaftige Hölle. Ihr, die ihr eintretet und so weiter.«
»Ihren Kindern geht es gut, Frau Tonseidel?«, fragte Schwester Hilde.
»Danke, alles bestens«, sagte Gabi.
»Unterwelt, Sackgasse, letzte Ausfahrt«, tönte Brückles Stimme von der Tür her. »Packeis, meine Damen. Sankt Helena war ein Paradies dagegen. Können Sie mir sagen, womit ich das verdient habe?«
»Natürlich, mit Tom ist es manchmal schwierig«, sagte Gabi. »In dem Alter …«
»Sicher, in dem Alter«, nickte Schwester Hilde.
»Der Hades, das Reich der Toten. Und nicht ein Wort des Mitleids von den …«
»Könntest du bitte die Tür schließen, Pierre«, unterbrach ihn Gabi. »Es zieht.«
»Man redet mit mir! Noch ist nicht alles verloren.« Brückle zog die Tür hinter sich zu und betrat den Raum. »Trotzdem Hölle. Über der Stadt liegt ein Fluch.«
»Über der Stadt liegt ein Tief, und es wird Regen geben. Habe ich gehört.«
»Aber das Schlimmste sind die Bewohner. Die Eingeborenen. Wer ist für diese missratene Spezies verantwortlich? Wer, Schwester Hilde?«
»Also, ich nicht«, antwortete die Stationsschwester. »Ich bin aus Schnarrenfurt.«
»Aber irgend jemand muss sie doch so gemacht haben, wie sie sind.«
»Wie sind sie denn?«, fragte Gabi, die volle Kaffeetasse an den Lippen.
»Irgendjemand muss doch die Verantwortung für diese unfertige, dumpfe, klumpenförmige Masse Homo Wolckensteinensis übernehmen. Gäbe es den hiesigen Stationskaffee nicht, wäre ich längst über alle Berge. Bitte, Schwester Hilde, wären Sie so freundlich?«
»Wenn’s hilft«, sagte Schwester Hilde und schenkte ihm Kaffee in eine Tasse.
»Danke. Vielen Dank.« Dr. Brückle setzte sich auf den Tisch der Stationsschwester, nahm einen Schluck und schielte auf seine Nasenspitze. »Wie sie sind, unsere Wolckensteiner? Das weißt du selbst, Gabi. Und falls du es vergessen hast, geh in den OP und schnippel einen auf. Schau dir seine Innereien an, seine aufgedunsenen Organe und seine zerfressenen Arterien, alles verklebt und verkalkt und verrottet. Haltbarkeitsdatum abgelaufen.«
»Wenn ich daran denke, dass Sie nur noch der Kaffee bei uns hält, Dr. Brückle«, sagte Schwester Hilde versonnen.
»Und natürlich das Personal. Sofern es aus Schnarrenburg stammt.«
»Schnarrenfurt.«
»Bist du das eigentlich, der so nach Kippen riecht?«, fragte Gabi.
»Genau!«, rief Brückle und sprang auf. Er schnupperte an seiner Kleidung. »Immer noch. Furchtbar! Dieser … dieser Mensch! Heute Morgen, in meiner Sprechstunde, ich weiß seinen Namen nicht mehr, die heißen ja eh alle gleich.«
»Ein Wolckensteiner, willst du sagen.«
»Ekelhaft, der Typ. Hüftprothese, doppelter Bypass, aber privat versichert. Pafft mich die ganze Zeit voll. So!« Er machte es vor: sog mit starrem Blick Luft durch Zeige- und Mittelfinger ein, beide Hände rasch wechselnd. »Seine Lunge ein Schlachtfeld. Was soll man mit so einem machen?«
»Operieren vielleicht?«
»Zwecklos. Vertane Zeit. Ich habe ihm empfohlen zu essen.«
»Essen?«
»Essen. Den lieben, langen Tag hindurch. So oft und so viel er wollte. Bei den Mahlzeiten rauchte er nämlich nicht.«
Ein kurzes Klingelzeichen ertönte: Zimmer elf.
»Apropos Essen«, sagte Schwester Hilde und erhob sich, ihre weiße Kluft glattstreichend. »Ich habe mal zwei Jahre in Bottrop gearbeitet. Dagegen ist Wolckenstein ein Paradies, Dr. Brückle. Du meine Güte, ich könnte Ihnen Geschichten erzählen.«
»Bitte, nein. Lassen Sie mir meine Illusionen, Schwester Hilde.«
»Wie Sie möchten. Aber glauben Sie mir, schlimmer als anderswo ist es hier auch nicht.« Sie verließ das Zimmer.
»Schwester Hilde!«, rief der Arzt ihr nach. »Habe ich Ihnen von dem Leistenbruch erzählt, den wir am Montag im OP hatten? Angeblich eine Frau. Die war so dick, dass sie uns fast vom OP-Tisch fiel. Es dauerte eine halbe Stunde, bis wir zu ihrer Leiste vordrangen, aber dann hatten wir gleich drei bis vier zur Auswahl.«
»Pierre, bitte«, sagte Gabi. »Sie hat zu tun.«
Dr. Brückle stürzte zur Lautsprecheranlage und drückte die Taste von Zimmer elf. »Hallo, Schwester Hilde!«
»Pierre!«
Der Arzt ließ die Taste los, griff nach seiner Tasse und stellte sich ans Fenster. »Ehrlich, Gabi, das war keine Frau, sondern ein Monstrum. Die eigene Brust zog sie vom OP-Tisch. Wir stellten auf beiden Seiten Stützschalen auf, um sie zu stabilisieren. Und ins Bett wurde sie von vier Pflegern gehoben.«
»Interessant.«
»Einer der Pfleger verhob sich dabei. Wahrscheinlich hat er jetzt einen Leistenbruch. Ich sollte einen Artikel darüber schreiben: Ansteckungsgefahr bei Leistenbruch erwiesen.«
»Hochrisikogebiet Wolckenstein. Vergiss das nicht zu erwähnen.«
»Du bist die Einzige, der ich mein Leid klagen kann, Gabi. Du bist auch nur eingeheiratet.«
»Aber mit vollem Herzen Wolckensteiner Patriotin. Kein Defätist wie du.«
Brückle zündete sich eine Zigarette an und öffnete das Fenster. »Defätismus hat etwas Edles. Die Reinheit des Untergangs.«
»Alter Jammerlappen! Wieso rauchst du jetzt eine?«
»Weil ich ein Jammerlappen bin. Ich habe mich vorhin im Spiegel gesehen. Grauenhaft. Wie wär’s mit einer Partie Squash heute Abend, um den Tag angemessen zu beenden? Eine Niederlage zum Abschluss käme gerade recht.«
Gabi verdrehte die Augen. »Du hast noch nie gegen mich verloren, Pierre. Noch nie.«
»Sportlich vielleicht nicht. Aber moralisch. Ich spiele so brutal, machohaft. Nur den Triumph im Blick, nicht die Kooperation.«
»Wenn man beim Squash nur nicht so schwitzen würde.«
Der einzige Grund, warum ich mit dir spiele, dachte Brückle.
»Heute geht es jedenfalls nicht.« Gabi richtete sich auf. »Ich muss noch zur Polizei oder zum Schrottplatz oder was weiß ich wohin.«
»Zur Polizei? Hoppla!«
»Nichts mit Hoppla. Mein Mann hat sich gestern Abend volltrunken am Steuer erwischen lassen, der Depp. Führerschein weg.«
»Ts, ts, ts«, machte Dr. Brückle und betrachtete seine Hände. Für einen Chirurgen besaß er außergewöhnlich feine Hände, lang und schmal und mit gerundeten Fingernägeln. Er war kein überragender Operateur, genoss aber einen ausgezeichneten Ruf. Wer ihm gegenübersaß, fasste sofort Vertrauen zu seinen Fähigkeiten. Ein Arzt, der seinen eigenen Körper so sorgfältig pflegte, würde auch mit dem seiner Patienten achtsam umspringen, lautete die Unterstellung. Mochten die übrigen Chirurgen metzgern und Knochen spalten; ein Dr. Pierre Brückle vergaß über der Arbeit die Ästhetik nicht. Leider übersah, wer so dachte, dass gerade der Sinn für Ästhetik ein schlechter Ratgeber am OP-Tisch war. Tatsächlich ließ Brückles Interesse an seinen Patienten deutlich nach, sobald er an ihrem Äußeren Spuren des Verfalls feststellte. Und das war bei praktisch allen jenseits der fünfundzwanzig so, bei männlichen Patienten ohnehin. Schlanken jungen Frauen hingegen trennte er mit einer Eleganz und Umsicht die Haut auf, dass man ins Staunen kam. Und seine Nähte waren ein Gedicht. Am Körper der wenigen Exemplare, die es verdienten, wollte Dr. Pierre Brückle keine Narben hinterlassen.
»Wie ich es dir immer prophezeit habe«, sagte der Arzt. »Kein leichtes Leben mit so einem leichtlebigen Gatten.«
»Mein Mann ist nicht leichtlebig, ganz im Gegenteil. Bloß zuweilen etwas gedankenlos. Wenn er meint, er könne sich ein paar Monate ohne Auto leisten, bitte. Von mir wird er kein Gejammer hören, aber trösten werde ich ihn auch nicht.«
»Er war sicher nie mit dir Squash spielen«, sagte Brückle nachdenklich und sah aus dem Fenster.
»Er würde auch nicht gegen mich gewinnen«, lächelte sie überlegen.
»Dein Mann fährt doch einen dunkelblauen Golf, oder? Und sagtest du nicht gerade, sie hätten ihm den Führerschein abgenommen?«
»Mich wundert, dass sie ihn nicht gleich zur Ausnüchterung dabehalten haben. Warum?«
»Weil er gerade unten seinen Wagen abgestellt hat.«
Gabi eilte ans Fenster und sah hinunter zu den Parkplätzen vor dem Krankenhaus. Ihr Mann stand gutgelaunt neben seinem Auto, tätschelte es liebevoll und drückte den Sperrmechanismus der Wagenschlüssel.
»Ich fasse es nicht«, murmelte Gabi. Theo erblickte sie und winkte freudestrahlend zu ihr hinauf.
Tom Tonseidel war vierzehn, zwei Jahre älter als seine Schwester, hatte dunkle, immer leicht fettige Haare, einen Ring im linken Ohrläppchen und eine vom Stimmbruch ziemlich verkorkste Stimme. Manchmal kam er gut mit seinen Eltern aus, meistens nicht. Meistens erschien er zum Abendessen, manchmal nicht. An diesem Abend war er anwesend, weil ihn seine Mutter ausdrücklich darum gebeten hatte. Dummerweise gab es Brote; die musste man selbst schmieren und konnte sie nicht einfach in sich hineinlöffeln.
»Euer Vater hat euch etwas zu erzählen, Kinder«, sagte Gabi in einem Ton, der alle drei aufhorchen ließ.
»Wieso habe ich den Kindern …?«
»Du erzählst es genau so, wie du es mir vorhin im Krankenhaus erzählt hast. Ganz genau so.«
»Ach, du warst im Krankenhaus?«, fragte Mira.
»Dafür siehst du aber noch gut aus«, sagte Tom und fing an zu grinsen. Für seine Verhältnisse war das ein prima Witz.
»Ich verstehe überhaupt nicht, warum man aus der ganzen Sache ein solches Drama machen muss«, sagte Theo verärgert. »Das geht die beiden überhaupt nichts an.«
»Natürlich geht es uns was an«, rief Mira. Das klang ja vielversprechend! Tom grinste immer noch.
»Ich komme mir vor wie ein Angeklagter. Ein einziges Mal ein Glas zu viel, und jetzt muss ich mich vor aller Welt dafür rechtfertigen. Was soll das?«
Gabi schüttelte den Kopf, kalt und milde zugleich. »Es geht nicht um dein … wie sagtest du? … dein Glas zu viel, sondern um das, was du heute Mittag ausgehandelt hast. Das hat die Kinder sehr wohl zu interessieren.«
»Gurke«, sagte Tom.
»Das heißt bitte, Mann«, rief Mira. Ihre Mutter schob Tom das Gurkenglas über den Tisch.
»Was ist schon dabei?«, wehrte sich Theo. »Hat im Grunde nichts zu bedeuten. Wirklich, du machst eine Staatsaffäre daraus, Gabi. Das ist die Sache nicht wert.«
Schweigend bestrich seine Frau ein Brot mit Butter.
»Na los, jetzt erzähl schon«, drängte Mira.
»Es ist völlig uninteressant. Du wirst sehen. Völlig uninteressant.«
Niemand erwiderte etwas.
»Also gut. Ich hatte einfach Glück mit meinem Führerschein. Der zuständige Polizist ist ein alter Schulkamerad von mir, so eine Art Freund.« (Gabi hob eine Augenbraue.) »Er hat mir versprochen, dass das Verfahren gegen mich fallen gelassen wird. Ich weiß nicht, wie er das anstellt, aber es wird wohl klappen. Das ist das Schöne an Wolckenstein, hier finden sich immer Wege.« Er sah lächelnd in die Runde. »Da haben wir noch einmal Glück gehabt, nicht wahr?«
»Wie viel hast du ihm gezahlt?«, fragte Mira.
»Nun fang nicht wieder damit an. Könnt ihr euch nicht vorstellen, dass man guten Freunden einen Gefallen ganz umsonst erweist?«
Tom schüttelte den Kopf. »Umsonst ist nur der Tod«, ergänzte Mira. »Sagt Frau Hollerieth.«
»Weißt du, was ich deiner Frau Hollerieth demnächst erzähle?«, erregte sich ihr Vater.
»Nur die Ruhe«, beschwichtigte Gabi. »Dein Freund Schaffrath lässt sich seine Gefälligkeit schließlich auch vergüten.«
»Was heißt hier vergüten? Er hat mich bloß um meine Hilfe gebeten. Als kleines Dankeschön.«
»Na, also.«
»Du sollst der Polizei helfen?«, fragte Mira. »Spionieren oder was? Undercover vielleicht?«
»Käse«, sagte Tom und zeigte auf den Gouda auf der anderen Tischseite.
»Papa, der sagt nie bitte, wenn er was will. Und ich muss es immer sagen. Immer!« Mira funkelte ihren Bruder wütend an. Man konnte nicht behaupten, dass er sie sehr beachtete.
»Spionieren, von wegen«, sagte Theo und schob seinem Sohn den Käseteller hin. »Es handelt sich bloß um eine kleine Gefälligkeit, eine lächerliche Kleinigkeit, versteht ihr? Dieser Herr Schaffrath sucht Leute, die sich in seiner Partei engagieren. Für ein paar Wochen oder Monate nur, das ist alles.«
»Er hat sicher auch nicht bitte gesagt«, brummte Tom. Es hätte leise klingen sollen, doch das ließ sein von der Spätpubertät aufgerautes Organ nicht zu. Nachdenklich musterte er den Käseteller. Er mochte keinen Gouda, aber zu sehen, wie prompt und widerspruchslos sein Vater ihn bedient hatte, befriedigte ihn ungemein. Der Alte musste ein verdammt schlechtes Gewissen haben.
»Das ist alles«, wiederholte Theo und putzte sich den Mund ab. »Gar nicht der Rede wert.«
»Um welche Partei geht es denn?«, fragte Mira. »Die Grünen?«
»Zum Glück nicht. Herr Schaffrath gehört dem Vorstand der Demokratischen Mitte an. Das ist die Partei, die bei uns im Ort die Mehrheit hat und den Bürgermeister stellt. Und deren Mitglieder ziemlich überaltert sind, wie es heißt. Jedenfalls sagt Schaffrath, sie bräuchten ein paar neue, unverbrauchte Gesichter, und er hätte da an mich gedacht. Übrigens schon länger, nicht erst jetzt. Ich werde also demnächst zu einer ihrer Sitzungen gehen, mir ihre Diskussionen anhören, einen Wahlaufruf oder Ähnliches unterschreiben – fertig. Schon ist beiden Seiten geholfen. Die bekommen ihre Frischzellenkur, und ich darf meinen Führerschein behalten. Capito?«
Er sah seine Kinder herausfordernd an. Beide schwiegen. Das war mehr, als er zu hoffen gewagt hatte. Ermutigt setzte er noch einen drauf: »Außerdem gibt es so etwas wie demokratische Pflichten, staatsbürgerliche … ja, Pflichten eben. Habt ihr das in der Schule schon durchgenommen? Es bedeutet, dass man denen da oben nicht alle Entscheidungen überlassen darf, sondern Druck von unten ausübt, das politische Geschehen selbst in die Hand nimmt, sozusagen. Versteht ihr?«
»Noch mal Gurke«, sagte Tom. Mira warf ihm einen vernichtenden Blick zu.
»Wir sind also Zeugen des Beginns einer erfolgreichen Politkarriere«, sagte Gabi. »Wenn du mehr Gurke willst, Tom, schau in der Küche nach.«
»Nein, nein, nein.« Theo schüttelte energisch den Kopf. »Alt werde ich nicht bei dem Verein, keine Angst. Ich habe mit Schaffrath vereinbart, dass ich sie im Blick auf die Kommunalwahl unterstütze und mich danach jederzeit zurückziehen kann.«
»Also, ich finde das blöd«, sagte Mira. »Die Grünen tun wenigstens was für die Umwelt. Unser Bürgermeister ist ein Fettsack, der immer nur grinst und jungen Frauen auf den Hintern guckt.«
»Das stimmt«, sagte Tom. »Superfett ist der.«
»Nanana, solche Reden will ich von euch nicht hören.«
»Kindermund tut Wahrheit kund«, sagte Gabi mit unschuldigem Augenaufschlag. »Könnte von Frau Hollerieth stammen.«
»Nun bestärke sie nicht auch noch. So entsteht Politikverdrossenheit.«
»Politikverdrossenheit entsteht, wenn eine Partei seit Jahrzehnten die absolute Mehrheit hat und man den Eindruck bekommt, es bewegt sich nichts mehr.«
»Die Wähler sehen das ein bisschen anders. Sonst würden sie der Demokratischen Mitte nicht immer wieder ihre Stimme geben.«
»Ach, die werden schon ihre Methoden haben, diese Politiker. Wenn sie ihre Mitglieder neuerdings durch die Polizei rekrutieren lassen …«
»Hör mal«, sagte Theo, der diese Diskussion vor den Kindern möglichst rasch beenden wollte. »Über die Art und Weise, wie mein Deal … meine Abmachung mit Schaffrath zustande gekommen ist, kann man ja streiten. Aber Fakt ist, dass ich schon immer eine Art heimlicher Sympathie für die Demokratische Mitte empfunden habe.«
»Sympathie«, staunte Gabi. »Davon habe ich nie etwas bemerkt.«
»Das sind alles Leute, die etwas für unsere Stadt tun wollen. Keine Spinner oder Extremisten, auch keine Ideologen oder solche Typen, die nur darauf warten, dass sie nach Berlin wechseln können. Übrigens muss ich nicht mal in die Partei eintreten. Verlangen die gar nicht.«
»Sie verlangen nur, dass du mit deinem Namen und deinem Gesicht für sie wirbst. Vielleicht brauchen sie einen glaubwürdigen Vertreter für ihr neues Großprojekt, ein atomares Zwischenlager in Wolckenstein oder so.«
»Wirklich?«, fragte Mira. »Hier bei uns in Wolckenstein?«
»Also bitte, Gabi! Musst du alles ins Lächerliche …? Rainer Schaffrath fragte mich konkret, ob ich mir vorstellen könnte, bei der Arbeitsgruppe Kleinod mitzuwirken. Da geht es um diesen Städtewettbewerb, an dem wir Wolckensteiner uns beteiligen wollen. Das ist doch was.«
»Ich erinnere mich an eine recht abfällige Bemerkung, als dieser Wettbewerb im Echo angekündigt wurde.«
»Aber nicht von mir. Das war Tom. Ich sage nie etwas Abfälliges. Höchstens etwas Ironisches.«
»Ironisch? Du?«
»Höchstens.«
»Was habe ich gesagt?«, wollte Tom wissen. Das musste eine supertolle Bemerkung gewesen sein, wenn sich seine Mutter jetzt noch daran erinnerte.
»Nicht so wichtig«, erwiderte sein Vater. »Übrigens habe ich Hortensien bei den Schneider-Schwestern bestellt, für unsere Blumenkästen.«
»Wegen dieses Wettbewerbs?«
»Ja, und zwar bevor mich Rainer darauf angesprochen hat. Wolfhard bringt sie uns mit.«
»Interessant. Du entwickelst ja einen regelrechten Aktionismus.«
»Nenne es, wie du willst. Eine Sache ist mir allerdings wichtig.« Das Oberhaupt der Familie Tonseidel schaute ernst in die Runde und hob sein butterglänzendes Messer. »Von dieser kleinen Absprache zwischen Herrn Schaffrath und mir darf kein Mensch erfahren. Keiner. Sonst bin ich meinen Führerschein los, ein für allemal. Ist das klar?«
Ringsum Nicken.
»Tom, ist das klar?«
»Ja, Mann! Ich bin doch nicht blöd.«
»Weißt du, was ich finde?«, meinte Mira. »Wenn du schon in die Politik gehst, dann aber richtig. Parteichef musst du mindestens werden. Drunter hat man ja nichts zu sagen. Du willst doch auch Entscheidungen fällen und bestimmen, wo es langgeht, oder?«
»Sehr gut«, nickte ihr Vater. »Parteichef, ich sehe das genauso. Da hörst du’s, Gabi, unsere Tochter hat vollstes Vertrauen zu meinen Fähigkeiten.«
»Apropos … Hast du dir schon überlegt, wie du es deinem Vater beichtest?«
Theo seufzte. Nein, das hatte er noch nicht. Und vor dieser Beichte fürchtete er sich. Mehr als vor allem anderen.
Die politische Karriere des Versicherungsvertreters und Familienvaters Theo Tonseidel begann am folgenden Tag: mit einer Begegnung unter der Dusche. Beim Frühstück hatte sich Theo entschlossen, schwimmen zu gehen, weil er nach seinen grippebedingten Terminabsagen unendlich viel Zeit hatte und weil Schwimmen der einzige Sport war, den er ausübte. Während er eine Bahn nach der anderen zog, überlegte er sich, wie er seinem Vater den Einstieg in die Politik erklären konnte, ohne dass dieser mit Möbeln warf. Theo Tonseidel senior war seit über einem halben Jahrhundert Sozialdemokrat, und zwar aus Überzeugung. Sein Sohn schwamm fünfzehn Bahnen, hatte aber auch nach der fünfzehnten Bahn keine Lösung für dieses Problem gefunden. Er beschloss, es zu vertagen. (Wie ein guter Politiker, dachte er grimmig und stieg aus dem Becken.)
»Ah, unsere Nachwuchshoffnung«, rief ihm jemand entgegen, sobald er den Duschraum der Männer betrat. »Willkommen im Club, Theo.« Bei diesem Jemand handelte sich um einen durchtrainierten Frührentner namens Bruno Habicht, der seit Jahren Seniorenausflüge ans Mittelmeer organisierte – extrem billig, extrem feuchtfröhlich und daher extrem begehrt. Theo kannte ihn nur flüchtig, aber Habicht gehörte zu jenen Menschen, die jeden duzen, den sie nicht von Grund auf verabscheuen.
»Wie, in welchem Club?«, gab Theo zurück. Die Duschenden ringsum, übergewichtige Herren mit bleicher Haut und Krampfadern, stellten das Wasser ab und schauten interessiert. Ein Club in Wolckenstein? Da durfte man nichts verpassen.
»Ich habe gehört, dass du bei uns einsteigst«, sagte Habicht, während er sich einseifte. »Recht so. Die Partei kann jeden Mann gebrauchen.«
»Woher weißt du das?«
»Gute Nachrichten sprechen sich schnell rum. Fast so schnell wie schlechte.«
»Bist du auch in dem … in dem Club?«
»Ehrensache.« Habicht legte ein gelbbraunes Stück Kernseife von beachtlicher Größe beiseite und sagte etwas lauter als nötig: »Politische Betätigung adelt den Menschen, das ist meine Meinung.« Ringsum wurden die Duschen wieder angestellt. Also doch kein Club. Man wandte den beiden Kommunalpolitikern den Rücken zu und widmete sich der Körperpflege.
»Das ist meine Meinung«, wiederholte Habicht. »Wolckenstein braucht Leute wie dich, Theo.«
»Warte erst mal ab«, entgegnete Theo, doch er spürte, wie Stolz warm durch seine Glieder strömte. Ja, er fühlte sich geschmeichelt, mit einem Mal zu den Wichtigen der Stadt zu gehören, zu den Entscheidern, den Herausgehobenen. War es Zufall, dass er genau in der Mitte des Duschraums stand, während sich die restlichen Anwesenden, teigige Plattfüßler mit Haarwuchs an den unmöglichsten Stellen, gegen die Wand drückten? Schämten sie sich ihrer unpolitischen Einstellung? Unwillkürlich zog er den Bauch ein. »Weißt du, Bruno, irgendwann muss man ja mal Farbe bekennen.«
»Sehr richtig.«
»Wir sind schließlich alle Staatsbürger.«
»Meine Worte, Theo!«
Die ersten Mitduschenden verließen auf Zehenspitzen den Raum. »Man kann nicht immer nur die anderen machen lassen.«
»Achtung!«
Habicht drehte mit Schwung das kalte Wasser seiner Dusche auf und ließ seine Arme kreisen. »Ja!«, rief er. »So muss es … oh, ja!«
Das umherspritzende Wasser ließ die letzten Duschenden flüchten. Auch Theo ging in Deckung. Wie lange würde es sein zukünftiger Parteikollege wohl aushalten? Habicht drehte sich um, hob die Arme und japste. An seiner Schläfe trat eine fingerdicke Ader hervor. Zwanzig Sekunden vergingen, dreißig. Theo war beeindruckt. Habicht war über sechzig, und die fünf oder sechs Jahre seit seiner Frühpension schien er hauptsächlich auf Sportplätzen und in Krafträumen verbracht zu haben.
Endlich stellte er das Wasser ab.
»Ah«, machte er, einen Schimmer von Seligkeit in den geröteten Augen. »Wie gut das tut! Wie man sich da fühlt! Super ist das. Wehtun muss es!«
»Sag mal … sind alle Mitglieder der Demokratischen Mitte so sportlich wie du? Ist das eine Zugangsvoraussetzung?«
»Von wegen«, lachte Habicht. »Das genaue Gegenteil sind sie. Du kennst doch Rainer. Und August bewegt sich keinen Meter mehr, seit er auf dem Bürgermeisterstuhl sitzt.«
»Beruhigend.«
»Es ist wirklich gut, dass du bei uns bist, Theo. Ich meine, mit deinen Kenntnissen, was das Finanzielle angeht. Du könntest in einigen Ausschüssen mitwirken.«
»Mal sehen. Bin ja noch Anfänger. Ich muss mich erst in die Abläufe hereinfinden.«
»Übrigens bin ich mit meiner Versicherung nicht mehr zufrieden. Aber das nur nebenbei. Wir können uns in einer ruhigen Stunde mal zusammensetzen. Kommst du zu unserer Mitgliederversammlung nächste Woche?«
»Ehrlich gesagt, bin ich noch gar nicht in die Partei eingetreten.«
»Mitgliedsbeiträge kannst du absetzen, kein Problem. Aber wem erzähle ich das?« Klatsch, fuhr Habichts Pranke auf die Schulter seines neuen politischen Mitstreiters herab, und Theo wusste, dass er mit dieser feierlichen Handlung, einem Ritterschlag unter Nackten, ideell in die Partei aufgenommen war, mochte seine Unterschrift unter dem offiziellen Aufnahmeantrag auch noch ausstehen. Er begann sich ebenfalls abzuduschen, und als der Frührentner pfeifend den Raum verließ, drehte er den Wärmeregler seiner Dusche auf Kalt. Nicht bis zum Anschlag, aber immerhin.
Eine Viertelstunde später verließ er das Schwimmbad zusammen mit Habicht. Theo zückte seine Autoschlüssel.
»Kann ich dich mitnehmen, Bruno? Wohin musst du denn?«
»Zum Marktplatz. Aber lass mal. Die paar Schritte laufe ich zu Fuß.«
»Alles klar. Bis dann.«
»Ach, dir gehört der Golf! Ich wusste doch, dass ich den kenne.«
»Wieso? Was ist damit?«
»Nichts. Hab ihn bloß gestern Morgen bei der Polizei gesehen, hinten im Hof. Und daraufhin hab ich mich gefragt …«
»Das war nicht mein Golf«, sagte Theo bestimmt. »Garantiert nicht.«
»Na, hör mal, ich kenn mich aus bei Autos …«
»Unter Garantie nicht. Mein Golf: garantiert Garage.«
»Aber hast du nicht …?«
»Nein. Absolut nicht.«
»Komisch. Sogar der Schokoladenkäfer am Rückspiegel war der gleiche.«