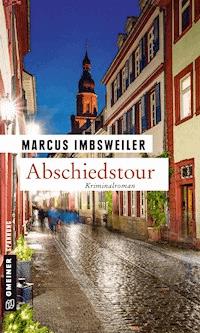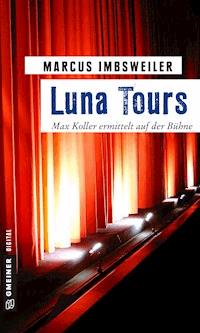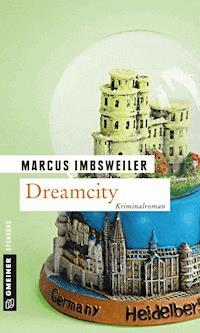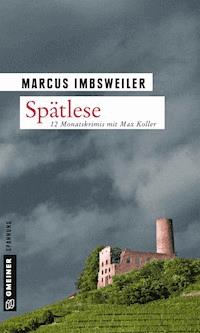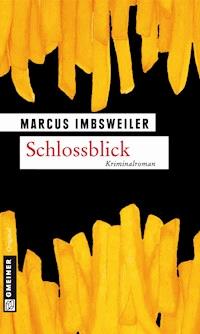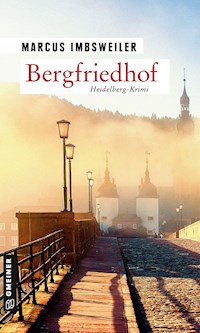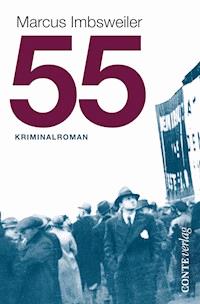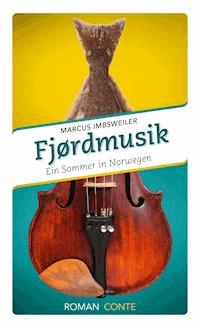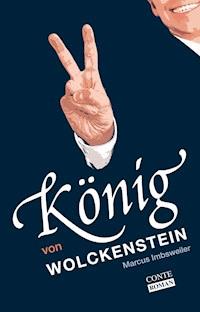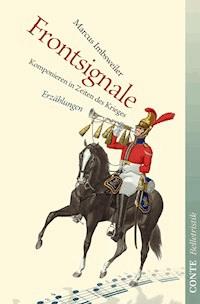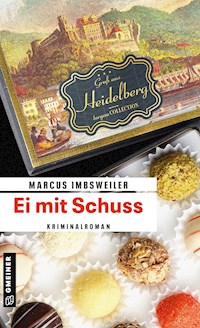
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Privatdetektiv Max Koller
- Sprache: Deutsch
Aufruhr in der Heidelberger Schokodynastie Torgau: Ein Erpresser hat zwölf vergiftete Schokoeier über die Stadt verteilt. Der Motivationstrainer von Nichte Vivian wird erstochen. Und der Streit zwischen Firmenpatriarch Edgar und den Geschwistern Vivian und Sven bedroht den Familienfrieden. Tassilo, Edgars Adoptivsohn, versucht die Wogen zu glätten - bis der Vater vor laufender Kamera ein Ei verzehrt … Eigentlich ein Fall für Privatermittler Max Koller. Aber der ist ja im Ruhestand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcus Imbsweiler
Ei mit Schuss
Kriminalroman
Impressum
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung: Julia Franze
E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © codswollop / photocase.de
ISBN 978-3-8392-5408-0
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Freitag
Kapitel 1
Alles beginnt mit einem Osterhasen.
Der Hase kommt übers Feld gehoppelt. Zunächst ist da nur ein Punkt in der Ferne. Ein brauner Punkt. Allmählich wird der Punkt größer, hüpft auf und ab. Jetzt erkennt man, dass es ein Hase ist. Fell braun, Bauch weiß. Hübsch sieht das aus. Auf dem Rücken trägt der Hase etwas. Einen Korb. Ja, es ist ein Korb mit Eiern darin. Bunt bemalte Eier, jedes von ihnen groß wie ein Kinderkopf. Der Hase hüpft und hüpft, doch sie fallen nicht heraus. Nur die langen Hasenohren klappen vor und zurück. Manchmal, wenn er eine Pause einlegt, hängen sie schlapp zur Seite.
Warm scheint die Aprilsonne auf den Osterhasen herab.
Jetzt hüpft er wieder. Das Feld scheint gar kein Ende zu nehmen. Es ist frisch gepflügt, die Erde aufgeworfen, an manchen Stellen ragen grüne Halme in die Höhe. Hinter dem Feld ein lang gestreckter Wald, hügelige Landschaft, ein Jägerstand, eine Hochspannungsleitung. Alles friedlich. Idylle mit Mümmelmann.
Für die Eingeweihten: Odenwald. Aber das nur nebenbei.
So.
Als der Osterhase endlich den Rand des Feldes erreicht hat, treten drei Kinder aus dem Wald. Zwei Mädchen, ein Junge. Pi mal Daumen Grundschulalter. Der Osterhase bleibt stehen. Es scheint, als spitze er die Ohren. Was er nicht tut, die Löffel baumeln so schlapp wie zuvor. Trotzdem. Er dreht den Kopf in Richtung der Kinder. Er fixiert sie. Weit ragen seine breiten Schneidezähne über die Unterlippe hinaus.
Auch die drei Knirpse haben den Hasen bemerkt. Zeigen auf ihn, quietschen vor Vergnügen. Gelächter und Vorfreude. Da haben sie aber was zu erzählen bei Mama und Papa!
In diesem Moment setzt sich der Osterhase wieder in Bewegung. Er hüpft. Und zwar in ihre Richtung. Auf sie zu. So schnell er kann.
Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass er etwa 1,80 Meter hoch ist. Mit Ohren zwei Meter.
Die Kinder hören auf zu lachen. Unwillkürlich weichen sie einen Schritt zurück. Der hüpfende Osterhase kommt näher. Beide Hände auf dem Rücken, den Korb stützend, starrer Blick. Die Ohren propellern um den Kopf.
Komisch, denken die Kinder. Komischer Osterhase, das. Jetzt ist er so nahe, dass sie ihn hören können.
Und was hören sie?
Es ist kein Keuchen, kein Stöhnen, kein Grunzen, kein Grollen. Sondern eine Mischung aus alledem. Ein hektisches, unter größter Anstrengung hervorgepresstes »Mhmm … Mhmm!«
Angst?
Panik?
Eine Drohung?
Wahnsinn?
Egal was es ist, mit dem, was die drei bislang über Osterhasen erfahren haben, hat es nichts zu tun. Weshalb sie sich wie auf Kommando umdrehen und davonrennen. Aus vollem Halse schreiend. Wusch, schon sind sie im Wald verschwunden.
Der Osterhase hält inne und starrt ihnen nach. Sein Brustkorb hebt sich. Auf seinem Rücken der prall gefüllte Korb. Die in der Sonne glänzenden Eier. Seine Schlappohren. Die Riesenzähne.
Und wenn man ganz genau hinschaut, kann man hinter den Sehschlitzen zwei Augen erkennen. Menschliche Augen.
Kapitel 2
Der Osterhase, den mir die alte Torgau mit spitzen Fingern reichte, bestand aus Vollmilchschokolade.
Zum größten Teil jedenfalls.
Schokoohren, Schokokörper, Schokogesicht. In der oberen Hälfte des Gesichts klemmte ein Augenpaar. Heller Glaskörper, braune Iris, riesige schwarze Pupillen. Für einen Schokoosterhasen von 30 Zentimeter Höhe waren die Augen zu groß. Außerdem bestanden sie nicht aus Schokolade. Jemand hatte sie dem Osterhasen mit Gewalt ins Gesicht gedrückt und anschließend so viel geschmolzene Schokolade außen rum geschmiert, dass sie nicht herausfielen.
Der Osterhase sah aus wie ein Monster.
»Krass«, sagte ich und stellte das Monster auf den Schreibtisch.
Die Torgau nickte.
»Sind das Menschenaugen?«, fragte ich. »Von einem Kind vielleicht?«
Entrüstet schüttelte sie den Kopf.
»Sondern?«
»Wenn Sie mich fragen: Kaninchenaugen«, sagte sie scharf.
»Ah.«
»Können Sie Kaninchenaugen nicht von Menschenaugen unterscheiden?«
»Nicht von Kinderaugen.«
»Sie haben keine Kinder, Herr Koller.«
Ich ließ mir Zeit mit der Antwort. »Nö.«
»Merkt man«, seufzte sie.
Während sich ihr Seufzer in den Weiten des Büros verlor, nahm ich ihr Mitbringsel unter die Lupe. Bei Puppen gab es das manchmal, solche überdimensionierten Kulleraugen. Dazu Riesenwimpern und Kussmund – das Kindchenschema. Hier erinnerte nichts an eine Kinderei. Das Ganze war schlicht und einfach widerlich. Eine der Pupillen blickte starr geradeaus, die andere stand ein wenig schräg. Das Weiße drum herum war schokoverschmiert. Derjenige, der die Kaninchenaugen in den Osterhasenkopf gedrückt hatte, hatte sich nicht viel Mühe gegeben. Oder unter Zeitdruck gestanden.
»Haben Sie Kinder?«, fragte ich meinen Gast.
»Einen Sohn. Adoptiert. Ein Kaninchen habe ich übrigens auch.«
»Deshalb Ihre Fachkenntnisse. Geht es dem Tierchen gut?«
»Sie meinen, das könnten seine Augen …? Keine Sorge, nach Hildebrand habe ich als Erstes geschaut. Er ist wohlauf.«
»Hildebrand.«
»Außerdem hat er blaue Augen.«
»Und Ihr Sohn?« Ich winkte ab. »Kleiner Scherz. Frau Torgau: Wann und wo haben Sie das Ding gefunden?«
Mit beiden Händen umklammerte sie den Griff ihrer Handtasche. »Heute Morgen. Auf der Kühlerhaube meines Wagens. Es stand einfach da. Wie eine Kühlerfigur. Erst dachte ich noch, wie nett, das passt doch zu uns. Bis ich die Augen sah.«
»Der Hase stand auf der Kühlerhaube? So, ohne Verpackung?«
Sie nickte.
»Und sonst? Was weiter?«
»Meine spontane Reaktion war: Wirf das Ding ins Gebüsch. Aber dann kam ich ins Grübeln. Ich machte mir Sorgen. Deshalb rief ich Sie an. Meinem Mann habe ich nichts …«
»Moment. Der Hase – was war da noch? Ich meine, gab es keine Botschaft, einen Zettel oder irgendwas?«
»Nein.«
»Sie haben am Telefon von einer Drohung gesprochen, Frau Torgau.«
Empört schaute sie mich an. »Selbstverständlich! Was soll das anderes sein als eine Drohung?«
»Ein Scherz vielleicht?«
»Ein Scherz?« Ihr Lachen war schneidend. »Das soll ein Scherz sein?« Sie packte den Schokoosterhasen und hielt ihn mir direkt vor die Nase. »Wenn das ein Scherz ist, Herr Koller, möchte ich mit Ihrem Humor nichts zu tun haben.«
Der Hase zwinkerte mir zu. Nicht in echt natürlich, aber insgeheim. Bestimmt fand er die Torgau genauso aufgeblasen wie ich. Die hatte mich doch längst in eine Schublade gesteckt: Keine Kinder, der Typ! Ganovenfresse! Perverser Humor! Dabei hatte ich mir extra ein frisches Hemd angezogen.
»Es geht hier nicht um meinen Humor«, sagte ich. »Sondern um den eines anderen. Auch wenn dieser Humor Ihnen nicht behagt. Ich frage mich, wo die Drohung steckt, von der Sie sprachen. Was sie beinhaltet und gegen wen sie gerichtet ist.«
»Na hören Sie mal!« Sie stellte den Hasen auf den Tisch zurück. »Diese Schweinerei war auf unserem Auto platziert, also richtet sie sich ja wohl gegen uns. Gegen meinen Mann und mich. Gegen die Firma. Und worum es geht, sollen Sie herausfinden. Weshalb sonst wäre ich hier?« Sie öffnete ihre Handtasche, zog ein Taschentuch heraus und wischte sich damit die Finger ab.
»Aber wenn sich jemand schon die Mühe macht, ein Paar Kaninchenaugen zu besorgen, sie in einen Schokoosterhasen zu quetschen und damit heimlich Ihren Wagen zu dekorieren – warum wird dieser Jemand dann nicht konkreter und hinterlässt eine Nachricht? Warum keine Geldforderung? Haben Sie vielleicht etwas übersehen, Frau Torgau?«
»Ich habe nichts übersehen«, entgegnete sie scharf. »Sie halten mich für senil, junger Mann. Aber das bin ich nicht.«
Das glaubte ich ihr aufs Wort.
Bevor ich etwas erwidern konnte, fuhr sie fort. »Mein Mann und ich führen die Firma schon seit vier Jahrzehnten. Da entwickelt man ein Gespür für solche Vorfälle. Der Name ›Torgau-Schokolade‹ hat einen guten Klang. Was wir an Reaktionen erhalten, ist zu 99 Prozent positiv, und ich rede nicht nur von Briefen oder Testergebnissen. Wir bekommen Geschenke, persönliche Zuschriften, Anrufe. Ganze Schulklassen haben schon für uns gebastelt. Aber es gibt auch das andere. Dieses eine Prozent Unzufriedener, die an allem herummäkeln müssen. Denen unsere Schokolade nicht schmeckt, die plötzlich Allergien entwickeln oder die uns unterstellen, minderwertige Zutaten zu verwenden. Manche brauchen nicht einmal einen Grund. Die stricken sich ihre ganz persönliche Verschwörungstheorie zusammen: Torgau will die Weltherrschaft, Torgau schmiert Politiker, Torgau macht uns mit Drogen gefügig.« Sie seufzte. »Es sind nur Einzelne. Eine Handvoll Verrückte. Aber die können einem schlaflose Nächte bereiten.«
»Und Sie meinen, jetzt handelt es sich wieder um so einen Fall?«
Sie nickte. »Wir hatten schon Graffiti, wir hatten nächtliche Drohanrufe und Betrunkene, die bei uns im Park randalierten. Alles nicht der Rede wert. Bis auf den Vorfall vor gut 20 Jahren, als wir erpresst wurden. Da wollte einer unsere Nussschokolade vergiften. Der meinte es ernst.«
»Wurde er geschnappt?«
»Ja. Aber es dauerte. Keine schöne Zeit damals, das kann ich Ihnen versichern.« Sie verstaute das Taschentuch wieder in ihrer Handtasche. »Der hier meint es auch ernst, glauben Sie mir. Für so etwas habe ich ein Näschen.«
Eine Weile herrschte Stille. Ich hing ihren Worten nach. »Okay«, sagte ich schließlich, »trotzdem fehlt etwas: die Forderung des Täters. Beziehungsweise der Täter. Der Erpresser damals wollte doch sicher Geld?«
»Natürlich wollte er. Die Forderung wird kommen, Herr Koller. Sie wird kommen, ganz sicher. Deshalb möchte ich, dass Sie das Wochenende bei uns in der Villa verbringen.«
»Haben Sie einen Verdacht?«
Sie seufzte erneut. Tiefer und länger diesmal. »Verdacht nicht«, sagte sie, meinem Blick ausweichend. »Aber ein unangenehmes … ja, ein unangenehmes Gefühl.«
»Das heißt?«, hakte ich nach, weil sie nicht weitersprach.
»Mein Mann ist nicht mehr der Jüngste. Und auch wenn er die Firma noch einige Jahre führen kann, müssen wir die Nachfolge regeln. Genau darüber gibt es … nun ja, unterschiedliche Ansichten in der Familie.«
»Über die Frage, wer einmal an die Stelle Ihres Mannes tritt?«
»Und über die Zukunft der Firma. Unser Sohn Tassilo wäre die erste Wahl. Er hat die Kreativität, das Gespür, auch das Organisationstalent, Torgau weiterzubringen. Nur Kaufmann, das ist er nicht.«
»Habe ich das richtig gehört: Tassilo?«
»Ein alter bayerischer Name. Meine Familie stammt aus Landshut. Tassilo hat eine Cousine und einen Cousin, die sehr erfolgreich in der Wirtschaft gearbeitet haben und nun ebenfalls für uns tätig sind. Leider haben sie völlig andere Vorstellungen, wie es mit Torgau weitergehen soll.«
»Andere Vorstellungen als Ihr Sohn?«
»Vor allem andere als mein Mann.« Ihre Hände fanden sich auf dem Griff ihrer Tasche. »An Ostern findet traditionell ein Familientreffen bei uns in der Villa statt. Dabei wird es auch um die Zukunft der Firma gehen. Ja, und als wäre das nicht schon problematisch genug, kommt jetzt noch die Sache mit dem Hasen dazu.«
»Verstehe ich Sie richtig? Sie glauben, dass dieses Ding etwas mit Ihrem Treffen zu tun hat? Dass damit die Diskussion in eine bestimmte Richtung gelenkt werden soll?«
»Ist doch ein seltsamer Zufall, dass es ausgerechnet am Karfreitagmorgen passiert.«
»Verdächtigen Sie Cousin und Cousine?«
»Meinen Neffen? Meine Nichte?« Ihre Miene war undurchdringlich. »Ich traue es beiden nicht zu. Aber ausschließen will ich nichts.«
»Es könnte auch jemand von außerhalb sein, der die Tradition Ihrer Familientreffen kennt. Der genau weiß, dass er an Ostern die große Bühne für seine Aktion hat.«
Sie überlegte kurz, dann nickte sie. »Das stimmt. Sehr richtig. Wir feiern Ostern schon seit vielen Jahren zusammen. Da haben Sie einen guten Gedanken gehabt, Herr Koller.«
»Sind Sie religiös? Ich meine, wegen Ostern.«
»Mein Mann überhaupt nicht. Ich ein bisschen.« Sie überraschte mich mit einem schiefen Lächeln. »Für den Hausgebrauch, könnte man sagen.«
»Gut. Wie stellen Sie sich meinen Auftrag vor? Ich soll zu Ihnen nach Hause kommen und während Ihres Treffens«, ich sah sie fragend an, »Erkundungen einziehen? Im Hintergrund bleiben? Mich auf die Lauer legen?«
»Im Prinzip ja. Halten Sie Augen und Ohren …«, sie verlor kurz den Faden, weil ihr Blick auf den Monsterhasen gefallen war, »also seien Sie einfach wachsam, schließlich warten wir ja noch auf konkrete Forderungen. Im Hintergrund brauchen Sie nicht zu bleiben. Unsere Treffen waren schon immer offen, jeder darf einen Freund oder eine Freundin mitbringen. Ich werde Sie als einen Bekannten aus Heidelberg vorstellen.«
»Als Privatdetektiv?«
»Das vielleicht nicht. Einfach als Bekannten.«
Ich schwieg. Ich ein Bekannter der alten Torgau? Warum nicht gleich ihr Musiklehrer?
»Nein, viel besser!« In ihren Augen blitzte es auf. »Sie kommen als Psychologe! Ja, ich führe Sie als Psychologe ein, der unsere Diskussionen verfolgen wird. Das ist eine wunderbare Idee!«
»Ich weiß nicht.«
»Vivian und Sven werden kaum wagen, den Mund aufzumachen. Und mein Mann …«, sie schüttelte den Kopf. »Auch für den wird es eine neue Erfahrung sein.«
»Frau Torgau, wenn ich ehrlich bin, sehe ich in mir das Gegenteil von einem Psychologen.«
»Glauben Sie, das merkt einer? Und wenn, ist es auch egal.« Sie griff nach ihrer Handtasche. »Also, wie sieht es aus? Schaffen Sie es, um eins bei uns zu sein? Dann gibt es Mittagessen.«
Ich sah zur Uhr. Der Anruf der alten Dame lag erst eine Stunde zurück. Vor ihrem Erscheinen im Büro hatte ich mir ein bisschen was über die Torgaus zusammengegoogelt. Ihre Villa lag außerhalb, man brauchte eine halbe Stunde mit dem Auto. Da blieb für das, was ich vorher noch erledigen musste, genug Zeit.
»Gut«, sagte ich. »Dann sehe ich nur ein Problem.«
»Und zwar?«
»Ich mag keine Schokolade.«
Kapitel 3
Als ich längere Zeit an einer Ampel hielt, merkte ich, wie sehr ich ins Schwitzen gekommen war. Hoch stand die Aprilsonne über dem Neckartal und leuchtete den Karfreitag bis in seinen letzten düsteren Winkel aus. Handtücher hatte ich nicht dabei, also trocknete ich mir Stirn und Gesicht mit einem Lappen aus dem Handschuhfach ab. Der Lappen roch nach Öl. Direkt unter dem rechten Auge gab es eine schmerzende Stelle. Wenn ich Pech hatte, wuchs mir da ein Veilchen. Ich kontrollierte mein Aussehen im Rückspiegel. Zerknautscht wie immer.
Auf dem Weg zur Torgau-Villa kam ich am Firmengelände vorbei. Fast idyllisch lag es in einem Neckarbogen zu Füßen hellgrüner Berghänge. Ich hielt an und stieg aus. Ein markanter Geruch lag in der Luft, süß, malzig und leicht angebrannt. Ohne diesen Geruch und ohne die großen Werbeplakate, die an den Gebäuden hingen, hätte man das Ganze auch für eine Ziegelei halten können oder für ein Sägewerk. Lang gestreckte Backsteingebäude, einige Lastwagen, Palettentürme, ein hoher schlanker Schornstein. Menschen waren keine zu sehen. Feiertagsstille.
Von den Plakaten lachte mich Schokolade an. Nicht der übliche Einheitsbrei rund um Vollmilch, Zartbitter und Nuss. Sondern das Beste vom Besten, lauter Edelware: Dark Cranberry. Fleur de sel. Mayatraum. Blutorange-Krokant. Kakaogehalt von 80 Prozent und mehr. Eine Spielwiese für Produktdesigner. War das überhaupt noch Schokolade? Um das zu entscheiden, war ich definitiv der falsche Mann.
Außerdem hatte ich Durst.
Auf sämtlichen Plakaten stand derselbe Spruch: »Glück ist Schokolade«. Darunter »Torgau« in goldener Schreibschrift, sonst nichts. Offenbar genügte der Name, um im Konsumenten die gewünschten Reaktionen hervorzurufen. »Torgau« lesen – Speichelfluss.
Mein Handy brummte. Eine Nachricht von Ariane. Sie machte sich Sorgen, wollte wissen, wie es lief. Ich schrieb kurz zurück, dass alles bestens sei, ich hätte mir einen dicken Auftrag geangelt. Ein Tropfen Schweiß zerplatzte auf dem Display, als ich die Nachricht abschickte. Ich wischte ihn weg und ging zum Auto zurück.
Glück ist Schokolade. Auch wenn ich in diesem Leben kein Fan von dem Zeug mehr werde, der Slogan gefiel mir. Einem Otto Normalverbraucher zerging er vermutlich auf der Zunge.
Die Sonne zur Linken, fuhr ich ein Stück Neckar abwärts, dann bog ich nach Norden in ein Seitental ab. Mein Hemd klebte im Nacken und unter den Achseln. Außerdem musste ich mir im Rücken etwas verdreht oder gezerrt haben. In einer Kurve links, hatte die Torgau gesagt, und bitte achten Sie auf den Gegenverkehr. Ich achtete auf den Gegenverkehr, bloß war da keiner. Also Blinker links und rein in die Wildnis. Auf einer Straße, die mir mit jedem Meter schmaler vorkam. Immerhin war sie frisch asphaltiert.
Weil die alte Torgau so auf ihrer blöden Kurve mit dem Gegenverkehr herumgeritten hatte, dachte ich, die einzige Gefahrenstelle der gesamten Strecke läge hinter mir. Das war falsch gedacht. Im Grunde war es überhaupt keine Gefahrenstelle, was jetzt kam, sondern ein Stück kerzengerade Straße, ohne jeden fahrerischen Anspruch, frei von Tücke.
Auch der Wagen, der mir entgegenkam, bereitete mir keine Sorgen. Eine schwarze Limousine, zwar etwas schneller unterwegs als ich, aber immer noch nicht schnell.
Nur dass da plötzlich ein Vieh über die Straße lief.
Also noch mal, zum Mitschreiben: Das Sträßchen war eng. Rechts und links dichter Wald, dunkle Braun-, zarte Grüntöne. Über uns ein schmaler Streifen Himmel. Und dann, ohne Vorwarnung, dieser rötliche Blitz, der von rechts über den Asphalt schoss. Ein Reh, aber das registrierte ich erst mit Verzögerung. Anderes nahm meine Aufmerksamkeit in Anspruch: der entgegenkommende Wagen, der ins Schlingern geriet. Das grelle Quietschen von Bremsen. Mein rechter Fuß, der das Bremspedal bis zur Schmerzgrenze durchdrückte. Die Limousine, die sich plötzlich querstellte. Der knapper und knapper werdende Abstand zwischen uns …
Ich hatte aufgeschrien und schrie immer noch. Die beiden Autos rutschten aufeinander zu, instinktiv riss ich das Lenkrad nach rechts. Noch fünf Meter, noch einen. Dann der Aufprall.
Stille.
Niemand schrie mehr. Nichts bewegte sich.
Das Reh war vermutlich längst über alle Berge. Das verfluchte scheiß Reh, das für alles hier die Verantwortung trug. Ich saß da, beide Hände um das Lenkrad geklammert, dass mir die Finger schmerzten. Mit einem Wut- und Angstgeheul brach gestaute Luft aus meinen Lungen und zeitgleich der Schweiß aus allen Poren. Hinter den Fenstern der Limousine war Bewegung, ich sah fuchtelnde Hände und das Weiß von Airbags.
Meiner hatte nicht einmal ausgelöst.
Es war also nur ein Witz von Aufprall gewesen, ein Aufprällchen, eher ein gegenseitiges Schmusen, ein sanftes Streifen der beiden Fahrzeuge – und trotzdem zitterten meine Knie, zitterte alles an mir, vom Kopf bis zu den Füßen, das Adrenalin jagte durch meinen Körper, ich hielt nicht mehr an mich, wollte nur noch raus, raus aus diesem verdammten Blechkäfig, also schnallte ich mich ab, kletterte über den Beifahrersitz, brauchte nur drei Versuche, um die Tür zu öffnen, und kroch ins Freie.
Wie gut die Luft draußen tat!
Gern wäre ich sitzen geblieben, mitten im Wald, auf der warmen Asphaltdecke. Doch ich hörte Stimmen. Die Insassen der Limousine stiegen ebenfalls aus. Mühsam kam ich auf die Beine und lehnte mich gegen die Kühlerhaube meines Wagens. Ich hasste das, was jetzt kam. Diese Suche nach Schuld und Verantwortung. Aber es half ja nichts. Schwer atmend musterte ich die Gegenpartei. Sie waren zu dritt. Drei Herren unterschiedlichen Alters, alle mit südländischem Teint und schwarzer Haarpracht. Zwei von ihnen trugen Bärte. Während der dritte noch vom Beifahrer- auf den Fahrersitz krabbelte, also den umgekehrten Weg ins Freie nahm wie ich, pflaumten sich die beiden anderen bereits an. Denen schien der kleine Zusammenstoß nicht viel ausgemacht zu haben. Oder es war ihre Art, den Schreck wegzustecken. Jedenfalls beschimpften sie sich wie die Beduinen. Soll heißen: auf Arabisch. Wobei ich gar kein Arabisch kann, es war nur so ein Gefühl. Wüstenaura, Kamele, Öl. Erst als Araber Nr. 3 die Protzkarosse erfolgreich verlassen hatte, geruhten sie, von meiner Anwesenheit Kenntnis zu nehmen.
»Alles in Ordnung mit Ihnen?«, fragte der eine in ordentlichem Deutsch.
»Geht schon, danke. Und bei Ihnen?«
»Nichts passiert.« Sein Kompagnon nickte, bloß der Dritte verzog das Gesicht und hielt sich die Seite. Den hatte vermutlich einer der Airbags malträtiert.
»Es war ein Reh«, sagte ich. Vielleicht kannten diese Ausländer keine Rehe. Und ein Kamel war es ja nicht gewesen. Außerdem verspürte ich das dringende Bedürfnis, ihnen einen Schuldigen zu nennen.
Aber da machten sich die beiden Bärtigen schon daran, den Schaden zu begutachten. Sie gingen um die Autos herum, bückten sich, tasteten ab.
»Ein Reh«, sagte ich zu dem Dritten. »Saublöd, so was.«
Er nickte schmerzverzerrt. Hatte also wirklich etwas abgekriegt, der Kerl. Schön. Da ich jemanden gefunden hatte, dem es schlechter ging als mir, kehrten augenblicklich meine Lebensgeister zurück. Ich trottete hinter den anderen beiden her, um mir selbst ein Bild von der Situation zu machen. Was meine Karre anging, so waren da nur kleinere Kratzer. Vorne links gab es eine Delle im Blech, den Rest hatte die Stoßstange abgefangen. Bei der Limousine waren die Schäden größer. Die Beifahrertür eingedrückt, dazu Kratz- und Schleifspuren entlang der gesamten Seite sowie Beulen über dem rechten Vorderrad. Da war ich mit meiner linken Flanke einmal an dem Luxusschlitten vorbeigeschrammt.
Schöne Scheiße.
»Oh Mann, Mann, Mann«, sagte ich. »Musste das jetzt passieren? Warum knallen die solche Viecher nicht ab, bevor sie ein Verkehrschaos anrichten?«
Jetzt begann eine lebhafte Unterhaltung zwischen den Bartträgern. Kein Zoff mehr, eher nach dem Motto: Wer zahlt? Du oder du oder der? Nun, das fragte ich mich auch gerade. Das blöde Reh hatte sich ja erfolgreich vor der Verantwortung gedrückt. Wenn ich mich recht erinnerte, war es genau zwischen uns über die Straße gelaufen, vielleicht eine Spur näher an den Arabern dran als an mir. Wir hatten beide gebremst, der Fahrer der Limousine sofort, ich einen Tick später. Andererseits musste der Typ etwas mit seinem Lenkrad angestellt haben, sonst wäre der Wagen nicht derart ins Schlingern geraten und ausgebrochen. So oder so, es blieb etwas an mir hängen.
Und das konnte ich in der aktuellen Situation überhaupt nicht gebrauchen.
»Schlimm?«, sagte der eine Araber und zeigte auf mein Auto.
Ich zuckte die Achseln. »Nicht sehr.«
»Bei uns auch nicht. Lassen wir reparieren. Kein Problem.«
»Und er hier?« Ich zeigte auf den dritten Mann, der sich vor Schmerzen krümmte.
»Alles gut. Wir fahren ihn ins Krankenhaus.« Auf einen kurzen Befehl hin ging sein Bartträgerkollege zum Auto und beugte sich ins Innere. Währenddessen sprach der andere weiter. »Wir sind Geschäftsleute. Businessmen. Auf dem Weg zum Flughafen. Deutsche Polizei können wir nicht gebrauchen. Hält auf. Gibt nur Ärger.«
Ich glaubte, nicht recht zu hören. Die wollten das hier ohne die Bullen regeln?
»Wir müssen unser Flugzeug erreichen. Deshalb: keine Polizei. Bitte.« Er zog einen Geldbeutel aus der Tasche und entnahm ihm eine Visitenkarte. »Hier, Namen und Adresse der Anwälte, die unser Unternehmen in Deutschland vertreten. Melden Sie sich dort wegen des Schadens.«
Zögernd nahm ich die Karte entgegen. Jetzt nur nicht zu schnell auf den Deal eingehen! Auch wenn ich am liebsten losgebrüllt hätte vor Erleichterung. Ich las den Namen einer Rechtsanwaltskanzlei aus dem Frankfurter Westend, die sich als Bevollmächtigte für diverse AGs und KGs aus Saudi-Arabien und Katar bezeichnete.
»Keine Polizei?«, sagte ich. »Nur dieses Kärtchen hier?«
Aber da stand schon der andere neben uns und hielt mir ein Bündel Geldscheine vor die Nase. »Das sollte reichen, um Ihr Auto zu reparieren. Wenn nicht, kontaktieren Sie unseren Anwalt.«
Gebannt starrte ich auf das Bündel Scheine. Als ich es nahm und kurz auseinanderblätterte, lachten mir mehrere 1000 Euro entgegen.
»Das … Ja, das könnte reichen.«
»Wir wären Ihnen sehr verbunden«, sagte der Erste.
Nr. 3 stöhnte auf und humpelte zum Wagen zurück. Wortlos steckte ich das Geld ein. Dann sah ich ihnen dabei zu, wie sie nacheinander einstiegen, wie der Fahrer den Motor anwarf und vorsichtig zurückstieß, um die Limousine anschließend an meiner Karre vorbeizulotsen. Surrend rauschte das Schiff davon.
»Was war denn das?«, sprach ich vor mich hin.
Es war gut, meine eigene Stimme zu hören. Auch wenn in ihr noch der Schrecken von eben nachklang. Langsam ging ich zu meinem Wagen zurück. Drei Klischee-Araber in einer Klischee-Karosse mit Klischee-Geld. Fehlte nur noch die verschleierte Schöne auf dem Rücksitz. Andererseits hatten sie keine Beduinengewänder getragen, sondern Westanzüge. Und sie hatten gut Deutsch gesprochen. Geschäftsleute, ja, das kam hin. Was wollten die an Ostern in dieser gottverlassenen Gegend?
Erst als ich wieder hinter dem Lenkrad saß und mich anschnallte, stellte ich fest, dass die Gegend so ganz gottverlassen nicht war. Ein paar Meter weiter kreuzte ein Waldweg die Straße. Hier war das blöde Vieh in seiner Panik vermutlich entlanggelaufen. Am Rand des Weges gab es einen Bildstock aus Sandstein, der den alten Jesus beim Tragen des Kreuzes zeigte. Die Figur war stark verwittert, ihre Züge konnte man nur erahnen. Vor dem Bildstock lagen frische Blumen.
War das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
Ich wusste es nicht.
Kapitel 4
Als ich schließlich weiterfuhr, tat ich es im Schritttempo. Hinter jedem Baum sah ich ein Lebewesen, das nur darauf wartete, sich mir in den Weg zu werfen. Mal war es ein Tier, mal ein Araber. Davon abgesehen rechtfertigte der Straßenverlauf mein Verhalten. Es ging stetig nach oben, Serpentine folgte auf Serpentine, Kurven ohne Zahl. Der Frühlingswald hüllte mich ein wie ein smaragdgrüner Kokon. Einem Reh begegnete ich nicht mehr, dafür hing plötzlich ein Wagen hinter mir. Im Rückspiegel sah ich, wie sein Heck nervös hin und her zuckte. Der wollte doch nicht etwa …? Nur weil ich ein paar Pulsschläge langsamer fuhr als sonst?
Ich hatte den Gedanken noch nicht zu Ende gedacht, als der Wagen, ein schwarzer Chrysler, an mir vorbeischoss. 100 Meter vor der nächsten Haarnadelkurve, der Idiot. Da er schon mal auf der Überholspur war, blieb er auch in der Kurve dort. Ich sah seine Bremslichter aufleuchten. Dann zog er heulend davon.
»Ihr seid doch …!« Mir blieb die Spucke weg. »Aber so was von bescheuert seid ihr! Vollpfosten! Hoffentlich knallt euch eine Rotte Wildschweine vor den Latz!«
Wer in dem Chrysler saß, hatte ich nur schemenhaft ausmachen können. Zwei Personen, Männer anscheinend, der auf dem Beifahrersitz hatte eine Glatze oder sehr kurz geschorenes Haar. Ich wollte wetten, dass sie dasselbe Ziel hatten wie ich.
Ein paar Serpentinen weiter erreichte ich einen Bergrücken. Der Weg führte nun wieder geradeaus, und irgendwann stand ich vor einem Tor, das sich wie von Geisterhand öffnete. Dahinter gab es einen Park, hohe Bäume und gestutzte Hecken, ich fuhr einen Kiesweg entlang, bis das Haus in Sicht kam. Mehrere Autos standen auf einem Parkplatz, unter ihnen der Chrysler. Ich stellte meine Karre direkt neben ihn, stieg aus und legte eine Hand auf die schwarz glänzende Kühlerhaube des Wagens.
Man hätte ein Ei darauf braten können.
Anschließend nahm ich die Villa in Augenschein. Es war, nun ja, ein Monstrum von Villa. Drei Stockwerke, dazu ein Dachgeschoss. Balkone, Erker, ein Türmchen, Fachwerk auf Sandsteinsockel. Jagdhausstil nannte man das wohl. Die Breite des Gebäudes schätzte ich auf 20 Meter, in der Länge hatte es noch einmal mehr.
Und in diesem Riesenkasten wohnten bloß drei Leutchen? Papa, Mama, Sohn?
Glück ist Schokolade. Für Familie Torgau schien die Gleichung auch in umgekehrter Richtung zu gelten: Schokolade ist Glück.
Eine Tür öffnete sich, ein Mann kam die Stufen herab. Anzug und Krawatte, eisgraues Haar, federnder Schritt. Dazu eine wie ins Gesicht gemeißelte Fröhlichkeit.
»Herr Koller!«, rief er winkend. Es war wohl als Frage gedacht, wirkte aber mehr wie ein Stellungsbefehl.
Ich nickte.
»Alles gleich gefunden? Gute Fahrt gehabt? Brettschneider mein Name. Die Hand kann ich Ihnen leider nicht geben: Ansteckungsgefahr!« Zur Demonstration seiner Unpässlichkeit streckte er beide Hände in die Höhe und spielte Luftklavier. »Ihrem Gepäck wird es nichts ausmachen, oder?« Er ging zum Kofferraum. »Hier drin, nehme ich an.«
»Eigentlich kann ich das selbst tragen.«
»Machen Sie mich nicht arbeitslos!«
Achselzuckend öffnete ich. Solange die Spuren des Zusammenstoßes unentdeckt blieben, war mir alles recht. Als der Kerl die beiden Stofftaschen sah, die ich mit meinen Sachen vollgestopft hatte, zog er die Brauen nach oben.
»Kleines Gepäck, was?«, rief er und langte herzhaft zu.
Ich griff nach der Notebooktasche, die ebenfalls im Kofferraum lag. »Das hier nehme ich.«
»Gern. Bitteschön, hier lang!«
Brettschneider schritt voran. Sein Gang und seine ganze Art hatten etwas Zackiges, das es mir schwer machte, sein Alter zu schätzen. Um die 60 war er vermutlich, dabei schlank, hellwach und augenscheinlich immer auf der Suche nach der nächsten sportlichen Herausforderung.
Am Haus angekommen, sprang er die drei Stufen nach oben und hielt mir die Tür auf.
»Immer rein in die gute Stube, Herr Koller!«
Ich nickte und trat ein. Vor mir lag ein großer Raum, eine Art Empfangshalle. Schemenhaft nahm ich große Bilder an den Wänden wahr, dunkle Möbel und ein schwarz-weißes Fliesenmuster. Vor allem aber roch es nach Schokolade. Sehr intensiv sogar. Bevor sich meine Augen ans Dämmerlicht gewöhnt hatten, war der fidele Grauschopf an meiner Seite und lotste mich zum gegenüberliegenden Ende des Raumes.
»Kommen Sie, bedienen Sie sich!«
Der süßliche Geruch ging von einer Art Brunnen aus. Eine Metallfigur, die einen halb nackten Turbanträger mit wulstigen Lippen darstellte, hob eine Schale in die Höhe, und diese Schale endete in einem Röhrchen, aus dem sich eine Flüssigkeit in ein ebenfalls metallisches Halbrund ergoss. Nur dass es sich bei der Flüssigkeit nicht um Wasser handelte, sondern um Schokolade. Hellbraune glänzende Schokolade.
»Damit hätte ich rechnen müssen«, sagte ich.
»Unser Begrüßungstrunk. Willkommen im Hause Torgau!« Er reichte mir einen kleinen Porzellanbecher.
Schokolade, ausgerechnet. Und dann vorm Mittagessen. Andererseits war ich nicht zum Vergnügen hier, sondern zum Recherchieren. Also nahm ich den Becher, hielt ihn unter den Schokostrahl, bis er zur Hälfte gefüllt war, und probierte. Das Zeug war warm und sämig und schmeckte eigentlich ganz normal. Wie normale Schokolade, meine ich, nicht wie irgendein Cranberry-Experiment.
»Nicht schlecht«, sagte ich.
»Nicht schlecht? Das hier ist Qualität, mein Lieber! Kakaoanteil 50 Prozent, keine Billigfette. Da müssen Sie lange suchen, bis Sie etwas Vergleichbares finden.«
»Gilt das auch für den Apparat hier?«
»Der dient eher Dekorationszwecken. Läuft nur an hohen Feiertagen. Macht aber was her, finden Sie nicht?« Er nahm mir den Becher ab und stellte ihn auf einen Teller zu zwei anderen benutzten. »Wir arbeiten noch dran, dass er fertige Täfelchen auswirft.« Lachend winkte er mich weiter.
Anstatt ihm zu folgen, blieb ich stehen. Es lag nicht an Brettschneider und seinem Dauerbeschuss guter Laune, dass ich erstarrte. Mein Blick war in einen Spiegel gefallen, der seitlich an der Wand hing. Der Spiegel zeigte mir jenen Mann, der sich Zutritt zum Haus der Torgaus verschafft hatte. Den Mann, der ich war. Einen Privatdetektiv namens Max Koller, angetreten, um einen Fall zu lösen. Ich spürte, wie sich alles in mir verkrampfte.
Das geht nicht gut, schoss es mir durch den Kopf. Du tust etwas Unrechtes. Mach einen Rückzieher!
»Herr Koller?«
Noch kannst du zurück, sagte der Mann im Spiegel. Noch ist es möglich.
»Alles klar bei Ihnen?«
»Ja«, sagte ich, »ich komme.«
Brettschneider nickte und drehte sich wieder um. Diesmal folgte ich ihm, alle Bedenken beiseiteschiebend wie einen lästigen Zeitgenossen. Breite Holzstufen führten hoch in den ersten Stock, an Blumenvasen und weiteren Gemälden vorbei. Gedämpft fiel das Tageslicht ins Treppenhaus, gedämpft waren auch unsere Schritte auf dem Läufer. Und noch immer hing der süßliche Geruch nach Schokolade in der Luft. Ich dachte an den Beinaheunfall von vorhin und an das Überholmanöver vor der Kurve.
»Wem gehört eigentlich der schwarze Chrysler vorm Haus?«, fragte ich, als wir das Obergeschoss erreicht hatten.
Brettschneider drehte sich um. »Der Chrysler? Mit dem ist Vivian gekommen, die Nichte von Herrn Torgau.«
»Fuhr sie selbst?«
»Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie kurz vor Ihnen eintraf, zusammen mit einem Bekannten. Warum fragen Sie?«
»Weil mich dieser Wagen unterwegs überholt hat. Aber wie! Mit einem Affenzahn, direkt vor einer Kurve.«
Er lachte schallend. »Dann war sie es! Bei Vivian geht alles immer zack-zack.«
Ich schwieg. Im ersten Stock angekommen, blieb Brettschneider vor einer Tür stehen und zog einen Schlüsselbund aus der Tasche.
»Bitte sehr«, sagte er und öffnete. »Ihr Domizil.«
Ich nahm ihm die beiden Stofftaschen ab und trat ein. Viel dunkles Holz, ein Doppelbett, hellblaue Bettwäsche, an der Wand der unvermeidliche Ölschinken mit Jagdszene.
»Fühlen Sie sich wie zu Hause. Wenn Sie mich brauchen, ich bin unten. Ansonsten erwarten die Torgaus Sie in«, er schob einen Jackenärmel zur Seite, »in exakt 22 Minuten. In 20 Minuten hole ich Sie ab.«
»Herr Brettschneider?« Ich ließ Notebook und Stofftaschen auf einen Stuhl gleiten. »Darf ich Sie etwas fragen?«
»Aber immer.«
»Waren Sie mal beim Bund?«
Er nahm Haltung an. Seine Nüstern blähten sich. »Zeitsoldat. 15 Jahre. Und Sie?«
»Bloß Grundwehrdienst. Aber es gibt so Dinge, die vergisst man nicht.«
»Wohl wahr«, strahlte er. »Wohl wahr. Wissen Sie, unsereins arbeitet im Hintergrund. Die Torgaus sind die Torgaus. Aber dass der Laden läuft, hier im Haus, meine ich, das liegt an mir. Bei aller Bescheidenheit.«
Kapitel 5
Genau 20 Minuten später stand er wieder vor meiner Tür. Ich hatte die Zeit damit zugebracht, meine Klamotten in einen Kleiderschrank zu räumen und das Notebook einzuschalten. Nirgendwo ein WLAN-Signal. Okay, das wunderte mich nicht. Die Villa lag schließlich völlig ab vom Schuss. Ungewöhnlich war allerdings, dass auch mein Handy keinen Empfang hatte. Ich probierte es in allen Zimmerecken, hielt das Ding so weit wie möglich aus dem Fenster – nichts. Kein Netz. Lebten die Torgaus etwa offline?
»Ich hoffe, Sie haben Hunger mitgebracht«, sagte Brettschneider, während er mich durch das Haus lotste.
»Was gibt’s denn?«, fragte ich zurück.
»Wild.«
»Klingt gut. Was denn?
»Kaninchen.«
Ich blieb stehen. »Kaninchen?«
»Vom Hausherrn persönlich geschossen. Heute früh, frischer geht es nicht.«
»Herr Torgau ist Jäger?«
»Wenn er die Zeit dazu findet. Vor großen Familienessen nimmt er sie sich. Bitte hier lang.«
Schweigend folgte ich Brettschneider in den zweiten Stock. Kaninchen also. Was sollte ich davon halten? Stammten die Augen des Schokohasen, den Frau Torgau gefunden hatte, am Ende aus der Jagdbeute ihres Mannes? Wenn er sich sehr früh auf den Weg gemacht hatte, bestand zumindest rechnerisch die Möglichkeit. Andererseits wäre es schon sehr auffällig gewesen, ausgerechnet ein Tier zu verwenden, das er persönlich erlegt hatte. Und einen Sinn ergab es auch nicht. Weshalb sollte Torgau seine Frau mit einem Monsterhasen erschrecken? Oder sonst jemand aus dem Haus? Der Verdacht fiele doch sofort auf die Bewohner.
»Wer lebt eigentlich alles in der Villa?«, fragte ich Brettschneider. »Nur die Torgaus?«
»Die Torgaus und ihr Sohn Tassilo. Außerdem Jeanette, das Hausmädchen, allerdings nicht durchgehend. Und ich. Ebenfalls nur zeitweise.«
»Neffe und Nichte nicht?«
»Aber nein! Vivian wohnt in Hamburg, Sven in Frankfurt. Es gibt noch eine Köchin und den Gärtner, aber die übernachten so gut wie nie in der Villa.« Er hielt vor einer Tür an und klopfte. »An Ostern auch nicht.«
»Herein!«, kam es von innen. Ich erkannte die Stimme meiner Auftraggeberin.
Brettschneider öffnete. »Bitte, Herr Koller, nach Ihnen.«
Bei dem Raum, den ich betrat, handelte es sich um ein Arbeitszimmer mit breitem Schreibtisch und Bücherwand. Auch hier war alles im schweren dunklen Jagdhausstil gehalten, von den Möbeln über die Wände bis zum Teppich. In einem Ledersessel saß, oder besser: lag ein Mann, den Kopf nach hinten überstreckt, Blick zur Decke. Mit einer Hand hielt er sich ein blutiges Taschentuch unter die Nase. Neben ihm stand Frau Torgau.
»Erschrecken Sie nicht«, sagte sie in einem Ton, der zum Sarkasmus neigte. »Er hat bloß Nasenbluten.«
»Entschuldigung«, kam es gedämpft aus dem Sessel. Für den alten Torgau war der Mann zu jung, außerdem schien mir Nasenbluten nicht zu einem Firmenpatriarchen zu passen. Das hier war offenbar der Sohn, der mit dem seltsamen Vornamen.
»Soll ich den Erstehilfekoffer holen?« Brettschneider war schon auf dem Sprung.
»Ach was«, winkte die Torgau ab.
»Nein, nein«, sekundierte ihr Sohn.
»Ich bin sofort wieder da.«
»Lassen Sie es gut sein, Herr Brettschneider, wir kommen schon zurecht. Danke.«
Der Grauhaarige nickte und verließ das Zimmer.
»Es tut mir leid«, näselte Torgau junior, zu mir schielend. »Geht gleich vorbei.«
»Ich kann auch später wiederkommen«, schlug ich vor.
Frau Torgau schüttelte den Kopf. »Später essen wir. Tassilo hat ständig Nasenbluten, das brauchen Sie nicht ernst zu nehmen. Tassilo, darf ich dir Herrn Koller vorstellen, unseren heutigen Gast? Ein bekannter Psychologe aus Heidelberg.«
Tapfer stemmte sich der Sohn in die Höhe und kam mit ausgestreckter rechter Hand auf mich zu. Dabei legte er den Kopf weiter in den Nacken, während er mit der Linken das Taschentuch gegen die überlaufenden Nasenlöcher drückte.
»Tassilo Torgau«, sagte er. »Angenehm.«
Ich schüttelte seine Hand. »Max Koller. Ihre Mutter hat mich eingeladen.«
Er deutete ein Nicken an. Mit dem Kopf im Nacken. »Aus Heidelberg kommen Sie?«
»Ja.«
»Setz dich lieber wieder hin«, seufzte Frau Torgau.
»Tut mir leid, dass ich Ihnen hier so was vorblute, Herr Koller. Es kommt vom Asthma.«
Nasenbluten vom Asthma? Ich bin kein Mediziner, aber dass es hier keinen Zusammenhang gab, wusste sogar ich.
Er zwinkerte heftig mit den Augen. »Wir haben unten im Keller einen Salzraum. In dem bin ich oft wegen meines Asthmas. Und das Salz macht meine Nase kaputt. Die Schleimhäute und all das.« Wie aufs Stichwort lief ein rotes Rinnsal Richtung Mundwinkel. Gurgelnd ließ er sich wieder in den Sessel plumpsen und starrte zur Decke.
»Vielleicht wäre ein Erstehilfekoffer doch angebracht«, sagte ich.
Frau Torgau winkte ab. »Nehmen Sie Platz, Herr Koller.«
Das tat ich, nur um mich gleich wieder zu erheben, denn in einer offenen Seitentür erschien der Hausherr, Edgar Torgau. Diesmal war er es wirklich. Ein Wonneproppen von einem Mann, das breite Gesicht bis in die hintersten Winkel durchblutet, beide Fäuste in die Hüften gestemmt. Er trug einen dunkelblauen Anzug, über seinem Bauch spannte die Weste.
»Wieder die Nas’?«, dröhnte er durch den Raum.
Sein Sohn nickte.
»Geh zum Arzt, Junge, wie oft soll ich dir das noch sagen? Bevor dir das Hirn auf den Teller tropft. – Herr Koller!« Dem Ausrufezeichen schickte er seine Hand hinterher. Kräftig war sie, warm und gut gepolstert. »Herzlich willkommen in unserer bescheidenen Hütte. Ich hoffe, Sie haben gutes Wetter mitgebracht. Sonst kriegen Sie nämlich nichts zu essen. Darf ich erfahren, wie wir zu der Ehre kommen, Sie heute als Gast bei uns zu haben?«
Während er sprach, musterte er mich von Kopf bis Fuß. Die dicken Gläser seiner Brille verzerrten seine Augen auf geradezu groteske Weise. Unwillkürlich musste ich an den Schokohasen mit den hineingepressten Augäpfeln denken.
»Er ist Psychologe«, kam es piepsend aus dem Sessel.
»Ach was!« Torgau ließ meine Hand los. »Psychologe? Nä!«
Auf dieses ultimative »Nä!« wusste ich im ersten Moment nichts zu erwidern.
»Warum nicht?«, entgegnete Frau Torgau an meiner Statt. »Psychologischer Sachverstand ist niemals von Schaden. Ich habe Herrn Koller gebeten, unsere spezielle Familiensituation unter die Lupe zu nehmen. Vom Standpunkt des Fachmanns aus. Vielleicht gelingt es ihm ja, die eine oder andere Blockade zu lösen. Zum Wohl der Firma.«
»Ach das!«, rief ihr Mann. »Ach so! Na, das ist ja mal ’n prächtiger Gedanke. Da hast du meine vollste Unterstützung, Schnauz. Meine vollste. Auch wenn wir eher einen Ringrichter bräuchten als einen Psychologen, nicht wahr?«
»Wo ist der Unterschied?«, sagte ich.
»Sehr richtig!«, platzte er los und lachte sich herzhaft aus. »Sehr richtig, nä?« Bevor ich reagieren konnte, legte er seinen Arm um meine Schulter. »Also ich weiß ja nicht, was meine Frau Ihnen alles erzählt hat, Herr Koller, aber eines steht so fest wie der Kölner Dom: Ich liebe meine Familie. Und meine Familie liebt mich. Mein Neffe, meine Nichte: Prachtkerls sind das. Um nichts in der Welt geb ich die her. Aber auch in den besten Familien wird gestritten. Ist doch so, oder? Was sagen Sie als Psychologe?«
»Natürlich.«
»Streit gehört dazu. Hinterher verträgt man sich wieder. Das sehen Sie doch genauso?«
»Worum dreht sich denn Ihr Streit?«
Er nahm den Arm von meiner Schulter.
»Ach«, sagte er wegwerfend, während ich mein Hemd zurechtzupfte. »Nä! Lappalien. Wie es weitergeht mit der Firma. Wie wir uns in Zukunft aufstellen. Im Grunde sind wir uns einig. Nur die Details, die Einzelheiten, die sorgen manchmal für Zwist.« Ruckartig drehte er sich um. »Aber deswegen hast du hoffentlich nicht Nasenbluten, Junge! Weil Sven und Vivian anderer Meinung sind als wir? Wenn du den Laden mal übernehmen willst, musst du noch ganz andere Sachen aushalten.«
»Deswegen doch nicht«, sagte Tassilo und brachte seinen Kopf wieder in Normalstellung. »Ist schon vorbei, Papa.«
»Dann können wir ja zum Essen schreiten. Mögen Sie Kaninchen, Herr Koller? Oder gehören Sie auch zur Liga der Radikalveganer?«
»Bisher nicht, nein.«
»Sehr gut. Stürzen wir uns in die Schlacht!«
Mit diesen Worten rumpelte er hinaus. Ich hatte noch nie einen Menschen von derart niederwalzender Fröhlichkeit erlebt. Gute Laune schien in diesem Haus zur Grundausstattung zu gehören, siehe Exsoldat Brettschneider. Nur Frau Torgau brachte aus Prinzip die Mundwinkel nicht auseinander. Und was ihren Sohn anging, so musste man abwarten, wie er sich verhielt, wenn er mal gerade nicht in Blut schwamm.
Apropos Sohn.
Zu viert steuerten wir die Treppe nach unten an, als mich Tassilo am Arm packte. »Moment bitte«, flüsterte er. Und laut zu seinen Eltern: »Wir kommen nach. Geht schon mal vor.«
Seine Mutter zog die Brauen zusammen, nickte aber und stieg die Stufen hinab.
Tassilo wartete, bis sie außer Hörweite waren, dann sagte er: »Koller heißen Sie? Max Koller?«
Ich nickte.
»Den Namen habe ich schon mal gehört. Letztes Jahr, glaube ich. Sie standen in der Zeitung. Es ging um einen Fall … ich weiß nicht mehr. Nur noch, dass Sie der Polizei geholfen haben. Sie sind Detektiv oder so was.«
»Psychologen arbeiten manchmal mit der Polizei zusammen«, sagte ich.
Er schüttelte den Kopf. »Nee, das war’s nicht. Es war etwas Handfesteres. Sie sind Detektiv, hieß es, wollten sich aber zur Ruhe setzen.«
»Eben deshalb bin ich jetzt als Psychologe tätig«, seufzte ich. Es machte keinen Spaß, Leute anzulügen, nur weil ich es der alten Torgau versprochen hatte.
»So?« Er blickte mich skeptisch an. Unter einem seiner Nasenlöcher krustete Blut. »Wie dem auch sei, letztlich spielt es keine Rolle, ob Sie als Detektiv oder als Psychologe hier sind. Ich will auch gar nicht wissen, was der wahre Grund ist, warum Sie meine Mutter eingeladen hat. Allerdings habe ich einen Verdacht.«
Ich schwieg. Er wartete auf eine Reaktion meinerseits, und als keine kam, zuckte er mit den Achseln.
»Okay, kommen Sie mit.«
Er führte mich zu einer Tür, hinter der ein unaufgeräumtes Zimmer lag. Bücher, Zeitungen, ein Klavier mit Stapeln von Notenheften darauf, ein Paar Hanteln, ein Fernseher – Junggesellenaura. Tassilo schloss die Tür hinter mir und ging zu einem Schrank, den er aufsperrte. »Vielleicht ist es ganz gut, dass Sie hier sind«, sagte er, während er dem Schrank einen Gegenstand entnahm. Dann drehte er sich um.
In der Hand hielt er einen Osterhasen aus Schokolade. Im Kopf steckte ein einzelner überdimensionierter Augapfel. Daneben war die Schokolade herausgebrochen; gut möglich, dass es sich auch hier einmal um ein Paar von Augen gehandelt hatte.
Von Kaninchenaugen, um exakt zu sein.
»Woher haben Sie das?«, fragte ich.
»Der hübsche Kerl lag unter meinem Auto. Gleich bei der Fahrertür, ich wäre fast draufgetreten.«
»Hier vorm Haus?«
»Ja.«
Ich nahm ihm den Monsterhasen ab. »Mit nur einem Auge?«
»Der Hase Polyphem«, nickte er. »Hat meine Mutter auch so einen gefunden?«
»Wie kommen Sie darauf?«
Er lachte. »Na hören Sie mal. Wenn Mutter am frühen Karfreitag nichts Besseres zu tun hat, als nach Heidelberg zu düsen, nur um einen Psychologen fürs Wochenende einzuladen, der sich als Detektiv entpuppt – dann wird das ja wohl einen Grund haben.«
Schweigend begutachtete ich den Hasen von allen Seiten. Er hatte die gleiche Größe und das gleiche Aussehen wie der von Frau Torgau. Auch das Auge saß an der entsprechenden Stelle. Der einzige Unterschied bestand darin, dass Tassilos Hase einäugig war. Vielleicht hatte der Täter hier noch geübt.
»Und? Was halten Sie von der Sache?« Ich gab ihm das Ding zurück.
»Was ich davon halte? Ist doch klar, da will uns jemand drohen.«
»Meinen Sie?«
»Herr Koller.« Fast vorwurfsvoll sah er mich an. »Wenn Sie ein Unternehmen führen, wie wir es tun, müssen Sie sich andauernd mit solchen Verrücktheiten auseinandersetzen. Und da lernen Sie zu unterscheiden: zwischen Albernheiten und echten Drohungen. Das hier«, er hielt den Hasen in die Höhe, »ist ernst gemeint. Da kommt noch was nach, glauben Sie mir.«
Kapitel 6
Der Speisesaal lag zu ebener Erde im hinteren Teil der Villa. Schon von Weitem drang Kindergeschrei durch die Flure. Niemand beachtete Tassilo und mich, als wir eintraten. Die allgemeine Aufmerksamkeit galt – nun ja, sie galt einem Paar Füße. Die Füße steckten in einer Art Lederpantoffeln, und das sah man, weil sie in Augenhöhe durch den Raum schaukelten. Übrigens falsch herum, Sohle nach oben. Von dem, was sich unterhalb der Füße befand, von ihrem Eigentümer also, sah man eher wenig; die tobenden Kinder, drei Stück an der Zahl, versperrten die Sicht. Dass der Mann einen sehnigen, durchtrainierten Körper besaß, ließ sich nur erahnen, ebenso, dass er eine Leinenhose und ein Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln trug. Ganz unten lugte ein kahl geschorener Kopf zwischen den Armen hervor.
»Was ist denn hier los?«, hörte ich Tassilo neben mir sagen. »Zirkus Krone, oder was?«
Meine Gedanken gingen in eine ähnliche Richtung. Einen Akrobaten hätte ich in der Torgau-Villa nicht unbedingt erwartet. Unter dem Beifall und Gelächter der Kinder lief der Mann auf seinen Händen einmal quer durch den Saal. An der gegenüberliegenden Wand machte er kehrt. Immer noch auf den Händen.
»Dshieses, Dshieses!«, brüllten die Knirpse. Es waren zwei Mädchen und ein Junge, allesamt im Grundschulalter.
Die beiden Torgaus waren ebenfalls schon da und verfolgten das Schauspiel mit einer Mischung aus Amüsement und Herablassung. Eine blonde, stark geschminkte Frau, vermutlich die Mutter der Kiddies, versuchte, die Begeisterung ihrer Sprösslinge auf ein erträgliches Maß zu dimmen, hatte aber wenig Erfolg. Endlich sprang der Zirkusartist wieder auf die Füße und klatschte die Kinder ab, eines nach dem anderen.
»Er hat uns Eier aus den Ohren gezaubert, Opa«, schrie der Junge. »Echt wahr, jedem von uns. Ostereier!« Triumphierend streckte er ein bemaltes Ei in die Höhe. Die Beweisstücke seiner Schwestern folgten umgehend.
»Hättest dir mal gescheit die Ohren waschen sollen«, polterte Großvater Torgau. »Dann wär das nicht passiert.«
»O doch«, sagte der Akrobat. »Solche Eier wachsen nur in gewaschenen Ohren.« Grinsend fuhr er sich über den rasierten Schädel. Außer einem rot angelaufenen Gesicht zeigte er keinerlei Spuren von Anstrengung. Seine Züge hatten asiatischen Einschlag: runder Kopf, Schlitzaugen, kleine Nase.
»Was Sie alles können!«, trällerte die Blonde, während sie eines der Mädchen streichelte. »Daran werden sich die Kinder noch lange erinnern.« Sie lächelte ihn an, aber irgendwas in ihrem Blick gefiel mir nicht. Als wäre ihrem Lächeln eine unterschwellige Botschaft mitgegeben: Finger weg von meinem Nachwuchs! Ich muss allerdings zugeben, dass ich mich nicht lange bei ihrem Blick aufhielt, so großzügig war ihr Kleid dekolletiert.
»Das ist übrigens Herr Koller«, mischte sich Tassilo ein.
Er hätte auch eine Bemerkung über das Wetter machen oder einfach schweigen können, der Effekt wäre vergleichbar gewesen. Blondie blinzelte immer noch dem Asiaten zu, der mit ihren Kindern schäkerte, und die wiederum interessierten sich ohnehin nicht für Wesen, die drei oder vier Mal so alt waren wie sie und nicht mal auf den Händen laufen konnten. Wer musste es richten? Der Hausherr.
»Ariane, Liebes, darf ich dir unseren Gast vorstellen?«, rief er und packte mich am Arm. »Herr Koller, das ist Ariane, die Frau meines Neffen Sven. Gewissermaßen meine Schwiegernichte.«
Nach einer Schrecksekunde fanden sich unsere Hände, unsere Blicke auch. Allerdings waren es irritierte Blicke, ihrer ebenso wie meiner, und das verstärkte die gegenseitige Irritation noch einmal.
»Ariane heißen Sie?«, sagte ich. »Stimmt das?«
»Herr Koller?«, gab sie zurück. »Kennen wir uns? Waren Sie mal im Fernsehen? Oder in der Zeitung?«
»Eher nein.«
»Fußballtrainer?«
»Psychologe.«
»Ah.« Ihre Augen wurden groß und rund. »Und was ist an meinem Namen so Besonderes?«
»Eigentlich nichts. Nur dass eine … Also eine Freundin von mir heißt auch Ariane. Und so häufig ist der Name ja nicht.«
»Da sieht man es mal wieder«, dröhnte Torgau dazwischen, »so klein ist die Welt.« Er schob mich in Richtung des Akrobaten. »Hier hätten wir noch Herrn Brandmüller, ebenfalls Gast unseres Hauses.«
»Dshingis Brandmüller«, lächelte der Asiate. »Angenehm.« Sein Händedruck war fest, beinahe zu fest.
»Wir kennen uns auch erst seit gerade eben«, erklärte Torgau. »Meine Nichte Vivian hat ihn mitgebracht. Wo seid ihr beiden euch noch mal über den Weg gelaufen?«
»Er gab ein Seminar bei uns in Hamburg«, sagte jemand hinter mir. Ich drehte mich um. Die Frau, die da stand, war eindeutig eine Frau. Allerdings tat sie eine ganze Menge dafür, nicht so zu wirken. Von der Figur her konnte sie als sportlicher junger Mann durchgehen. Sie trug Kurzhaarfrisur und einen schwarzen Anzug. Auf Ohrringe verzichtete sie ebenso wie auf sonstigen Schmuck, geschminkt war sie allenfalls dezent. Trotzdem musste man ihre Verkleidung als misslungen bezeichnen. Sie war und blieb eine Frau, und zwar eine verdammt gut aussehende. Eine Schande, dass ich sie beim Eintreten übersehen hatte. Daran war nur die Handstandnummer ihres Fernostlers schuld.
»Herr Koller, ich grüße Sie«, sagte Vivian Torgau.
Nun schüttelte ich also auch der Nichte die Hand. Hatten wir jetzt alle? Nein, Vivians Bruder Sven, der Gatte der Blonden, fehlte noch. Trotzdem bat uns der Hausherr zu Tisch, das heißt, er trieb uns mit launigen Bemerkungen, Schulterklapsen und Sprüchen, unter Einsatz seiner ganzen lärmenden Frohnatur also, zu unseren Plätzen, gab dem unvermeidlichen Brettschneider, der eben zur Tür hereinschaute, die Anweisung aufzutragen und nahm selbst am Kopfende der Tafel Platz. Direkt über ihm ragte ein Hirsch aus der Wand, der präparierte Kopf eines stattlichen Sechzehnenders. Irgendwie passend.
»Ist das eine gute Freundin von Ihnen, diese Ariane?«, flüsterte mir die Blonde im Vorbeigehen zu.
»Schon, ja. Warum?«
Ihre Lippen kräuselten sich. »Es klang so.«
Zusammen mit ihren Kindern setzte sie sich ans andere Ende des Tisches. Ich saß zwischen Frau Torgau und Tassilo, mir gegenüber der Asiate mit Vivian. Svens Platz blieb leer. Eine nicht mehr ganz junge, aber immer noch ansehnliche Frau im Sommerkleid brachte Getränke: Rotwein für Torgau, Vivian und mich, Saft für die Kinder, Wasser für alle. Das war dann wohl Jeanette, das Hausmädchen. Als sie mir einschenkte, wehte mich ein Gemisch aus Lavendel und Rosenblüte an, das mir den Atem raubte. Währenddessen wirbelte Brettschneider mit der Vorspeise herein, einer Spargelcremesuppe. Kerzen wurden angezündet, Teller ausgeteilt. Brettschneider trug weiße Handschuhe, vielleicht wegen seiner Erkältung.
»Und ihr wisst ja«, ermahnte er die Kinder augenzwinkernd. »Ratzeputz aufessen, sonst regnet es morgen.«
»Bäh«, schrien die drei. »Spargel ist eklig!«
»Ach, ist das schön, euch alle wieder hier zu haben.« Der Hausherr lehnte sich zurück und breitete die Arme aus. »Nicht wahr, Schnauz? An den Enkeln sieht man, wie die Zeit vergeht.«
»An der Suppe fehlt Salz«, sagte seine Frau. »Ich muss mit der Köchin reden.«
Gleich darauf stürmte ihr Neffe in den Saal: Sven Torgau, der Vater des Knirpstrios und Mann der Blonden. Mit seiner Schwester hatte er nicht viel gemein, weder die Figur noch die Haltung und schon gar nicht die Attraktivität. Sein Haar war dunkel, aber schütter. Und das massive Kreuz passte überhaupt nicht zur schlappen Wölbung seines Bauches. Oben Muckibude, unten Midlife-Crisis.