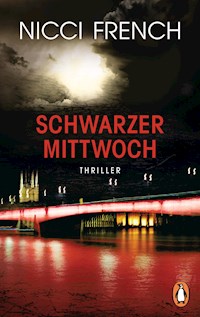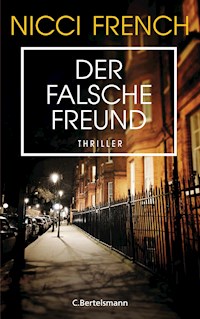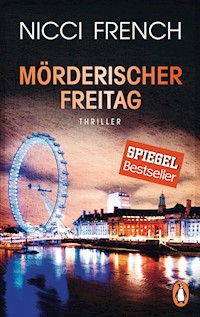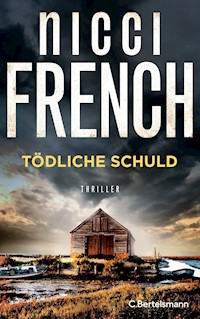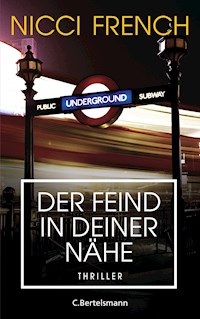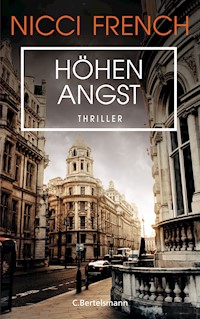7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dein Kind ist verschwunden - und keiner glaubt dir ...
Der Schrecken beginnt als Idylle. Auf sandling Island hält der Winter Einzug, doch Nina ist an ihrem vierzigsten Geburstag mit den Gedanken bereits im sonnigen Florida. In wenigen Stunden wird sie mit ihren beiden Kindern zum Flughafen aufbrechen. Nur dass die 15-Jährige Tochter Charlie nicht nach Hause kommt. Nina wird schnell klar, dass jede Minute zählt. Sie muss Charlie finden - ksote es, was es wolle ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 460
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Nicci French
Acht Stunden Angst
Psychothriller
Deutsch von Birgit Moosmüller
Buch
Der Schrecken beginnt als Idylle. Es ist kurz vor Weihnachten, und auf Sandling Island, einer kleinen Insel unweit der englischen Küste, hält der Winter Einzug. Doch Nina Landry ist an ihrem 40. Geburtstag mit den Gedanken bereits im sonnigen Florida. In wenigen Stunden wird sie mit ihrer fünfzehnjährigen Tochter Charlie und ihrem elfjährigen Sohn Jackson zum Flughafen aufbrechen. Unterwegs werden sie Christian abholen, mit dem Nina seit wenigen Monaten eine neue Liebe verbindet. Endlich scheint die schwere Zeit vorbei, in der sie von ihrem Mann Rory verlassen wurde und ihre Tochter mit Mobbing-Problemen in der Schule zu kämpfen hatte.
Doch dann taucht Charlie, die die Nacht nicht zuhause verbracht hat, einfach nicht auf. Ninas Unruhe wächst von Minute zu Minute, wird zur Besorgnis und schließlich zur Panik. In diesem Albtraum ist sie allein mit den sie peinigenden Fragen. Ist Charlie ausgerissen? Oder ist ihr etwas Schlimmes zugestoßen? Und warum will niemand glauben, dass sie verschwunden ist? Langsam bricht der Abend über die Insel herein – und aus einem bösen Verdacht wird allmählich schlimme Gewissheit. Charlies Rettung gerät zu einem atemlosen Wettlauf gegen die Zeit …
Autorin
Hinter dem Namen Nicci French verbirgt sich das Ehepaar Nicci Gerard und Sean French. Seit langem sorgen sie mit ihren höchst erfolgreichen Psychothrillern international für Furore. Sie leben mit ihren Kindern in Südengland.
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel »Losing You« bei Michael Joseph, an imprint of Penguin Books, London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Taschenbuchausgabe Dezember 2008 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Copyright © der Originalausgabe 2006 by Joined-Up Writing, Ltd. Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2007 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlaggestaltung: Design Team München Umschlagmotiv: plainpicture/Boe An · Herstellung: Str.
ISBN: 978-3-641-24602-0V001
www.goldmann-verlag.de
www.randomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Manchmal hatte ich immer noch das Gefühl, am Ende der Welt gelandet zu sein. Das winterliche Licht über der flachen, farblosen Landschaft, das Heulen des Windes, das Geschrei der Seevögel und das melancholische Tuten des Nebelhorns weit draußen auf dem Meer – das alles ließ mich für einen Moment schaudern, aber dann stampfte ich energisch mit den Füßen, um sie wieder warm zu bekommen, und sagte mir, dass ich in ein paar Stunden weit weg sein würde.
Rick ließ den Schraubenschlüssel fallen, richtete sich vor der geöffneten Motorhaube meines Wagens auf und rieb seine abgeschürften Knöchel. Der eisige Nordostwind, der über uns hinwegpeitschte, trug bereits die ersten Regentropfen mit sich. Ricks unrasiertes Gesicht war von der Kälte gerötet, seine hellblauen Augen wirkten wässrig, und seine Locken klebten ihm feucht am Kopf, so dass ich die Form seines Schädels erkennen konnte. Er blies in seine vor Kälte weißen Finger und sah mich dabei an. Sein sonst so jungenhaftes Lächeln wirkte gezwungen.
»Rick«, sagte ich. »Es ist lieb von dir, aber du brauchst dich wirklich nicht so abzumühen. Mir ist nur dieses Klappern aufgefallen, und deswegen dachte ich, am Motor wäre irgendetwas locker. Sonst hätte ich dich nie angerufen. Ich kann den Wagen in die Werkstatt bringen, wenn wir aus dem Urlaub zurück sind.«
Gerade trat seine Frau Karen aus dem Haus. Sie trug ein Tablett mit drei großen Bechern Kaffee. Neben jeder der Tassen hatte sie einen Keks platziert. Sie war grobknochig, aber dünn, und fast so groß wie Rick. Manchmal sah sie richtig gut aus, beinahe schön, und dann konnte ich auch verstehen, warum die beiden zusammengefunden hatten, aber allzu oft wirkte sie ausgemergelt und ein wenig ungepflegt, als würde sie ihrem Äußeren nicht genug Aufmerksamkeit schenken. Ihr braunes, schon etwas grau meliertes Haar war zu einem unordentlichen Knoten zusammengedreht. In ihr Gesicht hatten sich Sorgenfalten eingegraben, und ihre Fingernägel waren abgekaut. Sie trug nur selten Make-up oder Schmuck, abgesehen von ihrem Ehering. Was sie anhatte, passte nie so ganz zusammen: Heute war es eine erdbeerfarbene Steppjacke, kombiniert mit einem dünnen schwarzen Rock, der über den Boden schleifte. Ich befürchtete, dass sie darauftreten und stolpern würde. Sie hatte die ein wenig abrupte Art eines grundsätzlich schüchternen Menschen, und irgendwann hatte sie mir mal in leicht beschwipstem Zustand gestanden, dass es ihr vorkomme, als würde das Leben wie aus einem Nebel auf sie einstürzen und ihr dadurch eine Überraschung nach der anderen bescheren. Vielleicht war das der Grund, warum sie oft unlogische Schlussfolgerungen zog und häufig zwischen Sarkasmus und kaum unterdrückter Wut hin- und herschwankte.
»Mit Milch, aber ohne Zucker, richtig? Wie läuft es denn? Alles wieder in Ordnung?«
Rick verzog entnervt das Gesicht und nickte dann auf den Boden hinunter, wo die Batterie meines Wagens und ein paar andere Teile lagen, die ich nicht identifizieren konnte. Ein kleines Funkeln trat in Karens Augen.
»Als du zurückgekommen bist, hast du doch gesagt, dass es nur ein paar Minuten dauern würde.«
»Ich weiß«, antwortete Rick trocken.
»Das war vor zehn.« Sie warf einen demonstrativen Blick auf ihre Armbanduhr. »Du werkelst jetzt schon fast eine Dreiviertelstunde hier draußen herum.«
»Das weiß ich auch.«
»Nina muss ein Flugzeug erwischen.« Sie sah mich mit einem amüsierten Lächeln an, das so viel hieß wie: Männer! Ich wandte schuldbewusst den Blick ab.
»Ich weiß.«
»Keine Sorge«, sagte ich. »Ich habe schon das meiste gepackt, zumindest für mich und Jackson, und Charlie hat versprochen, fertig zu sein, bis ich zurückkomme.«
Ricks Kopf verschwand wieder unter der Motorhaube. Ein paarmal war ein scharfes Klopfen zu hören, dann ein unterdrücktes Fluchen. Das Ganze entbehrte nicht einer gewissen Komik, aber da Rick es offensichtlich überhaupt nicht lustig fand, biss ich mir auf die Lippe, um selbst den leisesten Anflug eines Lächelns zu unterdrücken. Ich zog meine Handschuhe aus, um meinen Kaffee entgegenzunehmen. Beide Hände an die heiße Tasse gepresst, genoss ich dankbar den wärmenden Dampf, der vor meinem kalten Gesicht aufstieg.
»Weihnachten in der Sonne statt hier in diesem ewig grauen, kalten Nieselregen«, meinte Karen, während sie sich fester in ihre Jacke wickelte. »Wann geht denn euer Flugzeug?«
»Erst kurz vor sechs. Auf dem Weg nach Heathrow werde ich Christian aufsammeln.«
Obwohl ich das ganz beiläufig sagte, spürte ich in meiner Brust ein kleines Prickeln: Christian und ich waren zwar schon seit fast achtzehn Jahren befreundet, aber erst seit wenigen Monaten ein Liebespaar, und nun würden wir zu viert nach Florida fliegen und dort zwei Wochen auf den Keys verbringen. Wir würden die Familie sein, von der ich befürchtet hatte, sie wäre für immer zerschlagen. Wir würden Ausflüge machen, Pläne schmieden, gemeinsam erlebte Geschichten sammeln, die wir uns später wieder erzählen konnten, und sogar zusammen frühstücken. Mit Ausnahme von Charlie, die grundsätzlich nie frühstückte. Sie tat, als wäre Toast etwas Unmoralisches. Ich hoffte, sie würde sich benehmen.
»Ich finde, Weihnachten sollte abgeschafft werden«, erklärte Karen gerade. »Eamonn hat damit sowieso eine Art ideologisches Problem und versucht immer, uns dazu zu bringen, stattdessen die Wintersonnenwende zu feiern. Wenn es nach ihm ginge, würden wir mitten in der Nacht wie Hexen um ein Lagerfeuer stehen. Rick versucht uns zu Brettspielen, Scharaden und Wink Murder zu animieren, obwohl man Wink Murder gar nicht richtig spielen kann, wenn man nur zu dritt ist, und ich …«, sie sah mich an und hob dabei eine Augenbraue, »… ich trinke zu viel und lasse den Truthahn anbrennen.«
Rick kam zur Fahrertür und beugte sich in den Wagen, um den Motor anzulassen.
»Jetzt aber los!«, meinte er entschlossen. Ein kurzes Stottern, dann herrschte wieder Ruhe.
»Du hoffst, du wirst Christian aufsammeln«, sagte Karen, die fast ein wenig schadenfroh klang.
Rick zog ein Gesicht, eine Mischung aus Verwirrung, Nervosität und Niedergeschlagenheit. Dabei war das hier eigentlich genau sein Ding. Er half, wo er nur konnte, reparierte Dinge, zeigte sich auf eine unerschütterliche, charmante Art kompetent. Wenn die Leute Hilfe brauchten, wandten sie sich an ihn, genau wie ich heute Morgen.
»Zumindest hast du das mit dem Klappern hingekriegt«, meinte Karen mit einem amüsierten kleinen Prusten.
»Was?«, fragte Rick und sah sie dabei entnervt an. Sie tat, als hätte sie seinen Blick nicht bemerkt.
»Wenn man den Wagen nicht anlassen kann, dann kann er auch nicht klappern.«
Sein Gesicht nahm einen beängstigenden Rotton an. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr.
»Sollen wir einfach die Werkstatt anrufen?«, schlug ich vor. »Oder den AA? Ich bin Mitglied.«
»Tja«, begann Rick. »Vielleicht wäre das …«
»Nun sei nicht albern!«, unterbrach ihn Karen. »Bei dir steht doch heute nichts auf dem Programm, oder? Außer an deinem Boot rumzuwerkeln. Wobei nur Gott allein weiß, warum du an einem solchen Tag an deinem Boot arbeiten willst, noch dazu an deinem ersten Ferientag. Du kannst Ninas Wagen nicht einfach auseinandernehmen und dann so lassen. Sie muss doch zum …«
»Ich weiß. Wie alt ist dieser Wagen eigentlich?« Rick starrte den rostigen kleinen Rover an, als handelte es sich um einen seiner eher hoffnungslosen Schüler.
»Zirka zehn«, antwortete ich. »Er war schon ziemlich alt, als ich ihn bekam.«
Rick stieß ein Grunzen aus, als wäre das Alter des Wagens schuld an der ganzen Misere.
»Kannst du nicht einfach rückwärtsarbeiten?«, fragte Karen. »Vielleicht bekommst du ihn dann wenigstens wieder so hin, wie er war, als Nina hier eintraf.«
»Was, glaubst du, dass ich gerade mache?«, entgegnete Rick, den es sichtlich Mühe kostete, ruhig zu bleiben.
»Mach dir keine Sorgen, Nina«, wandte sich Karen in beschwichtigendem Ton an mich.
»Ich mache mir keine Sorgen.« Das entsprach der Wahrheit. Ich wusste, dass wir in ein paar Stunden in der Luft sein würden, selbst wenn ich uns für die ganze Strecke nach Heathrow ein Taxi bestellen musste. Dann würden wir die kurzen, kalten Tage des englischen Winters weit hinter uns lassen. Ich stellte mir vor, wie ich neben Christian sitzen und aus dem Fenster sehen würde, während London sich in ein kompliziertes Muster aus orangefarbenen und weißen Lichtern verwandelte. Ich hob den Kopf und ließ den Blick vorbei an Ricks und Karens Haus in die Ferne schweifen.
Neununddreißig Jahre lang hatte ich in einer Stadt gelebt, in der ich einen ganzen Tag lang herumlaufen konnte, ohne den Horizont zu sehen. Hier auf Sandling Island war alles Horizont: das ebene Gelände, die Wattflächen, das endlose Marschland, das graue, gekräuselte Meer. Inzwischen war später Vormittag, und von dort, wo ich stand – mit dem Gesicht nach Westen, dem Festland zugewandt –, konnte ich nur das schimmernde Watt mit seinen schmalen, versickernden Wassergräben erkennen, wo Watvögel auf ihren langen, filigranen Beinen dahinstelzten und dabei traurig klingende Schreie ausstießen. Es war gerade Ebbe. Kleine Boote, festgebunden an im Moment völlig unnötige Bojen, neigten sich so weit zur Seite, dass man ihre Blasen werfenden, schlammigen Rümpfe sehen konnte. Ihre Fallleinen pfiffen und knatterten im Wind. Von meinem eigenen Haus aus, das ein Stück weiter südöstlich lag, konnte ich das Meer sehen. Manchmal, wenn ich morgens die Augen aufschlug und auf seine graue, wogende Weite hinausblickte, musste ich immer noch einen Moment überlegen, wo ich mich befand und wie um alles in der Welt ich hier gelandet war.
Rory war derjenige gewesen, der unbedingt hierher wollte, nachdem er jahrelang davon geträumt hatte, London zu verlassen, seine Arbeit als Anwalt aufzugeben und stattdessen ein Restaurant zu eröffnen. Anfangs war es wirklich nur ein Traum gewesen, ein Wunsch, den ich nicht so richtig teilte, aber nach und nach war eine Obsession daraus geworden, bis er schließlich auf Sandling Island geeignete Räumlichkeiten gefunden und seine widerstrebende Familie mit sich geschleppt hatte, um dort ein neues Leben anzufangen. Die Insel war nur hundert Kilometer von London entfernt, aber durch ihre Lage im Mündungsgebiet, wo es Ebbe und Flut gab und man aufs offene Meer hinausblickte, fühlte man sich wie in einer anderen Welt, im eisernen Griff des Wetters und der Jahreszeiten. Es gab dort jede Menge Wildnis und Einsamkeit, eigenartig schreiende Seevögel und seufzende Winde. Hin und wieder, wenn die Flut besonders hoch stieg und den Verbindungsdamm überschwemmte, war man sogar vom Festland abgeschnitten. Von meinem Schlafzimmer aus hörte ich das Wasser ans Ufer klatschen und draußen auf dem Meer die Nebelhörner tuten. Nachts, wenn die Insel in die Dunkelheit des Himmels und des steigenden oder sinkenden Wassers gehüllt war, überkam mich manchmal ein solches Gefühl von Einsamkeit, dass ich es kaum ertragen konnte.
Trotzdem hatte ich mich halb in Sandling Island verliebt. Rory dagegen hatte die Insel wahnsinnig gemacht. Irgendwas in seinem Traum von dem schlichten Restaurant, das er mit Hummerfallen, Netzen und Kupferstichen von kleinen Küstenschiffen dekorieren wollte, war schiefgelaufen. Es hatte mit einem Zulieferer Streit wegen der Ofen gegeben, Bargeld war einfach nicht geflossen, und das Restaurant hatte nie eröffnet. Als Rory feststellen musste, dass sein Traum in einer Sackgasse mündete, wusste er plötzlich nicht mehr, was er wollte oder wer er überhaupt war. Am Ende sah er nur noch einen Ausweg – Flucht.
»Entschuldige.« Ich wandte meine Aufmerksamkeit wieder Karen zu, die gerade etwas sagte.
»Du hast heute Geburtstag, oder?«
»Stimmt.«
»Und nicht nur irgendeinen.«
»Ja«, gab ich widerstrebend zu. »Den vierzigsten. Einen von denen, über die man angeblich nicht allzu glücklich sein sollte. Woher weißt du das überhaupt?«
Sie zuckte mit den Achseln.
»Hier weiß doch jeder alles über jeden. Wie auch immer, herzlichen Glückwunsch!«
»Danke.«
»Macht es dir wirklich etwas aus?«
»Ich weiß nicht so recht. Eine Freundin hat mal zu mir gesagt …«
»Mir hat es schon etwas ausgemacht«, unterbrach sie mich. »Ich habe damals in den Spiegel gesehen und mir gedacht: Das bist du jetzt. Ob du willst oder nicht. Das bist du. Es kommt alles anders, als man denkt, nicht wahr?«
»Ich glaube, jetzt hab ich’s gleich«, verkündete Rick. »Gibst du mir meinen Kaffee, bitte?«
Er hatte einen Streifen schwarze Schmiere am Kinn, was ihm recht gut stand, und einen Riss in der Jacke. Ich beobachtete, wie er einen großen Schluck Kaffee nahm und einen halben Keks hinterherschob. Ich hatte mir im Geiste eine Liste gemacht, der ich immer wieder etwas hinzufügte: Badezeug einpacken, inklusive Schwimmbrillen und Sonnencreme; unbedingt an die Weihnachtsgeschenke denken, einschließlich des Schnorchels und der Flossen für Christian, der Meeresbiologe war, aber trotzdem viele Kilometer von der Küste entfernt lebte; außerdem ein paar Dollars; Bücher für den Flug; Spielkarten. Das Hundefutter und Instruktionen für Renata draußen deponieren, außerdem das Weihnachtsgeld für den Briefträger, den Milchmann, die Männer von der Müllabfuhr … Meine Zehen verwandelten sich allmählich in Eis, und mein Gesicht fühlte sich in dem kalten Wind ganz steif an.
»Was ich dich schon die ganze Zeit fragen wollte, Nina …« Rick kam ein paar Schritte auf mich zu und sprach mit gedämpfter Stimme. »Wie geht es denn Charlie inzwischen? Läuft es besser?«
»Ich glaube schon«, antwortete ich vorsichtig. »Aber sicher bin ich mir nicht. Das ist bei Charlie schwer zu sagen. Sie ist ziemlich verschlossen, das weißt du ja selbst.«
»Sie ist ein Teenager«, meinte Rick. »Teenager sind grundsätzlich verschlossen. Vor allem gegenüber ihren Eltern. Sieh dir Eamonn an. Lieber Himmel!«
»Worum geht’s?«, fragte Karen mit neugieriger Miene und trat näher.
»Charlie hatte in der Schule eine ziemlich harte Zeit«, erklärte ich widerstrebend. Eigentlich war das Charlies Geschichte, nicht meine. Ich wollte ihre Probleme nicht bagatellisieren, indem ich im Plauderton darüber sprach. Ich stellte mir Charlies bleiches, trotziges Gesicht vor, ihren verschlossenen Blick unter der wilden Mähne rötlichen Haars. »Rick hat das Ganze aufgedeckt. Er hat mit den Mädchen gesprochen, die sie schikaniert haben, und auch mit deren Eltern. Und mit mir. Er hat wirklich alles in seiner Macht Stehende getan, um uns zu helfen.«
»Mädchen können grausam sein«, stellte Karen fest.
»Sie war gestern Abend bei einer von ihnen zu einer Party mit Übernachtung eingeladen«, erklärte ich. »Bei Tam. Vielleicht ist das Eis nun gebrochen. Ich habe sie heute noch nicht gesehen. Es wäre ein guter Abschluss für das Schuljahr.«
»Sie schafft das schon«, meinte Rick, während er seine Tasse wegstellte und lustlos wieder nach dem Schraubenschlüssel griff. »Schikaniert zu werden ist schrecklich. Ich glaube, manchmal machen wir uns gar nicht richtig bewusst, wie schlimm das ist und wie sehr es einem zusetzen kann. Vor allem wir Lehrer erreichen irgendwann den Punkt, wo wir es schon fast für normal halten. Geht dir das nicht auch so, Nina? Aber Charlie ist hart im Nehmen. Sie ist eine ausgesprochen gescheite junge Frau mit einem eigenen Kopf und einem weiten Horizont. Ich freue mich immer, sie in meiner Klasse zu haben. Du kannst stolz auf sie sein.«
Ich lächelte ihn dankbar an.
»Sie hat jede Menge Piercings, stimmt’s?«
»Lieber Himmel, Karen, was tut denn das zur Sache?« Rick schraubte gerade ein rundes Teil fest.
»Ich dachte bloß, dass ihre Mitschülerinnen sie vielleicht auf dem Kieker haben, weil sie irgendwie anders aussieht.«
»Anders? Hast du in letzter Zeit mal einen Blick auf Amelia Ronson geworfen? Sie sieht aus, als hätte sie sich das rechte Auge halb zusammennähen lassen. Und apropos anders, schau dir unseren eigenen Sohn an …, wenn man vom Teufel spricht!«
Im Türrahmen war eine barocke Gestalt erschienen, eingehüllt in einen flaschengrünen, fast bodenlangen Trenchcoat, unter dem nackte, stämmige Füße herauslugten. Eamonns Gesicht war so bleich, dass es fast wie eine Maske wirkte, auch wenn diese mehrfach von Ringen geziert war: an den Augenbrauen, der Nase und den Ohren. Die Augen hatte er von Rick geerbt, aber sein Blick war fast immer traurig. In seiner Mähne aus wirrem, mattschwarzem Haar leuchteten grüne Strähnen, seine Fingernägel waren schwarz lackiert, und an seinem rechten Unterarm prangte eine wilde Tätowierung. Er wirkte immer ungewaschen und fertig, als wäre er verkatert oder auf Drogen, und extrem bedrückt, aber wenn er lächelte, trat ein leicht verlorener Ausdruck in seine Augen, und er sah plötzlich viel jünger aus als siebzehn. Ich wusste von Rick, dass er ein Problemkind war – ein überzeugter Grufti auf einer kleinen Insel, deren Bewohner ihn mit Argwohn oder Belustigung betrachteten, ein Einzelgänger, der zwar blitzgescheit war, sich aber als Außenseiter fühlte. Ich wusste außerdem, dass er und seine Eltern, insbesondere Karen, kaum eine Minute miteinander verbringen konnten, ohne in Streit zu geraten. Ich dagegen war immer gut mit ihm ausgekommen. Er unterhielt sich mit mir gern über lustige kleine Rechenaufgaben, die er in irgendwelchen Büchern entdeckt hatte – schließlich bin ich eine Exbuchhalterin, die jetzt auf Mathelehrerin macht –, und über Gott (oder das Nichtvorhandensein eines Gottes). Außerdem suchte er schon allein deswegen meine Nähe, um zur Stelle zu sein, wenn Charlie das Haus betrat. Einer Mutter fällt so etwas auf.
Karen blickte demonstrativ auf ihre Uhr.
»Weißt du, wie spät es ist?«
»Nein.«
»Halb elf vorbei«, sagte sie.
»Dann haben wir in zehn Minuten Ebbe«, antwortete er, als wäre das die naheliegendste Antwort. Dabei verzog er angewidert das Gesicht. »Wir sind von faulig stinkendem Schlamm umgeben.«
»Ich dachte, du wärst vielleicht schon aufgestanden und unterwegs.«
»Woher willst du wissen, dass ich das nicht war?«, gab er zurück.
»Der Tag muss erst noch kommen«, sagte Rick irgendwo in meinem Motor.
»Hallo, Eamonn«, begrüßte ich ihn fröhlich, um dadurch vielleicht einen weiteren Streit zu verhindern.
»Alles Gute zum Geburtstag!« Er begleitete seinen Glückwunsch mit einer ruckartigen halben Verbeugung, wobei sein Trenchcoat ein wenig auseinanderfiel und ich sehen konnte, dass er darunter nackt war.
»Anscheinend wissen das hier wirklich alle«, stellte ich lachend fest. Badesandalen, dachte ich. Ich darf die Badesandalen nicht vergessen, und den Akku für die Kamera auch nicht.
»Charlie hat es mir erzählt«, erklärte er.
»Habt ihr euch die letzten Tage mal getroffen?«, fragte ich, aber in dem Moment begann das Handy in meiner Tasche einen nervtötenden Song anzustimmen. Offenbar hatte Jackson ohne mein Wissen die Melodie eingestellt. Ich wandte mich ab. Bis ich das Telefon am Ohr hatte, war er schon mitten im Satz, und ich brauchte ein paar Sekunden, um seinen Redeschwall in verständliche Worte zu übersetzen. Es war, als hätte ich mich bei einer Radiosendung zugeschaltet, die schon zur Hälfte vorbei war.
»Und wenn ich verdammt noch mal geahnt hätte, dass du dich als die Sorte Mutter entpuppen würdest, die mir zu Weihnachten meine Kinder vorenthält, indem sie mit ihnen auf die andere Seite der Erdkugel fliegt, und das auch noch mit einem Mann, der die beiden kaum kennt und …«
»Moment mal, Rory …«
Ich ging ein paar Schritte die Zufahrt entlang.
»Dass ich ein bisschen ausgeflippt bin, heißt noch lange nicht, dass ich damit das Recht verwirkt habe, sie zu sehen, schließlich wachsen sie so schnell heran, meine zwei Kleinen, auch wenn sie natürlich gar nicht mehr so klein sind, und jetzt ist da dieser Christian, und bald werden sie vergessen haben, dass ich ihr Vater bin, denn genau das möchtest du doch, oder? Du hast ja schon immer gesagt …«
»Was ist denn los?« Ich hasste den sanften, beruhigenden Ton, den meine Stimmte plötzlich annahm. Als würde ich einem verängstigten Pferd irgendwelchen Unsinn ins Ohr flüstern und gleichzeitig versuchen, ihm das Zaumzeug über den Kopf zu streifen. Ich wusste, wie sein Gesicht aussah, wenn er vor sich hinschimpfte: in kummervolle Zornesfalten gelegt, genau wie das von Charlie, wenn sie sich aufregte. Ich wusste, dass ihm die Tränen in den Augen standen und dass er getrunken hatte. »Dir ist doch schon seit Wochen bekannt, dass wir wegfliegen. Du hast gesagt, es sei in Ordnung. Wir haben das besprochen.«
»Wenigstens hättest du mir Gelegenheit geben können, sie vor ihrer Abreise noch mal zu sehen.«
»Wie meinst du das?«
»Nur kurz, um ihnen frohe Weihnachten zu wünschen.«
»Das geht nicht.« Hinter mir hörte ich Kieselsteine knirschen. Als ich mich umdrehte, sah ich Karen übertrieben hektisch mit den Armen herumfuchteln und dabei lautlose Worte formen, die ich nicht verstand. Hinter ihrem Rücken hustete und ächzte der Motor meines Wagens, ehe er schließlich stotternd zum Leben erwachte. Ich gab ihr ein Zeichen, dass ich gleich fertig sein würde, und kam mir dabei ziemlich heuchlerisch vor. Obwohl ich gerade – wenn auch in gedämpftem Ton – mit Rory stritt, tat ich gegenüber der begierig lauschenden Karen so, als würde ich mich völlig zivilisiert mit ihm unterhalten. »Wir brechen in zirka einer Stunde Richtung Flughafen auf.«
»Ich spreche von der Theorie. Es geht mir ums Prinzip. Kennst du dieses Wort? Prinzip? Das Prinzip, dass ein Vater seine Tochter sehen möchte.«
»Du hast auch einen Sohn«, entgegnete ich. Ich hatte es schon immer schlimm gefunden, dass er vor lauter Vernarrtheit in Charlie oft kaum Notiz von Jackson nahm, der ihn vergötterte.
»Das Prinzip, dass ein Vater seine Kinder sehen möchte.« Seine Stimme klang plötzlich brüchig.
»Du rufst vom Handy an. Du sitzt doch nicht am Steuer, oder?« Betrunken am Steuer, meinte ich, sagte es aber nicht.
»Ich habe das Schreiben deiner Anwältin bekommen.«
Nun war ich auf der Hut. Ich hatte meine Anwältin, Sally, die gleichzeitig eine enge Freundin war, dazu gebracht, seinem Anwalt einen Brief zu schreiben. Es war der erste Schritt auf einem sehr unangenehmen Weg gewesen. Der Brief informierte ihn darüber, dass ich gezwungen sein würde, eine einstweilige Verfügung gegen ihn zu erwirken, falls er sich nicht stärker am Riemen riss, wenn er mit Jackson und Charlie zusammen war. Ich hatte mich dazu durchgerungen, nachdem die beiden ihn das letzte Mal besucht hatten und er in betrunkenem Zustand über Jackson gestolpert war. Die Kinder hatten mir nichts davon erzählt, bis ich darauf bestand zu erfahren, woher der Bluterguss an Jacksons Schulter kam.
»Du willst sie mir bloß wegnehmen.«
»Das stimmt nicht«, antwortete ich resigniert.
»Es ist Weihnachten, und ich werde sie nicht sehen.«
»Ich muss jetzt los. Ich rufe dich von zu Hause aus an.«
»Würg mich nicht so ab.«
»Das tue ich doch gar nicht, ich habe gesagt, dass ich dich in ein paar Minuten zurückrufe. Trink einen starken Kaffee oder so was, dann rufe ich dich zurück.«
»Was soll das heißen, trink einen starken Kaffee?«
»Bis gleich, Rory.«
Blinzelnd schaltete ich das Telefon aus. Hoffentlich sah es für die anderen so aus, als müsste ich nur wegen des Windes blinzeln.
»Oje«, sagte Karen. »Probleme?«
»Es geht ihm gut.« Ich spürte, wie mein Mitleid angesichts von Karens unverhohlener Neugier in Beschützerinstinkt umschlug. »Ich meine, nein, keine Probleme.«
»Weihnachten ohne die Kinder kann für den Vater schwierig sein, nicht wahr?«
»Ja, wahrscheinlich.«
»Und außerdem war Rory immer ziemlich …«, sie zögerte, weil sie nach dem richtigen Wort suchte, »…impulsiv«, sagte sie schließlich. »Wie Charlie«, fügte sie hinzu. »Nicht wie du und Jackson. Du bist immer so höflich und diszipliniert.«
Ich wandte mich erleichtert zu meinem mittlerweile fröhlich tuckernden Wagen um.
»Großartig, Rick. Vielen Dank!«
»Nicht der Rede wert.«
»Jetzt aber ab mit dir zu deinem Boot!«, erklärte ich, während ich mich auf die Zehenspitzen stellte und ihn auf seine kalten, stoppeligen, ölverschmierten Wangen küsste.
»Nicht so schnell!«, schaltete Karen sich ein. »Ich brauche ihn vorher noch für etwas anderes.«
Mein Gefühl sagte mir, dass ich rasch flüchten musste, ehe ein wirklich ernsthafter Streit ausbrach.
»Ich werde jetzt Jackson abholen und dann fertig packen. Auf Wiedersehen, Karen.« Ich drehte mich um und küsste sie ebenfalls, verfehlte dabei aber ihre Wange und landete auf ihrer Nase. »Danke für den Kaffee. Mach’s gut, Eamonn.«
Nachdem ich eingestiegen war, ließ ich das Fenster herunter.
»Frohe Weihnachten!«, rief ich hinaus, während ich rückwärts aus der Zufahrt fuhr. Ehe ich in die schmale Straße einbog, winkte ich ihnen noch einmal zu. »Und ein gutes neues Jahr!«
Dann legte ich den ersten Gang ein und fuhr befreit los. Der Wagen klapperte fröhlich vor sich hin.
Sobald ich außer Sichtweite war, parkte ich am Straßenrand, zog mein Handy aus der Tasche und rief Christian an. Ich ließ den Motor laufen, so dass mir die Heizung warme Luft auf die Hände blies, während meine Füße leider kalt blieben. Draußen fuhr der böige Wind durch die kahlen Äste der Bäume und wehte Zweige und Blechdosen die Straße entlang. Christian ging nicht an seinen Festnetzapparat, deswegen probierte ich es auf dem Handy, landete aber nur bei seiner Mailbox.
»Ich bin’s nur«, sagte ich. »Und ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich anrufe.«
Ich hatte Christian während des letzten Jahres meines Mathematikstudiums kennen gelernt. Er promovierte damals gerade im Fach Meeresbiologie. Ich war zu der Zeit bereits mit Rory zusammen und verbrachte jedes Wochenende bei ihm in London. Wir planten unsere gemeinsame Zukunft, und die Universität erschien mir schon wie ein Teil meiner Vergangenheit. Ich mochte Christian und seinen Freundeskreis, aber da ich im Begriff war, die Welt zu verlassen, zu der er gehörte, kann ich mich heute nur noch vage an ihn erinnern. Ich habe es versucht, aber er bleibt in meinem Kopf eine Art verschwommener Fleck, ein Gesicht, das ich fast vergessen hatte. Immerhin weiß ich noch, dass wir uns damals ein paarmal auf einen Drink getroffen haben. Ich glaube, ich war auch einmal mit vielen anderen Leuten bei ihm zum Essen eingeladen. Ihm zufolge haben wir sogar mehrfach miteinander getanzt. Er behauptet außerdem felsenfest, er habe in einem Pub am Fluss mal den Arm um mich gelegt. Vor ein paar Wochen zeigte er mir eine Aufnahme aus seiner Studentenzeit, ein Foto von einem jungen Mann mit schmalem Gesicht, einem dichten dunklen Haarschopf und einer Zigarette im Mundwinkel. Als ich es betrachtete, spürte ich, wie in mir ein Gefühl von Verlangen nach dem Jungen erwachte, der er damals gewesen war, aber zu der Zeit hatte ich nichts Derartiges empfunden. Für mich war er nur ein flüchtiger Bekannter, und obwohl wir einander versprachen, in Kontakt zu bleiben, gelang uns das im Grunde nicht. Vor ein paar Jahren schrieb er mir von einer Konferenz in Mexiko eine Postkarte. Ich brauchte ein paar Sekunden, bis mir wieder einfiel, wer dieser »Christian«, der unter ein paar fast unleserlichen Zeilen so schwungvoll unterschrieben hatte, überhaupt war. Vor zwei Jahren erfuhr ich von einer gemeinsamen Bekannten, dass seine damalige Beziehung in die Brüche gegangen war, und nahm mir vor, mich bei ihm zu melden, setzte diesen Vorsatz aber nie in die Tat um. Nach unserem Umzug nach Sandling Island schickte ich ihm eine Karte mit unserer neuen Anschrift, ging aber eigentlich davon aus, dass sie gar nicht bei ihm landen würde. Ich war nicht mal mehr sicher, ob ich überhaupt noch seine aktuelle Adresse besaß.
Vor sechs Monaten rief er mich dann aus heiterem Himmel an, um mir mitzuteilen, dass er im Rahmen einer Konferenz nach East Anglia komme und dies vielleicht eine Gelegenheit sei, sich endlich mal wieder zu treffen. Fast hätte ich unter irgendeinem Vorwand Nein gesagt. Rory hatte in einem Durcheinander aus Tränen, unbezahlten Rechnungen und zerbrochenen Träumen das Weite gesucht, und ich fühlte mich einsam, verwirrt und traurig. Eigentlich wollte ich niemanden sehen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich bereits eine kurze Affäre hinter mir und wusste, dass dadurch nichts besser wurde. Jedenfalls nicht die Einsamkeit und ganz bestimmt auch nicht die Traurigkeit. Eigentlich wollte ich nur noch möglichst viel Zeit mit meinen Kindern verbringen und ansonsten am Haus und im Kleinen, mit Unkraut überwucherten Garten arbeiten. Ich versuchte, einen Hafen für uns zu schaffen, in dem es nach frischer Farbe und Selbstgebackenem roch, und hatte keine Lust, irgendwelche Anstrengungen wegen eines alten Bekannten zu unternehmen, an den ich mich nur noch vage erinnern konnte und der inzwischen ein Fremder für mich war.
Letztendlich verabredete ich mich nur deshalb mit ihm, weil mir nicht schnell genug eine Ausrede einfiel. Das sagte ich ihm auch, als wir uns nach diesem ersten Treffen wieder trennten, denn schon da – nach zweieinhalb Stunden – wollte ich ehrlich zu ihm sein. Ich hatte das Gefühl, ihm vertrauen zu können. Er schien nicht Eindruck bei mir schinden oder mir auf irgendeine Weise etwas vorspielen zu wollen, und ich fragte mich, ob er wohl immer schon so gewesen war – und warum ich das damals nicht bemerkt hatte.
Er sah immer noch schlank und jungenhaft aus, aber sein widerspenstiges Haar war kürzer und von grauen Strähnen durchzogen. Außerdem hatte er Krähenfüße um die Augen, und links und rechts von seinem Mund hatten sich zwei Längsfalten eingegraben. Während ich ihn musterte und versuchte, sein etwa vierzigjähriges Gesicht mit dem glatten, erwartungsvollen von früher in Einklang zu bringen, spürte ich, dass er das Gleiche mit mir tat. Die Geister der Vergangenheit waren wieder aufgetaucht. Während wir den Deich entlangspazierten, sank das Wasser, und das warme Licht des frühen Maiabends ging langsam in die Dämmerung über. Wir unterhielten uns, und manchmal schwiegen wir auch. Er nannte mir die Namen der auf den Strömungen dahingleitenden Vögel, obwohl ja eigentlich ich die Inselbewohnerin war, die sie hätte kennen müssen. Aber das wurde Teil der Scherze, die wie bei allen Flirtenden zwischen uns hin- und hergingen. Er besuchte mich ein zweites Mal, und wir tranken bei mir ein Glas Wein. Er spielte ein Computerspiel mit Jackson (und verlor), und als er Charlie kennen lernte, die mit schlammverschmierten Schuhen und einem gefährlichen Glitzern in den Augen hereinplatzte, begrüßte er sie mit ernster Freundlichkeit, ohne dabei kumpelhaft oder sich anbiedernd zu wirken. Kaum war er zur Tür draußen, rief er mich auch schon an. Er sagte mir, dass er gerade über den Verbindungsdamm fahre, der beinahe überflutet sei, und dann fragte er mich, ob ich ihn am nächsten Abend zum Essen einladen würde. Er werde die Nachspeise und den Wein mitbringen, und ich solle ihm doch verraten, was die Kinder gerne aßen.
Nach meinem kurzen Zwischenstopp fuhr ich nun wieder los, Richtung Ort, vorbei an den Läden und der Kirche, der Autowerkstatt, dem Altenheim, dem Gartencenter. Schließlich kam ich auch an dem Gebäude vorbei, das Rorys Fischrestaurant hätte werden sollen und über dessen leeren Fenstern nun ein »Zu vermieten«-Schild im Wind schaukelte. Ich fühlte mich von alledem schon ein wenig losgelöst, als befände ich mich bereits in einer sicheren Entfernung von acht Kilometern Höhe. In das Gefühl der Losgelöstheit mischte sich allerdings eine Spur von schlechtem Gewissen. Ich hatte Jackson gleich nach dem Frühstück bei seinem besten Freund Ryan abgesetzt und versprochen, ihn bald wieder abzuholen. »Bald« ist ein dehnbarer Begriff, aber ich hatte Ryans Mutter Bonnie von Weihnachtseinkäufen sprechen hören, und mittlerweile war der Tag schon ziemlich fortgeschritten. Ein paar Minuten später klopfte ich an ihre Tür – auf Sandling Island brauchte man im Grunde immer nur ein paar Minuten, um von einem Ort zum anderen zu kommen – und betrat mit einem Schwall von Entschuldigungen das Haus.
»Es tut mir so leid!«, sagte ich zu Bonnie. »Du wolltest doch einkaufen gehen. Nun habe ich deine Pläne für den Tag durcheinandergebracht.«
»Kein Problem«, antwortete Bonnie lächelnd.
Das machte es nur schlimmer. Obwohl wir nun schon knapp zwei Jahre auf der Insel lebten, hatte ich immer noch das Gefühl, erst allmählich Wurzeln zu schlagen, aber im Fall von Bonnie war mir sofort klar gewesen, dass ich sie zur Freundin haben wollte. Als alleinerziehende Mutter eines kleinen Sohnes war sie in der gleichen Situation wie ich – und meisterte sie mit gleichbleibender Fröhlichkeit, ohne jemals zu klagen. Sie hatte kurzes Haar und ein bleiches Gesicht mit roten Wangen und war ziemlich rundlich. Ich musste bei ihrem Anblick immer daran denken, dass nicht viel Make-up nötig wäre, um sie in einen Zirkusclown zu verwandeln.
»Aber hattest du nicht was von Weihnachtseinkäufen gesagt?«
»Stimmt. Das ist so ein Prinzip von mir oder, vielleicht sollte ich eher sagen, ein Ziel, das ich mir jedes Jahr stecke: Sämtliche Weihnachtseinkäufe müssen an einem einzigen Tag erledigt werden. Und heute ist der Tag.«
»Von dem nun genau genommen nur noch die Hälfte übrig ist«, antwortete ich zerknirscht.
»Drei Viertel. Es ist noch nicht mal elf, uns bleibt also noch eine Menge Zeit. Ryan und ich starten jetzt gleich los in die Stadt, und in etwa sechs Stunden werden wir beladen wie Packesel zurückkommen.«
»Dann wünsche ich euch am besten schon mal frohe Weihnachten«, sagte ich. »Und ein gutes neues Jahr und das alles.«
»Ach ja, richtig«, meinte Bonnie. »Ihr fliegt ja weg. Das ist die richtige Art und Weise, den Vierzigsten zu feiern. Es tut mir so leid, dass ich nicht zu deiner …«
Sie brach mitten im Satz ab.
»Zu meiner was?«, fragte ich.
»Ich meine, dass wir uns in den Ferien nicht sehen können. Aber lass uns das im neuen Jahr gleich richtig nachholen.«
Ich pflichtete ihr bei und ging dann Jackson holen, den ich genau so vorfand, wie ich ihn neben Ryan zurückgelassen hatte: vertieft in ein Computerspiel. Ryan grunzte kurz, blickte aber kaum hoch, als wir Bonnie zum Abschied umarmten, ihr frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschten und dann aufbrachen. Sobald wir im Wagen saßen, zog Jackson ein anderes Minicomputerspiel aus der Tasche. Ich warf einen Blick auf sein ernstes Gesicht, die gerunzelte Stirn unter seinem schwarzen Haar, die rosa Zungenspitze, die immer ein wenig hervorlugte, wenn er sich verbissen auf etwas konzentrierte, und versuchte gar nicht erst, ein Gespräch mit ihm anzufangen. Stattdessen ging ich erneut die Liste in meinem Kopf durch: Pässe, Flugtickets, Kreditkarten. Wenn ich es damit bis zum Flughafen schaffte und darüber hinaus zwei Kinder und einen noch ziemlich neuen Freund im Gepäck hatte, war alles andere im Grunde nebensächlich.
Ich wählte die malerische Route nach Hause. Statt mich durch die Nebensträßchen zu schlängen, tuckerte ich die Hauptstraße entlang, die den phantasievollen Namen The Street trug, bog nach rechts Richtung Strand ab und fuhr dann wieder links, vorbei an dem verlassenen Campingplatz, den dichtgemachten Strandhütten und dem Gelände des Bootsbauers, wo sich im Winter lauter an Land gezogene Boote drängten.
Unser Haus gehörte zu einer Reihe von kunterbunt zusammengewürfelten Gebäuden, die nur durch eine Straße von den Bootshäusern, Werften und Anlegestegen entlang des Ufers getrennt waren. Sie stammten alle noch aus einer Zeit, als die meisten Leute offensichtlich noch nicht viel davon hielten, für ein Haus mit Meerblick diverse Nachteile in Kauf zu nehmen, insbesondere den eisigen Wind und gelegentliche Überschwemmungen. Die vornehmen georgianischen Gebäude, die Herrenhäuser und Pfarrhäuser standen alle ein Stück weiter landeinwärts, in sicherer Entfernung vom Meer. Die kleinen Häuschen entlang der Saltings Road bildeten wirklich eine seltsame Mischung und waren teilweise in ungewöhnlichen Winkeln aneinandergereiht, als hätte jedes davon auf einen Platz gezwängt werden müssen, der eigentlich ein wenig zu klein dafür war. Unseres war wahrscheinlich das seltsamste von allen. Es bestand fast ganz aus Holzschindeln und sah eher aus wie ein rechteckiges Boot, das an Land gezogen, auf den Kopf gestellt und dann notdürftig mit einem grauen Schieferdach getarnt worden war. Es war schwer zu verkaufen gewesen, weil abgesehen von ein paar Quadratmetern Vorgarten kein Grund dazugehörte und die Räume feucht und klein waren, aber Rory und ich hatten uns auf den ersten Blick in das alte Ding verliebt. Von unserem Schlafzimmerfenster aus konnten wir das Watt und das Meer sehen und am Horizont nichts als Himmel.
Als Jackson und ich uns der Tür näherten, hörten wir drinnen verzweifeltes Kratzen, Winseln und Stöhnen.
»Lass das, Sludge!«, rief ich, während ich den Schlüssel ins Schloss zu fummeln versuchte. Die Tür schwang auf, und etwas Schwarzes flog auf uns zu.
Die Zeit zwischen unserer Ankunft auf der Insel und Rorys Abgang war in erster Linie ein Chaos aus Rechnungen, unvollendeten Bauarbeiten und noch mehr Rechnungen gewesen. In dieser schlimmen Phase hatte Rory im Grunde nur einen einzigen Beitrag zu unserem Haushalt geleistet: Er hatte dem hartnäckigen Bitten von Charlie und Jackson nachgegeben, die sich schon seit Jahren einen Hund wünschten. In einem Wirrwarr aus Ereignissen, die alle fast gleichzeitig passierten, erstand er eine junge Labradorhündin, die aussah wie ein etwas zu groß geratener Maulwurf, taufte sie Sludge, überließ sie meiner Obhut und verließ mich. Als Rory ging, konnte ich es erst nicht fassen. Ich bekam es einfach nicht in meinen Kopf hinein, dass er nicht mehr mit mir zusammen sein wollte. Wenn ich dann aber an die letzten Wochen unseres Zusammenlebens dachte, konnte ich es doch irgendwie verstehen. Trotzdem begriff ich nicht, wie er ohne die Kinder sein konnte.
Dagegen war schnell klar, dass Sludge uns nie verlassen würde. Ganz im Gegenteil, sie schien jedes Mal, wenn wir aus dem Haus gingen, um einzukaufen, ein akutes Trennungstrauma zu erleiden. Während wir nun hineingingen und sie wie immer ihr überschwängliches Begrüßungsritual absolvierte, fragte Jackson mich zum hundertsten Mal, warum wir sie nicht mitnehmen konnten, worauf ich antwortete, weil sie ein Hund sei. Er entgegnete, wir sollten ihr einen Haustierpass besorgen. Ich antwortete, das erfordere eine Menge Zeit und Geld, und er konterte wie üblich mit dem unschlagbaren Argument: Und?
Am Vorabend hatten Charlie und ich eine angeregte Diskussion übers Telefon geführt. Ich hatte Bedenken geäußert, ob es wirklich eine so gute Idee sei, ausgerechnet an dem Abend, bevor wir in Urlaub flogen, bei einer Freundin zu übernachten. Ihre Stimme hatte den harten Klang angenommen, den ich so gut kannte. Warum nicht, wollte sie wissen. Ich antwortete, es sei noch eine Menge zu tun, worauf sie entgegnete, dass könne sie alles auch noch machen, wenn sie zurückkomme. Es wurde kein richtiges Streitgespräch daraus, weil ich froh war – und das wusste sie –, dass ihre Feindinnen nun vielleicht ihre Freundinnen wurden. Als sie mir versicherte, sie werde früh zurückkommen, Sludge füttern, die Wäsche aufhängen, ihr Zimmer aufräumen und dann ihre Sachen packen, verkniff ich mir eine sarkastische Bemerkung. Ich kommentierte ihre guten Vorsätze weder mit einer Grimasse noch mit einem Lachen. Immerhin gestattete ich mir die Bemerkung, dass sie zusätzlich noch eine Zeitung zu verteilen habe, aber sie antwortete, sie werde die Zeitung auf dem Heimweg ausfahren und anschließend alles andere erledigen. Es sei jede Menge Zeit. Und sie hatte Recht. Es war jede Menge Zeit.
Ich hatte Sludge am Morgen nicht gefüttert, weil das ein Vorrecht von Jackson oder Charlie war. Sie freuten sich jedes Mal von neuem, wie überschwänglich die Hündin ihre Dankbarkeit zum Ausdruck brachte. Und Sludge hatte getan, was sie immer tat, wenn sie nichts bekommen hatte: Sie suchte sich etwas anderes zu fressen oder – falls sie nichts fand – zumindest etwas zu kauen. Diesmal hatte sie eine Packung Haferflocken erbeutet. Das ganze Wohnzimmer war mit Haferflocken und Pappestückchen übersät. Ich holte tief Luft. Heute war unser erster Ferientag, da konnte mich nichts erschüttern. Wenigstens hatte sie nicht die Post gefressen, die während meiner Abwesenheit durch den Briefschlitz geschoben worden war – ein größerer Stapel als sonst, lauter Glückwunschkarten, soweit ich es erkennen konnte.
Ich legte sie zur Seite und sammelte erst mal die größeren Stücke der Schachtel ein. Dann holte ich den Staubsauger aus dem Schrank, und nach wenigen Minuten sah der Raum aus wie zuvor. Jackson fütterte Sludge, die allerdings nach der Haferflockenorgie keinen großen Hunger mehr hatte.
Ich wurde auch nicht wütend, als ich in die Küche ging und unsere Sachen noch in der Waschmaschine vorfand. Wenn Charlie Sludge nicht gefüttert hatte, konnte ich auch nicht damit rechnen, dass sie die Wäsche aufgehängt hatte. Natürlich hieß das, dass wir die Sachen, die wir für unseren Urlaub brauchten, nun in den Trockner stecken mussten, aber das stellte kein größeres Problem dar. Ich schob sie hinein und stellte die Uhr auf vierzig Minuten. Das müsste reichen.
Natürlich war es beinahe schon eine logische Folge – genau so klar wie die Tatsache, dass zwei und zwei vier ergeben –, dass Charlie, wenn sie Sludge nicht gefüttert und die Wäsche nicht aufgehängt hatte, auch noch nicht Gelegenheit gehabt hatte, ihre Sachen aufzuräumen oder zu packen. Ich ging hinauf und warf einen flüchtigen Blick in ihr Zimmer. Obwohl ich wusste, dass sie letzte Nacht nicht in ihrem Bett verbracht hatte, sah es trotzdem so aus, als hätte jemand darin geschlafen und wäre anschließend noch ausgiebig darauf herumgesprungen. Auf dem Boden lagen ein paar Kleidungsstücke, die sie einfach hatte fallen lassen, außerdem ein Gürtel, ein leerer Geigenkasten, eine Decke aus Tigerfellimitat, diverse Stifte, ein zerbrochenes Lineal, eine Schere, noch ein Gürtel, ein Paar Badesandalen, CDs ohne Hülle, CD-Hüllen ohne CDs, ein Einkaufsnetz, ein paar Teenagerzeitschriften, ein aufgeschlagenes Buch, ein Pyjamaoberteil, eine große grüne Stoffeidechse, ein paar kleine Häufchen schmutzige Wäsche, ein ramponierter Föhn, verschiedene Schminkutensilien, einzelne Schuhe und drei Badetücher. Offenbar legte Charlie Wert darauf, stets ein frisches Handtuch zu benutzen, wenn sie gebadet oder geduscht hatte, hielt aber nichts davon, die gebrauchten in den Wäschekorb zu werfen.
Auch auf ihrem Schreibtisch türmte sich so allerlei: ihr Computer, ein kariertes Federmäppchen, diverse Notizbücher, ein Deo mit rosa Deckel, eine Flasche Clearasil, eine Schuhschachtel, eine Plüschkuh, mehrere Stapel Schulsachen und anderes mehr.
Ich hatte bereits das Gefühl, ihre Privatsphäre zu verletzen, obwohl ich nur durch die offen stehende Tür hineinspähte. Seit sie in dieses neue Zimmer gezogen war, hatte sie deutliche Grenzen gezogen. Ich machte hier nicht sauber. Nun ja, sie auch nicht, aber was das betraf, hatten wir eine Vereinbarung getroffen. Ich ließ sie in ihrem Zimmer schalten und walten, wie sie wollte, solange sie im restlichen Haus Ordnung hielt. Sie hatte ihren Teil der Vereinbarung nicht immer eingehalten, ich den meinen schon. Natürlich machte mir diese Entwicklung ein wenig zu schaffen. In der Vergangenheit hatte sie mir immer sehr freimütig von all ihren Sorgen, Nöten und Problemen erzählt, manchmal sogar so beängstigend offen, dass ich mich von der Last ihrer Geständnisse fast erdrückt fühlte. Inzwischen war das anders geworden, weil sie selbst sich verändert hatte und nun langsam erwachsen wurde. Was meiner Meinung nach aber nicht hieß, dass sie mir wichtige Geheimnisse vorenthielt. Mir war klar, dass sie eine Tür brauchte, die sie absperren, und einen Raum, den sie als ihr Reich betrachten konnte. Manchmal fühlte ich mich ausgeschlossen, aber ich konnte dieses Gefühl nicht von all den anderen Emotionen trennen, die ich empfand, während ich meine einzige Tochter zu einer Frau heranwachsen sah: zu einer von mir unabhängigen Person, die ihr eigenes Leben führte.
Deswegen verkniff ich es mir auch jetzt, Ordnung in ihr Chaos zu bringen oder ihre Urlaubssachen zusammenzupacken. Ich warf einen Blick auf meine Uhr. Sie befand sich nicht an meinem Handgelenk. Wo hatte ich sie hingelegt? Auf den Rand der Badewanne? Auf den Boden neben meinem Bett? Neben das Spülbecken? Oder hatte ich sie in irgendeine Tasche gesteckt? In dem Moment tauchte aus Charlies alberner Schäfchenuhr ein Schaf auf und informierte mich blökend über die Zeit. Elf Uhr, also noch keine Eile. Ich beschloss, wenigstens ihre Badesandalen aufzuheben und einzupacken, weil sie sie sonst wahrscheinlich vergessen und ich am Ende gezwungen sein würde, ihr neue zu kaufen.
Ich trug die Schuhe in mein Zimmer und verstaute sie dort in meinem Koffer, der inzwischen fast voll war. Als ich mich anschließend auf den Weg nach unten machte, stieß ich auf der Treppe mit einem Wesen zusammen, das fast aussah wie eine Kreuzung aus einem Jungen und einem Roboter. Es war Jackson mit dem Camcorder, den Rory vor einem Jahr für uns gekauft hatte und der sich immer noch in seiner Verpackung befand. Ich hatte vorgehabt, ihn mit nach Florida zu nehmen, und das Ding eigentlich auch schon eingepackt, aber Jackson schafft es irgendwie, jedes technische Gerät ausfindig zu machen, genau wie Charlie jedes noch so kleine Stückchen Schokolade.
»Was machst du denn da?«, fragte ich.
»Filmen«, antwortete er. »Das ist super.«
»Die Kamera war für den Urlaub gedacht«, erklärte ich. »Es ist nicht sehr sinnvoll, unser Haus zu filmen. Wir wissen doch schon, wie es aussieht.«
»Das macht nichts«, widersprach Jackson.
»O doch. Ich habe extra den Akku aufgeladen.«
»Ich werde ihn neu aufladen.« Mit diesen Worten setzte er sich wieder in Bewegung, und ich blieb mit offenem Mund auf der Treppe zurück. Urlaubsfilme sind auch ohne eine zehnminütige Wackeltour durchs eigene Haus langweilig genug. Aber wenn Jackson ein technisches Gerät erst einmal in die Finger bekommen hatte, war ein größerer chirurgischer Eingriff nötig, um ihn wieder davon zu trennen. Außerdem hatte ich andere Dinge im Kopf. Elf Uhr. Charlie hatte sich diese Übernachtungsparty als Abschluss eines schwierigen und sehr anstrengenden Schuljahrs redlich verdient, aber sie musste noch ihre Zeitungen ausfahren, ihre Sachen packen, alle möglichen anderen Urlaubsvorbereitungen treffen. Ich nahm das Telefon von dem niedrigen Tischchen am Fuß der Treppe und wählte ihre Handynummer, wurde aber sofort mit der Mailbox verbunden, die mir nicht wirklich weiterhalf. Wie ich im Lauf des letzten Jahres zu meinem Leidwesen feststellen musste, gab es auf Sandling Island mehrere Funklöcher, wo man mit dem Handy keinen Empfang hatte. Vielleicht hatte Charlie ihr Telefon aber auch ausgeschaltet oder in ihrem Zimmer in einer Schublade liegen lassen, oder sie drehte bereits ihre Zeitungsrunde. Ich machte mir im Geist eine Notiz, sie in ein paar Minuten noch einmal anzurufen.
Einen Moment lang stand ich unschlüssig im Wohnzimmer. Ich hatte ungefähr acht Sachen zu erledigen und wusste nicht so recht, womit ich anfangen sollte.
Es war mein Geburtstag, mein vierzigster Geburtstag. Mir fiel die Post wieder ein, die ich noch nicht geöffnet hatte, und ich beschloss, erst mal eine Tasse Kaffee zu trinken und einen Blick auf die Karten und die interessanten kleinen Päckchen zu werfen, die auf dem Küchentisch lagen. Ich setzte Wasser auf, mahlte Kaffeebohnen und holte die weiße Porzellantasse mit Unterteller heraus, die Rory mir vor genau einem Jahr geschenkt hatte. Ich erinnerte mich daran, wie ich mit ihm an diesem Tisch gesessen und sie vor seinen Augen ausgepackt hatte. Vor einem Jahr, als ich neununddreißig wurde, war ich noch verheiratet gewesen, und wir hatten uns gerade gemeinsam in unser neues Abenteuer gestürzt. Nun, da ich das Ganze mit gnadenloser Klarheit betrachtete, konnte ich die unheilvollen Zeichen deutlich erkennen. Hätte ich sie schon damals gesehen, dann wäre vielleicht noch eine Chance gewesen, uns zu retten. Ich konnte mich noch genau an den Tag erinnern. Rory hatte mir die schöne Tasse geschenkt und außerdem eine Bluse, die mir mehrere Nummern zu groß war. Am Nachmittag hatten wir einen langen Spaziergang im Regen rund um die Insel gemacht.
Inzwischen war ich vierzig und wieder solo, und aus den Trümmern meiner Ehe stieg noch der Rauch auf. Trotzdem fühlte ich mich dank Christian jünger, attraktiver, energiegeladener und hoffnungsvoller als seit langem. So ist das, wenn man sich verliebt.
Ich schüttete das kochende Wasser über die frisch gemahlenen Bohnen und öffnete dann das erste Kuvert. Die Karte darin kam von meiner alten Schulfreundin Cora. Ich hatte sie schon seit Jahren nicht mehr gesehen, aber wir vergaßen nie, uns zum Geburtstag zu schreiben, um auf diese Weise wenigstens einen letzten Rest unserer Freundschaft zu bewahren.
Insgesamt waren es etwa zwölf Karten und drei Geschenke: ein Paar Ohrringe, ein Buch mit Karikaturen über das Älterwerden und eine CD von einer sinnlich dreinblickenden jungen Sängerin, deren Namen ich noch nie gehört hatte. Beinahe hätte ich den großen, mit ordentlichen Druckbuchstaben versehenen braunen Umschlag ganz unten im Stapel gar nicht aufgemacht, weil ich davon ausging, dass er eine Werbebroschüre enthielt. Nachdem ich die gummierte Lasche mit dem Finger geöffnet hatte, sah ich, dass er ein glänzendes Blatt enthielt, und zog es vorsichtig heraus. Es war eine DIN-A4-Aufnahme von Jackson und Charlie. Auf dem oberen Rand prangte in Charlies typischer Krakelschrift »Happy Birthday!«, und unten hatten sie beide unterschrieben.
Lächelnd betrachtete ich ihre Gesichter, die mich ihrerseits anlächelten. Jackson machte trotz dieses Lächelns einen ernsten und leicht verlegenen Eindruck. Seine dunkelbraunen Augen blickten direkt in die Kamera. Neben seinem ordentlich gekämmten dunklen Haar mit dem herzförmigen Stirnansatz wirkte Charlies kupferrote Mähne herrlich wild. Sie lächelte breit, so dass sich an einer Wange ein Grübchen gebildet hatte, und ihre blaugrünen Augen leuchteten in ihrem bleichen, sommersprossigen Gesicht.
»Jackson!«, rief ich die Treppe hinauf. »Das ist wundervoll!«
»Was?«, rief er zurück.
»Das Foto. Es ist mit der Post gekommen.«
»Das war Charlies Idee. Sie hat gesagt, dass es aufregender ist, wenn man etwas mit der Post bekommt.«
»Es ist wirklich schön«, sagte ich, während ich mir das Bild noch einmal genau ansah, mich über die strahlenden Augen der beiden freute. »Wer hat es gemacht?«
Er streckte den Kopf zur Küchentür herein und warf ebenfalls einen Blick auf das Foto.
»Was?«
»Wer hat euch fotografiert?«
»Oh, ich weiß nicht genau. Eine Freundin von Charlie, als du mal nicht da warst.«
»Am Sonntag?«
»Ja. Ich kann mich aber nicht an ihren Namen erinnern.«
»Danke. Ich werde es immer in Ehren halten.«
Er zog wieder ab, als hätte er meine Worte nicht gehört.
Später würde ich einen passenden Rahmen dafür suchen, aber nun pinnte ich es erst mal mit einem Magneten an die Kühlschranktür. Dann überlegte ich, was als Nächstes zu tun war. Was von all den Dingen, die erledigt werden mussten, sollte ich zuerst in Angriff nehmen? Ich warf im Geiste eine achtseitige Münze. Als Erstes verstaute ich die Tasche mit dem Schnorchel, den Flossen und all unseren Schwimmsachen und Badetüchern im Kofferraum des Wagens, damit sie schon mal aus dem Weg war. Dann steckte ich die Dollars, die ich letzte Woche bei der Bank bestellt hatte, in meine Geldbörse. Als Nächstes schrieb ich dem Milchmann eine Nachricht, dass wir die kommenden zwei Wochen keine Milch brauchten, rollte den Zettel zusammen und schob ihn in den Hals einer leeren Flasche, die ich vor die Haustür stellte. Anschließend widmete ich mich dem Geschirr, das sich im Spülbecken stapelte. Nachdem ich es gespült, getrocknet und weggeräumt hatte, fegte ich noch gründlich den Küchenboden – ich wollte Renata ein sauberes Haus hinterlassen. Deswegen zog ich auch noch all unsere Betten ab und trug die Bettwäsche in die Küche, um mich dort darum zu kümmern. Die Uhr am Herd zeigte schon fast halb zwölf an, als ich es ein weiteres Mal bei Charlie versuchte, aber es schaltete sich wieder nur ihre Mailbox ein.
Ich beschloss, mir rasch die Haare zu waschen, bevor Charlie nach Hause kam und das Bad in Beschlag nahm: Außer ihr kenne ich niemanden, der es schafft, mit einmal Duschen einen ganzen Wassertank zu leeren. Ich hatte noch die Hälfte der Spülung im Haar, als es plötzlich an der Tür klopfte. Ich stöhnte entnervt, weil ich annahm, dass es sich um den Fischverkäufer handelte, der jeden Samstagvormittag vorbeikam. Das war insbesondere deswegen ärgerlich, weil es in dem Fischladen am Hafen, der etwa drei Gehminuten von unserem Haus entfernt lag, ein größeres und frischeres Angebot gab. Doch hin und wieder erbarmte ich mich seiner, was für ihn wohl Motivation genug war, immer auf der Matte zu stehen.
Es klopfte erneut, diesmal lauter, und ich dachte: Charlie, die mal wieder ihre Schlüssel verloren hat. In den schäbigen grauen, von Rory zurückgelassenen Bademantel gehüllt, eilte ich die Treppe hinunter und frottierte mir dabei im Gehen das Haar. Als ich die Tür aufriss, wollte ich gerade so etwas sagen wie: »Die verlorene Tochter kehrt heim«, klappte den Mund aber wieder zu, weil es weder Charlie noch der Fischmann war.
Irgendjemand sang laut. Mehrere Leute sangen laut. Ich sah mich mindestens zwölf Gesichtern gegenüber. Bei ihrem Anblick empfand ich schlagartig jene Art Entsetzen, die man fühlt, wenn man weiß, dass man gleich einen Unfall haben wird und nichts tun kann, um ihn zu verhindern. Wenn man mit dem Ellbogen die Vase vom Regal gestoßen hat, sie aber noch nicht auf dem Boden gelandet ist. Wenn man zu spät auf die Bremse gestiegen ist und spürt, wie der Wagen unaufhaltsam auf den Wagen davor zurast. Mir wurde klar, dass ich das Opfer einer Überraschungsparty war.
Ganz vorne stand Joel, der alle anderen um Haupteslänge überragte und sein Arbeitsoutfit trug, bestehend aus Jeans und einer schweren grünen Jacke. Er lächelte mich entschuldigend an. Wenigstens sang er nicht. Er hatte versprochen, nie wieder in die Nähe dieses Hauses zu kommen, und doch stand er nun hier, und direkt hinter ihm – mit eisiger Miene und ebenfalls, ohne zu singen – seine Frau Alix. Das an sich wäre ja schon schlimm genug gewesen, aber war da nicht auch noch der Pfarrer? Definitiv singend. Er leitete den Gesang, als befände er sich in der Kirche und müsste eine träge Gemeinde mitreißen. Hinter mir begann Sludge panisch zu winseln. Sie war noch nie ein besonders guter Wachhund gewesen.
»Happy Birthday to you-ou-ou-ou!«, brachten sie ihr Ständchen zu Ende.
»Überraschung!«, rief Joel.
Einen Moment lang war ich versucht, ihnen einfach die Tür vor der Nase zuzuschlagen und abzusperren. Aber das konnte ich natürlich nicht. Das waren meine Nachbarn, die Leute, die mit mir zusammen diese Insel bewohnten, meine Freunde. Krampfhaft versuchte ich, mir meinen Schrecken nicht anmerken zu lassen und stattdessen zu lächeln.