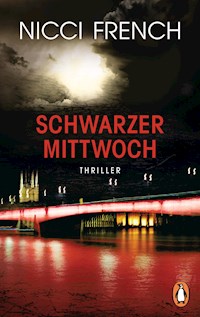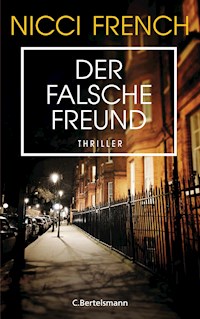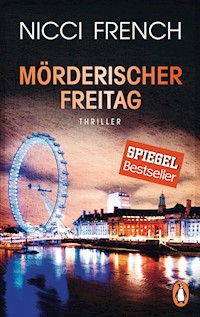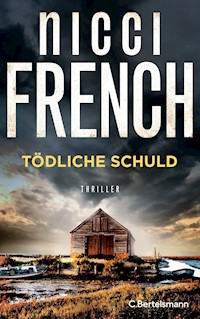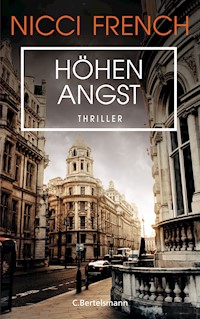9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Psychologin Frieda Klein als Ermittlerin
- Sprache: Deutsch
Als der 5-jährige Matthew verschwindet, geht ein Aufschrei durch London. In den Zeitungen erscheint sein Bild – und die Psychotherapeutin Frieda Klein kann es nicht fassen: Matthew gleicht bis ins Detail dem Wunschkind eines verzweifelten kinderlosen Patienten von ihr. Ist dieser Mann ein brutaler Psychopath? Warum hat sie das als Therapeutin nicht schon vorher bemerkt? Zusammen mit Inspector Karlsson stößt Frieda auf Parallelen zum Verschwinden eines Mädchens vor mehr als zwanzig Jahren. Sie kommt dem Entführer immer näher. Doch es ist ein Wettlauf gegen die Zeit …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 577
Veröffentlichungsjahr: 2012
Sammlungen
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1987
In dieser Stadt gab es viele Geister. Sie musste aufpassen. Deshalb übersprang sie die Ritzen im Pflaster und hüpfte jedes Mal gerade so weit, dass ihre Füße, die in abgewetzten Schnürschuhen steckten, auf den Flächen zwischen den Spalten landeten. Mittlerweile war sie dabei sehr flink, sie beherrschte dieses Himmel-und-Hölle-Spiel fast schon im Schlaf. Sie hatte es jeden Tag auf dem Schulweg geübt, und auch davor, so lange sie denken konnte: zunächst an der Hand ihrer Mutter, die ungeduldig an ihr zerrte, während sie von einem sicheren Platz zum nächsten sprang, und später allein. Nur nicht auf die Ritzen treten, oder… oder was? Vermutlich war sie mit ihren neun Jahren inzwischen viel zu alt für dieses Spiel. In ein paar Wochen – kurz bevor die Sommerferien anfingen – wurde sie sogar schon zehn. Trotzdem spielte sie es weiter, größtenteils aus Gewohnheit, aber auch aus Angst vor dem, was passieren könnte, wenn sie damit aufhörte.
Das nächste Stück hatte es in sich, denn hier war das Pflaster in ein von Zacken durchzogenes Mosaik aufgebrochen. Sie überwand den schwierigen Abschnitt, indem sie auf Zehenspitzen von einer kleinen Insel zur nächsten hüpfte. Dabei schlugen ihr die Zöpfe gegen die heißen Wangen, und die Schultasche mit den schweren Büchern und ihrer nur halb geleerten Lunchbox an die Hüfte. Hinter sich hörte sie Joannas Schritte, wandte sich jedoch nicht um. Ihre kleine Schwester trödelte wie immer hinter ihr her und hielt sie auf. Gerade hörte sie sie wieder jammern: »Rosie, Rosie! Warte auf mich!«
»Beeil dich ein bisschen!«, rief sie über die Schulter zurück. Obwohl sich mittlerweile mehrere Leute zwischen ihnen befanden, erhaschte sie einen Blick auf Joannas erhitztes Gesicht, das unter dem dunklen Pony rot leuchtete. Ihre kleine Schwester machte einen ängstlichen Eindruck und hielt vor lauter Konzentration die Zungenspitze an die Unterlippe gepresst. Ihr Fuß landete auf einer Ritze. Sie schwankte einen Moment lang und trat dann auf eine weitere Spalte. Das passierte ihr ständig. Sie war ein ungeschicktes Kind, das oft Essen verschüttete und sich regelmäßig die Zehen anschlug oder in Hundekacke trat. »Beeil dich!«, wiederholte Rosie ärgerlich, während sie weiter an den anderen Fußgängern vorbeihüpfte.
Es war vier Uhr nachmittags, und der Himmel strahlte in einem wolkenlosen Blau. Das grelle Sonnenlicht auf dem Pflaster tat ihr in den Augen weh. Rasch bog sie in Richtung Süßwarenladen ab und befand sich plötzlich im Schatten, wo sie sofort ihr Tempo drosselte, da die Gefahr nun gebannt war. Die Pflastersteine wurden hier von Asphalt abgelöst. Sie ging an dem Mann mit dem pockennarbigen Gesicht vorbei, der tagtäglich in der Tür saß und eine Büchse neben sich stehen hatte. An seinen Schnürstiefeln fehlten die Schuhbänder. Rosie vermied es, ihm ins Gesicht zu sehen. Sie mochte es nicht, wie er lächelte, ohne wirklich zu lächeln, genau wie ihr Vater es manchmal tat, wenn er sich am Samstag von ihnen verabschiedete. Heute war Montag: Am Montag vermisste sie ihn am meisten, weil sie dann noch die ganze Woche vor sich hatte und genau wusste, dass er wieder nicht da sein würde. Wo blieb Joanna bloß? Während Rosie wartete, eilten andere Leute an ihr vorüber – ein Pulk Jugendlicher, eine Frau mit einem Schal um den Kopf und einer großen Tasche, ein Mann mit einem Stock –, und dann trat endlich ihre kleine Schwester aus dem gleißenden Licht in den Schatten, eine magere Gestalt mit überdimensionaler Schultasche, Knubbelknien und schmuddeligen weißen Söckchen. Das Haar klebte ihr an der Stirn.
Rosie wandte sich wieder um, steuerte auf den Süßwarenladen zu und begann zu überlegen, was sie sich kaufen sollte. Vielleicht Fruchtgummis … oder Eiskonfekt, allerdings schmolz das bei der Hitze bestimmt, bis sie zu Hause war. Joanna würde sich wie üblich für Erdbeerstangen entscheiden und davon einen rosa verschmierten Mund bekommen. Hayley, eine Klassenkameradin von Rosie, befand sich bereits im Laden. Sie gesellte sich zu ihr an die Theke, und gemeinsam suchten sie ihre Süßigkeiten aus. Weingummis, beschloss Rosie. Mit dem Zahlen musste sie warten, bis Joanna kam. Sie warf einen Blick zur Tür und hatte einen Moment lang das Gefühl, etwas zu sehen – irgendetwas Verschwommenes, das anders war als sonst, wie ein Schimmer in der heißen Luft, als wollte ihr das Licht einen Streich spielen. Dann aber war es verschwunden. Die Tür war leer, niemand stand da.
Während draußen Bremsen quietschten, ereiferte Rosie sich laut.
»Immer muss ich auf meine kleine Schwester warten!«
»Du Ärmste«, meinte Hayley.
»Sie ist eine solche Heulsuse. Das nervt!« Sie sagte das, weil sie das Gefühl hatte, dass es von ihr erwartet wurde. Man musste auf seine jüngeren Geschwister herabblicken, die Augen verdrehen und über sie herziehen.
»Das kann ich mir vorstellen«, antwortete Hayley mitfühlend.
»Wo bleibt sie bloß?« Mit einem theatralischen Seufzer legte Rosie ihr Päckchen Süßigkeiten ab und ging zur Tür, um hinauszuspähen. Auf der Straße rauschten die Autos vorbei. Eine Frau in einem Sari ging vorüber, von Kopf bis Fuß in Gold-und Rosétöne und einen lieblichen Duft gehüllt, gefolgt von drei Jungs aus der nahe gelegenen höheren Schule. Die drei rempelten einander die spitzen Ellbogen in die Rippen.
»Joanna! Joanna, wo bist du?«
Sie merkte selbst, wie schrill und ärgerlich ihre Stimme klang, und dachte: Ich höre mich schon an wie meine Mum, wenn sie schlechter Laune ist.
Hayley stand daneben und kaute schmatzend auf ihrem Kaugummi herum. »Wo ist sie denn hin?« Aus ihrem Mund tauchte eine blassrosa Blase auf, die sie aber gleich wieder einsaugte.
»Sie weiß genau, dass sie bei mir bleiben soll!«
Rosie lief zu der Ecke, wo sie Joanna zuletzt gesehen hatte, und blickte sich mit zusammengekniffenen Augen um. Sie rief erneut nach ihrer Schwester, wobei ihre Stimme von einem Lastwagen übertönt wurde. Vielleicht war Joanna über die Straße gelaufen, weil sie auf der anderen Seite eine Freundin entdeckt hatte. Ähnlich sah ihr das nicht. Sie war ein gehorsames kleines Mädchen. Fügsam, so sagte ihre Mutter immer.
»Findest du sie nicht?« Hayley tauchte an ihrer Seite auf.
»Wahrscheinlich ist sie ohne mich nach Hause«, meinte Rosie so lässig wie möglich. Trotzdem war der panische Unterton in ihrer Stimme auch für sie selbst nicht zu überhören.
»Na dann, bis morgen.«
»Bis morgen.«
Sie versuchte, in ihrem normalen Tempo zu gehen, doch das funktionierte nicht. Ihr Körper ließ sie nicht ruhig bleiben, sodass sie schließlich in einen gehetzten Galopp verfiel. Das Herz schlug ihr bis zum Hals, und sie hatte einen scheußlichen Geschmack im Mund. »So eine blöde Kuh!«, stieß sie immer wieder hervor, und dann: »Ich bringe sie um! Wenn ich sie sehe, dann …« Während sie auf wackligen Knien weiterlief, stellte sie sich vor, wie sie Joanna an den knochigen Schultern packen und schütteln würde, bis ihr der Kopf brummte.
Zu Hause. Eine blaue Haustür und eine Hecke, die niemand mehr geschnitten hatte, seit ihr Vater gegangen war. Als sie stehen blieb, verspürte sie jenen leichten Anflug von Übelkeit, den sie immer empfand, wenn sie sich mit irgendetwas in Schwierigkeiten brachte. Sie betätigte den Klopfer, so fest sie konnte, weil die Klingel nicht mehr funktionierte. Und wartete. Lass sie da sein, lass sie da sein, lass sie da sein! Die Tür ging auf, und vor ihr stand ihre Mutter, noch im Mantel. Sie war wohl gerade erst aus der Arbeit gekommen. Einen Moment sah sie Rosie an, dann wanderte ihr Blick ein Stück tiefer, auf den leeren Platz neben ihr.
»Wo ist Joanna?« Die Worte hingen zwischen ihnen in der Luft. Rosie registrierte die plötzliche Anspannung in den Zügen ihrer Mutter. »Rosie? Wo ist Joanna?«
So leise, dass sie es selbst kaum hörte, antwortete sie: »Vorhin war sie noch da. Es ist nicht meine Schuld. Ich dachte, sie wäre schon vorausgegangen.«
Ehe sie es sich versah, hatte ihre Mutter sie auch schon an der Hand gepackt, und sie liefen gemeinsam den Weg zurück, den Rosie gekommen war: die Straße entlang, in der sie wohnten, und dann vorbei am Süßwarenladen, vor dem ein paar Kinder herumhingen, vorbei an dem Mann mit dem pockennarbigen Gesicht und dem leeren Lächeln und um die Ecke, hinaus aus dem Schatten ins gleißende Licht. Obwohl Rosie bereits Seitenstechen hatte, liefen sie immer weiter, und ihre Füße trommelten über die Ritzen ohne haltzumachen.
Die ganze Zeit hörte sie über alle anderen Geräusche hinweg – das laute Pochen ihres Herzens und das asthmatische Rasseln ihres Atems – die Rufe ihrer Mutter: »Joanna? Joanna? Wo bist du, Joanna ?«
Deborah Vine hielt sich ein Taschentuch vor den Mund, als wollte sie den herausströmenden Worten Einhalt gebieten. Durch das Fenster, das auf die Rückseite des Gebäudes hinausging, sah der Polizeibeamte ein schlankes, dunkelhaariges Mädchen ganz still in dem kleinen Garten stehen, die Arme dicht am Körper, die Schultasche noch über der Schulter. Deborah Vine starrte ihn an. Er wartete auf ihre Antwort.
»Ich weiß es nicht genau«, sagte sie schließlich, »gegen vier. Auf dem Heimweg von der Schule, Audley Road Primary. Normalerweise hätte ich sie selbst abgeholt, aber es ist so schwierig, von der Arbeit rechtzeitig hinzukommen, außerdem war sie mit Rosie unterwegs, und es sind keine Straßen zu überqueren, deswegen dachte ich, es könnte nichts passieren. Andere Mütter lassen ihre Kinder ganz allein nach Hause gehen, schließlich müssen sie es ja lernen, nicht wahr, sie müssen lernen, auf sich selbst aufzupassen, und Rosie hat versprochen, ein Auge auf sie zu haben.«
Während sie keuchend nach Luft rang, notierte er etwas in seinem Buch. Dann fragte er sie noch einmal nach Joannas genauem Alter. Fünf Jahre und drei Monate. Wo sie zuletzt gesehen worden sei. Vor dem Süßwarenladen. An den Namen des Ladens erinnerte Deborah sich nicht, erklärte jedoch, sie könne die Polizei hinführen.
Der Beamte klappte sein Notizbuch zu. »Wahrscheinlich ist sie bei einer Freundin«, mutmaßte er, »aber vielleicht hätten Sie trotzdem ein Foto? Ein aktuelles.«
»Sie ist klein für ihr Alter«, antwortete Deborah. Sie bekam die Worte kaum heraus. Der Beamte musste sich vorbeugen, um sie zu verstehen. »Ein mageres kleines Ding. Sie ist ein braves Mädchen. Schrecklich schüchtern, wenn man sie das erste Mal trifft. Sie würde niemals mit einem Fremden mitgehen.«
»Ein Foto«, wiederholte er.
Während sie sich auf die Suche machte, betrachtete der Beamte wieder das Mädchen im Garten. Ihr blasses Gesicht wirkte ausdruckslos. Er würde mit ihr sprechen müssen. Vielleicht konnte einer seiner Kollegen das übernehmen. Am besten eine Frau. Aber womöglich tauchte Joanna ja wieder auf, bevor das nötig wurde. Kam einfach ins Haus gestürmt. Vermutlich war sie mit einer Freundin davonmarschiert und spielte gerade, mit was auch immer fünfjährige Mädchen so spielen – Puppen oder Malkreiden oder Teegeschirr oder Prinzessinnenkrönchen. Er starrte auf das Foto, das Deborah Vine ihm reichte. Es zeigte ein Mädchen, das wie seine Schwester dunkles Haar und ein schmales Gesicht hatte. Ein Mädchen mit einem abgebrochenen Zahn, einem strengen Pony und einem Lächeln, das aussah, als hätte sie pflichtbewusst die Mundwinkel hochgezogen, als der Fotograf sie aufforderte, »Cheese« zu sagen.
»Haben Sie Ihren Mann erreicht?«
Sie verzog das Gesicht.
»Richard – mein… besser gesagt, der Vater der Mädchen – lebt nicht bei uns.« Dann, als müssten die Worte einfach noch heraus, fügte sie hinzu: »Er hat uns wegen einer Jüngeren verlassen.«
»Sie sollten ihn verständigen.«
»Demnach glauben Sie also, dass etwas wirklich Schlimmes passiert ist?« Natürlich wünschte sie, er würde Nein sagen. Sie wollte von ihm hören, dass es im Grunde gar nicht nötig war, den Vater zu verständigen. Dabei rechnete sie ja selbst mit etwas Schlimmem. Nicht umsonst war ihr vor lauter Angst der kalte Schweiß ausgebrochen. Der Polizist konnte ihre Angst fast riechen.
»Wir bleiben in Kontakt. Eine Kollegin ist bereits auf dem Weg hierher.«
»Was soll ich tun? Es muss doch etwas geben, das ich tun kann. Ich kann nicht einfach hier herumsitzen und warten. Sagen Sie mir, was ich tun kann. Irgendwas.«
»Sie könnten bei ihren Freundinnen anrufen«, schlug er vor. »Überall dort nachfragen, wo sie vielleicht hingegangen sein könnte.«
Sie hielt ihn am Ärmel fest. »Sagen Sie mir, dass alles wieder gut wird!«, beschwor sie ihn. »Sagen Sie mir, dass Sie sie finden werden!«
Verlegen wandte der Beamte den Blick ab. Er konnte ihr das nicht versprechen und wusste auch nicht, was er ihr sonst sagen sollte.
Jedes Mal, wenn das Telefon klingelte, wurde es ein bisschen schlimmer. Leute klopften an die Tür. Sie hatten davon gehört. Was für eine schreckliche Sache, aber natürlich werde es gut ausgehen. Alles werde wieder gut werden, der Albtraum ein Ende haben. Konnten sie irgendetwas tun? Was es auch sei, sie bräuchten es nur zu sagen. Ein Wort genüge.
Nun stand die Sonne bereits tief am Himmel, und lange Schatten fielen über Straßen, Häuser und Parks. Es wurde allmählich kühl. In ganz London saßen die Leute vor dem Fernseher oder standen am Herd und rührten in ihren Töpfen oder scharten sich in verrauchten Pubs zu Grüppchen, um miteinander über ihre Urlaubspläne oder die Fußballergebnisse vom Samstag zu sprechen oder sich stöhnend über allerlei Beschwerden und Wehwehchen auszutauschen.
Rosie hockte mit weit aufgerissenen Augen auf einem Sessel. Einer ihrer Zöpfe hatte sich halb aufgelöst. Die Polizistin, eine große, füllige und sehr freundliche Frau, saß neben ihr und tätschelte ihr die Hand. Aber Rosie konnte sich an nichts erinnern, sie wusste nichts und durfte auch nicht darüber reden: Worte waren gefährlich. Davon war sie überzeugt, obwohl ihr das niemand gesagt hatte. Sie wollte, dass ihr Vater nach Hause kam und alles wieder in Ordnung brachte, doch kein Mensch wusste, wo er sich aufhielt. Er war nicht zu erreichen. Ihre Mutter meinte, er sei wahrscheinlich irgendwo unterwegs. Rosie stellte ihn sich auf einer Straße vor, die sich endlos vor ihm erstreckte, bis sie sich in der Ferne unter einem dunklen Himmel verlor.
Sie kniff die Augen fest zu. Wenn sie sie wieder aufschlug, würde Joanna da sein. Sie hielt die Luft an, bis ihr die Brust wehtat und das Blut in den Ohren dröhnte. Sie konnte die Dinge beeinflussen. Doch als sie die Augen schließlich wieder öffnete und das nette, besorgte Gesicht der Polizistin vor sich sah, weinte ihre Mutter immer noch und nichts hatte sich verändert.
Am nächsten Morgen um halb zehn fand in dem Raum, der auf dem Polizeirevier von Camford Hill zur Einsatzzentrale erklärt worden war, eine Besprechung statt. Was zunächst eine hektische Suchaktion gewesen war, verwandelte sich in eine systematische polizeiliche Ermittlung. Der Fall bekam eine Nummer. Detective Chief Inspector Frank Tanner übernahm das Kommando und hielt eine Ansprache. Leute wurden einander vorgestellt und Schreibtische vergeben, was bei einigen zu Diskussionen Anlass gab. Ein Techniker installierte Telefonleitungen, und an den Wänden wurden Korkflächen angebracht. Im ganzen Raum herrschte eine Atmosphäre besonderer Dringlichkeit. Da war aber noch etwas anderes, das niemand laut aussprach, aber alle spürten: ein ungutes Gefühl in der Magengegend. In diesem Fall ging es nicht um einen Teenager oder einen Ehemann, der nach einem Streit verschwunden war. Hier ging es um ein fünfjähriges Mädchen. Siebzehneinhalb Stunden waren vergangen, seit sie zum letzten Mal gesehen worden war. Das war zu lange. Eine ganze Nacht, noch dazu eine kalte. Zum Glück hatten sie Juni und nicht November, aber trotzdem – eine ganze Nacht.
DCI Tanner war gerade dabei, das Team über eine für den späteren Vormittag angesetzte Pressekonferenz zu informieren, als er unterbrochen wurde. Ein Beamter in Uniform hatte den Raum betreten. Er bahnte sich einen Weg nach vorn und sagte zu Tanner etwas, das keiner der anderen Anwesenden mitbekam.
»Ist er unten?«, fragte Tanner. Der Beamte bejahte. »Ich spreche gleich mit ihm.«
Tanner forderte einen anderen Detective mit einer Kopfbewegung auf, ihn zu begleiten. Gemeinsam verließen sie den Raum.
»Der Vater?«, fragte der Detective, der Langan hieß.
»Er ist gerade erst eingetroffen.«
»Sind sie im Streit auseinandergegangen?«, erkundigte sich Langan. »Er und seine Ex?«
»Das nehme ich an«, antwortete Tanner.
»Meistens ist es jemand aus dem näheren Umfeld«, bemerkte Langan.
»Was für eine erfreuliche Neuigkeit.«
»Ich meine ja nur.«
Mittlerweile waren sie vor dem Verhörraum angelangt.
»Wie wollen wir vorgehen?«, fragte Langan.
»Wir haben es mit einem besorgten Vater zu tun«, erwiderte Tanner, ehe er die Tür aufschob.
Richard Vine hatte sich erhoben – oder gar nicht erst hingesetzt. Er trug einen grauen Anzug ohne Krawatte. »Gibt es etwas Neues?«, fragte er.
»Wir tun alles in unserer Macht Stehende«, antwortete Tanner.
»Also nichts Neues?«
»Es ist noch zu früh«, erklärte Tanner, obwohl er genau wusste, dass das nicht stimmte. Das genaue Gegenteil entsprach eher der Wahrheit. Mit einer Handbewegung forderte er Richard Vine auf, sich zu setzen.
Langan bezog an einer Seite des Raums Stellung, um den Vater während des Gesprächs beobachten zu können. Vine war hochgewachsen und hatte die schlechte Haltung eines Mannes, der sich wegen seiner Körpergröße unwohl fühlte. Sein dunkles Haar begann an den Schläfen bereits grau zu werden, obwohl er kaum älter als Mitte dreißig sein konnte. Er hatte dunkle, buschige Augenbrauen und war unrasiert. Sein blasses, leicht aufgeschwemmtes Gesicht ließ ihn ziemlich mitgenommen aussehen. Seine braunen Augen waren rot gerändert und wirkten entzündet. Er machte einen benommenen Eindruck.
»Ich war unterwegs«, erklärte Vine ungefragt. »Ich wusste nichts davon. Ich habe es erst heute früh erfahren.«
»Können Sie mir sagen, wo Sie waren, Mr. Vine?«
»Unterwegs«, wiederholte er. »Meine Arbeit …« Er hielt inne und strich sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. »Ich bin Handelsvertreter. Ich verbringe viel Zeit auf der Straße. Was hat das mit meiner Tochter zu tun?«
»Es geht lediglich darum zu klären, wo Sie waren.«
»Ich war in St. Albans. Dort gibt es ein neues Sportzentrum. Brauchen Sie die genauen Zeiten? Brauchen Sie Beweise?« Seine Stimme klang plötzlich schärfer. »Ich war nicht hier in der Nähe, falls es das ist, was Sie denken. Was hat Debbie über mich erzählt?«
»Ich hätte tatsächlich gern die exakten Zeiten.« Tanner behielt seinen ruhigen Ton bei. »Und die Namen sämtlicher Personen, die Ihre Angaben bestätigen können.«
»Was glauben Sie eigentlich? Dass ich sie entführt und irgendwo versteckt habe, weil Debbie nicht zulässt, dass die Mädchen bei mir übernachten, und die beiden gegen mich aufhetzt? Oder gar, dass ich …« Er konnte die Worte nicht aussprechen.
»Das sind reine Routinefragen.«
»Für mich nicht! Mein kleines Mädchen ist verschwunden, mein Baby!« Er sackte in sich zusammen. »Natürlich werde ich Ihnen die gottverdammten Zeiten nennen. Sie können sie gern überprüfen. Aber Sie vergeuden Ihre Zeit mit mir, und während dieser ganzen Zeit suchen Sie nicht nach ihr.«
»Wir suchen sehr wohl«, widersprach Langan. Und zwar schon seit siebzehneinhalb Stunden, ging ihm durch den Kopf. Nein, inzwischen sind es schon achtzehn. Sie ist erst fünf Jahre alt und seit achtzehn Stunden verschwunden. Er starrte den Vater an. Man konnte nie wissen.
Später kauerte Richard Vine neben dem Sofa, auf dem sich Rosie in eine Ecke drückte. Sie trug noch ihren Schlafanzug und die Zöpfe vom Vortag, auch wenn sich diese immer mehr auflösten.
»Daddy?«, fragte sie. Das war so ziemlich das Erste, was sie von sich gab, seit ihre Mutter am Vortag die Polizei angerufen hatte. »Daddy?«
Er nahm sie in die Arme. »Hab keine Angst«, sagte er, »sie kommt bestimmt bald nach Hause. Du wirst schon sehen.«
»Versprochen?«, flüsterte sie in seinen Hals hinein.
»Versprochen.«
Aber sie spürte seine Tränen auf ihrer Kopfhaut. Dort, wo der Scheitel war.
Sie fragten sie, woran sie sich erinnere, aber sie konnte sich an nichts erinnern. Nur an die Ritzen im Pflaster, an die Süßigkeiten, die sie sich ausgesucht hatte, und an Joannas Rufe, sie solle doch auf sie warten. Und an ihre Wut auf die kleine Schwester, ihren Wunsch, sie möge anderswo sein. Die Polizeibeamten erklärten ihr, wie wichtig es sei, dass sie ihnen sämtliche Leute, die sie auf dem Heimweg von der Schule gesehen habe, genau beschreibe. Sowohl diejenigen, die sie kannte, als auch solche, die sie nicht kannte. Dabei spiele es keine Rolle, ob ihr selbst etwas wichtig erscheine oder nicht: Es sei Aufgabe der Polizei, darüber zu entscheiden. Aber sie hatte niemanden gesehen, nur Hayley im Süßwarenladen und den Mann mit dem pockennarbigen Gesicht. Schatten schwirrten durch ihr Gehirn. Ihr war sehr kalt, obwohl draußen vor dem Fenster die Sonne schien. Sie steckte das Ende eines ihrer in Auflösung begriffenen Zöpfe in den Mund und saugte heftig daran.
»Sagt sie noch immer nichts?«
»Kein Wort.«
»Sie glaubt, dass es ihre Schuld war.«
»Die arme Kleine, wie soll sie nur damit leben?«
»Schhh! Sprich nicht, als wäre es schon vorbei.«
»Glaubst du wirklich, dass sie noch am Leben ist?«
Sie zogen Linien und wanderten ganz langsam über das Brachland in der Nähe des Hauses, wobei sie sich hin und wieder bückten, um Dinge vom Boden aufzuheben und in Plastiktüten zu stecken. Sie gingen von Tür zu Tür und zeigten den Leuten das Foto, das Joannas Mutter ihnen am Montagnachmittag gegeben hatte und das die Fünfjährige mit einem gerade geschnittenen Pony und einem gehorsamen Lächeln im schmalen Gesicht zeigte. Inzwischen hatte dieses Foto Berühmtheit erlangt, denn auch die Zeitungsleute hatten es in die Finger bekommen. Vor dem Haus drängten sich Journalisten, Fotografen, ein Fernsehteam. Aus Joanna wurde »Jo« oder – noch schlimmer – »die kleine Jo«, als wäre sie die kindliche, fast schon heilige Heldin eines viktorianischen Romans. Gerüchte wurden laut. Es war unmöglich, ihre Quelle auszumachen, aber sie verbreiteten sich rasch durchs ganze Viertel. Es war der Obdachlose. Es war ein Mann in einem blauen Kombi. Es war der Vater. Man hatte ihre Kleidung auf einer Müllhalde gefunden. Man hatte sie in Schottland gesehen, und in Frankreich. Sie war definitiv tot, und sie war definitiv noch am Leben.
Rosies Oma kam, um für eine Weile bei ihnen zu bleiben, und Rosie ging wieder zur Schule. Dabei wollte sie das gar nicht. Sie hatte Angst, dass die anderen sie anstarren und hinter ihrem Rücken flüstern, sich andererseits aber bei ihr einschleimen und um ihre Freundschaft bemühen würden, weil ihr diese große Sache passiert war. Sie saß an ihrem Pult und versuchte sich auf die Worte der Lehrkraft zu konzentrieren, spürte dabei jedoch die Blicke ihrer Mitschüler. Sie hat zugelassen, dass ihre kleine Schwester entführt wurde.
Sie wollte nicht in die Schule, wollte aber auch nicht zu Hause bleiben. Ihre Mutter benahm sich nicht mehr wie ihre Mutter. Sie tat nur noch so, als wäre sie eine Mutter, während sie sich in Wirklichkeit längst anderswo befand. Ihr Blick irrte suchend umher. Immer wieder schlug sie die Hände vor den Mund, als versuchte sie etwas zurückzuhalten – eine Wahrheit, die andernfalls ungehindert hervorquellen würde. Ihr Gesicht wurde hager, verhärmt und alt. Abends, wenn Rosie längst im Bett lag und beobachtete, wie das Scheinwerferlicht der vorbeifahrenden Autos über die Zimmerdecke zuckte, hörte sie ihre Mutter unten rumoren. Selbst dann, wenn alles dunkel war und der Rest der Welt schlief, war ihre Mutter noch wach. Ihr Vater hatte sich ebenfalls verändert. Er lebte jetzt wieder allein. Wenn er Rosie umarmte, drückte er sie viel zu fest. Außerdem roch er komisch – süß und sauer zugleich.
Deborah und Richard Vine saßen zusammen vor den Fernsehkameras. Obwohl sie nach wie vor denselben Familiennamen führten, sahen sie sich nicht an. Tanner hatte ihnen geraten, sich möglichst kurz zu fassen: Sie sollten der Welt nur sagen, wie sehr sie Joanna vermissten, und an ihren Entführer – wer auch immer das sein mochte – appellieren, das Mädchen doch nach Hause gehen zu lassen. Sie sollten sich nicht scheuen, Gefühle zu zeigen. Den Medien würde das gefallen – vorausgesetzt, diese Gefühle hinderten sie nicht am Sprechen.
»Lassen Sie meine Tochter zurück nach Hause!«, flehte Deborah Vine. Als ihr kurz die Stimme versagte, hielt sie eine Hand vor ihr neuerdings so hageres Gesicht. »Lassen Sie sie einfach wieder nach Hause!«
In heftigerem Ton fügte Richard Vine hinzu: »Bitte geben Sie uns unsere Tochter zurück! Alle, die irgendetwas wissen, sollen bitte helfen!« Auf seinem blassen Gesicht leuchteten rote Flecken.
»Was halten Sie davon?«, wandte sich Langan an Tanner.
Tanner zuckte mit den Achseln. »Sie meinen, ob sie ehrlich sind? Ich habe keine Ahnung. Wie kann ein Kind auf diese Weise verschwinden – als hätte es sich in Luft aufgelöst?«
Dieses Jahr gab es keinen Sommerurlaub. Ursprünglich hatten sie vorgehabt, nach Cornwall zu fahren und auf einem Bauernhof zu wohnen. Rosie wusste noch genau, wie sie es sich ausgemalt hatten: Auf den Feldern würde es Kühe geben und auf dem Hof Hühner und sogar ein altes, fettes Pony, auf dem sie vielleicht reiten konnten, wenn die Besitzer es erlaubten. Natürlich wollten sie auch zu den nahe gelegenen Stränden. Joanna fürchtete sich vor dem Meer, sie kreischte jedes Mal, wenn eine Welle an ihre Knöchel klatschte, aber sie liebte es, Sandburgen zu bauen, nach Muscheln zu suchen und Eistüten zu mampfen, in denen oben Schokosplitter steckten.
Stattdessen fuhr Rosie für ein paar Wochen zu ihrer Oma. Dabei wollte sie gar nicht weg. Sie wollte unbedingt zu Hause sein, wenn Joanna gefunden wurde. Sie befürchtete, Joanna könnte es falsch verstehen, wenn sie nicht da war. Womöglich glaubte sie dann, es wäre Rosie nicht wichtig genug gewesen, auf ihre kleine Schwester zu warten.
Bei manchen ihrer Besprechungen blätterten die Detectives durch die Aussagen von Fantasten, einschlägig Vorbestraften und angeblichen Augenzeugen, von denen in Wirklichkeit keiner etwas gesehen hatte.
»Ich glaube immer noch, dass es der Vater war.«
»Er hat ein Alibi.«
»Das haben wir doch schon besprochen. Er könnte zurückgefahren sein. Die Zeit hätte gerade gereicht.«
»Kein Mensch hat ihn gesehen. Nicht mal seine eigene Tochter.«
»Vielleicht doch. Vielleicht sagt sie deswegen nichts.«
»Wie auch immer. Selbst wenn sie etwas beobachtet hat, wird sie sich jetzt nicht mehr daran erinnern. Nach so langer Zeit bleiben nur noch Erinnerungen an Erinnerungen an irgendwelche Suggestionen. Alles ist längst von anderem überdeckt.«
»Was willst du damit sagen?«
»Ich will damit sagen, dass die Kleine verloren ist.«
»Tot?«
»Tot.«
»Das heißt, du gibst auf?«
»Nein.« Er schwieg einen Moment, ehe er hinzufügte: »Aber ich ziehe ein paar Männer von dem Fall ab.«
»Sage ich doch: Du gibst auf.«
Ein Jahr später wurde von einem neuen Computerprogramm, bei dem sogar sein Erfinder warnte, es sei spekulativ und unzuverlässig, ein Foto erstellt, das zeigte, auf welche Weise Joanna sich verändert haben könnte. Ihr Gesicht wirkte ein wenig voller, ihr dunkles Haar noch eine Spur dunkler. Ihr Zahn war nach wie vor abgebrochen, ihr Lächeln immer noch ängstlich. Ein paar Zeitungen brachten das Bild, wenn auch nicht auf der Titelseite. In der Zwischenzeit war eine besonders fotogene Dreizehnjährige ermordet worden, deren Gesicht seit Wochen die Schlagzeilen dominierte. Joanna war inzwischen Schnee von gestern – eine alte Geschichte, an die sich die Öffentlichkeit nur noch dunkel erinnerte. Rosie starrte das Foto an, bis es ihr vor den Augen verschwamm. Sie hatte Angst, ihre Schwester nicht mehr zu erkennen, wenn sie ihr über den Weg lief. Gleichzeitig befürchtete sie, Joanna würde sie ihrerseits auch nicht mehr erkennen – oder sie zwar erkennen, sich aber trotzdem von ihr abwenden. Manchmal setzte sie sich in Joannas Zimmer, das seit dem Tag ihres Verschwindens nicht verändert worden war. Noch immer thronte ihr Teddy auf dem Kissen, ihr Spielzeug war in den flachen Behältern unter dem Bett verstaut, und ihre Anziehsachen – die ihr inzwischen bestimmt nicht mehr passten – lagen ordentlich gestapelt in Schubladen oder hingen im Schrank. Rosie war inzwischen zehn. Nächstes Jahr wollte sie auf die höhere Schule wechseln. Sie hatte darum gebeten, in die knapp drei Kilometer und zwei Busstationen entfernte Schule im benachbarten Stadtteil gehen zu dürfen. Dort würde sie nicht mehr das Mädchen sein, das ihre kleine Schwester verloren hatte, sondern einfach Rosie Vine, Jahrgangsstufe sieben: eine schüchterne, für ihr Alter eher kleine Schülerin, die in allen Fächern recht gut war, wenn auch in keinem Klassenbeste, außer vielleicht in Biologie. Inzwischen war sie alt genug, um zu wissen, dass ihr Vater mehr trank, als er sollte. Gelegentlich musste ihre Mutter kommen und sie abholen, weil er sich nicht mehr richtig um sie kümmern konnte. Sie war auch alt genug, um sich wie eine ältere Schwester ohne jüngere Schwester zu fühlen, und manchmal spürte sie Joannas Anwesenheit wie die eines Geistes – eines Geistes, der einen abgebrochenen Zahn hatte und ihr mit weinerlicher Stimme nachrief, sie solle doch warten. Manchmal entdeckte sie ihre Schwester auf der Straße, und jedes Mal setzte ihr Herz einen Schlag aus, bevor sich das betreffende Gesicht in das einer Fremden verwandelte.
Drei Jahre nachdem Joanna verschwunden war, zogen sie in ein kleineres, knapp zwei Kilometer entferntes Haus, das näher bei Rosies Schule lag. Es hatte zwar drei Schlafzimmer, aber das dritte war winzig, eher eine Abstellkammer als ein richtiger Raum. Deborah Vine wartete, bis Rosie morgens in die Schule aufgebrochen war, ehe sie Joannas Sachen wegpackte. Dabei ging sie ganz systematisch vor, indem sie erst die weichen Stapel ihrer Jacken und Shirts in Schachteln verstaute und dann die Kleider und Röcke zusammenlegte, in Müllsäcke steckte und zu festen Paketen verschnürte. Dabei gab sie sich große Mühe, nicht zu den rosafarbenen Plastikpuppen mit den langen Nylonhaarmähnen und starr geradeaus blickenden Augen zu schauen.
Auf dem jüngsten, vom Computer erzeugten Bild wirkte Joanna recht gelassen, als hätte sie ihre kindliche Ängstlichkeit inzwischen abgelegt. Ihr abgebrochener Zahn war einem neuen, unversehrten gewichen.
Rosie bekam ihre Periode und begann sich die Beine zu rasieren. Sie verliebte sich zum ersten Mal: in einen Jungen, der ihre Existenz kaum zur Kenntnis nahm. Jeden Abend schrieb sie unter der Bettdecke in ihr Tagebuch und verschloss es mit einem silbernen Schlüssel. Als ihre Mutter irgendwann anfing, sich mit einem fremden Mann zu treffen, der einen braunen Stoppelbart hatte, tat Rosie, als machte ihr das nichts aus. Bei ihrem Vater schüttete sie regelmäßig den Schnaps ins Spülbecken, obwohl sie genau wusste, dass es nichts nützen würde. Anlässlich der Beerdigung ihrer Großmutter trug sie ein Gedicht von Tennyson vor, sprach dabei aber so leise, dass kaum jemand ihre Worte verstehen konnte. Bald darauf schnitt sie sich die Haare kurz und begann sich mit dem Jungen zu treffen, in den sie so verliebt gewesen war, doch leider wurde er den Vorstellungen, die sie sich von ihm gemacht hatte, nicht gerecht.
In der Schublade mit ihrer Unterwäsche bewahrte sie einen kleinen Stapel Computerausdrucke auf: Joanna mit sechs, sieben, acht, neun. Joanna mit vierzehn. Sie fand, dass ihre Schwester genau aussah wie sie. Aus irgendeinem Grund fühlte sie sich deswegen noch schlechter.
»Sie ist tot.« Deborahs Stimme klang ruhig, fast ausdruckslos.
»Bist du die ganze Strecke gefahren, um mir das zu sagen?«
»Ich dachte, wir beide wären uns zumindest das schuldig, Richard. Lass sie los.«
»Woher willst du wissen, dass sie tot ist? Du lässt sie einfach im Stich!«
»Nein.«
»Weil du einen neuen Ehemann gefunden hast und jetzt …« Angewidert starrte er auf ihren schwangeren Bauch. »Jetzt bekommst du eine neue glückliche Familie.«
»Richard.«
»Und vergisst sie ganz und gar.«
»Das ist nicht fair. Es ist nun schon zehn Jahre her. Das Leben muss weitergehen, und zwar für uns alle.«
»Das Leben muss weitergehen. Willst du mir womöglich auch noch sagen, dass das Joannas Wunsch gewesen wäre?«
»Joanna war fünf, als wir sie verloren haben.«
»Als du sie verloren hast.«
Deborah erhob sich: schlanke Beine auf hohen Absätzen und ein runder Bauch, über dem der Rock spannte. Er konnte ihren Nabel erkennen. Ihr Mund war ein schmaler, zitternder Strich. »Du Mistkerl!«, stieß sie hervor.
»Und jetzt lässt du sie im Stich.«
»Soll ich mich auch noch kaputt machen?«
»Warum nicht? Immer noch besser als ›Das Leben muss weitergehen‹. Aber keine Sorge, ich warte weiter auf sie.«
Als Rosie zu studieren begann, nahm sie den Namen ihres Stiefvaters an und nannte sich von nun an Rosalind Teale. Ihrem Vater sagte sie nichts davon. Sie liebte ihn nach wie vor, auch wenn ihr sein chaotischer, niemals nachlassender Kummer Angst machte. Sie wollte nicht, dass irgendein Kommilitone zu ihr sagte: »Rosie Vine? Warum kommt mir der Name nur so bekannt vor?« Obwohl damit immer weniger zu rechnen war. Joanna war mit der Vergangenheit verschmolzen. Sie war nur noch ein Hauch von Erinnerung, eine in Vergessenheit geratene Berühmtheit, sozusagen eine Eintagsfliege. Rosie fragte sich manchmal, ob sie ihre Schwester womöglich nur geträumt hatte.
Deborah Teale – ehemals Vine – betete insgeheim voller Inbrunst darum, einen Sohn zu bekommen und keine Tochter. Trotzdem erblickten zuerst Abbie und dann Lauren das Licht der Welt. Sie saß nachts über ihre Körbe gebeugt, um sie atmen zu hören. Sie hielt sie ständig an den Händen und ließ sie keine Sekunde aus den Augen. Die beiden erreichten Joannas Alter, überholten sie und ließen sie hinter sich zurück. Die Schachteln mit Joannas Sachen standen weiterhin ungeöffnet auf dem Dachboden.
Der Fall wurde nie wirklich abgeschlossen. Niemand rang sich zu dieser Entscheidung durch. Dennoch gab es immer weniger zu berichten. Die zuständigen Beamten waren mit anderen Fällen beschäftigt. Besprechungen fanden nur noch sporadisch statt. Irgendwann wurden sie mit anderen Besprechungen zusammengelegt, bis der Fall schließlich überhaupt keine Erwähnung mehr fand.
Rosie, Rosie! Warte auf mich!
1
Es war kurz vor drei Uhr morgens. Vier Personen gingen um diese Zeit über den Fitzroy Square. Ein junges Paar trotzte eng aneinandergeschmiegt dem Wind. Die beiden kamen aus Richtung Soho, wo sie einen Nachtklub besucht hatten. Für sie näherte sich der Sonntagabend allmählich seinem Ende. Obwohl sie es einander nicht eingestanden hatten, zögerten sie den Moment hinaus, in dem sie entscheiden mussten, ob sie in getrennte Taxis oder in ein gemeinsames steigen wollten. Eine dunkelhäutige Frau, die einen braunen Regenmantel und einen transparenten Plastikhut trug, dessen Bänder sie unter dem Kinn fest zusammengebunden hatte, schlurfte entlang der Ostseite des Platzes in Richtung Norden. Für sie war bereits Montagmorgen. Sie war unterwegs in ein Büro an der Euston Road, um dort in aller Herrgottsfrühe, während es draußen noch dunkel war, für Menschen, die sie nie zu Gesicht bekam, Mülleimer zu leeren und Teppiche zu saugen.
Bei der vierten Person handelte es sich um Frieda Klein, und für sie war es weder Sonntagabend noch Montagmorgen, sondern irgendetwas dazwischen. Als sie den Platz betrat, schlug ihr der Wind mit voller Kraft entgegen. Um überhaupt etwas sehen zu können, musste sie sich erst einmal das Haar aus dem Gesicht streichen. Im Verlauf der letzten Wochen hatte sich das Laub der Platanen zunächst rot und dann goldgelb gefärbt, doch nun war es durch Wind und Regen von den Ästen befreit worden und umwogte Frieda wie ein Meer aus Blättern. Ihr ging es im Grunde nur darum, London für sich allein zu haben. Näher konnte sie der Erfüllung dieses Wunsches kaum kommen.
Einen Moment lang blieb sie unschlüssig stehen. In welche Richtung sollte sie gehen? Nach Norden, über die Euston Road zum Regent’s Park? Der wäre tatsächlich menschenleer, denn selbst für die Jogger war es noch zu früh. Im Sommer ging Frieda manchmal mitten in der Nacht dorthin, kletterte über den Zaun und tauchte in die Dunkelheit des Parks ein, um zu beobachten, wie das Mondlicht auf dem Wasser des Sees glitzerte, oder um den Geräuschen aus dem Zoo zu lauschen. Heute Nacht aber wollte sie nicht so tun, als wäre sie gar nicht in London. Nach Süden zog es sie ebenso wenig. Dort würde sie über die Oxford Street nach Soho gelangen. An manchen Abenden verlor sie sich gern zwischen den seltsamen Kreaturen, die mitten in der Nacht noch dort ausharrten oder gerade erst aus ihren Löchern gekrochen kamen. Zwielichtige kleine Taxiunternehmen brachten einen rund um die Uhr nach Hause, verlangten dafür aber so viel, wie sie einem nur abknöpfen konnten. Polizisten rotteten sich zu Pulks zusammen. Lieferwagen wichen Fußgängerscharen aus. Außerdem gab es da noch die City-Maut, ganz zu schweigen von der ständig zunehmenden Zahl von Menschen, die weiter aßen und tranken, egal, wie spät es schon war.
Nicht in dieser Nacht. Nicht an diesem Tag. Nicht jetzt, wo eine neue Woche gerade im Begriff stand, widerwillig in die Gänge zu kommen. Eine Woche, die gezwungen sein würde, dem November ins Auge zu blicken und sich auf Dunkelheit und Regen einzustellen, mit der Aussicht auf noch mehr Dunkelheit und Regen. Es war eine Zeit, in der man eigentlich in einen Winterschlaf versinken und erst im März oder April oder Mai wieder aufwachen sollte. Schlaf. Frieda hatte plötzlich das beklemmende Gefühl, von lauter schlafenden Menschen umgeben zu sein, die allein oder paarweise in Wohnungen, Häusern, Pensionen und Hotels lagen und sich als Träumende die Filme in ihren Köpfen ansahen. Zu diesen Menschen wollte Frieda nicht gehören. Sie setzte sich in Richtung Osten in Bewegung, vorbei an den geschlossenen Läden und Restaurants. Einen Augenblick kam es in der Tottenham Court Road mit ihren Nachtbussen und Taxis zu einem Aufblitzen von Aktivität, doch dann war alles wieder ruhig, und Frieda hörte nur noch das Klacken ihrer eigenen Schritte, während sie weiterging, vorbei an anonymen Wohnblöcken, schäbigen Hotels, Universitätsgebäuden und auch ein paar einzelnen Häusern, die erstaunlicherweise überlebt hatten. Obwohl in diesem Viertel viele Menschen wohnten, fühlte es sich gar nicht danach an. Hatte es überhaupt einen Namen?
Zwei Polizeibeamte in einem geparkten Streifenwagen sahen sie auf die Gray’s Inn Road zusteuern. Die beiden betrachteten sie mit gelangweiltem Interesse. Für eine Frau, die allein umherwanderte, war das hier nicht unbedingt eine sichere Gegend. Die beiden Männer hatten Schwierigkeiten, sie richtig einzuordnen. Eine Prostituierte schien sie jedenfalls nicht zu sein. Sie war nicht mehr ganz jung, vielleicht Mitte dreißig. Langes dunkles Haar. Mittelgroß. Ihr langer Mantel verbarg ihre Figur. Sie sah auch nicht aus wie eine Frau, die gerade von einer Party zurückkam.
»Anscheinend hatte sie keine Lust, die ganze Nacht mit ihm zu verbringen«, meinte einer der beiden.
Der andere grinste. »Ich würde sie in einer solchen Nacht bestimmt nicht aus dem Bett werfen«, antwortete er, während er das Fenster öffnete. »Alles in Ordnung, Miss?«, sprach er sie an, als sie vorbeiging.
Sie schob nur die Hände ein wenig tiefer in die Taschen ihres Mantels und eilte weiter, als hätte sie nichts gehört.
»Sehr charmant«, bemerkte einer der Beamten und wandte sich wieder seiner Arbeit zu: Nach einem kleinen Vorfall, der im Grunde kaum die Bezeichnung »Vorfall« verdiente, galt es, ein Formular auszufüllen.
Während Frieda ihren Weg fortsetzte, hatte sie plötzlich die Worte ihrer Mutter im Ohr. Es hätte nicht geschadet, hallo zu sagen, oder? Aber was wusste ihre Mutter schon? Das war einer der Gründe, warum sie diese Spaziergänge unternahm: damit sie nicht reden, sich niemandem präsentieren musste. Sie wollte nicht angestarrt und beurteilt werden. Um diese Zeit wollte sie einfach nur nachdenken oder aber jeden Gedanken ausblenden. In solchen Nächten, in denen sie nicht schlafen konnte, genoss sie es, endlos dahinzumarschieren und auf diese Weise das ganze Zeug aus ihrem Kopf herauszubekommen. Eigentlich sollte das ja im Schlaf passieren, aber bei ihr funktionierte das nicht. Da brachte es auch kaum etwas, wenn sie liegen blieb und doch von Zeit zu Zeit ein wenig einnickte.
Sie überquerte die Gray’s Inn Road, wo es weitere Busse und Taxis gab, und nahm dann eine Abkürzung durch eine schmale Gasse, die so verlassen wirkte, dass man hätte glauben können, die Welt hätte sie vergessen.
Als sie in die King’s Cross Road einbog, sah sie sich plötzlich mit zwei Jungs im Teenageralter konfrontiert. Die beiden trugen Kapuzenpullis und weite Jeans. Einer von ihnen sagte etwas zu ihr, das sie nicht recht verstand. Sie starrte ihn an, woraufhin er den Blick abwandte.
Wie dumm von mir, schalt sie sich selbst. Das war wirklich dumm gewesen. Eine der wichtigsten Regeln für solche Märsche durch London lautete: keinen Augenkontakt aufnehmen! Das konnte als Herausforderung aufgefasst werden. Dieses Mal hatte der Betreffende einen Rückzieher gemacht, aber es reichte schon ein Einziger, der anders reagierte.
Fast schon automatisch schlug Frieda einen Weg ein, der von der Hauptstraße wegführte und dann wieder in sie einmündete, um kurz darauf erneut wegzuführen. Für die meisten Leute, die dort arbeiteten oder mit dem Auto durchfuhren, war dies nur ein hässlicher und unbedeutender Teil Londons: Bürogebäude, Wohnungen, ein Eisenbahndurchstich. Frieda jedoch folgte dem Lauf eines alten Flusses. Sie fühlte sich seit jeher von ihm angezogen. Einst war er durch Felder und Obstgärten zur Themse hinuntergeflossen. Menschen hatten an seinem Ufer gesessen, um sich auszuruhen oder zu fischen. Was wäre jenen Männern und Frauen, die damals an warmen Sommerabenden dort saßen und die Füße im Wasser baumeln ließen, wohl durch den Kopf gegangen, wenn sie in der Lage gewesen wären, die Zukunft vorherzusehen? Der Fluss war zu einem Müllabladeplatz verkommen, einer schmutzigen Kloake, verstopft mit Fäkalien und Tierkadavern und all den anderen Dingen, bei denen die Menschen sich nicht die Mühe machten, sie anderweitig zu entsorgen. Am Ende war er zugebaut worden und in Vergessenheit geraten. Wie konnte ein Fluss in Vergessenheit geraten? Wenn Frieda hier vorbeikam, blieb sie stets an einem Metallrost stehen, durch den aus der Tiefe immer noch das Rauschen des Flusses heraufdrang – fast wie ein Echo aus der Vergangenheit. Und hatte man diese Stelle hinter sich gelassen, konnte man zwischen den Ufern, die zu beiden Seiten anstiegen, dahinspazieren. Hin und wieder erinnerte sogar noch ein Straßenname daran, dass es hier früher einmal Kais gegeben hatte, an denen Lastschiffe entladen wurden, und noch früher Uferböschungen, an deren grasbewachsenen Hängen die Leute saßen und einfach nur zusahen, wie das kristallklare Wasser zur Themse floss. Das war London: Dinge, gebaut auf Dingen, gebaut auf Dingen, gebaut auf Dingen, von denen eines nach dem anderen in Vergessenheit geraten war, aber dennoch eine Spur hinterlassen hatte, und sei es nur ein Wasserrauschen, das man durch einen Metallrost hören könnte.
War es ein Fluch, dass die Stadt so viel von ihrer Vergangenheit zudeckte, oder konnte eine Stadt nur auf diese Weise überleben? Einmal hatte Frieda davon geträumt, dass in London Gebäude, Brücken und Straßen abgerissen wurden, damit die alten, in die Themse mündenden Flüsse wieder ans Tageslicht geholt werden konnten. Aber was hätte das für einen Sinn? Wahrscheinlich blieben diese Flüsse ohnehin lieber, wie sie waren: verborgen, unbemerkt und voller Geheimnisse.
Als Frieda die Themse erreichte, beugte sie sich wie immer über das Wasser. Meist konnte sie in der Dunkelheit gar nicht erkennen, wo der Zufluss aus seinem erbärmlichen kleinen Rohr quoll. So auch an diesem Morgen. Sie konnte nicht einmal sein Rauschen hören. Hier unten am Wasser wehte der aus Süden kommende Wind ziemlich stark, aber seltsam warm. An einem dunklen Novembermorgen wirkte er irgendwie fehl am Platz. Frieda warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Noch nicht einmal vier. Welche Richtung? East End oder West End? Sie entschied sich für den Westen, überquerte den Fluss und lief flussaufwärts. Jetzt wurde sie endlich müde, sodass sie den Rest der Wegstrecke nur noch verschwommen wahrnahm: eine Brücke, Regierungsgebäude, Parks, große Plätze. Dann ging es quer über die Oxford Street, und als sie schließlich die vertrauten Pflastersteine ihrer Wohngegend unter den Füßen spürte, war es immer noch so dunkel, dass sie mit ihrem Schlüssel an der Haustür herumfummeln musste, um ins Schloss zu finden.
2
Carrie sah ihn schon aus der Ferne, trotz des bereits schwächer werdenden Lichts. Die Hände tief in den Taschen vergraben, kam er mit leicht hängenden Schultern quer über die Wiese auf sie zu. Dabei pflügte er mit den Schuhen durch feuchte Haufen braunen Laubs. Er sah Carrie nicht, denn er hielt den Blick starr auf den Boden gerichtet. Seine Bewegungen wirkten so langsam und schwerfällig, als wäre er gerade erst aus einem tiefen Schlaf erwacht. Als fühlte er sich immer noch etwas benommen, eingehüllt in seine Träume. Oder Albträume, dachte Carrie, während sie ihren Ehemann beobachtete. Als er schließlich doch hochblickte, hellte sich seine Miene auf, und er beschleunigte seine Schritte ein wenig.
»Danke, dass du gekommen bist!«
Sie hakte sich bei ihm unter. »Was ist denn los, Alan?«
»Ich musste einfach weg von der Arbeit. Ich habe es dort nicht mehr ausgehalten.«
»Ist etwas passiert?«
Achselzuckend zog er den Kopf ein. Sie dachte, dass er noch immer aussah wie ein Junge, auch wenn sein Haar vorzeitig ergraut war. Er besaß die Schüchternheit, aber auch die Unbefangenheit eines Kindes. Man konnte alle seine Empfindungen von seinem Gesicht ablesen. Oft wirkte er ein wenig verloren und weckte bei den Leuten den Wunsch, ihn zu beschützen. Vor allem bei Frauen. Auch sie wollte ihn beschützen, es sei denn, sie wünschte sich ausnahmsweise mal selbst einen Beschützer. Bei solchen Gelegenheiten trat an die Stelle ihrer sonst so zärtlichen Gefühle eine Mischung aus Frustration und Verärgerung.
»Der Montag ist immer ein schlimmer Tag.« Sie bemühte sich um einen lockeren, frischen Ton. »Vor allem im November, wenn der ewige Nieselregen anfängt.«
»Ich musste dich unbedingt sehen.«
Sie zog ihn den Pfad entlang. Sie waren diesen Weg schon so oft miteinander gegangen, dass ihre Füße sie von selbst in die richtige Richtung zu lotsen schienen. Inzwischen hatte es zu dämmern begonnen. Sie kamen am Spielplatz vorbei. Carry vermied es hinüberzublicken, wie sie es inzwischen immer tat, aber es war ohnehin niemand da, abgesehen von ein paar Tauben, die auf dem gummierten Asphalt herumpickten. Sie bogen auf den Hauptweg ein und schlenderten am Musikpavillon vorbei. Vor Jahren hatten sie mal dort gepicknickt. Carrie wusste selbst nicht, warum sie sich so deutlich daran erinnerte. Es war im Frühling gewesen, an einem der ersten milden Tage des Jahres. Während sie damals ihre Schweinefleischpasteten aßen und ihr mitgebrachtes, schon viel zu warmes Bier tranken, sahen sie den Kindern zu, die vor ihnen im Gras herumtollten und sogar über ihre eigenen Schatten stolperten. Carrie erinnerte sich noch genau, wie sie an jenem Tag auf dem Rücken gelegen hatte, den Kopf auf Alans Schoß, und er ihr das Haar aus dem Gesicht gestrichen und ihr dann gesagt hatte, dass sie ihm alles bedeute. Er war kein Mann vieler Worte. Vielleicht war das der Grund, warum sich solche Dinge derart in ihr Gedächtnis eingruben.
Sie wanderten über den Hügel zu den Teichen hinüber. Früher hatten sie gelegentlich Brot mitgebracht, um die Enten zu füttern, auch wenn das normalerweise wohl eher eine Beschäftigung für Kinder war. Wobei die Enten mittlerweile sowieso von den Kanadagänsen vertrieben wurden, die sich oft angriffslustig in die Brust warfen und mit lang gestrecktem Hals auf einen zustürmten.
»Vielleicht sollten wir uns einen Hund zulegen«, sagte Carry unvermittelt.
»Sowas hast du noch nie erwähnt.«
»Einen Cockerspaniel. Die sind nicht zu groß, aber auch nicht so klein, dass sie ständig kläffen … Möchtest du mir vielleicht erzählen, was dir so zusetzt?«
»Wenn du einen Hund willst, dann lass uns einen besorgen. Wie wäre es, wenn wir uns gemeinsam einen zu Weihnachten schenken?« Er versuchte sich für die Vorstellung zu begeistern.
»Einfach so?«
»Einen Cockerspaniel, sagst du. Gerne.«
»Es war nur so eine Idee.«
»Wir können ihm einen Namen geben, je nachdem, ob es eine Sie oder ein Er ist. Vielleicht nehmen wir ein Männchen. Dann wäre ich für Billy, Freddie oder Joe.«
»So habe ich es nicht gemeint. Ich hätte den Mund halten sollen.«
»Entschuldige, es liegt an mir. Ich bin nicht …« Er sprach den Satz nicht zu Ende. Irgendwie wusste er selbst nicht so recht, was er nicht war.
»Ich wünschte, du würdest mir erzählen, was passiert ist.«
»So ist das nicht. Ich kann es nicht erklären.«
Inzwischen waren sie wieder am Spielplatz gelandet, als würden sie wie magisch von ihm angezogen. Die Schaukeln und die Wippe waren leer. Alan blieb stehen. Er entzog ihr seinen Arm und umklammerte mit beiden Händen das Geländer. Ein paar Augenblicke blieb er reglos stehen, dann presste er plötzlich eine Hand flach auf die Brust.
»Geht es dir nicht gut?«, fragte Carrie.
»Ich fühle mich so seltsam.«
»Auf welche Weise seltsam?«
»Das kann ich nicht sagen. Einfach seltsam. Als stünde ein Sturm bevor.«
»Was denn für ein Sturm?«
»Warte.«
»Nimm meinen Arm. Stütz dich auf mich.«
»Warte einen Moment, Carrie.«
»Sag mir, was du spürst. Hast du Schmerzen?«
»Ich weiß nicht«, flüsterte er. »Das Gefühl ist in meiner Brust.«
»Soll ich einen Arzt rufen?«
Er stand inzwischen vornüber gebeugt, sodass sie sein Gesicht nicht mehr sehen konnte.
»Nein. Lass mich nicht allein.«
»Ich hab mein Handy dabei.« Sie fummelte unter ihrem dicken Mantel herum, bis sie das Handy aus der Hosentasche gefischt hatte.
»Mein Herz schlägt so heftig, dass ich das Gefühl habe, als würde es mir gleich die Brust zerreißen.«
»Ich rufe einen Krankenwagen.«
»Nein. Es vergeht gleich. Es vergeht immer ganz schnell.«
»Ich kann doch nicht einfach danebenstehen und zusehen, wie du dich quälst!«
Sie versuchte, einen Arm um ihn zu legen, was aber wegen seiner gekrümmten Haltung schlecht ging, so dass sie sich völlig nutzlos vorkam. Sie hörte ihn wimmern. Einen Moment verspürte sie den starken Drang, einfach davonzulaufen und ihn, gebückt und hoffnungslos, wie er war, in der Dämmerung stehen zu lassen. Natürlich brachte sie das nicht übers Herz. Außerdem spürte sie, dass das, was ihn im Griff hatte – was auch immer es sein mochte –, allmählich nachließ. Schließlich konnte er sich wieder aufrichten. Carrie sah die Schweißtropfen auf seiner Stirn, doch als sie nun seine Hand nahm, war sie kalt.
»Besser?«
»Ein wenig. Tut mir leid.«
»Du musst etwas dagegen unternehmen.«
»Das wird schon wieder.«
»Nein, ganz im Gegenteil, es wird schlimmer. Glaubst du, ich höre dich nachts nicht? Und deine Arbeit beeinträchtigt es auch. Du musst zu Dr. Foley gehen.«
»Bei dem war ich doch schon. Er verschreibt mir nur wieder diese Schlaftabletten, die mich völlig außer Gefecht setzen. Wenn ich die nehme, fühle ich mich am nächsten Tag wie verkatert.«
»Du musst noch einmal mit ihm reden.«
»Er hat mich von Kopf bis Fuß durchgecheckt. An seiner Miene habe ich gemerkt, dass es mir nicht schlechter geht als den meisten anderen Leuten, die ihren Arzt aufsuchen. Ich bin einfach nur müde.«
»So ein Zustand ist doch nicht normal. Versprich mir, dass du zum Arzt gehst. Alan?«
»Wenn du unbedingt meinst.«
3
Von ihrem Platz auf dem roten, mitten im Raum platzierten Lehnstuhl konnte Frieda verfolgen, wie die Abbruchbirne drüben auf der anderen Straßenseite, wo sich eine große Baustelle befand, in die alten Gebäude schwang. Ganze Hausmauern erzitterten und stürzten dann in Brocken zu Boden. Innenwände wurden plötzlich zu Außenwänden, und Frieda entdeckte gemusterte Tapeten, ein altes Poster, ein Stück von einem Regal oder einem Kaminsims. Bisher verborgene Leben waren auf einmal für alle sichtbar. Den ganzen Vormittag schaute sie diesem Treiben nun schon zu. Ihre erste Patientin, eine Frau, deren Ehemann zwei Jahre zuvor überraschend gestorben war und deren Kummer und Schock nie nachgelassen hatten, saß in gebeugter Haltung und laut schluchzend vor ihr. Das hübsche Gesicht der Frau war vom vielen Weinen schon ganz rot und verquollen. Obwohl Friedas ganze Aufmerksamkeit ihrer Patientin galt, bekam sie dennoch aus dem Augenwinkel mit, was auf der anderen Straßenseite vor sich ging.
Später, als ihr zweiter Patient, der wegen seiner immer schlimmer werdenden manisch-depressiven Störung an sie überwiesen worden war, auf seinem Platz herumzappelte und dann aufstand, um sich anschließend sofort wieder zu setzen und in zornigem Ton die Stimme zu erheben, beobachtete Frieda, wie die Birne in den großen Wohnblock krachte. Wie konnte etwas, dessen Bau so viel Zeit in Anspruch genommen hatte, derart schnell zusammenbrechen? Schornsteine knickten ein, Fenster zerbarsten, Böden verschwanden, Gehwege wurden ausradiert. Bis zum Ende der Woche würde alles in Schutt und Asche liegen, und Männer mit Schutzhelmen würden über das verwüstete Gelände laufen und auf Kinderspielzeug und Möbelstücken herumtrampeln. Binnen eines Jahres würden neue Gebäude auf den Ruinen der alten stehen.
Frieda erklärte den Männern und Frauen, die den Weg in ihre Praxis fanden, sie wolle ihnen einen geschützten Raum bieten, in dem sie ihre finstersten Ängste und unzulässigsten Begierden erforschen könnten. Im Sprechzimmer war es kühl, sauber und ordentlich. Der Wandschmuck beschränkte sich auf eine einzige Zeichnung, das Mobiliar auf zwei einander gegenüberstehende Stühle mit einem niedrigen Tisch dazwischen. Eine Lampe spendete im Winter sanftes Licht, und auf dem Fensterbrett stand eine Topfpflanze. Draußen wurde gerade eine ganze Häuserreihe abgerissen, doch hier drinnen waren die Menschen, wenn auch nur für eine Weile, sicher vor der Welt.
Alan war klar, dass Dr. Foley sich seinetwegen keinen Rat mehr wusste. Wahrscheinlich sprach er mit seinen Kollegen aus der Gemeinschaftspraxis über ihn: »Dieser verdammte Alan Dekker schon wieder! Dauernd jammert er mir vor, dass er nicht schlafen kann und mit seinem Leben nicht klarkommt. Kann der Kerl sich nicht einfach zusammenreißen?« Dabei hatte er so sehr versucht, sich zusammenzureißen. Er hatte die Schlaftabletten genommen, seinen Alkoholkonsum reduziert und mehr Sport getrieben. Trotzdem lag er nachts wach und spürte, wie der Schweiß in Strömen an ihm hinabfloss und sein Herz rasend schnell schlug. In der Arbeit saß er stocksteif und mit geballten Fäusten an seinem Schreibtisch, starrte auf die vor ihm liegenden Papiere hinunter und wartete verzweifelt darauf, dass seine Angstzustände sich wieder legten, ohne dass die Kollegen etwas davon mitbekamen. Er empfand es als demütigend, derart die Kontrolle zu verlieren. Es machte ihm Angst. Carrie sprach von Midlife-Crisis. Immerhin war er schon zweiundvierzig. In diesem Alter tickten viele Männer aus. Plötzlich begannen sie zu trinken, kauften sich ein Motorrad und hatten Affären – in der Hoffnung, sich dadurch wieder jung zu fühlen. Aber er wünschte sich weder ein Motorrad noch eine Affäre. Jung wollte er auch nicht mehr sein: nichts als Peinlichkeiten und Schmerz und ständig das Gefühl, im falschen Leben zu stecken. Erst jetzt, mit Carrie, war er in seinem richtigen Leben angekommen. In dem kleinen Haus, auf das sie so lange gespart hatten und das sie noch dreizehn weitere Jahre abbezahlen würden. Es gab durchaus Dinge, von denen er träumte, aber bestimmt hatte jeder irgendwelche Träume und Hoffnungen. Wobei andere im Gegensatz zu ihm nicht im Park zusammenbrachen oder nachts weinend aus dem Schlaf hochschreckten. Manchmal hatte er auch diese Albträume – über die er nicht einmal nachdenken wollte. Das war einfach nicht normal. Ganz bestimmt war es alles andere als normal. Er wollte, dass diese Albträume aufhörten. Er wollte nicht die Sorte Mensch sein, die solche Dinge im Kopf hatte.
»Die Tabletten, die Sie mir gegeben haben, wirken nicht«, erklärte er Dr. Foley. Am liebsten hätte er sich dafür entschuldigt, dass er schon wieder da war und dem Arzt die Zeit stahl, obwohl sein Wartezimmer doch voller Patienten mit echten Krankheiten und echten Schmerzen war.
»Immer noch Probleme mit dem Schlafen?« Dr. Foley sah ihn nicht an. Stattdessen blickte er auf seinen Computerbildschirm und tippte stirnrunzelnd irgendetwas ein.
»Nicht nur das.« Alan bemühte sich um einen ruhigen Ton. Sein Gesicht fühlte sich an wie aus Gummi, als gehörte es einer anderen Person. »Ich bekomme so schreckliche Zustände.«
»Sie meinen Schmerzen?«
»Mein Herz fühlt sich an, als würde es aufgepumpt, und gleichzeitig habe ich einen metallischen Geschmack im Mund. Ich weiß auch nicht.« Verzweifelt versuchte er, die richtigen Worte zu finden, brachte am Ende aber nur heraus: »Irgendwie bin ich mir so fremd.« Anders konnte er es nicht ausdrücken, und jedes Mal, wenn er diese Formulierung gebrauchte, hatte er das Gefühl, ein Loch in sein eigenes Inneres zu bohren. Einmal hatte er Carrie gegenüber ausgerufen: »Ich bin gar nicht mehr ich selbst!« Schon damals war ihm aufgefallen, wie seltsam das klang.
Dr. Foley ließ seinen Stuhl herumschwingen und betrachtete ihn. »Bereitet Ihnen in letzter Zeit irgendetwas Kummer?«
Alan mochte es nicht, wenn der Arzt nur auf seinen Computer starrte, aber es war ihm immer noch lieber, als derart gemustert zu werden: als könnte der Doktor in sein Innerstes hineinblicken und dort Dinge entdecken, von denen Alan gar nichts wissen wollte. Was sah er dort drinnen?
»Als ich noch viel jünger war, hatte ich oft so ein Gefühl von Panik. Ich fühlte mich ganz einsam, wie in einem Albtraum. Als wäre ich der einzige Mensch im Universum. Als würde mir etwas Wichtiges fehlen. Aber ich wusste nicht, was. Nach ein paar Monaten legte sich das wieder. Jetzt geht es von Neuem los.« Er wartete, aber Dr. Foley reagierte nicht. Alan hatte den Eindruck, dass seine Worte bei dem Arzt gar nicht angekommen waren. »Damals war ich am College«, fuhr er fort. »Vielleicht sind solche Probleme in dem Alter ja ganz normal. Und jetzt habe ich wahrscheinlich so eine Art Midlife-Crisis. Blöd, ich weiß.«
»Die Medikamente wirken offenbar nicht. Ich hätte gern, dass Sie jemand anders aufsuchen.«
»Wie meinen Sie das?«
»Jemanden, mit dem Sie reden können. Über Ihre Gefühle.«
»Sie glauben, das spielt sich alles nur in meinem Kopf ab?« Vor seinem geistigen Auge sah er sich mit wild verzerrter Miene wie einen Verrückten wüten, weil die Gefühle, die er die ganze Zeit tief in seinem Inneren unter Verschluss zu halten versuchte, plötzlich aus ihm hervorbrachen und ganz und gar von ihm Besitz ergriffen.
»Das kann sehr hilfreich sein.«
»Ich brauche keinen Psychiater.«
»Probieren Sie es aus«, widersprach Dr. Foley. »Wenn es nicht funktioniert, ist ja nichts verloren.«
»Ich kann mir das finanziell gar nicht leisten.«
Dr. Foley tippte erneut etwas in seinen Computer. »Sie bekommen eine Überweisung. Die Behandlung kostet Sie nichts. Allerdings wird es eine ziemliche Fahrerei werden, aber diese Leute sind wirklich gut. Man wird sich wegen eines Termins für eine erste Beurteilung mit Ihnen in Verbindung setzen. Dann sehen wir weiter.«
ENDE DER LESEPROBE
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel »Blue Monday« bei Michael Joseph (Penguin), London.
1. Auflage Copyright © 2011 by Joined-Up Writing, Ltd. Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2011 beim C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlag: R·M·E, Roland Eschlbeck/Rosemarie Kreuzer Satz: Uhl + Massopust, Aalen
eISBN 978-3-641-09363-1
www.cbertelsmann.de
www.randomhouse.de