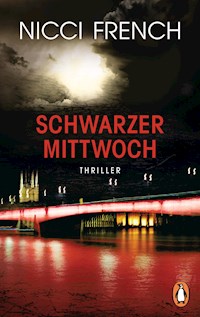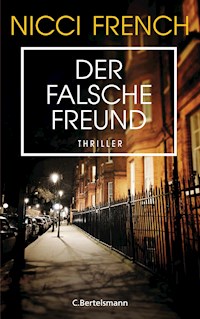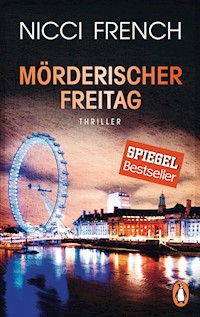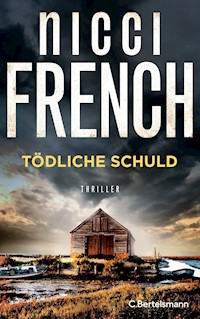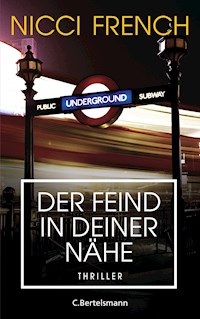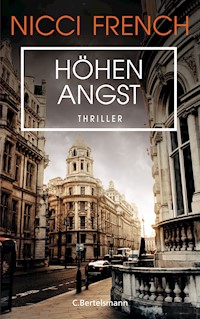7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Willkommen in der Hölle des Misstrauens
Astrid ist Fahrradkurier in London - und bringt anderen Leuten kein Glück. Kaum denkt sie über die Gefahren ihres Jobs nach, wird sie von der Autotür der Nachbarin vom rad gestoßen. Die Nachbarin ist am nächsten Tag tot. Ein paar Tage später soll Astrid ein Päckchen abholen, findet die Kundin aber nur noch leblos im Flur. Astrid gerät unter Verdacht, aber nicht nur sie, sondern auch ihre sechs Mitbewohner, mit denen sie ein Haus teilt. Schnell entwickelt sich die Atmosphäre im haus zu einem Albtraum aus gegenseitigen Vorwürfen und Verdächtigungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 560
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Nicci French
Bis zumbitteren Ende
Thriller
Deutschvon Birgit Moosmüller
Buch
Astrid Bell ist Fahrradbotin in London. Kein Job für zarte Gemüter, und sie kennt viele Geschichten von Kollegen, was einem im dichten Verkehr der britischen Hauptstadt alles zustoßen kann. Als sie sich eines Abends schon auf Zuhause freut, passiert es: Ausgerechnet eine Nachbarin öffnet die Autotür, ohne vorher zu schauen, und Astrid stürzt. Das Fahrrad ist demoliert, und Astrid humpelt nach Hause. Am nächsten Morgen ist die Nachbarin tot, ermordet.
Ein paar Tage später soll Astrid bei einer wohlhabenden Kundin ein Päckchen abholen, doch als sie dort eintrifft, findet sie die Frau tot in der Eingangshalle vor. Auch sie wurde Opfer eines Gewaltverbrechens.
Für die Polizei ist es kein Zufall, dass bei beiden Morden Astrid ganz in der Nähe war, und die junge Frau gerät unter Verdacht. Aber auch ihre sechs Mitbewohner, mit denen sie in einer WG zusammenlebt, rücken ins Visier der Ermittlungen. Der Mordverdacht lässt die bisherige Idylle schnell zur Hölle für alle werden, denn nun traut keiner dem anderen mehr über den Weg. Miles, der Besitzer der Wohnung und Exfreund von Astrid, verkündet daraufhin, er finde, es sei an der Zeit, dass alle ausziehen. Er hat aber nicht mit dem Widerstand der Mitbewohner gerecht, den Pippa, die Rechtsanwältin, organisieren will. Doch am Ende kämpft jeder gegen jeden, mit erlaubten und unerlaubten Mitteln. Und dann bleibt da der schreckliche Verdacht: Ist einer von ihnen tatsächlich der Mörder, und sind nicht aller guten und auch schlechten Dinge drei?
Autoren
Hinter dem Namen Nicci French verbirgt sich das Ehepaar Nicci Gerrard und Sean French. Seit langem sorgen sie mit ihren höchst erfolgreichen Psychothrillern für Furore. Mit »Höhenangst« und »Der Sommermörder« haben sie auch in Deutschland die Bestsellerlisten erobert. Sie leben mit ihren Kindern in London. Weitere Informationen unter www.niccifrench.co.uk.
Die Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel »Until It’s Over« bei Michael Joseph, an imprint of Penguin Books, London
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Taschenbuchausgabe Dezember 2009 Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 2008 by Joined-Up Writing Ltd. Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2008 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München Umschlagmotiv: Getty Images / John Francis Bourke IK · Herstellung Str.
ISBN: 978-3-641-24599-3V002
www.goldmann-verlag.de
www.randomhouse.de
Für Rafi, Martin, Tommy, Vadilson, Arthur, Tilly und Dougie
Inhaltsverzeichnis
ERSTER TEIL
1
Woche für Woche, Monat für Monat war ich auf meinem Fahrrad durch London gebraust. Ich wusste, dass ich eines Tages einen Unfall haben würde. Die Frage war nur, unter welchen Umständen. Einen von den anderen Fahrradkurieren hatte es erwischt, als er in vollem Tempo die Regent Street entlangfuhr und vor ihm plötzlich ein Taxi ausscherte, um zu wenden. Der Fahrer hatte nicht aufgepasst, zumindest hatte er das Rad nicht gesehen. Die Leute achten einfach nicht auf Radfahrer. Don war mit voller Wucht in die Seite des Taxis gedonnert. Als er im Krankenhaus aufwachte, konnte er sich nicht mal an seinen Namen erinnern.
Ein ganzer Haufen von uns Fahrradkurieren trifft sich jeden Freitagabend in einem Pub, dem Horse and Jockey, um zusammen einen zu trinken, die neuesten Tratschgeschichten auszutauschen und über unsere Stürze zu lachen. Alle paar Monate aber gibt es schlechte Nachrichten. Erst kürzlich war es mal wieder so weit. In der Nähe des Elephant and Castle fuhr ein Kurier neben einem Lastwagen her, als dieser nach links abbog, ohne zu blinken, und dabei die Kurve schnitt. In einem solchen Moment verringert sich der Abstand zwischen dem Laster und dem Randstein von etwa einem Meter auf wenige Zentimeter. Man kann nur noch versuchen, möglichst schnell von der Straße runterzukommen. In diesem Fall war jedoch ein Eisengeländer im Weg. Als ich das nächste Mal an der Stelle vorbeiradelte, sah ich, dass das Geländer mit Blumen geschmückt war.
Wenn solche Unfälle passieren, ist der Radfahrer manchmal selbst schuld, oft aber auch nicht. Ich habe Geschichten von Busfahrern gehört, die absichtlich Fahrräder rammen. Andererseits habe ich auch schon viele Radfahrer erlebt, die glauben, dass Ampeln für sie nicht gelten. Fakt ist jedenfalls, dass die Person auf dem Rad grundsätzlich den Kürzeren zieht. Deswegen sollte man immer einen Helm tragen, sich nach Möglichkeit von Lastwagen fernhalten und prinzipiell davon ausgehen, dass es sich bei dem Fahrer um einen blinden, beschränkten Psychopathen handelt.
Trotzdem wusste ich, dass ich eines Tages einen Unfall haben würde. Es gab so viele Möglichkeiten. Wahrscheinlich würde es diejenige sein, die am schwierigsten zu vermeiden oder vorherzuberechnen war. Wie sich herausstellte, lag ich mit dieser Vermutung genau richtig. Trotzdem hätte ich nie gedacht, dass es keine dreißig Meter vor meiner Haustür passieren würde. Als ich in die Maitland Road einbog, war ich fast schon im Begriff, das Bein über die Stange zu schwingen. Nach sechs Stunden auf dem Sattel trennten mich nur noch fünfundvierzig Sekunden von einer heißen Dusche. Im Geiste war ich bereits vom Rad gesprungen und ins Haus geeilt, als vor mir plötzlich eine Wagentür aufschwang wie der Flügel eines metallenen Vogels. Ich donnerte mit voller Wucht dagegen.
Es blieb keine Zeit für irgendeine Reaktion. Ich konnte weder ausweichen noch mich gegen den Aufprall wappnen. Trotzdem schien alles in Zeitlupe abzulaufen. Während mein Rad gegen die Tür knallte, wurde mir klar, dass ich sie aus der falschen Richtung traf: Statt sie zuzuschieben, drückte ich sie weiter auf. Ich spürte, wie die Tür ächzend ein Stück nachgab. Dann aber übertrug sich die Wucht des Aufpralls von der Tür zurück auf das Fahrrad, insbesondere den beweglichsten Teil des Fahrrads, nämlich mich. Mir schoss durch den Kopf, dass ich die Füße in den Klickpedalen hatte und womöglich am Rad hängen bleiben und mir beide Beine brechen würde, falls ich sie nicht freibekam. Doch wie aufs Stichwort lösten sich meine Füße von den Pedalen wie zwei Erbsen aus ihrer Schote, und ich flog ohne mein Rad über die Wagentür.
Es passierte alles so schnell, dass ich weder den Sturz abfangen noch irgendwelchen Hindernissen ausweichen konnte. Gleichzeitig passierte es so langsam, dass ich dabei noch nachdenken konnte. Mir gingen viele Gedanken durch den Kopf, wobei allerdings nicht klar war, ob sie einer nach dem anderen kamen oder alle gleichzeitig. Ich dachte: Ich habe gerade einen Unfall – so ist es also, wenn man einen Unfall hat. Ein anderer Gedanke war: Ich werde mich verletzen, wahrscheinlich sogar ziemlich schlimm. Und: Ich werde mich um einiges kümmern müssen. Wie es aussieht, kann ich morgen nicht arbeiten. Ich muss Campbell anrufen und es ihm sagen. Oder jemand anderer tut es. Außerdem dachte ich: Wie schade. Wir wollten doch heute zusammen essen, es sollte einer jener seltenen Abende werden, an denen wir alle gemeinsam um den Tisch sitzen, aber vermutlich werde ich nicht dabei sein. Ich hatte sogar noch Zeit zu denken: Wie ich wohl aussehen werde, wenn ich auf der Straße liege und alle viere von mir strecke?
In dem Moment knallte ich auf den Boden. Ich hatte mich in der Luft überschlagen wie ein unfähiger Akrobat und landete so hart auf dem Rücken, dass es mir mit einem »Uff« die ganze Luft aus der Lunge presste. Ich rollte ein Stück und spürte dabei, wie ich mich mehrfach anschlug und über den Straßenbelag schrammte. Als ich schließlich auf dem Asphalt liegen blieb, empfand ich zunächst keinen Schmerz. Es fühlte sich an wie ein Knall und ein heller Blitz, doch ich wusste, dass der Schmerz nicht lange auf sich warten lassen würde. Sekunden später war er da, bildete schlagartig den Mittelpunkt von allem. In meinen Augen pulsierte Licht in grellen Rot-, Violett- und Gelbtönen, von denen jeder auf eine andere Art wehtat. Ich versuchte mich zu bewegen. Mir war klar, dass ich auf der Straße lag, also an einem gefährlichen Ort. Womöglich würde mich ein Lastwagen überrollen. Aber es half nichts, ich konnte mich nicht rühren. Ich konnte nur laut vor mich hin fluchen.
»So ein Mist! Verdammte Scheiße! So ein Mist!«
Allmählich begann sich der Schmerz zu verteilen. Es war wie nach einem Platzregen: Erst wenn es zu schütten aufgehört hat, bilden sich Pfützen und Rinnsale. Mir war schwindlig, doch der Helm hatte meinen Kopf vor größerem Schaden bewahrt. Der obere Teil meines Rückens, auf dem ich gelandet war, fühlte sich taub an. Vorerst schmerzten eher andere Stellen meines Körpers, vor allem die Ellbogen und die Seite eines Knies. Außerdem hatte ich mir die eine Hand so stark nach hinten verbogen, dass sie nun heftig pochte. Als ich mit der anderen Hand über meinen Oberschenkel strich, spürte ich klebrige Feuchtigkeit und kleine Kieselsteine. Ein winziger Teil meines Gehirns hatte immer noch Zeit zu denken: Wie dumm! Wenn mir das nicht passiert wäre, befände ich mich jetzt im Haus, und alles wäre ganz normal. Nun bin ich hier und muss mich mit alledem herumschlagen. Wenn ich doch bloß nicht …
Ich lehnte mich zurück und spürte den warmen Asphalt unter mir. Ich nahm sogar seinen Geruch wahr, ölig und scharf. Die Sonne stand schon sehr tief. Dottriges Gelb vor verblassendem Blau. Ein Schatten fiel über mich, eine Gestalt versperrte mir die Sicht auf den Himmel.
»Sind Sie in Ordnung?«, fragte sie.
»Nein«, antwortete ich. »Mist!«
»Es tut mir so leid!«, sagte sie. »Ich habe Sie nicht gesehen. Ich hätte besser aufpassen sollen, als ich die Tür aufgemacht habe. Sind Sie verletzt? Soll ich einen Krankenwagen rufen?«
Eine weitere Welle des Schmerzes traf mich.
»Lassen Sie mich in Ruhe!«, stieß ich hervor.
»Es tut mir so leid.«
Ich holte tief Luft. Der Schmerz ließ ein klein wenig nach, und die Person bekam feste Konturen. Ich sah das Gesicht einer Frau mittleren Alters, dahinter ihren silbermetallicfarbenen Wagen, dessen geöffnete Tür durch die Wucht meines Aufpralls tatsächlich nach außen gebogen worden war. Ich holte noch einmal tief Luft und versuchte, etwas anderes als ein Wimmern oder Fluchen von mir zu geben.
»Sie sollten wirklich besser aufpassen.«
»Es tut mir so leid!«
Ich wollte ihr noch einmal sagen, dass sie mich in Ruhe lassen sollte, aber plötzlich war mir so schlecht, dass ich meine ganze Energie dafür benötigte, nicht auf die Straße zu kotzen. Ich musste nach Hause. Es waren doch bloß ein paar Meter. Ich kam mir vor wie ein Tier, das nur noch in sein Loch kriechen und dort am liebsten sterben wollte. Mit einem Stöhnen drehte ich mich um und begann mich aufzurichten. Es tat schrecklich weh, aber durch den ganzen Nebel meiner Benommenheit registrierte ich, dass meine Arme und Beine noch funktionierten. Offenbar war nichts gebrochen, keine Sehne gerissen.
»Astrid!«
Ich hörte eine vertraute Stimme und auch einen vertrauten Namen. Meinen Namen. Astrid. Ein weiteres gutes Zeichen: Ich wusste, wer ich war. Als ich hochblickte, sah ich ein vertrautes Gesicht, das besorgt auf mich herunterstarrte. Dahinter nahm ein zweites vertrautes Gesicht Konturen an. Beide musterten mich eindringlich, beide mit dem gleichen besorgten Gesichtsausdruck.
»Was zum Teufel ist passiert?«, fragte der eine.
Es war albern, und eigentlich gab es dafür keinen Grund, aber mir war die Sache peinlich.
»Davy«, sagte ich. »Dario. Ich bin bloß gestürzt. Mir ist nichts passiert. Ich bin nur …«
»Ich habe die Wagentür aufgemacht«, erklärte die Frau. »Sie ist dagegengefahren. Es war meine Schuld. Soll ich einen Krankenwagen rufen?«
»Wie sieht mein Rad aus?«, fragte ich.
»Mach dir deswegen keine Sorgen«, antwortete Davy, während er sich zu mir herunterbeugte. »Wie geht es dir?«
Ich setzte mich auf, bewegte meinen Unterkiefer, befühlte mit der Zunge die Zähne.
»Ich glaube, mir fehlt nichts«, sagte ich. »Ich fühle mich nur ein bisschen wacklig.«
Beim Aufstehen verzog ich stöhnend das Gesicht.
»Astrid?«
»Was ist mit meinem Rad?«
Dario trat auf die andere Seite der Wagentür und zog das Rad hoch.
»Es ist ein bisschen verbogen«, erklärte er.
Er versuchte es zu schieben, aber das Vorderrad war zwischen der Gabel eingeklemmt.
»Es sieht aus …« Ich wollte sagen, dass es so aussah, wie ich mich fühlte, hatte jedoch Schwierigkeiten, den Satz zusammenzubekommen. Stattdessen sagte ich einfach, dass ich ins Haus wolle. Die Frau fragte noch einmal, ob sie einen Krankenwagen rufen solle, aber ich schüttelte den Kopf. Woraufhin ich erneut aufstöhnte, weil mein Hals dabei so schmerzte.
»Ich werde für das Rad bezahlen«, sagte die Frau.
»Ja, das werden Sie.«
»Ich wohne gleich hier. Ich komme Sie besuchen. Kann ich jetzt noch irgendetwas für Sie tun?«
Eigentlich wollte ich ihr eine schnippische Antwort geben, so etwas wie: »Sie haben schon genug getan«, aber dazu fehlte mir die Kraft. Außerdem wirkte sie ziemlich erschüttert und besorgt und verteidigte sich auch nicht, wie es so manch anderer getan hätte. Als ich mich umblickte, versuchte sie gerade, die dämliche Wagentür zu schließen. Sie schaffte es erst beim zweiten Mal. Während Dario mein Rad schulterte, legte Davy behutsam einen Arm um mich und führte mich zum Haus. Dario wandte den Kopf und nickte jemandem zu.
»Wer war das?«, fragte ich.
»Niemand. Wie geht es deinem Kopf?«
Vorsichtig rieb ich mir die Schläfe.
»Ich fühle mich ein bisschen komisch.«
»Wir saßen gerade draußen auf der Haustreppe«, erklärte Dario. »Wir haben eine geraucht und den Abend genossen, nicht wahr, Davy?«
»Ja«, bestätigte Davy. »Und dann hat es gekracht, und du lagst auf der Straße.«
»Ganz schön blöd von mir«, stellte ich fest.
»Geht’s? Es sind nur noch ein paar Meter.«
»Ja, geht schon«, antwortete ich, obwohl meine Beine zitterten und die Tür eher in die Ferne zu rücken als näher zu kommen schien. Davy rief nach Miles. Sofort stimmte Dario noch lauter ein. Ihr Geschrei hallte derart durch meinen Kopf, dass ich das Gesicht verzog. Inzwischen hatten wir das Tor erreicht, und während Davy mich hineinführte, tauchte oben an der Treppe Miles auf. Als er sah, in welchem Zustand ich mich befand, machte er ein Gesicht, das fast schon wieder komisch war.
»Um Gottes willen, was ist denn passiert?«, fragte er.
»Wagentür«, antwortete Davy knapp.
Binnen kürzester Zeit war ich von meinen Mitbewohnern umringt. Davy versuchte das Rad an die Wandhaken in der Diele zu hängen. Da es beschädigt war, passte es nicht richtig. Er nahm es wieder herunter und begann daran herumzubiegen, wobei er sich sein schönes weißes Hemd sofort mit Öl verschmierte.
»Das wird ein bisschen Arbeit erfordern«, stellte er mit einer gewissen Befriedigung fest.
Pippa, die gerade die Treppe herunterkam, fauchte ihn an, dass erst mal ich Hilfe bräuchte, nicht das Rad. Sie nahm mich ganz behutsam in den Arm, ohne mich richtig zu berühren. Mick starrte über das Treppengeländer im ersten Stock zu mir herunter. Seine Miene war ausdruckslos.
»Bringt sie herein«, sagte Miles. »Helft ihr runter in die Küche.«
»Mir fehlt nichts«, erklärte ich.
Sie bestanden darauf, mir zu helfen, sodass ich – halb gestützt, halb gezerrt – die Treppe in den großen Küchen- und Essbereich hinunterstolperte, wo wir uns die meiste Zeit aufhielten, wenn wir nicht gerade in unseren Zimmern waren. Ich wurde auf das Sofa neben der Tür gesetzt, und Dario, Pippa und Mick ließen sich rundherum nieder, starrten mich mit großen Augen an und fragten mich ständig, wie es mir gehe. Ich hatte inzwischen wieder einen klaren Kopf. Der Schock des Unfalls war schlichtem, gewöhnlichem Schmerz gewichen. Ich wusste, dass mir am nächsten Morgen mein ganzer Körper höllisch wehtun würde, ansonsten aber alles in Ordnung war. Dario zog eine Zigarette aus der Tasche und zündete sie sich an.
2
Das Nachspiel eines Unfalls, bei dem man nicht ernstlich verletzt wurde, hat etwas Befriedigendes. Vor allem, wenn man schlimmer aussieht, als man sich fühlt. Ich fühlte mich recht gut, hatte aber einen schönen großen Bluterguss am Bein, eine grobe Schürfspur entlang des Oberschenkels, einen Schnitt an der Hand sowie einen hässlichen Kratzer an der linken Wange. Außerdem war mein Handgelenk geschwollen. Mein ganzer Körper brannte, pochte und schmerzte, aber auf eine masochistisch angenehme Weise. Ich drückte immer wieder an meinen Schrammen herum, um sicherzustellen, dass sie noch bluteten. Nach einem kurzen, lauwarmen Bad lag ich in einer alten Jogginghose und einem T-Shirt auf meinem Bett, während diverse Mitglieder des Haushalts in den Raum gewandert kamen, um mich zu fragen, ob es mir gut gehe, und sich den Unfallhergang noch einmal genau erzählen zu lassen. Allmählich war ich fast schon stolz auf mich.
»Es lief alles wie in Zeitlupe ab«, wiederholte ich zum vierten Mal.
Davy und Dario, meine zwei heldenhaften Retter, blickten auf mich herunter. Dario zündete sich schon wieder eine an, diesmal allerdings keine normale Zigarette. Ein vertrauter illegaler Geruch breitete sich in meinem Zimmer aus.
»Anscheinend hast du dich genau richtig abgerollt«, erklärte Davy. »Deswegen bist du auch nicht ernsthaft verletzt. Das finde ich echt beeindruckend. Fallschirmspringer werden extra dazu ausgebildet. Du hast es ganz von selbst richtig gemacht.«
»Ich hatte das nicht unter Kontrolle«, erwiderte ich.
Dario zog gierig an seinem Joint.
»Bei Betrunkenen ist das auch so«, meinte er dann. »Leute, die im Vollrausch hinfallen, tun sich nicht weh, weil ihr Körper so entspannt ist.«
»Lass mal sehen«, sagte Mick und setzte sich auf die Bettkante.
Wäre das von jemand anderem gekommen, hätte ich vielleicht eine bissige Bemerkung gemacht, aber Mick gegenüber macht man keine bissigen Bemerkungen. Er ist kein Mann vieler Worte. Sprechen scheint für ihn eine Qual zu sein, und wenn er es doch einmal tut, verstummen wir anderen für gewöhnlich. Ich hätte ihn am liebsten gefragt, warum er sich für besonders qualifiziert hielt, den Schaden zu beurteilen, wusste aber, dass er nur mit den Schultern zucken würde.
»Tut das weh?«, fragte er, obwohl ich schon das Gesicht verzog. »Und das?« Er drückte mit einer Hand gegen meine Rippen. Dann hob er nacheinander meine Beine an und tastete über die dicken Ölspuren an meinen Waden, die selbst durch längeres Abschrubben mit warmem Seifenwasser nicht zu entfernen gewesen waren.
»Es ist nichts gebrochen«, erklärte er, aber das hatte ich schon vorher gewusst.
Pippa erschien mit einer kleinen Flasche einer blauen Flüssigkeit und einer Handvoll Watte.
»Brennt das?«, fragte ich.
»Überhaupt nicht.« Mit diesen Worten verteilte sie eine großzügige Dosis Desinfektionsmittel über meine Wange.
»Spinnst du?« rief ich, während ich vor ihr zurückwich. »Hör sofort auf!«
»Sei tapfer.«
»Warum?«
»Darum«, antwortete sie nur und klatschte einen weiteren durchtränkten Wattebausch auf meinen Oberschenkel.
»Zieh mal kräftig«, forderte Dario mich auf und hielt mir seinen Joint hin. »Das hilft gegen Schmerzen und Übelkeit.«
»Danke, ich verzichte«, antwortete ich.
»Kannst du mit uns essen?«, wollte Pippa wissen.
»Ich sterbe vor Hunger.«
»Owen bringt auf dem Heimweg vom Atelier etwas mit.« Er traf mit einem indischen Gericht in Pappbehältern ein und stellte erst einmal alles auf den Tisch, ehe er hochblickte. Als er mich am Kopfende des Tisches mit mehreren Kissen im Rücken auf einem großen Stuhl thronen sah, runzelte er erschrocken die Stirn.
»Lieber Himmel, Astrid!«, sagte er. »Was ist passiert? Bist du in eine Schlägerei geraten?«
»Mit einer Wagentür.«
»Du hast ja schöne Blutergüsse.«
»Ich weiß.«
»Morgen werden sie noch schöner sein.«
»Du hättest sie sehen sollen«, sagte Davy, während er sich auf den Stuhl neben mir setzte. Er wirkte geschockter als ich selbst. »Sie ist durch die Luft geflogen.«
»Wie eine menschliche Kanonenkugel«, fügte Dario hinzu, der sich auf der anderen Seite niederließ.
»Tut es weh?«
»Nicht besonders.«
»Natürlich tut es weh«, mischte Pippa sich ein. »Sieh sie dir doch an.«
»Nein, seht mich nicht an. Meine Nase ist doppelt so groß wie sonst. Was schulden wir dir, Owen?«
»Jeder acht Pfund.«
Unter leisem Gemurmel suchten alle in ihren Taschen und Börsen herum, zählten Münzen auf den Tisch oder nahmen Wechselgeld entgegen. Dario zog ein zusammengerolltes Bündel Geldscheine aus der Tasche und warf Owen einen Zwanziger rüber.
»Den Rest kannst du behalten«, sagte er. »Wahrscheinlich bekommst du eh noch was von mir.«
»Hast du im Lotto gewonnen?«, fragte Owen mit misstrauischer Miene.
Dario wich seinem Blick aus.
»Jemand hat mir was geschuldet.«
Alle ließen sich um den Küchentisch nieder, zogen die Aludeckel ab, öffneten Bierdosen und reichten angeschlagene Teller und ein wild zusammengewürfeltes Bestecksortiment herum. Pippa schnappte sich Darios Joint.
»Dürfen Anwälte das überhaupt?«, fragte Miles.
»In der Kanzlei nicht«, antwortete Pippa und warf einen Blick in die Runde. »Wie oft kommt das schon vor? Wir sind ganz unter uns.«
»Und wir sind sieben«, meinte Dario. Er schlug mit der Gabel gegen den Tellerrand, um sich Gehör zu verschaffen, schaufelte sich dann aber sofort eine Unmenge von Reis in den Mund, während wir ihn alle erwartungsvoll ansahen.
»Genau wie die sieben Zwerge«, sagte er schließlich.
»Es gibt da etwas, das wir besprechen müssen«, erklärte Miles ziemlich formell. »Als Erstes wollte ich euch sagen …«
»In dem alten Walt-Disney-Zeichentrickfilm heißt der Chef der Zwerge Doc«, unterbrach ihn Dario. »Du bist Doc, Miles.«
»Was?«
»Wenn wir die sieben Zwerge sind …«
»Sind wir aber nicht.«
»Trotzdem. Du bist definitiv Doc«, erklärte Dario.
»Weil mir dieses Haus gehört? Wer soll sich sonst darum kümmern, dass die Rohre repariert und die Rechnungen bezahlt werden?«
»Die Zwerge stehen für die Elemente, aus denen sich die menschliche Psyche zusammensetzt«, fuhr Dario fort.
»Bin ich deswegen gegen eine Wagentür geknallt?«, fragte ich. Dank des Biers entspannte ich mich allmählich, und der Schmerz ließ nach.
»Du bist Angry«, wandte sich Dario an Mick.
Mick ignorierte ihn.
»Gibt es in dem Film überhaupt einen Angry?«, erkundigte ich mich. »Ich kann mich nicht erinnern.«
»Auf jeden Fall ist einer der Zwerge ein richtiger Brummbär. Ich glaube, er heißt Grumpy«, antwortete Davy.
»Pippa ist Randy, habe ich recht?«, meinte Dario, während er über den Tisch zu Davy hinüberzwinkerte.
Das war eine Anspielung auf die Tatsache, dass Pippa nicht in einer festen Beziehung lebte, sondern stattdessen eine Menge extrem kurzer hatte.
»Ach, Jungs«, sagte ich. »Das ist doch erbärmlich.«
»Ich schätze, wir sind uns einig, dass Dopey vergeben ist«, konterte Pippa.
»Dann bist du eben Sleepy«, entgegnete Dario. »Kein Mensch ist so eine Schlafmütze wie du.«
Das war ein bisschen ungerecht. Pippa schläft nur am Wochenende lang, weil sie da erst in den frühen Morgenstunden ins Bett kommt und nachmittags wieder aufsteht. An solchen Tagen wirkt sie aufgedunsen, benebelt und völlig erledigt. Während der Woche geht sie pflichtbewusst zur Arbeit und steht bereits um sieben auf. Dario dagegen schläft, wann immer er will.
»Langsam gehen uns die guten aus«, stellte Davy fest. »Owen kann Sneezy übernehmen.«
»Warum?«
Davy sah mich an.
»Das heißt, du und ich müssen uns um Bashful und Happy streiten«, fuhr er fort. »Als Bashful kommst du aber nicht infrage, denn du bist nicht schüchtern, Astrid Bell. Willst du vielleicht Schneewittchen sein?«
»Nein, lieber die böse Königin. Das ist mal eine richtige Frau.«
»Spielverderberin«, meinte Dario. »Du bist Happy.«
Happy. Und groggy. Und entspannt. Ich lehnte mich zurück und ließ den Blick in die Runde schweifen: eine zusammengewürfelte Gruppe von Leuten, die im Moment so etwas wie meine Familie darstellten. Es waren nur noch drei von denen übrig, die von Anfang an dabei gewesen waren. So richtig begonnen hatte das Ganze vielleicht schon früher, während unserer Studienzeit. Als Miles das Haus damals kaufte, war er noch ein ganz junger Mann, der gerade mal seinen Uni-Abschluss in der Tasche hatte und die Welt verändern wollte. Er hatte einen lächerlich niedrigen Preis für das große, heruntergekommene Haus im schäbigeren Teil von Hackney bezahlt. Zu der Zeit trug er noch keinen Bart, dafür aber das Haar so lang, dass er es oft zu einem Pferdeschwanz zusammenband. Jetzt hatte er einen kurz rasierten, dunkelblonden Bart und eine Glatze. Wenn ich ihm mit der Hand über den Kopf fuhr, konnte ich jede Unebenheit seines samtigen Schädels spüren. Die andere Langzeitmieterin war Pippa. Sie und ich waren seit meinem ersten Studiensemester Freundinnen, und wir hatten uns in unserem Abschlussjahr ein Haus geteilt, sodass ich ihre persönlichen Gewohnheiten bereits sehr gut kannte, als wir beide bei Miles einzogen. Sie war groß und gertenschlank, und sie besaß eine zarte Schönheit, die manche Leute in die Irre führte.
Wir bildeten also das ursprüngliche Trio und hatten all die Jahre zusammen überstanden, obwohl Miles und ich während dieser Zeit ein Jahr lang so etwas wie ein Paar gewesen waren, anschließend sechs schreckliche Monate lang so etwas wie kein Paar mehr, und dann definitiv keines mehr. Inzwischen hatte Miles eine neue feste Freundin, Leah. Das war ein gutes Gefühl, wie ein Zaun zwischen uns. Gute Zäune sorgen für gute Nachbarschaft, hat mal jemand gesagt.
Um uns herum hatte es viele andere gegeben. Auch die Zusammensetzung der derzeitigen sieben würde sich zwangsläufig früher oder später ändern. Mick war älter als der Rest von uns und tat so, als läge sein Alter wie eine Last auf seinen breiten Schultern. Er war klein und untersetzt, und er stand immer ein bisschen breitbeinig, als befände er sich während eines Sturms auf Deck eines Schiffs. Seine Augen waren hellblau, sein Gesicht von Sonne und Wind gegerbt. Er war jahrelang rastlos rund um die Welt gereist. Ich wusste nicht, ob er etwas gesucht hatte, und falls ja, ob er es gefunden hatte. Er sprach nie darüber. Inzwischen hielt er sich mit irgendwelchen Jobs über Wasser und hatte zumindest vorübergehend in der Maitland Road angelegt. Wenn er zu Hause war, verbrachte er den Großteil seiner Zeit oben in seinem kleinen Zimmer, auch wenn mir nie so ganz klar war, was er dort tat, und ich ihn nur selten besuchte. Keine Zimmertür in diesem Haus ist mit einem Schloss versehen, aber manche Türen sind trotzdem fester verschlossen als andere. Manchmal, wenn ich nicht schlafen konnte, ging ich mitten in der Nacht hinunter in die Küche. Dann saß er meist ganz still am Tisch, vor sich eine Tasse Tee, aus der ihm der Dampf ins Gesicht stieg.
Was Dario betraf, so wusste keiner so recht, wie es eigentlich dazu gekommen war, dass er hier wohnte. Seine frühere Freundin (wie ich vermutete, seine bisher einzige) hatte für ein Jahr ein Zimmer bei uns gemietet, und er war oft über Nacht geblieben. Ehe wir uns versahen, war sie wieder weg, er aber aus irgendeinem Grund noch da. Er hatte das kleinste Zimmer des Hauses beschlagnahmt, das im zweiten Stock lag, und von dort aus nach und nach den leeren Raum nebenan kolonisiert. Obwohl er keinen Job hatte und die Miete nicht bezahlen konnte, brachte es keiner von uns übers Herz, ihn hinauszuwerfen. Wir besaßen alle nicht die dafür nötige Härte. Vielleicht lag es aber auch daran, dass er nicht so richtig wie ein Dario aussah. Er hatte störrisches rötliches Haar und dicke Sommersprossen. Seine Zähne waren ein bisschen schief, und wenn er lächelte, sah er aus wie ein naiver kleiner Junge. Miles traf schließlich eine Vereinbarung mit ihm: Er sollte das Haus von oben bis unten renovieren, und dafür konnte er bei uns wohnen bleiben. Ich glaube nicht, dass das ein besonders gutes Geschäft für Miles war. Soweit ich es beurteilen konnte, verbrachte Dario einen Großteil des Tages damit, Dope zu rauchen, Horoskope zu lesen, fernzusehen, auf anderer Leute PCs Computerspiele zu spielen und mit einem steifborstigen Pinsel, den er nie reinigte oder ersetzte, an den Wänden herumzumalen.
Davy war – genau wie Owen – erst vor Kurzem zu unserem Haushalt gestoßen. Er arbeitete als Schreiner auf dem Bau. Im Gegensatz zu Dario war er wirklich ein guter Handwerker. Obwohl er nicht den Vorteil genoss, Pole zu sein, hatte er jede Menge zu tun. Das meiste davon fand draußen statt, sodass er immer leicht gebräunt war. Er hatte helles Haar, das ihm dick über die Schultern fiel, und graue Augen. Er sah gut aus, schien sich dessen allerdings nicht bewusst zu sein, was ich süß fand. Er hatte den ängstlichen Blick eines Neulings, zugleich aber ein nettes Lächeln, bei dem man die Lachfältchen rund um seine Augen sah. Als er eingezogen war, hatte ich mich kurz gefragt: vielleicht? Dann hatte ich beschlossen: besser nicht. Sex mit einem Hausbewohner war für mich inzwischen so etwas wie ein Tabu, meine Erfahrung mit Miles ein warnendes Beispiel.
Der Letzte im Bunde war Owen Sullivan, der mir gerade gegenübersaß. Mit seiner blassen Haut, seinem glatten, schulterlangen dunklen Haar und seinen weit auseinanderstehenden, fast schwarzen Augen hatte er etwas leicht Orientalisches an sich, auch wenn meines Wissens alle seine Vorfahren aus Wales stammten. Er war Fotograf und stellte seine Mappe ständig bei irgendwelchen Zeitschriften vor, was ihm hin und wieder einen Auftrag einbrachte. Viel lieber aber hätte er seine eigenen Sachen gemacht. Irgendwann war ihm mal herausgerutscht, dass er die Arbeit für Zeitschriften hasse. Ich hatte kichernd geantwortet, dann sei es ja ein Glück, dass er so wenig davon bekomme. Er hatte nichts mehr gesagt, mich aber mit einem bitterbösen Blick bedacht, der mir klarmachte, dass man ihn besser nicht aufzog, wenn es um seine Arbeit ging. Er sah die Leute immer an, als würde er gerade das Licht und den Hintergrund prüfen, um sie anschließend zu fotografieren. Ich fragte mich manchmal, ob er sie überhaupt richtig wahrnahm und hörte, was sie ihm zu sagen hatten.
»Sieben Zeitalter der Menschheit«, meinte Dario gerade verträumt. »Sieben Meere, sieben Kontinente …«
»Das stimmt nicht.«
»Hört mal«, schaltete Miles sich ein. »Ich störe euch wirklich nur ungern, aber es kommt so selten vor, dass wir hier alle versammelt sind. Nur wir sieben. Wage es also ja nicht, weiter auf diesem Thema herumzureiten, Dario.«
»Du hast recht, es kommt selten vor«, pflichtete Davy ihm bei. »Warum machen wir nicht zur Erinnerung ein Gruppenfoto?«
»Wir haben ja einen professionellen Fotografen.«
»Ich mache keine Schnappschüsse,« erklärte Owen entschieden.
»Wir wollen doch nicht vergessen, dass er Künstler ist«, kommentierte ich sarkastisch.
Davy lächelte nur.
»Dann mache ich es eben«, meinte er.
»Meine Kamera ist da drüben in der Schublade«, sagte Miles müde.
Davy stand auf und zog die Schublade heraus. »Nein, da ist sie nicht. Du musst sie anderswo hingeräumt haben.«
»Ich schätze eher, jemand hat sie sich ausgeliehen und vergessen, sie zurückzulegen.«
»Ich habe eine oben«, sagte Davy.
»Lassen wir das Ganze doch einfach«, meinte Mick, doch Davy war schon draußen und rannte die Treppe hinauf, wobei er dem Geräusch nach jeweils zwei Stufen auf einmal nahm.
Bei uns in der Küche machte sich Stille breit. Draußen hupte ein Wagen mehrere Male, dann hörten wir Schritte die Straße entlangeilen. Oben flog eine Tür zu.
»Findet ihr nicht auch, dass dieses Lamm wie Hundefutter schmeckt?«, fragte Dario.
»Wie schmeckt denn Hundefutter?«
»Genau wie das hier.«
Hundefutter oder nicht, jedenfalls waren Kaugeräusche zu hören, und Teller wurden leer gekratzt. Gesprochen wurde wenig, alle schienen in Gedanken versunken. Als Davy schließlich zurückkehrte, wirkte er atemlos und leicht erhitzt, schwang aber triumphierend seine Kamera. »Sie war nicht da, wo ich dachte. Los, nun quetscht euch mal alle zusammen. Nein, du brauchst dich nicht zu bewegen, Astrid. Die anderen können sich um dich herumstellen. Owen, so kommst du nicht mit aufs Bild. Ich kann dich immer noch nicht sehen.«
»Gut.«
»Dario, dein Gesicht ist von Pippas Schulter verdeckt. Mick, mit diesem Lächeln siehst du ein bisschen seltsam aus. Fast schon beängstigend. Gut, noch zehn Sekunden. Seid ihr bereit?«
»Was ist mit dir?«, fragte Pippa.
»Wart’s ab.«
Davy drückte auf einen Knopf und rannte los, um sich zu uns zu gesellen. Dabei blieb er mit einem Fuß am Tischbein hängen, sodass er stolperte und halb auf die eng zusammengedrängte, teils stirnrunzelnde, teils lächelnde Gruppe fiel, während der Blitz losging. So hielt uns die Kamera fest: ein verschwommenes Durcheinander rudernder Arme und Beine, und ich in der Mitte, den Mund überrascht aufgerissen und das Gesicht verschrammt, als wäre ich in eine Kneipenschlägerei geraten.
»Schaut nur, wie wir darauf aussehen!«, rief Pippa vergnügt: Sie selbst sah natürlich am besten von uns allen aus – sogar in diesem Gedränge war sie noch bildschön und wie aus dem Ei gepellt.
»Ich habe die Augen geschlossen!«, stöhnte Dario. »Warum mache ich bloß immer die Augen zu?«
»Also«, sagte Miles, nachdem wir uns alle wieder niedergelassen hatten. Er schob seinen Teller weg, auf dem das orangefarbene Currygericht bereits eintrocknete. »Ich möchte euch etwas sagen.«
»Ja?«
»Es fällt mir nicht leicht, aber ich gebe euch genug Zeit.«
»Bestimmt geht es um den Zustand des Badezimmers, oder?«
»Leah und ich haben beschlossen, zusammenzuziehen.«
Pippa stieß einen kleinen Jubelschrei aus. Ich runzelte die Stirn.
»Warum dann das ernste Gesicht?«, fragte ich.
»Sie wird hier einziehen.«
»Damit kommen wir schon klar«, sagte Dario. »Die Frage ist allerdings, ob sie damit klarkommt.«
»Ich habe gemeint«, fuhr Miles fort, »dass Leah und ich allein hier leben werden.«
Einen Moment lang sagte niemand ein Wort. Wir starrten ihn nur an, während sein Satz noch in der Luft hing.
»Oh«, meinte Mick schließlich.
»Mist!«, sagte Pippa.
»Du wirfst uns raus?«
»Nicht einfach so«, entgegnete Miles. »Nicht sofort.«
»Wie lange haben wir Zeit?«, wollte ich wissen. Mein Gesicht begann zu pochen.
»Ein paar Monate. Drei. Das ist doch in Ordnung, oder? Auf diese Weise habt ihr alle genug Luft, um anderswo unterzukommen.«
»Ich war doch gerade erst dabei, mich hier einzugewöhnen«, erklärte Davy bedauernd. »Oje.«
»Ihr hättet sowieso nicht ewig bleiben können«, meine Miles.
»Warum nicht?« Dario wirkte völlig niedergeschmettert. Seine Sommersprossen traten in roten Flecken hervor.
»Weil sich die Dinge eben ändern«, antwortete Miles. »Im Lauf der Zeit.«
»Geht es dir nicht gut, Astrid?«, fragte Davy. »Du siehst plötzlich ein bisschen blass aus.«
»Ich muss ins Bett«, erklärte ich. »Oder mich zumindest eine Weile hinlegen. Ich fühle mich irgendwie komisch.«
Pippa und Davy legten die Hände unter meine Ellbogen, um mir aufzuhelfen. Dabei gaben beide beruhigende Geräusche von sich.
»Es tut mir leid«, sagte Miles niedergeschlagen. »Vielleicht war es der falsche Zeitpunkt.«
»Für so etwas ist nie der richtige Zeitpunkt, Miles«, entgegnete Pippa. »Komm doch erst mal mit zu mir, Astrid. Dann musst du dich eine Treppe weniger hochkämpfen. Ich kann dich mit Sportsalbe einreiben, wenn du möchtest.«
Ich schleppte mich die Treppe rauf, eine Stufe nach der anderen, und schlurfte dann langsam in Pippas Zimmer, wo es stark nach Parfüm roch. Es war ein großer Raum, der auf die Vorderseite des Hauses hinausging. Als wir damals eingezogen waren, hatte er als Wohnzimmer fungiert und war wohl seit den fünfziger Jahren nicht mehr renoviert worden. Pippa hatte nichts unternommen, um das zu ändern, sondern den Raum einfach mit dem gesammelten Schnickschnack ihres Lebens gefüllt. Das Ergebnis war äußerst ungut. Zwei Wände waren in einem schmuddeligen Senfgelb gestrichen, eine andere mit einem unruhigen Blumenmuster tapeziert, bei dessen Anblick einem sofort schummrig wurde. An den Kanten blätterte die Tapete bereits ab. Von der Mitte der Zimmerdecke hing eine Glühbirne, umspannt von einem braunen Papierschirm, der auf einer Seite aufgerissen war. Ein großes Erkerfenster ging auf die Straße hinaus, aber Pippa hatte die Jalousien immer halb geschlossen, sodass der Raum in ewigem Schatten lag. In meinem wackligen Zustand nahm das Chaos, das sie geschaffen hatte, eine beängstigende, fast halluzinatorische Dimension an. Über Pippas Metallbett – einem großen Einzelbett, das ihrem Lebensstil überhaupt nicht entsprach – war eine Tagesdecke in erotischem Purpurrot gebreitet. Auf einem kleinen Diwan, den ihr Großvater ihr in seinem Testament hinterlassen hatte, türmten sich Berge von Klamotten, sowohl saubere als auch getragene. Die Schubladen der Kommode waren alle aufgezogen, sodass Unterwäsche und Shirts hervorquollen und teilweise auf dem Boden verstreut lagen. Der Schrank mit Pippas wundervollen Kleidern, Hosenanzügen, Röcken und Jacken stand ebenfalls offen. An einer Wand lehnte ein großer Spiegel, und vor ihm auf dem Boden waren haufenweise Make-up-Dosen zu bewundern, Flaschen mit Körperlotion, ineinander verschlungene Ketten, verstreute Ohrringe, ein paar Gürtel. Trotzdem tauchte Pippa jeden Morgen frisch und makellos aus diesem Raum auf, jedes Haar saß am richtigen Platz, und sie roch nach Seife und Chanel No 5.
Ich schob einen Schlüpfer beiseite und ließ mich vorsichtig auf ihr Bett sinken.
»Aspirin?« Sie griff unters Bett und beförderte eine Packung Pillen zum Vorschein. »Mit Whisky?« Wie eine Zauberkünstlerin zog sie unter dem Kleiderberg auf dem Diwan eine Flasche heraus und schwenkte sie.
»Vielleicht verzichte ich heute Abend lieber auf den Whisky.«
»Ach was!«
Sie schüttelte mir zwei weiße Tabletten auf die Handfläche. Anschließend schenkte sie ein paar Fingerbreit aus der Flasche in ein Glas und reichte es mir. Ich schob mir das Aspirin in den Mund und spülte es mit einem kleinen Schluck Whisky hinunter.
»Soll ich dir die Schultern massieren?«, fragte sie.
»Ich glaube, das würde mir zu sehr wehtun.«
»Ich finde, du machst nicht annähernd genug Aufhebens um die Sache.«
»Seltsamer Tag«, antwortete ich.
Unten waren Stimmen zu hören, dann erkannte ich die unverwechselbaren, schweren Schritte von Mick, der die Treppe zu seinem Zimmer hinaufstieg.
»Hauptsächlich für dich«, meinte Pippa. Sie nahm mir das Glas aus der Hand, schenkte sich eine großzügige Menge Whisky ein und kippte ihn routiniert hinunter. »Dieser Mistkerl!«, fügte sie laut hinzu.
»Miles?«
»Wer sonst?«
»Ich weiß nicht, Pippa. Das musste ja irgendwann mal kommen.«
»Bah!«
»Und wenn er und Leah allein miteinander leben wollen …«
»Da steckt doch nur sie dahinter.«
»Aus deinem Mund klingt das nach einer Verschwörung.«
»Natürlich ist es eine Verschwörung. Deswegen müssen wir eine Gegenverschwörung starten.«
Sie sprach weiter, sagte irgendetwas darüber, dass mich die Beule an meinem Kopf zu vernünftig mache, aber ich hörte ihre Worte gar nicht richtig, und ihren Sinn verstand ich erst recht nicht. Ich fühlte mich zum Umfallen müde. Hin und wieder verschwamm mir schon der Raum vor den Augen. Ich ließ mich auf die Kissen sinken und schloss meine bleiernen Lider.
»Vielleicht schlafe ich heute Nacht einfach hier«, murmelte ich benommen.
Pippa packte mich am Arm und zog mich wieder in eine sitzende Position.
»O nein, das tust du nicht. Nicht heute Nacht, Schätzchen.«
Wie eine Krabbe erklomm ich die zweite Treppe und kroch in
3
Ich wälzte mich unruhig hin und her, schlief für eine Weile ein, wälzte mich weiter, schlief erneut. Als ich schließlich wieder aufwachte und helles Sonnenlicht durch die Vorhänge scheinen sah, gab ich den Kampf auf. Außerdem brauchten sowohl mein Körper als auch mein Fahrrad dringend eine Inspektion.
Unter der Dusche – diesmal einer heißen – untersuchte ich mich. Ich beugte meine Knie und Ellbogen. Sie schmerzten, aber es war kein Krachen oder Schaben zu hören. Am besten, ich kam möglichst schnell wieder in die Gänge. Außerdem war schönes Wetter, daher hielt ich es für eine gute Idee, den Tag nicht im Haus zu verbringen.
Vorerst fand ich es allerdings durchaus wohltuend, allein in der Küche zu hantieren. Ich machte mir Kaffee und Porridge und schnitt eine Grapefruit auf. Während mein Porridge vor sich hin köchelte, ging ich in den Garten hinaus, um einen Blick auf mein Gemüsebeet zu werfen. Ich hatte vorher noch nie etwas selbst angebaut, außer vielleicht Senf und Kresse auf Löschpapier, als ich klein war, doch dieses Jahr hatte ich auf einmal beschlossen, dass wir unser eigenes Gemüse ziehen sollten. Deswegen hatte ich Anfang des Jahres bei einem Kofferraum-Flohmarkt eine Schaufel, einen kleinen Spaten und eine Gießkanne erstanden. Die Sachen waren sehr schön, fast neu und derart billig, dass sie mit ziemlicher Sicherheit Leuten aus der Gegend gestohlen worden waren, die vergessen hatten, ihren Gartenschuppen abzuschließen. Wozu veranstaltet man sonst in Hackney einen Kofferraum-Flohmarkt? Mir jedoch leistete das Diebesgut beste Dienste, als ich ein langes Rechteck überwucherten Bodens abmaß und zu einem schönen Beet umgrub. Seine lehmige, fruchtbare Erde war durchsetzt von alten Münzen und Tonscherben, die ich alle einsammelte und auf die Kommode in meinem Schlafzimmer legte. Die Arbeit entpuppte sich als überraschend befriedigend. Ich genoss die Rückenschmerzen, die Blasen an den Händen und die Erde unter den Fingernägeln. Davy bot an, mir bei dem anstrengenden Graben zur Hand zu gehen, aber ich wollte nicht, dass mir jemand half. Es sollte alles mein Werk sein. Ich pflanzte Zucchini, Saubohnen, Stangenbohnen, Rote Bete und Rauke – ja sogar Kartoffeln, für die ich einen separaten Bereich mit aufgehäufter Erde angelegt hatte. Alle anderen im Haus machten sich über mich lustig, aber inzwischen kamen überall bereits kräftige Triebe zum Vorschein. Fast jeden Morgen und Abend ging ich hinaus, um sie zu inspizieren. An diesem Morgen nahm ich mir vor, nächstes Jahr auch Zuckermais anzubauen, und vielleicht Kürbisse für Suppe – doch dann fiel mir ein, dass ich nächstes Jahr gar nicht mehr da sein würde. Erst in dem Moment wurde mir klar, dass ich auch schon dieses Jahr keine Gelegenheit mehr haben würde, das Gemüse zu ernten, mit dem ich mir so viel Mühe gegeben hatte. Stattdessen würden Miles und Leah die Früchte meiner Arbeit genießen.
Ich trank bereits meine zweite Tasse Kaffee, als Pippa in einem hellgrauen Hosenanzug und einem weißen Hemd die Küche betrat, fertig gestylt fürs Büro. Sie war nicht allein. Ein Mann, der eine schwarze Hose, ein Blumenhemd und eine Lederjacke trug, folgte ihr mit der typischen Mischung aus Verlegenheit und Stolz, die Männer morgens oft an den Tag legen. Sie stellte ihn als Jeff vor. Er ließ sich mir gegenüber am Tisch nieder, fragte, ob ich etwas dagegen hätte, und schenkte sich eine Tasse Kaffee ein.
Ich war zu verblüfft, um ihm eine Antwort zu geben. Pippa war wirklich erstaunlich. Wie hatte sie das bloß wieder angestellt? Wo hatte sie ihn hergezaubert? Als ich am Vorabend ging, war es schon ziemlich spät gewesen, und sie saß allein in ihrem Zimmer. Trotzdem hatte sie mitten in der Nacht noch irgendwo diesen Mann aufgegabelt und in ihr Bett geschmuggelt.
»Hallo, Jeff«, sagte ich und stammelte dann: »Wie … wo habt ihr euch …?«
»Wir waren auf einen Drink verabredet«, erklärte Pippa fröhlich. »Ich habe vorgeschlagen, dass wir genauso gut bei mir etwas trinken könnten. Am Ende war es so spät, dass, nun ja, du weißt schon …«
»Nein, eigentlich nicht«, antwortete ich. »Pippa, ich möchte dich etwas Berufliches fragen.«
»Was?«
»Hat Miles gesetzlich überhaupt das Recht, uns alle rauszuwerfen? Gelten wir denn nicht als reguläre Mieter?«
»Ich weiß nicht.«
»Bist du nicht Anwältin?«
»Du bist Anwältin?«, mischte Jeff sich ein.
»Ja, Süßer«, antwortete Pippa. »Nun beeil dich, und trink deinen Kaffee aus.« Sie wandte sich wieder mir zu. »Das heißt nicht, dass ich so etwas auswendig weiß. Ich werde es nachschlagen oder jemanden fragen. Aber man sollte bei so etwas grundsätzlich keinen Anwalt einschalten. Das ist das Einzige, was ich gelernt habe.«
Ich nickte Pippa zu und verabschiedete mich höflich von Jeff, den ich vermutlich nie wiedersehen würde. Dann rief ich Campbell im Büro an. Er meinte, ich könne mir ohne Weiteres für ein paar Tage ein Rad bei ihm ausleihen. Ich müsse es nur im Büro in Clerkenwell abholen. So kam es, dass ich an diesem Morgen der wohl einzige Fahrradkurier in London war, der nicht mit dem Rad zur Arbeit fuhr. Stattdessen saß ich in der U-Bahn, bekleidet mit engen Lycra-Shorts und meinem neongelben Oberteil, den Helm auf dem Schoß. Hätte ich Reiterhosen und einen scharlachroten Mantel getragen, hätte ich nicht lächerlicher aussehen können.
Ich schaute fast nie im Büro vorbei. Es war im Grunde nur eine kleine Kammer, in der Campbell und sein Assistent Becks Aufträge entgegennahmen und die Kuriere anriefen. Trotzdem war es erstaunlich trist – ein Chaos aus Pappkartons, ungespülten Kaffeetassen und sich stapelnden Unterlagen.
»Streit mit deinem Liebsten gehabt?«, fragte Campbell, als ich das Büro betrat.
»Wagentür«, gab ich zurück.
»Bist du sicher, dass du dich gut genug fühlst?«
Beim Anblick des Fahrrads, das er mir leihen wollte, fühlte ich mich gleich nicht mehr so gut. Campbell bemerkte meinen skeptischen Gesichtsausdruck.
»Dieses Rad hat mir gute Dienste geleistet«, versicherte er.
»Zumindest wird es mir keiner klauen«, murmelte ich. »Also, was steht als Erstes auf dem Programm?«
Er warf einen Blick auf sein Klemmbrett.
»Was hättest du denn gern? Von der Wardour Street nach Camden Town?«
»Das Einzige, was ich wirklich gern hätte, bist du, Campbell.« Ich nahm den Zettel entgegen, den er mir hinhielt. »Nachdem ich mal wieder gesehen habe, wie es in diesem Büro zugeht, nehme ich mir fest vor, in Zukunft noch seltener vorbeizuschauen. Vielleicht sehen wir uns ja später im Pub.«
Es war einer jener schönen Tage, die uns Fahrradkuriere für die Januartage entschädigen, an denen wir nass und klamm durch die Stadt fahren und es um vier Uhr nachmittags schon dunkel ist, und für die Augusttage, an denen man als Radfahrer das Gefühl hat, nichts als Hitze und Abgase einzuatmen. Der Sonnenschein ging mit der Frische des Frühlings einher, es herrschte nicht allzu viel Verkehr, und ich war glücklich, auch wenn ich nicht so ganz wusste, warum. Ich schoss in geraden Linien über die Karte von London. Nach dem Auftrag in Camden Town fuhr ich von der Charlotte Street nach Maida Vale und anschließend aus Soho zur London Bridge. Unterwegs gab ich am Borough Market zu viel Geld für ein exotisches Sandwich aus. Dann ging es über den Fluss zur Old Street und von dort in einer langen geraden Linie nach Notting Hill Gate. Auf dem Rückweg in die Stadt machte ich im St. James’s Park Halt, verspeiste mein Sandwich und trank eine Flasche Wasser. Dann ging es weiter kreuz und quer durch London, zu den Fotolabors, Werbeagenturen, Verlagshäusern, Anwaltskanzleien und Büros, in denen ich schon seit Monaten aus und ein ging, ohne wirklich zu wissen – oder wissen zu müssen –, was genau die Leute da eigentlich taten.
An manchen Tagen hatte ich das Gefühl, schwere Gewichte hinter dem Rad herzuschleppen. Nicht so heute. Der Unfall hatte mir definitiv keinen bleibenden Schaden zugefügt. Meine schmerzenden Gliedmaßen lockerten sich allmählich, und bis zum Abend hatte ich gut hundert Kilometer zurückgelegt, fühlte mich aber nicht mal müde, sondern spürte lediglich ein angenehmes Ziehen in den Waden und Oberschenkeln. Auf dem Heimweg machte ich im Horse and Jockey Halt. Das Pub wurde hauptsächlich von Fahrradkurieren frequentiert. Die Motorradkuriere, fast ausschließlich große, bärtige Männer in schwarzen Lederklamotten, trafen sich im Crown, gleich südlich der Oxford Street. Sie saßen draußen auf dem Gehsteig, pfiffen vorbeikommenden Frauen hinterher und sprachen über Nockenwellen oder wie auch immer die Teile heißen, aus denen Motorräder bestehen.
Wir Fahrradkuriere betrachteten uns als eine sensiblere Spezies. Wir sahen auf jeden Fall um Welten gesünder aus – zumindest diejenigen von uns, die überlebten. Als ich ankam, begrüßten mich die Leute, die schon da waren, mit kurzem Jubelgeschrei und hoben ihre Bierflaschen. Sie umringten mich, um meine Blutergüsse und Schrammen zu inspizieren. Nachdem sie kundgetan hatten, dass sie wirklich nicht besonders schlimm seien, wandten wir uns wichtigeren Themen zu. Wir sprachen über die Lage auf dem Arbeitsmarkt und tauschten Klatschgeschichten aus. In erster Linie aber machten wir uns über unsere Kunden lustig. Wir waren zwar von ihnen abhängig, aber das hieß nicht, dass wir sie respektieren mussten. Der Großteil der Aufträge kam von Firmen, für die wir Umschläge von Büro zu Büro transportierten, aber wir fuhren auch für mehrere Privatfamilien, von denen einige so reich waren – oder zumindest so viel reicher als wir –, dass sie bei jeder Gelegenheit nach dem Hörer griffen und uns antanzen ließen. Wir hatten einen inoffiziellen Wettbewerb laufen, bei dem es um den lächerlichsten Auftrag ging. Einmal war ich mehrere Tage hintereinander losgeschickt worden, ein vergessenes Lunchpaket von Primrose Hill zu einer Mädchenschule im West End zu liefern. Ein anderer Kurier behauptete, er sei bei strömendem Regen nach Notting Hill Gate gefahren, um dort einen Regenschirm abzuholen und einer Frau zu bringen, die vor Fortnum and Mason stand. Der Job gab uns auch die Möglichkeit, hin und wieder einen Blick ins Innere der Häuser zu werfen. Einer der Kuriere schlug vor, ein Spiel zu starten: Für ein Kino im Haus sollte es fünf Punkte geben, für einen Brunnen zehn, für ein Schwimmbad fünfzig.
Als mir anschließend ein anderer Kollege namens Danny eine Lügengeschichte über eine Kundin auftischte, die angeblich auf ihn stand, rettete mich mein Telefon. Es war Davy.
»Ich sitze gerade im Jockey«, erklärte ich. »Hast du Lust vorbeizukommen?«
Das Pub war ein praktischer Treffpunkt mitten in der Stadt. Pippa, Davy oder Owen leisteten mir dort hin und wieder Gesellschaft und versuchten dann jedes Mal ihr Bestes, um zwischen uns durchtrainierten, sonnengebräunten, leicht bekleideten und für gewöhnlich göttergleich gebauten Kurieren nicht unangenehm aufzufallen.
»Nein«, antwortete er. »Ich bin zu Hause. Du solltest vielleicht besser auch herkommen.«
»Ist irgendetwas passiert?«
»Nein, nein«, beruhigte er mich. »Zumindest nichts, was mit uns zu tun hat. Aber dramatisch ist es trotzdem.«
Gemächlich machte ich mich auf den Heimweg. Ich genoss das bernsteinfarbene Licht und die kühle Luft auf meiner geröteten Haut. Als ich in die Maitland Road einbog, ging mir durch den Kopf, dass ich auf keinen Fall noch einmal einen so dämlichen Unfall in meiner eigenen Straße haben durfte. Um ein Haar wäre ich dabei fast an derselben Stelle, an der ich am Vortag gegen die Wagentür gefahren war, mit einem Streifenwagen kollidiert. Ein paar Häuser von dem unseren entfernt war ein Stück des Gehsteigs mit Plastikband abgesperrt. Mehrere Polizeibeamte und -beamtinnen liefen geschäftig herum. Einer stand neben dem Wagen und machte einen eher gelangweilten Eindruck.
»Was ist hier los?«, fragte ich ihn.
»Fahren Sie weiter, meine Liebe«, antwortete er.
»Ich wohne in dieser Straße.«
»Es ist schon alles vorbei.«
»Was ist schon alles …?«
»Fahren Sie einfach weiter.«
Das widerstrebte mir. Fast genau dort, wo ich wohnte, war etwas passiert, und ich wollte alles darüber wissen, aber der Beamte starrte mich nur an, und da mir nichts mehr einfiel, schob ich mein Rad den Gehsteig entlang bis zu unserem Haus.
Dario stand in der Diele auf einer Leiter und strich die Rosette rund um die Deckenlampe. Ich lehnte Campbells Rad gegen die Wand.
»Da fällt bestimmt jemand drüber«, bemerkte er.
»Es ist nur für heute«, entgegnete ich. »Was ist denn da draußen los?«
»Vor zwei Stunden war noch viel mehr Polizei da. Mehrere Streifenwagen, und auch ein Krankenwagen.«
»Was ist passiert?«
»Das kann ich dir auch nicht so genau sagen«, antwortete er. »Ich war nicht draußen. Angeblich ist jemand überfallen worden.«
»Ermordet«, sagte eine Stimme hinter mir. Ich drehte mich um. Es war Mick.
»Ermordet?«, fragte ich. »Nein! Was ist passiert?«
»Jemand ist auf der Straße überfallen worden und dabei ums Leben gekommen. Offenbar hat sich das Opfer gewehrt. Wie kann man nur so blöd sein!«
Dario grinste zu mir herunter. »Gestern kracht Astrid gegen ein Auto, heute wird jemand ermordet. Unser Viertel entwickelt sich langsam zu einem gefährlichen Pflaster.«
»Dann ist es ja gut, dass wir hier rausmüssen, oder?«, meinte ich und blickte dabei misstrauisch zu ihm hoch. »Wie lange renovierst du nun eigentlich schon dieses Haus?«
»Keine Ahnung«, antwortete er.
4
Nach einer kühlen, sehr kurzen Dusche entschied ich mich für locker sitzende Kleidung, zuckte allerdings trotzdem ein paarmal zusammen, als ich sie überstreifte: einen leichten Rock, weil es ein milder, lauer Maiabend war, ein Shirt, das meine Arme bedeckte, dazu Sandalen. Ich war in Clerkenwell mit drei alten Freunden verabredet und würde mich nicht mehr auf mein Rad schwingen, sondern den 73er-Bus nehmen. Dario, der ebenfalls noch ausgehen wollte, kam mit zur Haltestelle. Die Polizei war immer noch da, es schienen sogar mehr Beamte zu sein als vorher, außerdem hatten sie inzwischen wenige Meter von dem abgesperrten Bereich entfernt ein gelbes Metallschild aufgestellt: Alle, die am Donnerstag, dem 10. Mai, gegen Abend etwas Ungewöhnliches beobachtet hatten, sollten sich bei der Polizei melden.
»Glaubst du wirklich, jemand ist ermordet worden?«, fragte ich Dario.
»Auf jeden Fall«, antwortete er voller Enthusiasmus.
»Hier steht nur ›ernster Vorfall‹. Das könnte doch alles Mögliche sein. Vielleicht ein Verkehrsunfall, oder ein Raubüberfall.«
»Für einen Überfall sind das aber verdammt viele Bullen«, meinte Dario.
Wir waren es schon gewöhnt, dass in der Maitland Road hin und wieder jemand überfallen wurde und die Polizei auf gelben Schildern um Mithilfe bat, was aber meistens nicht viel brachte. Hinter der Maitland Road lag ein übler Wohnblock. Gangs von Jugendlichen mit tief hängenden Hosen und Kippen im Mundwinkel streiften durchs Viertel und lungerten im Park herum. Sie warfen Fenster ein, leerten Mülltonnen auf die Straße, tätigten an der Bushaltestelle, an der wir gerade standen, ihre Drogengeschäfte und lieferten sich Kämpfe, die böse ausarten konnten. Unsere Straße gehörte zu jenen, die eine Art Grenze zwischen den Wohlhabenden und den extrem Armen bildeten.
Als Miles, Pippa und ich vor Jahren hierherzogen, waren viele von den Häusern baufällig und mit Brettern vernagelt. In den Gärten wucherte das Unkraut, und die paar Geschäfte, die es gab, waren Zeitungshändler, die rund um die Uhr geöffnet hatten, und ein paar seltsame Außenposten einer früheren Zivilisation, in denen es Trevira-Hosen und lange Unterhosen zu kaufen gab. Der Sandkasten im Park war voller Spritzen und Müll. Man hatte damals das Gefühl, dass es sich um eine verlassene, ungeliebte Gegend handelte. Nun jedoch wurde das Viertel wieder hochgepäppelt. Es gab immer noch heruntergekommene Reihenhäuser und baufällige, von Hausbesetzern bewohnte Gebäude, aber auch renovierte und schön hergerichtete, die zwischen ihren schäbigen Nachbarn unpassend schick wirkten. Man sah sowohl Volvos und BMWs als auch verbeulte Rovers und Fords. Schilder von Immobilienmaklern sprenkelten die Vorgärten, Baufahrzeuge und Container thronten vor Häusern, die ihres gesamten Innenlebens beraubt waren. Die scheußlichen grauen und rosafarbenen Wohnblöcke, die Namen wie Morris und Ruskin House trugen, bildeten inzwischen triste, verwahrloste, hartnäckig ausharrende Inseln.
Als der Bus kam, suchte ich mir oben einen Platz und starrte zum Fenster hinaus. Bald endete Hackney, und ich befand mich im nobleren Stoke Newington, dann im noch nobleren Islington, wo in gepflegten Reihenhäusern Lichter funkelten und all die teuren Restaurants voll besetzt waren. Den Rest des Abends dachte ich nicht mehr an den Vorfall in der Maitland Road. Ich traf mich mit meinen Freunden, und wir gönnten uns erst mal einen Drink, den wir stehend in der noch warmen Luft draußen vor dem Pub einnahmen, ehe wir in einem billigen Restaurant zu Abend aßen und anschließend bei Saul noch einen Kaffee tranken. Alle waren müde, aber da es sich um einen Freitagabend handelte, zog es keinen nach Hause, sodass wir faul weiterplauderten und ich erst ziemlich spät mit dem Nachtbus zurückfuhr. Inzwischen war die Luft recht kühl. Mir ging durch den Kopf, dass ich am nächsten Tag lange schlafen und dann vielleicht mit Pippa den Blumenmarkt besuchen und irgendwo zu Mittag essen würde. Außerdem ging mir durch den Kopf, dass ich mir eine neue Behausung suchen musste. Drei Monate waren im Grunde keine lange Zeit, der Sommer würde so schnell vorbeigehen.
In der Maitland Road standen immer noch zwei Streifenwagen. Um den einen hatten sich ein paar Jungs im Teenageralter versammelt. Als ich vorbeiging, trat einer von ihnen gegen den Vorderreifen und versuchte dabei möglichst cool zu erscheinen. Ich grinste ihn an, woraufhin er rot anlief, sodass er plötzlich viel jünger wirkte, als ihm recht war.
»Hallo!«, rief ich, als ich die Haustür aufschob.
Alle bis auf Dario und Owen hatten sich unten in der Küche versammelt. Auf dem Tisch standen ein paar leere Weinflaschen. Miles’ Freundin Leah war auch da: der Grund für unseren Rauswurf aus dem Haus. Ich hatte mit einer eher eisigen Stimmung gerechnet, spürte aber sofort, dass stattdessen Adrenalin in der Luft hing.
»Jetzt hast du die ganze Aufregung verpasst«, begrüßte mich Miles.
»Was denn für eine Aufregung?«
»Die Polizei war da und hat uns befragt, ob wir gestern Nacht irgendetwas Ungewöhnliches gehört hätten.«
»Wirklich? Haben sie gesagt, was passiert ist?«
»Mick hatte recht«, antwortete Miles. »Es ist jemand ermordet worden.«
»In der Maitland Road«, fügte Davy hinzu, als wäre das eine gute Nachricht.
»Nein!«
»Doch.«
»Mein Gott, wie schrecklich! Wer denn? Hoffentlich niemand, den wir kennen?«
»Nein«, entgegnete Pippa. Sie klang fast enttäuscht.
»Angeblich eine Frau namens Margaret Farrell«, meinte Davy. »Wir kennen keine Margaret Farrell, oder?«
»Ich zumindest nicht«, antwortete ich. »Hat sie in der Nähe gewohnt?«
»Das ist ja das Brutale«, erwiderte Pippa. »Sie hat hier in unserer Straße gewohnt, bloß ein paar Häuser weiter, in Nr. 54. Sie war praktisch eine Nachbarin.«
»Nr. 54?« Ich überlegte, welches Haus das war und wer darin wohnte.
»Das Haus mit der dunkelgrünen Tür und dem ordentlichen Vorgarten«, erklärte Miles.
»Wir haben es uns angesehen«, fügte Davy hinzu.
»Um wie viel Uhr ist es passiert?« Es wollte nicht so recht in meinen Kopf hinein, dass ein paar Schritte von unserer Haustür entfernt jemand umgebracht worden war, während wir sicher und gemütlich in der warmen Stube saßen.
»Das konnte die Polizei auch noch nicht so genau sagen. Sie wollten lediglich wissen, ob wir während der Nacht irgendetwas Ungewöhnliches gehört hätten.«
»Nur das gewöhnliche Ungewöhnliche«, bemerkte ich. »Geschrei, Gerenne, Zeug, das durch die Gegend fliegt.«
»Das haben wir ihnen auch gesagt.« Davy kippte den Rest des Weins in sein Glas und hielt es gegen das Licht. »Außerdem haben wir ihnen die Namen sämtlicher Hausbewohner gegeben.«
»Warum denn das?«
»Routine«, antwortete Miles knapp. »Ich habe ihnen gesagt, dass wir gestern Nacht alle hier waren. Sie haben bloß gemeint, wir sollten uns bei ihnen melden, falls uns noch irgendetwas einfällt, das hilfreich sein könnte.«
»Margaret Farrell«, überlegte ich laut. »Weiß man, warum? War es ein Raubüberfall, oder was ist passiert? Wurde sie in ihrem eigenen Haus ermordet?«
»Nein«, antwortete Davy. »Jemand hat erwähnt, ihre Leiche sei bei den Mülltonnen gefunden worden, draußen vor dem Keller. Angeblich haben die Müllmänner sie heute Nachmittag entdeckt.«
»Nein!«, rief ich. »Man hat sie einfach zu dem ganzen Müll geworfen? Das ist ja schrecklich!«
»Zumindest ist es mir so erzählt worden. Kaum zu glauben, nicht wahr?«
»Aber warum?«
»Ich glaube, es war ein Überfall, und sie wollten ihr Opfer eigentlich gar nicht umbringen«, erklärte Miles.
»Sie?«
»Wahrscheinlich war es der Ehemann«, meinte Pippa. »Es ist doch immer der Ehemann.«
»Wisst ihr überhaupt, ob sie verheiratet war?«, fragte ich.
»Wir wissen eigentlich gar nichts«, antwortete Miles. »Die Leute geben bloß Gerüchte und Vermutungen weiter, davon schwirren inzwischen jede Menge durch die Straße, und sie werden immer bizarrer. Endlich reden mal alle miteinander. Ironie des Schicksals, oder?«
»Allerdings«, pflichtete Leah ihm bei. Überrascht blickte ich hoch, weil ich ihre Anwesenheit fast vergessen hatte. Ruhig und elegant saß sie da, beide Hände auf dem Tisch.
»Beängstigend«, sagte ich mit einem leichten Schaudern. »Direkt vor unserer Haustür.«