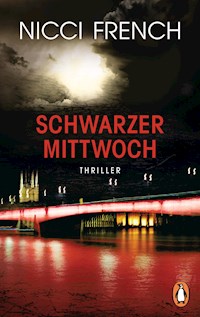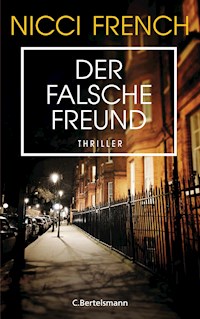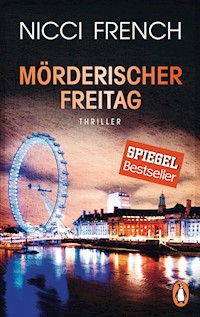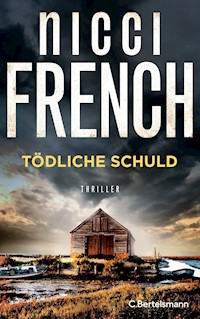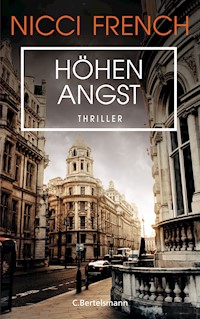9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Psychologin Frieda Klein als Ermittlerin
- Sprache: Deutsch
Psychologin Frieda Kleins persönlichster Fall: Es sind alle bedroht, die sie liebt ...
Unter den Dielen im Wohnzimmer von Frieda Klein wird die Leiche eines Mannes gefunden. Es handelt sich um den Detektiv, den Frieda auf ihren Stalker Dean Reeve angesetzt hatte. Sie ist überzeugt, Dean ist der Mörder, aber die Polizei glaubt ihr nicht – und dann überschlagen sich plötzlich die Ereignisse: Friedas Nichte wird entführt, jemand schlägt ihren ehemaligen Mentor zusammen, und dann verschwindet der kleine Sohn ihres Freundes Josef spurlos. Offensichtlich will jemand sie einschüchtern. Doch die Verbrechen tragen nicht Deans Handschrift. Wer ist der Unbekannte, der ihm nacheifert? Und wen wird er sich als nächstes vornehmen? Die Zeit drängt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
NICCI FRENCH – hinter diesem Namen verbirgt sich das Ehepaar Nicci Gerrard und Sean French. Seit dem Erscheinen ihres Longsellers »Der Sommermörder« sorgen sie mit ihren Psychothrillern international für Furore und verkauften weltweit über 8 Mio. Exemplare. Die beiden leben in Südengland. »Blutroter Sonntag« ist der vorletzte Band der achtteiligen Thrillerserie um Psychotherapeutin Frieda Klein. Zuletzt erschien »Böser Samstag«.
Nicci French in der Presse:
»Endlich: Ein guter psychologischer Kriminalroman.«
Die Zeit
»Adrenalinkickende Doppelermittlungen.«
Der Tagesspiegel
»Frieda wird von Tag zu Tag besser.«
TV Movie
Außerdem von Nicci French lieferbar:
Blauer Montag
Eisiger Dienstag
Schwarzer Mittwoch
Dunkler Donnerstag
Mörderischer Freitag
Böser Samstag
Der achte TagDer Sommermörder
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
NICCI FRENCH
BLUTROTER SONNTAG
PSYCHOTHRILLER
Aus dem Englischenvon Birgit Moosmüller
C. Bertelsmann
Die Originalausgabe erschien 2017
unter dem Titel »Sunday Morning Coming Down«
bei Michael Joseph (Penguin Random House), London.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2017 by Joint-Up Writing, Ltd.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017
bei C. Bertelsmann, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: www.buerosued.de Covermotiv: plainpicture/robertharding/Paul Porter
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-19920-3V005www.cbertelsmann.de
Glendower: Ich rufe Geister aus der wüsten Tiefe.
Percy: Ei ja, das kann ich auch, das kann ein jeder. Doch kommen sie, wenn Ihr nach ihnen ruft?
William Shakespeare, Heinrich IV, Teil 1 (III/1)
ERSTER TEIL
ERSTER TEIL – Die Leiche unter dem Fußboden
1
Auf einmal war die Wohnung von Geräuschen erfüllt. Das Telefon läutete, verstummte, läutete erneut. Auf dem Tisch vibrierte das Handy. Die Türklingel ging – einmal, zweimal –, und gleichzeitig klopfte jemand heftig. Detective Chief Inspector Karlsson hievte sich aus seinem Sessel auf die Krücken, humpelte zur Tür und öffnete sie.
Eine sehr kleine und dünne Frau starrte ihm stirnrunzelnd entgegen. Ihr rotblondes Haar war im Nacken fast stoppelkurz, der schräg geschnittene Pony aber auf einer Seite so lang, dass er ein Auge verdeckte. Sie hatte ein schmales, blasses, leicht asymmetrisch wirkendes Gesicht mit farblosen Brauen und zimtbraunen Augen. Bekleidet war sie mit einem schwarzen Anorak, einem weiten grauen Pulli, einer dunklen Hose und orangeroten Turnschuhen. Hinter ihr regnete es in Strömen. Sowohl ihr Gesicht als auch ihr Haar waren vom Regen ganz nass. Über ihr knarrten die Äste einer Platane.
»Ich bin Chief Inspector Petra Burge.«
Karlsson fand, dass sie dafür zu jung aussah. Dann aber entdeckte er die Fältchen rund um ihre Augen. Außerdem hatte sie an der linken Kopfseite eine Narbe, die sich vom Ohr bis zum Hals hinunterzog.
»Ich habe schon von Ihnen gehört.«
Burge wirkte weder überrascht noch geschmeichelt.
»Ich muss Sie bitten, mich zu einem Tatort zu begleiten.«
Karlsson deutete auf seine Krücken.
»Ich bin krankgeschrieben.«
»Auf Weisung des Polizeipräsidenten.«
»Crawford schickt Sie?«
»Ich soll Ihnen sagen, dass es in den Saffron Mews eine Leiche gibt.«
»In den Saffron Mews?«
Plötzlich fühlte er sich, als hätte ihm jemand einen Magenschwinger verpasst. Er streckte eine Hand aus, um sich abzustützen. »Was ist passiert?«
»Wir fahren da jetzt hin. Ich habe einen Wagen.«
Burge wandte sich zum Gehen, doch Karlsson hielt sie am Ärmel fest.
»Ist sie tot?«
Sie schüttelte den Kopf.
»Es handelt sich um einen Mann.«
Einen Mann, dachte Karlsson. Was für einen Mann? Er hatte das Gefühl, sich selbst zu beobachten. Er hörte sich sagen, er komme gleich, während er sich benommen nach seinem Mantel umwandte, mit einem raschen Griff sicherstellte, dass sein Dienstausweis in der Tasche steckte, sich dann die Krücken unter die Achseln schob und die Tür zuzog. In dem Moment roch er die Kartoffel im Ofen. Sie würde zu Ruß verkokeln. Und wenn schon.
Er ließ sich auf den Rücksitz sinken und zog die Krücken nach. Erst dann merkte er, dass neben ihm jemand im Wagen saß.
»Es tut mir so leid!«
In der Dunkelheit brauchte er ein paar Augenblicke, um Detective Constable Yvette Long auszumachen. Sie lehnte sich zu ihm herüber, als wollte sie nach seinen Händen greifen. Ihr sonst streng nach hinten gebundenes Haar fiel ihr offen über die Schultern. Sie trug einen unförmigen Pullover und eine alte Jeans.
Ihre Stimme klang nach unterdrücktem Schluchzen. Mit einer Handbewegung brachte er sie zum Schweigen. Sein Bein schmerzte, und seine Augen brannten. Er saß ganz still und aufrecht, während er auf den Verkehr starrte, der ihnen aus der regennassen Dunkelheit entgegenkam.
»Immerhin lebt sie«, sagte er schließlich.
Burge stieg auf der Beifahrerseite ein. Neben ihr blickte ein Fahrer starr geradeaus. Von hinten sah Karlsson nur sein geschorenes Haar, seinen ordentlich getrimmten Bart. Burge wandte sich den beiden Fahrgästen auf dem Rücksitz zu.
»Fahren wir nicht gleich los?«, fragte Karlsson.
»Noch nicht. Was soll das alles?«
»Ich weiß nicht, was Sie meinen.«
»Polizeipräsident Crawford ruft mich zu Hause an. Der Polizeipräsident. Ich bin ihm nie begegnet, kenne ihn nicht mal vom Sehen. Trotzdem ruft er bei mir zu Hause an und fordert mich auf, alles liegen und stehen zu lassen, um an einen Tatort zu eilen und die Ermittlungen in einem Fall zu leiten, von dem ich noch gar nichts gehört habe. Und nicht nur das. Unterwegs soll ich außerdem eine Kollegin auflesen, die ich nicht kenne, und dann auch noch einen Kollegen, der eigentlich gerade krankgeschrieben ist. Es geht um Frieda Klein, hat er gesagt. Sie müssen aufpassen, hat er gesagt, es geht um Frieda Klein.«
Sie legte eine Pause ein.
»Was genau wollen Sie wissen?«, fragte Karlsson, der es vor Ungeduld kaum noch aushielt.
»Worauf lasse ich mich da ein?«
»Wenn Crawford Sie persönlich mit der Leitung beauftragt, dann muss das bedeuten, dass er Gutes über Sie gehört hat. Sollten wir also nicht zu diesem Tatort aufbrechen?«
»Wer ist Frieda Klein?«
Karlsson und Yvette Long sahen sich an.
»Ist das eine schwierige Frage?«, hakte Burge nach.
»Sie ist Psychotherapeutin«, antwortete Karlsson zögernd.
»Und in welcher Verbindung stehen Sie zu ihr?«
Karlsson holte tief Luft.
»Sie war in diverse polizeiliche Ermittlungen involviert.«
»Als Ermittlerin oder als Verdächtige?«
»Im Grunde ein wenig von beidem«, warf Yvette ein.
»Das ist nicht fair«, meinte Karlsson.
»Na ja, es stimmt aber, denken Sie doch nur an …«
»Halt«, fiel ihr Burge ins Wort. »Ich will nur eines wissen: Wieso mischt sich der Polizeipräsident da persönlich ein? So läuft das normalerweise nicht. Und warum warnt er mich?«
Karlsson und Yvette wechselten erneut einen Blick.
»Ich habe schon mehrfach mit Frieda zusammengearbeitet«, begann er.
»Wir beide«, wandte Yvette ein.
»Ja, wir beide. Sie besitzt gewisse Fähigkeiten. Ganz besondere Fähigkeiten. Aber manche Leute finden Frieda …«, er machte eine Pause. Was war das richtige Wort?
»Unglaublich schwierig«, schlug Yvette vor.
»Das ist jetzt ein bisschen heftig formuliert«, entgegnete Karlsson.
»Sie bringt die Leute gegen sich auf«, versuchte Yvette es erneut.
»Sie kann nichts dafür«, kommentierte Karlsson, an Burge gewandt. »Jedenfalls nicht viel. Reicht Ihnen das?«
Burge nickte dem Fahrer zu, woraufhin sich der Wagen in Bewegung setzte.
»Wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen?«, fragte sie.
Karlsson warf einen Blick auf seine Armbanduhr.
»Vor etwa drei Stunden.«
Burge drehte sich abrupt um.
»Wie bitte?«
»Sie war an einer Ermittlung beteiligt.«
»Was für einer Ermittlung?«
»Sie hat versucht, eine Unschuldige aus dem Gefängnis zu bekommen.«
»Welche Unschuldige?«
»Es handelte sich um den Hannah-Docherty-Fall.«
»Den Docherty-Fall? Das war Frieda Klein?«
»Ja.«
»Das ist aber nicht gut gelaufen.«
»Nein.« Es herrschte einen Moment Schweigen. Karlsson schwirrte der Kopf. Es gab so viele Fragen.
»Die Leiche«, begann er. »Ist es jemand aus Friedas Bekanntenkreis?«
»Warum wollen Sie das wissen?«, fragte Burge. »Haben Sie einen Verdacht?«
»Eigentlich nicht.«
Es wurden keine weiteren Worte gewechselt, bis der Wagen von der belebten Euston Road abbog und sie sich einer Art Dunstglocke aus blitzendem Blaulicht näherten. Der Wagen hielt am Straßenrand. Als Karlsson die Tür öffnete, drehte Burge sich noch einmal zu ihm um.
»Sind Sie beide hier, um mir zu helfen oder ihr?«
»Geht nicht beides?«
»Wir werden sehen. Vielleicht können Sie mir bei Gelegenheit mal erklären, warum Sie eine Psychotherapeutin für kriminalistische Ermittlungen engagieren.«
»Ich habe sie nicht direkt engagiert.«
»Sie sollten sie nicht nach Ihrem ersten Eindruck beurteilen«, warf Yvette ein, »und nach dem zweiten eigentlich auch nicht.«
Mit einem irritierten Kopfschütteln öffnete Burge ihre Tür und eilte voraus. Karlsson brauchte länger, um sich nach draußen und auf seine Krücken zu hieven. Yvette folgte ihm. Er hörte sie hinter sich schwer atmen. Auf dem Gehsteig hatte sich bereits eine Schar Schaulustiger versammelt, zurückgehalten vom Absperrband und etlichen uniformierten Beamten. Es stimmte also. Schlagartig überkam ihn ein Gefühl von Ruhe und Distanz. Das war seine Welt. Er fand sein Gleichgewicht auf den Krücken und humpelte in schnellem Tempo auf den Tatort zu. Blitzlichter flammten auf. Die Medien waren bereits vor Ort. Wie hatten sie davon Wind bekommen? Einer der Fotografen war auf eine Mauer geklettert und hockte nun dort oben.
Ein junger Beamter kontrollierte den Zutritt hinter die Absperrung. Burge zückte nur rasch ihren Ausweis und stürmte an ihm vorbei. Karlsson kam sich vor wie ein alter, kranker Mann, während er, auf eine seiner Krücken gestützt, seinen eigenen Ausweis herausfischte. Der Mann griff danach und begann mit großem Brimborium, Karlssons Namen in sein Protokollbuch zu schreiben.
»Warum haben Sie sie nicht aufgehalten?«, fragte Karlsson und deutete dabei auf Burge.
»Sie leitet die Ermittlungen«, erwiderte der Mann. »Wir haben schon auf sie gewartet.« Nach einem hastigen Blick auf seine Armbanduhr notierte er auch noch die Zeit, ehe er Karlsson seinen Ausweis zurückgab. Bei Yvette verfuhr er ebenso. Karlsson hatte plötzlich das Gefühl, irgendwie wieder im Dienst zu sein, aber doch nicht richtig.
Mittlerweile befand er sich in der kleinen Gasse, wo seine Krücken auf den nassen Pflastersteinen rutschten. Vor den Garagen stand ein Krankenwagen mit geöffneten Türen. In seinem Inneren beugte sich ein Sanitäter über irgendetwas. Während sie auf das Haus zustrebten, traf ein weiterer Krankenwagen ein. Sein Licht ließ die enge Gasse seltsam fremd wirken: für einen Moment in Blau getaucht, dann wieder in Dunkelheit versunken. Karlsson registrierte rundherum Gestalten, zielstrebig, aber schweigsam. Aus den gegenüberliegenden Fenstern sah er Gesichter herabstarren.
Neben der Tür lehnte ein Mann an der Wand. Er trug einen weißen Overall, hatte jedoch seine Kapuze in den Nacken geschoben und auch seinen Mundschutz nach unten gestreift, sodass er ihm nun um den Hals hing. Der Mann sog gierig an seiner Zigarette, blies den Rauch aus, sog erneut.
»Wo ist die Spurensicherung?«, fragte Burge.
»Ich gehöre dazu«, antwortete der Mann.
»Was machen Sie dann hier draußen?«
»Ich musste einen Moment raus.«
»Sie sollten da drin sein.«
Der Mann musterte erst Burge und dann die beiden Personen in ihrer Begleitung. Sogar in dem schwachen Licht, das von den Fahrzeugen und Straßenlampen bis zum Haus fiel, nahmen sie den Graustich seines schweißbedeckten Gesichts wahr. Er sah aus, als müsste er sich gleich übergeben.
»Ich untersuche sonst hauptsächlich Raubüberfälle«, erklärte er, »und Verkehrsunfälle. So was wie hier habe ich noch nie gesehen.«
Burge wandte sich zu Karlsson und Yvette um und schnitt eine Grimasse.
»Wir müssen rein«, drängte Yvette in scharfem Ton.
Der graugesichtige Beamte führte sie zur offenen Tür eines größeren Einsatzfahrzeugs. Karlsson war vor Ungeduld und Beklemmung schon ganz hektisch. Ohne Yvette und den Beamten der Spurensicherung hätte er es nicht geschafft, den Overall über seinen Anzug zu ziehen, die Papierschuhe überzustreifen und dann den Gesichtsschutz und die Latexhandschuhe anzulegen. Als er schließlich auf die Haustür zusteuerte, versuchte Yvette ihn zu stützen, doch er schob sie weg. Er drückte auf den Klingelknopf, wie er es schon so viele Mal getan hatte. Die Tür schwang auf.
2
Karlsson holte tief Luft und trat ins Haus. Das grelle Licht der an Ständern befestigten Strahler blendete ihn, und der Gestank knallte ihm wie ein Faustschlag ins Gesicht. Schlagartig überfiel ihn eine Erinnerung: In einem heißen Sommer hatte er einmal den Deckel einer Mülltonne angehoben, in der schon tagelang Reste von Fisch und Fleisch verrotteten, und dabei einen Luftschwall abbekommen, dessen süßlicher Verwesungsgeruch einen sofort zurücktaumeln und würgen ließ.
Inzwischen gewöhnten sich seine Augen an das gleißende Licht, und er registrierte etliche menschliche Gestalten in weißen Overalls. Burge trat auf eine von ihnen zu. Die beiden sprachen kurz miteinander. Was sie sagten, konnte Karlsson nicht verstehen. Burges Gesprächspartner hielt eine sperrige Kamera in Händen. Als diese plötzlich aufblitzte und dann gleich noch einmal, hatte Karlsson einen Moment bläuliche Lichtspiralen vor Augen. Er war viele Male in dem Raum gewesen, doch in der grellen Laborbeleuchtung, die jede Unebenheit, jeden Riss und sonstigen Makel deutlich hervortreten ließ, wirkten die Wände und die Zimmerdecke ganz anders als sonst.
Die weiß gekleideten Gestalten um ihn herum schenkten den Wänden jedoch keine Beachtung, sondern starrten alle hinunter auf den Boden. Karlsson folgte ihrem Beispiel. Zunächst begriff er nicht: Warum waren die Bodendielen entfernt worden? Warum war der Gestank so penetrant? Karlsson empfand einen Anflug von Panik und dann, als er einen Blick auf das erhaschte, was in der Lücke im Boden lag, eine Welle der Erleichterung, die durch seinen ganzen Körper flutete. Er bekam weiche Knie. Benommen lehnte er sich auf seine Krücken, vollkommen durch den Wind.
Burge hatte ihn bereits darüber informiert, dass es sich nicht um Frieda handelte – dass Frieda Klein nicht tot war. Trotzdem fühlte es sich anders an, nachdem er sich nun selbst davon überzeugt hatte. Neben sich hörte er Yvette etwas sagen, ihn beim Namen nennen, doch den Sinn ihrer Worte begriff er nicht. Er konnte in dem Moment weder denken noch fühlen, sondern stand einfach nur da und wartete, bis sich die Welt um ihn herum wieder einpendelte. Dann zwang er sich, den Tatort genauer zu inspizieren.
Alles wirkte schräg und seltsam. Da war kein richtiger Fußboden mehr. Die Dielen in der Raummitte waren entfernt und auf einer Seite aufgetürmt worden – nicht zu einem ordentlichen Stapel, sondern zu einem wilden Haufen. Karlsson beugte sich vor und starrte in das Loch hinunter. Er konnte die Trägerbalken sehen. Oder sagte man da anders? Schwellen? Sein Gehirn schien nur in Zeitlupe zu arbeiten. Bleib ruhig, ermahnte er sich selbst. Atme. Denk nach. Dafür bist du doch ausgebildet. Unter dem Holz war unglaublicherweise Londoner Erde zu sehen. Häuser sind viel zu dünne, zerbrechliche Gebilde, um die Welt auszusperren, ging ihm durch den Kopf.
Da war sie, eingepfercht in einen der rechteckigen Zwischenräume: die Leiche eines Mannes. Aber irgendwie stimmte nichts. Die Augen waren gelb, ohne jede Transparenz, starr nach oben gerichtet. Die Gesichtshaut wirkte wächsern und fahl, durchsetzt von bläulichen Flecken. Der aufgeblähte Torso fand kaum noch Platz in dem blauen Hemd, das dunkle, feuchte Flecken aufwies. Es gab Spuren von Bewegung: fette, surrende Fliegen und auf dem Boden rund um die Leiche Maden, die sich zum Teil wanden, zum Teil reglos dalagen, vermutlich tot. Obwohl er es eigentlich nicht wollte, sah Karlsson genauer hin. In der einen Hand befand sich etwas, vertrocknet, ramponiert und ausgebleicht, aber dennoch eindeutig eine Blume. Ein Märzenbecher, dachte er. Der Jahreszeit entsprechend. Es war März. Sein Blick wanderte zurück zu dem schrecklichen Gesicht. Erst jetzt bemerkte er, dass beide Ohren fehlten. Jemand hatte sie abgeschnitten.
Neben der Lücke im Fußboden kniete eine Gestalt in Schutzkleidung, damit beschäftigt, in einer mittelgroßen weißen Kiste zu wühlen. Karlsson kannte sich damit aus. Die Kiste enthielt Beweismitteltüten, Behälter für feuchtes und trockenes Beweismaterial. Er setzte zum Sprechen an, rief sich aber rasch ins Gedächtnis, dass von seiner Stimme kaum mehr als ein Nuscheln zu hören sein würde. Als er daraufhin seinen Mundschutz nach unten schob, wurden die Gerüche sofort intensiver – noch widerwärtiger und süßlicher. Karlsson hatte das Gefühl, sich gleich übergeben zu müssen. Du bist Chief Inspector, ermahnte er sich selbst. Du kannst unmöglich einen Tatort vollkotzen. Er holte tief Luft, bereute es aber sofort.
»Wie lange liegt die Leiche schon hier?«, fragte er.
Die Gestalt blickte hoch und sagte etwas, das er nicht verstand. Er machte eine hilflose Handbewegung.
»Der Gerichtsmediziner ist bereits unterwegs«, antwortete die Stimme, die eher weiblich klang.
Karlsson wurde bewusst, dass Burge neben ihn getreten war.
»Wo ist Klein?«, fragte sie.
Die Gestalt deutete auf eine Tür, die aus dem vorderen Bereich des Hauses in den hinteren führte. Karlsson zog seinen Mundschutz wieder hoch, um besser gegen den grässlichen Gestank gewappnet zu sein. Er und Burge traten durch die Tür in die Küche. Frieda Klein saß in ziemlich aufrechter Haltung am Tisch. Es war ein seltsames Gefühl, von jenem Ort der Zerstörung und Verwesung in diesen Raum der Ordnung zu wechseln, wo ein Basilikumtöpfchen auf dem Fensterbrett stand, eine Katze sachte Wasser aus einer Schale schlabberte und orangerote, erst halb offene Tulpen in einer Keramikvase den Tisch zierten. Einen Moment kam es Karlsson so vor, als handelte es sich dabei um eine Bühnenkulisse, während hinter ihm der Schrecken der Realität lauerte. Ganz langsam wandte Frieda den Kopf und blickte ihnen entgegen. Ihre wachsamen dunklen Augen machten Karlsson immer ein wenig nervös, selbst wenn sie lächelten. Nun aber lächelten sie nicht. Friedas Haut wirkte noch bleicher als sonst. Außerdem war irgendetwas an ihrem Gesichtsausdruck anders, fand Karlsson. Dann begriff er: Sie erkannte ihn nicht, obwohl er auf seinen Krücken angehumpelt kam. Er zog seine Kapuze zurück und streifte die Schutzmaske ab, die Mund und Nase bedeckte. Frieda reagierte mit dem Anflug eines Lächelns, sagte jedoch nichts. Burge trat auf sie zu, stellte sich vor und ließ sich dann gegenüber Frieda am Küchentisch nieder.
»Fühlen Sie sich in der Lage, mit uns zu sprechen?«, begann sie.
»Ja.«
»Sie werden eine vollständige Aussage machen müssen, aber vorab bräuchte ich schon ein paar Informationen von Ihnen. Schaffen Sie das?«
»Kann ich zuerst mit meinen Freunden sprechen?«
»Als Erstes müssen Sie mit mir sprechen.«
»In Ordnung.«
»Sie machen einen recht ruhigen Eindruck«, bemerkte Burge. Friedas Augen schienen noch eine Nuance dunkler zu werden.
»Ist das ein Problem?«, gab sie zurück.
»In Ihrem Haus wurde eine Leiche entdeckt. Die meisten Menschen fänden das sehr beängstigend und schockierend.«
»Tut mir leid«, erwiderte Frieda. »Großes Brimborium liegt mir nicht.«
Von draußen drang ein Geräusch herein. Als Burge den Kopf wandte, sah sie, dass in Friedas kleinem Garten hinter dem Haus eine Gestalt im strömenden Regen stand. Eine Zigarette glühte auf.
»Wer ist das?«
»Ein Freund von mir. Er heißt Josef Morozov. Josef hat die Leiche gefunden und ist deswegen noch ziemlich durcheinander.«
»Wie kommt es, dass er derjenige war, der sie gefunden hat?«
Frieda hob beide Hände an den Kopf und massierte sich die Schläfen. Burge begriff, dass sie es gerade so schaffte, sich zusammenzureißen.
»Ich bin vor ein paar Stunden nach einem schweren Tag nach Hause gekommen. Da fiel mir ein Geruch auf. Ich konnte mir nicht erklären, woher er kam. Josef ist Bauarbeiter. Er hilft mir manchmal, wenn am Haus etwas zu machen ist. Auf meine Bitte hin hat er vorbeigeschaut und eine Bodendiele gelöst. Ich hatte den Verdacht, es könnte sich um eine Ratte handeln.«
»Wissen Sie, wer der Tote ist?«
»Ja. Ein ehemaliger Polizist namens Bruce Stringer.«
Burge zögerte kurz. Ihr war nicht ganz klar, wo sie anfangen sollte.
»Haben Sie irgendeine Idee, wer so etwas tun könnte? Und warum die betreffende Person die Leiche eines ehemaligen Polizisten in Ihrem Haus deponieren sollte?«
Nun war es an Frieda zu zögern. Burge registrierte, dass ihr Blick zu Karlsson wanderte, der mit einem leichten Nicken reagierte.
»Entschuldigung«, sagte Burge, »aber verpasse ich gerade etwas?«
»Schon gut«, entgegnete Frieda. »Sie sollen ruhig wissen, wie ich die Sache sehe. Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass Stringer von einem Mann namens Dean Reeve getötet wurde. Haben Sie von ihm gehört?«
»Ist das jetzt Ihr Ernst?«, gab Burge zurück.
»Ja, ich bin tatsächlich dieser Überzeugung.«
»Jeder hat von Dean Reeve gehört«, erwiderte Burge. »Er war verantwortlich für eine Serie von Entführungen und möglicherweise auch für einen Mord. Das Problem ist, dass er vor sieben Jahren Selbstmord begangen hat.«
Frieda schüttelte den Kopf.
»Wenn Sie in Ihr Büro zurückkehren, werden Sie feststellen, dass es über mich eine dicke Akte gibt. Unter anderem steht in dieser Akte, dass ich seit Längerem hartnäckig versuche, die Leute davon zu überzeugen, dass Dean Reeve noch am Leben ist und weitere Morde begangen hat.«
Burge sah Karlsson an.
»Glauben Sie das?«
»Ja, das tue ich«, antwortete Karlsson.
»Mal angenommen, es stimmt. Warum sollte er dann diesen Mann töten und sich die Mühe machen, ihn in Ihrem Haus zu verstecken?«, fuhr Burge an Frieda gewandt fort.
Frieda strich sich mit einer Hand über die Augen und holte tief Luft, als versuchte sie mühsam, die Fassung zu wahren. Ihre Antwort klang dann tatsächlich gefasst, kostete sie aber wohl extrem viel Kraft.
»Bruce Stringer hat mir bei meiner Suche nach Dean Reeve geholfen, und ich schätze mal, er war erfolgreich. Meiner Meinung nach hat Dean Reeve die Leiche hier abgelegt, um mir auf diese Weise eine Nachricht zu übermitteln.«
»Was für eine Nachricht?«
»›Das kommt dabei heraus, wenn du nach mir suchst.‹«
Burge erhob sich.
»Ich schicke Ihnen einen Wagen. Sie müssen eine richtige Aussage machen. Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie den Leuten erzählen. Selbst Ihren Freunden gegenüber. Gehen Sie nirgendwohin. Sprechen Sie nicht mit der Presse. So, und ich mache mich jetzt auf den Weg und sehe mir Ihre Akte an.«
Mit einem Nicken in Karlssons Richtung verließ sie den Raum. Karlsson lehnte seine Krücken gegen eine Arbeitsplatte und setzte sich an den Tisch, dessen Fläche so gut wie leer war, abgesehen von dem Wasserglas vor Frieda und einem Whiskyglas sowie der dazugehörigen Whiskyflasche. Karlsson beugte sich Frieda ein wenig entgegen, doch weder er noch sie sagten ein Wort. Schließlich streckte sie eine Hand aus, und Karlsson nahm ihre Finger zwischen seine. Frieda schloss einen Moment die Augen.
»Warum kannst nicht du die Ermittlungen leiten?«
»Das wäre nicht richtig.«
Die Tür, die in den Garten hinter dem Haus führte, ging auf, und Josef kam herein. Er wirkte immer noch benommen. Seine Kleidung war durchnässt, das Haar klebte ihm am Kopf. Karlsson deutete auf einen Stuhl.
Josef sah ihn mit leerem Blick an, ließ sich schwer auf den Stuhl fallen, griff nach der Flasche und goss Whisky in das Glas. Nachdem er es in einem Zug ausgetrunken hatte, schenkte er sich sofort nach.
»Ich habe die Bretter rausgenommen.«
Seine Stimme klang belegt, seine braunen Augen glühten.
»Das war bestimmt …« Karlsson hielt inne. Alles, was er hätte sagen können, lag ohnehin auf der Hand.
»Ich habe schon drei Whiskys intus«, erklärte Josef. »Und jetzt trinke ich noch mal drei.«
»Ist das da draußen dein Lieferwagen?«, fragte Karlsson.
»Ich hab mein Werkzeug mitgebracht.«
»Vielleicht solltest du mit dem Bus heimfahren.«
»Wie geht es jetzt weiter?«, meldete sich Frieda zu Wort. »Jemand wird vorbeikommen und dich auf Spuren untersuchen. Vorausgesetzt, du willigst ein. Möglicherweise brauchen sie auch deine Kleidung.« Sein Blick wanderte zu Josef. »Deine auch.«
Josef leerte erneut sein Glas. »Meine?«
»Sie organisieren dir irgendetwas anderes zum Anziehen. Und Fingerabdrücke werden sie auch nehmen. Und Haarproben. Außerdem wird man von euch beiden eine Aussage wollen. Das kann eine Weile dauern.«
Die Tür ging auf, und Yvette betrat den Raum. Sie streifte ihre Schutzmaske ab und steuerte auf Frieda zu. Ihr Gesicht wirkte fleckig. Karlsson sah Schweißperlen auf Stirn und Oberlippe glänzen.
Als sie das Wort an Frieda richtete, klang ihre Stimme vor Verlegenheit und Kummer überlaut.
»Wenn du mit jemandem darüber sprechen möchtest …«, begann sie.
»Danke.«
»Ich bin wahrscheinlich die Letzte, die du dir aussuchen würdest, aber wenn du …«
Yvette brachte nichts weiter heraus. Frieda tätschelte ihr die Hand, wie um sie zu trösten.
Josef hielt Yvette das Whiskyglas hin, woraufhin sie einen großen Schluck nahm und dann heftig hustete. Ihre Augen tränten.
»Mehr?«, fragte Josef ermutigend.
Sie schüttelte den Kopf. »Eigentlich mag ich Whisky überhaupt nicht. Ich bekomme davon immer einen Ausschlag. Der Polizeipräsident verlangt nach dir«, fügte sie an Karlsson gewandt hinzu.
Seufzend zog er seine Krücken zu sich heran. »Bis bald«, verabschiedete er sich von Frieda.
Sie nickte, gab ihm aber keine Antwort. Ihr bleiches Gesicht wirkte völlig ausdruckslos, während sie ihn mit ihren dunklen, durchdringenden Augen anstarrte. Er war nicht sicher, ob sie ihn überhaupt wahrnahm.
3
Sie wissen, was das bedeutet, Mal?« Das Gesicht von Polizeipräsident Crawford wirkte gerötet. Er zerrte an seiner Krawatte, um sie zu lockern.
Karlsson nickte.
»Man hat mich aus einem Abendessen in der Guildhall geholt. Dabei hatte ich meinen gottverdammten Lachs encroute erst zur Hälfte gegessen.«
Er nahm einen Kaffeebecher vom Schreibtisch und betrachtete ihn.
»Könnte ich einen frischen Kaffee haben?«, rief er jemandem zu, den Karlsson nicht sehen konnte. »Möchten Sie auch einen?«
»Nein danke.«
»Ich weiß, was Sie denken.«
»Tatsächlich?«
»Und ich weiß, was sie denkt.«
»Wer?«
»Ihre Frieda Klein bildet sich bestimmt ein, dass sie jetzt gewonnen hat. Sie hatten recht, Mal, und Ihre heiß geliebte Frau Doktor Klein auch.«
»Ich glaube nicht, dass das im Moment ihre Gedanken beherrscht.«
Crawford erhob sich von seinem Schreibtisch und trat ans Fenster. Karlsson schwang auf seinen Krücken zu ihm hinüber und stellte sich daneben. Es gab nicht viel zu sehen – bloß den Parkplatz des Polizeipräsidiums, umgeben von einer hohen Mauer, die gekrönt war von NATO-Draht.
»Konnten Sie einen Blick auf die Leiche werfen?«
»Ja.«
»Sie lag tatsächlich unter den Bodendielen?«
»Ja, tatsächlich.«
»Das gibt eine große Story. Die Presse liebt so etwas. Die Leiche unter dem Fußboden. Was, glauben Sie, wird Doktor Klein sagen?«
»Wozu?«
Crawford sah ihn stirnrunzelnd an. »Dazu. Zu dem Fall. In Bezug auf mich.«
»In Bezug auf Sie? Wie meinen Sie das?«
»Ich bin dafür verantwortlich, dass die Ermittlungen im Fall Dean Reeve eingestellt wurden. Ich wollte ihr keinen Glauben schenken. Jetzt hat mich Frieda Klein da, wo sie mich haben wollte. Ich wette, nun lacht sie sich ins Fäustchen.«
»Commissioner, ich kann Ihnen wirklich versichern, dass sie nicht lacht und dass sie im Moment gar nicht in erster Linie an Sie denkt.«
Crawford fuhr fort, als hätte er Karlssons Einwand nicht gehört.
»Sie kennen die Frau doch. Wir müssen uns überlegen, wie wir das handhaben wollen.«
»Die einzig richtige Art, das zu handhaben, besteht darin, das Verbrechen aufzuklären.«
»Ja, stimmt.« Crawford holte ein großes weißes Taschentuch heraus, faltete es umständlich auseinander, wischte sich damit die Stirn ab und verstaute es wieder. Als er schließlich weitersprach, tat er das im Flüsterton, als spräche er mit sich selbst.
»Ich habe eine Spitzenkraft auf den Fall angesetzt. Eine richtig gute. Sind Sie ihr schon begegnet?«
»Ja, bin ich.«
»Eine Frau. Das sorgt vielleicht für ein bisschen Gegengewicht.«
»Wir brauchen einfach nur jemand Guten.«
»In der Tat«, bestätigte Crawford. »Ich kämpfe hier nämlich um mein Leben.«
Eine halbe Stunde später sah Karlsson beim Verlassen des Präsidiums, wie Frieda aus einem Streifenwagen stieg und dann in Begleitung eines Beamten die Treppe heraufkam. Als sie neben ihm stehen blieb, legte er ihr eine Hand auf den Arm. Der fühlte sich seltsam steif an, wie ein Stück Holz. Frieda musterte ihn einen Moment fragend, als müsste sie überlegen, wer er war.
»Ich brauche jemanden, der nach meiner Katze schaut«, sagte sie schließlich.
»Ich kümmere mich darum.«
Frieda wurde in einen kleinen Raum geführt. In der Ecke stand ein Topf mit einer Birkenfeige. Sie registrierte, dass die Pflanze gegossen gehörte. Die Jalousien waren heruntergelassen, und auf dem Tisch stand eine Schachtel Papiertaschentücher. Wie bei einer Therapiesitzung, ging ihr durch den Kopf. All die Tränen. Jemand kam mit einem Krug Wasser und zwei Gläsern herein. Sie wurde gefragt, ob sie Tee wolle, was sie verneinte. Oder Kaffee? Nein. Kekse? Sie wollte auch keine Kekse. An der Wand hing eine Uhr: Sie zeigte zehn vor zwölf.
Frieda zog ihren langen Mantel aus und hängte ihn an den Haken an der Tür. Nachdem sie auf einem der Stühle Platz genommen hatte, schenkte sie sich ein Glas Wasser ein. Ihre Hände waren ganz ruhig, ihr Herzschlag normal. Draußen hörte sie den Regen prasseln. Der Minutenzeiger der Uhr rückte vor.
Um vier Minuten vor Mitternacht schwang die Tür auf, und ein hochgewachsener junger Mann stand im Rahmen. Er hatte breite Schultern, markante dunkle Augenbrauen und eine Nase, die aussah, als wäre sie irgendwann in der Vergangenheit mal gebrochen und nicht wieder ordentlich gerichtet worden. Als er weiter in den Raum trat, sah Frieda, dass er ein Tablett mit drei Pappbechern Kaffee trug. Petra Burge folgte ihm auf dem Fuße. Sie ließ einen Lederrucksack von der Schulter gleiten und auf den Boden fallen.
»Das ist mein Kollege, Don Kaminsky. Einer von diesen Kaffeebechern ist für Sie. Ich kann Milch für Sie organisieren, wenn Sie welche brauchen.«
»Danke, nicht nötig.«
Petra nahm einen Schluck von ihrem eigenen Kaffee.
»Sogar Einbrüche sind traumatische Erlebnisse«, erklärte sie. »Die Leute fühlen sich in ihrer Privatsphäre verletzt. Entblößt.«
»Ich habe davon gelesen.«
»Und hier geht es um eine Leiche – noch dazu um jemanden, den Sie kannten.«
»Das stimmt.«
Petra Burge musterte sie einen Moment aus schmalen Augen. Dann nickte sie.
»Fühlen Sie sich in der Verfassung, eine erste Aussage zu Protokoll zu geben? Ich würde gern gleich loslegen, es sei denn …«
»Mir geht es wie Ihnen«, fiel ihr Frieda ins Wort.
»Gut.« Sie nahm Frieda gegenüber Platz und holte einen Notizblock aus ihrem Rucksack. »Don wird alles, was Sie sagen, ordnungsgemäß protokollieren, aber es könnte sein, dass ich mir auch ein paar Notizen mache. Ist das für Sie in Ordnung? Am Schluss werden wir Sie bitten, Ihre Aussage zu unterschreiben.«
»Ja, natürlich.« Frieda griff nach einem der Kaffeebecher. Sie fror bis in die Knochen, und das warme Getränk hatte etwas Tröstliches. »Jetzt trinke ich doch einen.«
Nach gut zwei Stunden ließ sich DCI Burge zurücksinken.
»Wir sind fertig. Bestimmt sind Sie erschöpft.«
»Eigentlich nicht.« Tatsächlich hatte Frieda das Gefühl, nach wie vor scharf und klar denken zu können.
»Sie hatten einen schlimmen Tag und sollten schlafen.«
»Ich muss ein Stück marschieren.«
»Ich glaube, es regnet immer noch.« Burge warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Außerdem ist es schon fast halb drei.«
»Ich weiß.«
Burge musterte Frieda ein paar Sekunden und wandte sich dann an ihren Kollegen. »Don, schau doch mal nach, wer Zeit hat.«
»Zeit wofür?«, fragte Frieda, während Don Kaminsky abzog. Aber Burge gab ihr keine Antwort, sondern studierte aufmerksam die paar Worte, die sie sich auf ihrem Block notiert hatte, umgeben von etlichen Kritzeleien. Dabei wirkte ihr schmales Gesicht sehr streng und nachdenklich.
Kaminsky kehrte mit einer jungen Polizistin zurück. Sie hatte aschblondes Haar, gerötete Wangen und einen nervösen Gesichtsausdruck. Burge stellte sie als PC Fran Bolton vor. Frieda schüttelte ihr die Hand und registrierte dabei nicht nur den schlappen Händedruck, sondern auch die abgekauten Fingernägel der jungen Frau. Fran Bolton wirkte müde und blass, als hätte man sie wach gehalten, obwohl es für sie eigentlich längst Schlafenszeit war. Burge sah sie an.
»Bitte ziehen Sie sich um, wir brauchen Sie in Zivil.«
Die junge Beamtin verließ den Raum.
»Fran Bolton wird Sie begleiten.«
»Ich benötige keine Begleitung.«
»Unter Ihrem Fußboden wurde eine Leiche gefunden, und Sie sind der Meinung, sie wurde vom Mörder, nämlich Dean Reeve, dort platziert. Wenn Sie mit einer uniformierten Beamtin herumlaufen, wird das Aufsehen erregen. Die Leute werden sich fragen, was da los ist. Man wird vermuten, dass Sie unter Arrest stehen oder dass etwas Schlimmes passieren könnte. Wobei das natürlich einen gewissen Abschreckungseffekt hätte. Schwer zu sagen, ob es eher schädlich oder nützlich wäre.«
»Dean Reeve würde sich von einer Uniform bestimmt nicht abschrecken lassen.«
Als die Beamtin schließlich zurückkehrte, trug sie eine braune Cordjacke über einer dunklen Hose und sah damit noch jünger aus als vorher. Frieda hatte überlegt, zum Fluss hinunterzugehen, entlang der Uferbefestigung in Richtung Osten und dann am Kanal entlang zurück, entschied nun aber, dass sie dieser jungen Polizistin keinen stundenlangen Marsch durch Wind und Regen zumuten durfte. Auch konnte sie sich kaum vorstellen, dass sie ihr als Beschützerin viel nützen würde. Klein und schmal gebaut, sah sie aus wie ein Schulmädchen beim ersten Berufspraktikum. Immerhin war sie mit einem Funkgerät ausgestattet. Damit konnte sie vielleicht Hilfe anfordern. Trotzdem kam es bei nächtlichen Wanderungen eigentlich darauf an, dass man alleine marschierte.
»Schon gut. Ich verzichte auf den Fußmarsch.«
»Dann organisiere ich Ihnen jetzt eine Übernachtungsmöglichkeit. Nur für heute«, fügte Petra hinzu.
»Das heißt, morgen kann ich nach Hause?«
»Auf gar keinen Fall. Morgen oder vielleicht auch erst übermorgen haben wir etwas Längerfristigeres für Sie.«
»Das klingt nicht gut.«
Burge neigte den Kopf zur Seite, als versuchte sie, Frieda aus einem anderen Winkel zu betrachten. »So wird es aber sein.«
»Für heute brauche ich keine Übernachtungsmöglichkeit. Das habe ich schon geregelt.«
»Geben Sie mir die Adresse. Wir werden zwei Leute vor dem Haus postieren.«
»Allen Ernstes?«
Petra Burge zögerte einen Moment. »Ich war schon oft in dieser Situation«, erklärte sie schließlich. »Im Gespräch mit Betroffenen, nach einem Verbrechen, einem Leichenfund, einem Hausbrand, solchen Sachen. Manchmal weinen die Leute, oder sie sind wütend oder verängstigt. Manche machen auch einfach dicht. Aber Sie sind …«, sie suchte nach dem passenden Wort, »… normal. Ruhig.«
Frieda musterte sie ein paar Sekunden. »Wie reagieren Sie denn, wenn etwas Schreckliches passiert?«
Burge hob nachdenklich die Augenbrauen. »Ich stehe dann extrem unter Strom.«
»Ich werde ganz ruhig«, entgegnete Frieda. »Das habe ich im Lauf der Zeit festgestellt.«
»Sie klingen, als sprächen Sie über jemand anderen.«
»Nein, ich spreche sehr wohl über mich selbst.«
Im Wagen fragte Bolton, wohin es gehe.
»Zu einem Mann namens Reuben McGill«, erklärte Frieda. »Er ist ein alter Freund. Außerdem wohnt da auch noch ein anderer Freund von mir, Josef Morozov.«
»Oh«, sagte Bolton. »So ist das also.«
»Nein, so ist das nicht. Aber ich sollte Ihnen von Reuben erzählen. Sie vielleicht sogar vor ihm warnen.« Sie registrierte Boltons Gesichtsausdruck. »Er ist nicht gefährlich oder so was. Sie wissen sicher, dass man während der Ausbildung zum Psychotherapeuten selbst eine Therapie machen muss. Drei Jahre lang war ich bei Reuben in Therapie, fünf Tage die Woche. Er war wichtig für mich, und wir wurden Freunde. Tief in seinem Innern ist er ein intelligenter, sensibler Mann, aber wenn man ihn zum ersten Mal trifft, merkt man das nicht immer gleich. Das ist alles.«
4
Obwohl es drei Uhr morgens war, als der Wagen vor Reubens Haus eintraf, brannte unten überall Licht. Bevor Frieda klopfen konnte, riss Reuben bereits die Tür auf.
»Herrgott noch mal, komm rein! Schnell herein mit dir!«
Er trat vor und umarmte sie. Frieda roch seinen Duft – das Rasierwasser, das er schon seit Jahrzehnten benutzte, die Zigaretten, die er geraucht, den Wein, den er getrunken hatte. Sie schloss einen Moment die Augen und ließ sich einfach nur im Arm halten.
»Es ist so spät«, murmelte sie. »Du hättest nicht aufbleiben sollen.«
Reuben starrte sie an. »Du machst Witze, oder? Eine Leiche unter deinen Bodendielen, und da hätte ich nicht aufbleiben sollen?«
»Ich möchte nicht …«, begann Frieda, brach dann aber ab. Sie wusste selbst nicht, was sie eigentlich sagen wollte.
»Ist mit dir alles in Ordnung? Frieda?«
»Ja.«
Er legte ihr einen Arm um die Schulter, um sie ins Haus zu führen. Erst jetzt registrierte er Fran Bolton, die hinter Frieda stand und ihm ihren Ausweis hinhielt. Neugierig starrte er sie an. »Stehst du unter Arrest?«, fragte er Frieda.
»Nein, unter Schutz gestellt«, erklärte sie. »Kommen Sie mit rein?«, wandte sie sich an Fran Bolton.
»Wie Sie wollen«, antwortete diese. »Ich kann auch im Wagen bleiben.«
»Schau dir ihr trauriges kleines Gesicht an«, mischte Reuben sich ein. »Du kannst sie doch nicht draußen in der Kälte lassen.«
Er entzog Frieda seinen Arm, legte ihn stattdessen um die Schulter der verblüfften Fran Bolton und zog sie fast gewaltsam ins Haus. Drinnen saß Josef am Tisch. Aus der Flaschen- und Gläsersammlung, die er vor sich stehen hatte, schloss Frieda, dass er seine Selbstmedikation fortgesetzt hatte. Er erhob sich und schwankte mit ausgebreiteten Armen auf sie zu.
»Du bist hier. Wir sind beide hier. Am Leben, das ist das Wichtigste. Wir müssen für immer …« Er verstummte. Abrupt ließ er sich auf den nächsten Stuhl fallen, die Arme noch immer ausgestreckt.
»Ich wünschte, ihr würdet aufhören, mich ständig zu umarmen. Ich möchte nur noch unter die Dusche und dann ins Bett. Für die paar Stunden, die von der Nacht noch übrig sind.«
»Du musst total erschöpft sein«, pflichtete Reuben ihr bei.
»Ich kann gar nicht sagen, wie ich mich eigentlich fühle.«
»Unter Schock«, warf Fran Bolton ein. »Das ist ein Schocksymptom.«
»Als Erstes musst du etwas essen«, meinte Reuben.
»Nein danke.«
»Ein Omelett. Ich mache mittlerweile richtig feine Omeletts. Mit Schnittlauch. Brot und Käse habe ich auch da.«
»Meinen Mohnkuchen«, warf Josef ein, während er vergeblich versuchte, wieder aufzustehen. »Meinen Borschtsch, der noch im Kühlschrank steht.«
»Gar nichts«, widersprach Frieda.
»Setz dich«, sagte Josef. »Es gibt viel zu bereden. So viel.«
»Ja, es gibt viel zu besprechen und zu tun, aber nicht jetzt. Ich kann nicht. Ich gehe ins Bett.«
»Mit Wärmflasche«, sagte Josef. »Und Tee.«
»Könntet ihr Fran mit allem versorgen, was sie braucht?«
»Jede Freundin von dir kann von uns alles haben«, verkündete Reuben.
Sie warf einen Blick zu Fran Bolton hinüber. »Wir sehen uns in ein paar Stunden.«
Es fühlte sich länger an als ein paar Stunden. Nachdem Frieda den Wecker ihres Handys gestellt hatte, lag sie lange Zeit mit offenen Augen auf dem Bett in Reubens Gästezimmer. Eine Weile bemühte sie sich vergeblich, jeden Gedanken auszublenden. Dann versuchte sie, an langsam dahinwogende Wellen zu denken, die aus einem dunklen Meer kamen und sich leise am Ufer brachen, doch selbst durch die Wellen sah sie jenes Gesicht zu sich aufstarren. Womöglich hatte es schon tagelang unter dem Fußboden zu ihr aufgestarrt, während sie, ohne es zu wissen, darauf hin und her spaziert war. Phasenweise schlief sie, dazwischen lag sie wieder wach, aber als schließlich der Wecker schrillte, riss er sie aus irgendeinem chaotischen Traum. Sie hatte genug geschlafen, um sich benommen und wie wattiert zu fühlen, aber nicht genug, um erfrischt aufzustehen.
Trotzdem kämpfte sie sich hoch, griff nach ihren Schuhen und patschte aus dem Raum. Im Haus war es noch dunkel, abgesehen von einem schwachen Lichtschein im Erdgeschoss. Frieda ging ins Bad und riss eine frische Zahnbürste aus der Verpackung. Nachdem sie sich die Zähne geputzt und das Gesicht mit kaltem Wasser gewaschen hatte, betrachtete sie ihr Spiegelbild. Wo würde diese Person den kommenden Abend verbringen? Seltsam, keine Ahnung zu haben.
Immer noch schuhlos, schlich sie die Treppe hinunter. Fran Bolton saß im Wohnzimmer auf dem Sofa und blätterte durch einen Bildband.
»Sie haben nicht geschlafen«, stellte Frieda fest.
»Ich arbeite. Man bezahlt mich dafür, dass ich hier herumsitze.«
Frieda gefiel der säuerliche Ton, in dem sie das sagte. »Jetzt nicht mehr. Wir machen einen Spaziergang.«
Mit diesen Worten begann sie ihre Schuhe zu schnüren. Als sie kurz darauf das Haus verließen, zog Frieda die Tür so leise wie möglich hinter sich zu.
»Keine Sorge«, meinte Fran Bolton. »Ich glaube nicht, dass Sie die beiden aufwecken können.«
Frieda setzte sich in Richtung Primrose Hill in Bewegung. »War es so schlimm?«
»Ziemlich emotional. Sie haben die ganze Zeit über Sie gesprochen.«
»Das klingt nicht gut.«
»Doch, es war interessant.«
»Ich will es gar nicht wissen.«
»Außerdem hat Reuben mir erzählt, dass er Krebs hat.«
»Ja.«
»Ist es ernst?«
»Das weiß ich noch nicht so genau. Er weiß es selbst erst seit ein paar Tagen. Unter Umständen schon.«
Frieda beschleunigte das Tempo.
»Ich kann uns einen Wagen kommen lassen«, bemerkte Fran Bolton, die sichtlich Mühe hatte, Schritt zu halten.
»Ein bisschen Marschieren tut gut.«
»Wohin gehen wir?«
»Nach Holborn.«
»Das sind doch etliche Kilometer.«
»Ja.«
»Warum?«, fragte Bolton. »Ich sollte das wissen.«
»Es gibt jemanden, mit dem ich über das alles sprechen muss.«
»Ist die betreffende Person in den Fall verwickelt?«
»Es handelt sich um den Mann, der mich mit Bruce Stringer in Kontakt gebracht hat. Ich muss es ihm sagen. Bevor ich irgendetwas anderes mache, muss ich mit ihm reden.«
»Das klingt für mich, als wäre er in den Fall verwickelt.«
Frieda gab ihr keine Antwort. Sie erreichten den Park und gingen Richtung Zoo.
»Josef und Reuben, sind die beiden, Sie wissen schon …?«
»Ein Paar? Nein. Sie sind Freunde, und Josef wohnt die meiste Zeit dort.«
»Was macht Josef beruflich? Woher kennen Sie ihn?«
Frieda wandte abrupt den Kopf. »Bei Josef sollten Sie aufpassen.«
»Ich dachte, er ist Ihr Freund.«
»Das ist er, sogar ein sehr guter. Aber wenn er Frauen kennenlernt, wollen ihn die immer irgendwie bemuttern, und dann …«
»Ich will ihn nicht bemuttern.«
»Genau das meine ich.«
Sie liefen über den Kanal in den Regent’s Park. Als sie die lange Allee erreichten, die mitten durch den Park führte, deutete Frieda auf eine Bank.
»Wir sollten vorab etwas klären«, verkündete sie, sobald sie sich niedergelassen hatten. »Ich nehme an, Sie müssen Ihrer Chefin über mich Bericht erstatten.«
»Aus Ihrem Mund klingt das irgendwie negativ«, stellte Bolton fest. »Natürlich bin ich verpflichtet, meine Arbeit zu dokumentieren. Das muss Ihnen klar sein.«
»Ja, das ist mir klar.« Frieda überlegte eine ganze Weile. Als sie das Schweigen schließlich wieder brach, klang es, als würde sie laut denken. »Ich habe immer versucht, mich von allem fernzuhalten, was mit Macht und Autorität zusammenhängt. Ich schreibe anderen nicht gerne vor, was sie zu tun haben, und genauso wenig mag ich es, wenn mir jemand sagt, was ich zu machen habe. Verstehen Sie, was ich meine?«
»Ich bin bei der Polizei, deswegen …«
»Vor etwa einem Jahr steckte ich in Schwierigkeiten. Ich stand sogar unter Arrest, aber dann tauchte ein Mann namens Walter Levin auf und sorgte dafür, dass sich alle meine Probleme in Luft auflösten. Auf diese Weise tat er mir etwas sehr Gefährliches an.«
»Das verstehe ich jetzt nicht.«
»Er hatte mir einen Gefallen erwiesen. Dafür war ich ihm etwas schuldig. Im Gegenzug musste ich ihm auch einen Gefallen tun. Ich erklärte mich bereit, den Fall einer jungen Frau unter die Lupe zu nehmen, der zur Last gelegt wurde, ihre Familie ermordet zu haben.«
»Sprechen wir von dem Hannah-Docherty-Fall?«
»Ja.«
»Wie das gelaufen ist, tut mir leid.«
»Ja, mir auch. Danach habe ich ihn gefragt, ob er mir bei meiner Suche nach Dean Reeve behilflich sein könnte, woraufhin er mir Bruce Stringer empfohlen hat, und der ist jetzt tot.«
»Arbeitet der besagte Mann für die Polizei?«
»Nein.«
»Für die Regierung?«
»Ich nehme es an, aber was seine Arbeitgeber betrifft, war er immer ein wenig vage.«
»Warum?«, fragte Fran Bolton. »Ich meine, warum hat er Ihnen den Gefallen erwiesen?«
Frieda wandte ihr den Kopf zu und lächelte.
»Das ist eine gute Frage. Sie sollten Detective werden. Die Antwort lautet: Ich weiß es nicht, aber ich sollte es wissen. Er arbeitet mit einem ehemaligen Polizeibeamten namens Jock Keegan zusammen. Die beiden haben ein Büro und eine Assistentin. Irgendjemand muss das bezahlen, aber ich habe keine Ahnung, wer.«
Frieda erhob sich und gab damit das Zeichen zum Aufbruch. Sie wanderten weiter durch den Park, wo allmählich immer mehr Radfahrer, Jogger und Fußgänger mit Hunden auftauchten. Frieda fand es grundsätzlich unbefriedigend, in Begleitung zu marschieren. Für sie stellten ihre Wanderungen eine Möglichkeit dar, in Ruhe nachzudenken und gleichzeitig die Welt wie eine Spionin unter die Lupe zu nehmen. Wenn jemand dabei war, ging das nicht so gut. Allerdings war Fran Bolton in dieser Hinsicht besser, als viele andere es gewesen wären. Sie schien zumindest nicht das Bedürfnis zu haben, laufend zu kommentieren, was sie sah oder dachte. Als sie die Euston Road überquerten, versetzte es Frieda einen leichten Stich, weil sie sich so nahe an ihrem Zuhause befand. Würde sie jemals richtig dorthin zurückkehren können? Sie war nicht abergläubisch, hatte aber dennoch den Eindruck, dass Orte – einzelne Gebäude ebenso wie ganze Städte – oft von ihrer Vergangenheit geprägt wurden. Konnte sie jemals wieder in ihrem Wohnzimmer sitzen, den Holzboden unter den Fußsohlen spüren und dabei das wohltuende Gefühl haben, dass die Welt ausgesperrt blieb?
Nach Hause zu gehen hätte bedeutet, nach rechts abzubiegen, doch sie wandten sich nach links und liefen weiter, vorbei an den Universitätsgebäuden, über die vertrauten Plätze, den Kingsway entlang und dann durch den Queen Square, bis Frieda sich vor dem Haus wiederfand, in dem sie erst vor Kurzem gewesen war, auch wenn es ihr inzwischen vorkam, als läge das schon eine Ewigkeit zurück.
»Ich werde Sie draußen warten lassen müssen«, erklärte sie, »verspreche aber, DCI Burge Bericht zu erstatten, falls irgendetwas zur Sprache kommt, das für die Ermittlungen relevant sein könnte.«
»Das wäre ratsam«, entgegnete Bolton. »Allerdings glaube ich, dass DCI Burge ohnehin den Wunsch haben wird, mit ihm zu sprechen.«
»Na, da wünsche ich ihr viel Glück.«
Die Tür ging auf.
»Hallo, Jude«, sagte Frieda.
Die farbenfroh gekleidete junge Frau mit den stacheligen Haaren blickte Frieda ungewohnt düster entgegen. »Ich war mir nicht sicher, ob Sie kommen würden.«
»Das ist doch klar, dass ich in einer solchen Situation herkomme.«
Levin und Keegan saßen im vorderen Raum der Tür zugewandt, als erwarteten sie Frieda zu einem Vorstellungsgespräch. Beide trugen Anzug, Levin einen dunklen mit Nadelstreifen, der zerknautscht und staubig wirkte, Keegan einen grauen, strapazierfähigen, in dem er aussah wie der Kriminalbeamte, der er früher mal gewesen war. Levin wirkte wie immer eine Spur amüsiert. Keegans Miene war völlig ausdruckslos. Frieda nahm gegenüber den beiden Platz.
»Eine schreckliche Sache«, begann sie.
»Er wusste, was er tat.« Keegans Ton klang gleichmütig.
»Nein, das wusste er nicht. Sonst wäre er nicht umgebracht worden. Außerdem hat er es in meinem Auftrag getan. Deswegen war es mir ein Bedürfnis herzukommen und Ihnen zu sagen, wie leid es mir tut.«
»Schon gut«, antwortete Keegan.
»Hatte er Familie?«
»Eine Ehefrau, einen siebenjährigen Sohn und eine vierjährige Tochter.«
Frieda verspürte einen Schock, wie sie ihn bis dahin nicht empfunden hatte – nicht einmal, als Josef die Bodendielen entfernt und die Leiche freigelegt hatte.
»Dann hätte er das nicht machen sollen.«
»Es war seine Arbeit«, entgegnete Keegan.
Eine ganze Weile sagte keiner von ihnen etwas.
»Wie haben Sie davon erfahren?«, brach Frieda schließlich das Schweigen.
»Spielt das wirklich eine Rolle?«, gab Levin in sanftem Ton zurück.
»Ich schätze mal, Sie sind stets gut informiert.«
»Wir tun, was wir können.« Levin nahm seine Brille ab, zog ein Taschentuch heraus, hauchte auf die Gläser und polierte sie ausgiebig. »Es muss für einigen Wirbel gesorgt haben«, bemerkte er dann.
»Wirbel? O ja, es hat für einigen Wirbel gesorgt.«
Levin setzte seine Brille wieder auf und betrachtete Frieda mit einem Ausdruck, den sie nicht recht deuten konnte.
»Für Sie muss es eine schlimme Entdeckung gewesen sein«, sagte er. »Und trotzdem eine Bestätigung. In gewisser Weise.«
»Ich weiß nicht, wie Sie das meinen.«
»Ich meine, was die Existenz von Dean Reeve betrifft. Sie behaupten nun schon seit Jahren, dass er noch am Leben ist und eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt, aber niemand hat Ihnen Glauben geschenkt. Stattdessen hat man sich über Sie lustig gemacht und Ihnen übel mitgespielt. Jetzt werden sich Ihre Kritiker der Wahrheit stellen müssen.«
Frieda holte tief Luft. »Manche Leute meinen, dass ich unter posttraumatischem Stress leide, und haben deshalb das Bedürfnis, mich ständig zu umarmen und zu trösten. Das wirkt auf mich beklemmend. Aber ein Gefühl von Bestätigung empfinde ich bisher nicht.«
»Verstehe.« Levin nickte ein-, zweimal. »Natürlich.«
»Ich nehme an, Ihnen setzt das Ganze auch sehr zu. Schließlich kannten Sie ihn.«
»Genau genommen kannte ich ihn gar nicht richtig. Er war eher ein Bekannter von Keegan.«
»Trotzdem …«
Levin betrachtete sie mit dem Anflug eines Lächelns. »Ich habe wahrscheinlich eine unglückliche Art, mich auszudrücken. Natürlich sind wir beide schockiert.« Er massierte seine Schläfen. »Ich denke, für Polizeipräsident Crawford wird es besonders peinlich.«
»Wie meinen Sie das?«
»Er wird öffentlich eingestehen müssen, dass Sie recht hatten und er unrecht.«
»Ein Mann ist ermordet worden«, sagte Frieda langsam.
»Genau. Das wird ihn in keinem guten Licht erscheinen lassen.«
Frieda erhob sich. »Draußen steht eine Polizistin. Zu meinem Schutz. Sie wird wahrscheinlich neugierige Fragen stellen. Es fällt mir schwer, den Leuten zu erklären, was genau Sie machen.«
Levin erhob sich ebenfalls. »Sie brauchen im Grunde nichts zu erklären.«
»Polizeibeamter sind Sie jedenfalls keiner, stimmt’s?«
»Nein«, antwortete er. »Ich meine, Sie haben recht, Polizeibeamter bin ich keiner. So, wie Sie die Frage formuliert haben, ist es schwierig, mit Ja oder Nein zu antworten.«
»Fragen zu beantworten scheint Ihnen überhaupt schwerzufallen. Anfangs dachte ich, Sie arbeiten für das Innenministerium.«
»Tatsächlich? Sie hätten mich einfach fragen sollen.«
»Ich glaube, das habe ich getan.«
»Nun ja, die Grenzen zwischen den Ministerien verwischen heutzutage.«
»Sie geben mir schon wieder keine klare Antwort.«
Er musterte sie freundlich. »Betrachten Sie mich als Unterstützer.«
»Als Unterstützer«, wiederholte Frieda. »Ist das eine Art Berater?«
»Ich versuche, eher helfend als nur beratend tätig zu sein.«
»Unterstützend.«
»Wenn ich kann.«
»Das bringt mich ganz und gar nicht weiter. Ich hoffe, Sie werden auch die ermittelnden Beamten unterstützen.«
»Ich werde tun, was ich kann. Als besorgter Bürger.«
»Ich führe Sie hinaus.« Mit diesen Worten hielt Keegan Frieda die Tür auf.
Im Vorraum setzte er zum Sprechen an, blickte sich dann jedoch um, klappte den Mund wieder zu und begleitete Frieda schweigend hinaus auf den Gehsteig, wo Fran Bolton wartete. Frieda stellte die beiden vor.
»Ich bin ein Kollege«, erklärte Keegan.
»Ehemaliger Kollege«, korrigierte ihn Frieda.
Er holte seine Brieftasche heraus, zückte eine Visitenkarte und schrieb eine Telefonnummer auf die Rückseite.
»Wahrscheinlich können Sie meinen Anblick nicht mehr ertragen, und ich bin mir auch sicher, dass die Polizei das alles schnell aufklären wird. Aber falls es doch komplizierter werden sollte …«
Er reichte Frieda die Karte.
»Danke.«
»Es wird eine Trauerfeier geben.«
»Lassen Sie es mich wissen.«
Keegan wandte sich an Bolton. »Passen Sie gut auf sie auf.«
Frieda blieb vor einem Zeitungskiosk stehen.
»So schnell«, stellte sie fest.
»Was?«
»Das.« Frieda deutete auf das Zeitungssortiment.
Soweit sie es beurteilen konnte, prangte ihr Bild auf jeder Titelseite. Ihr Haus war zu sehen, ihr Gesicht, ihr Name. Ganz zu schweigen von den reißerischen Schlagzeilen. LondonerHorrorhaus. Sie wandte den Blick ab.
Als sie sich Reubens Haus näherten, sahen sie, dass sich draußen auf dem Gehsteig eine Gruppe von Leuten drängte und entlang der Straße mehrere große Wagen parkten. Im ersten Moment dachte Frieda an einen Unfall, bis sie begriff, dass sie selbst der Unfall war – das Spektakel, das die Leute sehen wollten.
»Wie haben die herausgefunden, wo ich mich aufhalte?«
»Das finden die immer heraus«, antwortete Fran Bolton, »manchmal sogar schneller als wir. Gibt es einen Hintereingang?«
»Nein.«
»Sagen Sie nichts.«
»Das hatte ich sowieso nicht vor.«
»Nicht bevor wir uns auf die offizielle Version geeinigt haben.«
»Die offizielle Version?«
Jemand in der kleinen Menschenansammlung vor Reubens Haus entdeckte sie. Es war, als würde ein Windstoß durch ein Kornfeld fegen: Innerhalb von Sekunden fuhren alle Köpfe herum. Sämtliche Blicke und Kameras waren nun auf sie beide gerichtet. Die Leute traten ein wenig zur Seite und begannen sich dann in ihre Richtung zu bewegen. Fran Bolton nahm Frieda am Arm und zischte etwas, das Frieda jedoch nicht verstand. Sie musste daran denken, was sie am Vortag zu Petra Burge gesagt hatte: dass sie sich wie losgelöst fühle, als würde sie sich selbst beobachten. Jetzt sah sie sich selbst dabei zu, wie sie sich durch das Gedränge der Journalisten schob, die alle ihren Namen riefen. Sie erkannte eine Frau mit einem Lächeln auf den Lippen, die hübsche Liz Barron, die im Lauf der Jahre ein feindseliges Interesse für sie entwickelt hatte. Ein Mann mit einer Hakennase und funkelnden braunen Augen trat ihr in den Weg und fragte sie etwas. Ihr Blick blieb an einem anderen Mann hängen; er war mittleren Alters, übergewichtig und trug einen Bart, der wie eine gelockte Grenzmarkierung die untere Hälfte seines Gesichts umrahmte.
»Wer war es, Frieda?«, rief jemand.
»Wie fühlen Sie sich?«
Ein unverständliches Gewirr aus Stimmen brach los. Sie entdeckte Reubens Gesicht am Fenster. Es war nicht fair, ihn all dem auszusetzen. Sie erreichten das kleine Gartentor.
»Glauben Sie wirklich, dass Dean Reeve noch am Leben ist?«, meldete sich eine laute, durchdringende Stimme zu Wort. »Hat das alles mit Dean Reeve zu tun?«
Die plötzliche Stille war für Frieda schockierender als das Geschrei davor. Sie blieb wie angewurzelt stehen, die Hand bereits am Griff des kleinen Eisentors. Sie konnte die Erregung hinter sich regelrecht spüren. Es fühlte sich an, als wäre die Luft elektrisch geladen. Das Stimmengewirr setzte erneut ein, noch lauter und eindringlicher als zuvor, doch nichts davon ergab für Frieda irgendeinen Sinn, abgesehen von dem vielfach wiederholten Namen Dean Reeve, der immer mehr Gewicht zu gewinnen schien.
»Jetzt bekommen wir keine Ruhe mehr«, verkündete Fran Bolton grimmig, während sie die Haustür aufschoben und hinter sich schnell wieder schlossen.
5
Frieda und Reuben saßen in Reubens Küche und tranken Kaffee. Die Jalousien waren heruntergelassen. Im Lauf des Vormittags war es einem Fotografen gelungen, jenseits der Gartenmauer auf einen Baum zu klettern und eine Aufnahme von Reuben in seinem bestickten Morgenmantel zu machen.
»Mir war nicht klar, dass sich das so entwickeln würde«, erklärte Frieda. »Ich hätte nicht kommen sollen.«
»Warum?« Reuben sah sie mit hochgezogenen Augenbrauen an. »Weil ich Krebs habe? Ich genieße es, dass du hier bist.«
Frieda schaltete ihr Handy an. Als sie feststellte, dass sie dreiundsechzig Anrufe verpasst hatte, machte sie es sofort wieder aus. Wie waren die bloß an ihre Nummer gekommen? Ein Stockwerk höher knallte es laut. Man hörte Josef fluchen.
»Da ist jemand verkatert«, meinte Reuben.
Fran streckte den Kopf herein. »Der Wagen, der uns zu Ihrem Haus bringen soll, ist schon unterwegs. Bereit?«
»Ja, bereit.«
Obwohl es zu regnen aufgehört hatte, waren die Pflastersteine in der kleinen Gasse noch dunkel und feucht. Entlang der Zufahrt drängte sich eine Schar von Reportern. Kameras blitzten auf, als sie vorbeifuhren. Vor Friedas Haus parkte ein Zivilfahrzeug der Polizei, und im Eingangsbereich war Absperrband gespannt. Ein Mann in einem grünen Overall ließ sie durch und reichte ihnen Plastiküberschuhe, die sie vor dem Eintreten anzogen. Frieda war an den besonderen Geruch ihres Hauses gewöhnt: die holzige Note der Bodendielen mit ihrer Bienenwachspolitur, oft vermischt mit dem Duft der Kräuter auf ihrem Küchenfensterbrett sowie dem trockenen, aber angenehmen Geruch, den sie inzwischen mit alten Büchern, Kohlestiften, Schachfiguren und Toast verband. Jetzt roch es nach scharfen Chemikalien und unterschwellig vielleicht noch nach etwas anderem, das bis ins Fundament des Hauses gesickert war. Frieda blieb einen Moment benommen stehen, bis sie sich wieder gefangen hatte.
Das Zimmer, in dem sie für gewöhnlich neben dem Kamin saß oder Schachpartien durchspielte, wurde von dem Strahler, den das Team der Spurensicherung aufgestellt hatte, grell ausgeleuchtet. Es befanden sich zwei Personen im Raum, von denen eine gerade fotografierte. Frieda starrte in die gelb angestrahlte Grube hinunter, in der gestern noch Bruce Stringer gelegen hatte. Natürlich war alles weg. Sogar die Maden und Fliegen. Geblieben war nur ein Loch. Der Raum selbst war nach wie vor ein Raum – auch wenn man die Teppiche entfernt und die Möbel zur Seite geschoben hatte –, aber für Frieda fühlte er sich nicht mehr an wie ihr Raum. Sie wandte sich ab und ging in die Küche.
»Was ist mit der Katze passiert?«, erkundigte sie sich bei dem Mann in Grün.
»Es gibt eine Katze?«
»Ja.«
»Im Moment ist sie nicht hier.«
Frieda stieg nach oben. Alles sah mehr oder weniger unverändert aus, doch sie spürte, dass auch hier oben jemand gewesen war. Nichts fühlte sich an, als gehörte es noch ihr. Rasch zog sie ein paar Kleidungsstücke aus den Schubladen und stopfte sie in eine Segeltuchtasche, dann noch ein paar Bücher und Toilettenartikel. Anschließend ging sie hinauf in ihr Dachstübchen, um ihren Zeichenblock und ihre Stifte zu holen. Sie wusste nicht, wie lange sie wegbleiben würde. Ihr bisheriges Leben in diesem Haus erschien ihr wie eine ferne Erinnerung an ein anderes Ich, ein anderes Leben. Sie stellte sich Dean Reeve vor, wie er leise durch ihre Räume schlich, in ihren Sachen stöberte, die Seiten ihres Zeichenblocks durchblätterte und sich hinunterbeugte, um die Katze zu streicheln. Wo war ihre Katze?
»Was können Sie vorweisen?«, wollte Polizeipräsident Crawford von Petra Burge wissen.
»Wir stehen noch ganz am Anfang.«
»Die Anfangsphase ist entscheidend.«
»Die Autopsie ist noch nicht abgeschlossen, aber Ians erster Eindruck war, dass Stringer schon vor vier oder fünf Tagen gestorben sein muss. Die Jungs von der Spurensicherung gehen davon aus, dass er woanders getötet und dann dort abgelegt wurde. Meine Leute sprechen gerade mit den Nachbarn und werten die Aufzeichnungen aller relevanten Überwachungskameras aus.«
»Was ist mit Reeve?« Crawfords Gesicht verzog sich zu einer säuerlichen Grimasse, als er den Namen aussprach. »Vorausgesetzt, der Verdacht von Doktor Klein trifft tatsächlich zu. Wo stehen wir, was ihn betrifft?«
»Es ist natürlich mit Problemen verbunden, nach jemandem zu suchen, der praktisch vom Erdboden verschwunden ist und acht Jahre lang als tot galt. Frieda Klein war immer der Überzeugung, dass er noch lebt, aber sie ist ihm nie begegnet, hat ihn nie gesehen. Zwei von Kleins Bekannten behaupten allerdings, ihn getroffen zu haben. Bei dem einen, Josef Morozov, handelt es sich um einen ukrainischen Bauarbeiter. Seine Verbindung zu Klein ist mir noch nicht ganz klar.«
»Wahrscheinlich sexueller Natur«, mutmaßte Crawford.
»Da bin ich mir nicht so sicher. Alles in allem kommt er mir ein bisschen undurchsichtig vor, auch im Hinblick auf seinen Aufenthaltsstatus. Er hat Reeve auf einer Baustelle kennengelernt.«
»War ihm bewusst, um wen es sich handelt?«
»Nein. Reeve hat dort unter einem falschen Namen gearbeitet. Zu dem zweiten Kontakt kam es mit Kleins Schwägerin. Olivia Klein. Sie war mit Kleins Bruder verheiratet. Olivia ist Reeve in einem Nachtlokal begegnet. Über die näheren Umstände hat sie sich nicht so genau ausgelassen. Die beiden sind wohl in einer Kneipe ins Gespräch gekommen.«
Crawford wirkte inzwischen nervös und gereizt.
»Was soll das? Was führt Reeve im Schilde?«
»Es hat alles mit Klein zu tun. Irgendwie muss sie ihm unter die Haut gegangen sein, als die beiden sich über den Weg gelaufen sind.«
»Tja, das kann ich nachvollziehen. Mir ist sie auch unter die Haut gegangen. Die Frau nervt mich schon, seit ich sie kenne. Aber was will er von ihr? Was hat er vor?«
»Das ist nicht klar. Noch nicht.«
»Was ist mit der Witwe?«
»Ich habe heute Vormittag mit Misses Stringer gesprochen.«
»Und?«
»Natürlich ist sie völlig am Ende. Sie sitzt im Rollstuhl, weil sie an MS leidet, und wie es aussieht, hat ihr Mann sie schon seit Jahren gepflegt. Die beiden haben zwei kleine Kinder.«
»Genau das, was wir jetzt noch brauchen.«
»Sie hatte wohl keine richtige Vorstellung von der Arbeit ihres Mannes. Ein Team von uns befindet sich gerade bei ihnen im Haus und geht seine Sachen durch.«
»Und das ist alles?«
»Wir sollten überlegen, wie wir mit der Presse verfahren wollen.« Crawford stöhnte, aber Burge ließ nicht locker. »Sie könnte nützlich für uns sein. Ich frage mich, ob wir Frieda Klein ein paar Interviews geben lassen sollten.«
Crawford murmelte irgendetwas Unverständliches vor sich hin.
»Was halten Sie davon?«, hakte Burge nach.
»Man weiß nie so genau, was sie sagen wird.« Er verzog das Gesicht. Dann beugte er sich ein wenig vor. »Für ihre Sicherheit ist gesorgt?«
»Wir passen rund um die Uhr auf sie auf.«
»Das mit der Leiche unter dem Fußboden kommt mir vor, als wollte er mit uns spielen. Falls er zuschlagen sollte, ich meine, ein weiteres Mal, dann würde das gar nicht gut aussehen.«
»Nein, ganz und gar nicht.«
»Ich habe Ihnen da einen Fall übertragen, der viel Aufmerksamkeit erregt.«
»Ja, ich weiß.«
»Mit einem solchen Fall kann man Karriere machen«, fuhr Crawford fort. »Oder aber, nun ja, Sie wissen schon.«
»Ja, ich weiß.«