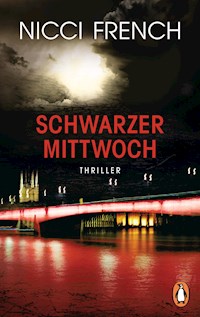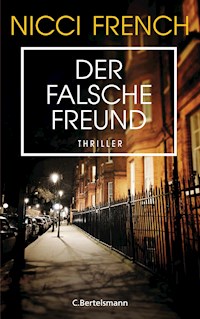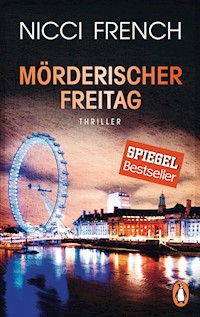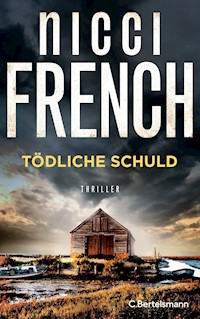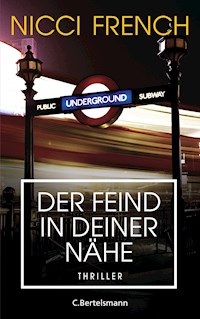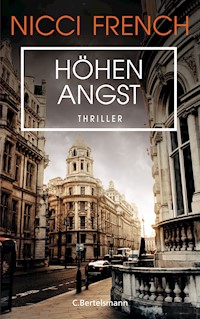9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Psychologin Frieda Klein als Ermittlerin
- Sprache: Deutsch
Bei einer Routinekontrolle macht eine Sozialarbeiterin in der Wohnung der psychisch kranken Michelle Doyce einen grausamen Fund: Auf dem Sofa sitzt ein nackter Mann, der offensichtlich schon seit Tagen tot ist. Doch aus Michelle sind keine zusammenhängenden Sätze herauszubekommen. Hat sie den Mann getötet? Frustriert bittet Inspektor Karlsson Psychotherapeutin Frieda Klein um Hilfe. Die hat gerade ihre eigenen Probleme: Die Presse macht sie für den Tod einer jungen Frau verantwortlich. Trotzdem beißt Frieda sich an Michelles Fall fest und forscht nach den wahren Umständen des Mordes. Bald hat sie eine schreckliche Vermutung …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 676
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
NICCI FRENCH
EISIGER DIENSTAG
PSYCHOTHRILLER
Deutsch von Birgit Moosmüller
C. Bertelsmann
Die Originalausgabe erschien 2011unter dem Titel »Tuesday’s Gone« bei Michael Joseph (Penguin), London.
1. Auflage
Copyright © 2012 by Joined-Up Writing, Ltd.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012
beim C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Karte: Peter Palm, Berlin
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-09418-8www.cbertelsmann.de
1
Im Laufschritt eilte Maggie Brennan die Deptford Church Street entlang. Während sie in ihr Handy sprach, überflog sie eine Akte und suchte gleichzeitig im Straßenverzeichnis ihres Stadtplans nach der Adresse. Obwohl erst der zweite Tag der Woche war, hinkte Maggie ihrem Zeitplan bereits zwei Tage hinterher. Dabei hatte sie die zusätzlichen Fälle, die sie von einer längerfristig krankgeschriebenen Kollegin geerbt hatte, noch gar nicht mit einberechnet.
»Nein«, sagte sie ins Telefon und warf einen Blick auf ihre Armbanduhr, »ich versuche es in die Besprechung zu schaffen, bevor ihr fertig seid.«
Sie steckte ihr Handy wieder in die Tasche. In Gedanken war sie noch ganz bei dem Fall, von dem sie gerade kam: einem dreijährigen Jungen mit Blutergüssen – verdächtigen Blutergüssen, wie der Arzt in der Ambulanz meinte. Maggie hatte mit der Mutter gesprochen, sich das Kind angesehen und die Wohnung überprüft, in der die beiden lebten. Obwohl es sich um eine schreckliche, feuchtkalte Bude handelte, bestand dort für das Kind – zumindest auf den ersten Blick – keine unmittelbare Gefahr. Die Mutter behauptete, keinen Freund zu haben. Die Tatsache, dass Maggie im Bad keinen Rasierer gefunden hatte, schien das zu bestätigen. Der Mutter zufolge war der kleine Junge die Treppe hinuntergefallen. Das sagten die Leute immer, wenn sie ihre Kinder schlugen. Andererseits fielen Dreijährige tatsächlich manchmal die Treppe hinunter. Maggie war nur zehn Minuten in der Wohnung gewesen, wäre aber auch nach zehn Stunden kaum zu einem anderen Ergebnis gekommen. Wenn sie das Kind abholen ließ, würde die strafrechtliche Verfolgung der Mutter vermutlich zu nichts führen, und sie selbst bekäme eine auf den Deckel. Ließ sie den Jungen aber nicht abholen und er wurde irgendwann tot aufgefunden, dann gab es eine Untersuchung und sie, Maggie, wurde entlassen und womöglich ihrerseits strafrechtlich verfolgt. Deswegen hatte sie beschlossen, demnächst noch einmal der Mutter einen Besuch abzustatten, ehe sie eine endgültige Entscheidung fällte.
Sie wandte sich wieder dem Stadtplan zu. Ihre Hände fühlten sich schon ganz eisig an, weil sie vergessen hatte, Handschuhe mitzunehmen, und dank ihrer billigen Stiefel hatte sie nun auch noch nasse Füße. Obwohl sie schon mehrfach in dem Wohnheim gewesen war, konnte sie sich den Weg dorthin einfach nicht merken. Bei der Howard Street handelte es sich um eine kleine Sackgasse, die gut versteckt irgendwo in Richtung Fluss lag. Maggie musste erst ihre Lesebrille aufsetzen und mit dem Finger die Straßen entlangfahren, ehe sie fündig wurde. Na bitte, da war sie ja, nur ein paar Gehminuten entfernt.
Als sie von der Hauptstraße abbog, fand sie sich zu ihrer Überraschung neben einem Kirchhof wieder. Sie lehnte sich einen Moment an die Mauer, um noch einmal einen Blick in die Akte der Frau zu werfen, die sie gleich aufsuchen würde: Michelle Doyce, geboren 1959. Die Informationen über sie waren äußerst dürftig: Entlassungspapiere einer Klinik, die in Kopie an das Sozialamt gegangen waren, ein Formular, das bestätigte, dass man ihr eine Unterkunft zugewiesen hatte, ein Antrag auf Beurteilung.
Maggie blätterte die Formulare ein weiteres Mal durch: keine Angehörigen. Aus den Unterlagen ging nicht einmal der Grund für den Klinikaufenthalt klar hervor, auch wenn der Name der Einrichtung vermuten ließ, dass es etwas Psychisches gewesen sein musste. Maggie konnte das Ergebnis ihrer Beurteilung schon im Voraus erahnen: schlichte allgemeine Hoffnungslosigkeit. Bestimmt hatte sie es mit einer bemitleidenswerten Frau mittleren Alters zu tun, die einfach einen Platz zum Wohnen brauchte – und jemanden, der hin und wieder nach ihr schaute und sie davon abhielt, durch die Straßen zu streifen. Maggie warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. Für eine umfängliche Beurteilung reichte die Zeit an diesem Tag nicht aus. Sie konnte nur kurz nach dem Rechten sehen und die grundlegenden Fragen klären: sich vergewissern, dass Michelle nicht unmittelbar gefährdet war und ausreichend Nahrung zu sich nahm.
Sie klappte die Akte zu und setzte sich wieder in Bewegung. Nachdem sie die Kirche hinter sich gelassen hatte, kam sie an einem Block mit Sozialwohnungen vorbei. Bei einigen waren die Fenster und Türen mit Metallplatten verrammelt, die meisten aber wirkten bewohnt. Aus einer Tür im zweiten Stock trat ein Junge im Teenageralter und eilte den Balkon entlang, die Hände tief in die Taschen seiner weiten Jacke geschoben. Maggie blickte sich um. Wahrscheinlich bestand kein Anlass zur Sorge. An diesem Dienstagvormittag lagen die gefährlichen Leute wohl größtenteils noch im Bett.
Nachdem sie um die Ecke gebogen war, warf sie erneut einen Blick auf die Adresse, die sie in ihr Notizbuch geschrieben hatte: Apartment eins, Howard Street Nummer drei. Ja, nun konnte sie sich wieder erinnern. Es handelte sich um ein ganz eigenartiges Haus, das aussah, als wäre es aus den gleichen Materialien wie der Block mit den Sozialwohnungen gebaut und auch genauso schnell heruntergekommen. Im Grunde war es gar kein richtiges Wohnheim, sondern ein normales Haus, welches das Sozialamt von Privatleuten gemietet hatte. Dort wurden Personen so lange untergebracht, bis das Amt entschied, wie es mit ihnen verfahren wolle. Für gewöhnlich zogen sie einfach weiter oder gerieten in Vergessenheit. Es gab andere derartige Häuser, die Maggie aus Sicherheitsgründen nur in Begleitung aufsuchte, aber über dieses hier war ihr noch nichts Besonderes zu Ohren gekommen. Seine Bewohner stellten hauptsächlich für sich selbst eine Gefahr dar.
Nachdenklich ließ sie den Blick an der Fassade hinaufwandern. Im zweiten Stock hatte jemand ein zerbrochenes Fenster provisorisch mit brauner Pappe abgedichtet. Der nicht sehr große Vorgarten des Gebäudes war geteert, und links vom Haus verlief eine kleine Seitengasse. Neben der Haustür lehnte ein aufgeplatzter Müllsack, was aber kaum ins Gewicht fiel, weil ohnehin überall Müll herumlag.
Nachdem Maggie sich in ihrem Büchlein eine Notiz gemacht hatte, die aus nur einem Wort bestand, wandte sie sich den fünf Klingelknöpfen neben der Haustür zu. Namensschilder gab es keine. Sie drückte zweimal kurz hintereinander auf den untersten Knopf, konnte jedoch nicht hören, ob die Klingel funktionierte. Sie überlegte, ob sie mit der Faust gegen die Tür hämmern oder durchs Fenster in die Erdgeschosswohnung spähen solle. In dem Moment hörte sie eine Stimme und fuhr erschrocken herum. Direkt hinter ihr stand ein hagerer Mann mit rotblondem, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenem Haar und Piercings im ganzen Gesicht. Als sie einen Schritt zur Seite trat, entdeckte sie seinen Begleiter, einen kleineren Kampfhund, dessen Besitz rein theoretisch verboten war, auch wenn sie bereits drei Exemplare dieser Sorte gesehen hatte, seit sie in Deptford aus dem Zug gestiegen war.
»Keine Sorge, der ist brav«, erklärte der Mann, »nicht wahr, Buzz?«
»Wohnen Sie hier?«, fragte Maggie.
Der Mann wirkte misstrauisch. An seiner einen Wange zuckte ein Nerv. Rasch zog Maggie eine laminierte Karte aus der Tasche und hielt sie ihm unter die Nase.
»Ich bin vom Sozialamt«, erklärte sie. »Ich komme wegen Michelle Doyce.«
»Ist das die im Erdgeschoss?«, fragte der Mann. »Die habe ich noch kaum zu Gesicht bekommen.« Er trat vor die Tür und sperrte auf. »Wollen Sie rein?«
»Ja, bitte.«
Der Mann zuckte nur mit den Achseln.
»Komm schon, Buzz«, sagte er. Maggie hörte die Krallen des Hundes über den Boden klacken, als er ins Haus und dann die Treppe hinaufrannte. Sein Herrchen folgte ihm nach oben.
Sobald Maggie eingetreten war, schlug ihr der Gestank von Schimmel, Müll, Bratfett und Hundekot entgegen, vermischt mit anderen Gerüchen, die undefinierbar waren – ein Potpourri, das ihr fast das Wasser in die Augen trieb. Sie zog die Haustür hinter sich zu. Was früher einmal die Diele eines Privathauses gewesen sein mochte, war nun mit Paletten, Farbdosen, offenen Müllsäcken und einem alten Fahrrad ohne Reifen zugestellt. Die Treppe lag direkt vor ihr. Die erste Tür links, durch die man früher wohl das Wohnzimmer betreten hatte, war zugemauert. Maggie ging an der Treppe vorbei bis zu einer Tür weiter hinten, klopfte fest dagegen und lauschte. Drinnen war ein kurzes Rascheln zu hören, dann nichts mehr. Sie klopfte noch ein paarmal und wartete. Schließlich klapperte etwas, dann schwang die Tür nach innen auf. Erneut zückte Maggie ihre laminierte Karte.
»Michelle Doyce?«, fragte sie.
»Ja«, antwortete die Frau.
Maggie konnte selbst nicht genau festmachen, was sie an ihrem Gegenüber so seltsam fand. Die Frau wirkte gewaschen und trug ihr Haar ordentlich gekämmt – allerdings fast zu ordentlich, als hätte sie es wie ein kleines Mädchen angefeuchtet und dann derart glatt gestriegelt, dass es ganz flach am Kopf anlag. Noch dazu war es so dünn, dass überall die bleiche Kopfhaut hindurchlugte. Ihr glattes Gesicht leuchtete rosig und war von einem Hauch aus feinen Härchen überzogen. Mit ihrem knallroten Lippenstift hatte sie ein klein wenig zu weit über die Lippenkonturen hinausgemalt. Sie trug ein weites, ausgewaschenes Blumenkleid.
Maggie stellte sich vor und zeigte ihre Karte.
»Ich wollte nur mal nach Ihnen sehen, Michelle«, erklärte sie, »und hören, wie es Ihnen geht. Ist bei Ihnen alles in Ordnung? Fühlen Sie sich gut?«
Die Frau nickte.
»Darf ich reinkommen?«, fragte Maggie. »Um mich davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist?«
Sie trat in die Diele und holte ihr Notizbuch heraus. Soweit sie es auf den ersten Blick beurteilen konnte, achtete Michelle auf Körperpflege. Sie machte auch durchaus den Eindruck, als würde sie ausreichend Nahrung zu sich nehmen, und reagierte auf Fragen. Trotzdem erschien Maggie irgendetwas seltsam. Prüfend ließ sie den Blick durch die schäbige kleine Diele schweifen. Der Gegensatz zum Hausgang war beeindruckend. Die Schuhe standen fein säuberlich aufgereiht, ein Mantel hing ordentlich an einem Haken. In der Ecke lehnte ein Kübel mit einem Wischmob.
»Wie lange wohnen Sie schon hier, Michelle?«
Die Frau runzelte die Stirn.
»Hier?«, wiederholte sie. »Ein paar Tage.«
Aus Maggies Unterlagen ging hervor, dass man die Frau am fünften Januar aus der Klinik entlassen hatte. Mittlerweile war der erste Februar. Trotzdem war eine derart vage Zeitangabe nichts wirklich Ungewöhnliches. Während die beiden Frauen so dastanden, wurde Maggie auf ein Geräusch aufmerksam, das sie nicht recht zuordnen konnte. Wahrscheinlich drang von draußen Verkehrslärm herein, oder im Stockwerk über ihnen war gerade jemand mit dem Staubsauger zugange. Oder es handelte sich um das Summen eines weit entfernten Flugzeugs. Wobei ihr nun auch ein seltsamer Geruch in die Nase stieg. Als hätte etwas Essbares zu lange im Warmen gestanden. Maggie blickte zur Dielenlampe empor. Der Strom war offenbar angeschaltet. Vielleicht sollte sie überprüfen, ob Michelle über einen Kühlschrank verfügte. Andererseits machte die Frau einen recht gesunden und wohlgenährten Eindruck.
»Darf ich mich ein bisschen umsehen, Michelle?«, wandte Maggie sich an sie. »Mich vergewissern, dass alles in Ordnung ist?«
»Möchten Sie ihn kennenlernen?«, entgegnete Michelle.
Maggie starrte sie verblüfft an. Ein Partner war in der Akte nicht erwähnt worden.
»Sie haben einen Freund?«, fragte sie. »Es wäre nett, wenn Sie ihn mir vorstellen würden.« Michelle übernahm die Führung und öffnete die Tür zu einem Raum, der auf die Rückseite des Hauses hinausging und früher wahrscheinlich so eine Art Hinterzimmer gewesen war. Maggie, die ihr folgte, spürte sofort etwas auf ihrem Gesicht. Zuerst hielt sie es für Staub. Es fühlte sich an, als würde einem von einer nahenden U-Bahn warme, staubige Luft entgegenwehen. Gleichzeitig aber wurde das Geräusch lauter, und Maggie begriff, dass es sich nicht um Staub, sondern um Fliegen handelte – eine dicke Wolke aus Fliegen, die ihr ins Gesicht klatschte.
Ein paar Augenblicke lang starrte sie irritiert zu dem Mann auf dem Sofa hinüber. Ihre Wahrnehmung hatte sich verlangsamt und irgendwie verschoben, als befände sie sich tief unter Wasser oder in einem Traum. Benommen fragte sie sich, ob er eine Art Taucheranzug trug – einen bläulichen, wie marmoriert wirkenden und an manchen Stellen leicht aufgerissenen Taucheranzug –, und warum seine Augen so gelb und trüb aussahen. Dann wurde sie auf einmal hektisch und fischte ihr Handy aus der Tasche, doch vor lauter Aufregung ließ sie es fallen, und plötzlich wollten ihre Finger ihr nicht mehr gehorchen. Maggie konnte sie einfach nicht dazu bewegen, das Telefon von dem schmutzigen Teppich aufzuheben, denn nun sah sie, dass es sich keineswegs um einen Taucheranzug handelte, sondern um sein nacktes, aufgedunsenes, platzendes Fleisch, und dass der Mann tot war. Lange tot.
2
Der Februar«, sagte Sasha, während sie einer Pfütze auswich, »sollte abgeschafft werden.«
In der Straße, die sie und Frieda gerade entlanggingen, ragten zu beiden Seiten hohe Büroblöcke auf, die den Blick auf den Himmel einengten und den dunklen Tag noch dunkler erscheinen ließen. Alles war schwarz, grau und weiß wie auf einer alten Fotografie: Die Gebäude wirkten monochrom, der Streifen Himmel kalt und leer, und all die Männer und Frauen – aber es waren hauptsächlich Männer –, die mit ihren schmalen Laptoptaschen und griffbereiten Schirmen vorübereilten, trugen nüchterne Geschäftskleidung und Mäntel in gedeckten Tönen. Nur der rote Schal um Friedas Hals sorgte für einen Farbklecks in der Landschaft.
Frieda marschierte in strammem Tempo dahin, so dass Sasha, obwohl sie eigentlich die Größere war, Mühe hatte, Schritt zu halten.
»Genau wie die Dienstage«, fuhr sie fort. »Der Februar ist der schlimmste Monat im Jahr, viel schlimmer als der Januar, und der Dienstag der schlimmste Tag der Woche.«
»Heißt es das nicht immer vom Montag?«
»Die Dienstage sind noch schlimmer. Das ist wie …« Sasha legte eine Pause ein, weil sie erst darüber nachdenken musste, wie es eigentlich war. »Der Montag ist wie ein Sprung ins eiskalte Wasser. Durch den Kälteschock bekommt man wenigstens einen Adrenalinstoß. Am Dienstag treibt man immer noch im Wasser, aber der Schock hat sich gelegt, und man ist nur noch am Frieren.«
Als Frieda zu ihr hinübersah, stellte sie fest, dass Sasha mit ihrer winterlichen Blässe noch zerbrechlicher wirkte als sonst, was ihrer außerordentlichen Schönheit aber keinen Abbruch tat. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass sie in einen dicken Mantel gehüllt war und ihr dunkelblondes Haar streng zurückgebunden trug.
»Schlimmen Vormittag gehabt?«
Auf Höhe eines Weinlokals bogen sie kurz in die Cannon Street ab, wo der übliche Trubel aus roten Bussen und Taxis herrschte. Der Himmel spie die ersten Regentropfen aus.
»Eigentlich nicht. Nur eine Besprechung, die sich länger hinzog als nötig, weil sich manche Leute einfach gerne reden hören.« Abrupt blieb Sasha stehen und blickte sich um. »Ich hasse diesen Teil von London«, sagte sie, klang dabei aber keineswegs wütend, sondern eher so, als hätte sie gerade erst realisiert, wo sie sich befand. »Als du einen Spaziergang vorgeschlagen hast, dachte ich, du würdest mit mir den Fluss entlanggehen oder in einen Park. Diese Ecke hier hat einfach etwas Unwirkliches.«
Frieda verlangsamte ihren Schritt. Sie passierten gerade ein winziges Fleckchen eingezäunten Grüns, um das sich offenbar niemand kümmerte, da dort Nesseln und Gestrüpp wucherten.
»Hier stand mal eine Kirche«, erklärte Frieda. »Natürlich gibt es die schon lange nicht mehr, ebenso wenig wie den dazugehörigen Friedhof, aber dieser kleine Fleck hat überlebt. Vermutlich ist er zwischen all den Bürogebäuden irgendwie in Vergessenheit geraten. Ein Fragment aus der Vergangenheit.«
Sasha blickte über den Zaun auf den herumliegenden Müll.
»Inzwischen kommen die Leute wohl nur noch her, um rasch eine zu rauchen.«
»Als ich sieben oder acht Jahre alt war, ist mein Vater mal mit mir nach London gefahren.«
Sasha betrachtete sie aufmerksam. Es war das erste Mal, dass ihre Freundin ein Mitglied ihrer Familie erwähnte und auf eine Kindheitserinnerung zu sprechen kam. Sasha selbst hatte Frieda mittlerweile fast alles über ihr Leben erzählt: über ihre Beziehung zu ihren Eltern und ihrem nichtsnutzigen jüngeren Bruder, ihre Liebesgeschichten, ihre Freundschaften. Viele Dinge, die sie bisher immer unter Verschluss gehalten hatte, waren zutage getreten, aber Friedas Leben blieb ihr weiterhin ein Rätsel.
Sie beide kannten sich seit gut einem Jahr. Sasha hatte Frieda als Patientin aufgesucht und konnte sich noch genau an die eine Sitzung erinnern, in der sie Frieda damals im Flüsterton erzählte – und dabei kaum wagte, den Kopf zu heben und Friedas ruhigem Blick zu begegnen –, wie sie mit ihrem vorherigen Therapeuten geschlafen hatte. Besser gesagt, der Therapeut mit ihr. Es war wie eine Beichte: Ihr schmutziges Geheimnis breitete sich in dem ruhigen Raum aus, und Frieda, die in ihrem roten Sessel leicht nach vorne gebeugt saß, nahm ihr durch die Art, wie sie ihr zuhörte, den Schmerz und die Scham. Als Sasha die Praxis wieder verließ, fühlte sie sich ausgelaugt, aber gereinigt. Erst später erfuhr sie, dass Frieda im Anschluss an ihre Sitzung schnurstracks in das Restaurant geeilt war, in dem besagter Therapeut gerade mit seiner Frau saß. Sie hatte dort ein ziemliches Chaos angerichtet, indem sie den Mann mit einem Kinnhaken niederstreckte, wobei auch etliche Gläser und Teller zu Bruch gingen. Am Ende war sie mit einer bandagierten Hand in einer Polizeizelle gelandet, aber der Therapeut hatte von einer Anklage abgesehen und darauf bestanden, für den Schaden im Restaurant aufzukommen. Später hatte Sasha – die von Beruf Genetikerin war – sich bei Frieda revanchiert, indem sie bei einem Beweisstück, das Frieda aus dem Polizeipräsidium entwendet hatte, einen heimlichen DNA-Test durchführen ließ. Sie waren Freundinnen geworden, auch wenn es sich dabei um eine Art von Freundschaft handelte, die Sasha völlig neu war. Frieda sprach nicht über ihre Gefühle. Sie hatte ihren Exfreund Sandy, der aus beruflichen Gründen nach Amerika gegangen war, mit keinem Wort erwähnt und das eine Mal, als Sasha sie auf das Thema ansprach, in beängstigend höflichem Ton geantwortet, sie wolle nicht darüber reden. Stattdessen sprach Frieda über Bauwerke oder seltsame Fakten, die sie im Zusammenhang mit London ausgrub. Hin und wieder lud sie Sasha zu einer Ausstellung ein oder rief sie an, um sie zu fragen, ob sie spontan Zeit zu einem Spaziergang habe. Dann sagte Sasha eine andere Verabredung ab oder ließ ihre Arbeit liegen, um mit Frieda durch die Straßen Londons zu ziehen. Sie hatte das Gefühl, dass das Friedas Art war, sich ihr anzuvertrauen, und dass sie, Sasha, die Einsamkeit ihrer Freundin vielleicht ein wenig linderte, indem sie sie auf ihren Streifzügen begleitete.
Nun wartete sie geduldig, bis Frieda weitersprach, weil sie genau wusste, dass es nichts brachte, sie zu drängen.
»Wir besuchten den Spitalfields Market, wo er mir plötzlich erklärte, dass wir auf einer Pestgrube stünden und unter unseren Füßen Hunderte von Menschen begraben lägen, die am schwarzen Tod gestorben waren. Das hätten die Untersuchungen ergeben, die an den Zähnen einiger ausgegrabener Leichen durchgeführt worden seien.«
»Hätte er nicht mit dir in den Zoo gehen können?«, fragte Sasha.
Frieda schüttelte den Kopf und schaute sich um.
»Ich finde diese Gebäude auch schrecklich. Wir könnten überall sein, solche Scheußlichkeiten findet man in jeder Stadt. Trotzdem gibt es hier ein paar kleine Details, die sie zu eliminieren vergessen haben: das eine oder andere besondere Fleckchen und die Straßennamen: Threadneedle Street, Wardrobe Terrace, Cowcross Street. Erinnerungen und Geister.«
»Das klingt fast nach Therapie.«
Frieda lächelte sie an. »Ja, nicht wahr? Komm, ich möchte dir etwas zeigen.«
Sie kehrten wieder in die Cannon Street zurück und blieben gegenüber dem Bahnhof vor einem in die Wand eingelassenen Eisengitter stehen.
»Was ist das?«
»Der London Stone.«
Skeptisch betrachtete Sasha den hinter dem Gitter liegenden Sandsteinklumpen, der nicht allzu ansehnlich, sondern pockennarbig und langweilig wirkte und sie an die unbequemen Felsbrocken erinnerte, auf denen man sich am Strand oft niederließ, um sich den Sand von den Füßen zu reiben, bevor man die Schuhe wieder anzog.
»Wozu dient der?«
»Er beschützt uns.«
Sasha lächelte verblüfft.
»Inwiefern?«
Frieda richtete den Blick auf ein kleines Schild neben dem Stein.
»›Solange dem Stein des Brutus nichts geschieht, solange wird London gedeihen.‹ Angeblich handelt es sich dabei um das Herz der Stadt, den Punkt, von dem aus die Römer die Reichweite ihres Imperiums maßen. Manche Leute sind der Meinung, dass er Zauberkräfte besitzt. Niemand weiß wirklich, woher er stammt – ob von irgendwelchen Druiden oder den Römern. Vielleicht handelt es sich um einen alten Altar oder Opferstein oder, wie gesagt, um eine Art mystischen Mittelpunkt.«
»Du glaubst an so etwas?«
»Was mir daran gefällt«, antwortete Frieda, »ist die Tatsache, dass er sich in der Seitenmauer eines Ladens befindet und die meisten Leute vorbeigehen, ohne ihn überhaupt zu bemerken. Und dass man ihn nie wieder finden würde, falls er verloren ginge, weil er aussieht wie ein ganz gewöhnlicher Felsbrocken. Welche Bedeutung er für uns hat, hängt ganz davon ab, was wir in ihm sehen wollen.«
Nachdem sie beide ein paar Augenblicke geschwiegen hatten, legte Sasha eine Hand auf Friedas Schulter.
»Sag mal, wenn es dir schlecht ginge, würdest du dich dann jemandem anvertrauen?«
»Keine Ahnung.«
»Würdest du dich mir anvertrauen?«
»Vielleicht.«
»Also, ich bin immer für dich da.« Sie fühlte sich gehemmt und peinlich berührt, weil in ihrer Stimme so viel Gefühl mitschwang. »Ich wollte nur, dass du das weißt.«
»Danke.« Friedas Stimme klang ganz neutral.
Sasha ließ die Hand wieder sinken, und sie wandten sich von dem Gitter ab. Die Luft war inzwischen merklich kühler geworden, und der Himmel sah aus, als würde es bald schneien.
»Ich habe in einer halben Stunde einen Patienten«, bemerkte Frieda.
»Eins noch.«
»Ja?«
»Wegen morgen. Da bist du doch bestimmt nervös. Ich hoffe, es geht alles gut. Gibst du mir Bescheid?«
Frieda zuckte nur mit den Achseln. Sasha blickte ihrer schlanken, aufrechten Gestalt nach, bis die Menge sie verschluckte.
3
Detective Constable Yvette Long traf ein paar Augenblicke vor Karlsson ein. Obwohl der Anruf gerade mal fünfzehn Minuten zurücklag, hatte sich auf der Straße bereits eine kleine Schar von Neugierigen versammelt: Kinder, die eigentlich in der Schule sein sollten, junge Mütter mit Kinderwagen, Männer, die es nicht eilig zu haben schienen. Obwohl es klirrend kalt war, trugen die meisten von ihnen weder einen warmen Mantel noch Handschuhe. Alle wirkten aufgeregt und hatten vor Neugier glänzende Augen. Vor Nummer drei parkten zwei Streifenwagen, und der Bereich vor dem Haus war bereits mit Plastikband abgesperrt. Gleich dahinter führte ein dünner, drahtiger Mann mit einem rötlich blonden Pferdeschwanz seinen Hund auf und ab. Hin und wieder ließ sich das Tier, das einen auffallend breiten Brustkorb hatte, für einen Moment nieder und gähnte, wobei ihm jede Menge Speichel von den Lefzen tropfte. Ansonsten aber marschierten die beiden ununterbrochen auf und ab. Ein zweiter, extrem fetter Mann befand sich ebenfalls knapp hinter der Absperrung. Seine vielen Speckrollen schienen von seinem T-Shirt zusammengehalten zu werden, während er reglos dastand und sich immer wieder über die schweißglänzende Stirn fuhr, als wäre nicht Februar, sondern ein heißer Sommertag. Yvette Long stellte ihren Wagen ab und steuerte auf den Eingang zu. Als sie die Tür öffnen wollte, kam gerade DC Chris Munster aus dem Haus, ein Taschentuch vor den Mund gepresst.
»Wo ist die Frau, die ihn gefunden hat?«
Munster nahm das Taschentuch vom Mund und steckte es ein. Es fiel ihm sichtlich schwer, seine Gesichtszüge unter Kontrolle zu halten. »Entschuldigung, die Sache ist mir ein bisschen auf den Magen geschlagen. Sie ist dort drüben.« Er nickte zu einer Frau mittleren Alters hinüber, die ein paar Meter von ihnen entfernt auf dem Gehsteig saß und die Hände vors Gesicht geschlagen hatte. »Sie wartet, bis wir Zeit haben, mit ihr zu sprechen. Vermutlich steht sie unter Schock. Die andere Frau – die, die bei ihm war – sitzt mit Melanie im Wagen. Sie redet die ganze Zeit über Tee. Die Spurensicherung ist schon unterwegs.«
»Karlsson kommt auch gleich.«
»Gut.« Munster senkte die Stimme. »Wie können diese Leute nur so leben?«
Long und Karlsson schlüpften in papierene Überschuhe. Dann nickte er ihr aufmunternd zu und legte ihr für einen Moment eine Hand auf den Rücken, als wollte er ihr mit dieser Geste Kraft spenden. Sie holte tief Luft.
Später würde Karlsson versuchen, alle seine Eindrücke zu sortieren und in eine gewisse Ordnung zu bringen, vorerst aber bot sich ihm ein Wirrwarr aus Anblicken und Gerüchen, von denen ihm so übel wurde, dass ihm der Schweiß ausbrach. Durch den ganzen Müll, den Hundekot und den penetranten, leicht süßlichen Geruch, der einem sofort im Hals stecken blieb, steuerten er und Yvette auf die einzige offene Zimmertür zu. Als sie eintraten, wechselten sie in ein völlig anderes, geordnetes Universum über. Plötzlich kamen sie sich vor wie in einer Bibliothek, wo alles gewissenhaft katalogisiert und am dafür bestimmten Platz untergebracht war: drei Paar alte Hüte, ordentlich übereinandergestapelt, ein Regalfach mit lauter runden Steinen, ein anderes Fach voller Vogelknochen, an denen zum Teil noch Federn klebten, eine Schale mit Zigarettenkippen, fein säuberlich nebeneinandergelegt, ein Plastikbehälter, gefüllt mit etwas, das aussah wie Haarknäuel. Während Karlsson ins angrenzende Zimmer ging, blieb ihm gerade genug Zeit für den Gedanken, dass die Frau, die in diesen Räumen lebte, verrückt sein musste. Dann starrte er eine Weile nur noch das Ding auf dem Sofa an – den nackten Mann, der da in aufrechter Haltung vor ihm saß, umgeben von einer Wolke träger, fetter Fliegen.
Der Tote wirkte schlank und – auch wenn das in diesem Stadium letztendlich schwer zu sagen war – nicht sehr alt. Seine Hände lagen auf seinem Schoß, als wollte er damit seine Blöße bedecken, und in der einen Hand steckte ein mit Zuckerguss überzogenes Gebäckstück. Er hatte ein Kissen im Nacken, das den Kopf stützte, so dass der Blick seiner offenen, schwefelgelben Augen direkt auf die Eintretenden gerichtet war und sein schiefer, erstarrter Mund aussah, als lächelte er spöttisch. Seine Haut wies eine fleckige, bläuliche Färbung auf, wie ein Schimmelkäse, den man zu lange im Warmen gelassen hatte. Karlsson musste an die hell gebleichte Jeans seiner Tochter denken, die er ihr auf ihr Drängen hin gekauft hatte. Rasch schob er den Gedanken wieder beiseite, er wollte seine Tochter nicht mit dieser Szenerie in Verbindung bringen, nicht einmal in seinen Gedanken. Als er sich ein wenig vorbeugte, sah er, dass sich auf dem Torso des Mannes eine Art Muster aus vertikalen Streifen abzeichnete. Nach den dunklen Hautverfärbungen an der Unterseite seiner Oberschenkel und Pobacken zu urteilen, wo das Blut zusammengelaufen war, musste er schon eine ganze Weile tot sein. Dafür sprach auch der Geruch, der Yvette Long, die hinter Karlsson stand, zu flachen, keuchenden Atemzügen veranlasste. Neben dem linken Fuß des Mannes, der in einem unnatürlichen Winkel und mit gespreizten Zehen nach oben ragte, standen zwei volle Tassen Tee. In seinem hellbraunen Haar steckte ein Kamm, und seine Lippen waren rot geschminkt.
»Offensichtlich sitzt er hier schon eine ganze Weile.« Karlsson war selbst überrascht, wie ruhig seine Stimme klang. »Dass es im Raum so warm ist, hat die Sache nicht besser gemacht.«
Yvette Long gab ein Geräusch von sich, das sich durchaus als Zustimmung deuten ließ.
Karlsson zwang sich, die fleckige, aufgedunsene Haut des Toten genauer unter die Lupe zu nehmen. Nach ein paar Augenblicken winkte er Long zu sich.
»Sehen Sie mal«, sagte er.
»Was?«
»An seiner linken Hand.«
Der vordere Teil des Mittelfingers fehlte, etwa ab dem Knöchel.
»Es könnte sich um eine angeborene Missbildung handeln.«
»Für mich sieht es eher so aus, als wäre ein Stück abgeschnitten worden und die Wunde nicht richtig verheilt«, meinte Karlsson.
Long musste erst schlucken, bevor sie etwas erwidern konnte. Sie war fest entschlossen, den Kampf gegen die Übelkeit zu gewinnen.
»Ich weiß nicht«, antwortete sie schließlich, »das ist schwer zu sagen. Es sieht in der Tat ein bisschen matschig aus, aber vielleicht ist der Grund einfach …«
»… die ganz normale Verwesung«, führte Karlsson den Satz zu Ende.
»Ja.«
»Die wegen der Hitze besonders schnell fortschreitet.«
»Den Kollegen zufolge lief der Heizstrahler auf Hochtouren, als sie eintrafen.«
»Nach der Autopsie wissen wir mehr. Unsere Pathologen werden sich diesmal besonders beeilen müssen.«
Karlsson schaute sich im Raum um. Sein Blick fiel auf die gesprungene Scheibe und das verrottende Holz der Fensterbank, die orangeroten Vorhänge. Auch hier gab es Dinge, die Michelle Doyce gesammelt und geordnet hatte: eine Schachtel mit zerknüllten, offenbar benutzten Papiertaschentüchern, eine Schublade voller Flaschenverschlüsse, die nach Farben sortiert waren, ein Marmeladenglas, gefüllt mit dem, was beim Nagelschneiden anfiel: lauter kleinen, gelblichen Halbmonden.
»Lassen Sie uns nach draußen gehen«, stieß er hervor, »und mit den beiden Frauen reden. Wir können uns den Raum später noch einmal ansehen, wenn man die Leiche weggebracht hat.«
Als sie das Haus verließen, trafen gerade die Leute von der Spurensicherung ein, die mit ihren Scheinwerfern und Kameras, ihren Gesichtsmasken und Chemikalien immer so professionell und kompetent wirkten. Karlsson empfand ein Gefühl von Erleichterung. Sie würden das Grauen entfernen und den schrecklichen Raum mit seinen Wolken von Fliegen in ein gut ausgeleuchtetes Labor verwandeln, wo aus den Dingen Daten wurden, die man klassifizieren konnte.
»Was für ein Abgang«, stellte er fest, während er mit Yvette Long ins Freie trat.
»Wer, zum Teufel, ist der Mann?«, entgegnete sie ratlos.
»Damit fangen wir an.«
Karlsson überließ es Yvette Long, mit Maggie Brennan zu sprechen, und setzte sich zu Michelle Doyce in den Wagen. Er wusste über sie nur, dass sie einundfünfzig war, erst vor Kurzem nach einer Untersuchung, die hinsichtlich ihres Geisteszustands keine eindeutigen Ergebnisse erbracht hatte, aus einer psychiatrischen Klinik entlassen worden war und seit etwa einem Monat in der Howard Street lebte, ohne dass sich die Nachbarn beschwert hatten. Maggie Brennan hatte ihr dort zum ersten Mal einen Besuch abgestattet, wobei sie lediglich für eine Kollegin eingesprungen war, die selbst aber auch nicht eher vorbeigeschaut hätte, weil sie seit Oktober krankgeschrieben war.
»Michelle Doyce?«
Sie sah ihn an, antwortete jedoch nicht. Ihre Augen wirkten auffallend hell, fast wie die einer Blinden.
»Ich bin Detective Inspector Malcolm Karlsson.« Er wartete. Sie blinzelte nur. »Von der Polizei«, fügte er hinzu.
»Haben Sie einen weiten Weg hinter sich?«
»Nein, aber ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen.«
»Ich habe einen sehr weiten Weg hinter mir. Fragen Sie ruhig.«
»Es ist wichtig.«
»Ja, ich weiß.«
»Der Mann in Ihrer Wohnung …«
»Ich habe ihn bewirtet.«
»Er ist tot, Michelle.«
»Ich habe ihm die Zähne geputzt. Ich kenne nicht viele Leute, die das für ihre Gäste tun. Dafür hat er für mich gesungen. Sein Lied erinnerte mich an die Geräusche des Flusses in der Nacht, wenn der Hund zu bellen aufgehört hat und niemand mehr weint.«
»Michelle, er ist tot. Der Mann in Ihrer Wohnung ist tot. Wir müssen herausfinden, wie er gestorben ist. Können Sie mir seinen Namen sagen?«
»Seinen Namen?«
»Ja. Wer er ist. Oder war.«
Sie starrte ihn verwirrt an.
»Warum wollen Sie von mir seinen Namen wissen? Sie können ihn doch selbst fragen.«
»Michelle, es handelt sich hier um eine ernste Angelegenheit. Wer ist er?«
Sie starrte ihn an: eine kräftig gebaute, blasse Frau mit unheimlichen Augen und geröteten Händen, die sie mit vagen Gesten durch die Luft gleiten ließ, wenn sie sprach.
»Ist er in Ihrer Wohnung gestorben, Michelle? War es ein Unfall?«
»Bei einem von Ihren Zähnen fehlt ein Stück. Ich mag Zähne, müssen Sie wissen. Ich habe alle meine alten Zähne unter dem Kopfkissen, nur für den Fall, dass sie kommen, und zusätzlich auch noch ein paar von anderen Leuten, aber nicht viele. Man findet nur ganz selten welche.«
»Verstehen Sie, was ich Sie frage?«
»Will er mich verlassen?«
»Er ist tot.« Am liebsten hätte Karlsson das letzte Wort laut herausgeschrien, um damit wie mit einem Stein ihre Verständnislosigkeit zu zerschmettern, riss sich aber am Riemen.
»Am Ende gehen sie alle. Obwohl ich mir solche Mühe gebe.«
»Wie ist er gestorben?«
Sie begann Worte vor sich hin zu murmeln, die er nicht verstand.
Chris Munster verschaffte sich einen ersten Eindruck vom Rest des Hauses. Das Ganze widerte ihn an. Es kam ihm überhaupt nicht vor wie eine polizeiliche Ermittlung. Hier ging es um Leute, für die keine Hoffnung mehr bestand, weil sie längst durchs Raster gerutscht waren. Der Raum im ersten Stock, den er gerade inspizierte, war voller Spritzen: Hunderten, nein Tausenden benutzter Spritzen, die alle auf dem Boden herumlagen, so dass er sich zunächst fragte, ob sie vielleicht irgendein Muster ergaben. Außerdem stieß er auch hier auf Hundescheiße, die aber größtenteils alt und schon ganz hart war. Das Mobiliar beschränkte sich auf eine dünne Matratze, die im mittleren Bereich scheußliche Flecken aufwies. Im Moment war es ihm völlig egal, wer den Mann unten umgebracht hatte, er wollte nur sämtliche Leute aus dem Haus schaffen, die Hütte anzünden und selbst das Weite suchen. Er sehnte sich nach sauberer Luft, je kälter, desto besser. Er fühlte sich schmutzig, und zwar äußerlich und innerlich. Wie konnten Menschen nur so leben? Der fette Kerl mit den rot geäderten Augen und der aschfahlen Haut eines Säufers, der kaum noch in der Lage war zu sprechen und sichtlich Schwierigkeiten hatte, mit seinen kleinen Füßen das Gewicht seines massigen Körpers zu balancieren. Oder der Dürre mit dem Hund, der ganz zerstochene Arme und ein schorfiges Gesicht hatte und sich ständig kratzte, während er nervös grinsend auf und ab tigerte. War das sein Zimmer? Handelte es sich um seine Spritzen? Oder womöglich um die des toten Mannes? Das war vermutlich des Rätsels Lösung. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde sich herausstellen, dass der Tote ebenfalls ein Mitglied dieses Höllenhaushalts gewesen war. Oder gar der gottverdammte Hausherr. Man hatte diese Menschen einfach in dieses Loch gesteckt – hoffnungslose Außenseiter, mit denen die Gesellschaft nichts anzufangen wusste und für die sie auch kein Geld übrig hatte – und sie dort ihrem Schicksal überlassen. Nun musste die Polizei den Dreck wegräumen. Wenn die Öffentlichkeit das wüsste, dachte er, während er mit seinen schweren Stiefeln zwischen den Spritzen herumrutschte. Wenn die Leute wüssten, wie manche Menschen lebten, und wie sie starben.
4
Karlsson war unterwegs zur Fallbesprechung, als er auf dem Flur seinem Chef über den Weg lief, Polizeipräsident Crawford. Er unterhielt sich gerade mit einem hochgewachsenen jungen Mann, der zu einem schimmernden blauen Anzug eine bunt gemusterte Krawatte in Orange- und Grüntönen trug. Auf seiner Nase saß ein leicht überdimensionales schwarzes Brillengestell. Alles an ihm – angefangen bei seinem streng gescheitelten Haar bis hin zu den spitzen grünen Lederschuhen – signalisierte ein gewisses Maß an Ironie.
»Malcolm«, wandte sich der Polizeipräsident an Karlsson, »haben Sie einen Moment?«
Karlsson hielt die Akte hoch, die er dabeihatte.
»Die Leiche in Deptford?«, fragte Crawford.
»Ja.«
»Sind Sie sicher, dass es sich um einen Mordfall handelt?«
»Nein, bin ich nicht.«
»Warum kümmern dann Sie sich darum?«
»Weil sich niemand einen Reim auf die Geschichte machen kann«, erklärte Karlsson. »Wir müssen erst noch entscheiden, wie wir weiter damit verfahren wollen.«
Der Polizeipräsident stieß ein nervöses Lachen aus. An den anderen Mann gewandt sagte er: »Er ist nicht immer so.«
Crawford rechnete mit einer schlagfertigen Antwort von Karlsson, doch da der nicht reagierte, entstand eine peinliche Pause.
»Das ist Jacob Newton«, brach der Polizeipräsident schließlich das Schweigen, »und das hier ist Detective Chief Inspector Karlsson, von dem ich Ihnen schon erzählt habe. Derjenige, der den Faraday-Jungen gefunden hat.«
Die beiden Männer gaben sich die Hand.
»Nennen Sie mich Jake«, sagte Newton.
»Jake wird sich ein paar Tage bei uns umsehen, Abläufe und Strukturen unter die Lupe nehmen, solche Dinge«, erklärte der Polizeipräsident.
Karlsson starrte den jungen Mann überrascht an.
»Arbeiten Sie für die Londoner Polizeibehörde?«
Sein Gegenüber lächelte, als hätte Karlsson, ohne sich dessen bewusst zu sein, etwas Lustiges gesagt.
»Nein, nein«, mischte Crawford sich ein, »Jake ist von McGill Hutton. Sie wissen schon, der Unternehmensberatung.«
»Noch nie davon gehört«, entgegnete Karlsson.
»Ein frisches Paar Augen schadet nie«, fuhr der Polizeipräsident fort. »Wir können alle noch etwas lernen, insbesondere in unserer heutigen Zeit der finanziellen Neuorientierung.«
»Sie meinen wohl ›Kürzungen‹?«
»Wir sitzen alle im selben Boot, Mal.«
Wieder folgte eine Pause, die ein wenig zu lang dauerte.
»Die anderen warten auf mich«, verkündete Karlsson.
»Hätten Sie etwas dagegen, wenn ich Sie begleite?«, fragte Newton.
Karlsson warf einen fragenden Blick zu seinem Chef hinüber.
»Jake hat völlig freie Hand«, informierte ihn Crawford. »Ihm stehen alle Türen offen, ganz egal, wo er reinschnuppern möchte.« Er verpasste Karlsson einen Klaps auf den Rücken. »Schließlich haben wir nichts zu verbergen, oder? Sie können ihm gleich zeigen, was für ein schlankes Team Sie leiten.«
Karlsson sah zu Newton.
»Na, dann los«, sagte er, »beginnen wir mit der Besichtigung.«
Yvette Long und Chris Munster saßen an einem Schreibtisch und tranken Kaffee. Karlsson stellte Newton vor, der die beiden aufforderte, einfach so zu tun, als wäre er gar nicht da, was sofort zur Folge hatte, dass sie sich sichtlich verlegen und gehemmt fühlten.
»Kommt sonst noch jemand?«, wandte Karlsson sich an Yvette, die wortlos den Kopf schüttelte.
»Die Autopsie ist für heute Nachmittag angesetzt«, berichtete Karlsson. »Wäre es nicht wunderbar, wenn wir es mit einem Herzinfarkt zu tun hätten?«
»Aber Sie hatten doch den Verdacht, dass er erdrosselt worden sein könnte«, entgegnete Yvette.
»Ich darf doch wohl noch hoffen, oder nicht?«, gab Karlsson zurück.
»Mir tut der Hund leid«, meldete Munster sich zu Wort. »Diese Kerle leben in der Scheiße und schaffen es nie, einen Job zu behalten, müssen sich aber immer einen gottverdammten Hund zulegen.«
»Da ich bis jetzt noch nichts in die Richtung gehört habe«, sagte Karlsson, »gehe ich davon aus, dass der Verstorbene nicht als weiterer Hausbewohner identifiziert wurde.«
»Dazu liegen mir sämtliche Informationen vor«, antwortete Munster. Er griff nach seinem Notizbuch. »Lisa Bolianis. Um die vierzig, schätze ich. Eindeutig Alkoholikerin. Ich habe mit ihr gesprochen. Sie hat wenig Zusammenhängendes von sich gegeben. Angeblich ist ihr Michelle Doyce ein-, zweimal über den Weg gelaufen. Aber nie in Begleitung.« Er zog eine Grimasse. »Ich habe nicht den Eindruck, dass sich die Bewohner dieses Hauses oft zum Grillen treffen. Dann wäre da noch Michael Reilly – unser Hundebesitzer. Im November aus dem Gefängnis entlassen. Dreieinhalb Jahre wegen Besitzes und Verkaufs harter Drogen. Er sagt, er habe ihr ein paarmal in der Diele zugenickt, aber sie sei wohl nicht sehr begeistert von seinem Hund gewesen. In Begleitung hat er sie auch nie gesehen.« Er blickte wieder auf sein Notizbuch hinunter. »Sie hat so allerlei gesammelt. Reilly zufolge ist sie mit Tüten voller Zeug zurückgekommen, das sie gekauft oder gefunden hatte, oder was auch immer.«
»Das haben wir ja in der Wohnung gesehen«, warf Yvette Long ein.
»Sonst noch jemand?«, fragte Karlsson.
Munster sah erneut in sein Notizbuch.
»Metesky. Tony Metesky. Aus dem war so gut wie gar nichts rauszukriegen. Er hat mich praktisch ignoriert. Der Mann hat definitiv einen Sprung in der Schüssel. Ich habe seinetwegen das Sozialamt verständigt, angeblich ruft mich bald jemand zurück. In seinem Zimmer herrschte – selbst nach dortigen Maßstäben – ein fürchterliches Chaos. Der Boden war mit Spritzen übersät, Hunderten von Spritzen.«
Karlsson runzelte die Stirn.
»Seinen eigenen?«
Munster schüttelte den Kopf.
»Ich tippe eher auf einen Kuckuck.«
»Was bedeutet das?«, fragte Newton. Die drei Polizeibeamten starrten ihn an, und er machte plötzlich einen verlegenen Eindruck.
»Von einem Kuckuck sprechen wir«, erklärte Munster, »wenn ein Dealer sich eine besonders verletzliche Person herauspickt und deren Unterkunft als Stützpunkt für seine Aktivitäten benutzt.«
»Ich nehme an, Mister Wie-hieß-er-noch-mal konnte nicht mit Informationen über den Verstorbenen aufwarten.«
»Ich habe so gut wie gar nichts Verständliches aus ihm herausbekommen.«
»Was für eine Art von Heim ist das überhaupt?«, fragte Yvette.
Munster klappte sein Notizbuch zu.
»Ich glaube, dorthin stecken sie die Leute, mit denen sie nichts anderes mehr anzufangen wissen.«
»Wem gehört das Haus?«, erkundigte sich Karlsson. »Vielleicht ist der Tote ja tatsächlich der Hausbesitzer.«
»Nein, es gehört einer Frau«, informierte ihn Munster. »Sie lebt in Spanien. Ich werde sie anrufen und überprüfen, ob sie sich wirklich dort aufhält. Sie besitzt mehrere Häuser und lässt sie von einer Agentur verwalten. Die Details bekomme ich noch.«
»Wo sind die Bewohner jetzt?«
Munster nickte zu Yvette hinüber.
»Michelle Doyce ist wieder in der Klinik«, erklärte sie. »Die anderen sind noch vor Ort, so viel ich weiß.«
»Vor Ort?«, wiederholte Karlsson entgeistert. »Es handelt sich um einen Tatort!«
»Nicht im strengen Sinn. Wenn uns die Autopsie nicht eines Besseren belehrt, haben wir es unter Umständen nur mit einer kleinen Unterlassung zu tun – einem nicht gemeldeten Todesfall –, und ich glaube kaum, dass irgendein Gericht Michelle Doyce deswegen belangen wird. Was die anderen betrifft, wo sollen sie denn hin? Wir haben schon mehrere Male im Sozialamt angerufen, bekommen aber nicht mal jemanden an die Strippe, der bereit ist, mit uns über die Angelegenheit zu sprechen.«
»Ist es den Verantwortlichen denn egal, dass eines ihrer Heime unter Umständen als Drogenumschlagplatz benutzt wird?«, fragte Karlsson.
Es folgte eine Pause.
»Tja«, meinte Yvette. »Mal angenommen, es gelänge uns, im Sozialamt einen Ansprechpartner zu finden und vor Ort zu zitieren, dann würde uns die betreffende Person vermutlich nur darüber belehren, dass es, sollte dort tatsächlich ein Verbrechen geschehen sein, unsere Aufgabe ist zu ermitteln. Was wir vermutlich aber nicht tun werden.«
Karlsson versuchte krampfhaft, Jake Newtons Blick auszuweichen. Das war nicht gerade die beste Einführung in die Polizeiarbeit.
»Alles, was wir haben«, fasste er zusammen, »ist demnach eine Frau, die in ihrer Wohnung einen vermeintlichen Gast mit Tee und Gebäck bewirtet, bei dem es sich um einen bisher nicht identifizierten, nackten und bereits verwesenden Mann handelt, dessen einzig auffallendes Merkmal das fehlende Fingerglied an der linken Hand ist. Könnte der Finger entfernt worden sein, um einen Ring abzubekommen?«
»Es war der Mittelfinger«, gab Munster zu bedenken, »nicht der Ringfinger.«
»Man kann einen Ring doch auch am Mittelfinger tragen«, entgegnete Karlsson. »Wer, zum Teufel, ist der Kerl?«
»Don und seine Leute haben Fingerabdrücke genommen«, informierte ihn Munster. »Es hat ihnen keinen großen Spaß gemacht, aber sie waren erfolgreich. Nur hat sich leider keine Übereinstimmung mit unseren Datenbanken ergeben.«
»Was meint ihr also?«, fragte Karlsson. »Wo sollen wir anfangen?«
Munster und Long wechselten einen ratlosen Blick. Keiner sagte etwas.
»Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll«, meinte Karlsson schließlich, »aber ich weiß, was ich hoffe.«
»Nämlich?«
»Ich hoffe, dass er einen schlichten Herzinfarkt hatte und diese Verrückte vor lauter Panik nur nicht wusste, was sie mit ihm machen sollte.«
»Aber er war nackt«, gab Yvette zu bedenken, »und wir haben keine Ahnung, wer er ist.«
»Sollte er tatsächlich an einem Herzinfarkt gestorben sein, dann muss sich ein anderer mit diesem Problem herumschlagen.« Er runzelte die Stirn. »Ich wünschte, mir fiele jemand ein, der mit dem Gebrabbel von Michelle Doyce etwas anfangen kann.«
Noch während er die Worte aussprach, tauchte vor seinem geistigen Auge ein Gesicht auf, ernst und mit dunklen Augen: Frieda Klein.
5
Bitte nehmen Sie Platz, Doktor Klein.«
Frieda war schon etliche Male in dem Raum gewesen. Während ihrer Ausbildung hatte sie hier Seminare besucht und als fertig ausgebildete Analytikerin selbst Seminare geleitet. Einmal hatte sie sogar dort gesessen, wo jetzt Professor Jonathan Krull saß, und ihren jetzigen Platz hatte der herausragende, damals sechzigjährige Therapeut eingenommen, der bald darauf wegen beruflichen Fehlverhaltens aus der Psychoanalytikervereinigung – dem British Psychoanalytic Council – ausgeschlossen worden war.
Während sie sich nun niederließ, holte sie noch einmal tief Luft, um ihre Nerven zu beruhigen, und faltete die Hände im Schoß. Sie kannte Krull vom Hörensagen und Dr. Barber als Kollegin. Mit Letzterer verstand sie sich recht gut – was erklärte, wieso Dr. Barber nun einen so verlegenen Eindruck machte und Schwierigkeiten hatte, Frieda in die Augen zu sehen. Das dritte Mitglied der Kommission war eine untersetzte, grauhaarige Frau, die einen Pullover in einem grellen Pinkton und eine Halskrause trug. Das faltige Gesicht über der Krause wirkte klug, und ihre grauen Augen leuchteten. Frieda fand, dass sie aussah wie ein intelligenter Frosch. Die Frau stellte sich als Thelma Scott vor. Frieda betrachtete sie interessiert. Sie hatte schon von Thelma Scott gehört, einer Spezialistin für die Bereiche Gedächtnis und Trauma, sie aber noch nicht persönlich kennengelernt. Am äußeren Ende des Tisches saß eine weitere Frau. Ihre Aufgabe war es, die Sitzung zu protokollieren.
»Wie Sie wissen, Doktor Klein«, begann Professor Krull mit einem Blick in die ihm vorliegenden Papiere, »handelt es sich hierbei um die Voruntersuchung einer bei uns eingegangenen Beschwerde.« Frieda nickte. »Unsere Vereinigung verfügt über einen Ethikkodex und eine festgelegte Vorgehensweise im Fall von Beschwerden. Mit beidem haben Sie sich bei Ihrer Aufnahme einverstanden erklärt. Wir sind heute hier zusammengekommen, um die gegen Sie eingereichte Beschwerde zu untersuchen und uns zu vergewissern, dass einer Ihrer Patienten nicht Opfer unlauterer Berufspraktiken geworden ist, sondern von Ihnen auf sorgsame und angemessene Weise behandelt wurde. Ehe wir beginnen, möchte ich Sie darauf hinweisen, dass keine unserer Entscheidungen oder Erkenntnisse rechtliche Konsequenzen hat.« Er las inzwischen von dem vor ihm liegenden Blatt ab. »Auch beeinträchtigt unsere Entscheidung, wie auch immer sie ausfallen mag, keineswegs das Recht der Person, die sich über Sie beschwert hat, zusätzlich rechtliche Schritte gegen Sie einzuleiten, falls sie sich dazu entschließen sollte. Sind Sie sich darüber im Klaren?«
»Ja, das bin ich«, antwortete Frieda.
»Dieser Untersuchungsausschuss besteht aus drei Psychotherapeuten, die zusammengekommen sind, um den Fall einer unparteilichen, professionellen Prüfung zu unterziehen. Haben Sie irgendeinen Grund, an der Unparteilichkeit von einem von uns zu zweifeln, Doktor Klein?«
»Nein.«
»Sie haben sich dazu entschieden, ohne Beistand zu erscheinen und für sich selbst zu sprechen.«
»Das ist richtig.«
»Dann können wir beginnen. Die Beschwerde wurde von Misses Caroline Dekker eingereicht, und zwar im Namen ihres Ehemanns Alan Dekker. Können Sie bestätigen, dass Alan Dekker Ihr Patient war?«
»Ja. Er hat mich im November und Dezember 2009 mehrfach aufgesucht. Ich habe die Daten sämtlicher Sitzungen notiert.« Sie holte ein bedrucktes Blatt hervor und schob es über den Tisch.
»Laut Misses Dekker ging es ihrem Mann sehr schlecht, als er zu Ihnen kam.«
»Er litt unter schweren Panikattacken.«
»Misses Dekker behauptet, Sie hätten ihren Mann, statt ihm zu helfen, als …« – Krull warf einen Blick in seine Unterlagen – »Schachfigur in einer polizeilichen Ermittlung benutzt. Sie hätten sich nicht wie eine Therapeutin, sondern wie eine Ermittlerin verhalten, indem Sie einen schweren Verdacht auf ihn lenkten und ihn sogar bei der Polizei meldeten, so dass er zum Verdächtigen in einem Fall von Kindesentführung wurde. Statt sich an Ihr Versprechen zu halten, die Aussagen Ihres Patienten vertraulich zu behandeln, hätten Sie auf Kosten seines Seelenfriedens und seines zukünftigen Glücks Ihre eigene Karriere vorangetrieben.«
»Würden Sie uns bitte Ihre Version der Ereignisse erzählen, Doktor Klein?« Thelma Scott, die ältere Frau mit der Halskrause und dem hässlichen Pullover, fixierte Frieda mit ihrem scharfen Blick.
Nun, da dieser Moment, vor dem sie sich so lange gefürchtet hatte, endlich da war, fühlte sie sich ganz ruhig. »Alan Dekker kam im November zu mir, weil ihn Fantasien quälten. Vor seinem geistigen Auge sah er sich immer wieder mit einem Sohn. Im wirklichen Leben war er kinderlos, obwohl er und seine Frau schon eine ganze Weile versuchten, ein Kind zu bekommen. Deswegen sprachen wir darüber, wieso seine Kinderlosigkeit bei ihm nicht nur großen Kummer, sondern darüber hinaus eine schwere Störung ausgelöst hatte. Zur selben Zeit war tatsächlich ein Junge verschwunden, Matthew Faraday. Das Kind, das Alan immer beschrieb – der Sohn, den er nie hatte –, besaß so große Ähnlichkeit mit dem verschwundenen Jungen, dass ich es für meine Pflicht hielt, die Polizei darüber zu informieren. Danach sagte ich Alan, was ich getan hatte.«
»War er wütend?«, fragte Jasmine Barber.
Frieda überlegte einen Moment.
»Er wirkte sehr verständnisvoll, vielleicht sogar zu sehr. Es fiel ihm schwer, Ärger zum Ausdruck zu bringen. Ich habe ihn als sanften, von Selbstzweifeln geplagten Mann kennengelernt. Carrie – Misses Dekker – war viel wütender als er. Sie hatte einen stark ausgeprägten Beschützerinstinkt, was ihn betraf.«
»Aber das war nicht das einzige Mal, dass Sie eine Grenze überschritten haben, oder?«, fragte Krull.
Frieda wandte sich ihm zu.
»Der Fall entpuppte sich als kompliziert. Alan war adoptiert. Er fand heraus – nein, ich fand es heraus und sagte es ihm –, dass er ein eineiiger Zwilling war. Er hatte einen Bruder, von dem er nichts wusste, auch wenn zwischen den beiden eine Art Verbindung bestand. Sie sahen viele Dinge gleich, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Verständlicherweise war diese Erkenntnis für Alan höchst beunruhigend. Sein Bruder hatte Matthew entführt. Dean Reeve – ein Name, den inzwischen jeder kennt. Der Lieblingsschurke der Nation.«
»Der sich umgebracht hat.«
»Als ihm klar wurde, dass er uns nicht entkommen konnte, erhängte er sich unter einer Brücke bei einem Kanal drüben in Hackney. Wie unerträglich der Gedanke an seinen Bruder für Alan auch gewesen sein mag, gleichzeitig liebte er ihn, oder hatte zumindest das Gefühl, einen Teil von sich selbst zu verlieren, als Dean starb. Bestimmt hat er deswegen sehr gelitten. Aber Carrie meint noch etwas anderes, wenn sie sagt, ich hätte ihn benutzt.« Frieda betrachtete die drei mit ihren großen, dunklen Augen. »Bei einer Gelegenheit«, fuhr sie fort, »habe ich mit Alan gesprochen, um dadurch Zugang zur Denkweise seines Bruders zu finden – um dahinterzukommen, was in Deans Kopf vorging. Ohne Alan davon zu erzählen. Hätte ich es ihm gesagt, hätte es nicht funktioniert.«
»Sie haben ihn also tatsächlich benutzt?«
»Ja«, antwortete Frieda. Sie erschraken alle über ihre Stimme, die eher wütend als versöhnlich klang.
»Sind Sie der Meinung, dass das falsch war?«
Frieda schwieg ein paar Augenblicke und runzelte dabei angestrengt die Stirn. Sie ließ sich zurückgleiten in die Dunkelheit des Falls, hinein in seine Schatten und die damit verbundene düstere Angst. Wie sich herausgestellt hatte, war ihr Patient der eineiige Zwilling von Dean, einem Psychopathen, der nicht nur Matthew, sondern zwanzig Jahre zuvor auch ein kleines Mädchen namens Joanna entführt hatte. Besagte Joanna, die zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ein mageres, schüchternes Mädchen mit Zahnlücke war, dessen Verlust von seiner Familie endlos betrauert wurde, entpuppte sich am Ende als die fette, lethargische Frau von Dean – das ehemalige Entführungsopfer, in aller Öffentlichkeit versteckt und schließlich selbst zur Täterin geworden. Sashas DNA-Test hatte bewiesen, dass es sich bei der übergewichtigen Kettenraucherin Terry tatsächlich um die ehemals so magere Joanna mit den Knubbelknien handelte und dass Deans willige Mittäterin ihrerseits ebenfalls ein Opfer von ihm war. Hinzu kam noch etwas anderes, und daran musste Frieda immer denken, wenn sie nachts durch die Straßen Londons streifte, bis sie so müde war, dass sie endlich schlafen konnte, auch wenn die Sache sie bis in ihre Träume verfolgte: Friedas Entdeckung der auffallenden Ähnlichkeit zwischen Alan und Dean hatte die Entführung einer jungen Forscherin zur Folge gehabt, deren Leiche nie gefunden worden war. Auch jetzt musste Frieda wieder an das kluge, sympathische Gesicht von Kathy Ripon denken und an die Zukunft, die sie nicht haben würde. Vermutlich warteten die Eltern der jungen Frau immer noch auf ihre Rückkehr, so dass jedes Mal ihr Herz aussetzte, wenn es an der Tür klopfte.
Die drei Menschen, die nun als Richter vor Frieda saßen, wollten von ihr wissen, ob sie falsch gehandelt habe. Als ob es auf diese Frage eine einfache Antwort gäbe – eine Wahrheit, die nicht unsicher und trügerisch war. Sie blickte hoch und sah die drei wieder an.
»Ja«, sagte sie sehr deutlich, »ich habe mich gegenüber meinem Patienten Alan Dekker falsch verhalten. Trotzdem weiß ich nicht, ob mein Verhalten insgesamt falsch war. Zumindest glaube ich nach wie vor, dass ich sowohl falsch als auch richtig gehandelt habe. Was Alan an jenem Tag zu mir sagte, führte direkt zu Matthew. Alan hat damit einem kleinen Jungen das Leben gerettet, daran besteht kein Zweifel. Ich dachte eigentlich, er wäre froh darüber, dass er helfen konnte. Mir ist natürlich klar, dass man manche Dinge mit der Zeit anders sieht, und ich habe auch keine Ahnung, wie es ihm seitdem ergangen ist. Trotzdem verstehe ich nicht, wieso er nach gut einem Jahr plötzlich den Wunsch haben sollte, sich über etwas zu beschweren, das er ursprünglich durchaus akzeptierte. Darf ich noch etwas dazu sagen?«
»Bitte.« Professor Krull vollführte mit seinen schmalen, blau geäderten Händen eine ritterliche Geste.
»Carrie behauptet, meine Karriere sei mir wichtiger gewesen als der Seelenfrieden und das Glück ihres Mannes. Dabei war die ganze Sache überhaupt nicht förderlich für meine Karriere. Ich arbeite nicht für die Polizei, und ich habe auch kein Interesse daran, Ermittlerin zu werden. Außerdem muss ich seitdem mit der Tatsache leben, dass durch mein Handeln eine junge Frau verschwunden ist, aber das ist ein anderes Thema und gehört nicht hierher. Als Therapeutin glaube ich an Selbsterkenntnis und Eigenständigkeit. Was die Menschen während der Therapie über sich selbst herausfinden, bringt ihnen nicht immer Frieden und Glück. Tatsächlich ist das oft nicht der Fall. Aber eine solche Therapie kann es einem ermöglichen, Unerträgliches erträglich zu machen und die Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, so dass man zumindest bis zu einem gewissen Grad die Kontrolle über sein eigenes Leben hat. Das versuche ich mit meiner Arbeit zu bewirken, so gut ich kann. Was das Thema Glück betrifft …« Frieda hob beide Hände zu einer vielsagenden Geste.
»Wenn man Sie also bitten würde, sich zu entschuldigen …«
»Ich soll mich entschuldigen? Wofür? Bei wem? Ich würde gerne wissen, was Alan selbst zu der ganzen Sache zu sagen hat. Er sollte nicht zulassen, dass seine Frau sich zu seinem Sprachrohr macht. Was für eine Rolle spielt eigentlich Alan in dieser Geschichte?«
Statt einer Antwort folgte betretenes Schweigen.
»Das weiß ich nicht so genau«, meinte Professor Krull schließlich verlegen.
»Was soll dann das Ganze?« Frieda machte eine ausladende Handbewegung, die den langen ovalen Tisch, die protokollierende Frau an seinem Ende und die an der Wand hängenden Bilder von illustren Mitgliedern der Vereinigung einschloss. »Ich dachte, hier ginge es darum, eine Beschwerde zu untersuchen, die – auf welch indirektem Weg auch immer – von einem Patienten ausgeht. Seit wann sind wir dafür verantwortlich, wenn sich der Ehepartner eines Patienten unzufrieden fühlt? Was mache ich überhaupt hier? Was machen Sie alle hier?«
Professor Krull räusperte sich.
»Wir möchten auf jeden Fall einen Prozess verhindern. Die Wogen glätten.«
Frieda stand so abrupt auf, dass ihr Stuhl laut über die Holzdielen scharrte. Ihre Stimme bebte vor unterdrückter Wut.
»Die Wogen glätten? Sie wollen, dass ich mich für etwas entschuldige, das ich nach wie vor für gerechtfertigt halte oder zumindest nicht für ungerechtfertigt? Noch dazu bei einer Person, die an der ganzen Sache gar nicht direkt beteiligt war?«
»Doktor Klein«, begann Krull.
»Frieda«, sagte Jasmine Barber in beschwichtigendem Ton, »bitte bleiben Sie doch noch einen Moment.«
Thelma Scott verkniff sich jeden Kommentar. Der Blick ihrer grauen Augen folgte Frieda.
»Ich weiß mit meiner Zeit wirklich etwas Besseres anzufangen.«
Sie nahm ihren Mantel von der Stuhllehne und verließ den Raum, wobei sie darauf achtete, nicht die Tür hinter sich zuzuknallen. Als sie auf den Ausgang zusteuerte, erhaschte sie einen Blick auf eine Frau, die gerade links von ihr die Treppe hinunterging, und hielt inne. Irgendetwas an der kräftigen, gedrungenen Figur und dem kurzen braunen Haar kam ihr bekannt vor. Frieda schüttelte den Kopf und steuerte weiter auf den Ausgang zu, überlegte es sich dann aber doch anders und machte kehrt, um ebenfalls die Treppe zur Kantine hinunterzugehen. Sie hatte recht gehabt: Es war tatsächlich Carrie Dekker, Alans Ehefrau – die Frau, derentwegen sie soeben diese Scharade hatte über sich ergehen lassen müssen. Irgendwie erschien sie Frieda kleiner, untersetzter, älter und müder als vor einem Jahr, als sie sich das letzte Mal gesehen hatten. Ihr braunes Haar wirkte strähnig.
ENDE DER LESEPROBE