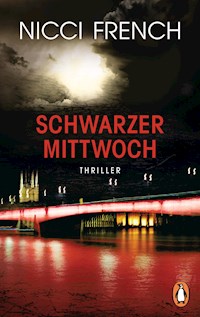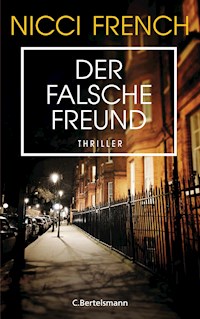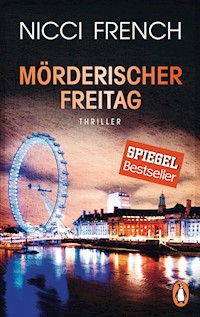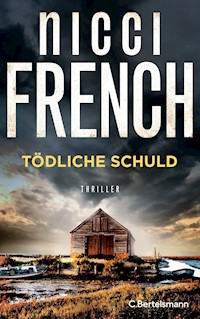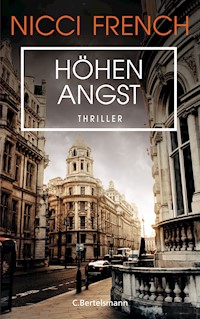9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Psychologin Frieda Klein als Ermittlerin
- Sprache: Deutsch
Vor der Vergangenheit gibt es kein Entkommen
Als Psychologin Frieda Klein unerwarteten Besuch von einer alten Freundin erhält, die sie um Hilfe für ihre Tochter bittet, ahnt sie nicht, worauf sie sich einlässt. Denn die Fünfzehnjährige wirkt vollkommen verstört. Frieda findet heraus, dass ihr Schreckliches widerfahren ist – und die Geschichte des Mörders reißt alte Wunden in ihr auf. Sie beschließt, sich endlich ihrer Vergangenheit zu stellen. Doch in der Heimatstadt Braxton begegnet man ihr mit Misstrauen, und bald schwebt Frieda in größter Gefahr …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
NICCI FRENCH
DUNKLER DONNERSTAG
PSYCHOTHRILLER
Deutsch von Birgit Moosmüller
C. Bertelsmann
Die Originalausgabe erschien 2014unter dem Titel »Thursday’s Children«bei Michael Joseph (Penguin), London.
1. Auflage
Copyright © 2014 by Joint-Up Writing, Ltd.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2014
beim C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Karte: Peter Palm
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-12916-3www.cbertelsmann.de
»Wer Augen hat zu sehen und Ohren zu hören, überzeugt sich, dass die Sterblichen kein Geheimnis verbergen können. Wessen Lippen schweigen, der schwätzt mit den Fingerspitzen, aus allen Poren dringt ihm der Verrat.«
Sigmund Freud
1
Es begann und endete mit einem Wiedersehen. Frieda Klein hasste es, Leute von früher zu treffen. Sie saß gerade vor ihrem Kamin und lauschte dem anheimelnden Knistern der Scheite. Neben ihr starrte Sasha ins Feuer, und neben Sasha stand ein Babykorb mit deren zehn Monate altem Sohn Ethan, von dem nur ein dunkler Haarschopf zu sehen und leises Schnarchen zu hören war. Draußen pfiff der Wind. Es war ein nebliger Tag gewesen. Windböen hatten das Herbstlaub durch die Straßen gefegt. Inzwischen war es dunkel, und Frieda saß mit ihrem Besuch drinnen am Feuer und versteckte sich vor dem nahenden Winter.
»Ich muss zugeben«, sagte Sasha, »dass ich schon gespannt darauf bin, eine alte Schulfreundin von dir kennenzulernen.«
»Sie war keine Freundin. Nur eine Klassenkameradin.«
»Was will sie?«
»Keine Ahnung. Sie hat mich angerufen und gesagt, sie müsse mich unbedingt sehen. Angeblich ist es sehr dringend. Sie hat sich für sieben angekündigt.«
»Wie spät ist es jetzt?«
Frieda warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Kurz vor sieben.«
»Mir ist jedes Zeitgefühl abhandengekommen. Seit Ethan auf der Welt ist, habe ich völlig vergessen, wie es sich anfühlt, eine Nacht durchzuschlafen. Mein Gehirn hat sich in Matsch verwandelt. Ich weiß nicht mal mehr, was für ein Tag ist. Mittwoch?«
»Donnerstag.«
»Gut. Fast schon Wochenende.«
Frieda starrte wieder ins Feuer. »Für mich ist der Donnerstag ein schlimmer Tag, vielleicht sogar der schlimmste der Woche. Wobei der Tag an sich nichts dafür kann. Er erinnert einen nur daran, dass die Woche sich schon zu lange hinzieht.«
Sasha schnitt eine Grimasse. »Interpretierst du da nicht ein bisschen viel hinein?« Sie spähte in den Korb und streichelte ihrem Sohn übers Haar. »Ich liebe ihn über alles, aber manchmal bin ich richtig erleichtert und froh, wenn er schläft. Ist es furchtbar, so etwas zu sagen?«
Frieda sah ihre Freundin an. »Geht Frank dir zur Hand?«
»Er tut, was er kann, aber seine Arbeit nimmt ihn ziemlich in Anspruch. Wie er selbst immer sagt: Einer muss ja dafür sorgen, dass die Schuldigen auf freiem Fuß bleiben.«
»Das gehört nun mal zu seinem Beruf«, meinte Frieda. »Schließlich ist er Strafverteidiger, und …«
Die Türklingel ließ sie abrupt innehalten. Frieda warf Sasha einen bedauernden Blick zu.
»Du hast aber schon vor aufzumachen, oder?«, fragte Sasha.
»Am liebsten würde ich mich verstecken.«
Als sie schließlich doch die Tür öffnete, hörte Frieda eine Stimme, die irgendwo aus der Dunkelheit zu kommen schien, und ehe sie es sich versah, wurde sie umarmt.
»Frieda Klein«, sagte die Frau, »dich würde ich überall wiedererkennen. Du bist deiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten.«
»Mir war gar nicht klar, dass du meine Mutter je kennengelernt hast.« Frieda führte ihre Besucherin ins Wohnzimmer und deutete zum Kamin hinüber. »Das ist meine Freundin Sasha. Und das ist Madeleine Bucknall«, fügte sie an Sasha gewandt hinzu.
»Maddie«, korrigierte die Frau, »Maddie Capel. Ich habe geheiratet.«
Maddie Capel stellte ihre große Tasche aus geprägtem Leder ab und befreite ihren Hals von einem karierten Schal. Dann schlüpfte sie aus ihrem schweren braunen Mantel, den sie wortlos Frieda reichte. Darunter kam ein bordeauxrotes Kleid mit Crossover-Ausschnitt zum Vorschein, zu dem sie Lederstiefel mit Keilabsatz trug. Ihr Schmuck bestand aus einer massiven goldenen Halskette und kleinen goldenen Ohrringen, und sie duftete nach einem teuren Parfüm. Zielstrebig steuerte sie auf den Kamin zu, wo sie einen Blick in den Korb warf.
»Was für ein niedliches kleines Schätzchen«, sagte sie. »Deines, Frieda?«
Frieda deutete auf Sasha.
»Wenn ich das sehe, möchte ich sofort auch noch eines«, erklärte Maddie. »In dem Alter finde ich sie einfach entzückend. Es gibt nichts Schöneres als so ein winziges warmes Bündel. Ist es ein Junge oder ein Mädchen?«
»Ein Junge.«
»So ein Süßer. Läuft er schon?«
»Er ist erst zehn Monate alt.«
»Man braucht nur ein bisschen Geduld.«
Frieda zog einen weiteren Stuhl ans Feuer, und Maddie ließ sich darauf nieder. Sie hatte langes braunes Haar, das kunstvoll zerzaust wirkte und von blonden Strähnen durchzogen war. Ihr Gesicht war sorgfältig geschminkt, was aber nur betonte, dass die Haut über ihren Wangenknochen spannte und sich rund um die Augen und an den Mundwinkeln bereits kleine Fältchen gebildet hatten. Frieda hatte sie aus ihrer Schulzeit lachend und laut in Erinnerung, aber unter der fröhlichen Fassade war immer eine Angst zu spüren gewesen: zur Gruppe zu gehören oder nicht, einen Freund zu haben oder nicht.
»Soll ich euch beide ein bisschen allein lassen?«, fragte Sasha.
»Nein, nein, ich finde es schön, eine Freundin von Frieda kennenzulernen. Wohnen Sie auch hier im Haus?«
Ein Lächeln huschte über Sashas Gesicht. »Nein, ich lebe mit meinem Partner zusammen. In einem anderen Stadtteil.«
»Ja, natürlich. Danke, vielen Dank«, fügte sie an Frieda gewandt hinzu, als diese ihr eine Tasse Tee reichte. Sie trank einen Schluck und blickte sich dann neugierig um. »Was für ein nettes kleines Nest du hier hast. Wirklich gemütlich.« Sie nahm einen weiteren Schluck. »Ich habe in der Zeitung über dich gelesen, Frieda. Darüber, wie du bei diesem schrecklichen Fall mit all den jungen Frauen mitgeholfen hast. Eine hast du sogar gerettet.«
»Aber nur eine«, entgegnete Frieda, »und das auch nicht allein.«
»Wie können Menschen nur so etwas tun?«
Einen Moment lang herrschte Schweigen.
»Worüber wolltest du mit mir sprechen?«
Maddie trank erneut von ihrem Tee.
»Es ist mir unbegreiflich, wieso wir uns derart aus den Augen verloren haben«, meinte sie schließlich. »Du weißt ja, dass ich nach wie vor in Braxton lebe. Verschlägt es dich manchmal in deine frühere Heimat?«
»Nein.«
»Ein paar von der alten Truppe sind noch da.« Sie setzte ein verschmitztes Lächeln auf. »Ich erinnere mich an dich und Jeremy. Um den habe ich dich damals ganz schön beneidet, er war wirklich ein Knaller. Natürlich ist er später weggegangen. Bist du mit ihm in Kontakt geblieben?«
»Nein.«
»Ich habe Stephen geheiratet, Stephen Capel. Kanntest du ihn? Wir hatten ein paar gute Jahre, bevor es bergab ging. Inzwischen hat er wieder geheiratet, wohnt aber noch in der Nähe.«
»Am Telefon hast du gesagt, du müsstest mit mir reden.«
Maddie nahm einen weiteren Schluck Tee und blickte sich dann suchend um.
»Kann ich die Tasse irgendwo abstellen?«
Frieda nahm sie ihr ab.
»Ich habe in der Zeitung von dir gelesen.«
»Ja, das sagtest du bereits.«
»Nicht nur einmal«, fügte Maddie hinzu. »Du hast ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt.«
»Darauf hätte ich gerne verzichtet.«
»Ja, das muss manchmal schwierig sein. Aber sie haben geschrieben, dass du nicht nur Verbrechen aufklärst …«
»Das ist nicht wirklich …«, begann Frieda, während erneut ein Lächeln über Sashas Gesicht huschte.
»Nein«, fuhr Maddie fort, »aber in den Zeitungsartikeln hieß es, du seist Psychologin.«
»Ich bin Psychotherapeutin.«
»Mit dem ganzen Fachjargon kenne ich mich nicht besonders gut aus«, erklärte Maddie. »Bestimmt besteht da ein Unterschied. So genau weiß ich das nicht, aber wenn ich es richtig verstanden habe, klagen die Leute dir ihr Leid, und du hilfst ihnen. Stimmt das?«
Frieda beugte sich vor.
»Was willst du?«
»Es geht nicht um mich, falls du das meinst.« Maddie stieß ein nervöses kleines Lachen aus. »Was nicht heißen soll, dass ich nicht auch ein bisschen Hilfe gebrauchen könnte. Als Stephen ging, musste ich tagelang weinen, nein, eigentlich waren es eher Wochen. Ich wusste nicht, an wen ich mich wenden sollte.«
Wieder herrschte einen Moment Schweigen.
»Mir ist klar, dass so eine Trennung etwas Schreckliches ist«, erwiderte Frieda. »Aber bitte sag mir doch endlich, warum du mich unbedingt sehen wolltest.«
»Du findest das Ganze bestimmt albern. Wahrscheinlich war es reine Zeitverschwendung, die weite Strecke vom Land hereinzufahren.«
»Soll ich euch nicht doch allein lassen?«, fragte Sasha erneut.
»Nein«, antwortete Maddie. »Es handelt sich bloß um ein Gespräch zwischen alten Freundinnen.«
»Sag mir, was du von mir willst.«
Maddie zögerte. Frieda hatte diesen Moment schon Dutzende Male mit ihren Patienten und Patientinnen erlebt. Einer der schwierigsten Augenblicke jeder Therapie bestand darin, die Angst des Patienten zum ersten Mal zu benennen. Das war wie ein Sprung vom Rand einer Klippe, hinein in die Dunkelheit.
»Es geht um meine Tochter, Becky«, erklärte Maddie. »Eigentlich heißt sie Rebecca, aber alle nennen sie Becky. Sie ist fünfzehn, fast schon sechzehn.«
»Hat es einen Vorfall gegeben?«
»Nein, nein, nichts dergleichen. Es ist schwer in Worte zu fassen. Becky war so ein süßes kleines Mädchen. Beim Anblick dieses kleinen Jungen da im Korb musste ich an die Zeit denken, als alles noch ganz einfach war. Ich brauchte mich bloß um sie zu kümmern. Weißt du, als Becky in dem Alter war, dachte ich, ich würde eine ganze Schar Kinder kriegen, die beste Mutter der Welt werden und sie vor allem beschützen. Ich war so jung, als Becky kam, fast noch selber ein Kind. Aber dann …« Sie holte tief Luft, als ränge sie um Fassung. »Ich konnte kein zweites mehr bekommen. Und dann verließ mich Stephen. Es war wahrscheinlich meine Schuld. Ich versuchte, Becky nicht spüren zu lassen, wie es mir ging, aber das gelang mir wohl nicht besonders gut. Sie war damals sechs. Das arme kleine Ding. Ich selbst war erst Mitte zwanzig und ständig unterwegs.« Ihre Stimme begann zu zittern. Sie hielt einen Moment inne. »Für sie muss es eine harte Zeit gewesen sein, aber ich dachte, inzwischen wären wir über den Berg. Ich schätze, ich hatte schon immer Angst vor den Teenagerjahren.« Sie warf Frieda einen Blick zu. »Vielleicht, weil ich mich noch allzu gut an unsere eigene Teenagerzeit erinnern kann. Wir haben damals ein paar Dinge angestellt, die wir inzwischen wohl eher bereuen, oder?«
Eine Stimme in Frieda entgegnete: Was meinst du mit »wir«? Wir waren keine Freundinnen. Wir haben überhaupt nichts miteinander angestellt. Doch sie verkniff sich jeden Kommentar und wartete.
»Seit etwa einem Jahr hat sie sich sehr verändert. Ich weiß, was du gleich sagen wirst: Sie ist eben in der Pubertät. Wieso mache ich mir da solche Sorgen? Tja, ich mache mir in der Tat Sorgen. Anfangs war sie nur verschlossen und launisch. Sie wollte über nichts mit mir reden. Ich habe mich gefragt, ob vielleicht Drogen oder Jungs im Spiel sind. Oder womöglich Drogen und Jungs. Ich habe versucht, das herauszufinden. Ich habe versucht, ihr mit Verständnis zu begegnen. Ohne jeden Erfolg.
Vor etwa einem Monat wurde es dann schlimmer. Sie kam mir irgendwie anders vor und sah auch anders aus. Plötzlich wollte sie nicht mehr richtig essen. Wobei sie bereits seit Längerem so eine alberne Diät machte und sowieso schon klapperdürr war. Mittlerweile frage ich mich, wie sie es überhaupt noch schafft, am Leben zu bleiben. Ständig zermartere ich mir das Gehirn, was ich für sie kochen könnte, aber egal, was ich ihr vorsetze, sie schiebt es nur auf ihrem Teller herum. Und selbst wenn sie isst, sorgt sie hinterher dafür, dass sie es wieder von sich gibt. Zumindest glaube ich das. Außerdem schwänzt sie die Schule und macht keine Hausaufgaben.«
»Hat sie regelmäßigen Kontakt mit ihrem Vater?«
»Stephen ist in der Hinsicht ein hoffnungsloser Fall. Er meint, es sei nur eine Phase. Sie werde schon darüber hinwegkommen.«
»Was erwartest du von mir?«, fragte Frieda.
»Kannst du nicht mit ihr sprechen? Das ist schließlich dein Beruf, oder? Knöpf sie dir doch mal vor.«
»Ich bin mir nicht sicher, ob dir wirklich klar ist, was ich mache. Ich begleite meine Patienten grundsätzlich über einen längeren Zeitraum hinweg, um Problemen, die sie im Leben haben, auf den Grund zu gehen. Ich frage mich, ob deine Tochter sich nicht besser an einen Schulpsychologen oder Beratungslehrer wenden sollte.«
»Dazu ist Becky bestimmt nicht bereit. Das habe ich alles schon versucht. Mittlerweile bin ich völlig verzweifelt. Ich weiß einfach nicht, an wen ich mich noch wenden soll. Bitte! Tu einer alten Schulfreundin den Gefallen!«
Frieda betrachtete Maddies flehende Miene. Das Ganze behagte ihr überhaupt nicht. Zum einen missfiel ihr, dass diese Frau aus ihrer Vergangenheit behauptete, mit ihr befreundet gewesen zu sein, und etwas verlangte, das sie ihr im Grunde nicht geben konnte. Zum anderen hatte sie ein ungutes Gefühl, weil Sasha Zeugin des Ganzen wurde.
»Ich bezweifle, dass ich in diesem Fall die richtige Ansprechpartnerin bin«, erklärte sie. »Aber wenn du mir deine Tochter bringst, rede ich mit ihr. Mal sehen, ob ich dir oder ihr einen Rat geben kann. Aber versprechen kann ich gar nichts.«
»Wunderbar. Wenn du möchtest, nehme ich auch an dem Gespräch teil.«
»Ich werde allein mit ihr reden müssen, jedenfalls beim ersten Mal. Sie muss wissen, dass es sich um ein vertrauliches Gespräch handelt und sie mir alles offen sagen kann – das heißt, wenn sie überhaupt etwas sagen möchte. Womöglich ist sie noch gar nicht bereit zu einem solchen Gespräch oder zumindest nicht zu einem Gespräch mit mir.«
»Oh, ich bin sicher, mit dir wird sie reden.«
Maddie stand auf und holte ihren Mantel, als müsste sie schnell das Weite suchen, ehe Frieda es sich anders überlegen konnte. Rasch schlüpfte sie hinein und wickelte sich den Schal wieder um den Hals. Frieda schien es, als würde sie ihre ehemalige Klassenkameradin beim Anlegen einer Rüstung beobachten. Nachdem Maddie sich verabschiedet hatte und bereits halb zur Tür hinaus war, drehte sie sich noch einmal um.
»Irgendetwas an meiner Tochter macht mir Angst«, erklärte sie. »Ist das nicht schrecklich?«
2
Ich bin nur gekommen, damit meine Mutter endlich Ruhe gibt.«
»Deswegen brauchst du aber nicht draußen in der Nässe stehen zu bleiben. Komm doch wenigstens kurz herein.«
Es schüttete schon eine ganze Zeit lang. Der Himmel sah gleichmäßig grau aus, und das Herbstlaub auf den Pflastersteinen war vom prasselnden Regen durchweicht.
Becky trat ein und zog die Tür hinter sich zu. Sie hatte langes, dunkles Haar, das ihr klatschnass am Kopf klebte, wodurch ihre fast schwarzen Augen in ihrem verkniffenen Gesicht besonders groß wirkten.
»Sie wollte mich nicht mal allein herkommen lassen. Ich bin fast schon sechzehn, aber sie hat darauf bestanden, sich mit mir in den Zug zu setzen und die ganze Strecke bis zur Goodge Street mitzufahren. Da ist sie jetzt. Wahrscheinlich kauft sie schon wieder Schuhe oder sonst was. Sie hat einen Schuhfimmel.«
»Setz dich doch ans Feuer. Darf ich dir deine Jacke abnehmen?«
»Ich lass sie lieber an.« Das Mädchen wickelte sich noch fester darin ein. Trotz der dicken Wolle konnte Frieda sehen, wie dünn Becky war. Ihre Handgelenke waren extrem knochig, die Beine auf Höhe der Oberschenkel nicht breiter als die Knie, und ihre Wangenknochen standen deutlich hervor. Sie wirkte regelrecht unterernährt. Ihre Gesichtshaut spannte.
»Soll ich dir eine Tasse Tee machen?«
»Nein, danke. Oder haben Sie Kräutertee?«
»Pfefferminz?«
»Pfefferminz ist in Ordnung.«
»Mach es dir gemütlich, und wärm dich ein bisschen auf. Magst du einen Keks zum Tee?«
»Nein, danke, nur Tee.«
Den Flammen zugewandt, streckte sie ihre zarten Finger der Hitze entgegen, während Frieda in die Küche ging und kurze Zeit später mit zwei Tassen Tee zurückkehrte – Pfefferminz für Becky und Assam für sich selbst. Becky legte die Hände um die Tasse, um sich daran zu wärmen, und hielt ihr finster dreinblickendes kleines Gesicht in den Dampf.
»Es ist immer schwer, einen Anfang zu finden«, erklärte Frieda.
Becky runzelte die Stirn und murmelte irgendetwas vor sich hin.
»Es bringt nichts herzukommen, ohne es selber zu wollen. Ich werde dich nicht zwingen, etwas preiszugeben, das du gar nicht sagen möchtest – dir nichts entlocken, das du lieber für dich behalten würdest. Du bist hier, weil deine Mutter sich Sorgen um dich macht und mich gebeten hat, mit dir zu sprechen. Aber ich will weder auf dich einreden noch dir sagen, was du tun sollst. Viel lieber würde ich dir zuhören – falls du das Bedürfnis hast, irgendetwas loszuwerden.«
Becky zuckte ruckartig mit den Schultern.
»Ich komm schon klar.«
»Trotzdem bist du hier.«
»Nur weil sie mich gezwungen hat.«
»Wie hat sie dich denn gezwungen?«
»Sie hat mir vorgeworfen, nur an mich selbst zu denken und eine Egoistin zu sein. Und sie hat gesagt, sie leide ebenfalls, und wenn ich auch nur ein bisschen an jemand anderen denken würde, könnte ich ihr wenigstens diesen kleinen Gefallen tun.«
»Du weißt, dass ich Therapeutin bin.«
»Demnach hält sie mich neuerdings nicht nur für egoistisch, sondern auch noch für verrückt.«
»Sie befürchtet, du könntest in irgendwelchen Schwierigkeiten stecken.«
»Schon klar. Drogen. Oder Jungs. Das ist alles, woran sie denken kann. Hat Sie Ihnen das gesagt?«
»Steckst du in Schwierigkeiten?«
»Immerhin bin ich fünfzehn. Gehört das nicht dazu, wenn man fünfzehn ist? Dass sich alles ätzend und beschissen anfühlt?«
»Beschissen. Fühlt sich für dich wirklich alles so an?«
»Ist das Ihre Methode?« Becky funkelte Frieda zornig an. »Sie greifen völlig willkürlich irgendein blödes Wort heraus, drehen es einem im Mund um und sagen dann: Ach, wie interessant, sie findet alles beschissen. Beschissen, Scheiße, zum Kotzen. Ich kann das genauso.« Sie sah sich im Raum um. Ihr Blick blieb an dem Schachtisch hängen, den Frieda von ihrem Vater geerbt hatte. »Sie spielen Schach. Sie bewegen Figuren auf einem Brett. Betrachten Sie das Leben auch als Schachpartie? Als großes Spiel, bei dem es ums Gewinnen geht?«
»Nein, so betrachte ich das Leben nicht.«
»Sie sind berühmt, nicht wahr? Ich habe Sie gegoogelt, müssen Sie wissen.«
»Und?«
»Ich habe beim Lesen eine Gänsehaut bekommen. Ich bin nicht wie die vermissten Mädchen.«
»Aber auf einem wirklich sicheren Weg bist du auch nicht, oder?«
»Wie meinen Sie das?«
»Du steckst voller Wut und Angst und Unruhe. Ich weiß, dass du oft die Schule schwänzt und deine Leistungen nachlassen.«
»Ach, darum geht es. Ich werde keine Einsen mit Sternchen mehr bekommen.«
»Außerdem sehe ich, dass du nicht richtig isst«, fuhr Frieda fort.
Becky starrte sie grimmig an. »Alle, die ich kenne, sind entweder zu fett oder zu dünn«, erklärte sie.
»Es widerstrebt dir, dich deiner Mutter anzuvertrauen.«
»Sie ist die Letzte, mit der ich reden würde. Da würde ich noch eher zu den Müttern meiner Freundinnen gehen als zu ihr.«
»An deiner Schule gibt es doch bestimmt einen Beratungslehrer.«
»Ich muss einfach nur ein paar Sachen für mich klären.«
»Was für Sachen?«
»Irgendwelche Sachen eben. Sie brauchen gar nicht so zu tun, als könnten Sie in mich hineinsehen. Das finde ich zum Kotzen.«
»Warum?«
»Weil es gruselig ist.«
Frieda musterte Becky einen Moment eindringlich. Dann sagte sie: »Ich weiß, dass dich das noch wütender machen wird, aber ich hätte gerne, dass du ein bisschen über deine Sprache nachdenkst.«
»Was meinen Sie mit ›meine Sprache‹?«
»Ätzend, beschissen, Scheiße, zum Kotzen, gruselig.«
»Und? Das sind doch nur Worte. Jeder verwendet solche Worte.«
»Es ist eine Sprache des Ekels.«
»Na und? Vielleicht ekelt es mich ja tatsächlich.«
»Aus welchem Grund?«
»Wollen Sie mich denn gar nicht nach meinem Dad fragen?«
»Nach deinem Vater? Wieso sollte ich?«
»Mum hat gemeint, Sie würden mich bestimmt nach ihm fragen. Darum dreht sich das Ganze nämlich, sagt Mum. Sie bildet sich ein, dass ich ihr die Schuld an der Scheidung gebe und ihn zu leicht davonkommen lasse. Nach Mums Meinung kann ich auf sie besser wütend sein, weil ich weiß, dass sie mich im Gegensatz zu ihm nicht verlassen wird – weil sie nämlich bei mir bleiben muss, egal, wie es läuft. Ihr zufolge hat man als Mutter gar keine andere Wahl. Man kann seiner nervigen Tochter nicht entkommen. Dabei habe ich nicht darum gebeten, geboren zu werden. Laut Mum verschließe ich die Augen vor der Tatsache, dass Dad mit dieser anderen Frau auf und davon ist, obwohl ich es andererseits natürlich weiß und deswegen …«
»Moment mal, Becky.« Frieda brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen. »Ich will nicht die Meinung deiner Mutter hören.«
»Wieso nicht? Schließlich haben Sie mich doch nur herbestellt, weil Sie und Mum in der Schule beste Freundinnen waren oder so was in der Art.«
Frieda machte den Mund auf, um zu widersprechen, riss sich dann aber am Riemen.
»Darum geht es jetzt überhaupt nicht«, erklärte sie. »Es geht um dich, Becky Capel, nicht um deine Mutter, und ganz bestimmt nicht um die Tatsache, dass sie und ich uns vor vielen Jahren kannten. Du kannst mir anvertrauen, was du willst, ohne dass ich es ihr oder sonst jemandem weitererzählen werde. Du kannst dich hier sicher fühlen und mir Sachen sagen, die du anderen vielleicht nicht erzählen kannst, mir aber schon, weil ich für dich eine Fremde bin.«
Becky wandte sich ab. Sie schwieg eine ganze Weile.
»Ich bringe mich selbst zum Kotzen«, murmelte sie schließlich.
»Meinst du das in einem übertragenen oder im wörtlichen Sinn?«
»Beides.« Sie stieß ein ersticktes Lachen aus. »Wie sagt man noch mal? Metaphorisch, ja, das ist das richtige Wort. Meine Lehrerin wäre stolz auf mich. Ich bringe mich im wörtlichen und im metaphorischen Sinn zum Kotzen.«
»Hast du das schon mal jemandem erzählt?«
»Nein. Es ist widerlich.«
»Weißt du, warum du das tust?«
»Essen finde ich auch widerlich. Die Leute schieben sich Brocken von toten Tieren und schimmligem Käse und dreckige, aus dem Boden ausgegrabene Wurzeln in den Mund und kauen darauf herum. Dann schlucken sie das Zeug hinunter, sodass alles tief in ihrem eigenen Körper landet und dort drinnen verfault.«
Becky warf einen Blick zu Frieda hinüber, um zu sehen, was für eine Wirkung sie mit ihren Worten erzielte.
»Äpfel sind in Ordnung«, fuhr sie fort. »Und Orangen.«
»Demnach hungerst du also, weil’s dich vor dem Essen ekelt?«
»Pflaumen mag ich nicht. Besonders widerlich finde ich Bananen und Feigen.«
»Becky …«
»Was? Dieses blöde Gespräch nervt mich. Wen interessiert es, was ich esse? Auf der ganzen Welt hungern die Menschen, und hier ist ein armes kleines reiches Mädchen am Kotzen, weil …«
»Weil?«
»Weil. Weil nichts. Es ist nur eine Phase.«
»Das Schuleschwänzen auch?«
»Das langweilt mich alles so!«
»Die Schule?«
»Ja.«
»Wenn dich die Schule langweilt, was findest du denn dann interessant?«
»Früher bin ich gerne geschwommen, vor allem im Meer, bei hohen Wellen. Im Regen.«
Gegen ihren Willen spürte Frieda plötzlich den Sog einer alten Erinnerung: die graue Nordsee mit ihrer wilden Brandung, die auf sie zudonnerte, während sich unter ihren Fußsohlen die Kieselsteine bewegten.
»Aber jetzt nicht mehr?«
»Es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal am Meer war. Außerdem ist jetzt schon fast Winter. Ich hasse es, wenn ich friere. Die Kälte dringt mir bis in die Knochen.«
Frieda wollte gerade etwas antworten, als es an der Haustür klopfte. Draußen stand Maddie, in der einen Hand einen großen, aufgespannten Schirm, in der anderen eine Einkaufstüte. Ihre Wangen schimmerten feucht und rosig.
»Komme ich zu früh?«
»Zu früh wofür?«
»Ich dachte, die Sitzung wäre inzwischen zu Ende.«
»Es ist keine Sitzung, sondern ein Gespräch.«
Maddie klappte den Schirm zu und lehnte sich Frieda mit verschwörerischer Miene entgegen.
»Was hältst du von ihr?«
»Bitte?«
»Was hältst du von Becky?«
»Ich halte sie für eine sehr intelligente junge Frau, die nur ein paar Schritte von uns entfernt sitzt und vermutlich jedes Wort hört, das wir von uns geben.«
»Aber hat sie irgendwas gesagt?«
»Ich rufe dich heute Abend an oder schicke dir eine Mail. Dann können wir das in Ruhe diskutieren.«
»Es wird doch wieder alles gut mir ihr, oder? Kannst du ihr helfen?«
Ein paar Stunden später stieg Frieda hinauf in ihr Arbeitszimmer unter dem Dach und lauschte eine Weile dem Prasseln des Regens und dem Wind, der an den Fenstern rüttelte. Etliche Minuten saß sie so da, tief in Gedanken versunken, bis sie schließlich nach dem Telefon griff. Maddie meldete sich in erwartungsvollem Ton.
»Ich hatte schon gehofft, dass du es bist. Becky wollte mir kein Wort über ihren Besuch bei dir erzählen. Ich hoffe, sie war dir gegenüber nicht allzu mürrisch.«
»Nein, war sie nicht.«
»Hast du irgendetwas herausgefunden?«
»Ich weiß nicht so recht, wie du das meinst. Allerdings bin ich zu dem Ergebnis gelangt, dass deine Tochter tatsächlich Hilfe braucht.«
»Deswegen habe ich sie ja zu dir geschickt.«
»Ich habe sie heute zu mir nach Hause kommen lassen und mich ein bisschen mit ihr unterhalten – weil du mich darum gebeten hattest, mit ihr zu sprechen. Meiner Meinung nach benötigt sie professionelle Hilfe.«
»Du sagst das so ernst!« Maddie stieß ein nervöses, schrill klingendes Lachen aus. »Ich brauche nur ein bisschen Beratung. Jemanden, der mir die Richtung weist. Das kannst du doch, oder? Ihren Launen auf den Grund gehen und sie wieder in die richtige Spur bringen.«
»Es ist wichtig, hier klare Trennlinien zu ziehen. Sie braucht eine geeignete Person für eine Therapie und nicht eine Frau, die – zumindest in ihren Augen – mit ihrer Mutter in Verbindung steht.«
»Du bist doch Therapeutin, oder etwa nicht? Und was unsere Verbindung betrifft …« Ihr Ton wurde ein paar Nuancen kälter. »Im Grunde haben wir sowieso nie zur selben Clique gehört, stimmt’s? Also brauchen wir uns darüber auch nicht den Kopf zu zerbrechen.«
»Ich werde mit Becky einen offiziellen Gesprächstermin vereinbaren«, erklärte Frieda. »Nur so kann ich mir wirklich ein Bild von ihr machen. Danach lasse ich dich wissen, was sie meiner Meinung nach braucht, und empfehle dir jemanden – wobei es wichtig wäre, dass sie dabei auch ein Wörtchen mitzureden hat.«
Maddies Ton wurde wieder wärmer. »Wunderbar. Aber was meinst du mit einem offiziellen Termin? Das klingt ein bisschen beängstigend.«
»Das Gespräch wird in meiner Praxis in Bloomsbury stattfinden. Ich gebe dir die Adresse. Es wird exakt fünfzig Minuten dauern, und ich werde dir dafür fünfundsiebzig Pfund berechnen.«
»Du willst, dass ich dich bezahle?«
»Ja.«
»Das finde ich ehrlich gesagt ganz schön kaltblütig von dir.«
»Ich habe Becky heute zu mir nach Hause kommen lassen, weil ich dich kenne«, entgegnete Frieda. »Das nächste Mal kommt sie als Patientin zu mir. Das bedeutet, dass du mich genauso bezahlen musst wie einen Elektriker oder einen Klempner.«
»Du bist sehr streng. Ist das die Summe, die du von allen deinen Patienten verlangst?«
»Es handelt sich um ein Honorar durchschnittlicher Höhe. Falls du nicht in der Lage bist, so viel zu bezahlen, komme ich dir gerne entgegen.«
»Ich verfüge über genügend Geld, Frieda, keine Sorge. Zumindest in der Hinsicht hat Stephen mich gut versorgt zurückgelassen. Es erscheint mir nur ein wenig seltsam, für einen kleinen Gefallen zu bezahlen.«
»Es handelt sich nicht mehr um einen Gefallen, sondern um das, was Becky braucht und ich beruflich mache.«
3
Frieda fuhr mit der U-Bahn bis zum Finsbury Park. Den Rest des Weges wollte sie gehen. Sie brauchte einen klaren Kopf. Energischen Schrittes eilte sie am Rand des Parks entlang und bog dann in die alte Schneise ein, die sich wie ein geheimer grüner Tunnel durch Hornsey bis zum Fuß von Highgate Hill zog. Früher war dort mal eine Eisenbahnlinie verlaufen, doch inzwischen hatte man die ehemalige Trasse wieder den Bäumen, den Hundebesitzern und den Füchsen überlassen. Überall war gelbes Herbstlaub: Zum Teil spürte sie es nass und matschig unter ihren Schuhsohlen, zum Teil blies der Wind es ihr ins Gesicht. Ein feuchter Geruch nach Fäulnis hing in der Luft, als gäbe es irgendwo Pilze, auch wenn Frieda keine entdecken konnte. Es fühlte sich an wie eine Zeit für Veränderungen: für Schlussstriche und Neuanfänge. Frieda verfasste im Geist gerade eine Art Rede, als ein Klingelton sie aus ihren Gedanken riss. Sie warf einen Blick auf das Display ihres Telefons. Es war ihr alter Schüler, Jack Dargan.
»Oh, entschuldige«, sagte Jack, nachdem sie sich gemeldet hatte, »ich erschrecke immer ein bisschen, wenn du tatsächlich mal rangehst.«
»Ich habe festgestellt, dass nicht rangehen noch komplizierter ist als rangehen.«
»Das muss ich mir erst durch den Kopf gehen lassen.«
»Hat dein Anruf einen besonderen Grund?«
»Können wir uns treffen?«
»Ist etwas passiert?«
»Ich muss dir etwas sagen.«
Frieda empfand einen Anflug von Beunruhigung. Für gewöhnlich rief Jack sie nur an, wenn er Kummer hatte. Er machte immer wieder Phasen des Zweifels durch, in denen er seine Arbeit als Psychoanalytiker grundsätzlich infrage stellte.
»Gibt es ein Problem?«, fragte sie.
»Nein, nein, fang besser gar nicht erst an zu raten.«
Frieda meinte, er solle doch später bei ihr vorbeischauen, aber er bestand auf einem Treffen auf neutralem Boden und schlug das Lord Nelson vor, ein Pub gleich bei ihr um die Ecke. Sie vereinbarten, sich in zwei Stunden dort zu treffen.
Eine halbe Stunde später saß Frieda in einem – ihr mittlerweile sehr vertrauten – Hinterzimmer im ersten Stock eines Reihenhauses in Highgate und blickte in das faltige, gütige und äußerst kluge Gesicht ihrer eigenen Therapeutin, Thelma Scott. Frieda holte tief Luft und begann mit der Rede, die sie unterwegs einstudiert hatte.
»Ich habe im Zusammenhang mit dem Thema Therapie seit jeher zwei Grundprobleme, und zwar zwei völlig gegensätzliche: Zum einen finde ich das Anfangen schwierig, weil man ja erst mal gar keine Therapie machen will beziehungsweise sich einbildet, keine zu brauchen. Die zweite Schwierigkeit ist das Aufhören, entweder, weil man inzwischen süchtig ist nach den Sitzungen, oder einfach, weil man nicht weiß, wie man sie zu Ende bringen soll. Es ist schwer zu sagen: ›Genug, das war’s.‹«
»Trotzdem möchten Sie das heute sagen, nicht wahr?«, entgegnete Thelma lächelnd, aber dennoch ernst. »Sie finden, es ist genug?«
»Ja.«
»Was lässt Sie zu diesem Schluss kommen?«
»Wir waren zusammen auf einer Reise«, erklärte Frieda, »und ich glaube, wir sind am Endpunkt angelangt, oder zumindest an einem Endpunkt. Ich bin Ihnen sehr dankbar, wirklich.«
»Wie Sie sehr gut wissen, liebe Frieda, beenden die meisten Patienten ihre Therapie nicht schlagartig, sondern schrittweise. Das kann Wochen oder sogar Monate dauern.«
»Ich mag keine Abschiede. Für gewöhnlich verschwinde ich einfach, ohne mich überhaupt zu verabschieden.«
Wieder huschte ein Lächeln über Thelmas faltiges Gesicht.
»Wenn ich Ihre Therapeutin wäre, hätte ich jetzt das Bedürfnis, das zu besprechen. Oh, da fällt mir gerade ein …«
Nun musste Frieda ihrerseits lächeln.
»Sie glauben, ich liege falsch?«
Thelma schüttelte bedächtig den Kopf.
»Als Sie das erste Mal zu mir kamen – wie lange ist das nun her, achtzehn Monate? –, da war ich mir nicht sicher, was eine Therapie in Ihrem Fall bringen würde. Ich hatte so etwas noch nie erlebt. Als Sie mich anriefen, um einen Termin zu vereinbaren, wusste ich ja bereits, dass jemand Sie mit dem Messer attackiert hatte und Sie dabei fast ums Leben gekommen wären. Sie hatten ein schweres Trauma erlitten und brauchten Hilfe. Aber kurz vor unserer ersten Sitzung waren Sie dann auch noch in einen schrecklichen Vorfall verwickelt, bei dem ein Mann starb und ein enger Freund von Ihnen schwer verletzt wurde. Sie erzählten mir danach, wie Sie den ganzen Weg zu Fuß nach Hause gegangen waren, dreißig Kilometer, noch dazu völlig blutverschmiert.«
»Es handelte sich nicht um mein eigenes Blut.«
»Ja, ich kann mich daran erinnern, dass Sie mich auf diese Tatsache schon damals hingewiesen haben. Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich mich anfangs gefragt, ob Sie nicht eigentlich eine Weile in eine Klinik gehört hätten.«
»Ich stand vollkommen in Flammen«, erklärte Frieda, »und hatte keine Ahnung, wie ich mich selbst löschen sollte.«
Nun folgte eine lange Pause.
»Ich glaube, das Bild trifft es ziemlich gut – nicht das mit den Flammen, obwohl das im vergangenen Jahr wohl ebenfalls zutraf, sondern das mit der Reise. Sie haben eine Haltestelle erreicht, und nun wäre ein guter Zeitpunkt, um auszusteigen.« Sie zögerte kurz. »Zumindest für eine Weile.«
»Weil es nur eine Station auf dem Weg ist?«
»Wir beide haben in diesem Raum vieles besprochen, und ich bin der Meinung, dass wir dabei eine Entwicklung durchgemacht haben.« Sie hielt einen Augenblick inne. »Ich bezweifle jedoch, dass Sie all den Schmerz rund um die Geschichte, derentwegen Sie sich ursprünglich an mich gewandt haben, schon ganz losgeworden sind. Vielmehr glaube ich, dass Sie diesen Schmerz absorbiert haben. Sie haben ihn zu einem Teil von sich selbst gemacht und daraus gelernt. Trotzdem gibt es da noch etwas, das Sie nicht so recht lokalisieren können, und vielleicht betrifft dieses Etwas all die Dinge, über die Sie mit mir nie gesprochen haben: Ihre Vergangenheit, Ihre Eltern, Ihre Herkunft.«
»Tja«, sagte Frieda. »Meine eigenen Patienten sprechen in der Regel sehr wohl über ihre Kindheit und ihre Eltern, und auch über ihre Liebesbeziehungen. Mir ist bewusst, dass ich das nicht getan habe.«
Thelma betrachtete sie. »Dafür haben Sie viel über Dean Reeve gesprochen.«
»Ich weiß. Für alle anderen ist Dean tot. Die Polizei geht davon aus, dass er tot ist. Seine Exfrau geht davon aus, dass er tot ist. Seine Leiche – oder das, was die Leute für seine Leiche hielten, in Wirklichkeit aber die seines armen Bruders Alan war – ist längst verbrannt und die Asche verstreut. Eine Weile war er der Lieblingsschurke der Medien, aber selbst dieser Ruhm ist verblasst. Nach und nach ist er in Vergessenheit geraten – wenn auch nicht bei mir. Für mich ist er am Leben. Er mag ja etwas von einem Geist haben, aber er ist nicht tot. Er beobachtet mich, bewacht mich sogar in gewisser Weise. Irgendwie kommt es mir vor, als würde er dort draußen auf etwas warten.« Frieda bemerkte Thelmas Gesichtsausdruck und schüttelte den Kopf. »Er ist weder ein Produkt meiner Fantasie noch eine Art Freud’sches Alter Ego. Dean Reeve ist ein Mörder, und er befindet sich irgendwo dort draußen in der Welt.«
»Ob er sich draußen in der Welt befindet, weiß ich nicht, aber in Ihrem Kopf befindet er sich auf jeden Fall. Er lässt Ihnen keine Ruhe.«
»Er lässt mir in der Tat keine Ruhe. Aber er ist am Leben.«
»Zumindest für Sie.«
»Nein. Er lebt wirklich. Die Therapie kann mir hinsichtlich meiner Gefühle helfen, meiner Ängste wegen Dean, aber an der Tatsache, dass er noch lebt, kann sie auch nichts ändern.«
»Dann wollen Sie damit also sagen, dass Sie nicht über Ihre Eltern und Ihre Liebesbeziehungen gesprochen haben, weil Dean Reeve dem im Weg steht.«
»Ehrlich gesagt denke ich seit Kurzem viel über die Vergangenheit nach – die weit zurückliegende Vergangenheit, meine ich. Vor ein paar Tagen kam nämlich eine Frau zu mir, die während meiner Schulzeit mit mir in die Klasse ging. Sie war keine richtige Freundin, ich hatte sie das letzte Mal gesehen, als wir sechzehn waren. Trotzdem wollte sie mit mir über ihre Tochter sprechen. Sie war deswegen gestern bei mir, und seitdem habe ich ein seltsames Gefühl, auch wenn ich nicht genau sagen kann, warum.«
»Versuchen Sie trotzdem, es zu formulieren.«
»Es hat sich angefühlt, als würde mich meine Vergangenheit einholen.«
»Vielleicht ist das ja gut.«
Allerdings fand Thelma, dass aus Friedas Zügen plötzlich eine Traurigkeit sprach, die sie bei ihr vorher noch nie gesehen hatte.
»Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.«
Als Frieda im Lord Nelson eintraf, lehnte Jack bereits am Tresen. Zunächst bemerkte er sie nicht, sodass sie Gelegenheit hatte, ihn eingehend zu betrachten. Er ist erwachsen geworden, ging ihr durch den Kopf. Sie hatte ihn kennengelernt, als er noch ein junger Medizinstudent war – kratzbürstig, nervös und streitsüchtig, zugleich aber gehemmt und unsicher. Inzwischen sah er aus, als könnte er seinen Mann stehen, auch wenn dieser Mann gekleidet war wie ein Clown: mit einer karierten Jacke über einem lila Hemd, einer schwarz-weiß gestreiften Hose und einem bunt gestreiften Schal. Sein gelbbraunes Haar, das ihm für gewöhnlich widerspenstig vom Kopf abstand, schien zu einer Art Tolle gebändigt. Blinzelnd setzte sie sich in Bewegung. Genau in dem Moment drehte er sich um, lief bei ihrem Anblick rot an und hatte plötzlich wieder viel mehr Ähnlichkeit mit dem alten Jack. Er wollte ihr einen Drink spendieren, aber Frieda bestellte sich nur Leitungswasser, woraufhin Jack irgendetwas vor sich hin brummelte und den Barmann aufforderte, wenigstens eine Scheibe Zitrone hineinzugeben.
»Dann sieht es nicht ganz so langweilig aus«, bemerkte er, an Frieda gewandt.
Er selbst entschied sich für ein kleines Bitter und führte sie dann zu einem Ecktisch.
»Wie läuft die Arbeit?«, fragte Frieda.
Jack schüttelte energisch den Kopf, als würde er bei einem Theaterstück mitspielen und bewusst darauf achten, dass auch die Zuschauer in der letzten Reihe sein Kopfschütteln mitbekamen.
»Über so etwas kann ich jetzt nicht sprechen«, erklärte er. »Ich wollte dich unbedingt von Angesicht zu Angesicht sehen, weil es da etwas gibt, das ich dir sagen muss.«
»Dann sag es mir.«
Jack sah Frieda direkt in die Augen.
»Ich habe neuerdings eine Freundin.«
»Schön«, antwortete Frieda langsam. »Natürlich sollte ich jetzt sagen, dass ich mich für dich freue, aber warum die ganze Aufregung?«
»Die Sache ist die, dass ich der Meinung war, ich sollte mit dir darüber sprechen, weil es sich nämlich um eine Person handelt, die du kennst.«
»Ich kenne sie?«
»Ja.«
Frieda fühlte sich plötzlich leicht benommen, als würde ihr Gehirn nicht mehr richtig funktionieren. Sie blätterte eine Art geistiges Adressbuch durch. Wer konnte das sein? Und wer auch immer es war, warum veranstaltete Jack deswegen so ein Theater? Wieso musste er sie extra herbeizitieren und es ihr persönlich mitteilen?
»Also«, sagte sie schließlich, »verrätst du es mir jetzt endlich, oder soll ich raten?«
»Ich glaube, ich muss dir das erklären, Frieda, einfach weil …«
»Herrgott noch mal, Jack, wer ist es?«
»Frieda.« Frieda drehte sich um und erblickte ihre Nichte Chloë, die sie fröhlich anstrahlte.
»Chloë, was machst du denn …?« Dann aber begriff sie und verstummte.
»Hallo, mein Süßer«, wandte Chloë sich an Jack. Er stand auf, die beiden küssten sich, und Chloë gab zärtliches Gemurmel von sich. »Wie läuft es?«, fragte sie ihn dann.
»Ich war gerade im Begriff, es ihr zu sagen.«
»Bist du so lieb und holst mir etwas zu trinken?«, bat sie. »Einen Weißwein.« Sie wandte sich an Frieda. »Keine Sorge, ich habe meinen Ausweis dabei.«
Beide Frauen beobachteten einen Moment, wie Jack ohne großen Erfolg versuchte, sich durch die Menge einen Weg zurück zum Tresen zu bahnen. Dann sahen sie sich an.
»Chloë«, begann Frieda.
»Ich weiß, dass dir das seltsam vorkommen muss.«
Frieda wollte etwas erwidern, doch Chloë fiel ihr ins Wort.
»Erstens bist du meine Tante und kennst mich schon seit meiner Geburt, noch dazu warst du praktisch meine Ersatzmutter, weil meine eigene Mum eine totale Versagerin ist und …«
»Chloë!«
»Außerdem hast du so viel Zeit darauf verwendet, mir zu helfen. Im Grunde habe ich es allein dir zu verdanken, dass ich in den naturwissenschaftlichen Fächern meinen Sekundarstufenabschluss geschafft habe. Ich wünschte nur, du hättest mir beim Abitur genauso geholfen, aber das ist eine andere Geschichte. Außerdem durfte ich eine Weile bei dir wohnen, und wir haben alle möglichen Aufregungen miteinander durchgestanden. Ich weiß auch, dass Jack wie ein Sohn für dich ist …«
»Eigentlich war ich ja nur seine Tutorin …«
»Aber so läuft das nicht bei dir, Frieda. Alle, die du kennst, werden irgendwie Teil deiner Familie.«
»Das sehe ich ganz anders.«
»Ich will damit nur sagen, dass es dir wahrscheinlich fast wie ein Inzest vorkommt und das Ganze für dich umso seltsamer sein muss, weil du im Grunde ja diejenige warst, die uns zusammengebracht hat …«
»Zusammengebracht?«
»Immerhin haben wir uns durch dich kennengelernt – wofür ich dir immer dankbar sein werde, weil er so ein Lieber ist. Aber das weißt du ja.«
Frieda war erst einmal sprachlos. Als sie schließlich zu einer Antwort ansetzte, traf Jack gerade mit Chloës Weißwein ein und ließ sich bei ihnen nieder.
»Alles in Ordnung?«, fragte er nervös.
»Keine Sorge, wir haben die Sache schon geklärt.« Chloë hob ihr Glas. »Auf uns alle!« Sie nahm einen Schluck von ihrem Wein. Jack trank von seinem Bitter, während er gleichzeitig einen fragenden Blick zu Frieda hinüberwarf. Frieda ließ ihr Glas auf dem Tisch stehen. Chloë runzelte die Stirn. »Gibt es ein Problem?«
»Nein«, antwortete Frieda. »Ich bin bloß überrascht, das ist alles. Ich muss die Neuigkeit erst einmal verdauen.«
»Mir ist klar, dass das für dich schwierig ist«, räumte Chloë ein. »Wahrscheinlich siehst du mich immer noch als Zwölfjährige oder so. Aber ich bin achtzehn. Es ist alles völlig legal. Wir verstoßen nicht gegen das Gesetz.«
»Trotzdem besteht ein gewisser Altersunterschied.«
»Die paar Jahre sind doch gar nicht der Rede wert.«
»Neun Jahre, um genau zu sein.«
»Jetzt bist du aber ganz schön pedantisch«, entgegnete Chloë. »Wie schade. Ich dachte, du würdest dich für uns freuen.«
»Das tue ich ja. Es ist nur so, dass ihr mir beide sehr am Herzen liegt und ich nicht möchte, dass ihr euch da in etwas hineinstürzt, wodurch am Ende jemand zu Schaden kommt. Mir ist klar, dass ich gerade ziemlich alt und missbilligend klinge.« Frieda holte tief Luft. »Aber das ist gar nicht meine Absicht. Ich bin froh, dass ihr es mir erzählt habt und nicht das Gefühl hattet, es geheim halten zu müssen.«
»Gut.« Chloë warf Jack einen triumphierenden Blick zu. »Ich habe dir doch gesagt, dass es kein Problem ist.« Sie wandte sich wieder an Frieda. »Willst du denn gar nicht hören, wie alles angefangen hat?«
»Irgendwann schon«, antwortete Frieda, die das in Wirklichkeit ganz und gar nicht hören wollte.
»Ich habe meinerseits ja den starken Verdacht«, fuhr Chloë fröhlich fort, »dass Jack vom ersten Augenblick an auf mich stand. Das war so eine Schulmädchenfantasie von mir.«
»Die aber überhaupt nicht zutrifft«, erklärte Jack.
»Immerhin bist du schon zu meiner Geburtstagsparty gekommen, als ich sechzehn wurde.«
Frieda konnte sich noch gut an die Party erinnern. Damals war sie zum ersten Mal dem jungen Ted Lennox begegnet, dessen Mutter kurz zuvor ermordet worden war. Chloë hatte sehr für ihn geschwärmt.
»Das war etwas anderes«, widersprach Jack. »Wir waren nur Freunde.«
»So lautet deine Version.«
»Fakt ist, dass wir erst ganz kurz zusammen sind«, zischte Jack in eindringlichem Ton zu Frieda hinüber. »Ich wollte es dir gleich sagen. Mir war ziemlich mulmig bei dem Gedanken, wie du es aufnehmen würdest.«
»Sei nicht albern, Jack«, ereiferte sich Chloë. »Wovon redest du überhaupt?«
Frieda hatte plötzlich das schreckliche Gefühl, gleich Zeugin ihres ersten Streits zu werden. »Weiß Olivia Bescheid?«, warf sie rasch ein.
»Mum hätte dafür kein Verständnis.«
»Du solltest es ihr trotzdem sagen.«
»Ich weiß, wie sie reagieren würde: Sie würde sich betrinken und mir raten, ich solle mich lieber auf meine Wiederholungsprüfungen konzentrieren.«
»Womit sie zufällig …«
»Und dann würde sie behaupten, ich wisse nicht, was ich tue. Sie würde mir sämtliche Einzelheiten aus der Nase ziehen und anschließend bis ins kleinste Detail von ihren eigenen ersten sexuellen Erfahrungen erzählen. Igitt!«
»Du solltest es ihr trotzdem sagen«, wiederholte Frieda. »Ich mag es nicht, wenn du mich in etwas einweihst, wovon deine Mutter nichts weiß.«
»Irgendwann erzähle ich es ihr schon«, entgegnete Chloë.
Frieda erhob sich.
»Nun muss ich aber wirklich gehen.«
Chloë stand ebenfalls auf. »Du bist doch jetzt nicht sauer, oder? Sag mir, dass du nicht sauer bist.«
»Ich bin nicht sauer, aber ich muss gehen.«
»Ich schaue bald mal bei dir vorbei«, erklärte Chloë. »Ich möchte mit dir über meine Prüfungen sprechen. Du darfst es Mum nicht verraten, aber ehrlich gesagt befürchte ich, dieser Teil meines Lebens läuft gerade nicht allzu gut. Außerdem gibt es noch eine Menge andere Sachen, über die ich mit dir reden möchte.«
»Ja, ja«, meinte Frieda, bereits im Gehen begriffen. Sie verließ das Pub mit dem Gefühl zu flüchten.
4
Bitte setz dich.« Frieda deutete auf einen Stuhl und wartete, bis Becky sich niedergelassen hatte, ehe sie selbst in ihrem roten Sessel Platz nahm. Das Mädchen blickte sich neugierig um. Der Raum wirkte ordentlich und schlicht. An der ihr gegenüberliegenden Wand hing ein Bild einer staubig aussehenden Landschaft. Zwischen den beiden Sitzgelegenheiten stand ein niedriger Tisch mit einer Schachtel Papiertaschentücher darauf. Die Lampe in der Ecke tauchte den Raum, dessen Wände rauchgrün gestrichen waren, in ein sanftes Licht. Becky registrierte die Pflanze auf dem Fensterbrett. Durchs Fenster sah sie eine große, wie eine Kraterlandschaft wirkende Baustelle. Hinter hohen hölzernen Absperrungen ragten Kräne auf.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!