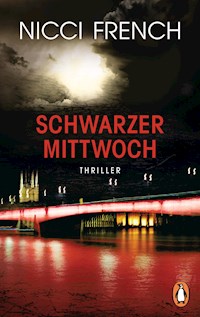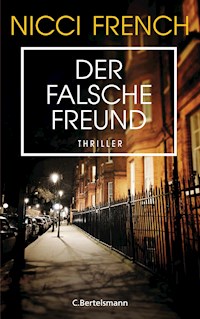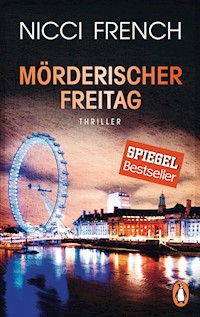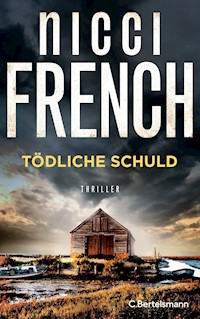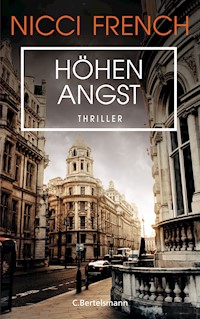7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wer ist der Frauenmörder? Ist Kit das nächste Opfer?
Die junge Ärztin Kit kümmert sich voller Idealismus um die Opfer unserer Wohlstandsgesellschaft - bis sie von einem ihrer Schutzbefohlenen attakiert und schwer verletzt wird. Wenig später bittet die Polizei Kit um Mithilfe in einem brutalen Mordfall. Der Verdächtige ist jener psychisch gestörte Mann, der Kit angegriffen hat. Nach längerem Zögern ist sie bereit, der Polzei zu helfen. Die erfahrene Psychiaterin weiß, dass sie sich den eigenen Ängsten stellen muss. Doch sie ahnt nicht, welche Dämonen sie damit heraufbeschwört.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 578
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Nicci French
Dasrote Zimmer
Roman
Deutsch von Birgit Moosmüller
Buch
Eines Abends erhält Kit Quinn Besuch von der Londoner Mordkommission. Ein junges Mädchen wurde tot an einem Kanal aufgefunden; die Leiche der Unbekannten ist grausam zugerichtet. Die Polizei hat einen Verdächtigen aufgegriffen und bittet die erfahrene Psychiaterin nun um ihre Mithilfe. Kit kennt den Mann – er hat sie vor drei Monaten während einer Therapiesitzung tätlich angegriffen. Trotz ihrer Befürchtung, einer erneuten Begegnung mit diesem Mann noch nicht wieder gewachsen zu sein, entschließt sich Kit zur Mitarbeit. Für den leitenden Ermittler Inspektor Oban ist die Sache klar: Michael Doll, verwahrlost, vorbestraft, verhaltensauffällig, hat den Mord begangen. Aber Kit, die zwischen Mitleid und Angst hin und her gerissen ist, zwingt die Polizei, ihr schnelles Urteil zu revidieren, denn die Beweise gegen Doll sind fadenscheinig. Außerdem ist Kit auf einen weiteren Frauenmord gestoßen, der die Handschrift desselben Täters trägt, und ist fortan fest davon überzeugt, der Lösung des Falles sehr nahe zu sein. Doch dann geschieht etwas, das Kits immer wiederkehrenden Alptraum von einem roten Zimmer blutige Wirklichkeit werden lässt …
Autorin
Nicci French sorgte bereits mit ihren ersten beiden Spannungsromanen für Furore. Die in London lebende Journalistin hat sich längst einen Namen als Englands neue »Lady of Crime« gemacht. »Das rote Zimmer« ist ihr fünfter Roman.
Von Nicci French sind außerdem als Goldmann Taschenbuch lieferbar
Der Glaspavillon. Roman Ein sicheres Haus. Roman Höhenangst. Roman Der Sommermörder. Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel »The Red Room« bei Michael Joseph, London
Der Goldmann Verlag ist ein Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH.
Copyright © 2001 by Joined-Up Writing Copyright © 2002 der deutschsprachigen Ausgabe by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Umschlaggestaltung: Design Team München Umschlagfoto: Getty images/Andrea Pistolesi
ISBN 978-3-641-24115-5V002
www.goldmann-verlag.de
www.randomhouse.de
FÜR KARL, FIONA UND MARTHA
Inhaltsverzeichnis
Man hüte sich vor schönen Tagen. An schönen Tagen passieren oft schlimme Dinge. Vielleicht liegt es daran, dass man leichtsinnig wird, wenn man glücklich ist. Man hüte sich auch davor, zu viel zu planen, denn dann konzentriert man seinen Blick auf das Geplante, und genau in dem Moment beginnt dort, wo man gerade nicht hinsieht, irgendetwas schief zu laufen.
Ich habe mal meinem Professor bei einer Studie über Unfälle geholfen. Ein Team von uns sprach mit Leuten, die überfahren, in Maschinen hineingezogen oder unter Autos hervorgezerrt worden waren. Andere waren von einem Brand überrascht worden, eine Treppe hinuntergefallen oder von einer Leiter gestürzt. Seile und Kabel waren gerissen, Fußböden hatten nachgegeben, Wände waren umgekippt, Zimmerdecken heruntergekracht. Es gibt keinen Gegenstand auf der Welt, der sich nicht gegen einen wenden kann. Wenn das Ding es nicht schafft, dir auf den Kopf zu fallen, dann kann es rutschig werden oder dich schneiden, oder du kannst es verschlucken. Und wenn bestimmte Gegenstände in menschliche Hände geraten, dann ist das noch mal eine ganz andere Geschichte.
Die Studie erwies sich in mancherlei Hinsicht als problematisch. Zum einen handelte es sich um Unfallopfer, die für unsere Fragen nicht zur Verfügung standen, weil sie tot waren. Hätten sie eine andere Geschichte zu erzählen gehabt? In dem Moment, als der Korb kippte und die Fensterputzer, den Schwamm noch in der Hand, aus dem zwanzigsten Stock in die Tiefe stürzten, dachten sie da noch etwas anderes als: O verdammt!? Unter den Übrigen gab es Leute, die zum Zeitpunkt ihres Missgeschicks erschöpft, überglücklich, depressiv, betrunken, mit Drogen voll gepumpt oder abgelenkt waren. Andere hatten einfach nur Pech gehabt. Eins aber war ihnen allen gemeinsam: Zum betreffenden Zeitpunkt waren sie mit den Gedanken nicht bei der Sache gewesen. Aber das ist ja wiederum die Definition eines Unfalls: Irgendetwas bricht gewaltsam in das ein, worauf man gerade seine Gedanken konzentriert, wie ein Räuber, der einen auf einer unbelebten Straße überfällt.
Als es schließlich darum ging, die Ergebnisse zusammenzufassen, war das zugleich einfach und schwer. Einfach deshalb, weil die meisten Schlussfolgerungen auf der Hand lagen. Wie schon auf dem Arzneifläschchen zu lesen steht, sollte man unter dem Einfluss von Medikamenten keine schweren Maschinen bedienen. Ebenso wenig sollte man die Schutzvorrichtung von der Kleiderpresse entfernen, selbst wenn sie einen stört, und es ist auch nicht ratsam, einen fünfzehnjährigen Lehrling mit der Bedienung des Geräts zu betrauen. Vor dem Überqueren einer Straße sollte man in beide Richtungen sehen.
Doch sogar Letzteres war problematisch. Wir versuchten, Dinge zu fassen zu bekommen, die die Leute irgendwo am Rand registriert hatten. Das Problem dabei ist, dass kein Mensch es schafft, alles, was er wahrnimmt, auch bewusst in sein Denken einzubeziehen. Sobald wir uns einer Gefahrenquelle zuwenden, bekommt etwas anderes Gelegenheit, sich von hinten an uns heranzuschleichen. Wenn wir nach links sehen, hat irgendetwas rechts von uns die Chance, uns zu kriegen.
Vielleicht ist es das, was uns die Toten erzählt hätten. Und vielleicht wollen wir manche dieser Unfälle ja auch gar nicht missen. Wenn ich mich in meinem Leben verliebt habe, dann nie in den Menschen, den ich eigentlich hätte mögen sollen, den netten Kerl, mit dem meine Freunde mich verkuppeln wollten. Was nicht heißen soll, dass es jedes Mal der Falsche war, aber in der Regel doch jemand, der in meinem Leben eigentlich gar nichts verloren gehabt hätte. Ich habe mal einen wunderschönen Sommer mit jemandem verbracht, den ich kennen lernte, weil er der Freund eines Freundes war, der meiner besten Freundin beim Umzug in ihre neue Wohnung half, weil der andere Freund, der eigentlich kommen und helfen wollte, bei einem Fußballspiel einspringen musste, weil ein anderer sich das Bein gebrochen hatte.
Das alles ist mir bekannt, aber dieses Wissen bringt nichts. Es hilft einem lediglich, das Geschehene im Nachhinein zu verstehen. Und manchmal nicht einmal das. Trotzdem ist es passiert, daran besteht kein Zweifel. Ich nehme an, das Ganze begann damit, dass ich in die andere Richtung schaute.
Es war an einem sonnigen Vormittag im Mai. An meiner Zimmertür klopfte es, und noch ehe ich etwas sagen konnte, ging sie auf, und ich sah das lächelnde Gesicht von Francis vor mir. »Dein Termin ist abgesagt worden«, erklärte er.
»Ich weiß.«
»Dann hast du ja Zeit …«
»Also …«, begann ich. In der Welbeck-Klinik war es immer gefährlich zuzugeben, dass man Zeit hatte, denn dann wurde einem sofort irgendeine Arbeit aufs Auge gedrückt. In der Regel handelte es sich dabei um die Dinge, mit denen sich die älteren Kollegen nicht herumschlagen wollten.
»Kannst du eine Beurteilung für mich übernehmen?«, fragte Francis rasch.
»Also …«
Sein Lächeln wurde breiter. »Was ich eigentlich sagen will, ist natürlich: ›Übernimm eine Beurteilung für mich!‹, aber ich formuliere es aus Gründen der Höflichkeit auf die konventionelle, weniger direkte Art.«
Das ist einer der Nachteile, die man in Kauf nehmen muss, wenn man in einem therapeutischen Umfeld arbeitet: Man hat mit Leuten wie Francis Hersh zu tun, der erstens nicht einmal guten Morgen sagen konnte, ohne es in Anführungszeichen zu setzen und anschließend sofort zu analysieren, und zweitens … Aber lassen wir das. Im Fall von Francis könnte ich mich über zweitens und drittens locker bis zu zehntens vorarbeiten.
»Worum geht’s?«
»Eine Polizeisache. Sie haben jemanden aufgegriffen, der auf der Straße herumgebrüllt hat oder so was in der Art. Wolltest du gerade gehen?«
»Ja.«
»Das passt ja wunderbar. Du brauchst auf dem Heimweg nur schnell auf dem Revier in Stretton Green vorbeizuschauen und einen Blick auf den Typen zu werfen, damit sie ihn schnell wieder loskriegen.«
»In Ordnung.«
»Frag nach DI Furth. Er erwartet dich.«
»Wann?«
»Vor ungefähr fünf Minuten.«
Ich rief Poppy an, mit der ich auf einen Drink verabredet war, und erwischte sie gerade noch rechtzeitig, um ihr zu sagen, dass ich mich ein paar Minuten verspäten würde.
Wenn jemand wegen öffentlicher Ruhestörung auffällig wird, kann es recht schwierig sein zu beurteilen, ob der oder die Betreffende bösartig, betrunken, geisteskrank, körperlich krank, verwirrt, missverstanden, grundsätzlich ein Ekel, aber harmlos oder – in Einzelfällen – eine echte Bedrohung ist. Normalerweise verfährt die Polizei mit solchen Fällen recht willkürlich. In der Regel rufen sie uns nur, wenn extreme und eindeutige Gründe vorliegen. Vor einem Jahr aber war ein bereits festgenommener, dann jedoch wieder auf freien Fuß gesetzter Mann ein paar Stunden später mit einer Axt bewaffnet in der nächsten Hauptstraße aufgetaucht und hatte zehn Personen verletzt, von denen eine alte Frau ein paar Wochen später starb. Es hatte eine Meinungsumfrage gegeben, deren Ergebnis seit einem Monat vorlag, was zur Folge hatte, dass uns die Polizei zurzeit ständig um Rat bat.
Ich war schon mehrmals auf dem Revier gewesen, mit Francis oder allein. Das Komische daran war, dass wir, indem wir nach bestem Wissen und Gewissen herauszufinden versuchten, was mit diesen meist recht traurigen, verwirrten und übel riechenden Gestalten, die uns in einem Raum in Stretton Green gegenübersaßen, los war, in erster Linie der Polizei ein Alibi verschafften. Wenn dann das nächste Mal etwas schief ging, konnten sie die Verantwortung auf uns abwälzen.
Detective Inspector Furth war ein gut aussehender Mann, nicht viel älter als ich. Er begrüßte mich mit einem amüsierten, fast unverschämten Gesichtsausdruck, der mich veranlasste, nervös an meinen Kleidern hinunterzusehen, ob alles richtig saß. Aber schon einen Moment später wurde mir klar, dass das sein ganz normaler Gesichtsausdruck war, sein Schutzschild gegen die Welt. Er trug sein blondes Haar streng nach hinten gekämmt, und sein Kinn war kantig wie mit dem Lineal nachgezogen. Seine Haut wirkte leicht narbig. Vielleicht hatte er als Kind unter Akne gelitten.
»Dr. Quinn«, sagte er mit einem Lächeln und streckte mir die Hand entgegen. »Nennen Sie mich Guy. Ich bin neu hier.«
»Freut mich, Sie kennen zu lernen.« Er drückte meine Hand so fest, dass ich das Gesicht verzog.
»Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Sie noch so … ähm … jung sind.«
»Tut mir Leid«, begann ich, brach aber gleich wieder ab. »Wie alt sollte ich denn Ihrer Meinung nach sein?«
»Treffer!«, antwortete er, noch immer lächelnd. »Und Sie heißen Katherine – Kit abgekürzt. Das weiß ich von Dr. Hersh.«
Früher sagten nur meine Freunde Kit zu mir. Die Kontrolle darüber war mir schon vor Jahren entglitten, aber ich zuckte immer noch leicht zusammen, wenn ein Fremder mich so nannte.
»Wo ist er?«
»Diese Richtung. Möchten Sie eine Tasse Tee oder Kaffee?«
»Danke, aber ich bin ein wenig in Eile.«
Er führte mich durch das Großraumbüro. An einem der Schreibtische blieb er kurz stehen und griff nach einer wie ein Rugbyball geformten Tasse, bei der der Deckel gekappt war wie bei einem Frühstücksei.
»Meine Glückstasse«, erklärte er, während ich ihm durch eine Tür am hinteren Ende des Raums folgte. Vor dem Verhörraum blieb er stehen.
»Mit wem habe ich es zu tun?«, fragte ich.
»Einer Ratte namens Michael Doll.«
»Und?«
»Er hat sich auf dem Gelände einer Grundschule rumgetrieben.«
»Hat er Kinder belästigt?«
»Nicht direkt.«
»Wieso ist er dann hier?«
»Die Eltern dort haben eine Aktionsgruppe gegründet. Sie verteilen Handzettel. Dabei ist er ihnen aufgefallen, und die Situation wurde ein wenig unangenehm.«
»Versuchen wir es doch mal anders herum: Wieso bin ich hier?«
Furth wich meinem Blick aus. »Sie kennen sich doch mit solchen Sachen aus, oder? Man hat mir gesagt, Sie arbeiten in Market Hill.«
»Hin und wieder, ja.« In der Tat teile ich meine Zeit auf zwischen Market Hill, einem Krankenhaus für geisteskranke Verbrecher, und der Welbeck-Klinik, die der Mittelklasse therapeutischen Beistand bietet.
»Jedenfalls ist er ein seltsamer Typ. Er hat recht komisches Zeug geredet. Murmelt die ganze Zeit vor sich hin. Wir haben uns schon gefragt, ob er vielleicht schizophren ist oder so.«
»Was wissen Sie über ihn?«
Furth rümpfte die Nase, als könnte er den Gestank des Mannes durch die Tür riechen. »Neunundzwanzig Jahre alt. Tut nicht viel. Ein bisschen Taxifahren.«
»Ist er früher schon mal wegen sexueller Belästigung aufgefallen?«
»Nicht wirklich. Leichter Hang zum Exhibitionismus.«
Ich schüttelte den Kopf. »Finden Sie das alles nicht ein bisschen vage?«
»Was, wenn er trotzdem gefährlich ist?«
»Sie meinen, wenn er der Typ Mensch ist, der irgendwann in der Zukunft gewalttätig werden könnte? Genau solche Fragen habe ich meiner Betreuerin gestellt, als ich in der Klinik anfing. Sie hat mir geantwortet, das würden wir jetzt wahrscheinlich nicht feststellen können und uns hinterher alle ganz schrecklich fühlen.«
Furth runzelte die Stirn. »Ich bin solchen Scheißkerlen wie Doll begegnet, nachdem sie ihr Verbrechen begangen hatten. Dann findet die Verteidigung immer jemanden, der vor Gericht über die schwierige Kindheit dieser Leute faselt.«
Michael Doll hatte volles Haar, das ihm in Locken bis auf die Schultern fiel, und ein hageres Gesicht mit vorstehenden Wangenknochen. Seine Züge wirkten seltsam zart. Insbesondere seine Lippen erinnerten mit ihrer ausgeprägten Herzform an die einer jungen Frau. Allerdings hatte er ein auswärts schielendes Auge, und es war schwer zu sagen, ob er mich ansah oder knapp an mir vorbei. Seiner Bräune nach zu urteilen, verbrachte er einen Großteil seiner Zeit im Freien. Ich hatte den Eindruck, dass der Raum auf ihn beklemmend wirkte. Seine großen, schwieligen Hände hielten einander umklammert, als versuchten sie, sich gegenseitig am Zittern zu hindern.
Er trug Jeans und eine graue Windjacke, die nicht weiter seltsam gewirkt hätte, wäre darunter nicht der dicke orangefarbene Pulli gewesen, den sie nicht ganz verdeckte. In einem anderen Leben, einer anderen Welt wäre er vielleicht ein attraktiver Typ gewesen, so aber hatte er etwas Unheimliches an sich, das ihn umgab wie ein übler Geruch.
Als wir den Raum betraten, sprach er gerade schnell und nahezu unverständlich auf eine gelangweilt wirkende Beamtin ein. Ihr war anzusehen, wie erleichtert sie über unser Erscheinen war. Nachdem sie mir Platz gemacht hatte, setzte ich mich gegenüber von Michael Doll an den Tisch und stellte mich vor. Ich verzichtete darauf, ein Notizbuch herauszuholen. Wahrscheinlich würde das gar nicht nötig sein.
»Ich werde Ihnen ein paar einfache Fragen stellen«, erklärte ich.
»Die haben es auf mich abgesehen«, murmelte Doll. »Sie wollen mich dazu bringen, irgendwelche Sachen zuzugeben.«
»Ich bin nicht hier, um mit Ihnen über das zu sprechen, was Sie getan haben. Ich möchte bloß herausfinden, wie es Ihnen geht. Ist das in Ordnung?«
Er blickte sich argwöhnisch um. »Ich weiß nicht. Sind Sie von der Polizei?«
»Nein. Ich bin Ärztin.«
Seine Augen weiteten sich. »Glauben Sie, ich bin krank? Oder verrückt?«
»Was glauben Sie denn?«
»Mir fehlt nichts.«
»Dann ist es ja gut.« Ich fand selbst, dass meine Stimme widerlich herablassend klang. »Nehmen Sie irgendwelche Medikamente?« Er starrte mich verwirrt an. »Tabletten? Oder Tropfen?«
»Ich nehme was für meine Verdauung. Ich bekomme immer solche Schmerzen. Nachdem ich gegessen habe.« Er klopfte gegen seine Brust.
»Wo wohnen Sie?«
»Ich habe ein Zimmer. Drüben in Hackney.«
»Sie leben allein?«
»Ja. Irgendwas dagegen einzuwenden?«
»Nicht das Geringste. Ich lebe auch allein.«
Dolls Lippen verzogen sich zu einem kleinen Grinsen. Es sah nicht besonders nett aus. »Haben Sie einen Freund?«
»Sie?«
»Ich bin doch keine Schwuchtel!«
»Ich meine, haben Sie eine Freundin?«
»Sie zuerst!«, gab er in scharfem Ton zurück.
Er war durchaus schlagfertig. Versuchte mich sogar zu manipulieren. Was aber noch lange nicht hieß, dass er verrückter war als die übrigen im Raum Anwesenden.
»Ich bin hier, um etwas über Sie zu erfahren«, antwortete ich.
»Sie sind genau wie die anderen.« In seiner Stimme schwang jetzt ein wütendes Zittern mit. »Sie wollen mich in eine Falle locken. Etwas aus mir rauskitzeln.«
»Was könnte ich denn aus Ihnen rauskitzeln?«
»Ich weiß nicht, ich … ich …« Er fing zu stammeln an. Seine Hände umklammerten die Tischkante. An seiner Schläfe pulsierte eine Ader.
»Ich will Sie nicht in eine Falle locken, Michael.« Ich stand auf und sah zu Furth hinüber.
»Ich bin fertig.«
»Und?«
»Ich sehe keine Probleme.«
Neben mir hörte ich Doll weiterplappern wie ein Radio, das jemand auszuschalten vergessen hatte.
»Wollen Sie ihn denn nicht fragen, was er bei der Schule zu suchen hatte?«
»Warum?«
»Weil er ein Perverser ist, darum!« Inzwischen war das Lächeln aus Furths Gesicht verschwunden. »Er ist eine Gefahr für andere, und wir dürfen nicht zulassen, dass er sich in der Nähe von Kindern rumtreibt.« Dieser Teil war an mich gerichtet. Nun begann er an mir vorbei mit Doll zu sprechen. »Glauben Sie bloß nicht, dass Ihnen das irgendwas bringt, Mickey. Wir wissen über Sie Bescheid.«
Ich warf einen Blick zu Doll hinüber. Sein Mund stand offen wie bei einem Frosch oder Fisch. Ich wandte mich zum Gehen. Ab diesem Zeitpunkt bekam ich die Dinge nur noch bruchstückhaft mit. Ein klirrendes Geräusch. Ein Schrei. Ein Stoß von der Seite. Ein reißendes Gefühl an der einen Hälfte meines Gesichts, von oben nach unten. Ich konnte es fast hören. Rasch gefolgt von einem warmen Schwall auf meinem Gesicht und meinem Hals. Der Boden, der mir entgegenkam. Linoleum, das hart gegen meinen Körper schlug. Ein Gewicht auf mir. Schreie. Andere Menschen um mich herum. Ich versuchte, mich hochzustemmen,
1. KAPITEL
Und ich hab gesagt: ›Ja, ja, ich glaube an Gott, aber Gott kann auch der Wind in den Bäumen und der Blitz am Himmel sein.‹« Er beugte sich vor und deutete mit seiner Gabel auf mich. Der Mann, mit dem ich am Ende des Abends nicht nach Hause gehen, dessen Telefonnummer ich verlieren würde. »Gott kann das eigene Gewissen sein. Oder ein anderer Name für die Liebe. Oder der Urknall. ›Ja‹, hab ich gesagt, ›ich bin der Überzeugung, dass sogar der Urknall eine Bezeichnung für den Glauben eines Menschen sein kann.‹ Darf ich Ihnen nachschenken?« Das war der Stand der Dinge, den wir an diesem Abend erreicht hatten. Sechs Flaschen Wein für acht Leute, und das, obwohl wir erst beim Hauptgang angelangt waren. Labberiger Fisch mit Erbsen. Poppy ist eine der schlechtesten Köchinnen, die ich kenne. Sie produziert riesige Mengen, die wie misslungene Babynahrung schmecken. Ich warf einen Blick zu ihr hinüber. Sie war gerade in irgendeine Diskussion mit Cathy verwickelt, fuchtelte dabei übertrieben dramatisch mit den Armen herum und saß so weit nach vorn gebeugt, dass ihr ein Ärmel in den Teller hing. Trotz ihrer herrischen Art war sie im Grunde ein ängstlicher und unsicherer, vielleicht sogar unglücklicher Mensch, aber stets großzügig – sie gab diese kleine Party anlässlich meiner Genesung und bevorstehenden Rückkehr in die Arbeit. Offenbar spürte sie meinen Blick, denn sie schaute zu mir herüber und lächelte mich an. Plötzlich sah sie wieder so jung aus wie die Studentin, die ich zehn Jahre zuvor kennen gelernt hatte.
Kerzenlicht schmeichelt jedem. Die Gesichter rund um den Tisch schienen auf geheimnisvolle Weise zu strahlen. Ich betrachtete Seb, Poppys Ehemann. Er war Arzt, genauer gesagt Psychiater. Unsere Reviere grenzten aneinander, zumindest hatte er das irgendwann mal so ausgedrückt. Ich hatte mich nie als Besitzerin eines Reviers gesehen, aber Seb wirkte manchmal wirklich wie ein Hund, der in seinem Garten patrouillierte und jeden anbellte, der sich zu nahe heranwagte. Seine scharfen Züge wurden durch das freundliche, flackernde Licht etwas gemildert. Cathy wirkte nicht mehr dunkel und schwer, sondern golden und weich. Ihr Mann saß am anderen Tischende in geheimnisvolles Dämmerlicht gehüllt, während der Mann zu meiner Linken nur aus Licht- und Schattenflächen zu bestehen schien.
»Ich hab zu ihr gesagt: ›Wir haben alle das Bedürfnis, an irgendetwas zu glauben. Gott kann auch für unsere Träume stehen. Wir alle brauchen Träume.‹«
»Das stimmt.« Ich schob mir eine Gabel voll Kabeljau in den Mund.
»Liebe. ›Was ist das Leben ohne Liebe?‹, hab ich gesagt. Ich hab gesagt« – er sprach jetzt lauter, an den ganzen Tisch gewandt – »›Was ist das Leben ohne Liebe?‹«
»Auf die Liebe«, meinte Olive und hob lachend ihr leeres Glas. Ihr Lachen klang wie das Geläut einer gesprungenen Glocke. Sie war eine große, dunkle, an einen Raubvogel erinnernde Frau, deren blauschwarzes Haar sich auf ihrem Kopf dramatisch türmte. Auf mich wirkt sie seit jeher eher wie ein Model, nicht wie eine Geriatrieschwester. Sie lehnte sich vor und platzierte einen schmatzenden Kuss auf den Mund ihres neuen Freundes, der zurückgelehnt neben ihr saß und einen leicht benommenen Eindruck machte.
»Gibt es jemanden in Ihrem Leben?«, murmelte mein Nachbar. Er war wirklich ziemlich beschwipst. »Jemanden, den Sie lieben?«
Blinzelnd versuchte ich mich zu erinnern. An eine andere Party, ein anderes Leben, bevor ich fast gestorben und als eine Frau ins Leben zurückgekehrt war, deren Gesicht von einer Narbe zweigeteilt wurde: Albie in einem ungenutzten Schlafzimmer in einem fremden Haus, mit einer anderen Frau, die Hände auf ihrem erdbeerroten Kleid. Er streifte ihr die Träger von den Schultern, berührte ihre cremeweißen Brüste. Sie hatte die Augen geschlossen und den Kopf zurückgelegt. Ihr kräftig roter Lippenstift war verschmiert. Betrunken nuschelte er: »Nein, nein, wir dürfen das nicht!«, ließ sie aber trotzdem gewähren, blieb völlig locker und passiv, während ihre Finger sich an seinem Reißverschluss zu schaffen machten. Ich hatte auf dem Treppenabsatz gestanden und zu ihnen hineingespäht, unfähig, mich zu bewegen oder einen Laut von mir zu geben. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Dingen, die man beim Sex tun kann, dachte ich damals, während ich auf diese Szene starrte. All die Gesten, von denen wir glauben, es seien unsere ganz persönlichen, gehören genauso anderen Leuten. Die Art, wie sie mit dem Daumen über seine Unterlippe strich. Ich mache das auch so. In dem Moment entdeckte mich Albie, und ich dachte: Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Arten, wie man seinen Geliebten mit einer anderen erwischen kann. Es erschien mir so abgedroschen. Sein schönes Hemd hing an ihm herunter. Wir hatten einander angestarrt, die sich rekelnde Frau zwischen uns. Ich konnte meinen Herzschlag hören. Was ist das Leben ohne Liebe?
»Nein«, antwortete ich. »Zurzeit nicht.«
Poppy klopfte mit dem Messer gegen ihr Glas. Oben im ersten Stock hörte ich ein Kind kreischen. Über unseren Köpfen schlug etwas dumpf auf den Boden. Seb runzelte die Stirn.
»Ich möchte einen Toast aussprechen.« Poppy räusperte sich.
»Warte noch einen Moment, lass mich erst die Gläser nachfüllen.«
»Vor drei Monaten passierte Kit diese schreckliche … Sache …«
Mein Tischnachbar wandte sich zu mir um und starrte auf mein Gesicht. Ich hob die Hand, um die Narbe zu bedecken, als könnte sein Blick sie zum Brennen bringen.
»Sie ist von einem Wahnsinnigen angegriffen worden.«
»Also …«, begann ich zu protestieren.
»Alle, die wie ich an ihrem Krankenbett gestanden … die gesehen haben, was er ihr angetan hatte … wir waren völlig entsetzt.« Der Alkohol und die Rührung ließen Poppys Stimme schwanken. Verlegen starrte ich auf meinen Teller. »Aber niemand sollte sie nach dem äußeren Schein beurteilen.« Sie lief rot an und sah erschrocken zu mir herüber. »Ich meine nicht die … du weißt schon.« Wieder hob ich die Hand ans Gesicht. Ich ertappte mich jetzt ständig bei dieser Geste des Selbstschutzes, zu der ich damals nicht fähig gewesen war. »Sie mag ja einen sehr sanften Eindruck machen, aber in Wirklichkeit ist sie eine starke, mutige Frau. Sie war schon immer eine Kämpferin, und deswegen sitzt sie jetzt auch hier bei uns und fängt am Montag wieder zu arbeiten an. Dieser Abend ist für sie, und ich möchte, dass ihr alle eure Gläser hebt, um ihre Genesung zu feiern und … na ja, das war’s eigentlich schon. Ich war noch nie besonders gut im Redenhalten. Jedenfalls trinken wir jetzt auf unsere liebe Kit!«
»Auf Kit!«, riefen alle im Chor. Ihre Gläser stießen über den Resten des Essens klirrend aneinander. Alle Gesichter um mich herum leuchteten, lächelten mich an, verschwammen für ein paar Momente im Kerzenlicht, um dann von neuem Gestalt anzunehmen. »Kit!«
Ich brachte ein Lächeln zustande. Eigentlich wollte ich das alles gar nicht und fühlte mich deswegen schlecht.
»Komm schon, Kit, du musst auch eine Rede halten!« Seb grinste mich an. Wahrscheinlich kennen Sie sein Gesicht oder seine Stimme. Sie haben bestimmt schon seine Meinung über alles Mögliche gehört, angefangen von Serienkillern bis hin zu kindlichen Albträumen oder kollektivem Massenwahn. Er macht mir oft Komplimente, lächelt mich an und tut sein Bestes, um mich aufzubauen, aber ich nehme an, im Grunde hält er mich für eine hoffnungslose Anfängerin in seinem Beruf. »Du kannst nicht nur schüchtern dasitzen und lieb schauen, Kit. Sag was!«
»Also gut.« Ich musste an Michael Doll denken, wie er sich mit erhobener Hand auf mich stürzte. »Eigentlich bin ich gar keine Kämpferin. Im Gegenteil, ich –« Von oben drang ein Schrei, gefolgt von lautem Geheul.
»Herrje!«, seufzte Poppy und stand auf. »Andere Kinder liegen um halb elf im Bett und schlafen. Unsere tragen noch Ringkämpfe aus. Bin gleich wieder da.«
»Nein, lass mich gehen!« Rasch schob ich meinen Stuhl zurück.
»Sei nicht blöd!«
»Nein, wirklich, ich möchte gern. Ich habe die Kinder den ganzen Abend nicht gesehen. Ich möchte ihnen gute Nacht sagen.«
Ich rannte praktisch aus dem Zimmer. Während ich die Treppe hinaufstieg, hörte ich Kinderfüße den Gang entlangrennen, begleitet von leisem Wimmern. Als ich schließlich in ihr Zimmer trat, lagen Amy und Megan bis zum Hals zugedeckt in ihren Betten. Megan, mit ihren sieben Jahren die Ältere der beiden, stellte sich schlafend, auch wenn mir ihre zitternden Lider verrieten, welche Anstrengung es sie kostete, die Augen geschlossen zu halten. Die fünfjährige Amy hatte die Augen weit offen. Neben ihr auf dem Kissen lag ein Plüschhase mit Knopfaugen und abgewetzten Ohren.
»Hallo, ihr zwei!« Ich ließ mich auf dem Fußende von Amys Bett nieder. Im Licht des Nachtlämpchens konnte ich sehen, dass sie einen roten Fleck auf der Wange hatte.
»Kitty«, sagte sie. Abgesehen von Albie waren diese beiden die einzigen Menschen, die mich Kitty nannten. »Megan hat mich geschlagen.« Megan setzte sich entrüstet auf. »Lügnerin! Sie hat mich gekratzt! Schau her! Man kann es noch genau sehen!« Sie hielt mir ihre Hand hin.
»Sie hat Spatzenhirn zu mir gesagt!«
»Hab ich nicht!«
»Ich bin gekommen, um euch gute Nacht zu sagen.«
Beide saßen jetzt mit zerzausten Haaren, leuchtenden Augen und geröteten Wangen in ihren Betten. Ich legte eine Hand auf Amys Stirn. Sie fühlte sich heiß und feucht an. Ein sauberer Geruch nach Seife und Kinderschweiß stieg von ihr auf. Sie hatte Sommersprossen auf der Nase und ein spitzes Kinn.
»Es ist schon spät«, sagte ich.
»Amy hat mich aufgeweckt«, erklärte Megan.
»Oh!«, sagte Amy voller Entrüstung.
Von unten drang Stimmengemurmel und das Geklapper von Besteck herauf. Jemand lachte.
»Wie bringe ich euch zwei jetzt zum Einschlafen?«
»Tut es noch weh?« Amy stupste mit einem Finger gegen meine Wange. Ich zuckte zurück.
»Inzwischen nicht mehr.«
»Mummy sagt, es ist eine Schande«, erklärte Megan.
»Ja?«
»Und sie hat gesagt, dass Albie nicht mehr bei dir ist.« Albie hatte sie oft gekitzelt und ihnen Lutscher geschenkt. Oder die Hände vor den Mund gelegt und hineingeblasen, was dann wie der Schrei einer Eule klang.
»Das stimmt.«
»Wirst du jetzt keine Babys bekommen?«
»Schsch, Amy, so was sagt man nicht!«
»Eines Tages vielleicht schon«, antwortete ich. Ich spürte ein leichtes, sehnsüchtiges Ziehen in meinem Bauch. »Aber jetzt noch nicht. Soll ich euch eine Geschichte erzählen?«
»Ja!«, antworteten beide mit triumphierender Stimme. Nun hatten sie erreicht, was sie wollten.
»Eine kurze.« Ich durchforstete mein Gedächtnis nach einer geeigneten Geschichte. »Es war einmal ein Mädchen, das lebte mit seinen zwei hässlichen Schwestern …«
Aus den Betten ertönte einstimmiges Stöhnen. »Nein, die nicht!«
»Lieber Schneewittchen? Die sieben Raben? Rapunzel?«
»La-angweilig! Erzähl uns eine, die du dir selbst ausgedacht hast«, forderte Megan mich auf. »Eine Geschichte aus deinem Kopf.«
»Über zwei Mädchen …«, schlug Amy vor.
»… die Amy und Megan heißen …«
»… und ein Abenteuer in einem Schloss erleben.«
»Also gut, also gut! Mal sehen.« Ich begann zu sprechen, ohne die geringste Ahnung zu haben, wie ich weitermachen würde.
»Es waren einmal zwei kleine Mädchen namens Megan und Amy. Megan war sieben und Amy fünf. Eines Tages verirrten sich die beiden.«
»Wie?«
»Sie machten einen Spaziergang mit ihren Eltern. Es war am frühen Abend, und plötzlich kam ein schlimmes Gewitter, mit Donner und Blitz und wilden Sturmböen. Die Mädchen versteckten sich in einem hohlen Baum, aber als der Regen aufhörte, merkten sie, dass sie ganz allein in einem großen Wald waren und keine Ahnung hatten, wo sie sich befanden.«
»Gut«, meinte Megan.
»Deswegen sagte Megan, sie sollten losmarschieren und nach einem Haus suchen.«
»Und was habe ich gesagt?«
»Amy sagte, sie sollten die Brombeeren an den Büschen rundherum essen, um nicht vor Hunger zu sterben. Die beiden gingen und gingen. Immer wieder fielen sie hin und schürften sich die Knie auf. Es wurde dunkler und dunkler, am Himmel zuckten Blitze, und immer wieder flogen große schwarze Vögel ganz knapp an ihnen vorbei und gaben dabei schreckliche kreischende Geräusche von sich. Aus den Büschen starrten sie Augen an … Tieraugen.«
»Panther.«
»Ich glaube nicht, dass es in dem Wald Panther –«
»Panther«, wiederholte Megan in bestimmtem Ton.
»Also gut, Panther. Plötzlich sah Megan ein Licht durch die Bäume schimmern.«
»Und was habe ich –«
»Amy sah es im selben Moment. Sie gingen darauf zu. Als sie es erreichten, stellten sie fest, dass es von einer Öllampe stammte, die über einer hölzernen Rundbogentür hing. Die Tür gehörte zu einem großen, halb verfallenen Haus. Es war Furcht erregend, ein unheimlicher Ort, aber inzwischen waren die Mädchen so müde und durchgefroren, dass sie beschlossen, das Wagnis einzugehen. Als sie an die Tür klopften, hörten sie das Geräusch drinnen wie einen Trommelschlag widerhallen.« Ich legte eine Pause ein. Inzwischen saßen die Mädchen mucksmäuschenstill und mit offenem Mund da. »Aber niemand kam, und immer mehr große schwarze Vögel flatterten kreischend um sie herum, bis eine ganze Wolke von ihnen den Himmel verdunkelte. Schwarze Vögel, zuckende Blitze, Donnergetöse und dazu noch die Äste der Bäume, die sich gespenstisch im Wind wiegten. Schließlich drückte Megan fest gegen die Tür, bis sie quietschend aufschwang. Amy nahm die Öllampe vom Eingang, und zusammen betraten sie das halb verfallene Haus. Sie hielten sich an den Händen und spähten in jeden Winkel. Sie befanden sich in einem Gang, an dessen Wänden Wasser herunterlief. Sie folgten dem Gang, bis sie in einen Raum gelangten. Er war ganz blau gestrichen, sogar die hohe Zimmerdecke, und in der Mitte blubberte ein kalter blauer Brunnen. Sie konnten das Geräusch von Wellen hören, die an einen Strand klatschten. Es war ein Raum des Wassers, der Ozeane und fernen Länder, der ihnen das Gefühl gab, ihrem Zuhause ferner zu sein als je zuvor. Rasch gingen sie ein Stück weiter und kamen in einen zweiten Raum. Es war ein grünes Zimmer voller Farne und Topfpflanzen, und es erinnerte sie an die Parks, in denen sie so gern spielten. Plötzlich hatten sie schlimmer Heimweh als je zuvor. Deswegen gingen sie erneut weiter und kamen zu einem dritten Raum. Die Tür zu diesem war geschlossen. Von außen war sie rot gestrichen. Aus irgendeinem Grund hatten sie große Angst vor diesem Raum, noch ehe sie die Tür geöffnet hatten.«
»Warum?«, fragte Megan. Sie streckte mir die Hand hin, und ich nahm sie fest in die meine.
»Hinter der roten Tür lag das rote Zimmer. Sie wussten, dass in diesem Zimmer alles war, wovor sie am meisten Angst hatten. Das waren für Megan andere Dinge als für Amy. Wovor hast du am meisten Angst, Megan?«
»Ich weiß nicht.«
»Hast du nicht Angst davor, in großer Höhe zu sein?«
»Ja. Und davor, aus einem Boot zu fallen und zu sterben. Und vor der Dunkelheit. Und vor Tigern. Und Krokodilen.«
»Alles das war für Megan in dem roten Zimmer. Und für Amy?«
»Amy hasst Spinnen«, erklärte Megan genüsslich. »Sie schreit schon, wenn sie eine bloß von weitem sieht.«
»Ja, und Giftschlangen. Und Feuerwerksraketen, die in meinem Haar explodieren.«
»Ok. Was haben Megan und Amy als Nächstes getan?«
»Sie sind davongelaufen.«
»Nein, das sind sie nicht. Sie wollten das Innere dieses Raums sehen. Sie wollten die Tiger und Boote und Krokodile sehen –«
»Und die Giftschlangen –«
»Und die Giftschlangen. Sie schoben also die Tür auf, betraten das rote Zimmer, sahen sich darin um und stellten fest, dass alles darin rot war. Die Decke war rot, die Wände waren rot, sogar der Boden war rot.«
»Aber was war in dem Zimmer?«, fragte Megan. »Wo waren die Krokodile?«
Ratlos hielt ich inne. Was war tatsächlich in dem Zimmer? Über diesen Teil der Geschichte hatte ich mir noch keine Gedanken gemacht. Einen Moment lang dachte ich an einen echten wilden Tiger, der sie beide auffressen würde.
»Da war ein kleiner Plüschtiger«, antwortete ich. »Und ein Plüschkrokodil.«
»Und eine Plüschschlange.«
»Ja, und ein kleines Spielzeugboot, und außerdem leckeres Essen und ein großes, schönes weiches Bett. Und die Eltern von Megan und Amy, die die zwei kleinen Mädchen ins Bett brachten, liebevoll zudeckten und ihnen einen dicken Gutenachtkuss gaben, woraufhin beide sofort einschliefen.«
»Mit einem Nachtlicht?«
»Mit einem Nachtlicht.«
»Ich möchte noch eine Geschichte hören!«, erklärte Megan.
Ich beugte mich zu ihnen hinunter und küsste ihre krause Stirn. »Nächstes Mal«, antwortete ich und wandte mich zum Gehen.
»Der Schluss war ein bisschen abrupt, fand ich.« Erschrocken fuhr ich herum. Seb stand in der Tür und lächelte. »Wo hast du die Geschichte her? Aus der Bruno-Bettelheim-Sammlung von Gutenachtgeschichten?«
Er begleitete seine Frage mit einem Grinsen, aber ich meinte es ernst, als ich antwortete: »Das war ein Traum, den ich im Krankenhaus hatte.«
»Ich nehme an, in deinem roten Zimmer gab es weder Spielsachen noch ein warmes Bett.«
»Nein.«
»Was war in dem Zimmer?«
»Ich weiß es nicht.« Das war gelogen. Ich spürte, wie mein Magen sich verkrampfte.
Später machte mir mein betrunkener Freund, der daran glaubte, dass Gott der Urknall war, das Angebot, mich nach Hause zu fahren. Ich lehnte dankend ab und ging zu Fuß. Von Poppy und Seb bis zu meiner Wohnung in Clerkenwell waren es nur gut eineinhalb Kilometer. Der kühle, feuchte Wind blies mir ins Gesicht, und meine Narbe kribbelte leicht. Der Halbmond schwebte zwischen dünnen Wolken über den orangefarbenen Straßenlampen. Ich fühlte mich zufrieden und zugleich traurig, auf jeden Fall ein wenig beschwipst. Ich hatte meine Rede dann doch noch gehalten – darüber, wie sehr mir der Beistand meiner Freunde in dieser schlimmen Zeit geholfen habe und dass ich das Leben jetzt noch mehr schätzte. Ich hatte all die abgedroschenen, aber wahren Phrasen von mir gegeben und anschließend Apfelkuchen gegessen. Dann hatte ich mich entschuldigt und war aufgebrochen. Nun war ich endlich allein. Meine Schritte hallten in den leeren Straßen wider, wo Wasserlachen glitzerten und der Wind klirrende Blechdosen in die Hauseingänge trieb. Eine Katze schmiegte sich um meine Beine und verschwand dann im Schatten einer Seitenstraße.
Zu Hause fand ich eine Nachricht von meinem Vater auf dem Anrufbeantworter vor. »Hallo«, sagte er mit klagender Stimme. Er hielt inne, wartete einen Moment. »Hallo? Kit? Hier ist dein Vater.« Das war’s.
Es war zwei Uhr morgens, und ich fühlte mich hellwach. Mir schwirrte richtig der Kopf. Ich machte mir eine Tasse Tee – nichts leichter als das, wenn man allein ist. Ein Beutel, kochendes Wasser darüber, dazu ein paar Tropfen Milch. Manchmal esse ich im Stehen vor dem Kühlschrank oder während ich in der Küche herumstöbere. Eine Scheibe Käse, einen Apfel, ein altes Brötchen aus der Tüte, einen Keks, auf dem ich geistesabwesend herumkaue. Orangensaft trinke ich meistens gleich aus dem Karton. Als Albie noch da war, gab es immer große, aufwändige Mahlzeiten – überkochende Pfannen voller Fleisch mit Unmengen von Kräutern und Gewürzen. Seltsame, unförmige Käse auf dem Fensterbrett. Entkorkt bereitstehende Weinflaschen. Lautes Lachen, das durch sämtliche Räume hallte. Ich ließ mich auf dem Sofa nieder und nippte an meinem Tee. Und weil ich allein war und in sentimentaler Stimmung, holte ich ihr Foto heraus.
Sie war damals in meinem Alter, das wusste ich, aber sie sah unglaublich jung aus, als wäre die Aufnahme vor langer, langer Zeit entstanden. Wie ein weit entferntes Kind oder jemand, den man durch ein Tor am Ende des Gartens erspäht. Sie saß in ausgefransten Jeansshorts und einem roten T-Shirt auf einem Flecken Gras, einen Baum im Rücken. Ihre nackten runden Knie waren vom Sonnenlicht gesprenkelt. Sie hatte ihr langes hellbraunes Haar hinter die Ohren geschoben, aber eine vorwitzige Strähne war entwischt und fiel ihr über ein Auge. Sie hatte ein weiches, rundes, mit winzigen Sommersprossen übersätes Gesicht und graue Augen und sah aus wie ich. Das sagte jeder, der sie gekannt hatte: »Du bist wirklich das Ebenbild deiner Mutter. Armes Mädchen«, fügten sie dann meist hinzu. Damit meinten sie wohl mich. Oder sie. Wahrscheinlich uns beide.
Sie starb, bevor ich alt genug war, um sie im Gedächtnis zu behalten, auch wenn ich oft versucht habe, mich durch den Nebel der ersten Lebensjahre hindurchzukämpfen, um zu sehen, ob ich sie an den ausgebleichten Rändern meiner Erinnerung finden konnte. Alles, was ich besaß, waren Fotos wie dieses und die Geschichten, die mir andere über sie erzählt hatten. Ich kannte sie nur durch die Worte anderer Menschen. Deswegen war das, was mir jetzt so sehr fehlte, auch nicht wirklich meine Mutter, sondern meine unglaublich zärtliche Vorstellung von ihr.
2. KAPITEL
Ich habe dem Silvesterabend immer mit einer gewissen Nervosität entgegengeblickt. Es gelingt mir einfach nicht, an einen wirklichen Neustart zu glauben. Eine Freundin hat mal zu mir gesagt, das bedeute, dass ich eigentlich mehr eine Protestantin als eine Katholikin sei. Sie meinte wohl damit, dass ich mein Leben hinter mir herschleppe: meine schmutzige Wäsche und mein unerwünschtes Gepäck. Trotzdem wollte ich mit meiner Rückkehr zur Arbeit einen neuen Anfang machen. In meiner Wohnung befanden sich noch jede Menge Sachen, die Albie zurückgelassen hatte. Obwohl unsere Trennung nun schon sechs Monate zurücklag, hingen immer noch ein paar von seinen Hemden im Schrank, und ein altes Paar Schuhe stand unter meinem Bett. Ich hatte ihn nicht richtig hinausgeworfen. Immer wieder tauchten Sachen von ihm auf. Wie Wrackteile, die nach einem Unwetter an den Strand gespült wurden.
An diesem Sonntagabend schlüpfte ich in eine weiße Baumwollhose und ein orangefarbenes Oberteil mit Dreiviertelärmeln, das am Ausschnitt wie eine feine Weste mit Spitze eingefasst war. Ich tuschte mir die Wimpern, gab etwas Gloss auf die Lippen und tupfte einen Hauch von Parfum hinter die Ohren. Dann bürstete ich mein Haar und steckte es hoch, obwohl es noch leicht feucht war. Es spielte keine Rolle. Er würde kommen, und ein wenig später würde er wieder gehen, und ich würde wieder bei weit geöffneten Fenstern und zugezogenen Vorhängen in meiner Wohnung allein sein, ein Glas kalten Wein trinken und Musik hören, irgendwas Ruhiges. Ich stellte mich vor den hohen Spiegel in meinem Schlafzimmer. Die Frau darin wirkte recht gefasst. Ich lächelte, und sie lächelte zurück, hob ironisch die Augenbrauen.
Natürlich kam er zu spät. Er kommt immer ein bisschen zu spät. Normalerweise trifft er völlig atemlos, aber lachend ein und beginnt zu reden, kaum dass die Tür richtig offen ist. Ich hörte ihn schon lachen, bevor ich ihn das erste Mal sah. Ich drehte mich um, und da war er, zufrieden mit sich selbst. Beneidenswert, dachte ich damals.
Heute war er stiller, sein Lächeln wirkte vorsichtig.
»Hallo, Albie.«
»Du siehst sehr gut aus«, sagte er und betrachtete mich, als wäre ich ein Kunstwerk an einer Wand, über das er sich noch nicht recht schlüssig war. Er beugte sich vor und küsste mich auf beide Wangen. Seine Bartstoppeln kratzten über meine Haut, meine Narbe. Seine Arme ruhten fest auf meinen Schultern. Er hatte schwarze Tinte an den Fingern.
Ich erlaubte mir, ihn einen Moment anzusehen, ehe ich mich aus seiner Umarmung befreite. »Komm rein.«
Er schien mein geräumiges Wohnzimmer ganz auszufüllen.
»Wie geht’s dir denn, Kitty?«
»Gut«, antwortete ich mit fester Stimme.
»Ich hab dich im Krankenhaus besucht, nachdem ich davon erfahren hatte. Du erinnerst dich wahrscheinlich nicht daran. Natürlich nicht. Du hast wirklich schlimm ausgesehen.« Lächelnd hob er einen Finger, um damit über meine Verletzung zu fahren. Das schien den Leuten Spaß zu machen. »Es heilt gut. Ich finde, Narben können durchaus schön sein.«
Ich wandte mich ab. »Sollen wir loslegen?«
Wir fingen in der Küche an. Er nahm sein spezielles Pilzmesser, bei dem am Griffende eine Bürste zum Wegfegen von Erdresten angebracht war, sein Fondueset mit den sechs langen Gabeln, seine gestreifte Schürze und die lächerliche Kochhaube, ohne die er nicht an den Herd trat, außerdem drei Kochbücher. Ich erinnerte mich noch genau an den gedünsteten Aal. Das Passionsfruchtsoufflé, das so stark aufgegangen war, dass es oben am Herd klebte. Die mexikanischen Tacos, gefüllt mit Minze, Sauerrahm und Zwiebeln. Er aß auch mit Genuss, wobei er gleichzeitig mit der Gabel herumfuchtelte, sich Essen in den Mund stopfte, mit mir diskutierte und sich über die Kerzen auf dem Tisch zu mir herüberbeugte, um mich zu küssen. Letztes Jahr Weihnachten hatte er so viel vom Gänsebraten gegessen und ihn mit so viel kräftigem Rotwein hinuntergespült, dass er anschließend in die Notaufnahme musste, weil er sich einbildete, einen Herzinfarkt zu haben.
»Was ist damit?« Ich hielt eine Kupferpfanne hoch, die wir gemeinsam gekauft hatten.
»Behalte sie.«
»Bist du sicher?«
»Ganz sicher.«
»Und all die spanischen Teller, die wir –«
»Sie gehören dir.«
Aber er nahm seinen Morgenmantel mit, seine südamerikanische Gitarrenmusik, seine Gedichtbände und Physikbücher, seine auberginenfarbene Krawatte. »Ich glaube, das ist alles.«
»Möchtest du ein Glas Wein?«
Er zögerte einen Augenblick, ehe er den Kopf schüttelte. »Ich muss zurück.« Er griff nach seiner Tasche. »Seltsame alte Welt, nicht wahr?«
»Das ist alles?«
»Was?«
»Deine Grabrede auf unsere Beziehung. Seltsame alte Welt.«
Er starrte mich mit gerunzelter Stirn an. Über seiner Nase bildeten sich zwei vertikale Falten. Ich gab ihm mit einem beruhigenden Lächeln zu verstehen, dass es nicht wirklich eine Rolle spielte. Ich lächelte, als er aufstand, um mit seinen Kartons aufzubrechen, lächelte, als er mich zum Abschied küsste, lächelte, als er die paar Stufen zu seinem Auto hinunterging, und lächelte auch noch, als er davonfuhr. Ab jetzt würde ich nur noch nach vorn blicken, nicht mehr zurück.
Die Welbeck-Klinik steht in einem ruhigen Wohngebiet in King’s Cross. Als sie Ende der Fünfziger gebaut wurde, ging es in erster Linie darum, nicht den Eindruck zu vermitteln, dass es sich um eine Institution handelte, vor der die Leute Angst haben mussten. Das bedeutete im Grunde nur, dass das Gebäude nicht viktorianisch aussehen sollte, mit gotischen Türmchen und kleinen, winkligen Fenstern. Schließlich sollten darin Psychiater die Probleme ihrer Patienten lösen und sie als glückliche Menschen wieder in die Welt entlassen.
Leider kam die Architektur der Klinik so gut an, dass sie von allen Seiten mit Lob überschüttet wurde und mehrere Preise gewann. Das hatte zur Folge, dass sie das Erscheinungsbild neuer städtischer Schulen, Krankenhäuser und Altersheime beeinflusste, und die Welbeck-Klinik inzwischen sehr wohl wie eine Institution aussah. Normalerweise nahm ich das Gebäude gar nicht mehr richtig wahr. Es war der Ort, wo ich tagtäglich zur Arbeit ging, mir den Mund fusslig redete, Unterlagen studierte und Kaffee trank. Als ich das Haus jetzt nach mehreren Wochen der Abwesenheit das erste Mal wieder betrat, fiel mir auf, dass es bereits Spuren des Alters zeigte, der Beton Flecke und Risse aufwies. Die Eingangstür schabte über den steinernen Treppenabsatz und gab ein kratzendes Geräusch von sich, als ich sie aufzog.
Als ich Rosas Büro erreichte, kam sie sofort heraus und umarmte mich fest und lang. Dann hielt sie mich ein Stück von sich weg, um mich mit einem halb scherzhaften, prüfenden Blick zu betrachten. Sie trug eine anthrazitfarbene Hose und dazu einen schlichten marineblauen Pulli. Ihr Haar war mittlerweile ziemlich grau, und wenn sie lächelte, schien ihr Gesicht vor lauter feinen Fältchen zu schimmern. Was ging ihr jetzt durch den Kopf? Als ich sie vor fast sieben Jahren kennen gelernt hatte, war mir ihre außergewöhnliche Arbeit auf dem Gebiet der kindlichen Entwicklung bereits bekannt gewesen. Diese große Kinderexpertin, die selbst kinderlos geblieben war, hatte mir des Öfteren Rätsel aufgegeben, und manchmal fragte ich mich, ob wir anderen an der Klinik vielleicht darum wetteiferten, ihr klügster Sohn oder ihre gescheiteste Tochter zu sein. Die Art, wie sie die Welbeck-Klinik leitete, mochte etwas Mütterliches haben, aber es war trotzdem nicht ratsam, immer auf die Nachgiebigkeit und Versöhnlichkeit einer Mutter zu zählen. Sie konnte durchaus Härte beweisen.
»Du hast uns gefehlt, Kit«, erklärte sie. »Schön, dass du wieder da bist.« Ich sagte nichts, zog nur ein Gesicht, von dem ich hoffte, dass es meine Zuneigung für sie zum Ausdruck brachte. Ich hatte Schmetterlinge im Bauch, fühlte mich wie an meinem ersten Tag am Gymnasium. »Lass uns rausgehen und ein bisschen plaudern«, fügte sie forsch hinzu. »Ich glaube, es hat zu regnen aufgehört. Ist das Wetter zurzeit nicht verrückt?«
Wir steuerten auf den Garten hinter dem Haus zu und trafen unterwegs auf Francis. Er war ebenfalls lässig gekleidet, in Jeans und einem dunkelblauen Hemd. Wie üblich war er unrasiert, sein Haar zerzaust – ein Mann, der nicht so sehr wie ein Wissenschaftler, sondern mehr wie ein Künstler wirken wollte. Als er mich sah, schloss er mich in die Arme.
»Wie schön, dass du wieder da bist, Kit! Fühlst du dich wirklich schon fit genug?«
Ich nickte. »Ich brauche die Arbeit. Es ist bloß … irgendwie fühlt es sich an, als würde ich nach einem schlimmen Sturz vom Pferd das erste Mal wieder in den Sattel steigen.«
Francis verzog das Gesicht. »Glücklicherweise war ich noch nie auch nur in der Nähe eines Pferdes. Am besten, man steigt gar nicht erst auf so ein großes Vieh.«
Vor einer Weile hatte es noch geregnet, aber inzwischen war die Sonne herausgekommen, und die feuchten Steinplatten glitzerten und dampften. Die Bänke waren zu nass zum Hinsetzen, sodass wir ein wenig linkisch beieinander standen.
»Erinnere mich daran, dass wir deinen Terminplan für heute durchsprechen«, erklärte Rosa, um etwas zu sagen.
»Als Erstes werde ich heute Morgen nach Sue sehen.« Sue war eine magersüchtige Dreiundzwanzigjährige, die aussah, als könnte das Licht durch sie hindurchscheinen. Ihre schönen Augen wirkten in ihrem kleinen Gesicht wie Teiche. Sie sah aus wie ein Kind oder wie eine alte Frau.
»Gut«, antwortete sie in forschem Ton. »Lass dir Zeit. Und sag uns, wenn wir dir irgendwie helfen können.«
»Danke.«
»Eins noch.«
»Ja?«
»Du hättest im Grunde Anspruch auf Schmerzensgeld.«
»Oh.«
»Ja. Francis ist definitiv der Meinung, dass du gerichtliche Schritte einleiten solltest.«
»Der Fall ist eindeutig«, mischte sich Francis ein. »Was zum Teufel hat sich dieser Polizist nur dabei gedacht? Die Tatwaffe war seine eigene gottverdammte Tasse!«
Ich sah zu Rosa hinüber. »Wie denkst du darüber?«
»Ich würde lieber hören, wie du selbst darüber denkst.«
»Ich weiß nicht, was ich denken soll. Es war alles so ein Durcheinander. Ihr wisst ja, dass die Staatsanwaltschaft …« – ich versuchte mich an den Wortlaut des Schreibens zu erinnern, das ich erhalten hatte – »… darauf verzichtet hat, Anklage gegen Mr. Doll zu erheben. Vielleicht war es wirklich ein Fehler der Polizei. Vielleicht auch meiner – oder einfach nur ein Unfall. Ich weiß nicht recht, worauf ich klagen sollte.«
»Ein paar Hunderttausend, schätze ich mal.« Francis lächelte.
»Ich bin nicht sicher, dass Doll wirklich jemanden verletzen wollte. Wahrscheinlich hat er bloß voller Panik um sich geschlagen, nach der Tasse gegriffen, sie gegen die Wand geknallt und erst sich selbst und dann mich damit geschnitten. Er war schon am Ende, bevor die Polizei mit ihm fertig war. Ihr wisst, was mit Menschen in Gefängniszellen geschieht. Sie drehen durch. Sie bringen sich um oder gehen auf andere Leute los. Ich hätte darauf vorbereitet sein müssen.« Ich sah Rosa und Francis an. »Seid ihr jetzt geschockt? Sollte ich eurer Meinung nach wütender sein? Auf Rache sinnen?« Ich schauderte. »Die von der Polizei haben ihn ziemlich unsanft zusammengeschlagen, bevor sie ihn in eine Zelle warfen. Sie waren wohl der Meinung, mir damit einen Gefallen zu tun. Bestimmt sind sie fuchsteufelswild, weil er ungeschoren davongekommen ist.«
»Das sind sie in der Tat«, bemerkte Rosa trocken.
»Dabei war es Furths Fehler, auch wenn er das natürlich niemals zugeben wird. Und meiner. Vielleicht war ich einfach nicht konzentriert genug. Wie auch immer, ich sehe einfach keinen Sinn darin, gerichtliche Schritte gegen sie einzuleiten. Wem würde das helfen?«
»Die Leute sollten für ihre Fehler zur Verantwortung gezogen werden«, meinte Francis. »Du hättest sterben können.«
»Ich bin aber nicht gestorben. Es geht mir gut.«
»Denk wenigstens darüber nach.«
»Ich denke die ganze Zeit darüber nach«, gab ich zurück. »Ich träume nachts davon. Irgendwie erscheint mir die Vorstellung, jemanden dazu zu bringen, mich mit Geld zu entschädigen, im Moment einfach nicht relevant.«
»Wenn du meinst«, erwiderte Francis in einem Ton, der in mir den Wunsch weckte, ihm eins auf die Nase zu geben.
Als ich abends nach Hause fuhr, regnete es wieder. Warmer Sommerregen klatschte gegen meine Windschutzscheibe und ließ funkelnde, bogenförmige Wasserfontänen von den Reifen der vorbeidonnernden Lastwagen hochspritzen. Der Berufsverkehr wurde langsam dichter. Meine Augen fühlten sich müde an, und mein Hals war ein wenig entzündet.
Als ich vor meiner Wohnung am Straßenrand parkte, sah ich einen Mann vor der Haustür stehen. Er trug einen Regenmantel, hatte die Hände in den Taschen vergraben und blickte am Haus hinauf. Als er meine Wagentür zufallen hörte, drehte er sich um. Sein blondes Haar glänzte im Regen, und seine schmalen Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. Ich starrte ihn lange an. Er erwiderte meinen Blick, ohne etwas zu sagen.
»Detective Inspector Guy Furth«, brachte ich schließlich heraus.
Ich spürte seinen prüfenden Blick und bemühte mich, keine Miene zu verziehen.
3. KAPITEL
Ich bin noch nie hier gewesen«, erklärte er und blickte sich um.
Ich musste über diese Bemerkung lachen. »Warum um alles in der Welt hätten Sie hier sein sollen? Wir sind uns erst ein einziges Mal begegnet. Erinnern Sie sich?«
»Es kommt mir öfter vor.« Er spazierte herum, als hätte er vor, die Wohnung zu kaufen. Schließlich trat er an das hintere Fenster, das auf ein Stück Wiese hinausging. »Schöner Blick«, sagte er. »Das sieht man von vorn gar nicht.«
Ich schwieg. Er drehte sich zu mir um, ein Lächeln auf den Lippen, das aber von seinen Augen Lügen gestraft wurde. Sein Blick wanderte gehetzt und misstrauisch im Raum herum, wie bei einem Tier, das befürchtete, von hinten angegriffen zu werden. Ich hatte immer das Gefühl, dass sich meine Wohnung mit jedem neuen Menschen, der sie betrat, veränderte. Ich sah sie dann durch die Augen der betreffenden Person – beziehungsweise so, wie ich mir vorstellte, dass diese sie sah. Auf Furth wirkte diese Wohnung bestimmt karg und ungemütlich. Es gab ein Sofa und einen Teppich auf einem lackierten Holzboden. In der Ecke stand eine alte Stereoanlage, daneben türmten sich meine CDs. Die Bücherregale quollen über, die Bücher lagen zum Teil auf dem Boden. Die Wände waren weiß gestrichen und fast kahl. Die meisten Bilder beunruhigten mich oder, noch schlimmer, hörten irgendwann auf, mich zu beunruhigen. Es schmerzte mich, wenn ich ein Bild, das mich anfangs aufgewühlt hatte, nach Wochen oder Monaten immer weniger wahrnahm, bis es irgendwann nur noch ein gewöhnlicher Dekorationsgegenstand war. Wenn mir ein Bild nicht mehr auffiel, hängte ich es ab oder trennte mich ganz von ihm, bis ich am Ende nur noch zwei besaß. Das eine war ein Gemälde von zwei Flaschen auf einem Tisch. Mein Vater schenkte es mir, als ich einundzwanzig war. Ein ziemlich durchgeknallter Freund von ihm, ein entfernter Cousin, hatte es gemalt. Ich konnte nie daran vorbeigehen, ohne von dem Bild in Bann gezogen zu werden. Das andere war ein Foto vom Vater meines Vaters, auf dem er zusammen mit seinem Bruder und seiner Schwester vor einem Vorhang in irgendeinem Fotostudio posierte. Das Bild musste Mitte der Zwanzigerjahre entstanden sein. Mein Großvater trug einen Matrosenanzug. Alle drei hatten ein seltsam starres Lächeln aufgesetzt, als müssten sie das Lachen unterdrücken. Es war eine sehr hübsche Aufnahme. Eines Tages würde jemand dieses Bild an der Wand hängen haben, sich an seinem Anblick erfreuen und fragen: Wer wohl diese Kinder waren?
Ich sah zu Furth hinüber. Für ihn hatte das Foto natürlich keinerlei Bedeutung. Vielleicht lag in seinem Blick eine Spur von Überraschung oder Verachtung. Ist das alles? In diese Wohnung kommt Kit Quinn jeden Abend zurück?
Er trat ganz nahe an mich heran und sah mir mit einem so besorgten Ausdruck in die Augen, dass sich mir der Magen umdrehte. »Wie geht es Ihnen inzwischen?«, fragte er. »Ist mit Ihrem Gesicht alles in Ordnung?«
Bevor er über meine Narbe streichen konnte, trat ich einen Schritt zurück. »Ich dachte nicht, dass wir uns jemals wiedersehen würden«, erklärte ich.
»Wir hatten Ihretwegen ein sehr schlechtes Gefühl, Kit.« Rasch fügte er hinzu: »Auch wenn niemand etwas dafür konnte. Er hat getobt wie ein Wahnsinniger. Es waren vier Mann von uns nötig, um ihn zu bändigen. Sie hätten besser aufpassen sollen. Schließlich hatte ich Ihnen gesagt, dass es sich um einen Perversen handelt.«
»Sind Sie deswegen gekommen? Um mir das zu sagen?«
»Nein.«
»Warum dann?«
»Um ein wenig mit Ihnen zu plaudern.«
»Worüber?«
Er wich meinem Blick aus. »Wir wollten einen Rat von Ihnen.«
»Wie bitte?« Ich war über diese unerwartete Antwort dermaßen verblüfft, dass es mir nur mit Mühe gelang, ein Kichern zu unterdrücken. »Sie sind wegen eines Falls hier?«
»Ja, richtig. Wir wollten mit Ihnen reden. Haben Sie was zu trinken da?«
»An was haben Sie denn gedacht?«
»Ein Bier vielleicht?«
Ich ging in die Küche, fand hinten in meinem Kühlschrank etwas bayerisch Aussehendes und brachte es ihm.
»Stört es Sie, wenn ich rauche?«
Ich holte ihm aus der Küche eine Untertasse. Er schob das Glas, das ich ihm gegeben hatte, zur Seite und nahm einen Schluck aus der Flasche. Dann zündete er sich eine Zigarette an und zog mehrmals daran. »Ich arbeite gerade an einem Mordfall«, erklärte er schließlich. »Dem Regent’s-Canal-Mord. Sie haben davon gehört?«
Ich überlegte einen Moment. »Ich hab vor ein paar Tagen in der Zeitung davon gelesen. Eine Leiche, die am Kanal gefunden wurde?«
»Ja, genau, das ist der Fall. Was war Ihr Eindruck?«
»Hat sich traurig angehört.« Ich zog eine Grimasse. »Ein kleiner Artikel ganz unten auf der Seite. Dass es ihn überhaupt gab, lag einzig und allein daran, dass die Leiche ein paar üble Verletzungen aufwies. Ihr Name war zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt, stimmt’s?«
»Wir wissen ihn immer noch nicht. Aber wir haben einen Verdächtigen.«
Ich schüttelte den Kopf. »Da habt ihr ja gute Arbeit geleistet. Aber –«
Er brachte mich mit einer Handbewegung zum Schweigen. »Fragen Sie mich nach dem Namen des Verdächtigen.«
»Wie bitte?«
»Nun machen Sie schon!« Er lehnte sich mit verschränkten Armen und einem breiten Grinsen in seinem Stuhl zurück und wartete.
»Also gut«, antwortete ich gehorsam. »Wie lautet der Name des Verdächtigen?«
»Sein Name ist Anthony Michael Doll.«
Ich starrte ihn an, musste seine Worte erst verdauen. Er erwiderte meinen Blick mit triumphierender Miene. »Verstehen Sie jetzt, warum Sie die Kandidatin für diesen Job sind? Perfekt, was?«
»Eine Gelegenheit, mich zu rächen«, sagte ich langsam. »Ich habe mir die Chance durch die Lappen gehen lassen, in der Zelle auf ihn einzutreten, aber dafür kann ich jetzt vielleicht mithelfen, ihn wegen Mordes in den Knast zu schicken. So in etwa stellt ihr euch das vor, oder?«
»Nein, nein«, widersprach er in besänftigendem Ton. »Mein Boss hätte einfach gern, dass Sie für uns arbeiten. Keine Angst, Sie kommen dabei schon auf Ihre Kosten. Und vielleicht macht es Ihnen sogar Spaß. Fragen Sie Ihren Freund Seb Weller.«
»Spaß«, sagte ich. »Wie könnte ich da widerstehen? Schließlich hatten wir beim letzten Mal schon so viel Spaß miteinander.«
Ich ging zum Kühlschrank und zog eine offene Flasche Weißwein heraus. Ich schenkte mir ein Glas ein und hielt es ins dämmrige Licht. Dann nahm ich einen Schluck, spürte, wie die eiskalte Flüssigkeit meine Kehle hinunterlief. Ich starrte aus dem Fenster, auf die rote Sonne, die tief am türkisfarbenen Himmel stand. Es hatte zu regnen aufgehört und versprach ein schöner Abend zu werden. Ich drehte mich wieder zu Furth um.
»Warum glauben Sie, dass es Doll war?«
Er wirkte einen Moment überrascht, dann erfreut. »Sehen Sie? Die Sache interessiert Sie. Doll verbringt seine Tage mit Fischen am Kanal. Er hält sich jeden gottverdammten Tag dort auf. Nachdem wir unseren üblichen Aufruf an alle gerichtet hatten, die zur betreffenden Zeit in der Gegend waren, hat er sich bei uns gemeldet.« Furth sah mich scharf an. »Überrascht Sie das?«
»Was?«
»Dass sich ein solcher Mann freiwillig meldet?«
»Nicht notwendigerweise«, antwortete ich. »Wenn er unschuldig ist, tut er besser daran, sich zu melden. Und wenn er schuldig ist …« Ich hielt inne. Ich wollte mich nicht in ein Beratungsgespräch hineinziehen lassen, das auf Furths grober Skizze von einem Verdächtigen basierte.
Er zwinkerte mir trotzdem zu, als hätte er mich bereits fest an der Angel. »Wenn er schuldig ist«, griff er meine letzten Worte auf, »dann möchte er womöglich auf irgendeine Weise bei den Ermittlungen mitmischen, wenn auch vielleicht nur ganz am Rand. Oder was meinen Sie?«
»So was ist schon vorgekommen.«
»Natürlich ist so was schon vorgekommen. Solche Leute fahren da voll drauf ab. Sie möchten nahe am Geschehen sein, um zu spüren, wie clever sie sind. Als kleinen Extrakick. Diese kranken Scheißkerle!«
»Was hat er denn überhaupt gesagt?«
»Wir haben noch nicht mit ihm gesprochen.«
»Warum nicht?«
»Wir werden ihn ein bisschen schmoren lassen. Aber wir haben auch nicht auf der faulen Haut gelegen. Bei uns gibt es eine junge Beamtin namens Colette Dawes. Ein nettes Mädchen. Sehr clever. Sie hat sich mit ihm angefreundet. In Zivil natürlich. Ihn zum Reden gebracht. Sie kennen so was ja. Ein bisschen Alkohol, ein paar Schmeicheleien, hin und wieder die Beine kokett übereinander geschlagen, wenn er gerade hinsieht, das Gespräch geschickt in die gewünschte Richtung gelenkt. Dabei hat sie die ganze Zeit ein Mikrofon getragen, und wir haben die Bänder. Stundenlange Gespräche.«
»Und das nennen Sie ermitteln?«, fragte ich verblüfft. »Eine Beamtin, die mit ihm flirtet?«
Furth beugte sich vor und starrte mich mit eindringlicher Miene an. »Mehr kann ich Ihnen nicht sagen«, antwortete er in verschwörerischem Tonfall. »Wir möchten nur Ihre professionelle Meinung über ihn hören. Ganz inoffiziell. Es würde auch nicht lange dauern. Sie bräuchten nur einen Blick in seine Akte werfen und dann kurz mit ihm sprechen. Sie wissen ja, wie so was läuft – einfach eine erste Beurteilung.«
»Ich soll mit ihm reden?«
»Ja, klar. Haben Sie damit ein Problem?«
Natürlich hatte ich damit ein Problem, und nun, da ich mir dessen bewusst geworden war, konnte ich nicht mehr Nein sagen. »Kein Problem«, antwortete ich. »Diese Frau, Colette Dawes, weiß sie, was sie tut?«