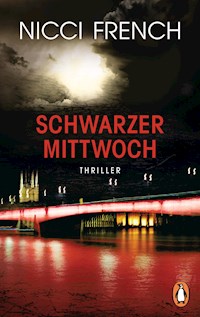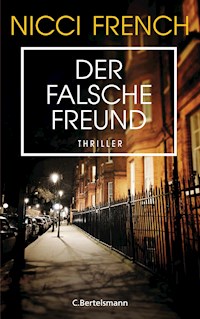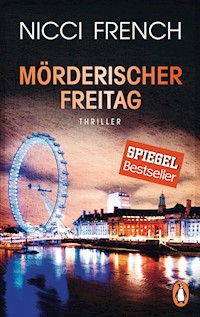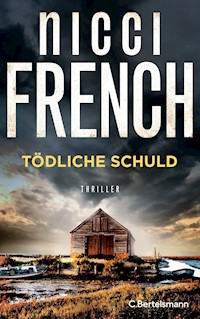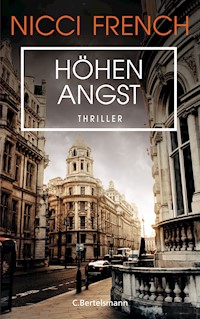Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Audio Media Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Psychologin Frieda Klein als Ermittlerin
- Sprache: Deutsch
Alte Verbrechen. Neue Gefahren. Kein Frieden für Psychologin Frieda Klein.
Frieda Klein kann nach den Aufregungen der Vergangenheit endlich aufatmen, glaubt sie, und sich Patienten, Freunden und Hobbys zuwenden. Doch schon bald holt eine offene Schuld sie ein – und wider Willen wird sie in den Fall Hannah Docherty verwickelt. Die über Dreißigjährige soll im Mai 2001 ihre Familie ermordet haben. Seitdem fristet sie ihr Leben, Medikamenten und Misshandlungen ausgesetzt, in einer psychiatrischen Klinik. Schon bald ist Frieda von Hannahs Unschuld überzeugt und setzt alles daran, den Fall neu aufzurollen ... Doch sie hat noch andere Sorgen – Dean Reeve, ihr Feind und Beschützer, ist anscheinend wieder aufgetaucht. Ein packender Thriller um die langen Schatten der Vergangenheit.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Blutiges Familiendrama und Psychoterror: Kein Frieden für Psychologin Frieda Klein.
Frieda ist froh, denn endlich hat sie alle Altlasten abgeschüttelt und kann sich ihren Patienten, Freunden und Hobbies zuwenden. Doch der Schein trügt, und schon bald wird sie in den Fall Hannah Docherty verwickelt. Die über Dreißigjährige soll im Mai 2001 ihre Familie ermordet haben. Seitdem fristet sie ihr Leben in einer psychiatrischen Klinik. Frieda ist aber von Hannahs Unschuld überzeugt und setzt alles daran, den Fall neu aufzurollen … Und sie hat noch andere Sorgen – Dean Reeve, ihr alter Feind und obskurer Beschützer, ist wieder aufgetaucht. Ein packender Thriller um die langen Schatten der Vergangenheit …
»Fans zählen schon die Tage, bis der sechste Roman der Thriller-Serie erscheint. Wir wissen – wieder geht es um die eigensinnige Frieda Klein, diesmal mit Samstag im Titel, und er wird uns genau süchtig machen wie Mörderischer Freitag.«
Andrew Wilson in The Independent
Autoren
Nicci French – hinter diesem Namen verbirgt sich das Ehepaar Nicci Gerrard und Sean French. Seit dem Erscheinen ihres Longsellers »Der Sommermörder« sorgen sie mit ihren Psychothrillern international für Furore und verkauften weltweit über 8 Mio. Exemplare. Die beiden leben in Südengland. »Böser Samstag« ist der sechste Band der achtteiligen Thrillerserie um Frieda Klein. Bislang erschienen »Blauer Montag«, »Eisiger Dienstag«, »Schwarzer Mittwoch«, »Dunkler Donnerstag« und »Mörderischer Freitag«.
NICCI FRENCH
BÖSER SAMSTAG
PSYCHOTHRILLER
Aus dem Englischenvon Birgit Moosmüller
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2016unter dem Titel »Saturday Requiem« bei Michael Joseph (Penguin Random House), London.1. Auflage
Copyright © 2016 by Joint-Up Writing, Ltd.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe 2016
bei C. Bertelsmann, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlag: www.buerosued.de
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-18338-7V001www.cbertelsmann.de
Sie empfindet keine Angst. Stichwunden verursachen keinen stechenden Schmerz. Es hatte sich eher angefühlt wie ein Faustschlag, gefolgt von einem schmerzhaften Ziehen, das in Wellen durch ihren Körper lief, bis schließlich ihre Beine nachgaben und sie zu Boden ging. Das Messer war klappernd auf der harten Fläche gelandet.
Sie hatte gar nicht richtig mitbekommen, wie es passierte, obwohl es mit ihrem eigenen Messer geschah. Sie hatte es gestohlen, unter der Matratze aufbewahrt und dann mitgenommen, versteckt in ihrem Hosenbund. Doch es war alles schiefgelaufen.
Jetzt liegt sie halb auf dem Fliesenboden, den Rücken gegen die Wand gestützt. Ihre nackten Füße sind feucht und warm von ihrem eigenen Blut.
Sie hört eine Stimme, und jemand schaltet eine Lampe an. Zwei an Ketten aufgehängte Neonröhren spenden ein schwaches, fahles Licht. Eine von beiden, diejenige auf der linken Seite, flackert und surrt. Mit distanziertem Interesse blickt sie auf ihr Blut hinunter. Es ist nicht rot, sondern eher kastanienbraun und wirkt klebrig und dick. Der Kopf sinkt nach hinten, sodass sich ihr Blick nach oben richtet.
Sie hört eilige Schritte, Gummisohlen, die über die Fliesen quietschen. Zunächst sieht sie nur den grünen Stoff der Kittel. Dann beugen sich die Gesichter dicht über sie. Sie spürt Hände, die ihr die Kleidung vom Leib schneiden, und hört murmelnde Stimmen.
»Wo ist sie hin?«
Sie sagt nichts. Stattdessen versucht sie, den Kopf zu schütteln, doch selbst das ist ihr zu anstrengend.
»Woher hatten Sie das Messer?« Sie findet es nicht der Mühe wert, diese Frage zu beantworten. Außerdem hört sie wieder Schritte, dann eine Männerstimme. Es ist einer von den Ärzten, der Asiat. Ein Licht leuchtet ihr direkt in die Augen. Als es wieder entfernt wird, erscheint ihr die Dunkelheit violett und wirbelnd.
»Sieht schlimm aus«, stellt er fest, »aber das wird schon wieder. Wo ist die andere hin?«
»Dahin«, antwortet eine der Pflegerinnen und deutet auf einen verschmierten Fußabdruck. Weitere Abdrücke führen hinaus auf den Gang, nach rechts, und verlieren sich in der Dunkelheit. Der Gang ist nicht beleuchtet, doch die Unruhe erregt Aufmerksamkeit. Hinter Gitterstäben sind Stöhnlaute und Geschrei zu hören. Jemand ruft um Hilfe, immer wieder dieselben Worte: »Holt mich! Holt mich!« Es handelt sich dabei um eine alte Frau, die stets diese Worte ausstößt, laut oder wimmernd, wenn sie wach ist und Angst hat, manchmal die ganze Nacht lang. Ein Pfleger starrt auf den letzten Fußabdruck und dann den dunklen Gang entlang. Als er hinter sich schnelle Schritte hört, blickt er sich um. Es sind zwei weitere Pfleger, bekleidet mit ihren weißen Kitteln und T-Shirts. Einer der beiden reibt sich die Augen. Er hat geschlafen.
»Was meint ihr, wo sie sein könnte?«
»Bestimmt ist sie im Aufenthaltsraum.«
»Wie kommst du darauf?«
»Das Stockwerk ist abgesperrt. Sie kann nirgendwo anders hin.«
»Habt ihr die nötige Dosis?«
Einer der Männer hält eine Spritze hoch.
»Reicht das?«
»Für ein gottverdammtes Pferd.«
»Sie steht bestimmt ganz schön unter Strom.«
»Wir sind zu dritt.«
»Hat sie ein Messer?«
»Sie hat es fallen lassen. Es war nicht das ihre.«
»Sie könnte noch eins haben.«
Sie schleichen den Gang entlang, spähen zu beiden Seiten in die Dunkelheit und lauschen, ob sich etwas bewegt.
Lediglich der Mond spendet ein wenig Licht, das in Streifen durch die Gitterstäbe auf den Gang fällt.
»Können wir denn kein Licht anschalten?«
»Nur von unten aus.«
Draußen bläst der Wind, und Regen klatscht gegen die Fenster, als würde jemand Wasser aus Kübeln schleudern. Einen kurzen Moment herrscht Ruhe, dann setzt das Klatschen wieder ein. Der Aufenthaltsraum ist eigentlich gar kein Raum, sondern nur der letzte Abschnitt des Gangs, wo dieser in einen offenen Bereich mit Sofas und Sesseln übergeht. Sie können bereits den Widerschein des Fernsehers an den Wänden sehen, als würde dort ein Kaminfeuer brennen. Die Männer sprechen im Flüsterton.
»Sollen wir warten?«
»Es ist doch nur eine einzelne Frau.«
»Ihr habt gesehen, was sie da hinten angerichtet hat.«
»Geht dir die Düse?«
»Nein, mir geht nicht die Düse.«
Zuerst können sie niemanden entdecken. Der Fernseher ist auf lautlos gestellt, es läuft eine Verkaufssendung, man sieht billigen Schmuck aufblitzen. Die Männer lassen den Blick über die leeren Sessel schweifen, den niederen Tisch mit der aufgeschlagenen Zeitung. Dann sehen sie in der Ecke eine zusammengekauerte Gestalt, die beide Arme um sich geschlungen hat. Im Licht des Fernsehers können sie die Tätowierungen entlang der Arme ausmachen: Gesichter, Sterne, Spiralen. Ein Arm ist mit etwas Dunklem verschmiert. Der Kopf ist gebeugt, das Gesicht hinter einem Vorhang aus Haar verborgen. Sie murmelt irgendetwas Unverständliches vor sich hin. Anschließend lässt sie den Kopf noch tiefer sinken, um ihn dann ruckartig nach hinten zu reißen. Mehrmals hintereinander knallt sie den Kopf gegen die Wand. Einer der Pfleger tritt vor.
»Beruhigen Sie sich. Wir bringen Sie zurück in Ihr Zimmer.«
Sie setzt ihr leises Gemurmel fort. Es ist fraglich, ob sie überhaupt mitbekommt, dass die Männer da sind. Als einer von ihnen näher tritt, dreht sie den Kopf einen Moment so, dass sich die dicke Haarmähne teilt. Ihr Blick wirkt leuchtend und starr wie der eines in die Enge getriebenen Tiers. Der Pfleger bekommt eine Gänsehaut und zögert einen Moment. In diesem Augenblick des Zögerns stürzt sie sich nach vorne. Es ist nicht klar, ob sie auf ihn losgeht oder er einfach nur im Weg steht. Jedenfalls landet er rückwärts auf dem Tisch und sie auf ihm. Er stößt einen Schrei aus. Die zwei anderen Pfleger versuchen, sie von ihm herunterzuziehen. Einer der beiden schlingt ihr einen Arm um den Hals und zerrt immer heftiger, doch der unter ihr liegende Mann schreit weiter. Sein Kollege reißt die Faust hoch und boxt ihr mehrmals fest in die Rippen. Sie können alle das dumpfe Geräusch jedes einzelnen Schlags hören. Es klingt, als würde ein Krockethammer in Erde einsinken. Schließlich lässt die Frau los, und die Männer zerren sie weg. Ihr ganzer Körper schlenkert und schlägt um sich, obwohl die Pfleger sich mit aller Kraft bemühen, sie ruhig zu halten.
»Haltet sie auf dem Boden!«
Sie drehen sie in die Bauchlage. Zwei der Männer umklammern je einen Arm, während der Dritte sich auf ihren Rücken setzt, doch sie tritt immer noch wild in die Luft. Mit den Zähnen zieht der Mann die Plastikkappe von der Spritze.
»Haltet sie ruhig.«
Er rammt der Frau die Spritze in den Oberschenkel und lässt das Beruhigungsmittel langsam in ihren Körper strömen. Anschließend wirft er die Spritze zur Seite und legt sich über die Beine der Frau, um sie zu fixieren. Kreischend und weinend windet sie sich unter ihm. Er kann sie riechen: Tabak, Schweiß, den heißen Geruch der Angst, fast wie sexuelle Erregung. Anfangs ist keine Veränderung spürbar, doch nach etwa einer Minute lassen die Bewegungen und auch die Laute nach, und ihr Körper erlahmt unter ihm. Er zählt langsam bis zehn, nur um sicherzugehen. Dann stehen sie alle drei auf und treten keuchend von dem reglos daliegenden Körper zurück.
»Ist mit euch alles in Ordnung?«
Einer der Pfleger fasst sich an den Hals.
»Sie hat mich gebissen.«
»Sie ist verdammt stark. Drei reichen da nicht aus.«
»Sie kann nichts dafür. Die anderen sind auf sie losgegangen.«
»Das nächste Mal werden sie ihr noch viel heftiger zusetzen.«
1
Der Wind pfiff die Straße entlang und blies Frieda Klein wie aus einem Tunnel entgegen. Es regnete unablässig. Sie wanderte durch die Dunkelheit, weil sie hoffte, dadurch endlich müde zu werden. Um diese Uhrzeit, in den frühen Morgenstunden, wenn auf den Straßen kaum noch jemand unterwegs war und Füchse die Mülltonnen durchwühlten, hatte sie das Gefühl, dass ihr London ganz allein gehörte. Sie erreichte The Strand und wollte gerade die Straße überqueren, um zur Themse zu gelangen, als in ihrer Tasche das Handy zu vibrieren begann. Wer rief sie um diese Zeit an? Sie holte das Telefon heraus und warf einen Blick auf das Display: Yvette Long. Detective Constable Yvette Long.
»Yvette?«
»Es geht um Karlsson.« Yvettes Stimme klang laut und hart. »Ihm ist etwas passiert.«
»Karlsson? Was denn?«
»Ich weiß es nicht genau.« Yvette klang, als müsste sie die Tränen zurückhalten. »Ich habe es soeben erst erfahren. Jemand wurde verhaftet, und Karlsson ist im Krankenhaus. Er wird gerade operiert. Es klingt ernst. Ich musste einfach jemanden anrufen.«
»In welchem Krankenhaus?«
»St. Dunstan’s.«
»Bin schon unterwegs.«
Sie versenkte das Handy wieder in ihrer Tasche. Das St. Dunstan’s lag in Clerkenwell, mindestens anderthalb Kilometer entfernt, vielleicht sogar noch weiter. Frieda rief ein Taxi. Sie starrte aus dem Fenster, bis sie die rußgeschwärzten oberen Stockwerke des Krankenhauses vor sich auftauchen sah. Die Frau am Empfang fand im Computer niemanden mit dem Namen Karlsson.
»Versuchen Sie es in der Notaufnahme.« Die Frau deutete nach rechts. »Auf der anderen Seite des Hofs. Dieser Gang führt direkt hinüber.«
In der Notaufnahme musste Frieda sich am Ende einer Schlange anstellen. Ganz vorne stand ein Mann, der sich gerade erkundigte, warum noch niemand nach seiner Frau gesehen habe. Sie warte schon zwei Stunden, nein, länger als zwei Stunden. Die Empfangsdame erklärte ihm sehr höflich und langsam, dass die wartenden Patienten nach dem Grad der Dringlichkeit behandelt würden. Frieda warf einen Blick auf ihr Handy. Es war inzwischen zwanzig nach vier Uhr morgens.
Wie es aussah, hatte der Mann nicht vor, das Feld zu räumen. Er wiederholte seine Beschwerde in noch lauterem Ton und begann dann eine Diskussion mit einem hinter ihm wartenden Teenager, der einen Trainingsanzug trug und die rechte Hand mit einem schmuddelig wirkenden Geschirrtuch umwickelt hatte. Der alte Mann vor Frieda wandte sich seufzend zu ihr um. Sein Gesicht hatte einen gräulich-grünlichen Farbton.
»Reine Zeitverschwendung«, bemerkte er. Frieda schwieg. »Meine Frau hat mich gedrängt herzukommen«, fuhr er fort. »Dabei plagt mich bloß mein Arm. Und meine schlechte Verdauung.«
Frieda betrachtete ihn genauer. »Wie fühlt sich das denn an?«
»Es liegt an meiner schlechten Verdauung.«
»Beschreiben Sie es mir.«
»Als würde sich eine Klammer um meine Brust spannen. Ich brauchte nur ein Alka-Seltzer.«
»Kommen Sie mit«, sagte Frieda und zerrte den perplexen Mann nach vorne.
Der dort stehende Mann unterbrach seine Beschwerde und blickte sich um. »Das ist hier eine Warteschlange!«
Frieda schob ihn beiseite. »Er steht kurz vor einem Herzinfarkt«, erklärte sie.
Die Frau am Empfang starrte sie verblüfft an. »Wer sind Sie?«
»Herzinfarkt«, sagte Frieda. »Das ist die Information, auf die Sie sich konzentrieren sollten.«
Die nächsten paar Minuten verliefen hektisch: Laute Anweisungen ertönten, Türen flogen auf und zu. Nachdem man den Mann auf ein Rollbett gelegt hatte, kehrte plötzlich wieder Ruhe ein. Frieda und die Frau am Empfang sahen sich an.
»Ist er Ihr Vater?«
»Ich bin wegen Malcolm Karlsson hier«, erklärte Frieda, »Chief Inspector Malcolm Karlsson.«
»Sind Sie eine Verwandte?«
»Nein.«
»Eine Kollegin?«
»Nein.«
»Dann tut es mir leid. Wir dürfen keine Informationen herausgeben.«
»Genau genommen war ich eine Weile seine Kollegin. Wir haben zusammengearbeitet.«
Die Frau musterte sie skeptisch. »Sind Sie Polizeibeamtin?«
»Ich war bei ihm angestellt, und außerdem ist er ein Freund.«
»Tut mir leid.«
»Sagen Sie mir wenigstens, wie es ihm geht.«
»Seien Sie bitte so gut und treten Sie beiseite. Hier warten Leute, die behandelt werden wollen.«
»Wer ist Ihr Vorgesetzter?«
»Wenn Sie nicht zur Seite treten, rufe ich den Sicherheitsdienst.
»Gut, dann tun Sie das.«
»Frieda.« Sie wandte den Kopf. Yvette wirkte atemlos. Sie fischte ihren Dienstausweis aus der Tasche und zeigte ihn der Frau am Empfang. Frieda bemerkte, dass ihre Hände zitterten. Die Frau nahm den Ausweis entgegen und unterzog ihn einer genauen Prüfung, als könnte es sich um eine Fälschung handeln. Schließlich stieß sie einen Seufzer aus.
»Durch die Tür am hinteren Ende des Wartebereichs. Fragen Sie dort. Gehört diese Dame zu Ihnen?«
»Sozusagen«, antwortete Yvette.
»Bitte nehmen Sie sie mit.«
»Niemand weiß etwas«, erklärte Yvette Frieda im Gehen.
Sie schob eine Schwingtür auf. Beim Verlassen des Wartebereichs stießen die beiden Frauen beinahe mit einem uniformierten Beamten zusammen.
»Ist Karlsson hier?«, fragte Frieda.
Der junge Mann betrachtete Frieda verblüfft. Yvette hielt ihm ihren Ausweis hin.
»Wie geht es ihm?«
»Schwebt er in Lebensgefahr?«
»Lebensgefahr?«, wiederholte der Beamte verdutzt. »Er ist da vorne. In der Kabine ganz am Ende.«
Frieda und Yvette eilten an den anderen Kabinen vorbei. Aus einer drang das Schluchzen einer Frau. Schließlich erreichten sie die letzte Nische, die mit einem blauen Vorhang abgeschirmt war. Yvette bedachte Frieda mit einem fragenden Blick, woraufhin Frieda den Vorhang zurückzog. Zum Vorschein kamen eine junge Ärztin und auf dem Bett Karlsson in halb sitzender Position, bekleidet mit einem weißen Hemd, Krawatte und einer Anzughose, bei der eine Seite fast ganz weggeschnitten war, um ein blutunterlaufenes, geschwollenes Bein freizulegen.
»Ich dachte …«, begann Frieda. »Wir dachten …«
»Ich habe mir das gottverdammte Bein gebrochen«, erklärte Karlsson.
»Sie haben den Kerl geschnappt«, berichtete Yvette. »Er sitzt in U-Haft. Er wird dafür bezahlen!«
»Wofür denn?« Karlsson funkelte sie beide finster an. »Ich bin gestürzt. Er wollte davonlaufen, da bin ich ebenfalls losgesprintet und dabei über einen losen Pflasterstein gestolpert. Normalerweise springt man wieder auf, klopft sich den Dreck von der Hose und rennt weiter, aber wie sich nun herausstellt, bin ich mittlerweile ein alter, nutzloser Vollidiot. Ich bin gestürzt, und dabei habe ich ein Knacken gehört, als würde ein Zweig brechen.«
»Yvette hat mich angerufen«, berichtete Frieda. »Wir dachten, etwas ganz Schreckliches sei passiert. Ich meine, richtig schrecklich.«
»Wonach sieht es denn aus?« Karlsson wandte sich an die junge Ärztin. »Sagen Sie es ihnen. Was ist noch mal alles gebrochen?«
»Tibia und Fibula«, antwortete die Ärztin.
»Ich werde operiert«, erklärte Karlsson. »Mit Nägeln und Schrauben.«
»Wir warten auf den zuständigen Facharzt. Er müsste gleich kommen.«
»Tut es weh?«, fragte Yvette.
»Sie haben mir was gegeben. Es ist seltsam, ich kann den Schmerz zwar noch spüren, aber er macht mir nichts aus.« Einen Moment herrschte Schweigen. Karlsson starrte auf sein blutunterlaufenes Schienbein. Erst jetzt registrierte Frieda, dass es nicht mehr ganz gerade war. »Das wird Wochen dauern. Monate.«
Die Ärztin machte ein betretenes Gesicht.
»Ich sehe mal nach, wo der Kollege bleibt«, sagte sie und verließ die Kabine.
»Sollen wir dir was zu essen oder zu trinken holen?«, fragte Yvette.
»Besser nicht«, gab Frieda zu bedenken. »Nicht wenn sie ihn gleich operieren wollen.«
Als Karlsson wieder das Wort ergriff, klang er ein wenig benommen und undeutlich, als würden die Medikamente bereits wirken. »Das ist alles deine Schuld.«
»Meine?«, fragte Frieda. »Ich habe dich doch seit Wochen nicht mehr zu Gesicht bekommen.«
»Du hast dafür gesorgt, dass meine Suspendierung aufgehoben wurde. Du und dein Freund, dieser Levin. Hättet ihr beide euch das verkniffen, säße ich jetzt wohlbehalten zu Hause.«
»Ich glaube nicht, dass man das so …«, begann Frieda, doch Yvette fiel ihr ins Wort.
»Wer ist Levin?«
»Frieda stand eigentlich schon mit einem Fuß im Gefängnis«, antwortete Karlsson. »Das weißt du ja. Und mir drohte ein Disziplinarverfahren oder die Entlassung oder eine Verhaftung – oder alles zusammen. Dass es dann doch nicht dazu kam, haben wir der Tatsache zu verdanken, dass plötzlich ein Kerl namens Levin auftauchte.«
»Von der Met?«, wollte Yvette wissen.
»O nein, der doch nicht.«
»Innenministerium?«
»Das hat er uns nie verraten. Er hatte es auf Frieda abgesehen, interessierte sich ganz brennend für sie. Aber den Grund nannte er uns nie.«
»Er hat gesagt, ich sei ihm einen Gefallen schuldig. Allerdings weiß ich nicht, was das heißen soll.«
»Auf jeden Fall ist es gefährlich«, meinte Karlsson, »jemandem einen Gefallen zu schulden. Ich saß schon Leuten gegenüber, die sagten: ›Ich habe es nur für einen Freund getan.‹ Wenn ich sie dann darauf hinwies, dass sie jemanden umgebracht hatten, antworteten sie: ›Aber ich war es ihm schuldig.‹ Als wäre das eine Entschuldigung.« Er ließ sich auf das Bett zurücksinken. Offenbar strengte ihn das Sprechen an. »Demnach hast du nichts von ihm gehört?«
»Das habe ich nicht gesagt. Er hat in letzter Zeit tatsächlich ein paar Nachrichten auf meiner Mailbox hinterlassen.« Genauer gesagt vier Stück, wobei er sie jedes Mal in liebenswürdigem Ton bat, sich schnellstmöglich bei ihm zu melden. »Ich habe ihn bloß noch nicht zurückgerufen.«
Karlsson schien gar nicht auf ihre Worte zu achten.
»Der Arzt hat von Schrauben und Bolzen in meinem Bein gesprochen.«
»Ja, das hast du schon erzählt.«
»In Zukunft werde ich immer den Alarm auslösen, wenn ich am Flughafen durch die Kontrolle gehe.«
»Ja, wahrscheinlich.«
»Levin hat also vor, dich mir zu stehlen.« Karlsson klang fast verträumt.
»Niemand stiehlt Frieda«, widersprach Yvette. »Die Polizei wird ihre Dienste sowieso nicht mehr in Anspruch nehmen. Nicht nach dem letzten Mal.«
»Danke, Yvette«, meldete Frieda sich zu Wort. »Darauf lege ich auch gar keinen Wert mehr.«
»Ich werde deine Dienste immer in Anspruch nehmen«, verkündete Karlsson.
»Das wird nicht gehen.« Yvette klang mittlerweile leicht verstimmt.
»Aus dir sprechen schon die Medikamente«, sagte Frieda zu Karlsson. »Du brauchst ein bisschen Ruhe.«
Karlsson veränderte seine Position auf dem Bett und verzog dabei das Gesicht.
»Ich brauche mehr Schmerzmittel. Was haben wir heute überhaupt für einen Tag?«
»Samstag«, antwortete Frieda. »Aber der Tag ist noch gar nicht richtig angebrochen.«
»Ich hasse Samstage.«
»Kein Mensch hasst den Samstag.«
»Genau das ist es ja. Eigentlich sollte man den Samstag mögen. Man sollte ausgehen, sich betrinken und sogenannten Spaß haben. Das ist ein richtiger Zwang.«
»Tja, heute Abend wirst du bestimmt nicht ausgehen«, bemerkte Frieda.
»Jetzt, nachdem ich nicht kann, hätte ich fast Lust darauf.«
Karlsson klang inzwischen sehr müde, und bevor Frieda oder Yvette etwas antworten konnten, war er auch schon eingeschlafen.
2
Am darauffolgenden Montag war es um die Mittagszeit stürmisch und nass. Der Regen klatschte so heftig gegen die Fensterscheiben, dass es unmöglich war, den wolkenverhangenen grauen Himmel draußen zu sehen. Frieda hatte an diesem Tag schon zwei Patienten empfangen und sich anschließend ihre Notizen gemacht. Nun blieb ihr genug Zeit, sich vor ihren Nachmittagssitzungen ein schnelles Mittagessen in der Nummer Neun zu gönnen. Während der Monate, die seit jenem letzten, schrecklichen Sommer vergangen waren, hatte ihr das gleichmäßige Muster ihres Lebens Freude bereitet: ihr kleines Haus mit dem offenen Kamin, die Arbeit hier in ihrer Praxis und im Warehouse, ihr kleiner Freundeskreis, aber auch die Stunden, die sie allein und in Stille verbrachte, wenn sie sich zum Zeichnen in ihr Dachstübchen zurückzog oder an ihrem Schachtisch verschiedene Partien durchspielte. Mit der Zeit war das Grauen zurückgewichen, sodass es nur noch am Rand ihres Bewusstseins lauerte.
Sie griff nach ihrem Mantel und hängte sich ihre Tasche um. Zweifellos würde sie nass werden, doch das machte ihr nichts aus. Als sie schließlich die Tür zum Vorzimmer aufschob, fielen ihr als Erstes die Schuhe ins Auge: alte braune Herrenschuhe mit Lochornamenten und Flügelkappe. Die dazugehörigen, mit einer braunen Cordhose bekleideten Beine waren ausgestreckt und endeten in blauen Socken. Frieda schob die Tür ganz auf.
Walter Levin nahm eine geradere Sitzhaltung ein, rückte seine heruntergerutschte Brille zurecht und strahlte Frieda an.
»Was machen Sie denn hier?«
Walter Levin erhob sich. Er trug eine Tweedjacke mit großen Knöpfen, bei deren Anblick Frieda sofort an Herrenklubs denken musste, an offene Kamine, holzvertäfelte Räume, Whisky und Pfeifen. Der Händedruck, mit dem er sie begrüßte, fühlte sich warm und kräftig an.
»Ich habe mir gedacht, wir könnten vielleicht ein bisschen plaudern.«
»Nein, ich meine, wie sind Sie hier hereingekommen? Wer hat Ihnen die Haustür aufgemacht?«
»Als ich ankam, verließ eine nette Dame gerade das Haus.«
»Das glaube ich Ihnen nicht.«
»Ist das so wichtig?«
»Hätten Sie nicht vorher anrufen können und wie jeder normale Mensch einen Termin vereinbaren?«
»Das habe ich ja versucht, aber es klappte nicht.« Er musterte sie mit hochgezogenen Augenbrauen. Frieda reagierte nicht. »Darf ich Ihnen Ihre Tasche abnehmen?«, bot er an.
»Nein, danke, nicht nötig.«
Er nahm seinen Mantel von der Armlehne und schlüpfte hinein. Nachdem er ihn bis oben zugeknöpft hatte, schlang er sich einen karierten Schal um den Hals.
»Ich habe einen Schirm«, erklärte er ritterlich.
»Wahrscheinlich muss ich in eine andere Richtung als Sie.«
»Ich bin gekommen, um Sie zu einem Abendessen einzuladen.«
»Zu einem Abendessen?«
»Ja, aber zu keinem gewöhnlichen.«
Er klopfte an seine Taschen, eine nach der anderen, um sich dann am Ende zu der Lederaktentasche hinunterzubeugen, die zu seinen Füßen stand. »Da haben wir es ja«, sagte er, während er ein cremefarbenes Kuvert hervorholte und es Frieda reichte.
Sie zog eine Karte aus festem Papier heraus. Goldgeprägte Lettern luden sie herzlich dazu ein, am kommenden Donnerstag an einem Galadinner in einem Saal in der Nähe von Westminster teilzunehmen, anlässlich einer Auktion mit dem Ziel, Geld für die Familien von Soldaten zu sammeln, die in Ausübung ihres Dienstes gefallen waren. Formelle Kleidung erbeten, stand da.
»Was erwartet mich dort?«
»Eine Versammlung der Großen und Guten.«
»Ist das der Gefallen, den ich Ihnen schulde?«
»Es ist eine Einführung zu dem Gefallen.« Er nahm seine Brille ab und putzte sie mit dem Saum seines Schals. Seine Augen wirkten kühl, wie braune Kieselsteine.
»Können Sie mir nicht einfach sagen, worum es geht?«
»Das ist nicht nötig. Soll ich Ihnen einen Wagen vorbeischicken?«
»Ich finde selbst hin.«
Frieda wartete, bis er verschwunden war, ehe sie ihrerseits aufbrach. Mit einem Gefühl von Erleichterung trat sie in den ungemütlichen Februartag hinaus. An den Straßenrändern strömte Wasser entlang und sammelte sich auf den Gehsteigen zu Pfützen. Die Konturen der Gebäude schienen zu verschwimmen. Im ganzen Land herrschte Hochwasser, eine richtige Flut. Während Frieda eilig dahinmarschierte, spürte sie, wie ihr der Regen am Hals hinunterlief, doch schon bald erreichte sie die Nummer Neun und ließ sich von wohliger Wärme und dem Duft nach Kaffee und frischem Brot einhüllen. Den Gedanken an den Donnerstag schob sie ganz weit von sich weg.
Nachdem Dorys Wunde genäht ist, bekommt sie eine Infusion und ein Bett in einem Privatflügel des Gebäudes, wo sie ganz isoliert liegt. Sie wollen nicht, dass sie mit anderen Patienten spricht. Anderen Gefangenen. Patienten. Gefangenen. Selbst die Wachen kommen manchmal durcheinander und schwanken zwischen den beiden Begriffen. Es ändert nichts an der Realität, egal, welches Wort sie benutzen. Dory befindet sich am hintersten Ende von Flügel D, neben einem Fenster. Zwei Eulen rufen einander die ganze Nacht zu. Dory kann die Laute nicht von den Geräuschen in ihrem Kopf unterscheiden, den Geräuschen in ihren Träumen, den Erinnerungen an ihre eigenen Schreie, als Hannah ihr das Messer in den Leib rammte und ihre Gesichter sich dabei so nahe kamen wie bei einem Liebespaar.
Aber ihr ist klar, dass Mary davon erfahren muss. Mary weiß bestimmt, was zu tun ist. Hannah bekommt ihr Fett schon noch ab.
3
Die Feier fand in einem Herrenklub in der St. James’s Street statt. Frauen hatten keinen Zutritt, außer zu besonderen Anlässen. Als Frieda den Saal betrat, fühlte sie sich geblendet von den vielen Lüstern, dem glitzernden Schmuck, den funkelnden, das Licht reflektierenden Weingläsern. Sie nahm auch den Lärmpegel wahr, Stimmen, die erfreute Rufe ausstießen, kleine Lachsalven. Sie roch Parfüm, Leder und Geld.
»Großartig«, sagte eine Stimme.
Levin war an ihre Seite geeilt, drückte ihr eine Champagnerflöte in die Hand, hakte sich bei ihr unter und führte sie hinein in die Menge, während er liebenswürdig vor sich hinmurmelte und den Blick hinter seinen Brillengläsern hierhin und dorthin schweifen ließ. Frieda registrierte Männer, die Medaillen und Bänder trugen. Levin machte sie auf eine ältere Politikerin aufmerksam, deren korpulenter Ehemann bereits ziemlich undeutlich sprach, auf ein Grüppchen von Geschäftsführern, auf einen General.
»Hat hier jeder irgendeine leitende Funktion?«, fragte Frieda.
»Jeder außer Ihnen.«
Sie warf ihm einen argwöhnischen Blick zu. Sein Gesicht wirkte völlig ausdruckslos. Er stellte sie einer Frau vor, die eine wichtige Position in der Finanzwelt bekleidete, doch bevor sie ein Wort sagen konnte, schob er sie schon weiter. Das Abendessen wurde angekündigt. Sie nahmen an einem Tisch Platz, zusammen mit dem Direktor einer Firma, die Sonnenkollektoren herstellte, einer Anwältin, die erzählte, sie habe sich auf Scheidungsfälle spezialisiert, einem Mann mit schönem silbergrauem Haar und einer Adlernase, dessen Namen und Beruf Frieda nicht in Erfahrung brachte, einem Architekten mit einem gläsernen Gehstock und einer Ehefrau, die zu viel trank und ständig mit dem Zeigefinger auf den silberhaarigen Mann zeigte, wenn sie im Gespräch etwas besonders betonen wollte. Sie aßen erst Jakobsmuscheln und dann Ente auf einem Bett aus Granatäpfelkernen, Pflaumen und gelben Pilzen. Frieda bekam nichts hinunter und trank nur Wasser. Sie träumte davon, zu Hause mit einer Schüssel Suppe an ihrem Kamin zu sitzen, ins Feuer zu schauen und dem Wind und Regen draußen zu lauschen. Der Mann am Nebentisch schob seinen Stuhl zurück und rammte ihn Frieda dabei in den Rücken.
»Entschuldigung«, sagte eine vertraute Stimme.
Als Frieda sich umdrehte, sah sie sich mit dem roten Gesicht von Polizeipräsident Crawford konfrontiert, dem Mann, der vorgehabt hatte, Karlsson ein Disziplinarverfahren anzuhängen, außerdem dafür verantwortlich war, dass sie, Frieda, aus ihrer Zusammenarbeit mit der Polizei entlassen wurde, und der es am liebsten gesehen hätte, wenn sie im Gefängnis gelandet wäre. Er starrte sie an, während er gleichzeitig noch ein wenig an seinem letzten Bissen kaute. Als er einen schnellen Blick zurück zu den Leuten an seinem Tisch warf, stellte er fest, dass sie ihn interessiert beobachteten. Rasch setzte er ein Lächeln auf. »Ich hatte nicht damit gerechnet, Sie hier zu sehen.«
»Ich habe selbst auch nicht damit gerechnet, mich hier zu sehen.«
»Was führt Sie dann her?«
»Ich bin als Gast hier.«
»Willst du uns denn nicht vorstellen?«, meldete sich die Frau an seiner Seite zu Wort.
Stirnrunzelnd kam Crawford ihrer Aufforderung nach.
»Und woher kennt ihr beide euch?«, fragte die Frau in scherzhaftem Ton. »Geschäft oder Vergnügen?«
»Weder noch«, antwortete Crawford und wandte sich wieder an Frieda. »Führen Sie irgendetwas im Schilde?«
»Keine Sorge«, entgegnete Frieda. »Ich werde nichts anstellen, was Sie in Verlegenheit bringen könnte.«
»Darüber bilde ich mir lieber selbst ein Urteil.«
Als Frieda sich daraufhin wieder ihrem eigenen Tisch zuwandte, stellte sie fest, dass Levin sie mit nachdenklicher Miene betrachtete. Vor dem Beginn der Auktion stand eine Pause auf dem Programm. Levin kam zu Frieda herüber. »Lassen Sie uns doch ein kleines Bad in der Menge nehmen«, schlug er vor.
Eine Hand leicht unter ihren Ellbogen geschoben, führte er sie zu dem langen Tisch am Ende des Raums, wo gerade Kaffee serviert wurde.
»Ich spiele mit dem Gedanken, einen Wochenend-Kochkurs in Wales zu ersteigern. Was halten Sie davon?« Sein Gesichtsausdruck veränderte sich. »Ben. Ich habe Sie gar nicht gesehen.«
Friedas erster Eindruck von dem Mann war, dass er überdimensional groß wirkte. Er hatte breite Schultern und einen entsprechend breiten Brustkorb, kastanienbraunes Haar, weiße Zähne und gebräunte Haut. Seine Ausstrahlung war geprägt von guter Laune und einem munteren, leicht großspurig anmutenden Charme. Er ließ nicht nur Levin klein und unscheinbar wirken, sondern überragte sämtliche Leute um ihn herum.
»Sie tauchen aber auch an den unwahrscheinlichsten Orten auf«, sagte er und legte Levin eine Hand auf die Schulter.
Mit einem gelassenen Lächeln stellte Levin ihn Frieda als Ben Sedge vor. Seine Augen waren sehr blau. Er begrüßte Frieda mit einem kräftigen Händedruck.
»Bieten Sie für irgendetwas?«, fragte er und blickte sich dabei im Saal um. »Für mich sind die Preise ein bisschen heftig.« Er beugte sich leicht zu Frieda hinunter. »Die meisten hier haben mehr Geld als Verstand, finden Sie nicht auch?«
»Immerhin ist es für einen guten Zweck, wenn ich das richtig sehe«, antwortete Frieda. Sie bemerkte, dass Levin verschwunden war.
»Das behaupten die zumindest. Sie sind nicht zufällig Journalistin, oder?«
»Nein.«
»Was machen Sie denn dann beruflich?«
»Ich bin Psychotherapeutin. Und was für einen Beruf haben Sie?«
»Den besten der Welt«, antwortete er. »Ich bin Polizeibeamter.«
Ehe Frieda noch etwas sagen konnte, tauchte Levin wieder auf. Er reichte ihr eine Tasse Kaffee und legte ihr erneut die Hand unter den Ellbogen.
»Sie müssen entschuldigen«, wandte er sich an Sedge und führte Frieda zurück in die Mitte des Raums.
»Ich glaube, wir sparen uns die Auktion«, erklärte er.
»Sie wollen schon gehen?«
»Ja.«
»Warum sind wir dann überhaupt hergekommen?«
Er blinzelte sie an. »Ich wollte, dass Sie Detective Chief Inspector Sedge kennenlernen.«
»Warum?«
»Ich interessiere mich für ihn.«
»Was hat das mit mir zu tun?«
Er fischte eine kleine Karte aus seiner Brusttasche und reichte sie ihr.
»Morgen früh, neun Uhr, bitte. Dann sage ich Ihnen, worin der Gefallen besteht, den Sie mir tun sollen.«
4
Am nächsten Morgen um halb neun verließ Frieda ihr Haus und marschierte über den Fitzroy Square in Richtung Osten. Die Sonne schien von einem blauen Himmel herab. Als Frieda damals in die Gegend zog, gehörte zu ihren Nachbarinnen eine alte Frau namens Doris, die schon dort lebte, seit sie ein kleines Mädchen war. Frieda kaufte manchmal für sie ein, und Doris sprach oft darüber, wie sehr sich das Viertel verändert habe. »Entlang der Warren Street gab es früher nur Gebrauchtwagenhändler«, erzählte sie immer. »Autohändler und Ganoven.«
Zu der Zeit, als Frieda einzog, waren die Autohändler längst weg. Die prächtigen Häuser rund um den Platz waren in schäbige kleine Büros für Anwälte und Reiseagenturen aufgeteilt worden. Die Anwälte hatten inzwischen das Weite gesucht, und die Reiseagenturen waren genauso ausgestorben wie die Leute, die einst die Straßenlaternen angezündet hatten. Der Platz war in eine Fußgängerzone umgestaltet und auf Vordermann gebracht worden, und die Büros hatte man in Stadthäuser zurückverwandelt. Sie wurden von Prominenten aus dem Fernsehen bewohnt, die sich über die Aussicht beschwerten, Steuern für die Millionen bezahlen zu müssen, die ihre Häuser mittlerweile wert waren. Frieda fragte sich, ob es nicht an der Zeit war, dorthin umzuziehen, wo die Autohändler und die Ganoven jetzt lebten.
Die Adresse, die Levin ihr gegeben hatte, war nur einen kurzen Fußmarsch entfernt. Vor ihrem geistigen Auge sah Frieda die Strecke wie ein geometrisches Spiel vor sich, bei dem man vier von Bäumen begrünte Plätze abhakte: Fitzroy, Bedford, Bloomsbury und Queen Square. Sie überquerte sie einen nach dem anderen, bis sie vom letzten schließlich in eine schmale, schattige, ziemlich versteckt liegende und von schmalen Häusern gesäumte Straße abbog. Sie betrachtete die dunkelgrüne Haustür. Hatte Levin hier wirklich sein Büro? Sie drückte auf einen kleinen Türsummer aus Kunststoff. Die Tür wurde von einer jungen Frau mit kurzem, stacheligem Haar geöffnet, die ein blau-weiß gestreiftes Hemd über einer blauen Hose trug und dazu schwere schwarze Lederstiefel. Sie lächelte Frieda an.
»Sie erkennen mich nicht wieder«, stellte sie fest.
Frieda hielt einen Moment inne. »Doch.«
»Woher denn?«
»Aus dem anderen Büro. In Chapel Market.«
»Stimmt. Ich habe Sie hereingelassen, als sie zu Walter zur Befragung kamen.«
»Eine Befragung war es nicht direkt.«
»Ich heiße Jude.«
Drinnen wirkte es wie ein normales, schmales Reihenhaus mit gerahmten Radierungen an der Wand. Vor ihnen befand sich eine Treppe, und seitlich von ihnen führte der Gang in die Küche. Jude öffnete eine Tür zu ihrer Linken und lotste Frieda hinein.
»Darf ich Ihnen eine Tasse Tee oder Kaffee bringen?«, fragte sie.
»Nein, danke.«
»Dann hole ich jetzt Walter.«
Sie verließ den Raum. Frieda hörte sie die Treppe hinaufgehen. Sie blickte sich um. So sahen auch eine Million andere Erdgeschossräume in London aus: ein Wohnzimmer, das mit einem Hinterzimmer verbunden worden war. Es gab zwei kleine Kamine und zwei dazugehörige Kaminsimse. Doch obwohl der Raum all die Komponenten eines Zuhauses aufwies – Bilder von ländlich anmutenden Landschaften, ein Sofa und zwei Sessel, einen niedrigen Couchtisch –, war trotzdem klar, dass niemand dort lebte. Die Fensterscheibe, die auf die Straße hinausging, bestand aus Milchglas. Im Raum selbst fehlten die Fragmente eines wirklichen Lebens. Es gab weder Nippes auf den Regalen noch Bücher, noch Zeitschriften. Stattdessen war alles mit Akten vollgepackt, breiten und schmalen Ordnern aus Pappe und aus Plastik, die sich auf dem Boden türmten und in den Regalen aneinanderreihten. Zwei Aktenschränke – leicht unterschiedlich in Form und Farbe – standen nebeneinander an einer Wand. Am hinteren Ende des Raums befand sich ein Kiefernholzschreibtisch mit einem Computer, einem Drucker und einem zusätzlichen Laptop.
»Demnach haben Sie uns also gefunden?«, fragte eine vertraute Stimme. Frieda blickte sich um. Es war Levin, begleitet von einem anderen Mann, der grobe Gesichtszüge hatte und mit einem grauen Anzug bekleidet war, zu dem er eine dunkle Krawatte trug. Er betrachtete Frieda mit einem gelangweilten Ausdruck, als würde er einerseits darauf warten, beeindruckt zu werden, andererseits aber nicht wirklich damit rechnen.
»Das ist Jock Keegan«, stellte Levin ihn vor. »Ein ehemaliger Polizeibeamter.«
»Was machen Sie denn jetzt?«, wollte Frieda wissen.
»Er arbeitet für uns«, erklärte Levin. »Hat Jude Ihnen Tee angeboten?«
»Ich möchte nichts, danke.«
»Machen wir es uns gemütlich.«
Levin und Keegan ließen sich auf dem Sofa nieder. Frieda zog sich vom Schreibtisch einen Holzstuhl herüber und platzierte ihn gegenüber den beiden Männern.
»Es kommt mir vor, als wollten Sie uns befragen«, bemerkte Levin mit einem Lächeln.
»Ich sollte Sie vorwarnen«, sagte Frieda.
»Inwiefern?«
»Falls Sie so eine Art Profiling von mir erwarten, muss ich Ihnen sagen, dass ich daran kein Interesse habe. Ich glaube nicht an so etwas und mache es auch nicht. Falls es das ist, was Sie wollen, sollten Sie sich nach jemand anderem umsehen.«
Einen Moment herrschte Schweigen. Levin und Keegan blickten sich an.
»Ich bin mir nicht ganz sicher, was Sie unter Profiling verstehen«, antwortete Levin schließlich. »Aber an diesem Punkt habe ich den Eindruck, dass wir jetzt zwei Möglichkeiten haben: Entweder Sie stellen weiter Vermutungen darüber an, was ich Ihrer Meinung nach von Ihnen verlangen werde und wie Sie reagieren würden, falls dem tatsächlich so wäre. Oder ich sage Ihnen jetzt einfach, was ich von Ihnen will. Ich glaube, die zweite Option wäre zeitsparender.«
»Gut.«
»Hat es Ihnen gestern Abend gefallen?«
»Solche Veranstaltungen sind nicht so ganz mein Ding.«
»Das hatte ich auch nicht erwartet. Aber Sie haben DCI Sedge kennengelernt oder zumindest kurz getroffen.«
»Ja.«
»War Ihnen sein Name vertraut?«
»Nein.«
»Wissen Sie über den Fall Geoffrey Lester Bescheid?«
»Nein.«
»Er ging durch alle Zeitungen.«
»Ich lese keine Zeitung.«
»Die Einzelheiten sind nicht wichtig«, erklärte Levin. »Lester konnte – beziehungsweise kann – als Verbrecher auf eine ziemlich steile Karriere zurückblicken. Letztes Jahr wurde er wegen des Mordes an einem Konkurrenten verurteilt. Wie sich später herausstellte, handelte es sich dabei um eines der wenigen Verbrechen, die er nicht begangen hatte. Letzten Montag hat man das Urteil aufgehoben und ihn freigelassen. Im Lauf der Berufungsverhandlung kam heraus, dass es bei den Ermittlungen Unregelmäßigkeiten gegeben hatte. Geleitet wurden diese Ermittlungen von unserem Freund, Ben Sedge.« Levin legte eine Pause ein, als rechnete er damit, dass Frieda etwas dazu sagen würde. Doch nachdem sie schwieg, fuhr er fort: »Sie fragen sich wahrscheinlich gerade, ob der Mordfall mittlerweile gelöst wurde.«
»Nein, das tue ich nicht.«
»Es ist für uns im Grunde auch nicht von Belang. Tatsache ist allerdings, dass jedes Mal, wenn ein Fall derartig in sich zusammenbricht, andere Fragen auftauchen. Das ist wie …«
»Ein Kartenhaus«, warf Keegan ein.
»Ich dachte mehr an Dominosteine«, sagte Levin. »Sie wissen schon, ein Dominostein fällt um und stößt dabei gegen einen anderen und so weiter. Damit meine ich nicht, wenn man tatsächlich Domino spielt, sondern wenn man die Steine in einer Reihe aufstellt. Daher der sogenannte Dominoeffekt. Oder zumindest das Klischee.«
»Inwiefern trifft das auf diesen Fall zu?«, wollte Frieda wissen.
»Während wir uns hier unterhalten«, erklärte Levin, »stochern irgendwelche Anwälte gerade in Sedges früheren Fällen herum. Und zwar in allen. Was zur Folge haben könnte, dass weitere Leute freigelassen werden. Leute, die schuldig sind.«
»Oder unschuldig«, wandte Frieda ein.
»Oder unschuldig. Was natürlich gut wäre.«
»Warum kümmert sich die Polizei nicht darum?«
»Weil das nicht zu ihren Aufgaben gehört. Es geht um eine schnelle, vorläufige Überprüfung, nur um herauszufinden, ob mit bösen Überraschungen zu rechnen ist.«
»Wer will das wissen?«
Levin starrte sie perplex an. »Alle, schätze ich mal. Zumindest alle, denen daran gelegen ist, das Richtige zu tun.«
»Was erwarten Sie von mir?«
»Gut«, sagte Levin, »damit wären wir endlich beim Thema. Es ist im Grunde ganz einfach. Wir wollen nur, dass Sie jemanden aufsuchen, sich mit der betreffenden Person unterhalten und uns dann sagen, wie Sie die Situation einschätzen.«
»Ich fürchte, ich bin unter völlig falschen Voraussetzungen hier«, stellte Frieda fest. »Ich besitze keine besonderen Kenntnisse in dieser Richtung. Ich bin kein Detective. Verhöre führen kann ich nicht.«
»Die Frau, um die es geht, ist geisteskrank«, erklärte Levin. »Das ist jetzt kein persönlicher Kommentar von mir. Die Krankheit wurde bei ihr diagnostiziert. Wir haben jemanden mit dem Auftrag hingeschickt, sie zu befragen.«
»Mich.« Keegan lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. Auf Frieda wirkte er wie ein Paradebeispiel aus einem psychologischen Lehrbuch: die verschränkten Arme als Zeichen seines emotionalen Rückzugs, eine Abwehrhaltung, die fast schon an Feindseligkeit grenzte.
»Er konnte kein vernünftiges Wort aus ihr herausbekommen«, berichtete Levin.
»Das dürfen Sie laut sagen!« Keegan schnaubte.
»Wer ist die Frau?«
»Es wäre vielleicht interessant, wenn Sie ihr völlig unvoreingenommen gegenüberträten«, meinte Levin.
»Sie hat ihre Familie umgebracht«, sagte Keegan.
»Tja, jetzt wird sie ihr wohl nicht mehr unvoreingenommen gegenübertreten«, merkte Levin in sanftem Ton an.
»Das sagen sie ihr doch schon am Eingang. Die Wärter werden es ihr sagen.«
»Pfleger, um genau zu sein«, stellte Levin richtig.
»Pfleger mit Handschellen in der Tasche. Außerdem weiß Klein, wie man online geht.«
»Doktor Klein«, korrigierte ihn Levin.
»Klein ist schon in Ordnung«, sagte Frieda. »Geht es um irgendetwas Bestimmtes, das ich herausfinden soll?«
»Die Frau bedeutet Probleme«, antwortete Keegan. »Und sie ist gefährlich. Wir wollen wissen, ob sie uns Probleme bereiten wird. Soweit ich es beurteilen kann, ist sie komplett durchgeknallt. Die Frage ist, ob sie irgendwann wieder anfangen wird, verständliches Zeug von sich zu geben und dann womöglich behauptet, sie sei zu Unrecht verurteilt worden.«
»Wäre das denn so schlimm?«
»Darüber brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen«, mischte Levin sich ein. »Wie vereinbart, schulden Sie mir nur einen Gefallen. Sie brauchen diese Frau lediglich aufzusuchen und uns zu erzählen, was Sie von ihr halten. Nachdem Sie mit ihr gesprochen haben, möchten Sie vielleicht noch einen Blick in die Unterlagen werfen, die uns zu dem Fall vorliegen. Danach sind wir quitt.«
»So einfach?«
»So einfach.«
Frieda überlegte einen Moment. »Worum geht es bei dem Ganzen?«, fragte sie. »Für wen arbeiten Sie?«
»Das ist jetzt wirklich ein philosophisches Thema.«
»Nein, ist es nicht. Wer zahlt die Rechnungen? Wem gehört dieses Haus?«
»Ich bin eine Art freiberuflicher Berater«, antwortete er, »wie so viele Leute heutzutage. Und ich engagiere Sie – oder spreche zumindest mit Ihnen – in der Rolle einer weiteren freiberuflichen Beraterin. Hinzu kommt, dass Sie mir wie gesagt einen Gefallen schulden. Außerdem stehen wir alle auf der Seite der Rechtschaffenheit. Was kann es also schaden, wenn Sie mit dieser Frau sprechen?«
»Wo ist sie?«
»In einer Klinik. Chelsworth Hospital. Haben Sie davon gehört?«
»Natürlich habe ich davon gehört. Das ganze Land hat davon gehört. Wann kann ich da hin?«
»Jetzt gleich, wenn Sie wollen«, antwortete Levin. »Oder morgen. Es liegt schon ein Berechtigungsschein für Sie bereit.«
»Was soll ich sie fragen?«
»Was immer Sie wollen«, meldete sich Keegan zu Wort. »Sie werden die Antwort sowieso nicht verstehen.«
»Und nach wem frage ich?«
»Hannah Docherty.« Er lächelte. »Ja, genau. Es handelt sich um die Hannah Docherty. Jetzt wissen Sie, warum wir uns Sorgen machen.«
Shay erfährt es als Erste. Sie bringt Dory ihr Frühstück, und dabei flüstert Dory ihr ein paar Worte zu. »Mit meinem eigenen Messer«, sagt sie. »Hannah hat mir mein Messer abgenommen.«
»Das zahlen wir ihr heim.«
5
Frieda, die erst später wieder Patienten hatte, wollte sofort aufbrechen, doch dieses Mal bestand Levin auf einem Wagen. Allerdings handelte es sich nicht um eine schicke schwarze Limousine, sondern um einen leicht schäbigen kleinen Honda, gefahren von Jude, die sich nicht an Geschwindigkeitsbeschränkungen hielt und unbekümmert über dunkelgelbe Ampeln brauste. Geleitet von einem Navi mit einer strengen Frauenstimme, verließen sie London und waren bald auf der A3, wo sich der Verkehr in der Gegenrichtung staute. Jude deutete auf eine Thermoskanne mit Kaffee und plauderte dann über ihre Hündin, eine betagte Promenadenmischung namens Serena, die früher als Rettungshund im Einsatz war. Laut Jude stand zu befürchten, dass Serena überall im Wagen ihre Haare hinterlassen hatte. Anschließend erzählte sie von ihrer eigenen Vorliebe für Fernsehsendungen, bei denen Wohnungen ausgestattet wurden.
Während der kleine Wagen durch die Landschaft von Surrey sauste, ließ Frieda den Blick aus dem Fenster schweifen. Der heftige Regen der letzten Tage hatte aufgehört. An seine Stelle war ein feines Nieseln getreten, das alles in einen weichen grauen Schleier hüllte. Felder lagen unter Wasser, Zäune verliefen quer durch neu entstandene Seen, und kleine Brücken standen nutzlos in der Landschaft herum.
Schließlich fuhren sie von der A3 ab, vorbei an großen Häusern mit Vordächern und gepflegten Rasenflächen. Mittlerweile führte ihr Weg sie durch hübsche Dörfer mit strohgedeckten Häusern und zahlreichen Teestuben. Frieda hatte das Gefühl, aus London in eine völlig andere Welt geraten zu sein.
»Nach einer Meile rechts abbiegen«, befahl das Navi, während der Wagen gerade über eine Bodenschwelle hinwegdonnerte und dann einen Haken schlug, um einem Mann auszuweichen, der einen Spaniel spazieren führte.
»Nun ist es nicht mehr weit«, meinte Jude.
Bald darauf bogen sie wie befohlen ab und landeten in einer kleineren Straße mit hohen Stacheldrahtzäunen zu beiden Seiten, gekrönt von NATO-Draht. Sie erreichten ein Doppeltor mit einem Wärterhäuschen, wo Jude das Fenster herunterließ, sich hinauslehnte und eine Karte schwenkte. Das Tor schwang auf. Als sie um eine Ecke bogen, tauchte aus dem nasskalten Nebel eine dunkle, überdimensionale Silhouette auf, eher eine trostlose kleine Stadt als eine einzelne Institution. Die Anlage wurde von Wohncontainern und kahlen Bäumen flankiert und lief auf der linken Seite in einem flachen, modernen Gebäude aus. Dahinter ragte eine alles dominierende, kompakte Masse aus dunklen, fleckigen Ziegelmauern auf, durchbrochen von mehreren Reihen kleiner, symmetrisch angeordneter, vergitterter Fenster. Manche waren beleuchtet, andere dunkel. Auf dem Dach saßen Vögel oder kreisten darüber, hin und her geworfen vom böigen Wind.
Jude parkte schwungvoll neben einem weißen Lieferwagen. Frieda nahm ihr Telefon und ihren Schlüsselbund aus der Manteltasche und legte beides auf den Wagensitz. Ihre Handtasche ließ sie ebenfalls zurück. Mit leeren Händen steuerte sie auf den Haupteingang zu.
Das Chelsworth Hospital war kein Gefängnis. Seine Insassen waren Patienten, und die Aufgabe der Ärzte bestand darin, sie zu behandeln, damit es ihnen besser ging. Doch nachdem Frieda durch eine Reihe von verstärkten Türen, die sich jeweils mit einem Klacken hinter ihr schlossen, in eine Sicherheitsschleuse getreten war, wo sie abgetastet wurde und ihre Manteltaschen nach außen kehren musste, ehe man ihr gestattete, hinter zwei kräftig gebauten Männern, an deren Gürteln jede Menge Schlüssel baumelten, einen leeren, schmalen Gang entlangzugehen, vorbei an vergitterten Fenstern mit Blick auf einen Wirrwarr aus Stacheldraht, kam sie sich vor wie in all den anderen Hochsicherheitsgefängnissen, in die ihr Beruf sie im Lauf der Jahre geführt hatte. Trotzdem hatte der Name dieser Institution einen besonderen Klang, der den Leuten einen ganz eigenen Angstschauer einjagte, wenn sie ihn hörten. Ein Haus voller unruhiger Geister.
Sie erreichten die Rückseite der Klinik. Erneut wurden zwei Türen hintereinander aufgesperrt, um sie in einen großen Bereich hinauszulassen, der von einem hohen, mit scharfen Spitzen versehenen Zaun umgeben war. Am hinteren Ende gab es ein Gewächshaus, in dem Frieda verschwommene, über ihre Arbeit gebeugte Gestalten ausmachen konnte. Während sie den Blick weiterschweifen ließ, spazierte ein riesiger Mann lächelnd an ihnen vorüber. Sein Kopf war kahl rasiert, und Frieda sah, dass sich eine bläulich schimmernde Narbe über seinen Schädel zog.
»Der Frauentrakt«, bemerkte einer der Pfleger und nickte dabei zu einem der Gebäudeflügel hinüber, die den Hof teilweise begrenzten.
»Wie viele Frauen sind dort untergebracht?«
»Ach, gar nicht so viele. Vielleicht fünfundzwanzig, dreißig.« Sie wichen einem anderen, ihnen entgegenkommenden Patienten aus. Ein paar Schritte hinter ihm folgte ein Pfleger. »Die Hälfte von denen haben ihre Kinder umgebracht«, fuhr Friedas Begleiter fort. Manchmal rauben einem ihre Schreie die ganze Nacht den Schlaf.«
»Sie würden nicht glauben, was manche von denen getan haben«, meldete sich der andere Pfleger zu Wort. Er sprach mit einer Art düsterem Vergnügen. »Von uns wird erwartet, dass wir sie als krank betrachten, nicht als böse, aber es gibt einem schon zu denken.«
Frieda saß in einem kleinen Raum und wartete. Es war dort sehr heiß und ruhig. In den Räumen über ihr schrie jemand auf, doch der Schrei erstarb schnell wieder. Der alte Heizkörper in der Ecke gurgelte leise vor sich hin. Plötzlich ging die Tür auf, und ein kräftig gebauter, mit einem Kittel bekleideter Mann trat ein. Er nickte Frieda zu und drehte sich dann um.
»Komm, Hannah«, sagte er, »das ist die Ärztin, von der ich dir erzählt habe.«
Frieda stand auf. Hannah Docherty betrat den Raum.
Hannah Docherty. Frieda versuchte, aus ihrem Kopf alles zu verbannen, was sie wusste oder halb zu wissen glaubte, weil sie es irgendwo mit angehört oder einen Blick auf eine Zeitungsschlagzeile erhascht hatte. Sie gab sich große Mühe, nicht an die Fotos zu denken, die sie vor all den Jahren gesehen hatte und die jedes Mal wieder auftauchten, wenn sich eine Frau auf eine Weise verhielt, wie sich weibliche Wesen nach der gängigen Meinung niemals verhalten sollten, und irgendetwas »wider die Natur« tat. Stattdessen versuchte Frieda nun, sich einfach auf die Gestalt vor ihr zu konzentrieren, die gerade mit linkischem, schwerfälligem Gang in den Raum humpelte.
Das Erste, was Frieda auffiel, war ihre Größe. Obwohl sie gebeugt ging und in dicken Schichten von Kleidung steckte, war Hannah Docherty offensichtlich hochgewachsen und athletisch gebaut, mit breiten Schultern und großen, fast männlich wirkenden Händen. Anfangs war es unmöglich, ihr Gesicht zu erkennen, weil es von einer Mähne aus dichtem, dunklem Haar verhüllt war. Auf einer Seite verlief, durchgängig vom Scheitel bis in die Spitzen, ein einzelner, ins Auge stechender weißer Streifen. Erst dann bemerkte Frieda, dass die Frau Handschellen trug.
Schließlich hob sie den Kopf, und Frieda sah ihr Gesicht: übersät mit Blutergüssen, aufgeschwollen, die volle Unterlippe von einem Schnitt entstellt, als würde sie schief und spöttisch grinsen, die breiten Brauen nach unten gezogen. Frieda blickte ihr in die Augen: Sie wirkten fast schwarz, aber dennoch sehr leuchtend. Man hatte den Eindruck, dass sie aus dem verquollenen und verfärbten Gesicht herausfunkelten, als wären sie von hinten beleuchtet. Frieda versuchte, Hannahs Gesichtsausdruck zu deuten: War sie verängstigt, verwirrt, missmutig oder wütend? Vielleicht ja alles zusammen. Ihre erweiterten Pupillen und die leicht herabhängenden Mundwinkel deuteten außerdem darauf hin, dass man ihr Medikamente verabreicht hatte. Als sie die gefesselten Hände ans Gesicht hob, sah Frieda ein Durcheinander aus Tätowierungen, die laienhaft und selbstgemacht wirkten. Sie zogen sich über ihre Handrücken, ihre Unterarme und um ihren Hals wie Tintenzeichnungen auf weichem Papier, das gedehnt worden war, bis die Konturen unscharf und fransig wurden.
»Hannah«, begann sie, »ich bin Frieda.«
Hannah starrte sie an, rührte sich aber nicht von der Stelle. Als Frieda daraufhin ein paar Schritte auf sie zutrat, zuckte die Frau zusammen und versteifte sich. Der Pfleger griff nach ihrem Arm.
»Sie sollten sich vor ihr in Acht nehmen«, instruierte er Frieda. »Manchmal geht sie einfach auf die Leute los. Sie wirkt ja ohnehin schon kräftig, aber in Wirklichkeit ist sie noch viel stärker, als sie aussieht.«
»Reden Sie nicht über Hannah, als wäre sie nicht da. Und bitte nehmen Sie ihr die Handschellen ab.«
»Sie ist erst vor Kurzem mit einem Messer auf jemanden losgegangen und hat die betreffende Person fast umgebracht.«
»Ich nehme an, dass sie im Moment kein Messer bei sich trägt.«
»Das weiß man nie so genau.« Er stieß ein leises Lachen aus.
»Nehmen Sie ihr die Fesseln ab.«
Achselzuckend löste er die Schlüssel von seinem Gürtel und schloss die Handschellen auf. Frieda sah die roten Striemen an Hannahs Handgelenken. Sie zog einen Stuhl heran und stellte ihn dicht neben die Frau. »Hier, setzen Sie sich. Sie sehen aus, als hätten Sie sich am Bein verletzt. Ich möchte nur mit Ihnen sprechen.«
»Sie ist nicht sehr redselig«, bemerkte der Pfleger.
Frieda starrte ihn an. »Bitte lassen Sie mich mit Hannah allein.«
Der Mann wirkte skeptisch.
»Sie können draußen warten.«
Er blickte von Frieda zu Hannah und verließ dann unter leisem Gemurmel den Raum. Frieda machte die Tür hinter ihm zu und platzierte ihren eigenen Stuhl gegenüber dem von Hannah, wobei sie darauf achtete, ihr nicht zu dicht auf die Pelle zu rücken. Hannah hatte die Arme um den Körper geschlungen und den Kopf wieder sinken lassen, sodass ihr Gesicht erneut hinter der Haarmähne verschwunden war. Sie wiegte sich leicht vor und zurück, wobei sie leise, kehlige Laute ausstieß.
»Verstehen Sie, was ich sage?«
Hannah gab ihr keine Antwort. Sie machte weiter diese wiegende Bewegung.
»Ich bin gekommen, um mit Ihnen zu sprechen und dabei in Erfahrung zu bringen, wie Sie über bestimmte Dinge denken, die Sie selbst betreffen.«
Wieder keine Reaktion.
»Ich weiß, dass Sie schon sehr lange hier drin sind. Vielleicht fällt es Ihnen schwer, sich ins Gedächtnis zu rufen, was passiert ist, bevor Sie herkamen. Können Sie sich daran erinnern?«
Unter leisem Stöhnen setzte Hannah ihr Geschaukel fort.
»Vielleicht möchten Sie etwas zu der Art und Weise sagen, wie Sie damals behandelt wurden – etwas, das Sie seinerzeit nicht sagen konnten. Mit mir können Sie reden, Hannah.«
Plötzlich richtete sich die Frau zu einer geraderen Sitzhaltung auf. »Ich bin es«, sagte sie mit einer tiefen Stimme, die sehr heiser klang, fast als wäre sie mangels Gebrauch eingerostet. »Ich bin es ich bin es ich bin es.«
»Was?«
»Ich bin es.«
»Hannah, können Sie sich daran erinnern, wie Ihre Familie starb?«
»Ich.« Sie hob eine Hand und schlug sich damit auf den Kopf. »Ich.« Wieder schlug sie sich selbst.
»Verletzen Sie sich nicht«, sagte Frieda, die den Drang unterdrücken musste, nach Hannahs großer Hand zu greifen, um sie zurückzuhalten. »Lassen Sie das. Sehen Sie mich an.«
»Nein. Nein. Nicht.« Dann sagte sie plötzlich mit recht ruhig und klar klingender Stimme: »Mir ist so heiß.«
Es stimmte, die stickige Luft in dem Raum war kaum zu ertragen, und Hannah liefen Schweißtropfen übers Gesicht. Sie zog ihre graue Strickjacke aus. Darunter kam ein weiteres langärmeliges Oberteil zum Vorschein, mit dem sie zu kämpfen begann, indem sie es sich über den Kopf zog und dabei irgendwie darin hängen blieb. Frieda konnte sie vor Anstrengung keuchen hören.
»Soll ich helfen?«, fragte Frieda. Sie stand auf, griff nach dem Saum des Pullis und zog ihn Hannah rasch über den Kopf. Anschließend setzte sie sich wieder. Hannah blinzelte sie an. Jetzt trug sie nur noch ein dunkelblaues Unterhemd, das unter den Achseln Schweißflecken aufwies. Ihre nackte Haut war derart mit Tätowierungen übersät, dass es kaum noch einen Fleck ohne Kreise, geometrische Muster, Worte oder Bilder gab. Man wusste gar nicht, was man sich als Erstes ansehen sollte: die Schlange, die Rose, das Kruzifix, die vielen durcheinanderwirbelnden Linien, den Vogel, die arabischen und römischen Zahlen, das Spinnennetz … Sie wirkte wie ein wildes, in vielen Farben schillerndes Manuskript.
»Ihre Tätowierungen sind erstaunlich«, stellte Frieda fest. »Sind die alle hier gemacht worden?«
Hannah gab ihr keine Antwort, ließ aber die Hände im Schoß ruhen und schaukelte nicht mehr.
»Was bedeutet denn das da?«, fragte Frieda und streckte eine Hand aus, ohne jedoch das Motiv direkt zu berühren, das aussah wie eine Sanduhr. Womöglich handelte es sich aber auch um eine grobe Zeichnung einer nackten Frau, umgeben von kleinen ovalen Formen, vielleicht Regentropfen oder Tränen.
Hannah sagte nichts. Ihre schwarzen Augen loderten.
»Mögen Sie eine von den Tätowierungen besonders gern?«
Zunächst kam keine Antwort, aber nach ein paar Augenblicken legte Hannah einen Finger auf die Innenseite ihres Unterarms, wo sich drei winzige Formen befanden, die aussahen wie krakelig gezeichnete Kreuze mit Kreisen darüber. Sie berührte das mittlere Kreuz und gab dabei ein Geräusch von sich.
»Was ist das?«, fragte Frieda. »Was bedeutet es?«
Hannah stieß ein weiteres gepresst klingendes Geräusch aus. Frieda beugte sich vor, um sie besser zu verstehen. Wieder berührte Hannah sanft die drei Formen. Ihr Atem kam in kleinen, rasselnden Stößen.
»Was ist das?«, fragte Frieda noch einmal. »Hannah?«
»Ich ich ich ich«, sagte sie. »Ich.«
Erneut schlang sie beide Arme um ihren Körper, und ihr Haar fiel wie ein Vorhang zwischen sie und Frieda. Sie wiegte sich erneut vor und zurück.
Als Frieda den Raum verließ, fragte sie den draußen wartenden Pfleger, wie oft Hannah Besuch bekomme. Er starrte sie an, als hätte sie einen Witz gemacht.
»Die?«
»Ja. Wann hatte sie denn das letzte Mal Besuch?«
»Keine Ahnung. Vor meiner Zeit.«
»Wie lange arbeiten Sie schon hier?«
»Etwa sieben Jahre.«
»Wollen Sie damit sagen, dass sie in sieben Jahren kein einziges Mal Besuch bekommen hat?«
»Genau. Oder sogar noch länger.«
»Hat sie denn keine Verwandten?«
»Warum sollte jemand aus ihrer Verwandtschaft sie sehen wollen?«
»Es gibt also niemanden.«
»Wen wundert’s?«
6
Nachdem sie wieder im Wagen saß, sprach Frieda mehrere Minuten lang kein Wort.
»Sie sollten eine Rückmeldung machen.«
»Da gibt es eigentlich nichts rückzumelden.«
»Das werden sie trotzdem hören wollen.«
Frieda seufzte. Sie telefonierte nicht gerne, aber nachdem Jude ihr die Nummer genannt hatte, tat sie, wie ihr geheißen.
»Und?«
»Ich war bei ihr.«
»Hat sie gestanden?«
»So weit sind wir gar nicht gekommen.«
»Haben Sie irgendetwas Vernünftiges aus ihr herausgekriegt?«
»Darüber werde ich Ihnen morgen persönlich Bericht erstatten.«
Er gab ihr keine Antwort. Erst nach ein paar Augenblicken begriff sie, dass sie keine Verbindung mehr hatten.
»War er nicht zufrieden?«, wollte Jude wissen.
»Keine Ahnung«, erwiderte Frieda. »Ich weiß nicht, ob das Netz zusammengebrochen ist oder er einfach aufgelegt hat.«
»Er hat einfach aufgelegt.«
»Ich schätze mal, die Zusammenarbeit mit ihm wird leichter, wenn man ihn besser kennt.«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen,« entgegnete Jude. »Ich kenne ihn erst ein Jahr.«
Friedas Telefon klingelte.
»Sie haben sich geirrt«, bemerkte Frieda an Jude gewandt, ehe sie ranging. »Dann sehen wir uns also morgen?«
»Wer will mich sehen?«, fragte eine Frauenstimme.
»Mit wem spreche ich?«, erkundigte sich Frieda. »Nicht mit Keegan?«
»Wer ist Keegan? Ich würde gern mit Frieda Klein sprechen.«
»Chloë?«
Chloë war Friedas Nichte, aber die beiden standen sich noch näher, als das vermuten ließ. Es hatte Zeiten gegeben, da hatte Frieda Chloë unterrichtet, sie ernährt und mit ihr zusammengelebt. Und es war gar nicht lange her, dass sie sogar gemeinsam einen Einbruch begangen hatten. Früher war es Chloës Wunsch gewesen, Ärztin zu werden wie ihre Tante, doch inzwischen wohnte sie oben in Walthamstow und machte eine Schreinerlehre.
»Wer ist Keegan?«
»Jemand, mit dem ich zusammenarbeite.«
»Ein Therapeut?«
»Nein, ein ehemaliger Polizist.«
»O nein!«
»Es ist nur …«
»Frieda, du wolltest doch damit aufhören!«
»Wo bist du? Was tust du gerade?«
»Du hast gesagt, ich soll mich regelmäßig melden«, antwortete Chloë, »also melde ich mich. Das ist mein wöchentlicher Anruf. Ich hatte allerdings damit gerechnet, dass ich dir eine Nachricht aufs Band sprechen muss. Das ist so ziemlich das erste Mal, dass du tatsächlich an dein Telefon gegangen bist.«
»Weil ich gerade diesen Job mache.«
»Darüber möchte ich mit dir sprechen.«
»Was hältst du von heute Abend?«, schlug Frieda vor.
»Heute Abend, wo?«
»Bei mir?«
Als Frieda das Gespräch beendet hatte, mustere Jude sie argwöhnisch. »Sie wissen aber schon, dass Sie eigentlich nicht darüber reden dürfen, oder?«
»Mit wem sollte ich denn darüber reden?«
»Zum Beispiel mit der Person, die Sie gerade an der Strippe hatten.«
»Das war meine Nichte.«
»Zum Beispiel mit Ihrer Nichte.«
Frieda musterte nun ihrerseits Jude. Sie trug violetten Lippenstift, und ihr Nagellack leuchtete so blau wie der Himmel an einem kalten Wintertag. Frieda fand, dass sie eher in eine Galerie oder eine Bar in Shoreditch gepasst hätte.
»Wie sind Sie bei diesem Job gelandet?«, fragte sie.
Jude wirkte verblüfft, als wüsste sie es selbst nicht so genau. »Nach der Uni hatte ich keine Ahnung, was ich tun sollte. Anfangs bin ich eine Weile mit verschiedenen Typen durch die Welt gezogen, aber die Kerle waren alle völlig hoffnungslose Fälle. Schließlich landete ich in Berlin, wo ich ein paar Jahre lebte. Dann fragte mich ein Freund, ob ich Lust hätte, ein bisschen Recherchearbeit zu machen.«
»Für wen?«
»Das war nicht so ganz klar.«
»Was sagen Sie, wenn Ihre Freunde wissen wollen, was Sie arbeiten?«
»Dass ich für eine Beraterfirma recherchiere. In der Regel wechseln sie dann schnell das Thema.«
»Macht es Ihnen Spaß?«
»Im Moment finde ich es ganz in Ordnung. Aber irgendwann möchte ich wieder reisen.«
»Sie können ja jetzt Deutsch.«
»Kaum ein Wort«, widersprach Jude. »Ich habe es Ihnen doch gesagt, ich war in Berlin. Da sprechen alle Englisch.«
Frieda empfand es als eigenartig, sich von einer Frau, die sie kaum kannte, herumchauffieren zu lassen. Jude hatte eine lockere, leicht distanzierte Art, über ihre Arbeit zu sprechen, die Frieda entwaffnend fand. Aber vielleicht war genau das der springende Punkt. Stimmte überhaupt irgendetwas von dem, was sie gesagt hatte, oder erzählte Jude nur, was sie, Frieda, vermutlich hören wollte, um sie aus der Reserve zu locken? Oder war sie inzwischen zu misstrauisch? Falls man überhaupt zu misstrauisch sein konnte.
»Ich bin Therapeutin«, erklärte Frieda. »Was bedeutet, dass ich ein sehr ausgeprägtes Gefühl dafür habe, welche Geheimnisse gewahrt bleiben müssen.«
»Ich bin auch mal zu einem Therapeuten gegangen«, berichtete Jude. »Als ich noch jünger war, hatte ich ein paar Probleme. Ich steckte ein bisschen in der Klemme. Aber der Typ hielt nicht viel von Schweigepflicht. Er erzählte mir von seinen anderen Patienten. Was dieser getan und jener gesagt hatte.«
Frieda fragte sich, ob Jude damit rechnete, dass sie antworten würde: »Ja, das haben wir alle schon mal gemacht.«
»Sie hätten nicht bei ihm bleiben sollen«, erwiderte sie.
»Das war damals nicht so einfach.«
Den Rest der Fahrt schwieg Frieda. Verschwommen zogen draußen Wimbledon Common, Putney und Wandsworth vorbei, während London langsam immer näher kam.
Chloë trug Jeans, ein Kapuzenshirt, schwarze Stiefel und eine graue Wollmütze, als sie bei Frieda eintraf.
»Du siehst aus, als kämst du geradewegs aus der Werkstatt«, bemerkte Frieda.
Chloë blickt an sich hinunter. »Ich habe mich extra noch umgezogen.«
»Möchtest du Tee?«
»Hast du auch Bier?«
»Wir könnten höchstens losziehen und uns irgendwo eins genehmigen.«
»Ja«, antwortete Chloë, »lass uns in eine Kneipe gehen.«
»Eigentlich habe ich dir das nur vorgeschlagen, weil ich davon ausgegangen bin, dass du antwortest, das passt schon, Tee ist völlig in Ordnung.«
»Aber ich mag jetzt keinen Tee. Und du kannst nicht nur den ganzen Tag in deinem Haus herumsitzen.«
»Ich bin doch gerade erst heimgekommen. Regnet es noch?«
»Keine Ausreden«, konterte Chloë. »Du hast bestimmt einen Schirm.«
»Nein, habe ich nicht.«