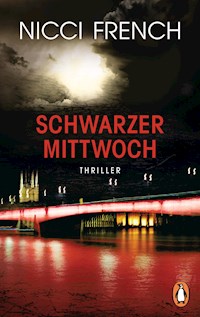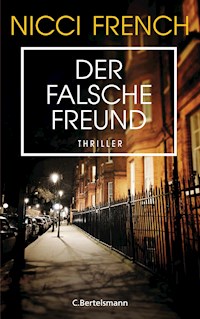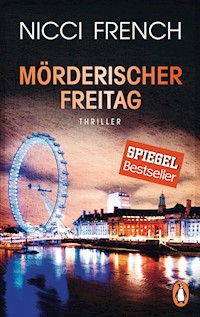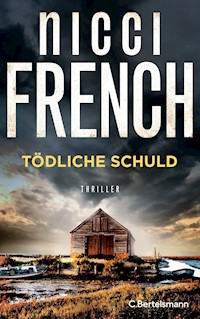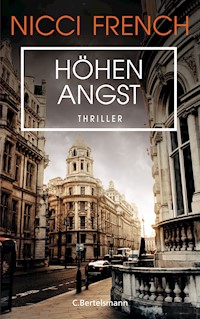2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine raffiniert konstruierte Geschichte über eine tödliche Bedrohung
Die Ärztin Samantha Laschen zieht mit ihrer 5-Jährigen Tochter Elsie in das einsam gelegene Elm House in Essex. Hier will sie Ordnung in ihr Leben bringen. Kurz nach ihrer Ankunft wird im benachbarten Stamford ein reiches Ehepaar ermordet, die Tochter überlebt unter Schock. Die Polizei sucht für sie eine sichere Bleibe. Samanthas Haus scheint die ideale Lösung zu sein... Für Fiona wird Elm House zum zweiten Zuhause, Samantha bekommt aber langsam das Gefühl, eine Fremde im eigenen Haus zu sein. Warum wird sie den Verdacht nicht los, auf subtile Weise manipuliert zu werden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 512
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Nicci French
Ein sicheres Haus
Aus dem Englischen vonElke vom Scheidt
Ein sicheres Haus
Samantha Laschen, Fachärztin für posttraumatische Medizin, zieht mit ihrer kleinen Tochter Elsie in ein einsam gelegenes Haus in Essex. Doch kurz nach ihrer Ankunft wird im benachbarten Stamford das wohlhabende Ehepaar Mackenzie brutal ermordet. Nur ihre neunzehnjährige Tochter Fiona überlebt, steht aber seit den Ereignissen unter Schock. Als die Polizei für das Mädchen eine sichere Bleibe sucht, scheint Samanthas Haus die ideale Lösung zu sein. Doch eines Tages ist Fiona verschwunden. Und es kommt noch schlimmer: Wenig später wird ein Auto mit Fionas verbrannten Überresten gefunden …
Autoren
Hinter dem Namen Nicci French verbirgt sich das Ehepaar Nicci Gerrard und Sean French. Seit langem sorgen sie mit ihren höchst erfolgreichen Psychothrillern für Furore. Sie leben mit ihren Kindern in London.
Von Nicci French außerdem bei Goldmann lieferbar:
Höhenangst. Roman (44893) Der Sommermörder. Roman (45425) Das rote Zimmer. Roman (45734) In seiner Hand. Roman (45946) Der falsche Freund. Roman (46176) Der Feind in deiner Nähe. Psychothriller (46576)
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe von »Ein sicheres Haus« erschien 1998 unter dem Titel »A Safe House« bei Michael Joseph, London.
Ein sicheres Haus Copyright © der Originalausgabe 1998 by Joined-Up Writing Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 1998 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbHNeumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagabbildung: plainpicture.com/Schoo Flemming
ISBN:978-3-641-24601-3V002
www.goldmann-verlag.de
www.randomhouse.de
FÜR PAT UND JOHN
Inhaltsverzeichnis
1. KAPITEL
Mit der Tür fing es an. Die Tür war geöffnet. Sonst stand die Haustür nie offen, nicht einmal bei der wunderbaren Hitze im vorigen Sommer, die sie so an zu Hause erinnert hatte; aber da war sie, leicht nach innen geöffnet, und das an einem so kalten Morgen, dass die in der Luft hängende Feuchtigkeit Mrs. Ferrer in die pockennarbigen Wangen stach. Sie drückte ihre behandschuhte Hand gegen das weißlackierte Türblatt und prüfte nach, was ihre Augen ihr sagten.
»Mrs. Mackenzie?«
Stille. Mrs. Ferrer rief noch einmal nach ihrer Arbeitgeberin, lauter diesmal. Als ihre Worte in der großen Eingangshalle widerhallten, war es ihr peinlich. Sie trat ins Haus und streifte ihre Schuhe dabei gründlich an der Fußmatte ab; das tat sie immer. Sie zog die Handschuhe aus und hielt sie in der linken Hand. Jetzt nahm sie einen Geruch wahr. Schwer und süßlich. Er erinnerte sie an etwas. So roch es auf dem Hof vor einer Scheune. Nein. Drinnen. In einer Scheune vielleicht.
Jeden Morgen um Punkt halb neun sagte Mrs. Ferrer Mrs. Mackenzie mit einem Nicken guten Morgen, ging geräuschvoll an ihr vorbei, über das blankgebohnerte Parkett der Eingangsdiele, nahm die Treppe gleich rechts in den Keller, zog ihren Mantel aus, holte den Staubsauger aus dem Geräteraum und verbrachte eine Stunde mit dessen ohrenbetäubendem Lärm. Die große Treppe auf der Vorderseite des Hauses hinauf, durch die Flure im ersten Stock, die Flure im zweiten Stock, dann über die kleine Hintertreppe wieder hinunter. Aber wo war Mrs. Mackenzie? In ihrem fest zugeknöpften, haferschleimfarbenen Tweedmantel stand Mrs. Ferrer unsicher an der Tür und verlagerte ihr Gewicht von einem Fuß auf den anderen. Sie konnte einen Fernsehapparat hören. Der Fernseher lief sonst nie. Sorgfältig streifte sie die Sohlen beider Schuhe an der Matte ab. Sie sah nach unten. Hatte sie das nicht eben schon getan?
»Mrs. Mackenzie?«
Sie trat von der Matte auf das harte Holz – Bienenwachs, Weinessig und Paraffin. Sie ging hinüber zum vorderen Zimmer, das nie zu irgendetwas benutzt wurde und kaum gesaugt werden musste, obwohl sie es trotzdem tat. Natürlich war niemand darin. Alle Vorhänge waren zugezogen, das Licht brannte. Sie ging hinüber zum Fuß der Treppe und zum zweiten vorderen Zimmer. Sie legte die Hand auf den Treppenpfosten, der von einer ornamentreichen Schnitzerei aus dunklem Holz gekrönt wurde, die aussah wie eine Ananas mit Schnabel. Afrormosia, ein Tropenholz – Leinöl brauchte man dafür, abgekocht, nicht roh. Niemand da. Sie wusste, dass der Fernseher im Wohnzimmer stand. Sie trat einen Schritt vor, ihre Hand streifte die Wand, als wollte sie sich abstützen. Ein Bücherschrank. Ledergebundene Bände, die Lanolin und Klauenfett benötigten, zu gleichen Teilen. Es war möglich, überlegte sie, dass, wer immer da fernsah, ihren Ruf nicht gehört hatte. Und was die Tür betraf – vielleicht wurde etwas geliefert, oder der Fensterputzer hatte sie beim Hereinkommen offengelassen. So beruhigt, ging sie zur Rückseite des Hauses und in das Hauptwohnzimmer. Sehr schnell, binnen weniger Sekunden nach dem Betreten des Raums, hatte sie sich heftig auf den Teppich übergeben, den sie seit achtzehn Monaten an jedem Werktag gestaubsaugt hatte.
Sie stand vorgebeugt, mit gesenktem Oberkörper, und keuchte. Sie suchte in ihrer Manteltasche herum, fand ein Papiertaschentuch und wischte sich den Mund ab. Sie war über sich selbst überrascht, fast verlegen. Als Kind war sie einmal von ihrem Onkel durch ein Schlachthaus außerhalb von Fuenteobejuna geführt worden. Er hatte auf sie herabgelächelt, weil sie nicht in Ohnmacht fallen wollte beim Anblick des Blutes und der abgehackten Gliedmaßen und vor allem des Dampfes wegen, der von dem kalten Steinboden aufstieg. Das war der Geruch, an den sie sich erinnert hatte. Ganz und gar kein Scheunengeruch.
Blutspritzer waren so weiträumig verteilt, bis hinauf an die Decke, bis an die gegenüberliegende Wand, als wäre Mr. Mackenzie explodiert. Doch das meiste Blut befand sich in dunklen Lachen auf seinem Schoß und auf dem Sofa. Es war so viel. Konnte das von einem einzigen Menschen stammen? Das, wovon ihr schlecht geworden war, war vielleicht die Normalität seines Pyjamas, so englisch, sogar der oberste Knopf war geschlossen. Mr. Mackenzies Kopf lag in einem unnatürlichen Winkel nach hinten gebeugt. Sein Hals war durchtrennt, und nichts außer der Rückenlehne des Sofas hielt den Kopf mehr aufrecht. Sie sah Knochen und Sehnen und die Brille, die immer noch nutzlos auf seiner Nase saß. Das Gesicht war sehr weiß. Und stellenweise grässlich blau verfärbt.
Mrs. Ferrer wusste eigentlich, wo das Telefon stand, aber sie hatte es vergessen und musste danach suchen. Sie fand es auf einem kleinen Tisch auf der anderen Seite des Zimmers, weit weg von all dem Blut. Sie kannte die Nummer aus einer Fernsehsendung. Neun, neun, neun. Eine weibliche Stimme antwortete.
»Hallo. Ein schrecklicher Mord ist passiert.«
»Wie bitte?«
»Ein Mord ist passiert.«
»Gut, in Ordnung. Beruhigen Sie sich, weinen Sie nicht. Sprechen Sie Englisch?«
»Ja, ja. Entschuldigung. Mr. Mackenzie ist tot. Umgebracht.«
Erst als sie den Hörer wieder aufgelegt hatte, fiel ihr Mrs. Mackenzie ein, und sie ging nach oben. Mrs. Ferrer brauchte nur eine Sekunde, um zu sehen, was sie befürchtet hatte. Ihre Arbeitgeberin war an ihr Bett gefesselt. Sie schien fast in ihrem eigenen Blut zu schwimmen, ihr Nachthemd auf dem hageren Körper glänzte von Blut. Zu dünn, hatte Mrs. Ferrer insgeheim immer gedacht. Und das Mädchen? Sie fühlte ein Gewicht auf der Brust, als sie eine weitere Treppe hinaufging. Sie stieß die Tür des einzigen Zimmers im Haus auf, das sie nicht saubermachen durfte. Sie konnte kaum etwas von der Person sehen, die an das Bett gefesselt war. Was hatten sie mit ihr gemacht? Braunes, glänzendes Klebeband auf dem Gesicht. Ausgestreckte Arme, die Handgelenke an die Ecken des metallenen Bettgestells gebunden, dünne rote Streifen auf der Vorderseite des Nachthemds.
2. KAPITEL
Ich sah mich um. Dies war keine Landschaft, sondern Brachland, in das man Bröckchen von Landschaft gestreut und dann aufgegeben hatte, einen Baum oder Busch hier und da, eine winterlich kahle Hecke, plötzlich ein Feld, gestrandet in Schlamm und Marschland. Ich wollte ein geographisches Merkmal – einen Hügel, einen Fluss – und konnte keines finden. Mit den Zähnen zog ich einen Handschuh aus, um auf die Landkarte zu schauen, und ließ ihn in das schleimige Gras fallen. Das große Blatt flatterte wild im Wind, bis ich es mehrfach faltete und mir die blassbraunen Konturen, die rot gepunkteten Fußwege und die rot gestrichelten Reitwege anschaute. Kilometerweit war ich der gepunkteten roten Linie gefolgt, hatte aber die Ufermauer, die mich an den Ort zurückführen würde, von wo ich losgegangen war, nicht erreicht. Ich spähte in die Ferne. Der Horizont war ein dünner Streifen Grau vor Himmel und Wasser.
Wieder sah ich auf die Karte, die sich unter meinem Blick aufzulösen schien, ein unentzifferbarer Code aus Kreuzen und Linien, Punkten und Strichen. Ich würde zu spät bei Elsie sein. Ich hasse es, zu spät zu kommen. Ich komme nie zu spät. Ich bin immer zeitig da, immer bin ich diejenige, die man warten lässt – die verärgert unter der Uhr steht, die vor einer kalt werdenden Tasse Tee in einem Café sitzt, ein Zucken der Ungeduld unter dem rechten Auge. Ich komme nie, niemals zu spät zu Elsie. Dieser Spaziergang sollte exakt dreieinhalb Stunden dauern.
Ich drehte die Karte. Ich musste eine Weggabelung übersehen haben. Wenn ich nach links ging, an dieser dünnen schwarzen Linie entlang, konnte ich den Weg über die sumpfige Landspitze abkürzen und die Ufermauer erreichen, bevor sie an den Weiler stieß, wo mein Auto geparkt war. Ich stopfte die Karte, die jetzt an den Faltstellen brach, in meine Anoraktasche und hob den Handschuh auf. Seine kalten, schlammigen Finger schlossen sich um meine taub werdenden. Ich ging los. Meine Wadenmuskeln schmerzten, und meine Nase lief; schleimige kleine Tropfen, die stechend meine Wangen hinunterrannen. Der riesige graue Himmel drohte mit Regen.
Einmal flog ein dunkler Vogel, den langen Hals ausgestreckt und mit schwer schlagenden Schwingen, niedrig über mich hinweg, doch sonst war ich ganz allein in einer Landschaft aus graugrünem Sumpf und graublauem Meer. Vermutlich ein seltenes und interessantes Tier, aber ich kenne die Namen von Vögeln nicht. Auch nicht die von Bäumen, bis auf die bekanntesten, Trauerweiden und Silberbirken, die in jeder Londoner Straße stehen und mit ihren Wurzeln die Häuser untergraben. Auch nicht die von Blumen, bis auf die gewöhnlichen, wie Butterblumen und Gänseblümchen, und die, die man freitags abends im Blumengeschäft kauft und in eine Vase stellt, wenn Freunde zu Besuch kommen: Rosen, Iris, Chrysanthemen, Nelken. Aber nicht die der schwachen Pflänzchen, die an meinen Stiefeln kratzten, als ich auf einen kleinen Wald zuging, der nicht näher zu kommen schien. Manchmal, als ich noch in London wohnte, fühlte ich mich bedrückt von all den Plakattafeln, Ladenschildern, Hausnummern, Straßenschildern, Grundstücksgemarkungen und Lieferwagen mit Aufschriften wie »Frische Fische« oder »Ihre freundlichen Möbelpacker«, Neonschriften, die am orangefarbenen Himmel aufleuchteten und verblassten. Jetzt hatte ich für nichts mehr Worte.
Ich kam zu einem Stacheldrahtzaun, der den Sumpf von etwas trennte, das wie beackertes Land aussah. Ich drückte den Draht mit dem Daumenballen fest nach unten und schwang ein Bein über den Zaun.
»Kann ich Ihnen helfen?« Die Stimme klang freundlich. Ich drehte mich nach ihr um, und der Stacheldraht verfing sich im Schritt meiner Jeans.
»Danke, ich komme schon zurecht.« Ich schaffte es, das andere Bein hinüberzuheben. Er war ein bärtiger Mann mittleren Alters in einer braunen Steppjacke und grünen Stiefeln und kleiner als ich.
»Ich bin der Farmer.«
»Wenn ich in gerader Linie hier weitergehe, komme ich dann auf die Straße?«
»Mir gehört dieses Feld.«
»Nun ja …«
»Dies ist kein öffentlicher Weg. Sie betreten Privatbesitz. Mein Land.«
»Oh.«
»Sie müssen da entlanggehen.« Ernst zeigte er in die Richtung. »Dann erreichen Sie einen Fußweg.«
»Kann ich nicht einfach …?«
»Nein.«
Er lächelte mich an, nicht unfreundlich. Sein Hemd war am Hals falsch zugeknöpft.
»Ich dachte immer, auf dem Land kann man überall frei herumlaufen.«
»Sehen Sie meinen Wald da drüben?« fragte er grimmig. »Jungen aus Lymne« – er sprach es aus wie »Lumney« – »haben angefangen, auf dem Weg durch den Wald Fahrrad zu fahren. Dann kamen sie mit Motorrädern. Sie haben die Kühe erschreckt und den Weg unpassierbar gemacht. Letztes Frühjahr sind ein paar Leute mit einem Hund über das Feld meines Nachbarn gegangen und haben drei von seinen Lämmern getötet. Ganz zu schweigen von all den Gattern, die sie offenlassen.«
»Das tut mir leid, aber …«
»Und Rod Wilson, gleich da drüben, der hat früher Kälber rüber nach Ostende geschickt. Sie haben angefangen, Streikposten am Hafen in Goldswan Green aufzustellen. Vor ein paar Monaten wurde Rods Scheune niedergebrannt. Nächstes Mal ist es vielleicht ein Haus. Und dann sind da das Winterton und die Thell-Jagd.«
»Schon gut, schon gut. Wissen Sie, was ich machen werde? Ich werde wieder über diesen Zaun klettern und in einem großen Bogen um Ihr Land herumgehen.«
»Kommen Sie aus London?«
»Früher habe ich in London gewohnt. Ich habe Elm House auf der anderen Seite von Lymne gekauft. Lumney. Sie wissen schon, das Haus, wo es überhaupt keine Ulmen gibt.«
»Also ist es denen endlich gelungen, es loszuwerden.«
»Ich bin aufs Land gekommen, um dem Großstadtstress zu entkommen.«
»Sind Sie ja. Wir haben immer gern Besucher aus London. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.«
Freunde hatten gedacht, ich mache Witze, als ich sagte, ich würde am Krankenhaus in Stamford arbeiten und auf dem Land wohnen. Ich habe immer nur in London gelebt – in London oder zumindest seinen Vorstädten bin ich aufgewachsen, zur Universität gegangen, habe meine Assistenzzeit absolviert und gearbeitet. Was ist mit Geschäften, die Essen ins Haus liefern? hatte einer gefragt. Und was ist mit Spätfilmen, Läden, die rund um die Uhr geöffnet haben, Babysitten, M&S-Mahlzeiten, Schachpartnern?
Und Danny, als ich endlich den Mut aufbrachte, es ihm zu sagen, hatte mich mit Augen voller Wut und Verletzung angesehen.
»Was soll das, Sam? Willst du dich auf irgendeiner verdammten Dorfwiese ganz intensiv deinem Kind widmen? Sonntags Lunchs geben und Blumenzwiebeln pflanzen?« Ich hatte tatsächlich an ein paar Blumenzwiebeln gedacht.
»Oder«, hatte Danny weitergesagt, »verlässt du mich endlich? Ist es das, worum sich alles dreht, ist das der Grund, warum du dich nie damit aufgehalten hast, mir wenigstens mitzuteilen, dass du dich um einen Job auf dem flachen Land bewirbst?«
Ich hatte mit den Schultern gezuckt, kühl und feindselig, weil ich wusste, dass ich mich schlecht benahm.
»Ich habe mich nicht darum beworben. Die sind zu mir gekommen. Und vergiss nicht, Danny, wir leben nicht zusammen. Du wolltest deine Freiheit.«
Er hatte eine Art Ächzen von sich gegeben und gesagt: »Hör mal, Sam, vielleicht ist die Zeit gekommen …«
Aber ich hatte ihn unterbrochen. Ich wollte nicht, dass er sagte, wir sollten endlich zusammenleben, und ich wollte auch nicht, dass er sagte, wir sollten uns endlich trennen, obwohl ich wusste, dass wir uns bald würden entscheiden müssen. Ich hatte eine Hand auf seine widerstrebende Schulter gelegt. »Es ist nur anderthalb Stunden entfernt. Du kannst kommen und mich besuchen.«
»Dich besuchen?«
»Bei mir bleiben.«
»Oh, ich werde kommen und bei dir bleiben, mein Liebling.« Und er hatte sich vorgebeugt, ganz dunkles Haar und Bartstoppeln und Geruch von Sägemehl und Schweiß, und hatte mich an dem Gürtel, der durch die Schlaufen meiner Jeans gezogen war, an sich gerissen. Er hatte meinen Gürtel geöffnet und mich auf das Linoleum der Küche hinuntergedrückt, auf die warme Stelle, unter der ein Heizungsrohr verlief, und seine Hände unter meinem Kopf mit den kurzen Haaren hatten verhindert, dass er auf den Boden aufschlug, als wir hinfielen.
Wenn ich rannte, würde ich vielleicht noch rechtzeitig zu Elsie kommen. An der Ufermauer pfiff der Wind, und der Himmel wurde vom Wasser verschluckt. Ich atmete stoßweise. In meinem linken Schuh befanden sich ein paar Steinchen, die beim Gehen in den Ballen drückten, aber ich wollte nicht anhalten. Es war erst ihr zweiter Tag in der Schule. Die Lehrerin wird denken, dass ich eine schlechte Mutter bin. Häuser! Endlich sehe ich Häuser. Häuser aus den dreißiger Jahren, rote Ziegel, quadratisch, Häuser, wie Kinder ihr Zuhause zeichnen. Perfekt gekräuselter Rauch, eins, zwei, drei Wölkchen aus der ordentlichen Reihe der Schornsteine. Und da war das Auto; vielleicht würde ich doch nicht zu spät kommen.
Elsie wiegte sich von den Fersen auf die Fußspitzen, von den Zehen auf die Fersen. Ihr glattes, helles Haar schwang bei der Bewegung. Sie trug eine braune Regenjacke, ein rot und orange kariertes Kleid und rosa getupfte Strumpfhosen an den staksigen Beinen, die an den sich ständig drehenden Fußknöcheln Falten warfen. (»Du hast gesagt, ich dürfte mir meine Kleider aussuchen, und ich will diese anziehen«, hatte sie beim Frühstück aufsässig gesagt.) Ihre Nase war rot, und ihr Blick leer.
»Komme ich zu spät?« Schuldbewusst umarmte ich ihre abweisende Gestalt.
»Mungo war bei mir.«
Ich sah mich auf dem verlassenen Spielplatz um.
»Ich sehe niemanden.«
»Jetzt nicht mehr.«
An diesem Abend, nachdem Elsie eingeschlafen war, fühlte ich mich in meinem Haus am Meer einsam. Die Dunkelheit draußen war wirklich sehr dunkel, die Stille geradezu unheimlich. Ich saß am unangezündeten Kamin, Anatoly auf dem Schoß, und sein Schnurren, wenn ich ihn hinter den Ohren kraulte, schien das Zimmer zu erfüllen. Unschlüssig stöberte ich im Kühlschrank herum, aß ein Stück hart gewordenen Käse, einen halben Apfel, einen Riegel Milchschokolade mit Rosinen. Ich rief Danny an, es meldete sich aber nur seine unpersönliche Stimme auf dem Anrufbeantworter, und so hinterließ ich keine Nachricht.
Ich schaltete den Fernseher ein, um die Abendnachrichten zu sehen. Ein reiches Ehepaar aus der hiesigen Gegend war brutal ermordet worden; man hatte ihnen die Kehlen durchgeschnitten. Auf ein Bild ihrer förmlich lächelnden Gesichter, seines gerötet und plump, ihres blass, mager und zurückhaltend, folgte eine Ansicht ihres großen roten Hauses vom Ende einer breiten, kiesbestreuten Einfahrt aus. Ihre Tochter im Teenageralter »erhole sich« im Stamford General Hospital. Es gab ein verwackeltes Schulfoto, das Jahre alt sein musste; ein glückliches, rundes, plumpes Gesicht. Das arme Ding. Ein großer Polizeibeamter sagte etwas von keine Mühe scheuen, ein lokaler Politiker äußerte Betroffenheit und Empörung und verlangte, dass Maßnahmen ergriffen würden.
3. KAPITEL
Nach dir.«
»Nein, nach dir.«
»Herrgott, nun gieß schon ein, du Blödmann.«
Sie standen zu viert um die Kaffeemaschine herum, Uniformierte und Anzugträger kämpften um den Zucker und das Milchkännchen. Sie hatten es eilig. Die Sitzplätze in dem normalerweise unbenutzten Konferenzraum waren begrenzt, und keiner wollte zu diesem Anlass zu spät kommen.
»Für eine Fallkonferenz ist es noch ein bisschen zu früh, was?«
»Der Super will es aber.«
»Ich würde sagen, es ist noch ein bisschen früh.«
Der Konferenzraum befand sich im neuen Anbau der zentralen Polizeidienststelle von Stamford, ganz Resopal, Leuchtröhren, summende Heizanlage. Der Chef des CID, Superintendent Bill Day, hatte das Treffen für 11.45 Uhr an diesem Vormittag anberaumt, an dem die Leichen entdeckt worden waren. Die Jalousetten waren hochgezogen und gaben den Blick auf das Bürogebäude gegenüber frei, dessen verspiegelte Fenster einen hellen Winterhimmel zurückwarfen. Einen Overhead-Projektor und einen Videorecorder hatte man in die hintere Ecke des Raums geschoben. Plastikstühle wurden von Stapeln an der Wand genommen und um den langen Tisch herum verteilt. Detektive Inspektor Frank »Rupert« Baird bahnte sich einen Weg durch das Gedränge der Beamten – er überragte die meisten von ihnen – und nahm seinen Platz am Ende des Tisches ein. Er legte ein paar Aktenordner vor sich auf den Tisch und sah auf seine Uhr, sich nachdenklich über seinen Schnurrbart streichend. Bill Day und ein älterer Mann in Uniform betraten den Raum, in dem plötzlich aufmerksame Stille herrschte. Day setzte sich neben Rupert Baird, der Uniformierte aber blieb demonstrativ gleich neben der Tür stehen und lehnte sich leicht an die Wand. Bill Day sprach als erster.
»Guten Morgen, meine Herren«, sagte er. »Und Damen«, fügte er hinzu, als er den ironischen Blick von WPC MacAllister am anderen Ende des Tisches auffing. »Wir werden Sie nicht lange aufhalten. Dies ist nur eine vorbereitende Sitzung.« Er hielt inne und musterte die Gesichter um den Tisch herum. »Also, Leute, wir müssen diese Sache ordentlich hinkriegen. Kein Herumpfuschen.« Es gab zustimmendes Nicken. »Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um Ihnen Chief Superintendent Anthony Cavan vorzustellen, den die meisten von Ihnen noch nicht kennen dürften.«
Der uniformierte Mann an der Tür nickte den Köpfen zu, die sich nach ihm umwandten.
»Danke, Bill«, sagte er. »Guten Morgen allerseits. Ich bin wegen der Pressekonferenz hier, aber ich wollte gern hereinschauen und Ihnen etwas Mut machen. Tun Sie so, als wäre ich gar nicht da.«
»Ja«, sagte Bill Day mit einem dünnen Lächeln. »Ich habe Detektive Inspektor Baird gebeten, die Leitung der Versammlung zu übernehmen. Rupert?«
»Danke, Sir«, sagte Baird und schob mit wichtiger Miene einige Papiere auf dem Tisch vor sich herum. »Der Sinn dieser vorbereitenden Besprechung ist, von Anfang an Klarheit zu schaffen. Die Polizei von Stamford wird im Rampenlicht stehen. Machen wir uns nicht zum Narren. Erinnern Sie sich an den Fall Porter.« Alle kannten den Fall Porter, selbst wenn sie nur davon gehört hatten: die Fernsehdokumentationen, das öffentliche Interesse, die Bücher, die vorzeitigen Pensionierungen, die Versetzungen. Die Atmosphäre wurde merklich kühler. »Ich werde versuchen, die Sache so schnell wie möglich darzulegen. Fragen Sie, was Sie wollen. Ich möchte, dass mich jeder richtig versteht.« Er setzte seine Lesebrille auf und schaute auf seine Notizen. »Die Leichen wurden gegen halb neun heute Morgen gefunden, Donnerstag, den achtzehnten Januar. Die Opfer sind Leopold Victor Mackenzie und seine Ehefrau Elizabeth. Mr. Mackenzie war der Firmenchef von Mackenzie und Carlow. Sie stellen Medikamente, Arzneien und dergleichen her. Ihre Tochter Fiona wurde ins Stamford General Hospital gebracht.«
»Wird sie überleben?«
»Ich habe noch nichts gehört. Wir haben sie in ein besonders gesichertes Zimmer im Krankenhaus gebracht, zu dem nur wenige Personen Zutritt haben. Ihr Hausarzt hat darauf bestanden, und wir denken, dass er recht hat. Zwei Polizisten halten Wache.«
»Hat sie irgendetwas gesagt?«
»Nein. Gerufen wurden wir von der spanischen Putzfrau der Familie, einer Mrs. Juana Ferrer, und zwar um kurz nach halb neun. Binnen zehn Minuten war der Tatort gesichert. Im Augenblick ist Mrs. Ferrer unten.«
»Hat sie irgendetwas gesehen?«
»Anscheinend nicht, sie …«
Baird verstummte und blickte auf, als sich die Tür öffnete. Ein Mann mittleren Alters mit wirrem Haar und dicken Brillengläsern betrat den Raum. Er trug eine vollgepackte Aktentasche, und er war außer Atem.
»Danke, dass Sie vorbeigekommen sind, Philip«, sagte Baird. »Könnte ihm jemand einen Stuhl bringen?«
»Ich habe keine Zeit. Ich komme gerade aus dem Haus und bin unterwegs zur Farrow Street. Ich möchte mir die Leichen sofort vornehmen. Ich kann Ihnen ungefähr eine Minute widmen. Außerdem glaube ich sowieso nicht, dass ich Ihnen hier sehr viel nutzen kann.«
»Das ist Dr. Philip Kale, der Rechtsmediziner«, erklärte Baird den Versammelten. »Was können Sie uns sagen?«
Dr. Kale stellte seine Tasche auf den Boden und runzelte die Stirn.
»Wie Sie wissen, bin ich als Gerichtspathologe unter anderem dafür verantwortlich, dass keine verfrühten Theorien aufgestellt werden. Aber …« Er fing an, an den Fingern abzuzählen.
»Auf der Basis der Untersuchung der Leichen am Tatort scheinen die beiden Fälle auffallend ähnlich. Todesursache: anämische Anoxie, zurückzuführen auf die Schnittwunden in den Kehlen, die einige von Ihnen gesehen haben. Todesart: Ihre Kehlen wurden mit einer möglicherweise nicht gezähnten Klinge von mindestens zwei Zentimeter Breite durchtrennt. Das könnte alles sein, von einem Stanley-Messer bis zum Schnitzmesser. Todesmodus: Tod durch Fremdeinwirkung.«
»Können Sie uns die Todeszeit nennen?«
»Nicht genau. Sie müssen verstehen, dass alles, was ich sage, noch sehr vorläufig ist.« Er hielt einen Moment inne. »Als ich die Leichen am Tatort untersuchte, hatte die Hypostase eingesetzt, war aber noch nicht voll entwickelt. Ich schätze, dass der Tod mehr als zwei Stunden vor dem Auffinden der Leichen eintrat und nicht länger als, sagen wir, fünf oder sechs Stunden zurücklag. Auf keinen Fall länger als sechs Stunden.«
»Die Tochter hätte mit durchschnittener Kehle keine fünf Stunden überleben können, oder?«
Dr. Kale dachte nach.
»Ich habe sie nicht gesehen. Wahrscheinlich nicht.«
»Noch irgendetwas, was Sie uns sagen können? Irgendetwas über den Mord?«
Dr. Kale zeigte die winzige Andeutung eines Lächelns. »Die Person, die das Messer geführt hat, hat dazu die rechte Hand benutzt. Sie hat offenbar keine Aversion gegen Blut, die ihr das unmöglich gemacht hätte. Und jetzt muss ich gehen. Die Autopsien dürften am späten Nachmittag beendet sein. Sie bekommen einen Bericht.«
Als er gegangen war, erhob sich ein leises Gemurmel, das abbrach, als Baird mit den Fingerknöcheln auf den Tisch klopfte.
»Gibt es irgendetwas von der Spurensicherung?«
Kopfschütteln.
»Ich habe mit der Putzfrau geredet.«
Das kam von Detektive Chris Angeloglou.
»Ja?«
»Sie sagte, dass Mrs. Mackenzie in dem Haus vorgestern eine Party gegeben hat. Es waren zweihundert Personen da. Schlechte Nachrichten, tut mir leid.«
»Herrgott. Haben Sie das Foster gesagt?«
»Ja.«
»Wir müssen unsere Leute einfach weitermachen lassen. Wir brauchen eine Liste der Anwesenden.«
»Ich bin schon dabei.«
»Gut. Wir haben bislang noch keine Anzeichen für ein gewaltsames Eindringen gefunden. Aber es ist noch früh am Tag. Wie auch immer, man könnte die Haustür mit einer Kreditkarte, einem Plastiklineal oder irgendetwas anderem öffnen. Eine flüchtige Untersuchung des Inhalts ergab, dass Schubladen und Schränke durchsucht worden sind. Jede Menge Schäden. Zerrissene und zerbrochene Fotos und Bilder.«
»Wurde nach etwas Bestimmtem gesucht?«
»Die Theorien lassen wir, bis wir die Informationen gesammelt und abgeglichen haben. Ich will nicht, dass Beamte nach Beweisen suchen, um eine Theorie zu erhärten. Ich will zuerst das gesamte Beweismaterial. Mit dem Denken können Sie hinterher anfangen.« Er schaute auf seine Notizen. »Was haben wir sonst noch? Da war diese Schrift, an der Wand, mit Mrs. Mackenzies Lippenstift. Piggies, Schweine.«
»Manson«, sagte DC Angeloglou.
»Was ist das?«
»Hat das nicht die Manson-Bande mit Blut an die Wand geschrieben, als sie in Kalifornien all diese Leute umbrachte? Es ist aus einem Beatles-Song.«
»Also gut, Chris. Gehen Sie der Sache nach, aber lassen Sie sich zu nichts hinreißen. Vermutlich ist es eine Sackgasse. Soweit sind wir also im Moment, und wir haben nicht viel. Ich komme gleich zum Schluss. Wenn Sie hinterher bei Christine vorbeigehen, wird sie Ihnen Kopien des Dienstplans aushändigen. Bei den Ermittlungen untersuchen Sie jeden Zentimeter des Hauses, Sie klopfen bei den Nachbarn in der Gegend an, Sie reden mit Mackenzie und Sowieso, wie immer die Firma heißt, und befragen die Leute, die auf der Party waren. Wir haben bereits Beamte auf dem Bahnhof, die sich nach Zeugen umhören, und Straßensperren auf der Tyle Road errichtet. Ich hoffe, wir kriegen die Schweinehunde binnen vierundzwanzig Stunden. Wenn nicht, möchte ich eine Menge Informationen, auf die ich zurückgreifen kann. Irgendwelche Fragen?«
»Hatten sie Feinde?«
»Das ist der Grund, warum wir ermitteln.«
»Gab es viele Wertgegenstände im Haus?«
»Gehen Sie, und finden Sie es heraus. Sie sind Polizist.«
»Es könnte doch ganz einfach sein, Sir.«
Bairds buschige Augenbrauen hoben sich und bildeten einen Winkel von fünfundvierzig Grad. Alle Augen richteten sich auf Pam MacAllister am anderen Ende des Tisches.«
»Klären Sie uns auf, PC MacAllister.«
»Wenn sie überlebt, kann uns die Tochter das vielleicht sagen.«
»Ja«, sagte Baird kühl. »Und inzwischen, bis sie soweit ist, dass sie eine Aussage machen kann, könnten wir so tun, als ob wir Polizisten wären. Oder Polizistinnen. Wenn Sie es tun, tue ich es auch.«
Pam MacAllister wurde rot, sagte aber nichts.
4. KAPITEL
Dreh dein Fenster hoch.«
»Aber mir ist heiß.«
»Es ist eiskalt; wir werden uns beide eine Lungenentzündung holen. Dreh es hoch!«
Mürrisch kämpfte Elsie mit der Kurbel. Das Fenster ging nur ein Stück weit nach oben.
»Ich kann’s nicht.«
Ich beugte mich zu dem Fenster auf ihrer Seite hinüber. Der Wagen geriet aus der Spur.
»Können wir mein Band anmachen? Das mit den Würmern.«
»Gefällt es dir in der Schule?«
Schweigen.
»Was habt ihr gestern gemacht?«
»Weiß nicht.«
»Sag mir drei Dinge, die du gestern gemacht hast.«
»Ich hab gespielt. Und gespielt. Und gespielt.«
»Mit wem hast du gespielt?« Munter. Eifrig.
»Mungo. Kann ich mein Band hören?«
»Der Recorder ist kaputt. Du hast Münzen reingesteckt.«
»Das ist nicht fair. Du hast es versprochen.«
»Ich habe es nicht versprochen.«
»Doch, hast du.«
Wir waren schon drei Stunden wach, und es war noch nicht einmal neun Uhr. Elsie war vor sechs in mein Bett gekrochen, hatte sich neben mir zusammengerollt, mir in der eisigen Morgendämmerung die Daunendecke weggezogen, meine Beine mit ihren Zehennägeln zerkratzt, die ich vergessen hatte zu schneiden, mir ihre kalten kleinen Füße an den Rücken gedrückt, den Kopf unter meinen Arm geschoben, mich mit einem warmen, nassen, gespitzten Mund geküsst, mir mit kundigen Fingern die Augenlider hochgezogen und das Licht neben dem Bett angeknipst, so dass für einen Augenblick das Zimmer voller unausgepackter Kartons und Kisten, aus denen zerknitterte Kleider quollen, in einem schmerzhaften Nebel verschwamm.
»Warum kannst du mich nicht abholen?«
»Ich muss arbeiten. Und du magst doch Linda.«
»Mir gefallen ihre Haare nicht. Warum musst du arbeiten? Warum kann Daddy nicht arbeiten, damit du zu Hause bleiben kannst wie andere Mütter?«
Sie hat keinen Daddy. Warum sagt sie so etwas?
»Ich komme und hole dich bei Linda ab, sobald es geht, das verspreche ich dir. Und ich mache dir etwas zum Abendessen.« Ich ignorierte das Gesicht, das sie daraufhin zog. »Und ich bringe dich morgens zur Schule. In Ordnung?« Ich versuchte, an etwas Fröhliches zu denken. »Elsie, warum spielen wir nicht unser Spiel? Was ist im Haus?«
»Weiß ich nicht.«
»Doch, du weißt es. Was ist in der Küche?«
Elsie schloss die Augen und runzelte vor Anstrengung die Stirn.
»Ein gelber Ball.«
»Fabelhaft. Was ist im Bad?«
»Eine Packung Coco Pops.«
»Phantastisch. Und was ist in Elsies Bett?«
Aber ich hatte ihre Aufmerksamkeit verloren. Elsie starrte aus dem Fenster. Sie zeigte auf eine langsam dahinziehende graue Wolke. Ich schaltete das Radio ein. »… frostiges Wetter … starke nordöstliche Winde …« Bedeutete das aus Nordosten oder in Richtung Nordosten? Was spielte es schon für eine Rolle? Ich drehte den Knopf, Rauschen, Jazz, Rauschen, eine dumme Diskussion, Rauschen. Ich schaltete aus und konzentrierte mich auf die Landschaft. Flach, gefurcht, grau, nass, gelegentlich eine industriell aussehende Scheune aus Aluminium oder Leichtbausteinen. Kein guter Ort, um sich zu verstecken.
Als ich versucht hatte, zu einer Entscheidung über den Job in Stamford zu kommen, hatte ich eine Liste aufgestellt. Auf eine Seite hatte ich die Dinge geschrieben, die dafür, auf die andere die, die dagegen sprachen. Ich mag Listen – an jedem Arbeitstag schreibe ich eine Liste, auf der ich die Dinge, die Priorität haben, mit verschiedenfarbigen Sternchen kennzeichne. Das gibt mir das Gefühl, dass ich mein Leben unter Kontrolle habe; und ich liebe es, die Dinge, die ich erledigt habe, sauber durchzustreichen. Manchmal schreibe ich sogar ein paar ordentlich durchgestrichene Aufgaben ganz oben auf die Liste, um mich ein bisschen in Schwung zu bringen, weil ich hoffe, dass ich so auch die Sachen in den Griff bekomme, die ich noch nicht erledigt habe.
Was hatte für den Job gesprochen? Die Liste sah ungefähr so aus:
Landleben
Größeres Haus
Mehr Zeit für Elsie
Job, den ich mir immer gewünscht habe
Mehr Geld
Zeit, das Trauma-Projekt zu beenden
Spaziergänge
Haustier für Elsie (?)
Kleinere Schule
Klärung der Beziehung zu Danny
Abenteuer und Veränderung
Mehr Zeit (Das war mit mehreren Sternchen versehen, da es alle anderen Gründe einschloss.)
Auf der Seite mit den Kontras hieß es schlicht: London verlassen. Ich bin in den Vorstädten groß geworden, und während meiner Teenagerjahre wollte ich immer bloß ins Zentrum gelangen, in die Mitte, ins Schwarze sozusagen. Als ich klein war und meine Mutter noch meine Kleider auswählte (sittsame Röckchen, Polohemden, ordentliche Jeans, blaue Sandalen mit diskreten kleinen Schnallen, vernünftige Mäntel mit Messingknöpfen, dick gerippte Strumpfhosen, die immer rutschten – »also schau mal einer an, wie du gewachsen bist«, pflegte meine Mutter zu sagen, wenn sie versuchte, meinen schlaksigen Körper in Kleider für zierliche kleine Mädchen zu zwängen), gingen wir immer in der Oxford Street einkaufen. Ich saß oben im Doppeldeckerbus und starrte auf die Menschenmenge, den Schmutz, das Chaos, die Jugendlichen mit den wilden Frisuren, die über die Gehsteige schlenderten, Paare, die sich in den Ecken küssten, die heißen, hellerleuchteten Läden, die ganze Unordnung, den Schrecken und das Entzücken. Ich sagte immer, ich würde Ärztin werden und ins Zentrum Londons ziehen. Während Roberta ihre Puppen anzog, an die Brust drückte, hätschelte und herumtrug, amputierte ich den meinen die Gliedmaßen. Ich wollte Ärztin werden, weil niemand, den ich kannte, Arzt war, weil die Hälfte der Mädchen in meiner Klasse Krankenschwester werden wollte und weil meine Mutter jedes Mal die Augenbrauen hob und mit den Schultern zuckte, wenn ich meinen Ehrgeiz erwähnte.
Für mich bedeutete London Müdigkeit, Aufbruch am frühen Morgen, Spätfilme, Verkehrsstaus, freche Radiosendungen, sobald man nur den Knopf drehte, Schmutz in meinen Kleidern, Hundekot auf den Gehsteigen; bedeutete, dass Männer, die aussahen wie mein Vater, »Doktor« zu mir sagten; bedeutete Vorankommen und Geld auf der Bank, das ich für riesige Ohrringe und unvernünftige Mäntel und spitze Schuhe mit auffallenden Schnallen ausgab; bedeutete Sex mit Fremden an seltsamen Wochenenden, an die ich mich jetzt kaum noch erinnern konnte, bis auf das Gefühl in meinem euphorischen Körper, dass ich Edgware hinter mir gelassen hatte, nicht Edgware als geographischen Ort, sondern das Edgware in meinem Kopf, mit seinen Sonntagsessen und den drei Straßen, durch die man gehen musste, um irgendwo hinzukommen, wo keine Häuser standen. London bedeutete, Elsie zu haben und ihren Vater zu verlieren. London bedeutete Danny. Es war die Geographie meines Erwachsenwerdens. Als ich nach Stamford hineinfuhr, nachdem ich Elsies Finger von meiner Jacke gelöst und ihre plötzlich geröteten Wangen geküsst und ihr impulsiv versprochen hatte, sie selbst von der Schule abzuholen, vermisste ich London plötzlich wie einen Liebhaber, ein weit entferntes Objekt der Begierde. Obwohl die Stadt mich nach Elsies Geburt eigentlich verraten hatte: Sie war ein Raster aus Spielplätzen und Kinderkrippen, Babysitten und Beratungsstellen für Mütter. Ein paralleles Universum, das ich niemals auch nur bemerkt hatte, bis ich es betrat, bis ich wochentags arbeitete, samstags und sonntags einen Kinderwagen schob und Rache schwor.
Das war es, wovon ich geträumt hatte. Zeit. Ich, allein im Haus, und kein Kind und kein Kindermädchen und kein Danny und kein Terminplan, der in meinem Kopf abschnurrte. Ich hörte ein Miauen und spürte das Kratzen von Krallen an meinem Bein. Mit gestrecktem Arm öffnete ich die Dose mit Katzenfutter, füllte Anatolys Napf und schob ihn und den Napf zur Hintertür hinaus. Ein Windstoß blies mir den Geruch von Thunfisch und Kaninchen in Gelee ins Gesicht, was einen würgenden Hustenreiz und Erinnerungen an Seekrankheit auslöste. Wie konnte so etwas gut sein, selbst für eine Katze? Ich wusch Elsies Teller und Becher vom Frühstück ab und machte mir eine Tasse Pulverkaffee mit Wasser, das nicht richtig gekocht hatte, so dass die Kaffeekörnchen auf der Oberfläche schwammen. Draußen fiel Regen auf meinen Garten; die rosa Hyazinthen, die ich gestern so aufregend gefunden hatte, hingen seitlich geknickt in der mit Steinen durchsetzten Erde, und ihre gummiartigen Blütenblätter sahen schlammig aus. Abgesehen vom Geräusch des Regens konnte ich nichts hören, nicht einmal das Meer. Ein Gefühl der Trostlosigkeit beschlich mich. Normalerweise wäre ich jetzt schon seit zwei, vielleicht drei, in Ausnahmefällen sogar vier Stunden in der Arbeit; das Telefon würde läuten, mein Posteingangskorb würde überfließen, meine Sekretärin würde mir eine Tasse Tee bringen, und ich wäre entsetzt darüber, wie rasch der Vormittag verging. Ich schaltete das Radio ein: »Vier kleine Kinder starben bei einem …« und hastig wieder aus. Ich wünschte, jemand hätte mir einen Brief geschickt; selbst Postwurfsendungen wären besser als nichts.
Ich beschloss zu arbeiten. Die Zeichnung, die Elsie letzte Woche für mich gemacht hatte, als ich mich über die Leere der gelblichen, abblätternden Wände meines Arbeitszimmers beklagt hatte, starrte mich anklagend von der Wand über meinem Schreibtisch an, wo ich sie festgepinnt hatte. Das Zimmer war feucht und kalt, also schaltete ich den Heizofen ein; er erwärmte mein linkes Bein und gab mir das Gefühl, ein Vormittagsschläfchen zu brauchen.
Der Bildschirm meines Computers schimmerte grün. Der Cursor pulsierte mit gesunden sechzig Schlägen pro Minute. Ich klickte mit der Maus die Festplatte und dann eine leere Datei mit dem Titel BUCH an. »Selbst eine Reise von tausend Meilen beginnt mit einem einzelnen Schritt«, hatte irgendjemand einmal gesagt. Ich legte eine Datei an und betitelte sie mit »Einleitung«. Ich öffnete die Datei und schrieb erneut »Einleitung«. Das Wort stand, bemitleidenswert klein, oben über einer grünen, leeren Fläche. Ich druckte es fett und größer und wählte dann eine andere Schriftart, so dass es dicker und farbiger aussah. So, das war besser; jedenfalls wirkte es eindrucksvoller.
Ich versuchte mich zu erinnern, was ich in dem Exposé für meinen Verleger geschrieben hatte. Mein Gehirn fühlte sich so leer an, wie es der Bildschirm vor mir war. Vielleicht sollte ich mit dem Titel anfangen. Wie nennt man ein Buch über traumatische Erlebnisse? In meinem Exposé hatte ich es einfach »Trauma« genannt, aber das klang ein bisschen schlicht, wie eine Art gelehrter Idiotenführer, und ich wollte etwas Kontroverses, Polemisches und Aufregendes; ich wollte mich damit beschäftigen, wie Trauma als Begriff missbraucht wird, so dass die Menschen, die wirklich darunter leiden, keiner bemerkt, während Leute, die sich von Katastrophen angezogen fühlen, als Trittbrettfahrer davon profitieren. In großer Druckschrift schrieb ich über »Einleitung« »Die verborgene Wunde« und zentrierte die Wörter. Das hörte sich an wie ein Buch über Menstruation. Mit einem kurzen Wischen der Maus löschte ich die Buchstaben. »Vom Geburtsschock zum Kulturschock«. Nein, nein, nein. »Traumata – Opfer und Süchtige«? Aber das war nur ein kleiner Aspekt des Buches, nicht der Gesamtinhalt. »Seelensuche«, ein passender Titel für ein religiöses Pamphlet. »Auf den Spuren der Trauer«. Na ja. Wie wär’s mit »Die Trauma-Jahre«? Das würde ich mir für meine Memoiren aufheben. Doch jetzt verging wenigstens die Zeit. Fast eine Dreiviertelstunde tippte und löschte ich Titel, bis ich schließlich wieder am Anfang war. »Einleitung«.
Ich ließ mir ein Bad ein, goss teure Badeöle hinein und lag in dem glitschigen Wasser, bis meine Finger schrumpelig wurden; ich las ein Buch über Endspiele von Schachpartien und lauschte dem Geräusch des Regens. Dann aß ich zwei Scheiben Toast mit zerdrückten Sardinen darauf und den Rest eines Käsekuchens, der seit Tagen unter Klarsichtfolie im Kühlschrank gestanden hatte, zwei Schokoladenkekse und eine ziemlich mehlige Scheibe Melone.
Ich ging zurück in mein Arbeitszimmer zum melancholischen Grün des Bildschirms und tippte entschlossen: »Samantha Laschen wurde 1961 geboren und wuchs in London auf. Sie ist leitende Psychiaterin am neuen Zentrum für posttraumatische Persönlichkeitsstörungen mit Sitz in Stamford. Sie wohnt mit ihrer fünfjährigen Tochter und ihrer Katze im ländlichen Essex und spielt in ihrer Freizeit Schach.« Das mit der Katze strich ich wieder aus: zu versponnen. Und das mit dem Schach auch. Ich löschte mein Alter (zu jung, um eine Autorität zu sein, zu alt für ein Wunderkind), das über das Aufwachsen in London und den Wohnsitz in Essex ebenfalls (langweilig). Ich löschte Elsie – ich würde meine Tochter nicht tragen wie ein Accessoire. Dann fing ich an herumzuspielen. Kannten wir Ärzte nicht auch ein gewisses Statusdenken? So, das gefiel mir: »Samanatha Laschen ist Fachärztin für Psychiatrie.« Oder wie wär’s einfach mit: »Samantha Laschen ist …« Minimalismus war immer mein Stil. Ich lehnte mich auf meinem Stuhl zurück und schloss die Augen.
»Keine Bewegung«, sagte eine Stimme, und zwei warme, schwielige Hände legten sich über meine geschlossenen Augen.
»Mmmm«, sagte ich und lehnte den Kopf nach hinten. »Ein fremder Mann, der mir die Augen zuhält.«
Ich spürte Lippen an meiner Kehle. Mein Körper rutschte tiefer in den Sessel, und ich fühlte, wie seine Spannung sich löste.
»›Samantha Laschen ist …‹ Na, dagegen kann ich nichts sagen. Aber vielleicht gibt es bessere Arten, wie du deine Tage verbringen kannst, als drei Wörter zu schreiben, was?«
»Zum Beispiel?« fragte ich, noch immer blind, noch immer schlaff, das Gesicht von seinen rauen Händen umschlossen.
Er drehte den Stuhl um, und als ich die Augen aufschlug, war sein Gesicht nur ein paar Fingerbreit von meinem entfernt: so braune Augen unter den geraden, dunklen Brauen, dass sie fast schwarz wirkten, wirres, ungewaschenes Haar über einer abgetragenen Lederjacke, stoppeliges Kinn, Geruch von Öl, Sägespänen, Seife. Wir berührten uns nicht. Er sah in mein Gesicht, und ich sah auf seine Hände.
»Ich hab dich nicht kommen hören. Ich dachte, du würdest ein Dach bauen.«
»Gebaut. Installiert. Bezahlt. Wie lange haben wir Zeit, bis du Elsie abholen musst?«
Ich sah auf meine Uhr.
»Ungefähr zwanzig Minuten.«
»Dann müssen zwanzig Minuten reichen. Komm her.«
»Mummy?«
»Ja.«
»Lucy hat gesagt, dass dein Haar getötet ist.«
»Sie hat nicht gemeint, dass es getötet ist, sie hat vermutlich gemeint, dass es getönt ist. Dass ich es färbe.«
»Ihre Mummy hat braune Haare.«
»Nun ja …«
»Und Mias Mummy hat auch braune Haare.«
»Möchtest du, dass ich auch braune Haare hätte?«
»Es ist ein ganz helles Rot, Mummy.«
»Ja, da hast du recht, das ist es.« Manchmal bin ich selbst noch schockiert, wenn ich morgens verschlafen ins Bad komme und mein Gesicht zufällig in dem fleckigen Spiegel sehe: weißes Gesicht, feine Linien, die sich allmählich um die Augen herum ausbreiten, und ein flammend roter Schopf auf einem schlanken Hals.
»Es sieht aus wie …«, sie starrte aus dem Fenster, ihr widerspenstiger Körper stemmte sich gegen den Gurt, »… wie diese rote Ampel.«
Dann folgte Stille, und als ich mich das nächste Mal umsah, war sie fest eingeschlafen, wie ein Baby mit dem Daumen im Mund, den Kopf zur Seite gelegt.
Ich saß auf einer Kante von Elsies schmalem Bett und las ihr ein Buch vor, zeigte gelegentlich auf ein Wort, das sie stockend buchstabierte oder – wild drauflos und meist fehlerhaft – zu erraten versuchte. Danny saß auf der anderen Bettkante und faltete kleine Stücke Papier zu einer eckigen Blume, einem flinken Mann, einem schlauen Hund. Elsie saß zwischen uns, den Rücken gerade, die Augen leuchtend, die Wangen rot, befangen, lieb und ernst. Wir waren wie eine richtige Familie. Elsies Blick schnellte zwischen uns hin und her, verband uns. Mein Körper glühte in der Erinnerung an meine kurze Begegnung mit Danny auf dem staubigen Boden meines Arbeitszimmers und in der Vorfreude auf den Abend, der vor uns lag. Während ich las, spürte ich Dannys Blick auf mir. Die Luft zwischen uns war erotisch aufgeladen. Und als Elsie immer undeutlicher redete und schließlich einschlief, gingen wir ohne ein Wort in mein Schlafzimmer, zogen uns gegenseitig aus, berührten uns, und das einzige Geräusch, das man hörte, war das Tropfen des Regens draußen oder manchmal ein Atemzug, der wie ein schmerzliches Aufstöhnen klang. Es war, als hätten wir uns wochenlang nicht gesehen.
Später nahm ich eine Pizza aus der Tiefkühltruhe und schob sie in den Backofen, und wir aßen sie vor dem Feuer, das Danny angezündet hatte. Dabei erzählte ich ihm von meinen Fortschritten mit der Trauma-Station, von Elsies ersten Schultagen, von dem Versuch, mit dem Buch anzufangen, und von meiner Begegnung mit dem Farmer. Danny sprach davon, welche Freunde er in London gesehen und wie er in bitterer Kälte auf feuchten, baufälligen Sparren gehockt hatte, und dann lachte er und sagte, während ich durch meinen Beruf aufstiege, würde er absteigen: vom Theater zum Nichtstun, dann zur Zimmererarbeit und schließlich zu Gelegenheitsjobs; im Augenblick baute er ein Dach für eine streitsüchtige alte Frau.
»Tu’s nicht«, sagte er, als ich anfing, hastig etwas darüber zu sagen, dass Erfolg mehr sei als Arbeit. »Spiel es nicht herunter. Du brauchst dir nicht solche Sorgen zu machen. Dir gefällt, was du tust, und mir gefällt, was ich tue.«
Als das Feuer erlosch, gingen wir wieder die knarrende Treppe hinauf, schauten nach Elsie, die in einem Nest aus Daunen und weichen Spielsachen schlief, legten uns in das Doppelbett und wandten einander müde und wie selbstverständlich das Gesicht zu.
5. KAPITEL
Alles in Ordnung, Sir?«
»Nein.«
»Ich werde Sie aufheitern. Vielleicht etwas zu lesen?«
Detektive Angeloglou warf eine Zeitschrift auf Rupert Bairds Schreibtisch. Baird nahm es auf und knurrte, als er den verblichenen Druck sah.
»Rabbit Punch? Was ist das?«
»Haben Sie das nicht abonniert? Wir haben unten sämtliche Ausgaben. Das ist die Hauszeitschrift von ARK.«
»ARK?«
»Das steht für Animal Rights Knights, die militanten Tierschützer.«
Baird stöhnte. Sanft tätschelte er die Haare oben auf seinem Kopf, die die kahle Stelle darunter bedeckten, aber nicht verbergen konnten.
»Wirklich?«
»Allerdings. Das sind die, die 1992 drüben in Ness in die Nerzfarm eingebrochen sind. Sie haben die Nerze befreit.« Angeloglou zog die Akte zu Rate, die er in der Hand hielt. »Dreiundneunzig haben sie den Brandsatz im Supermarkt in Goldswan Green gelegt. Dann war nichts mehr bis zur Explosion in der Universität im letzten Jahr. Sie sind auch in einige der extremeren Protestaktionen wegen der Kälber verwickelt, in die direkten Aktionen gegen Farmer und Transportfirmen.«
»So?«
»Schauen Sie sich das an.«
Angeloglou schlug die Zeitschrift in der Mitte auf, wo ein Artikel mit der roten Titelzeile »Schlächter des Monats« überschrieben war.
»Ist das irgendwie von Bedeutung?«
»Das ist eine der Dienstleistungen für ihre Leser. Sie drucken die Namen und Adressen von Leuten ab, die sie beschuldigen, Tiere zu quälen. Sehen Sie, hier steht Professor Ronald Maxwell vom Linnaeus-Institut. Er erforscht den Gesang der Vögel. Dazu benutzt er Vögel, die in Käfige gesperrt sind. Dr. Christopher Nicholson hat jungen Katzen die Augenlider zugenäht. Charles Patton führt die Pelzfirma seiner Familie. Und hier haben wir Leo Mackenzie, Firmenchef von Mackenzie und Carlow.«
Baird griff nach der Zeitschrift.
»Was soll er denn tun … getan haben, meine ich?«
»Tierversuche, steht hier.«
»Ach du Scheiße. Gut gemacht, Chris. Haben Sie das überprüft?«
»Ja. In ihren Labors in Fulton arbeitet die Firma an einem Projekt, das teilweise vom Landwirtschaftsministerium finanziert wird. Es geht um Stress bei der Tierhaltung, hat man mir gesagt.«
»Und was machen die da?«
Angeloglou lächelte breit.
»Das ist das Gute«, sagte er. »Zu den Untersuchungen gehört es, Schweinen Elektroschocks zu versetzen und verschiedene Verletzungen zuzufügen und dann ihre Reaktionen zu testen. Haben Sie je gesehen, wie ein Schwein geschlachtet wird?«
»Nein.«
»Sie schneiden ihm die Kehle durch. Überall Blut. Daraus machen sie Blutwurst.«
»Ich kann Blutwurst nicht ausstehen«, sagte Baird und blätterte mehrere Seiten der Zeitschrift um. »Ich finde kein Datum. Wissen wir, wann das veröffentlicht wurde?«
»Sie bekommen den Rabbit Punch nicht bei Ihrem örtlichen Zeitungshändler. Sein Erscheinen bezeichnet man wohl am besten als unregelmäßig, die Verteilung als lückenhaft. Wir haben uns dieses Exemplar vor sechs Wochen besorgt.«
»Wurde Mackenzie davor gewarnt?«
»Man hatte ihm davon erzählt«, sagte Angeloglou. »Aber das war nichts Neues. Wie mir seine Geschäftsleitung sagte, war er an derartige Dinge gewöhnt.«
Baird runzelte konzentriert die Stirn.
»Was wir jetzt brauchen, sind ein paar Namen. Wer war noch für die Aktionen dieser Tierfreunde zuständig? Mitchell, nicht?«
»Ja, aber der hat im Augenblick in den West Midlands alle Hände voll zu tun. Ich habe mit Phil Carrier telefoniert, der sein DI war. Seit Monaten läuft er dort herum und sieht sich abgefackelte Scheunen und zerstörte Lastwagen an. Er wird uns ein paar Namen liefern.«
»Gut«, sagte Baird, »dann mal ran an die Sache. Was gibt’s Neues über die Mackenzie-Tochter?«
»Sie ist bei Bewusstsein. Außer Lebensgefahr.«
»Irgendwelche Chancen, dass sie aussagt?«
Angeloglou schüttelte den Kopf.
»Im Augenblick nicht. Die Ärzte glauben, dass sie unter einem schweren Schock steht. Sie hat noch nichts gesagt. Außerdem, Sie erinnern sich, hatte man ihr die Augen verbunden. Ich würde mir davon vorerst nicht allzu viel versprechen.«
1990 war Melissa Hollingdale noch Biologielehrerin an einer Gesamtschule und vollkommen unbescholten; nicht einmal einen unbezahlten Parkschein konnte man ihr zur Last legen. Inzwischen aber war sie ein häufiger Gast in den Vernehmungszimmern der Polizei, und auf dem Bildschirm rollte Seite um Seite ihre Akte ab. Chris Angeloglou saß hinter dem nur einseitig transparenten Spiegel und starrte die Frau mit dem unbewegten Gesicht an, die etwa Mitte Dreißig war. Ihr langes, dichtes dunkles Haar war im Nacken zusammengebunden, sie trug kein Make-up. Ihre Haut war blass, glatt, sauber. Sie kleidete sich praktisch. Rollkragenpullover, Jeans, Turnschuhe. Ihre Hände, die mit den Handflächen nach unten ruhig auf dem Tisch vor ihr lagen, waren überraschend zierlich und weiß. Sie wartete ohne jedes Zeichen von Ungeduld.
»Wir fangen also mit Melissa an?«
Angeloglou drehte sich um. Es war Baird.
»Wo ist Carrier?«
»Unterwegs. Es gab eine Meldung über eine Bombe, die an eine Truthahnfarm adressiert war.«
»Großer Gott.«
»In einer Weihnachtskarte.«
»Himmel. Bisschen spät, nicht?«
»Er kommt später her.«
Ein Constable erschien mit einem Tablett, auf dem drei Tassen Tee standen. Angeloglou nahm es ihm ab. Die beiden Detektives nickten einander zu und traten ein.
»Danke, dass Sie gekommen sind. Möchten Sie eine Tasse Tee?«
»Ich trinke keinen Tee.«
»Zigarette?«
»Ich rauche nicht.«
»Haben Sie die Akte, Chris? In welcher Eigenschaft ist Miss Hollingdale hier?«
»Sie ist Koordinatorin der Vivisection and Export Alliance. VEAL.«
»Nie davon gehört«, sagte Hollingdale in ruhigem Ton.
Angeloglou schaute in seine Akte.
»Wie lange sind Sie jetzt draußen? Zwei Monate, nicht? Nein, drei. Mutwillige Sachbeschädigung, Angriff auf einen Polizisten, Störung der öffentlichen Ordnung.«
Hollingdale gestattete sich ein resigniertes Lächeln.
»Ich habe mich in Dovercourt vor einen Lastwagen gesetzt. Was soll das hier alles?«
»Welche Tätigkeit üben Sie zurzeit aus?«
»Ich habe Schwierigkeiten, eine Arbeitsstelle zu finden. Anscheinend stehe ich auf verschiedenen Schwarzen Listen.«
»Warum glauben Sie das?«
Sie sagte nichts.
»Vor drei Tagen wurden ein Geschäftsmann namens Leo Mackenzie und seine Ehefrau in ihrem Haus in Castletown, einem Vorort von Stamford, ermordet. Ihre Tochter liegt in kritischem Zustand in einem Krankenhaus.«
»Ja?«
»Lesen Sie manchmal eine Zeitschrift namens Rabbit Punch?«
»Nein.«
»Das ist ein Untergrundmagazin, das von einer terroristischen Tierschützergruppe herausgegeben wird. In der letzten Ausgabe standen Name und Adresse von Mr. Mackenzie. Sechs Wochen später wurden ihm, seiner Frau und seiner Tochter die Kehlen durchgeschnitten. Was haben Sie dazu zu sagen?«
Hollingdale zuckte mit den Achseln.
»Was halten Sie von Aktionen dieser Art?« fragte Baird.
»Haben Sie mich hierhergeholt, um über die Rechte der Tiere zu diskutieren?« fragte Hollingdale mit sarkastischem Lächeln. »Ich bin dagegen, dass irgendeiner Kreatur die Kehle durchgeschnitten wird. Ist es das, was Sie von mir hören wollen?«
»Würden Sie solche Akte verurteilen?«
»Ich bin nicht an Gesten interessiert.«
»Wo waren Sie in der Nacht vom siebzehnten zum achtzehnten Januar?« Hollingdale schwieg lange.
»Ich nehme an, ich lag im Bett, wie alle anderen auch.«
»Nicht alle. Haben Sie irgendwelche Zeugen dafür?«
»Vermutlich kann ich ein oder zwei Leute finden.«
»Ich wette, dass Sie das können. Übrigens, Miss Hollingdale«, fügte Baird hinzu, »wie geht es Ihren Kindern?«
Sie zuckte zusammen, ihre Miene wurde hart.
»Das sagt mir ja keiner. Werden Sie es mir sagen?«
»Mark Featherstone, oder möchten Sie bei Ihrem angenommenen Namen Loki genannt werden?«
Loki trug eine extravagante Mischung verschiedener Stoffe, die zu einer formlosen Tunika zusammengenäht waren, über weiten weißen Baumwollhosen. Sein rotes Haar war zu Dreadlocks gezwirbelt und hing ihm steif wie riesige Pfeifenreiniger bis auf den Rücken. Er roch nach Patschuliöl und Zigaretten.
»Reimt sich Loki auf ›Hockey‹ oder auf ›Chokey‹?1 Ich würde eher auf Chokey tippen.« Angeloglou sah in seine Akte. »Einbruch. Einbruchsdiebstahl. Körperverletzung. Ich dachte, Sie wären gegen Gewalt?«
Loki sagte nichts.
»Sie sind ein kluger Mann, Loki. Chemieingenieur. Doktorgrad in Naturwissenschaften. Nützliches Training für die Herstellung von Sprengstoffen, nehme ich an.«
»Wurden sie denn in die Luft gesprengt, dieses Ehepaar?« fragte Loki.
»Nein, aber meine Kollegen werden Sie zweifellos nach dem Päckchen fragen, das bei der Geflügelfarm Marshall’s Poultry eingegangen ist.«
»Ist es hochgegangen?«
»Zum Glück nicht.«
»Na, dann«, sagte Loki verächtlich.
»Mr. und Mrs. Mackenzie wurden die Kehlen durchgeschnitten. Wie finden Sie das?«
Loki lachte.
»Ich denke, er wird es sich zweimal überlegen, bevor er wieder Tiere foltert!«
»Sie kranker Mistkerl, was wollen Sie eigentlich erreichen, indem Sie auf diese Weise Leute umbringen?«
»Wollen Sie einen Vortrag über die Theorie revolutionärer Gewalt?«
»Versuchen Sie’s ruhig«, sagte Baird.
»Das Foltern von Tieren ist Teil unserer Wirtschaft, Teil unserer Kultur. Das Problem unterscheidet sich nicht von dem, vor dem die Gegner der Sklaverei oder der Kolonisierung Amerikas standen. Man muss die Aktivität einfach unökonomisch machen, wirtschaftlich unattraktiv.«
»Selbst wenn dazu Mord gehört?«
Loki lehnte sich auf seinem Stuhl zurück.
»Befreiungskriege haben ihren Preis.«
»Sie kleiner Scheißer«, sagte Baird. »Wo waren Sie in der Nacht des siebzehnten Januar?«
»Ich habe geschlafen. Und wurde gestört. Wie die Mackenzies.«
»Hoffentlich haben Sie dafür einen Zeugen.«
Loki lächelte und zuckte mit den Schultern.
»Wer hofft denn hier?«
»Ich möchte Ihnen etwas vorlesen, Professor Laroue«, sagte Baird, der ein maschinengeschriebenes Blatt in der Hand hielt. »Bitte entschuldigen Sie, wenn ich dem Stil nicht gerecht werde:
Jeder von uns akzeptiert Grenzen unserer Verpflichtung, dem Gesetz zu gehorchen. Nach dem Holocaust dürfen wir ferner feststellen, dass es Zeiten gibt, in denen wir gezwungen sind, gegen das Gesetz zu verstoßen, sogar die Grenzen dessen zu überschreiten, was wir normalerweise als akzeptables Verhalten betrachten. Ich sehe voraus, dass zukünftige Generationen uns nach unserem eigenen Holocaust fragen werden, dem Holocaust an Tieren, und danach, wie wir dabeistehen konnten, ohne etwas zu tun. Wir in Großbritannien leben jeden Tag mit Auschwitz. Nur, dass es diesmal schlimmer ist, weil wir uns nicht auf Unwissenheit berufen können. Wir essen es zum Frühstück. Wir ziehen es an. Was werden wir unseren Kindern eines Tages sagen? Vielleicht werden die einzigen Menschen, die ihr Haupt noch erheben können, diejenigen sein, die etwas getan, die Widerstand geleistet haben.
Erkennen Sie das wieder, Professor?«
Frank Laroues Haar war so kurz geschnitten, dass es fast wie ein Gazefilm seinen Schädel bedeckte. Er hatte sehr blasse blaue Augen mit merkwürdig winzigen Pupillen, so dass er aussah, als habe Blitzlicht ihn geblendet. Er trug einen makellosen rehbraunen Anzug mit weißem Hemd und Leinenschuhen. In der Hand hielt er einen Stift, den er zwanghaft drehte und mit dem er manchmal auf den Tisch klopfte.
»Ja. Das ist der Teil einer Rede, die ich letztes Jahr bei einer öffentlichen Versammlung hielt. Nebenbei bemerkt ist sie nie veröffentlicht worden. Es würde mich interessieren, wie Sie an dieses Exemplar gekommen sind.«
»Oh, wir gehen abends gern aus. Was haben Sie mit dieser Passage gemeint?«
»Was soll das alles? Meine Ansichten über unsere Verantwortung den Tieren gegenüber sind allgemein bekannt. Ich habe mich bereit erklärt herzukommen und Fragen zu beantworten, aber ich verstehe nicht, was Sie wollen.«
»Sie haben für Rabbit Punch geschrieben.«
»Nein, das habe ich nicht.« Mit einem halben Lächeln zeigte er, dass er erkannt hatte, wovon die Rede war. »Vielleicht sind Dinge, die ich geschrieben oder gesagt habe, dort wiedergegeben worden wie in anderen Zeitschriften auch. Das ist eine ganz andere Sache.«
»Sie lesen ihn also?«
»Ich kenne ihn. Ich habe ein Interesse an dieser Materie.«
Chris Angeloglou lehnte an der Wand. Baird zog sein Jackett aus und hängte es über den Stuhl, der Laroue gegenüber am Tisch stand. Dann setzte er sich hin.
»Ihre Rede ist eine klare Anstiftung zur Gewalt.«
Laroue schüttelte den Kopf.
»Ich bin Philosoph. Ich habe einen Vergleich gezogen.«
»Sie haben suggeriert, dass Menschen die Pflicht haben, zur Verteidigung der Tiere gewaltsame Aktionen durchzuführen.«
Eine kurze Pause trat ein. Dann, geduldig: »Es dreht sich nicht um etwas, was ich suggeriert habe. Ich glaube, dass Menschen objektiv die Pflicht zu handeln haben.«
»Sie auch?«
»Ja.« Er lächelte. »Das folgt daraus.«
»Rabbit Punch glaubt das gleiche, nicht wahr?«
»Wie meinen Sie das?«
»Die Zeitschrift veröffentlicht die Namen und Adressen von Leuten, denen sie vorwirft, Tieren Schaden zuzufügen. Soll das ein Aufruf zu gewaltsamen Aktionen gegen diese Leute sein?«
»Oder vielleicht gegen deren Eigentum.«
»Das war eine Unterscheidung, die Sie in Ihrem Vortrag nicht gemacht haben.«
»Nein.«
Baird lehnte sich schwer über den Tisch.
»Glauben Sie, dass es falsch war, Leo Mackenzie und seine Familie zu töten?«
Tap, tap, tap.
»Objektiv gesprochen, nein, das glaube ich nicht«, sagte er. »Könnte ich Tee oder Wasser oder irgendetwas bekommen?«
»Was ist mit den unschuldigen Opfern?«
»Unschuld ist ein schwer zu definierender Begriff.«
»Professor Laroue, wo waren Sie in der Nacht des siebzehnten Januar?«
»Ich war zu Hause, im Bett, mit meiner Frau.«
Baird wandte sich an Angeloglou.
»Würden Sie mir bitte die Akte geben? Danke.« Er öffnete sie und blätterte einige Seiten durch, bevor er fand, was er suchte. »Ihre Frau ist Chantal Bernard Laroue, nicht wahr?«
»Ja.«
Baird fuhr mit dem Finger an der Seite entlang.
»Jagdsabotage, Jagdsabotage, Störung der öffentlichen Ordnung, Störung der öffentlichen Ordnung, Behinderung des Verkehrs, und hier ist sie sogar zu Körperverletzung geschritten.«
»Gut für sie.«
»Aber nicht unbedingt gut für Sie, Professor Laroue. Möchten Sie mit Ihrem Anwalt sprechen?«
»Nein, Officer.«
»Detektive Inspektor.«
»Detektive Inspektor.« Ein Lächeln breitete sich auf Laroues blassem, knochigem Gesicht aus, und er hob zum ersten Mal den Blick, um Baird anzusehen. »Das ist alles Quatsch. Vorträge und wo ich in der Nacht des Ich-weiß-nicht-Wievielten war. Ich gehe jetzt. Wenn Sie wieder mit mir sprechen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sie etwas haben, worüber Sie mit mir sprechen wollen. Würden Sie bitte die Tür öffnen, Officer?«
Angeloglou sah Baird an.
»Sie haben den Mistkerl gehört«, sagte Baird. »Machen Sie ihm die Tür auf.«
In der Tür drehte sich Laroue nach den beiden Detektives um: »Wir werden siegen, glauben Sie mir.«
Paul Hardy sagte überhaupt nichts. Er saß in seinem langen Leinenmantel da, als wäre es bereits ein Zugeständnis, ihn auszuziehen. Ein- oder zweimal fuhr er sich mit der Hand durch das lockige braune Haar. Er sah durch seine Brille mit den Drahtbügeln abwechselnd Baird und Angeloglou an, aber die meiste Zeit starrte er einfach in die Luft. Er antwortete nicht auf Fragen und gab nicht einmal zu erkennen, dass er sie gehört hatte.
»Wissen Sie von den Mackenzie-Morden?«
»Wo waren Sie in der Nacht des siebzehnten?«
»Sie wissen, wenn Sie angeklagt werden, kann Ihr Schweigen als Beweis gegen Sie verwendet werden.«
Nichts. Nach mehreren vergeblichen Minuten klopfte jemand an die Tür. Angeloglou ging hin. Es war eine junge Polizistin.
»Hardys Anwältin ist da«, sagte sie.
»Führen Sie sie herein.«
Sian Spenser, eine Frau Anfang Vierzig mit energischem Kinn, war außer Atem und gereizt.
»Ich möchte fünf Minuten mit meinem Mandanten allein sprechen.«
»Man wirft ihm nichts vor.«
»Was zum Teufel soll er dann hier? Gehen Sie. Sofort.«
Baird atmete tief ein und verließ das Zimmer, gefolgt von Angeloglou. Als Spenser sie zurückholte, saß Hardy mit dem Rücken zur Tür.
»Mein Mandant hat nichts zu sagen.«