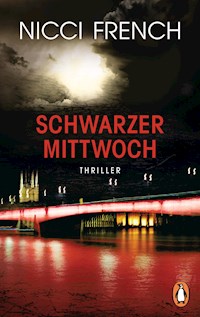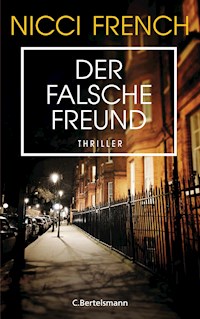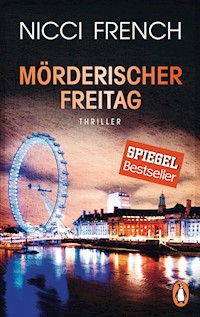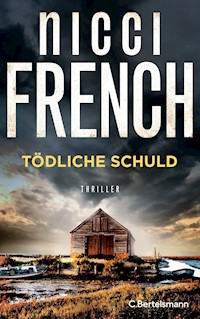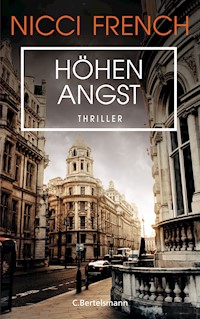
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zwischen Leidenschaft und Tod - ein Psychothriller der Extraklasse
Es ist Liebe auf den ersten Blick, als Alice dem Extrembergsteiger Adam begegnet. Erst nach der Heirat kommen Alice Zweifel, denn Adam überschreitet immer wieder Grenzen zwischen Leidenschaft und Gewalt. Als sie beginnt, in Adams Vergangenheit zu forschen, stößt sie auf ein furchtbares Unglück im Himalaya, bei der unter Adams Führung mehrere Teilnehmer auf mysteriöse Weise ums Leben kamen. Ein entsetzlicher Verdacht steigt in Alice auf, da scheint schon alles zu spät.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 570
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Nicci French
Höhenangst
Roman
Aus dem Englischen von Birgit Moosmüller
Buch
Es trifft Alice wie ein Blitz aus heiterem Himmel. An einem Januarmorgen begegnet die junge Frau auf dem Weg zur Arbeit einem Mann mit auffallend blauen Augen – und nichts ist in ihrem Leben mehr, wie es war. Während ihrer Mittagspause wartet der Mann, Adam, bereits auf Alice, und sie folgt ihm in eine fast leere Wohnung. Eine leidenschaftliche Affäre beginnt, die sich schon bald zur Obsession steigert. Alice bricht mit ihrer bürgerlichen Existenz, um Adam zu heiraten, obwohl sie fast nichts über ihn und seine Vergangenheit weiß. Sie weiß nur, dass er Extrembergsteiger ist und Touren im Himalaya geführt hat, bei denen mehrere Teilnehmer umgekommen sind. Als Alice versucht, eine Art biografisches Puzzle zusammenzusetzen, entdeckt sie immer mehr bedrohliche Details. Und auch in ihrer Liebe spürt sie etwas Neues, das ihr Angst macht, denn Adam überschreitet immer wieder die Grenze zwischen Leidenschaft und Gewalt. Bei ihren anfangs eher ziellosen Nachforschungen stößt Alice auf Zeitungsnotizen, versteckte Briefe, unbekannte Frauennamen, verschwundene Frauen – und die Toten im Himalaya. Und plötzlich fällt es ihr wie Schuppen von den Augen …
Autorin
Nicci French sorgte bereits mit ihren ersten beiden Spannungsromanen für Furore. Die in London lebende Journalistin hat sich längst einen Namen als Englands neue »Lady of Crime« gemacht.
Von Nicci French sind außerdem erschienen
Der Glaspavillon. Roman Ein sicheres Haus. Roman Das rote Zimmer. Roman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 1999 unter dem Titel »Killing Me Softly« bei Michael Joseph, London
Der Goldmann Verlag ist ein Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH.
Taschenbuchausgabe Mai 2001 Copyright © 1999 by Joined-Up Writing Copyright © 1999 der deutschsprachigen Ausgabe by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House, Neumarkter Str. 28, 81673 München. Umschlaggestaltung: Design Team München Umschlagfoto: Look/Wiesmeier
ISBN 978-3-641-24597-9V002
www.goldmann-verlag.de
www.randomhouse.de
FÜR KERSTI UND PHILIP
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
Er wußte, daß er sterben würde. Und irgendwo tief in seinem Innern wurde ihm dunkel bewußt, daß er sich das nicht wünschen sollte. Er wollte etwas unternehmen, um sich zu retten, aber er wußte nicht, was. Vielleicht würde ihm etwas einfallen, wenn er ein wenig klarer sähe, was überhaupt passiert war. Wenn nur der Wind und der Schnee nachlassen würden. Der Wind und der Schnee peitschten schon so lang auf ihn ein, daß er das Geräusch kaum mehr von der stechenden Kälte auf seinem Gesicht unterscheiden konnte. Ständig galt es, diesen Kampf durchzustehen, diesen wirklich letzten Kampf, in einer Höhe von achttausend Metern über dem Meeresspiegel, wo Menschen eigentlich nicht vorgesehen waren, Sauerstoff aus der Luft zu saugen. Seine Sauerstoffflaschen waren längst leer, die Ventile eingefroren, die Maske nur noch eine Last.
Es konnte innerhalb von Minuten vorbei sein, aber wahrscheinlicher war, daß es noch ein paar Stunden dauern würde. Auf jeden Fall würde er tot sein, bevor der Morgen kam. Das machte aber nichts. Er fühlte sich schläfrig und ruhig. Unter mehreren Schichten aus windundurchlässigem Nylon, GoreTex, Wolle und Polypropylen schlug sein Herz doppelt so schnell wie sonst – ein Gefangener, der verzweifelt gegen seine Brust hämmerte. Sein Gehirn aber arbeitete träge, wie in Trance. Was nicht gut war, weil sie alle wach und in Bewegung bleiben mußten, bis sie gerettet wurden. Er wußte, was er eigentlich tun sollte: aufstehen, wild die Hände zusammenschlagen und seine Gefährten aufwecken. Aber dazu fühlte er sich zu wohl. Es war ein gutes Gefühl, endlich zu liegen und sich auszuruhen.
Daß er die Kälte nicht mehr spürte, machte es leichter. Er blickte nach unten, wo eine seiner Hände, die aus dem Handschuh gerutscht war, in einem seltsamen Winkel von seinem Körper abstand. Bisher war sie immer dunkelrot gewesen, aber inzwischen wirkte sie weiß wie Wachs. Seltsam, daß er solchen Durst hatte. In seiner Jacke befand sich eine Flasche, aber die war eingefroren und daher nutzlos für ihn. Um ihn herum lag lauter Schnee, der genauso nutzlos war. Irgendwie war es fast schon komisch. Zum Glück war er nicht Arzt wie Françoise.
Wo war sie? Als sie das Ende der Leine erreicht hatten, hätten sie eigentlich an dem Paß mit dem dritten Camp sein müssen. Françoise war weitergegangen, und sie hatten sie nicht mehr gesehen. Die anderen waren zusammengeblieben und herumgetappt, bis sie völlig die Orientierung verloren hatten und überhaupt nicht mehr wußten, an welcher Stelle des Berges sie sich befanden. Das hatte ihnen die Entschuldigung dafür geliefert, sich irgendwann resigniert in diese Schneerinne zu kuscheln. Trotzdem war da etwas, woran er sich erinnern mußte, etwas, das in seinem Kopf verlorengegangen war. Er hatte nicht nur vergessen, wo es war, sondern auch, was es war.
Er konnte nicht einmal bis zu seinen Füßen sehen. Als sie am Morgen aufgebrochen waren, hatten die Berge in der dünnen Luft geschimmert, und während sich ihre Gruppe langsam über die schrägen Eishänge in Richtung Gipfel vorgekämpft hatte, hatte sich über den Rand der Berge gleißendes Sonnenlicht ergossen, das von dem bläulichweißen Eis reflektiert worden war und ihre schmerzenden Köpfe durchbohrt hatte. Erst waren bloß ein paar Kumuluswolken auf sie zugetrieben, aber dann hatte plötzlich dieser Schneesturm eingesetzt.
Neben sich spürte er eine Bewegung. Noch jemand war bei Bewußtsein. Mühsam drehte er sich auf die andere Seite. Eine rote Jacke, also mußte es Peter sein. Sein Gesicht war unter einer dicken Schicht grauen Eises verborgen. Es gab nichts, was er für ihn tun konnte. Sie waren eine Art Team gewesen, aber nun steckte jeder von ihnen in seiner eigenen, von den anderen abgetrennten Welt.
Er fragte sich, wer an diesem Berghang noch im Sterben lag. Aber auch für die anderen konnte er nichts tun. In seinem Schneeanzug hatte er einen Zahnbürstenbehälter mit einer Spritze voller Dexamethason stecken, aber mittlerweile ging selbst das Halten einer Spritze über seine Kräfte. Er konnte die Hände nicht einmal genug bewegen, um die Riemen seines Rucksacks zu lösen. Was hätte er auch tun sollen? Wohin sollte er sich von hier aus wenden? Besser, er wartete. Man würde sie schon finden. Die Leute wußten schließlich, wo sie waren. Warum blieben sie so lange aus?
Die Welt, die unter ihm lag, das Leben, das er vorher geführt hatte, diese Berge, all das war inzwischen so weit unter die Oberfläche seines trägen Bewußtseins gesunken, daß nur noch Spuren davon übriggeblieben waren. Er wußte, daß mit jeder Minute, die er hier oben in dieser sauerstoffarmen Todeszone lag, Millionen seiner Gehirnzellen ausgelöscht wurden. Ein winziger Teil seines Gehirns sah voller Entsetzen und Mitleid zu, wie er langsam starb. Er wünschte, es wäre vorbei. Er wollte nur noch schlafen.
Er kannte die verschiedenen Stadien des Todes. Fast neugierig hatte er verfolgt, wie sein Körper sich hier auf den letzten Kämmen unterhalb des Chungawatgipfels gegen seine Umgebung zur Wehr gesetzt hatte: Er hatte mit Kopfschmerzen und Durchfall reagiert, mit Atemnot und geschwollenen Händen und Knöcheln. Er wußte, daß er nicht mehr in der Lage war, klar zu denken. Vielleicht würde er Halluzinationen bekommen, bevor er starb. Er wußte, daß er an Händen und Füßen bereits Erfrierungen hatte. Seine verkohlten Lungen waren der einzige Teil seines Körpers, den er noch spürte. Es kam ihm vor, als wäre sein Verstand das letzte, was in dieser zerstörten Hülle noch schwach vor sich hinglomm. Er wartete darauf, daß auch sein Verstand ein letztes Mal aufflackern und dann sterben würde.
Schade, daß er es nicht bis zum Gipfel geschafft hatte. Der Schnee fühlte sich unter seiner Wange wie ein Kissen an. Tomas war warm. Voller Frieden. Was war falsch gelaufen? Es hätte alles so einfach sein sollen. Irgend etwas mußte er sich wieder ins Gedächtnis rufen, etwas, das falsch gelaufen war. Da war ein falscher Ton gewesen. Ein Teilchen des Puzzles paßte nicht. Er schloß die Augen. Die Dunkelheit tat gut. Sein Leben war so hektisch gewesen. Die ganze Mühe. Wofür? Nichts. Es mußte ihm einfach wieder einfallen. Sobald es ihm wieder einfiel, war alles andere unwichtig. Wenn bloß das Heulen des Windes aufhören würde. Wenn er bloß denken könnte. Ja, das war es. Es war so blöd, so einfach, aber jetzt erinnerte er sich. Er lächelte. Er spürte, wie die Kälte sich in seinem Körper ausbreitete, ihn in der Dunkelheit willkommen hieß.
Ich saß reglos auf dem harten Stuhl. Mein Hals schmerzte. Von dem flackernden Neonlicht wurde mir langsam schwindlig. Ich stützte die Hände auf den Schreibtisch, der uns voneinander trennte, legte die Fingerspitzen leicht aneinander und versuchte, gleichmäßig zu atmen. Wie seltsam, daß das Ganze an einem solchen Ort enden mußte.
Um uns herum klingelten die Telefone, und die Luft summte von Gesprächen, als wäre sie elektrisch aufgeladen. Irgendwo im Hintergrund waren andere Leute, uniformierte Männer und Frauen, die hektisch vorbeieilten. Hin und wieder streiften uns ihre Blicke, aber sie wirkten nicht neugierig. Warum sollten sie auch? Sie bekamen hier drin so vieles zu sehen, und ich war nur eine ganz normale Frau mit geröteten Wangen und einer Laufmasche in der Strumpfhose. Wer sah mir schon an, wie es mir ging? Meine Füße schmerzten in ihren lächerlichen Stiefeletten. Ich wollte nicht sterben.
Inspektor Byrne griff nach einem Stift. Ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und versuchte ihn anzulächeln. Er hatte buschige Augenbrauen und einen geduldigen Blick. Am liebsten wäre ich in Tränen ausgebrochen und hätte ihn angefleht, mich zu retten. O bitte! Ich hatte schon so lange nicht mehr richtig geweint. Wenn ich jetzt damit anfing, würde ich dann je wieder aufhören?
»Erinnern Sie sich, wo wir stehengeblieben sind?« fragte er.
O ja, ich erinnerte mich. Ich erinnerte mich an alles.
1. KAPITEL
Alice! Alice! Du bist spät dran!«
Ich hörte ein leises, widerwilliges Grunzen. Erst dann wurde mir bewußt, daß das Geräusch von mir selbst kam. Draußen war es kalt und dunkel. Ich kuschelte mich noch tiefer unter die aufgebauschte Bettdecke und kniff die Augen zusammen, um den schwachen Schimmer des Winterlichts nicht sehen zu müssen.
»Aufstehen, Alice!«
Jake roch nach Rasierschaum. Seine Krawatte war noch nicht gebunden. Ein neuer Tag. Es sind eher die kleinen Gewohnheiten als die großen Entscheidungen, die zwei Menschen zu einem richtigen Paar machen. Jake und ich kannten einander bis ins trivialste Detail. Ich wußte, daß er seinen Kaffee mit mehr Milch trank als seinen Tee, und er wußte, daß ich bloß einen Tropfen Milch im Tee mochte und meinen Kaffee schwarz trank. Er konnte mit sicherem Griff den harten Knoten lokalisieren, der sich neben meinem linken Schulterblatt bildete, wenn ich einen harten Arbeitstag im Büro hinter mir hatte. Ich tat seinetwegen kein Obst in den Salat und er meinetwegen keinen Käse. Was konnte man von einer Beziehung mehr erwarten? Wir waren gerade dabei, uns als Paar einzuspielen.
Ich hatte vorher noch nie mit einem Mann zusammengelebt – zumindest nicht mit einem, mit dem ich eine Beziehung hatte –, und fand es interessant zu sehen, wie beide Partner im Haushalt bestimmte Rollen übernahmen. Als Ingenieur kannte sich Jake unendlich gut mit all den Drähten und Röhren aus, die hinter unseren Wänden und unter unseren Böden verliefen. Ich sagte einmal zu ihm, daß das einzige, was ihn an unserer Wohnung störe, die Tatsache sei, daß er sie nicht eigenhändig auf der grünen Wiese gebaut habe, und er faßte diese Bemerkung nicht als Beleidigung auf. Ich hatte Biochemie studiert, was bedeutete, daß ich fürs Bettenmachen zuständig war und den Mülleimer in der Küche ausleerte. Jake reparierte den Staubsauger, aber ich benutzte ihn. Ich putzte auch das Bad, es sei denn, Jake hatte sich vorher dort rasiert. Da zog ich die Grenze.
Das Seltsame an unserer Aufteilung war, daß Jake die ganze Bügelwäsche erledigte. Er behauptete, heutzutage wüßten die Leute gar nicht mehr, wie Hemden richtig gebügelt würden. Ich hielt das für völlig bescheuert und hätte mit Sicherheit beleidigt reagiert, wenn es nicht so schwer wäre, beleidigt zu sein, wenn man mit einem Drink auf der Couch liegt und fernsieht, während jemand anderer bügelt. Jake holt die Zeitung, und ich lese sie über seiner Schulter, was ihn ziemlich nervt. Wir gehen beide einkaufen, wobei ich aber immer eine Liste mitnehme und alles abhake, während er viel planloser vorgeht und mehr Geld ausgibt als ich. Er taut den Kühlschrank ab, ich gieße die Pflanzen. Er bringt mir jeden Morgen eine Tasse Tee ans Bett.
»Du bist spät dran«, sagte er. »Hier ist dein Tee. Ich gehe in genau drei Minuten.«
»Ich hasse den Januar«, sagte ich.
»Das hast du über den Dezember auch schon gesagt.«
»Der Januar ist wie der Dezember. Bloß ohne Weihnachten.«
Aber er hatte bereits den Raum verlassen. Nach einer schnellen Dusche sprang ich in einen hellbeigen Hosenanzug, bei dem mir die Jacke fast bis an die Knie reichte. Dann bürstete ich mein Haar und drehte es zu einem lockeren Knoten zusammen.
»Du siehst gut aus«, sagte Jake, als ich in die Küche kam. »Ist das neu?«
»Ich habe es schon seit Ewigkeiten«, log ich, während ich mir eine zweite, lauwarme Tasse Tee einschenkte.
Auf dem Weg zur U-Bahn teilten wir uns einen Schirm und versuchten, allen größeren Pfützen auszuweichen. Am Drehkreuz blieben wir kurz stehen. Er klemmte sich den Schirm unter den Arm, nahm mich fest an den Schultern und gab mir einen Kuß.
»Mach’s gut, Schatz«, sagte er. Ich wußte, daß er in einem solchen Moment gern verheiratet gewesen wäre. Jake möchte, daß aus uns ein Ehepaar wird. Mit diesen beklemmenden Gedanken beschäftigt, vergaß ich ganz, seinen Gruß zu erwidern. Zum Glück fiel es ihm nicht auf. Er trat auf die Rolltreppe und fuhr mit einer ganzen Schar von Männern in Regenmänteln nach unten. Er sah sich nicht um. Fast war es, als wären wir schon verheiratet.
Ich wollte nicht in die Besprechung. Auch körperlich fühlte ich mich dazu kaum in der Lage. Am Vorabend waren Jake und ich essen gewesen, um Mitternacht nach Hause zurückgekehrt und dann erst gegen halb drei zum Schlafen gekommen. Wir hatten unseren Jahrestag gefeiert – unseren ersten. Es war kein besonderer Jahrestag, aber Jake und ich haben sonst keinen zu feiern. Obwohl wir uns hin und wieder das Gehirn zermartert haben, können wir uns nicht an unsere erste Begegnung erinnern. Wie zwei Bienen, die denselben Bienenstock umschwirren, halten wir uns schon so lange in derselben Umgebung auf. Wir können uns auch nicht daran erinnern, wann wir Freunde geworden sind. Wir gehörten beide zu einer Clique, die mal etwas kleiner, mal etwas größer war. Jake und ich wußten alles über die Eltern, die Schulzeit und das frühere Liebesleben des anderen. Einmal betranken wir uns ganz schrecklich, weil ihn seine Freundin verlassen hatte. Wir saßen unter einem Baum im Regent’s Park und leerten gemeinsam eine halbe Flasche Whisky. Dabei war unsere Stimmung mal traurig, mal albern, insgesamt aber ziemlich sentimental. Ich erklärte ihm, daß seine Ex schon noch merken würde, was sie an ihm gehabt habe, woraufhin er einen Schluckauf bekam und mein Haar streichelte. Wir lachten über die Witze des anderen, tanzten auf Partys miteinander, solange die Musik nicht zu langsam wurde, schnorrten Geld voneinander, bildeten Fahrgemeinschaften und erteilten uns gegenseitig Ratschläge. Wir waren Freunde.
Wir konnten uns beide noch an den Abend erinnern, an dem wir zum erstenmal miteinander geschlafen haben. Das war am siebzehnten Januar vergangenen Jahres gewesen. An einem Mittwoch. Ein paar von uns wollten sich im Kino eine Spätvorstellung ansehen. Dann konnten plötzlich mehrere nicht kommen, und als wir uns schließlich im Kino trafen, waren nur noch Jake und ich übriggeblieben. Irgendwann während des Films sahen wir uns an und lächelten ziemlich dümmlich, wahrscheinlich, weil uns beiden klarwurde, daß das Ganze nun auf eine Art Rendezvous hinauslief, und wir uns beide fragten, ob das wohl eine gute Idee war.
Hinterher lud er mich auf einen Drink in seine Wohnung ein. Es war gegen ein Uhr morgens. Er hatte eine Packung Räucherlachs im Kühlschrank und selbstgebackenes Brot. Darüber mußte ich im nachhinein lachen, weil er seitdem nie wieder Brot oder sonst was gebacken hat. Wir gehören zu den Paaren, die von Fertiggerichten leben oder sich irgendwo etwas zum Essen mitnehmen. Als ich ihn an diesem Abend zum erstenmal küßte, fand ich das irgendwie komisch, denn schließlich waren wir schon lange gute Freunde. Ich sah sein Gesicht auf mich zukommen, bis es dem meinen so nahe war, daß seine vertrauten Züge plötzlich fremd wirkten. Am liebsten hätte ich losgekichert oder einen Rückzieher gemacht, nur um den plötzlichen Ernst der Situation zu durchbrechen, diese neue Art von Stille zwischen uns. Aber ich fühlte mich sofort wohl, so als hätte ich mein Zuhause gefunden. Wenn es Phasen gab, in denen mich die Vorstellung, seßhaft geworden zu sein, störte (was war aus meinen Plänen geworden, im Ausland zu arbeiten, Abenteuer zu erleben, eine andere Art von Mensch zu sein?) oder ich mich fragte, ob ich mit meinen knapp dreißig Jahren schon an einem Endpunkt angelangt war, nun, dann schüttelte ich diese Gedanken ab.
Mir ist klar, daß Paare an einem bestimmten Punkt die Entscheidung treffen zusammenzuleben. Es ist eine Station auf dem Lebensweg, wie das Austauschen von Ringen oder das Sterben. Bei uns war das nicht so. Es fing einfach damit an, daß ich hin und wieder über Nacht blieb. Jake stellte mir eine Schublade für Slips und Strümpfe zur Verfügung. Gelegentlich hängte ich auch mal ein Kleid in seinen Schrank. Ich fing an, meine Haarspülung und meinen Eyeliner bei ihm im Bad zu deponieren. Nach ein paar Wochen fiel mir auf, daß etwa die Hälfte der Videos meine Handschrift trug.
Eines Tages fragte mich Jake, ob es denn sinnvoll sei, weiter Miete für mein Zimmer zu bezahlen, wenn ich mich nie dort aufhielte. Ich druckste eine Weile herum, konnte mich aber zu keiner Entscheidung durchringen. Im Sommer kam meine Cousine Julie in die Stadt, um dort bis zum Collegebeginn zu jobben. Ich bot ihr als Übergangslösung mein Zimmer an. Um Platz für ihre Sachen zu machen, mußte ich noch mehr von meinen Dingen ausräumen. Ende August – es war ein heißer Sonntagabend, und wir saßen in einem Pub, von dem aus man quer über den Fluß auf St. Paul’s hinüberblicken konnte – fing Julie damit an, uns die Ohren vollzujammern, daß sie sich etwas suchen müsse, wo sie auf Dauer bleiben könne. Ich schlug ihr vor, einfach mein Apartment zu übernehmen. So kam es, daß Jake und ich plötzlich zusammenwohnten und als einzigen Jahrestag unsere erste sexuelle Begegnung zu feiern hatten.
Aber diese Feier hatte ihre Folgen, und wenn man voller Widerwillen zu einer Geschäftsbesprechung geht und befürchtet, sich nicht gut genug präsentieren zu können, sollte man zumindest pünktlich und ordentlich gekleidet dort erscheinen. Das gehört zwar nicht unbedingt zu den zehn Geboten für Manager, aber an jenem dunklen Morgen, an dem mein Magen nichts anderes als Tee vertrug, erschien es mir wie eine Überlebensstrategie. In der U-Bahn versuchte ich meine Gedanken zu ordnen. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen, ein paar Notizen machen oder etwas in der Art. Ich setzte mich nicht hin, weil ich hoffte, daß mein neuer Hosenanzug auf diese Weise faltenfrei bleiben würde. Mehrere freundliche Herren boten mir einen Sitzplatz an und wirkten peinlich berührt, als ich ablehnte. Womit würden sich all die anderen Fahrgäste an diesem Tag beschäftigen? Bestimmt würde keiner etwas so Seltsames tun wie ich. Ich war unterwegs in das Büro einer kleinen Abteilung eines sehr großen multinationalen Pharmakonzerns, um im Rahmen einer Geschäftsbesprechung über einen Gegenstand aus Plastik und Kupfer zu reden, der wie eine New-Age-Brosche aussah, in Wirklichkeit aber der unbefriedigende Prototyp eines Intrauterinpessars war.
Ich hatte miterlebt, wie mein Chef Mike zunächst verblüfft, dann wütend, dann frustriert und schließlich verwirrt reagiert hatte, weil wir mit Drakloop IV nicht vorankamen. Drakloop IV war das Intrauterinpessar – von uns kurz IUP genannt –, mit dem der Drakon-Konzern die intrauterine Empfängnisverhütung revolutionieren wollte, falls das Ding je den Weg aus dem Labor schaffen sollte. Ich selbst war sechs Monate zuvor für das Projekt engagiert, mit der Zeit aber immer mehr in einen bürokratischen Sumpf hineingezogen worden: Budgetpläne, Marketingziele, Defizite, regionale Besprechungen, Besprechungen wegen Besprechungen. All das und die unmögliche Hierarchie des Entscheidungsprozesses hatten mich fast vergessen lassen, daß ich als Wissenschaftlerin in ein Projekt eingebunden war, das entfernt mit weiblicher Fruchtbarkeit zu tun hatte. Ich hatte den Job angenommen, weil mir die Vorstellung, ein Produkt zu kreieren und zu verkaufen, wie ein Urlaub von meinem sonstigen Arbeitsleben vorgekommen war.
An diesem Donnerstagmorgen wirkte Mike bloß mißmutig, aber man durfte seine Stimmung nicht unterschätzen. Er war wie eine an den Strand gespülte rostige alte Mine aus dem Zweiten Weltkrieg, die auf den ersten Blick harmlos wirkte, aber durch einen unbedachten Stoß an der falschen Stelle in die Luft gehen konnte. Dieser Stoß würde nicht von mir kommen – nicht heute.
Nacheinander betraten die Leute den Konferenzraum. Ich hatte mir bereits einen Platz gesucht, wo ich mit dem Rücken zur Tür saß, so daß ich einen guten Blick aus dem Fenster hatte. Das Büro lag südlich der Themse in einem Labyrinth schmaler Straßen, die nach Gewürzen und deren fernen Herkunftsländern benannt waren. Hinter unseren Büros erstreckte sich ein Grundstück, das immer kurz davorstand, aufgekauft und saniert zu werden. Vorerst aber wurde es als Sammelstelle für recyclingfähige Materialien genutzt. Als Müllhalde. In einer Ecke türmte sich ein riesiger Berg aus Flaschen. An sonnigen Tagen glitzerte er geheimnisvoll, aber selbst an einem schrecklichen Tag wie diesem hatte ich gute Chancen, den Bagger dabei beobachten zu können, wie er die Flaschen zu einem noch höheren Berg auftürmte. Das war interessanter als alles, was im Konferenzraum C passieren würde. Ich ließ den Blick durch den Raum schweifen. Drei der anwesenden Männer waren eigens zu dieser Besprechung aus dem Labor in Northbridge angereist. Sie schienen sich nicht besonders wohl zu fühlen. Dann gab es da noch Philip Ingalls von oben, meine sogenannte Assistentin Claudia und Mikes Assistentin Fiona. Mehrere Leute fehlten. Mike blickte noch mißmutiger drein und zog hektisch an seinen Ohrläppchen. Ich sah aus dem Fenster. Gut. Der Bagger näherte sich dem Flaschenberg. Meine Stimmung besserte sich.
»Kommt Giovanna nicht?« fragte Mike.
»Nein«, antwortete einer der Forscher. Er hieß Neil, glaube ich. »Sie hat mich gebeten, sie zu vertreten.«
Mikes resigniertes Schulterzucken verhieß nichts Gutes. Ich setzte mich gerade hin, machte eine aufmerksame Miene und griff voller Optimismus nach meinem Stift. Die Besprechung begann mit Hinweisen auf die letzte Konferenz und anderen monotonen Routineangelegenheiten. Ich kritzelte ein wenig auf meinem Block herum und versuchte mich dann an einer Skizze von Neils Gesicht, das mich mit seinen traurigen Augen an einen Bluthund erinnerte. Dann blendete ich mich aus und sah dem Bagger zu, der inzwischen mitten in der Arbeit steckte. Leider konnte man durch die Fenster das Geräusch des brechenden Glases nicht hören, aber ich fand es trotzdem höchst interessant. Nur mit Mühe konzentrierte ich mich wieder auf das Gespräch, als Mike nach den Plänen für den Februar fragte. Neil begann über anovulatorische Blutungen zu sprechen. Absurderweise ärgerte es mich plötzlich, daß ein männlicher Wissenschaftler einem männlichen Manager etwas über eine Technologie erzählte, die für die weibliche Anatomie bestimmt war. Ich holte tief Luft, um etwas zu sagen, überlegte es mir dann aber anders und wandte meine Aufmerksamkeit wieder dem Recyclingzentrum zu. Der Bagger hatte seine Arbeit beendet und war gerade dabei wegzufahren. Ich fragte mich, wie man wohl an einen Job als Baggerfahrer kam.
»Und was dich betrifft …« Schlagartig wurde ich mir meiner Umgebung bewußt, als wäre ich abrupt aus dem Schlaf gerissen worden. Mike hatte seine Aufmerksamkeit mir zugewandt, und alle verdrehten die Hälse, um ja nichts von dem bevorstehenden Fiasko zu verpassen. »Du mußt das in die Hand nehmen, Alice. In dieser Abteilung liegt einiges im argen.«
Sollte ich mir die Mühe machen, mit ihm zu diskutieren? Nein.
»Ja, Mike«, flötete ich in süßem Ton, gab ihm aber gleichzeitig durch ein Augenzwinkern zu verstehen, daß ich mich von ihm nicht einschüchtern ließ. Sein Gesicht lief rot an.
»Und kann irgend jemand dieses verdammte Licht reparieren?!« schrie er.
Ich blickte auf. Eine der Neonröhren flackerte leicht. Sobald man einmal darauf aufmerksam geworden war, hatte man das Gefühl, als würde einem jemand im Gehirn herumkratzen. Kratz, kratz, kratz.
»Ich mache das«, sagte ich. »Ich meine, ich sorge dafür, daß es gemacht wird.«
Ich saß an einem Bericht, den Mike Ende des Monats nach Pittsburgh schicken wollte. Mir blieb also noch eine Menge Zeit, so daß ich den Rest des Tages ruhig und ohne allzuviel Arbeit verbringen konnte. Eine wichtige halbe Stunde brauchte ich, um zwei Modekataloge durchzusehen. Ich entschied mich für ein Paar hübsche Stiefeletten, einen langen Samtrock, der als »unverzichtbar« beschrieben wurde, und einen kurzen taubenblauen Satinrock. Das würde mich hundertsiebenunddreißig Pfund tiefer in die roten Zahlen stürzen. Nach dem Mittagessen – mit einer netten Pressedame, deren Gesicht von rechteckigen, schwarzgerahmten Brillengläsern dominiert wurde – schloß ich mich in meinem Büro ein und setzte meine Kopfhörer auf.
»Je suis dans la salle de bains«, sagte eine übertrieben fröhliche Stimme in mein Ohr.
»Je suis dans la salle de bains«, wiederholte ich gehorsam.
»Je suis en haut!«
Was bedeutete en haut? Ich konnte mich nicht daran erinnern. »Je suis en haut«, sagte ich.
Das Klingeln des Telefons holte mich aus der sonnigen Welt der Lavendelfelder und Straßencafés zurück ins winterliche Londoner Hafenviertel. Es war Julie, die irgendein Problem mit der Wohnung hatte. Ich schlug ihr vor, mich mit ihr nach der Arbeit auf einen Drink zu treffen. Da sie bereits mit ein paar anderen Leuten verabredet war, rief ich Jake auf seinem Handy an und fragte ihn, ob er Lust habe, ebenfalls ins Vine zu kommen. Mein Arbeitstag war fast geschafft.
Als ich eintraf, sah ich Julie mit Clive an einem Ecktisch sitzen. Hinter ihrem Rücken rankten sich ein paar Kletterpflanzen die Wand hoch. Das Vine versuchte seinem Namen gerecht zu werden.
»Du siehst schrecklich aus«, sagte sie mitfühlend. »Verkatert?«
»Ich bin mir nicht sicher«, antwortete ich vorsichtig. »Auf jeden Fall könnte ich einen Antikatertrunk gebrauchen. Ich bestell’ euch auch einen.«
Clive war gerade dabeigewesen, Julie von einer Frau zu erzählen, die er am Vorabend auf einer Party kennengelernt hatte.
»Eine sehr interessante Frau«, sagte er. »Sie ist Physiotherapeutin. Ich habe ihr von meinem lädierten Ellbogen erzählt, ihr wißt ja …«
»Ja, wir wissen Bescheid.«
»Sie hat meinen Arm genommen und so einen Spezialgriff angewendet, und sofort tat er weniger weh. Ist das nicht erstaunlich?«
»Wie sieht sie aus?«
»Wie meinst du das?«
»Wie sieht sie aus?« fragte ich noch einmal.
Unsere Drinks kamen. Er nahm einen Schluck.
»Sie ist ziemlich groß«, antwortete er. »Größer als du. Sie hat braunes, etwa schulterlanges Haar. Sie sieht gut aus, hat eine gesunde Bräune und auffallend blaue Augen.«
»Kein Wunder, daß es deinem Ellbogen gleich besserging. Hast du sie gefragt, ob sie mit dir ausgehen will?«
Clive sah mich entrüstet, aber auch ein bißchen unsicher an. Er lockerte seine Krawatte.
»Natürlich nicht.«
»Aber du hättest es gern getan.«
»Man kann ein Mädchen nicht einfach fragen, ob es mit einem ausgehen will.«
»Klar kann man das«, mischte sich Sylvie ein. »Sie hat schließlich deinen Ellbogen berührt.«
»Und? Ich glaub’s einfach nicht! Sie hat als Physiotherapeutin meinen Ellbogen berührt, und daraus schließt du, daß sie auf mich scharf ist?«
»Nicht notwendigerweise«, entgegnete Sylvie affektiert. »Aber du solltest sie wenigstens fragen. Ruf sie an. Sie klingt interessant.«
»Natürlich war sie … attraktiv, aber es gibt da zwei Probleme: Das eine ist, wie ihr wißt, daß ich noch nicht das Gefühl habe, richtig über Christine hinweg zu sein. Und zweitens kann ich so etwas nicht. Ich brauche einen Vorwand.«
»Weißt du, wie sie heißt?« fragte ich.
»Gail. Gail Stevenson.«
Nachdenklich nippte ich an meiner Bloody Mary.
»Ruf sie an.«
Ein Anflug von Panik huschte über Clives Gesicht, was ziemlich komisch wirkte.
»Was soll ich sagen?«
»Es spielt keine Rolle, was du sagst. Wenn sie dich sympathisch gefunden hat – und die Tatsache, daß sie auf der Party deinen Ellbogen genommen hat, spricht dafür –, dann kannst du so ziemlich alles sagen, und sie wird trotzdem mit dir ausgehen. Falls sie dich wider Erwarten nicht sympathisch gefunden hat, wird sie sowieso nicht mit dir ausgehen, egal, was du sagst.« Clive wirkte verwirrt. »Ruf sie einfach an«, meinte ich. »Sag: ›Ich bin der Mensch mit dem lädierten Ellbogen, den Sie auf der Party kürzlich behandelt haben. Hätten Sie Lust, mal mit mir auszugehen?‹ Das gefällt ihr vielleicht.«
Clive sah mich entgeistert an.
»Einfach so?«
»Klar.«
»Wo soll ich mit ihr hingehen?«
Ich lachte.
»Was erwartest du von mir? Soll ich euch auch noch ein Zimmer besorgen?«
Ich holte uns noch eine Runde Drinks. Als ich zurückkam, hielt Sylvie gerade eine dramatische Rede und fuchtelte dabei theatralisch mit ihrer Zigarette herum. Ich war müde und hörte ihr nur mit halbem Ohr zu. Von dem Gespräch auf der anderen Seite des Tisches bekam ich ebenfalls nur Bruchstücke mit, aber allem Anschein nach erzählte Clive Julie gerade von der geheimen Bedeutung des Musters auf der Marlboro-Zigarettenschachtel. Ich fragte mich, ob er betrunken oder verrückt war. Jake war nicht in der Stadt. Er war unterwegs, um eine Baustelle zu inspizieren. Ein besonders schönes, von mehreren Religionen als heilig betrachtetes Fleckchen Erde sollte untertunnelt werden. Ich rechnete nicht damit, daß er es noch ins Pub schaffen würde. Da ich mich schon leicht benebelt fühlte, ließ ich mir mit dem Rest meines Drinks viel Zeit. Die Leute am Tisch gehörten alle zu unserer Clique, einer Gruppe von Leuten, die sich fast alle an der Uni kennengelernt und seitdem nie wieder aus den Augen verloren hatten, engen Kontakt pflegten und viel Zeit miteinander verbrachten. Sie waren eigentlich meine Familie.
Als ich zu Hause den Schlüssel ins Schloß steckte, öffnete mir Jake die Tür. Er hatte sich bereits umgezogen und trug Jeans und ein kariertes Hemd.
»Ich dachte, du würdest viel später kommen«, sagte ich.
»Das Problem hat sich erledigt«, antwortete er. »Ich koche dir gerade was zum Abendessen.«
Auf dem Tisch standen mehrere kleine Kartons. Paprikahuhn. Taramosalata. Pittabrot. Ein Miniaturkuchen. Ein Karton mit Sahne. Eine Flasche Wein. Ein Video. Ich küßte ihn.
»Eine Mikrowelle, ein Fernseher und du«, sagte ich. »Was will man mehr?«
»Und hinterher werde ich es die ganze Nacht mir dir treiben.«
»Was, schon wieder? Du Tunnelgräber, du!«
2. KAPITEL
Am nächsten Morgen war die U-Bahn voller als sonst. Mir war unter den vielen Schichten, die ich anhatte, ziemlich heiß, und ich versuchte mich abzulenken, indem ich über andere Dinge nachdachte, während der Zug durch die Dunkelheit ratterte. Mein Haar brauchte dringend einen neuen Schnitt. Vielleicht konnte ich für die Mittagspause einen Friseurtermin vereinbaren. Ich ging in Gedanken den Kühlschrank durch, ob für abends genug zu essen im Haus war oder ob wir uns etwas besorgen mußten. Vielleicht würden wir ja mal wieder tanzen gehen. Mir fiel ein, daß ich an diesem Morgen vergessen hatte, meine Pille einzunehmen, und das schleunigst nachholen mußte, sobald ich im Büro war. Dieses Versäumnis ließ mich auch an das IUP und die gestrige Besprechung denken, der ich es zu verdanken hatte, daß ich an diesem Morgen noch widerwilliger aufgestanden war als sonst.
Eine magere junge Frau mit einem dicken Baby quetschte sich durch den Zug. Da ihr niemand einen Platz anbot, blieb sie im Gang stehen, wo man vor lauter Gedränge sowieso nicht umfallen konnte. Das Baby auf ihrer knochigen Hüfte war so warm verpackt, daß man nur sein heißes, mißmutiges Gesicht sehen konnte. Wie zu erwarten, begann es bald zu weinen. Seine heiseren, langgezogenen Schreie ließen seine ohnehin schon geröteten Wangen dunkelrot anlaufen, aber seine Mutter achtete gar nicht darauf. Ihre bleiche Miene wirkte starr, als wäre sie völlig abwesend. Obwohl ihr Baby wie für eine Südpolexpedition angezogen war, trug sie selbst bloß ein dünnes Kleid und darüber einen offenen Anorak. Ich horchte in mich hinein, ob sich in mir so etwas wie ein Mutterinstinkt regte. Negativ. Dann ließ ich meinen Blick über all die korrekt gekleideten Männer und Frauen gleiten. Ich beugte mich zu einem Mann in einem edlen Kaschmirmantel hinunter, bis ich ihm nahe genug war, um seine Pickel zu sehen, und flüsterte dann leise in sein Ohr: »Entschuldigen Sie. Könnten Sie dieser Frau Ihren Platz überlassen?« Er sah mich verblüfft und abweisend an. »Sie braucht einen Sitzplatz.«
Er stand auf, und die junge Mutter kam mit schlurfenden Schritten herüber und zwängte sich zwischen zwei Guardians. Das Baby schrie weiter, und sie starrte immer noch geradeaus. Wenigstens konnte sich der Mann jetzt rühmen, eine gute Tat vollbracht zu haben.
Ich war froh, als ich endlich aussteigen konnte, auch wenn ich mich nicht auf den vor mir liegenden Arbeitstag freute. Sooft ich an meine Arbeit dachte, ergriff ein Gefühl der Lethargie von mir Besitz, als wären all meine Glieder plötzlich zentnerschwer und die Kammern meines Gehirns verstaubt. Die Straßen waren eisig, und mein Atem stieg in Ringen in die Luft. Ich wickelte mir den Schal fester um den Hals. Ich hätte einen Hut aufsetzen sollen. Vielleicht konnte ich mich in einer Kaffeepause kurz davonstehlen und mir Stiefel kaufen. Rund um mich herum eilten die Leute mit gesenktem Kopf in ihr jeweiliges Büro. Vielleicht sollten Jake und ich im Februar mal wegfahren, irgendwohin, wo es heiß und einsam war. Mir war jeder Ort recht, solange es sich nicht um London handelte. Vor meinem geistigen Auge sah ich mich schlank und gebräunt im Bikini an einem weißen Sandstrand liegen, über mir nur blauen Himmel. Ich hatte zuviel Werbung gesehen. Normalerweise trug ich nur Einteiler. Außerdem hatte Jake mir erst kürzlich ins Gewissen geredet, mehr zu sparen.
Am Zebrastreifen blieb ich stehen. Ein Lastwagen donnerte vorbei. Ich erhaschte einen Blick auf den Mann, der hoch oben in seinem Fahrerhaus saß, ohne die Leute wahrzunehmen, die unten auf der Straße ihrer Arbeit entgegentrotteten. Der nächste Wagen kam mit quietschenden Bremsen zum Stehen. Ich trat auf den Zebrastreifen hinaus.
Ein Mann überquerte die Straße von der gegenüberliegenden Seite. Ich registrierte, daß er schwarze Jeans und eine schwarze Lederjacke trug. Dann wanderte mein Blick hinauf zu seinem Gesicht. Ich weiß nicht, wer zuerst stehenblieb, er oder ich. Wir standen beide auf der Straße und starrten uns an. Ich glaube, ich hörte jemanden hupen. Ich konnte mich nicht von der Stelle bewegen. Das Ganze schien eine Ewigkeit zu dauern, aber wahrscheinlich war es nur eine Sekunde. Ich spürte ein leeres Gefühl im Magen und bekam nicht richtig Luft. Wieder hörte ich ein Auto hupen. Eine Stimme rief irgend etwas. Seine Augen waren stechend blau. Wir setzten uns beide wieder in Bewegung. Als wir aneinander vorübergingen, waren wir nur Zentimeter voneinander entfernt und konnten den Blick nicht abwenden. Wenn er die Hand ausgestreckt und mich berührt hätte, wäre ich ihm wahrscheinlich gefolgt, aber er berührte mich nicht, und ich erreichte die andere Straßenseite allein.
Ich ging ein paar Schritte auf das Gebäude zu, in dem die Drakon-Büros untergebracht waren, blieb dann aber stehen und wandte den Kopf. Er war noch da und beobachtete mich. Statt zu lächeln oder sonst eine Geste zu machen, sah er mich einfach nur an. Es kostete mich große Anstrengung, mich wieder abzuwenden. Ich hatte das Gefühl, als würde er mich mit seinem Blick zu sich ziehen. Als ich die Türen des Drakon-Gebäudes erreichte, drehte ich mich ein letztes Mal um. Der Mann mit den blauen Augen war verschwunden. Das war’s.
Ich ging sofort auf die Toilette, schloß mich in eine Kabine ein und lehnte mich gegen die Tür. Mir war schwindlig, meine Knie zitterten, und meine Augen kamen mir seltsam schwer vor, als wären sie voller ungeweinter Tränen. Vielleicht brütete ich eine Erkältung aus. Vielleicht war meine Periode überfällig. Ich dachte an den Mann und die Art, wie er mich angestarrt hatte. Dann schloß ich die Augen, als könnte ich ihn auf diese Weise irgendwie aussperren. Eine andere Frau kam in den Raum und drehte den Wasserhahn auf. Ich stand so still und reglos da, daß ich unter meiner Bluse mein Herz klopfen hörte. Ich legte eine Hand auf meine brennende Wange, dann auf meine Brust.
Nach ein paar Minuten konnte ich wieder richtig atmen. Ich wusch mir das Gesicht mit kaltem Wasser, kämmte mein Haar und dachte sogar daran, eine winzige Pille aus ihrem Folienkalender zu drücken und hinunterzuschlucken. Der seltsame Schmerz in meinem Magen ließ allmählich nach, und ich fühlte mich bloß noch schwach und nervös. Gott sei Dank hatte niemand etwas mitbekommen. Ich holte mir am Automaten im zweiten Stock einen Kaffee und einen Schokoriegel, weil ich plötzlich schrecklich hungrig war. Dann ging ich in mein Büro. Dort riß ich das Papier von der Schokolade und verschlang sie in großen Bissen. Mein Arbeitstag begann. Ich las meine Post, warf einen Großteil davon in den Papierkorb, schrieb ein Memo an Mike und rief dann Jake in der Arbeit an.
»Wie läuft dein Tag?« fragte ich.
»Er hat gerade erst angefangen.«
Mir kam es vor, als wären schon Stunden vergangen, seit ich von zu Hause aufgebrochen war. Wenn ich mich zurückgelehnt und die Augen geschlossen hätte, hätte ich stundenlang schlafen können.
»Gestern nacht war es schön«, sagte er mit leiser Stimme. Wahrscheinlich war er nicht allein im Raum.
»Mmm. Obwohl ich mich heute morgen ein bißchen seltsam gefühlt habe.«
»Geht es dir jetzt wieder besser?« Er klang besorgt. Ich bin sonst nie krank.
»Ja. Bestens. Wunderbar. Geht es dir auch gut?«
Mir war der Gesprächsstoff ausgegangen, aber ich wollte trotzdem noch nicht auflegen. Jake klang plötzlich beschäftigt. Ich hörte ihn mit jemand anderem reden, konnte aber nicht verstehen, was er sagte.
»Ja, Liebes. Hör zu, ich muß jetzt aufhören. Bis später.«
Der Morgen verging. Ich nahm an einer weiteren Besprechung teil, diesmal mit der Marketingabteilung, und brachte es fertig, einen Krug Wasser über den Tisch zu verschütten und kein Wort von mir zu geben. Anschließend ging ich die Forschungsunterlagen durch, die Giovanna mir per E-Mail geschickt hatte. Sie wollte um halb vier bei mir vorbeischauen. Ich rief bei meinem Friseur an und vereinbarte für ein Uhr einen Termin. Ich trank eine Menge bitteren, lauwarmen Kaffee aus Kunststoffbechern. Ich goß die Blumen in meinem Büro. Ich lernte, »Je voudrais quatre petits pains« und »Ça fait combien?« zu sagen.
Kurz vor eins nahm ich meinen Mantel, legte meiner Assistentin einen Zettel hin, daß ich etwa eine Stunde weg sein würde, und polterte die Treppe hinunter und auf die Straße hinaus. Es fing gerade zu nieseln an, und ich hatte keinen Schirm dabei. Ich sah zu den Wolken hinauf, zuckte mit den Achseln und ging los, um mir in der Cardamom Street ein Taxi zu nehmen. Nach ein paar Schritten blieb ich wie angewurzelt stehen. Die Welt verschwamm vor meinen Augen. Mein Magen machte einen Satz. Ich hatte das Gefühl, als müßte ich mich zusammenkrümmen.
Da stand er, nur wenige Schritte von mir entfernt. Als hätte er sich seit dem Morgen nicht von der Stelle bewegt. Er trug noch seine schwarze Jacke und Jeans. Auch jetzt lächelte er nicht, sondern stand einfach nur da und sah mich an. Es kam mir vor, als hätte mich noch nie zuvor jemand richtig angesehen, und plötzlich wurde mir mein Körper auf eine besonders intensive Weise bewußt – das Pochen meines Herzes, das Heben und Senken meiner Brust beim Atmen, die Oberfläche meines Körpers, die vor Panik und Aufregung prickelte.
Er war etwa so alt wie ich, Anfang Dreißig. Ich glaube, mit seinen blaßblauen Augen, seinem wirren braunen Haar und seinen hohen, flachen Wangenknochen war er als schön zu bezeichnen, aber damals wußte ich nur, daß er mich mit seinen Augen derart fixierte, daß ich das Gefühl hatte, von seinem Blick festgehalten zu werden. Ich hörte mich nach Luft schnappen, konnte aber weder weitergehen noch mich von ihm abwenden.
Ich weiß nicht, wer den ersten Schritt machte. Vielleicht stolperte ich auf ihn zu, oder vielleicht wartete ich einfach auf ihn. Als wir uns schließlich gegenüberstanden, ohne uns zu berühren, sagte er mit leiser Stimme:
»Ich habe auf dich gewartet.«
Ich hätte laut loslachen sollen. Das war nicht ich, so etwas konnte unmöglich mir passieren. Ich war doch nur Alice Loudon, unterwegs, mir an einem feuchtkalten Januartag die Haare schneiden zu lassen. Aber ich konnte weder lachen noch lächeln. Ich konnte ihn bloß ansehen, seine weit auseinanderstehenden blauen Augen, seinen leicht geöffneten Mund, die zarten Lippen. Seine Zähne waren weiß und ebenmäßig, mit Ausnahme eines Schneidezahns, bei dem ein Stück abgebrochen war. Sein Kinn war voller Bartstoppeln. Am Hals hatte er einen Kratzer. Sein Haar war lang und ungekämmt. O ja, er war schön. Am liebsten hätte ich die Hand ausgestreckt und seinen Mund ganz sanft mit dem Daumen berührt. Ich wollte das Kratzen seiner Bartstoppeln an meinem Hals spüren. Ich versuchte etwas zu sagen, aber alles, was ich herausbrachte, war ein ersticktes, gekünsteltes »Oh«.
»Bitte«, sagte er, ohne den Blick von mir abzuwenden. »Kommst du mit?«
Er konnte ein Straßenräuber sein, ein Vergewaltiger, ein Psychopath. Ich nickte wie betäubt, und er trat auf die Straße hinaus und winkte ein Taxi herbei. Er hielt mir die Tür auf, berührte mich aber noch immer nicht. Als wir beide im Wagen saßen, nannte er dem Fahrer eine Adresse und drehte sich dann zu mir um. Ich sah, daß er unter seiner Lederjacke nur ein dunkelgrünes T-Shirt trug. Er hatte ein Lederband um den Hals, an dem eine kleine silberne Spirale hing. Ich betrachtete seine langen Finger mit den gepflegten, sauberen Nägeln. Am linken Daumen hatte er eine weiße, wellige Narbe. Seine Hände sahen aus, als könnten sie zupacken, stark und gefährlich.
»Sagst du mir deinen Namen?«
»Alice«, antwortete ich.
»Alice«, wiederholte er. »Alice.« So, wie er es sagte, klang das Wort fremd in meinen Ohren. Er hob die Hände und lockerte mit einer ganz sanften Bewegung meinen Schal, achtete dabei aber darauf, ja nicht meine Haut zu berühren. Er roch nach Seife und Schweiß.
Das Taxi hielt an. Ein Blick aus dem Wagenfenster sagte mir, daß wir in Soho waren. Ich sah einen Schreibwarenladen, ein Feinkostgeschäft, Restaurants. Der Geruch von Kaffee und Knoblauch lag in der Luft. Er stieg aus und hielt mir wieder die Tür auf. Ich spürte, wie das Blut in meinem Körper pulsierte. Er lehnte sich gegen eine schäbige Tür neben einem Bekleidungsgeschäft, und ich folgte ihm eine schmale Treppe hinauf. Er zog einen Schlüsselbund aus der Tasche und sperrte zwei Schlösser auf. Hinter der Tür lag nicht bloß ein Zimmer, sondern eine kleine Wohnung. Mein Blick fiel auf ein Regal, Bücher, Bilder, einen Teppich. Zögernd blieb ich an der Schwelle stehen. Das war meine letzte Chance. Durch die Fenster drang Straßenlärm herein, das Gewirr von Stimmen, das Brummen der Autos. Er schloß die Tür und verriegelte sie von innen.
Ich hätte Angst haben sollen und hatte sie auch, aber nicht vor ihm, diesem Fremden, sondern vor mir selbst. Ich erkannte mich nicht wieder. Ich verging vor Verlangen, als würden sich die Umrisse meines Körpers langsam auflösen. Ich wollte meinen Mantel ausziehen, machte mich mit ungeschickten Händen an den Samtknöpfen zu schaffen.
»Warte«, sagte er. »Laß mich das tun.«
Zuerst nahm er mir den Schal ab und hängte ihn behutsam über den Kleiderständer. Als nächstes zog er mir langsam den Mantel aus. Dann kniete er sich auf den Boden und streifte mir die Schuhe ab. Ich stützte eine Hand auf seine Schulter, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Er stand wieder auf und begann, meine Strickjacke aufzuknöpfen. Ich sah, daß seine Hände leicht zitterten. Nachdem er mir die Jacke ausgezogen hatte, öffnete er den Reißverschluß meines Rocks. Beim Herabziehen kratzte der Stoff über meine Strumpfhose. Dann rollte er die Strumpfhose herunter und legte sie neben meine Schuhe. Noch immer vermied er jede Berührung meiner Haut. Als letztes zog er mir mein Unterhemd und meinen Slip aus. Nackt und leicht schaudernd stand ich in dem fremden Raum.
»Alice«, sagte er. Es hörte sich fast wie ein Stöhnen an. »O Gott, wie schön du bist, Alice!«
Ich zog ihm die Jacke aus. Seine Arme waren muskulös und gebräunt; von seinem linken Ellbogen bis zum Handgelenk verlief eine weitere lange, wellige Narbe. Ich folgte seinem Beispiel und kniete mich auf den Boden, um ihm Schuhe und Socken auszuziehen. Am rechten Fuß hatte er nur noch drei Zehen. Ich beugte mich hinunter und küßte die Stelle, an der die anderen beiden gewesen waren. Er seufzte leise. Ich zog ihm das Shirt aus der Jeans, und er hob wie ein kleiner Junge die Arme, als ich es ihm über den Kopf streifte. Er hatte einen flachen Bauch, über den eine schmale Haarspur nach unten verlief. Ich öffnete den Reißverschluß seiner Jeans und manövrierte sie vorsichtig über seinen Po. Seine Beine waren sehnig und sehr braun. Ich zog ihm den Slip aus und ließ ihn zu Boden fallen. Jemand stöhnte, aber ich weiß nicht, wer es war, er oder ich. Er schob eine Strähne meines Haars hinter mein Ohr. Dann fuhr er mit dem Zeigefinger ganz langsam meine Lippen entlang. Ich schloß die Augen.
»Nein«, sagte er. »Sieh mich an.«
»Bitte«, sagte ich. »Bitte.«
Er nahm mir die Ohrringe ab und ließ sie fallen. Ich hörte sie auf dem Holzboden klirren.
»Küß mich, Alice!« sagte er.
So etwas war mir noch nie passiert. Sex war für mich noch nie so gewesen. Es hatte in meinem Leben mittelmäßigen Sex gegeben, peinlichen Sex, schmutzigen Sex, guten Sex, großartigen Sex. Das hier hatte mehr von vernichtendem Sex. Wir krachten ineinander, versuchten die trennende Barriere aus Haut und Fleisch zu überwinden. Wir klammerten uns aneinander, als würden wir ertrinken. Wir kosteten einander, als wären wir völlig ausgehungert. Und die ganze Zeit sah er mich an. Er sah mich an, als wäre ich das Schönste, was er je gesehen hätte, und während ich auf dem harten, staubigen Boden lag, fühlte ich mich tatsächlich schön – schön, schamlos und ziemlich am Ende.
Hinterher zog er mich vom Boden hoch und führte mich in die Dusche. Er seifte meine Brüste ein und wusch mich zwischen den Beinen. Er wusch mir die Füße und Beine. Er wusch mir sogar das Haar, wobei er das Shampoo gekonnt einmassierte und meinen Kopf nach hinten neigte, damit mir nichts in die Augen lief. Dann trocknete er mich ab, wobei er darauf achtete, daß ich auch unter den Armen und zwischen den Zehen richtig trocken war, und während er dies tat, erforschte er meinen Körper. Ich fühlte mich wie ein Kunstwerk, aber auch wie eine Prostituierte.
»Ich muß zurück in die Arbeit«, sagte ich schließlich. Er hob meine Sachen vom Boden auf und zog mich an, steckte die Ohrringe wieder durch meine Ohrläppchen und bürstete mir das nasse Haar aus dem Gesicht.
»Wann hast du Schluß?« fragte er. Ich dachte an Jake, der zu Hause auf mich wartete.
»Um sechs.«
»Ich werde da sein«, sagte er. Ich hätte ihm antworten sollen, daß ich einen Partner hatte, ein Zuhause, ein ganzes anderes Leben. Statt dessen zog ich sein Gesicht zu mir heran und küßte seine wunden Lippen. Ich konnte mich kaum von ihm losreißen.
Als ich schließlich im Taxi saß, stellte ich ihn mir vor, dachte an seine Berührungen, seinen Geschmack, seinen Geruch. Ich wußte nicht mal seinen Namen.
3. KAPITEL
Völlig außer Atem traf ich wieder in der Arbeit ein. Ich griff nach ein paar Nachrichten, die mir Claudia entgegenstreckte, und eilte in mein Büro. Rasch sah ich sie durch. Nichts, was nicht warten konnte. Draußen begann es schon zu dämmern, und ich versuchte, im Fenster einen Blick auf mein Spiegelbild zu erhaschen. Ich hatte ein ungutes Gefühl wegen meiner Kleidung. Die Sachen fühlten sich irgendwie fremd an, weil sie mir von einem Fremden aus- und wieder angezogen worden waren. Ich hatte Angst, daß das für die anderen genauso offensichtlich war wie für mich. Hatte er meine Bluse richtig zugeknöpft? Oder hatte er mir meine Sachen womöglich in der falschen Reihenfolge angezogen? Es schien alles in Ordnung zu sein, aber ich war mir nicht sicher. Ich eilte mit meinem Schminkzeug auf die Toilette. In dem unbarmherzigen Licht vor dem Spiegel überprüfte ich, ob ich geschwollene Lippen hatte oder sonst irgendwie lädiert wirkte. Das meiste ließ sich mit Lippenstift und Eyeliner kaschieren. Meine Hand zitterte. Erst nachdem ich sie ein paarmal gegen ein Waschbecken geschlagen hatte, wurde sie ruhiger.
Ich rief Jake auf seinem Handy an. Er klang sehr beschäftigt. Ich erklärte ihm, daß ich in eine Besprechung müsse und eventuell später nach Hause käme. Wie spät? Das wisse ich nicht, gab ich ihm zur Antwort, das lasse sich überhaupt nicht vorhersagen. Würde ich es bis zum Abendessen schaffen? Ich riet ihm, ohne mich anzufangen. Nachdem ich aufgelegt hatte, beruhigte ich mich damit, daß das eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen sei. Wahrscheinlich würde ich vor Jake zu Hause sein. Dann setzte ich mich hin und dachte über das nach, was geschehen war. Ich rief mir sein Gesicht ins Gedächtnis. Ich schnupperte an meinem Handgelenk und roch die Seife. Seine Seife. Schaudernd schloß ich die Augen. Ich konnte wieder die Fliesen unter meinen Füßen spüren und das Wasser gegen den Duschvorhang prasseln hören. Seine Hände. Wie würde es nun weitergehen? Wie sollte es weitergehen? Ich kannte weder seinen Namen noch seine Adresse. Ich war mir nicht sicher, ob ich seine Wohnung wiederfinden würde, selbst wenn ich es wollte. Falls ich also um sechs aus dem Gebäude trat und er nicht da war, hatte die Sache damit sowieso ein Ende. Sollte er aber da sein, würde ich ihm genau das in aller Deutlichkeit sagen müssen: daß die Sache ein Ende haben mußte. Das Ganze war Wahnsinn, und wir taten am besten so, als wäre es nie passiert. Das war die einzig vernünftige Lösung.
Bei meiner Rückkehr ins Büro hatte ich mich wie betäubt gefühlt, aber nun war mein Kopf so klar wie schon lange nicht mehr, und ich verspürte neue Energie. Während der nächsten Stunde führte ich eine kurze Unterhaltung mit Giovanna und erledigte dann ein Dutzend Telefonate, ohne mich mit Smalltalk aufzuhalten. Ich rief verschiedene Leute an, vereinbarte Termine, erkundigte mich nach Zahlen. Sylvie rief mich auf einen Plausch an, aber ich erklärte ihr, daß ich mich am nächsten oder übernächsten Tag mit ihr treffen würde. Ob ich abends schon etwas vorhätte? Ja. Eine Besprechung. Ich verschickte ein paar Nachrichten und arbeitete die Akten auf meinem Schreibtisch durch. Eines Tages würde ich gar keinen Schreibtisch mehr haben, aber doppelt soviel schaffen.
Ich sah zur Uhr hinüber. Fünf vor sechs. Ich kramte gerade nach meiner Tasche, als Mike hereinkam. Bei ihm stand am nächsten Morgen noch vor dem Frühstück eine Konferenzschaltung auf dem Programm, und er wollte noch ein paar Dinge mit mir durchgehen.
»Ich bin heute ein bißchen im Streß, Mike. Ich muß zu einer Besprechung.«
»Mit wem?«
Einen Moment lang überlegte ich, ob ich behaupten sollte, daß ich mich mit jemandem aus dem Labor träfe, aber ein Aufflackern von Überlebensinstinkt hielt mich davon ab.
»Es ist etwas Privates.«
Er zog eine Augenbraue hoch.
»Ein Vorstellungsgespräch?«
»In diesem Aufzug?«
»Du wirkst tatsächlich ein bißchen verknittert.« Er fragte nicht weiter nach. Wahrscheinlich nahm er an, daß es sich um eine Frauensache handelte, irgend etwas Gynäkologisches. Aber er ging auch nicht wieder. »Es dauert bloß eine Sekunde.« Er ließ sich mit seinen Unterlagen, die er Punkt für Punkt durchgehen wollte, nieder. Eine oder zwei Sachen mußte ich überprüfen und wegen einer dritten jemanden anrufen. Ich schwor mir selbst, kein einziges Mal auf die Uhr zu sehen. Es spielte sowieso keine Rolle. Schließlich ergab sich eine Pause, und ich sagte, daß ich nun aber wirklich gehen müsse. Mike nickte. Ich warf einen Blick auf meine Armbanduhr. Vierundzwanzig Minuten nach sechs. Fünfundzwanzig. Ich beeilte mich nicht, nicht einmal, nachdem Mike weg war. Auf dem Weg zum Aufzug durchströmte mich ein Gefühl der Erleichterung, weil sich das Problem von selbst gelöst hatte. Es war am besten so. Ich mußte das Ganze möglichst schnell vergessen.
Ich lag schräg auf dem Bett. Mein Kopf ruhte auf Adams Bauch. Er hieß Adam. Das hatte er mir auf der Herfahrt im Taxi erzählt. Sonst hatte er fast nichts gesagt. Mir lief der Schweiß übers Gesicht. Ich schwitzte am ganzen Körper: am Rücken genauso wie an den Beinen. Sogar mein Haar war naß. Und ich spürte den Schweiß auf seiner Haut. In seiner Wohnung war es so heiß. Wie konnte es im Januar überhaupt irgendwo so heiß sein? Der kalkige Geschmack in meinem Mund wollte nicht vergehen. Ich setzte mich auf und sah ihn an. Seine Augen waren halb geschlossen.
»Ist irgendwas zu trinken da?« fragte ich.
»Ich weiß es nicht«, antwortete er schläfrig. »Warum siehst du nicht einfach nach?«
Ich stand auf und hielt nach etwas Ausschau, das ich mir um den Körper wickeln konnte, aber dann dachte ich: Warum eigentlich? Es war eine sehr kleine Wohnung. Neben diesem Raum, in dem sich außer dem Bett fast keine anderen Möbel befanden, gab es nur noch das Bad, wo ich an diesem Tag bereits geduscht hatte, und eine winzige Küche. Ich öffnete den Kühlschrank. Ein paar halb ausgedrückte Tuben, ein paar Gläser, ein Karton Milch. Keine anderen Getränke. Inzwischen war mir kalt. Auf einem Regal entdeckte ich einen Karton Orangensaft. Verdünnten Orangensaft hatte ich zum letztenmal als Kind getrunken. Ich fand ein Glas, mischte ein wenig Saft mit Wasser und trank in großen Schlucken. Dann schenkte ich mir noch einmal ein Glas ein und nahm es mit zurück ins Schlaf- oder Wohnzimmer – was immer es war. Adam saß inzwischen gegen das Kopfteil des Bettes gelehnt. Offenbar hatte er die ganze Zeit auf die Tür gestarrt und auf mich gewartet. Er lächelte nicht, sondern starrte bloß auf meinen nackten Körper, als müßte er ihn sich einprägen. Ich lächelte ihn an, aber er erwiderte mein Lächeln nicht. Ein Gefühl tiefer Freude stieg in mir auf.
Ich ging zu Adam und hielt ihm das Glas hin. Er nahm einen kleinen Schluck und gab mir das Glas zurück. Ich nahm ebenfalls einen kleinen Schluck und hielt es ihm von neuem hin. Nachdem wir das Glas auf diese Weise gemeinsam geleert hatten, lehnte er sich über mich und stellte das Glas neben dem Bett ab. Die Bettdecke war auf den Boden gerutscht. Ich zog sie hoch und deckte uns damit zu. Dann ließ ich den Blick durch den Raum schweifen. Die Fotos auf der Kommode und dem Kaminsims waren lauter Landschaftsaufnahmen. Im Regal standen ein paar Bücher, deren Titel ich nacheinander studierte: mehrere Kochbücher, ein großer Kunstband über Hogarth, die gesammelten Werke von W. H. Auden und Sylvia Plath. Eine Bibel. Sturmhöhe, ein paar Reiseberichte von D. H. Lawrence. Zwei Bände über britische Feldblumen. Ein Band über Touren durch und um London. Ein Stapel Reiseführer. An einer Kleiderstange hingen ein paar Klamotten, ein paar andere lagen ordentlich zusammengefaltet auf dem Korbstuhl neben dem Bett: Jeans, ein Seidenhemd, eine weitere Lederjacke, T-Shirts.
»Ich versuche gerade herauszufinden, wer du bist«, sagte ich. »Indem ich mir deine Sachen ansehe.«
»Nichts davon gehört mir. Das ist die Wohnung eines Freundes.«
»Oh.«
Ich drehte mich zu ihm um. Er lächelte noch immer nicht. Allmählich fand ich das beunruhigend. Ich wollte gerade wieder etwas sagen, als er plötzlich doch ein wenig den Mund verzog, den Kopf schüttelte und mit einem Finger meine Lippen berührte. Wir lagen ohnehin schon ganz nah beieinander, aber er kam noch ein paar Zentimeter näher und küßte mich.
»Was denkst du gerade?« fragte ich, während ich mit den Fingern durch sein weiches, langes Haar fuhr. »Rede mit mir. Erzähl mir von dir.«
Er antwortete nicht sofort. Statt dessen zog er die Bettdecke von meinem Körper und drehte mich auf den Rücken. Dann nahm er meine Hände und drückte sie über meinem Kopf auf das Laken, als wollte er sie dort fixieren. Ich fühlte mich, als läge ich auf dem Objektträger eines Mikroskops. Sanft berührte er meine Stirn und ließ seine Finger dann über mein Gesicht und meinen Hals bis zu meinem Bauch gleiten, wo sie in meinem Nabel haltmachten. Schaudernd schüttelte ich sie ab.
»Entschuldige«, sagte ich.
Er beugte sich über mich und berührte meinen Nabel mit der Zunge.
»Ich mußte gerade daran denken«, sagte er, »daß das Haar unter deinen Armen genauso ist wie dein Schamhaar. Aber nicht so wie das wunderschöne Haar auf deinem Kopf. Und ich mußte daran denken, daß ich deinen Geschmack mag. Ich meine, alle deine unterschiedlichen Geschmacksnuancen. Am liebsten würde ich dich von oben bis unten ablecken.« Er ließ den Blick über meinen Körper gleiten, als wäre ich eine Landschaft.
Ich kicherte, und er sah mir in die Augen. »Warum lachst du?« fragte er mit einem Blick, der fast ein wenig panisch wirkte.
Ich lächelte ihn an.
»Ich finde, du behandelst mich wie ein Sexobjekt.«
»Nicht!« sagte er. »Mach keine Witze darüber.«
Ich spürte, wie mir die Röte ins Gesicht stieg. Oder wurde mein ganzer Körper rot?
»Entschuldige«, sagte ich. »Das war nicht meine Absicht. Es gefällt mir ja. Mir wird ganz schwindlig davon.«
»Was denkst du gerade?«
»Leg du dich erst mal zurück«, antwortete ich, und er gehorchte. »Und schließ die Augen.« Ich ließ meine Finger über seinen Körper gleiten, der nach Sex und Schweiß roch. »Was ich denke? Ich denke, daß ich total verrückt bin und selbst nicht weiß, was ich hier eigentlich tue, aber es war …« Ich hielt inne. Mir fehlten die Worte, um den Sex mit ihm zu beschreiben. Allein der Gedanke daran löste kleine Wellen der Lust in meinem Körper aus. Mein Verlangen nach ihm regte sich schon wieder. Mein Körper fühlte sich weich und neu an, völlig offen für ihn. Ich ließ meine Finger über die samtige Haut an der Innenseite seines Oberschenkels gleiten. Was dachte ich noch? Ich mußte mich zwingen, mich zu konzentrieren. »Außerdem denke ich … ich denke daran, daß ich einen Freund habe. Mehr als einen Freund. Ich lebe mit jemandem zusammen.«
Ich weiß nicht, womit ich gerechnet hatte. Vielleicht mit Wut oder ausweichendem Verhalten. Adam blieb ganz still. Er öffnete nicht mal die Augen.
»Aber du bist hier«, war alles, was er sagte.
»Ja«, antwortete ich. »Gott, das bin ich.«
Wir lagen noch lange Zeit so nebeneinander. Eine Stunde, zwei Stunden. Jake sagt immer, daß ich mich nicht entspannen, daß ich weder stillhalten noch den Mund halten kann. Jetzt redeten wir kaum ein Wort. Wir berührten uns. Ruhten uns aus. Sahen uns an. Ich lag da und lauschte den Stimmen und Motorengeräuschen unten auf der Straße. Mein Körper fühlte sich unter seinen Händen dünner an als sonst, als hätte er mich von überflüssigen Schichten befreit. Schließlich sagte ich ihm, daß ich gehen müsse. Ich duschte und zog mich vor seinen Augen an. Sein Blick ließ mich schaudern.
»Gib mir deine Telefonnummer«, sagte er.
Ich schüttelte den Kopf.
»Gib du mir deine.«
Ich beugte mich über ihn und küßte ihn sanft. Er nahm meine Hand und zog meinen Kopf zu sich hinunter. Ich spürte in meiner Brust einen Schmerz, der mir den Atem raubte, aber ich befreite mich aus Adams Arm.
»Ich muß gehen«, flüsterte ich.
Es war nach Mitternacht. Als ich die Wohnung aufsperrte, war alles dunkel. Jake war schon ins Bett gegangen. Auf Zehenspitzen schlich ich ins Schlafzimmer. Ich warf meinen Slip und meine Strumpfhose in den Wäschebeutel. Dann duschte ich zum zweitenmal innerhalb einer Stunde. Zum viertenmal an diesem Tag. Ich seifte mich mit meiner eigenen Seife ein. Wusch mir das Haar mit meinem eigenen Shampoo. Anschließend kroch ich zu Jake ins Bett. Er drehte sich zu mir um und murmelte etwas.
»Ich dich auch«, sagte ich.
4. KAPITEL
J