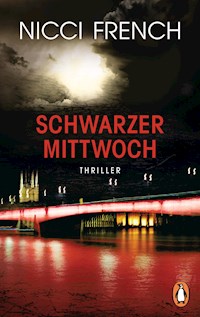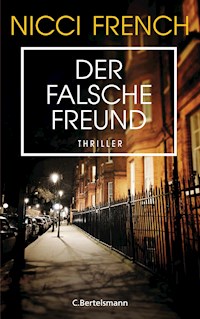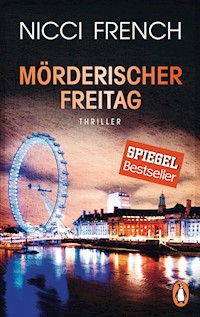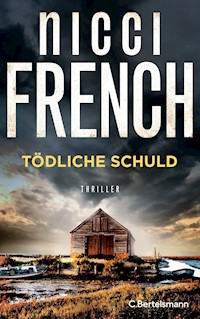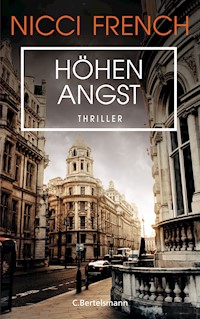9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Psychologin Frieda Klein als Ermittlerin
- Sprache: Deutsch
Das fulminante Finale der SPIEGEL-Bestsellerserie
Frieda Klein ist untergetaucht und nicht einmal ihre engsten Freunde wissen, wo sie steckt. Aber sie hat nicht mit der Hartnäckigkeit der Studentin Lola gerechnet, die eine Studie über Friedas Polizeiarbeit schreiben will. Nun wird sie die junge Frau nicht mehr los, und sie ahnt, dass sie sich beide in Lebensgefahr befinden. Denn Friedas alter Widersacher Dean Reeves ist ihnen unbarmherzig auf der Spur. Als bald darauf eine Mordserie die Londoner Öffentlichkeit erschüttert, steht für Frieda fest, dass nur Reeves hinter den Taten stecken kann. Und sie spürt, das Finale um Leben oder Tod steht kurz bevor ...
»Spannender kann man ein Finale kaum gestalten. ›Der achte Tag‹ ist Frieda Klein in Bestform, großartig [...].« SR 3 ›Krimitipp‹
»›Der achte Tag‹ ist das große Finale der Krimireihe um Frieda Klein. Die mysteriöse, kratzbürstige Frau ist eine der interessantesten Serienfiguren, die das Genre überhaupt zu bieten hat. Ein grandioses Serienfinale.« WDR 5 ›Bücher‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Frieda Klein ist abgetaucht, nicht einmal die engsten Freunde kennen ihren Unterschlupf. Nur eine junge Frau gibt nicht auf: die Studentin Lola Hayes, die sich ausgerechnet die umstrittene Psychologin und ihre spektakulären Fälle als Arbeitsthema ausgesucht hat. Lola wird fündig, aber sie riskiert ihr Leben. Denn Friedas alter Widersacher Dean Reeves ist den beiden Frauen unbarmherzig auf der Spur. Bald erschüttert eine Mordserie die Londoner Öffentlichkeit. Die Polizei tappt im Dunkeln, Frieda und Lola sind auf einer atemlosen Odyssee. Doch Frieda spürt, das Finale – Leben oder Tod – steht bevor …
Autoren
Nicci French – hinter diesem Namen verbirgt sich das Ehepaar Nicci Gerrard und Sean French. Seit über 20 Jahren sorgen sie mit ihren außergewöhnlichen Psychothrillern international für Furore und verkauften weltweit über 8 Mio. Exemplare. Die beiden leben in Südengland. »Der achte Tag« ist das Finale der achtteiligen Thrillerserie um Frieda Klein.
NICCI FRENCH
DER ACHTE TAG
PSYCHOTHRILLER
Aus dem Englischenvon Birgit Moosmüller
C. Bertelsmann
Für Edgar, Anna, Hadley und Molly
1
Es war ein schöner, warmer Montagmorgen – zu warm für den Spätherbst –, und Charlotte Beck würde gleich die einzige wirklich dramatische Erfahrung ihres Lebens machen. Bereit war sie dafür nicht. Im Grunde fühlte sie sich für gar nichts bereit.
Sie lotste gerade eine chaotische kleine Gruppe die Heath Street entlang, wie sie es jeden Wochentag tat. Während sie den Kinderwagen mit der zehn Monate alten Lulu lenkte, schob sich zu ihrer Linken der zweieinhalbjährige Oscar auf einem kleinen Roller voran. Um Charlottes rechtes Handgelenk war eine Hundeleine geschlungen, und am anderen Ende der Leine hing ein schwarzer Labradorwelpe namens Suki. Alles erschien Charlotte wie in Dunst gehüllt, doch es war kein wirklicher Dunst, sondern der bleierne Nebel der Erschöpfung, der seit einem halben Jahr beharrlich über ihrer Welt hing. Lulu schlief nachts nicht, sondern schrie und kreischte. Egal, was Charlotte ausprobierte, egal, welche Expertenratschläge sie befolgte, nichts half.
Stattdessen schlief Lulu tagsüber. Auch jetzt schlummerte sie zufrieden in ihrem Kinderwagen, warm verpackt unter einer Decke, einen Schnuller im Mund. Hin und wieder beugte Charlotte sich mit prüfendem Blick über sie. Lulu wirkte friedlich wie ein Engel. Es war kaum zu glauben, dass dieses glatte kleine Gesicht mit den langen Wimpern und rosigen Wangen einer erwachsenen Frau derartig zusetzen konnte. Charlotte fühlte sich so müde, dass es wehtat. Ihre Augen brannten, ihre Haut spannte, ihre Gelenke schmerzten. Sie war doch erst einunddreißig. Das konnte noch keine Arthritis sein, oder? Machte Schlafmangel die Knochen kaputt? Es fühlte sich danach an.
Während ihre kleine Chaoskarawane sich langsam den Hügel hinaufbewegte, war Charlotte bewusst, dass so vieles schiefgehen konnte. Suki war noch nicht richtig erzogen. Charlotte hatte eigentlich vorgehabt, ihr frühzeitig beizubringen, nicht zu betteln, sich bei »Platz« zu setzen und überhaupt alles zu tun, was man ihr sagte, doch dafür hatte die Zeit nicht gereicht. Es war so viel anderes zu bewältigen gewesen. Deswegen bestand nun die Gefahr, dass Suki voller Begeisterung auf einen Artgenossen zustürmte oder aus Angst vor einem bedrohlich wirkenden Exemplar die Flucht ergriff und dabei die ganze Gruppe auf die Straße riss, hinein in den Verkehr. Zwar war sie nur ein Welpe, ihrer Besitzerin aber mehr als gewachsen. Auch Oscar auf seinem Roller stellte eine ständige Gefahr für sich und andere dar. Wohl zum hundertsten Mal sagte sich Charlotte, dass sie ihm nun wirklich einen Helm kaufen musste. Was, wenn er von seinem Gefährt fiel und mit dem Kopf aufschlug? Welche Sorte Mutter war sie eigentlich? Benommen stellte sie sich die potenziellen Schlagzeilen vor: »Familie von Hund unter Auto gerissen«, »Kleinkind stirbt bei Rollercrash. Mutter verhaftet.«
An diesem Morgen erschien ihr die Geschäftsstraße wie eine Aneinanderreihung von Vorwürfen. Sie kam an mehreren Cafés vorbei, wo junge Mütter paarweise oder in Grüppchen saßen und sich unterhielten, als wäre die Mutterschaft eine einfache und erfreuliche Lebensstilvariante. Die Vorstellung, auch nur den Versuch zu unternehmen, sich mit Oscar, Lulu und Suki in einem Café niederzulassen, bescherte Charlotte schon eine ansatzweise Migräne. Mittlerweile befanden sie sich auf Höhe eines Kinderbekleidungsgeschäfts namens Mamma Mia. Oscar brachte seinen Roller zum Stehen, indem er das Schaufenster rammte.
»Ist das da ein Roboter?«, fragte er, den Blick gebannt auf die silbrig glänzende Schaufensterpuppe in Kindergröße gerichtet, die eine Jacke zum Preis von 87,50 Pfund trug.
»Nein«, antwortete Charlotte. »Das ist eine …« Sie zögerte. Wie sollte sie es ihm erklären? »Eine Art Puppe für Anziehsachen.« Hinter den Schaufensterpuppen sah Charlotte eine Frau in einer rosaroten Jacke, die ebenfalls zwei Kinder bei sich hatte, einen Jungen in Oscars Alter und ein blondes Mädchen, das ein paar Jahre älter war und das Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden trug. Charlotte kam es vor, als liefe in dem Laden eine Bühnenvorstellung ab, dargeboten von Menschen, die wussten, wie man eine Familie bildete, und auch genug Geld besaßen, um alles richtig hinzukriegen.
Sie setzten ihren Weg die Straße entlang fort. Ihr Ziel war die Kuppe des Hügels, der Whitestone Pond in Hampstead Heath. Dort hatte Charlotte jedes Mal das Gefühl, ins Licht zu entkommen, raus aus der darunterliegenden Düsternis, dem Verkehr und den Abgasen der Allradfahrer, die ihre Kinder in eine von den Dutzenden kleiner, über ganz Hampstead verteilter Privatschulen brachten. Vor einer Zahnarztpraxis legte sie eine Verschnaufpause ein. Wann mussten Kinder eigentlich erstmals zum Zahnarzt? Sie betrachtete das gläserne Schild mit den angebotenen Serviceleistungen. »Lächeln wie ein Promi!« Das klang nach etwas, das sie unbedingt brauchte. »Zähne wie mit zwanzig!« Noch besser. Sie dachte an ihr Leben vor zehn Jahren – war das wirklich schon so lange her? – als Studentin an der Uni. An die Freitag- und Samstagabende, die verschlafenen Vormittage. Niemand musste gefüttert werden, um niemanden brauchte sie sich Gedanken zu machen, außer um sich selbst und gelegentlich eine Mitbewohnerin, die den letzten Rest Milch verbrauchte. Sie erhaschte einen Blick auf ihr Spiegelbild. Was wohl die einundzwanzigjährige Charlotte Beck von der einunddreißigjährigen hielte, die von Schlafmangel gezeichnet war und mit ungewaschenem Haar herumlief und – wie sie gerade erst bemerkte – mit einem Fleck auf der Vorderseite ihres Shirts? Rasch zog sie den Reißverschluss ihrer Jacke hoch, damit man ihn nicht mehr sah.
Sie setzten ihren Weg den Hügel hinauf fort.
»Wohin gehen wir?«, fragte Oscar.
»Wohin wir immer gehen. Zum Teich. Vielleicht legen wir uns ja eines Tages ein Boot zu.«
»Was für ein Boot?«
»Ein kleines Segelboot.« Kaum waren die Worte draußen, wurde ihr klar, dass das wohl keine gute Idee gewesen war.
In dem Moment passierte es.
Wie ein silbriger Blitz schoss der Wagen an ihr vorbei, den Hügel hinunter.
Zu schnell, dachte sie und wandte sich instinktiv Oscar, dem Kinderwagen und Suki zu. Sie blickte also nicht in die entsprechende Richtung, als sie hinter sich plötzlich Schreie hörte, dann ein schabendes Geräusch, gefolgt von einem Knall, metallischem Knirschen und dem Bersten von Glas. Erschrocken fuhr sie herum und starrte den Hügel hinunter. Im ersten Moment hatte sie Schwierigkeiten zu begreifen, was sie da sah, denn auf einmal war alles ganz anders. Niemand bewegte sich, und die Welt war verstummt, abgesehen von irgendeiner Sirene – einer Alarmanlage oder einem Feueralarm. Unfassbarerweise, wie in einem Albtraum, klemmte das silberfarbene Auto, das eben an ihr vorbeigerast war, nun in einem Schaufenster, und zwar fast ganz drin. Ein weißer Lieferwagen, der im Begriff gewesen war, den Hügel hinaufzufahren, hatte mitten auf der Straße angehalten. Der Fahrer war ausgestiegen, unternahm jedoch nichts, sondern stand einfach nur da und starrte.
Charlotte kam es vor, als hätte das normale Leben einen Sprung bekommen und sie einen Schritt durch diesen Sprung getan, sodass nun alles anders war und nichts mehr einen Sinn ergab. Langsam setzte sie sich in Bewegung, auf die Verwüstung zu, blieb jedoch gleich wieder stehen. Sie hatte Suki bei sich, die Leine war ja um ihr Handgelenk geschlungen, ihre Kinder aber hatte sie vergessen. Sie machte kehrt und griff nach dem Kinderwagen. Lulu schlief immer noch tief und fest. Oscar starrte mit offenem Mund auf den Unfall, wie die Karikatur eines überraschten kleinen Jungen in einem Kinderbuch.
»Komm«, sagte Charlotte zu ihm, während sie steif seine rechte Hand in ihre linke nahm und mit der anderen, an der auch Sukis Leine hing, den Kinderwagen schob. Als sie näher kam, sah sie, dass ein paar Leute einfach nur dastanden und die Augen aufrissen. Zwei Frauen waren aus dem Café getreten. Ein Postbote stand auch dabei. Nein. Charlotte korrigierte sich im Geiste. Es handelte sich um eine Postbotin: Sie hatte ihren lustigen roten Anhänger im Schlepptau und hielt ein Päckchen in der Hand. Als Nächstes registrierte Charlotte die am Boden liegenden Gestalten. Warum half ihnen denn niemand? Wer kümmerte sich um alles? Sie blickte sich um. Was sie sich wünschte, war, dass Leute in Uniform auftauchten, die Regie übernahmen, Absperrband spannten und allen Anwesenden befahlen, auf der anderen Seite zu bleiben. Aber da waren keine Rettungskräfte, sondern nur normale Leute, die nicht wussten, was sie tun sollten.
Nicht weit von ihr entfernt standen zwei junge Frauen. Eine von beiden hatte eine Ledertasche umhängen.
»Haben Sie ein Telefon?«
Da die Frauen sie nur verwirrt anstarrten, wiederholte Charlotte ihre Frage, woraufhin eine der beiden den Arm hob und ihr das Telefon zeigte, das sie in der Hand hielt.
»Krankenwagen«, sagte Charlotte. »Neun, neun, neun. Rufen Sie an. Jetzt.«
Sie wandte sich an die andere Frau und deutete auf ihre Kinder. »Kümmern Sie sich um die zwei«, befahl sie. »Nur eine Minute. Ich bin gleich wieder da.«
Charlotte streifte Sukis Leine vom Handgelenk und übergab sie Oscar, dem immer noch der Mund offen stand. »Pass einen Moment auf Suki auf. Schaffst du das?«
Er nickte feierlich. Charlotte wandte sich um und steuerte auf den Wagen zu. Eine Frau lag halb auf dem Gehsteig, halb auf der Straße, ein Bein seltsam verrenkt. Charlotte kniete sich neben sie und sah ihr in die Augen. Krampfhaft versuchte sie, sich zu erinnern, was in einer solchen Situation zu tun war. Sollte man die verletzte Person bewegen oder nicht? Ihr Gehirn fühlte sich an wie leer gefegt.
»Wie geht es Ihnen?«, fragte sie.
»Mein Bein!«, stöhnte die Frau. Wenigstens konnte sie sprechen.
»Tut Ihnen sonst noch was weh?«
»Mein Mann, wo ist mein Mann?«
»Der Krankenwagen ist schon unterwegs«, antwortete Charlotte in der Hoffnung, dass es stimmte. Sie stand auf und ging zur anderen Seite des Fahrzeugs. Dort lag ein älterer Mann auf dem Rücken. Blicklos starrte er in den Himmel hinauf. Er war der erste Tote, den Charlotte in ihrem Leben sah.
Sie trat neben den Wagen. In seinem Inneren entdeckte sie eine zusammengesunkene Gestalt, konnte jedoch nicht erkennen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte. Als sie gerade die Wagentür öffnen wollte, hörte sie ein Schluchzen und wandte den Kopf: Es kam aus dem Laden. Sie stieg durch die Überreste dessen, was einmal das Schaufenster gewesen war. Glas knirschte unter ihren Füßen. Sie blickte nach unten und begriff plötzlich, dass es sich um das Mamma Mia handelte, das Kinderbekleidungsgeschäft.
Sie ging weiter hinein. Vor ihr auf dem Boden lag jemand, halb unter den Vorderreifen des Wagens eingeklemmt. Als Charlotte sich hinunterbeugte, bewegte sich die Gestalt stöhnend. In dem Moment spürte Charlotte einen warmen Schwall gegen ihren Körper klatschen und stellte fest, dass es sich um eine Frau handelte, aus deren Schulter – oder Schulterbereich – Blut quoll. Es kam in Fontänen, als würde es jemand herausblasen, dann einen Moment einatmen und erneut Blut ausstoßen. Die Frau sah zu ihr auf, blickte ihr direkt in die Augen. Charlottes erster Impuls war davonzulaufen und es jemand anderem zu überlassen, sich um die Schwerverletzte zu kümmern.
Immerhin konnte sie sich dunkel daran erinnern, was man in einem solchen Fall tun sollte. Etwas draufdrücken. Das war’s. Aber wo? Sie legte die Finger über die Wunde, doch das Blut quoll zwischen ihnen hindurch. Es funktionierte nicht. Daraufhin schob sie die Hand tiefer, ein kleines Stück weg von der Wunde, und drückte erneut, diesmal richtig fest. Der Blutstrom versiegte, als wäre sie auf einen Gartenschlauch getreten. Sie drückte noch fester, woraufhin die Frau ein Keuchen ausstieß.
»Werde ich sterben?«, fragte sie mit flackerndem Blick.
»Ein Krankenwagen ist schon unterwegs«, antwortete Charlotte.
»Joey«, sagte die Frau. »Und Cass.«
Schlagartig begriff Charlotte, dass es die Frau war, die sie vorhin durchs Fenster beobachtet hatte, und der Tote draußen vielleicht ihr Ehemann. Sie fragte sich, wo wohl die Kinder steckten.
»Bestimmt sind sie in Sicherheit«, erklärte sie.
Suchend blickte sie sich um. Dabei hatte sie fast Angst vor dem, was sie womöglich sehen würde. Doch ein paar Meter seitlich von ihnen entdeckte sie die Kinder, auf den Boden gekauert, die Augen glasig vor Schock. Charlotte hatte das Gefühl, dass sie den beiden irgendwie beistehen sollte, wagte aber nicht, die Hand von der Wunde zu nehmen. Plötzlich wimmelte es um sie herum von Uniformen, jungen Männern und Frauen, deren Gesichter sie nur verschwommen wahrnahm. Jemand bombardierte sie mit Fragen, doch sie konnte keinen klaren Gedanken fassen. Man zog sie weg von der Frau, die unter einer Schar von Rettungssanitätern verschwand. Charlotte wich zurück. Wieder hörte sie das Glas unter ihren Füßen knirschen. Sie starrte die beiden Kinder an, die immer noch auf dem Boden kauerten, und breitete hilflos die Arme aus.
In dem Moment fielen ihr ihre eigenen Kinder wieder ein. Benommen bahnte sie sich einen Weg durch den verwüsteten Laden. Überall sah sie uniformierte Rettungskräfte. Einige von ihnen musterten sie eindringlich. Sie trat nach draußen, spürte die Sonne auf der Haut und hörte die Leute rundherum keuchen. Verwirrt fragte sie sich nach dem Grund. Als sie daraufhin den Blick an sich hinabgleiten ließ, über ihre blutgetränkte Kleidung, begriff sie, dass sie selbst der Grund für das Keuchen war.
2
Constable Darren Symons hatte seinen Posten erst gut zwei Monate inne. Das am schlimmsten betroffene Unfallopfer, mit dem er bisher zu tun gehabt hatte, war ein junger Mann gewesen, den ein Betonmischer von seinem Motorrad herunterbefördert hatte. Allerdings war der Mann dabei nicht gestorben, sondern hatte sich nur ein Bein gebrochen. Das hier war etwas ganz anderes. Fast ehrfürchtig ließ Symons den Blick über das Blutbad schweifen. Es kam ihm vor wie ein Fiebertraum: das blitzende Blaulicht, der in den Laden gerammte silberfarbene Wagen, die funkelnden Glasscherben auf dem Gehsteig, die leblose Person, die noch in dem eingedrückten Fahrzeug gefangen war. Das alles erschien ihm nicht real, jedenfalls nicht realer als die Schaufensterpuppe in Kindergröße, die unerschütterlich inmitten des verwüsteten Ladens stand. Er sah, wie eines der Opfer auf eine Trage gehoben wurde. Eine Beamtin führte zwei kleine Kinder zu einem wartenden Fahrzeug. Sein Blick blieb an dem Blut auf dem Gehsteig hängen. Er hörte jemanden weinen, schrill und laut.
»Constable Symons. Darren!« Blinzelnd wandte er sich seiner Vorgesetzten zu, die eine ausladende Handbewegung machte. »Die Zeugen. Nehmen Sie ihre Namen auf, bevor sie alle verschwinden.«
Symons nickte und zog sein Notizbuch heraus. Sein Stift zuckte unsicher über das Papier, als er das Datum schrieb: 3. Oktober 2016. Nach einem Blick auf seine Armbanduhr fügte er die Uhrzeit hinzu: 9.11 Uhr. Hinter den Absperrungen standen die Leute bereits dicht gedrängt, und weitere strömten den Hügel herauf, als wären sie auf dem Weg zu einem Konzert. Wie erfuhren sie nur so schnell davon? Er blickte hoch und sah an den Fenstern der Häuser überall Gesichter.
Eine Frau saß blutüberströmt auf dem Gehsteig. Sie hielt eine Leine, an deren anderem Ende ein kleiner Hund hing. Jedes Mal, wenn das Tier zu zerren begann, riss es ihren Oberkörper in die entsprechende Richtung. Warum kümmerte sich niemand um sie? Vorsichtig trat Symons näher, als könnte sie wie eine Bombe explodieren. Die Frau hob den Kopf. Ihr Gesicht war vor Schock kalkweiß, aber äußere Verletzungen schien sie auf den ersten Blick keine zu haben. In dem Kinderwagen neben ihr lag ein Baby, das unglaublicherweise inmitten des ganzen Durcheinanders friedlich schlief. In seinem Mund steckte ein Schnuller, und seine Augen zuckten, als träumte es. Am Randstein sprang ein kleiner Junge auf und ab. Er trug eine gestreifte Hose und hatte vor Aufregung rot gefleckte Wangen.
»Sind Sie verletzt?«, fragte Constable Symons.
Hinter sich hörte er eine Motorsäge aufheulen. Offenbar schnitten sie jetzt die leblose Person aus dem Wagen.
»Ich? Nein. Ich bin nur …« Sie legte eine Pause ein. »Mir ist ein bisschen schlecht.«
»Das ist Blut!«, stieß der Junge keuchend hervor. »Echtes Blut!« Noch immer sprang er hektisch den Randstein auf und ab, das Gesicht vor Anstrengung verzogen, aber mit leuchtenden Augen.
»Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen?«, wandte Constable Symons sich wieder an die Frau. »Zu dem, was Sie gesehen haben?«
»Ich habe nichts gesehen.«
»Sie sind voller Blut.«
Benommen blickte sie an sich hinunter. »Es ist von der Frau. Muss sie sterben? Wo sind ihre Kinder?«
»Wen meinen Sie?«
»Die Frau in dem Geschäft. Ich habe versucht …«
»Darüber weiß ich nichts«, unterbrach er sie. »Wenn Sie mir bitte erzählen würden, was Sie gesehen haben.«
»Es ging zack-peng!«, rief der Junge. »Wir wollten zum Teich. Bald kaufen wir uns ein Segelboot.«
»Fangen wir doch mit Ihrem Namen an.«
»Ich heiße Charlotte Beck«, erklärte die Frau. Dann begann sie plötzlich zu weinen. Ihr magerer Körper zuckte, und die Tränen strömten ihr über die Wangen.
Er setzte sich neben sie auf den Gehsteig und legte ihr die Hand auf die Schulter. Der kleine Junge unterbrach sein Gehopse und kauerte sich ebenfalls neben sie.
»Das wäscht sich doch wieder ab«, versuchte er sie zu beruhigen. »Nicht weinen, Mummy.«
»Ich war hinten im Lager«, flüsterte die Inhaberin des Mamma Mia. Die Stimme versagte ihr einen Moment den Dienst. Ständig strich sie sich mit den Händen über Gesicht und Körper, als müsste sie sich immer wieder davon überzeugen, dass ihr nichts fehlte. »Ich habe nach etwas gesucht, nach …« Sie brach erneut ab. »Ich schätze, es spielt keine Rolle, wonach ich gesucht habe.«
»Sie haben also nichts gesehen?«, fragte Constable Symons.
»Ich dachte, es ist ein Erdbeben. Oder eine Bombe. Ich dachte, ich muss sterben.« Sie starrte ihn an. »Ich bin unter den Tisch gekrochen«, fuhr sie fort. »Statt zu helfen, habe ich mich einfach nur versteckt.«
»Das ist ganz normal«, entgegnete er.
»Da saß noch jemand mit dem Mann im Wagen.«
»Tatsächlich?«
»Ein zweiter Mann. Mit einem Hut, wenn ich mich nicht irre. Es ging alles so schnell, aber ich bin wirklich davon überzeugt, dass da noch ein Mann war. Ist er nicht mehr da? Merkwürdig.«
»Da war irgendetwas merkwürdig.«
Symons musterte den Mann. Er war kräftig gebaut, hatte kurz geschnittenes Haar und trug über seiner Jeans eine dicke grüne Jacke. »Natürlich, da war alles merkwürdig«, antwortete der Beamte. »Ein Wagen, der in einen Laden rast. Merkwürdiger geht’s nicht.«
»Das meine ich nicht. Der Wagen hat nicht so ausgesehen, als würde ihn jemand fahren. Es war eher, als käme er einfach den Hügel heruntergerollt, außer Kontrolle.«
»Gerollt? Wie meinen Sie das?«
»Ich sage nur, was ich gesehen habe.«
»Kann ich Ihren Namen und Ihre Nummer haben?«
»McGill«, antwortete der Mann, »Dave McGill.« Er fügte eine Telefonnummer hinzu.
Symons versuchte, sich zu konzentrieren. Die Sonne brannte so heiß, und die vielen lauten Geräusche gingen ihm auf die Nerven. Irgendwo schrillte immer noch dieser Alarm, verstärkt durch das Brüllen der Motorsäge, das Gehupe der weiter unten wartenden Wagen und die Sirenen in der Ferne. Er beäugte die Frau ihm gegenüber, die Sally Krauss hieß und sichtlich zitterte, während sie sich ihre glänzende braune Tasche wie einen Schutzschild an die Brust presste.
»Er hatte eine Glatze«, sagte sie, »und er hing nach vorne. Wahrscheinlich hatte er einen Herzinfarkt. Meinem Onkel ist das auch passiert. Er ist schnurstracks in einen Baum geknallt. Wegen eines plötzlichen Herzanfalls. Angeblich hat er das Ganze gar nicht mehr mitbekommen.«
Symons blickte auf seine Notizen hinunter. Jeder hatte etwas anderes gesehen. Er seufzte frustriert.
»Ich heiße Adrian Greville und habe alles gesehen«, verkündete der Mann, dessen Schnurrbart sich wie eine dünne Schnur über seine Oberlippe zog. »Er kam direkt auf mich zugeschossen und hat mich nur so knapp verfehlt.« Er hielt Daumen und Zeigefinger hoch, um zu zeigen, wie knapp er mit dem Leben davongekommen war. »Dann ist er in dieses ältere Paar gerast. Ich habe den Mann durch die Luft fliegen sehen. Sein Gesicht. Ich könnte schwören, dass er mich dabei direkt angeschaut hat. Der arme Kerl!«
»Haben Sie den Fahrer auch gesehen?«
»Ja, und zwar ganz genau. Er hielt das Lenkrad mit beiden Händen umklammert und lächelte. Das war kein Unfall, sondern Absicht.«
Ein paar von den Zeugen wollten gar nicht mehr gehen. Sie standen in Grüppchen beisammen und tauschten ihre Erfahrungen aus. Einer von ihnen – der Mann mit der grünen Jacke, dem zufolge der Unfall irgendwie merkwürdig gewesen war, weil der Wagen angeblich wie von selbst den Hügel heruntergerollt war – ließ sich neben der blutüberströmten Charlotte Beck auf dem Gehsteig nieder. Ihr kleiner Sohn saß mittlerweile neben ihr und saugte an dem Lutscher, den ein Polizeibeamter ihm geschenkt hatte. Das Baby schlief in seinem Kinderwagen. Charlotte Beck musterte den Mann benommen. »Ich sollte nach Hause gehen«, erklärte sie.
»Ich habe gesehen, was Sie getan haben.«
»Ich habe nur gemacht, was jeder andere auch gemacht hätte.«
»Bloß dass es außer Ihnen niemand getan hat. Wahrscheinlich kriegen Sie jetzt eine Medaille.«
Er stand auf und streckte ihr die Hand hin, um ihr vom Gehsteig aufzuhelfen. »Kommen Sie«, sagte er. »Ich bin Dave. Ich begleite Sie nach Hause. Lassen Sie mich den Kinderwagen schieben.«
In den Trümmern dessen, was einmal das Mamma Mia gewesen war, hievten mehrere weiß gekleidete Spurensicherungsexperten die Leiche eines Mannes mittleren Alters aus dem Fahrzeug. Er hatte kurz geschorenes Haar und ein Muttermal auf der rechten Wange. Bekleidet war er mit einer grauen Hose, einem grau-weiß karierten Hemd und Sportschuhen. Am Handgelenk trug er eine Uhr mit einem Metallband. Seine Haut war kalkweiß, das Gesicht mit weit aufgerissenen Augen zu einem Ausdruck der Überraschung erstarrt.
Sie legten ihn auf die Bahre. Der linke Arm hing schlaff herunter. Eine Beamtin platzierte ihn auf der Brust des Mannes.
»Viel Blut ist da nicht«, stellte sie fest.
Während sie den Leichnam abtransportierten, beugte sich ein anderer Beamter hinunter, um etwas aufzuheben, wobei er darauf achtete, sich nicht an einer Glasscherbe oder einem scharfkantigen Stück Metall zu schneiden.
»Hab ich dich!« Er reckte eine Brieftasche hoch.
Sergeant June McFarlane inspizierte den Inhalt der Brieftasche. Das Bargeld und die Kreditkarten interessierten sie nicht. Stattdessen fischte sie einen Führerschein heraus. Das unscharfe, pixelige Foto zeigte eindeutig den Mann aus dem Wagen.
»Geoffrey Udo Kernan«, las sie laut vor. »Motherwell Road 10, RM10 9BB.« Sie wandte sich nach Symons um. »Sagt Ihnen das was? Ist das außerhalb von London?«
»Kommt darauf an, was Sie unter ›außerhalb‹ verstehen. Ich tippe auf Romford. Soll ich jemanden hinschicken?«
McFarlane schüttelte den Kopf. »Wir fahren selbst. Jetzt gleich.«
Symons wirkte skeptisch. »Das ist ganz schön weit.«
»Egal. Wir haben es hier mit Toten und Schwerverletzten zu tun. Da müssen wir das schon selber machen.«
Es war halb drei Uhr nachmittags, die Sonne stand bereits tief am Himmel. Die Straße war noch abgesperrt. Etliche Streifenwagen und größere Einsatzfahrzeuge blockierten die Fahrbahn. Die Menge der Schaulustigen aber hatte sich inzwischen zerstreut, den Unfallwagen hatte man abgeschleppt, das Glas entfernt. Die Leute von der Spurensicherung machten fleißig Aufnahmen, maßen Schleuderspuren und sammelten Metallfetzen ein. Dabei befolgten sie streng die Vorschriften, damit alles seine Ordnung und seinen Sinn hatte. Das Mamma Mia war nur noch ein klaffendes Loch.
Währenddessen steckten McFarlane und Symons auf der North Circular im Stau. Die beiden hatten inzwischen das Navi zurate gezogen und festgestellt, dass Symons nicht ganz richtig gelegen hatte. Kernans Wohnort gehörte eher zu Barking als zu Romford, aber das machte die Strecke auch nicht kürzer.
»Es ist die falsche Tageszeit für eine solche Fahrt«, bemerkte Symons.
»Fragt sich nur, wann dann die richtige Zeit ist«, meinte McFarlane. »Vielleicht um drei Uhr morgens.«
Mittlerweile hatten sie Gelegenheit gehabt, Kernans Namen durch den Polizeicomputer laufen zu lassen. Nichts. Symons begann über den Unfallort zu sprechen, über den möglichen Hergang zu spekulieren, doch McFarlane unterbrach ihn.
»Warten wir erst mal ab«, meinte sie. Den Rest der Fahrt unterhielten sie sich über andere Themen. Sie brauchten über eine Stunde, ehe sie von der North Circular auf die Barking-Umgehung abbiegen konnten und von dort in die Motherwell Road, eine Wohnstraße mit den typischen zweistöckigen Kieselrauputz-Reihenhäusern aus der Nachkriegszeit, mit jeweils zwei Räumen pro Stockwerk. An ihrem Ziel angekommen, blieben sie noch einen Moment im Wagen sitzen.
»Das ist jedes Mal wieder ein seltsamer Moment«, erklärte McFarlane, »wenn man im Begriff steht, an der Tür zu klingeln und ein Leben zu ruinieren.«
»Vielleicht hat er ja alleine gelebt«, gab Symons zu bedenken, »oder es ist niemand zu Hause.«
»Wenn wir unseren Hintern nicht hier rausbewegen, werden wir es nie erfahren«, entgegnete McFarlane, woraufhin beide ausstiegen und den kleinen Pfad zum Haus hinaufgingen. Neben einem grauen Peugeot Kombi, der in der Einfahrt parkte, blieben sie stehen.
»Sieht aus, als wäre doch jemand zu Hause«, stellte McFarlane fest. Sie drückte auf den Klingelknopf. Irgendwo im Haus ertönte ein gedämpftes Läuten. Drinnen rührte sich etwas. Schritte waren zu hören, dann schwang die Tür auf. Die Frau trug eine locker sitzende Jeans, eine weiße Bluse und eine türkisgrüne Strickjacke, bei der June McFarlane an einem Ärmel kleine Löcher registrierte. Motten. Hauptsächlich aber registrierte sie das angsterfüllte Gesicht, dessen Blässe das dunkle Haar der Frau fast schwarz wirken ließ.
»Kennen Sie Geoffrey Kernan?«, fragte McFarlane. Symons spürte, wie sein Magen vor Anspannung krampfte.
»Das ist mein Mann«, sagte sie.
»Dürfen wir reinkommen?«
Eine Weile saßen sie verlegen im Wohnzimmer und sahen Mrs. Kernan beim Weinen zu. McFarlane beugte sich ein wenig vor und reichte ihr die Papiertaschentücher, die sie für solche Fälle immer griffbereit hatte. Symons ging hinüber in die kleine Küche, wo er ein Glas mit löslichem Kaffee fand und davon drei Tassen aufbrühte. Für Mrs. Kernan fügte er mehrere Löffel Zucker hinzu. McFarlane setzte sich neben sie und flößte ihr das heiße Getränk ein.
»Ich kann es noch gar nicht fassen«, stieß Mrs. Kernan hervor. »Ich kann es einfach nicht glauben. Die ganze Zeit hoffe ich, dass ich aus diesem Albtraum erwache.«
»Es tut mir so leid«, sagte McFarlane.
»Ich habe schon befürchtet, dass ihm etwas passiert ist, aber doch nicht das!«
»Was wollen Sie damit sagen? Warum haben Sie befürchtet, ihm könnte etwas passiert sein?«
»Ich habe ihn vermisst gemeldet.«
McFarlane warf Symons einen fragenden Blick zu. »Hatten Sie nicht gesagt …?«, begann sie.
»Ich habe es überprüft«, antwortete er. »Da war nichts.«
McFarlane wandte sich wieder an Mrs. Kernan. »Wann genau haben Sie ihn als vermisst gemeldet?«
»Vor drei Tagen. Ich bin aufs Polizeirevier gegangen und habe gemeldet, dass er nicht nach Hause gekommen ist.«
»Haben die Kollegen Ihre Aussage aufgenommen?«
»Nein, die waren nicht interessiert. Sie meinten, wahrscheinlich habe er bloß ganz kurzfristig weg müssen. So was komme öfter vor.«
»Demnach wurde keine Aussage aufgenommen?«
»Man hat mich einfach wieder weggeschickt. Die hatten kein Interesse. Die haben gesagt: ›Wenn er in ein paar Tagen nicht zurück ist, dann melden Sie sich noch mal.‹ Und jetzt … jetzt …« Wieder brach sie in Tränen aus.
»Misses Kernan, haben Sie …«
»Ich war mir ganz sicher, dass er so etwas nie tun würde.«
»Wie meinen Sie das?«
»Ich habe meine Schwester besucht, und als ich zurückkam, war er nicht mehr da. Ich dachte, er wäre spazieren oder irgendwo mit einem Freund auf ein Bier. Aber dann wurde es immer später, und er ging nicht ans Telefon. Er kam nicht nach Hause. Ich habe noch den ganzen nächsten Tag gewartet, aber als dann jemand aus seiner Firma anrief und wissen wollte, warum er nichts von sich hören lasse, bin ich zur Polizei gegangen.«
»Haben Sie Kinder?«
Die Frau schlang die Arme um ihren Körper, als versuchte sie, sich selbst zu trösten. »Ned. Er studiert. Ich muss ihn anrufen und es ihm sagen. Er ist im ersten Semester, hat also gerade erst angefangen mit dem Studium. Ich habe ihm nichts von Geoffs Verschwinden erzählt. Ich wollte ihn nicht beunruhigen. Und jetzt …« Sie tupfte sich mit dem Papiertaschentuch das Gesicht ab. Ihre Augen sahen entzündet aus.
»Stand er seinem Vater nahe?«
»Die beiden haben viel gestritten. Das liegt aber nur daran, dass sie sich so ähnlich sind.«
»Was hat Ihr Mann beruflich gemacht?«
»Als Vertreter gearbeitet.«
»Wofür?«
»Sanitärbedarf. Für Firmen. Er ist viel mit dem Auto unterwegs.« Sie blinzelte. »War. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich in der Vergangenheit von ihm spreche.«
»Ja«, sagte McFarlane, »das ist schwer.« Sie zögerte einen Moment, ehe sie fortfuhr. »Ist das da draußen Ihr Wagen?«
»Seiner. Besser gesagt, sein Firmenwagen.«
»Hat er noch einen anderen? Einen silbergrauen Nissan mit Metalliclackierung?«
»Nein, wir haben nur den einen.«
»Der Unfall ist in der Heath Street passiert. Hatte Ihr Mann da einen Geschäftstermin oder vielleicht einen privaten Grund, dort zu sein?«
»Er war beruflich ständig unterwegs, im ganzen Land. Über Hampstead ist mir nichts Besonderes bekannt.«
»Vielleicht hatte er ja wirklich geschäftlich dort zu tun. Oder privat.«
»Privat? Wie meinen Sie das?«
»Vielleicht war er mit jemandem verabredet.«
»Nicht dass ich wüsste. Was genau ist denn überhaupt passiert?«
McFarlane berichtete von dem Unfall.
»Ist jemand gestorben? Ich meine, abgesehen von Geoff.« Sie holte tief Luft und schluckte, als sie seinen Namen aussprach.
»Eine weitere Person ist bei dem Unfall ums Leben gekommen. Etliche andere Leute wurden verletzt, einige davon schwer.«
Mrs. Kernan zog ein frisches Taschentuch heraus und schnäuzte sich.
»Misses Kernan, mir ist klar, dass das gerade ganz schrecklich für Sie ist. Aber ich muss Ihnen trotzdem ein paar Fragen stellen.«
»Was für Fragen?«
»Gab es zwischen Ihnen und Ihrem Mann Probleme?«
»Wie meinen Sie das?«
»Eheprobleme.«
»Nein. Nichts dergleichen.«
»Ihr Mann war viel unterwegs. Brachte das Schwierigkeiten mit sich?«
»Früher schon, hin und wieder. Inzwischen nicht mehr.«
»Wie lief es mit seiner Arbeit?«
»Gut. Wie üblich. Zu viele Stunden für zu wenig Geld.«
»Gab es in letzter Zeit irgendwelche besonderen Vorfälle?«
Mrs. Kernan schüttelte den Kopf. Bisher hatte sie vor Kummer wie betäubt gewirkt, doch plötzlich wurde ihr Gesichtsausdruck misstrauisch. »Worauf wollen Sie hinaus?«
»Ich will auf gar nichts hinaus.«
»Sie meinen, er hat sich das selbst angetan?«
Das Telefon klingelte. Während Mrs. Kernan aufstand, um ranzugehen, trug McFarlane die Tassen zurück in die Küche und spülte sie ab. Durchs Fenster sah sie ein Rotkehlchen auf einem Spaten sitzen, der halb in die Erde gerammt war. Der ganze Garten wirkte wie eine Miniaturbaustelle. Am hinteren Ende waren große Pflastersteine gestapelt.
»Das war Geoffs Idee«, hörte sie Mrs. Kernan hinter sich sagen. »Er meinte, eine Terrasse wäre nett für Grillabende.«
»Haben Sie jemanden, der herkommen und Ihnen beistehen kann?«
»Ich könnte meine Schwester bitten.«
»Gut.«
Danach saßen sie eine Weile schweigend im Wagen.
»Ich glaube, sie hat uns etwas verschwiegen«, sagte Symons schließlich. »Wenn Sie mich fragen, hatten die beiden Probleme.«
»Jeder hat Probleme«, antwortete McFarlane.
»Aber in diesem Fall liegt es doch auf der Hand, oder?«
»Tatsächlich? Gut, dann erklären Sie es mir.«
»Geoffrey Kernan ist beruflich stark unter Druck und unglücklich in seiner Ehe. Irgendwann wird es ihm einfach zu viel. Er flüchtet aus seinem Leben, läuft ein paar Tage durch die Gegend, überlegt hin und her, wie er mit alledem klarkommen soll. Dann steigt er in einen Wagen und macht Schluss. Ganz einfach.«
»In einen Wagen. Nicht seinen eigenen.«
»Es gibt kein Gesetz, das besagt, dass man dafür seinen eigenen Wagen benutzen muss.«
»Und dann auch noch in Hampstead, wohin er anderthalb Stunden zu fahren hatte.«
»Er brauchte einen Hügel.«
»Wozu braucht er einen Hügel? Er sitzt in einem Auto, nicht in einem Einkaufswagen.« Die beiden Ermittler sahen sich an. »Na ja, wie auch immer«, fuhr McFarlane fort, »morgen wissen wir mehr. Überprüfen Sie in der Zwischenzeit doch mal den Wagen, den er gefahren hat.«
Gerichtsmedizinerin Dr. Jane Franklin richtete den Blick auf die Leiche von Geoffrey Kernan und dann auf eine Gruppe von Studenten, die ihr – alle mit Mundschutz und grünem Kittel – gegenüberstanden.
»Haben Sie sich die Unterlagen angesehen?«
Es folgte vages Gemurmel.
»Also?«
»Autounfall.«
»Und?«
»Möglicherweise Herzinfarkt.«
»Sonst noch was?«
»Oder Schlaganfall. Oder Selbstmord.«
»Bei Polizeiberichten muss man aufpassen«, erklärte Dr. Franklin, »dass sie einem nicht den Blick versperren. Vergessen Sie mal, was Sie gelesen haben. Was sehen Sie hier?« Sie deutete mit einem Skalpell auf das zerstörte Gesicht und anschließend auf einen der bleichgesichtigen Studenten.
»Ähm … Fraktur des …«
»Halt«, unterbrach ihn Dr. Franklin in scharfem Ton. »Lassen Sie mich die Frage umformulieren. Was sehen Sie nicht?«
Erneut hörte man Gemurmel, aber keine konkreten Aussagen.
»Hat sich einer von Ihnen schon mal am Kopf verletzt? Sich die Nase aufgeschlagen? Was beschert einem das?«
»Blut?«, mutmaßte ein Student zögernd.
»Genau. Blut, und zwar eine ganze Menge davon. In diesen Wunden hier findet sich überhaupt kein Blut. Und das bedeutet?«
»Dass das Herz nicht schlug.«
»In anderen Worten?«
»Er war schon tot.«
»Genau.«
»Aber wie kann ein Toter Auto fahren?«
»Wir sind Pathologen«, entgegnete Dr. Franklin. »Wir interessieren uns nicht für die Polizeiberichte. Wir interessieren uns für die Leiche.«
»Ich habe eine Halterabfrage gemacht«, verkündete Symons. »Der Wagen gehört einem Mister Alexander Christos aus Didcot.«
»Ist er ein Freund von Kernan?«
»Es war ein bisschen kompliziert. Ich habe mit den Kollegen vor Ort gesprochen, und die haben sich mit Christos in Verbindung gesetzt.«
»Lassen Sie mich die unkomplizierte Version hören.«
»Der Wagen muss gestohlen worden sein.«
»Gestohlen?«
»Christos macht gerade Urlaub auf den Kanaren. Soweit er weiß, steht sein Auto vor seinem Haus.«
McFarlane runzelte irritiert die Stirn. »Was läuft denn hier ab? Dieser Toilettenvertreter fährt die ganze Strecke nach Didcot, stiehlt einen Wagen und fährt ihn dann nach Hampstead, um sich umzubringen?«
Es klopfte. Ein junger Beamter streckte den Kopf herein. »Ein Anruf für Sie. Frau Doktor Franklin. Sie möchte mit Ihnen sprechen.«
Dr. Franklin empfing McFarlane an der Tür des Untersuchungsraums. »Sind Sie bereit für den Anblick der Leiche?«
»Ich habe sie doch schon am Tatort gesehen.«
»Trotzdem. Manchen bereitet es Probleme, wenn die Toten erst mal aufgeschnitten sind. Ich möchte Ihnen etwas zeigen.« Sie führte McFarlane zu einem der Obduktionstische und zog das Tuch zurück. »Werfen Sie mal einen Blick hierhin.« Sie deutete mit der Spitze ihres Skalpells auf den mittig platzierten Einschnitt am Hals des Toten. »Sehen Sie das?«
»Das Zungenbein«, fügte ihr Assistent hinzu und betrachtete seinerseits den zarten, wie ein Hufeisen geformten Knochen. »Es ist gebrochen.«
»Und?«, entgegnete McFarlane. »Der Mann hatte einen Verkehrsunfall. Da ist bestimmt vieles gebrochen. Ich weiß über diesen Knochen Bescheid. Er ist ein Indikator für Strangulation, bricht dabei aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit.«
»Stimmt, aber in diesem Fall besitzt er die Beweiskraft, die wir brauchen«, erklärte Dr. Franklin.
»Was bedeutet das?«
»Durch eine Strangulation bricht das Zungenbein in etwa einem Drittel der Fälle. Ist er jedoch gebrochen, dann heißt das immer Strangulation.«
»Aber der Mann hatte einen Verkehrsunfall. Kann man sich dabei strangulieren?«
»Damit wären wir bei dem anderen Punkt. Zum Zeitpunkt des Unfalls war er bereits tot.«
»Das haben Sie ja gerade schon angedeutet«, wandte McFarlane ein. »Weil er sich vorher stranguliert hat.«
»Nein, ich wollte damit sagen, dass er schon länger tot war. Weshalb die schweren Gesichtsverletzungen, hier und hier« – sie deutete auf den zerschmetterten Schädel, den eingedrückten Wangenknochen –, »nicht geblutet haben.«
»Dann ist Kernan also nicht im Verlauf des Unfalls gestorben?«
»Nein.«
»Haben Sie einen Todeszeitpunkt?«
»Wissen Sie, was ich hasse?«
»Vieles, schätze ich.«
»Ja. Aber besonders hasse ich es, wenn die Leute im Fernsehen ständig Krimis sehen und dann von mir hören wollen, dass das Opfer in der Nacht davor um Punkt zwei Uhr zweiunddreißig gestorben ist.«
»Ich komme nicht viel zum Fernsehen. Außerdem weiß ich als Polizeibeamtin, dass so was reine Fiktion ist.«
»Gut. Ich nehme mal an, Sie können mir nicht sagen, wo Kernan gestorben ist.«
»Noch nicht.«
»Und Sie wissen auch nicht, wo sich seine Leiche in der Zwischenzeit befand?«
»Nein.«
»Haben Sie Informationen bezüglich der Umgebungstemperatur? Der Luftfeuchtigkeit?«
»Nein. Mir ist klar, worauf Sie hinauswollen. Aber könnte es vor zwei oder drei Tagen passiert sein?«
Dr. Franklin runzelte die Stirn. »Ja«, antwortete sie schließlich, »es könnte vor zwei oder drei Tagen passiert sein. Unter Umständen ist es auch länger her. Viel länger. Oder nicht so lang. Mindestens jedoch mehrere Stunden vor dem Unfall.«
»Verstehe«, sagte McFarlane, obwohl sie eigentlich gerade gar nichts verstand.
»Wenn wir im Fernsehen wären«, fuhr Dr. Franklin fort, »würde die Gerichtsmedizinerin jetzt losziehen, ein paar Zeugen befragen und den Fall selbst lösen.«
»Ich wünschte, Sie täten es.«
Darren Symons putzte sich die Nase, rieb sich die Augen und schob sich dann ein Halsbonbon in den Mund. Der Tag zog sich schon zu lange hin. Die ganze Aufregung, die dieser schreckliche Unfall mit sich gebracht hatte, legte sich allmählich, und Symons wollte nur noch nach Hause, irgendetwas zum Essen bestellen, ein bisschen fernsehen und dann ins Bett.
»Eine Frage hätte ich noch«, sagte er.
»Bloß eine?«, entgegnete McFarlane.
»Allerdings eine ziemlich lange: Wie konnte ein Vertreter aus Barking für mehrere Tage verschwinden, einem Mord zum Opfer fallen und am Ende in einem herrenlosen Wagen die Heath Street hinunterrasen? Oder vielleicht meine ich eher, warum?«
»Die gute Nachricht ist, dass wir das nicht herausfinden müssen. Inzwischen hat sich das Ganze ja als Mordfall entpuppt, sodass sich die weiteren Ermittlungen wohl über unserer Gehaltsklasse abspielen werden. Jemand anderer muss sich jetzt mit Geoffrey Kernan herumschlagen.«
3
Simon Tearle, Gastdozent im Fach Kriminologie am Guildhall College der Universität von London, schenkte aus seiner Kaffeekanne zwei Tassen voll. In eine gab er einen Teelöffel Honig, in die andere einen Schuss halbfette Milch, ehe er beide zu seinem Schreibtisch trug. Wenn er zu seinen Studenten sagte, seine Tür stehe ihnen immer offen, tat er das in der Hoffnung, dass sie ihn nicht beim Wort nahmen. Lola Hayes jedoch hatte ihn beim Wort genommen. Er reichte ihr den Kaffee mit Milch. Es war der Tag, an dem er normalerweise ein paar Minuten für sich allein hatte und in dieser Zeit tun konnte, was er wollte: im Internet surfen, ein Kreuzworträtsel lösen oder einfach nur am Fenster stehen und auf den Russell Square hinausstarren. Nun erschien es ihm fast wie Hohn, dass er über Lolas Schulter hinweg einen kurzen Blick hinaus auf besagten Platz erhaschte, von wo ihm das Laub der Platanen goldgelb entgegenleuchtete.
Frustriert nahm er einen Schluck Kaffee und richtete seine Aufmerksamkeit dann auf seine Studentin. Lola Hayes hatte ein rundes Gesicht, blasse, sommersprossige Haut und große graugrüne Augen. Ihr braunes Haar wirkte weich. Sie schien überhaupt keine harten Kanten zu haben. Voller Interesse blickte sie sich in seinem Büro um, als faszinierten sie die Bilder, die er für die Wände ausgewählt hatte, die Gegenstände auf seinem Schreibtisch.
»Also?«, fragte er.
»Wie bitte?«
»Der Grund für Ihren Besuch. Gibt es ein Problem?«
»Mein Kopf fühlt sich völlig leer an.«
»Inwiefern? Weswegen sind Sie hier?«
»Wegen der Seminararbeit. Ich habe keinen blassen Schimmer, worüber ich schreiben soll.«
Seminararbeit. Allein schon das Wort ließ Tearle erschaudern. Am Ende des ersten Semesters des zweiten Jahres musste jeder Student eine rund zehntausend Wörter umfassende Arbeit zu einem Thema aus dem Bereich Kriminologie fertiggestellt haben. Zehntausend Wörter. Tearle betreute fünfzehn Studenten. Fünfzehn mal zehntausend ergab hundertfünfzigtausend Wörter. Tearle musste jedes einzelne dieser Wörter lesen und anschließend Kommentare schreiben und Noten vergeben.
»Was machen denn die anderen aus Ihrer Clique?«
Lola zog vor Konzentration die Nase kraus. »Ich glaube, Ellie schreibt einen historischen Abriss über sexuellen Missbrauch.«
»Ein interessantes Thema.«
»Ja, aber auch ein sehr umfangreiches. Außerdem macht das ja schon Ellie. Und Rob schreibt etwas über DNA.«
»Was ebenfalls interessant ist. Und wichtig.«
»Ich bin in den wissenschaftlichen Fächern eine Katastrophe. Deswegen habe ich mich ja für Kriminologie entschieden.«
»Genau genommen betrachten wir die Kriminologie auch als Wissenschaft. Nicht umsonst endet der Begriff auf ›ologie‹.«
»Es ist nur so, dass ich den chemischen Teil einfach nicht verstehe.«
Tearle schwieg einen Moment. »Sagen Sie mal, Lola, meinen Sie schon, dass Kriminologie das Richtige für Sie ist?«
Sie riss entsetzt die Augen auf. »Absolut!«, antwortete sie. »Ich finde das Fach echt toll.«
Tearle hatte auf »inspirierend« oder »stimulierend« gehofft, weniger auf »echt toll«. Nachdem er an seinem Computer ihren Namen eingegeben hatte, um die Noten des letzten Jahres abzurufen, hob er überrascht die Augenbrauen. »Sie haben bisher ja gut abgeschnitten. Sehr gut sogar.« Lola lief knallrot an. »Also, Lola, hätten Sie Interesse an etwas Historischem?«
»Ich würde lieber ein aktuelles Thema bearbeiten.«
»Vielleicht unter philosophischen Gesichtspunkten?«
»Eher nicht.«
»Wie wäre es mit einer Person?«
Lolas Miene hellte sich schlagartig auf. Endlich wirkte sie aufmerksam und engagiert. »Genau mein Ding. Ich würde viel lieber über Menschen schreiben als über Ideen oder Wissenschaft.«
Tearle schlug eine Reihe von Namen vor: einen Staatsanwalt, der eine öffentliche Untersuchung geleitet hatte, einen Innenminister, einen Polizeipräsidenten, einen Wahlkampfexperten. Keine dieser Personen schien bei Lola auf großes Interesse zu stoßen. Warum machte er das überhaupt? Die jungen Leute sollten doch eigentlich schon erwachsen sein. Konnte sich diese Lola nicht selbst ein Thema suchen? Aber er musste ihr irgendetwas vorschlagen, und sei es nur, um sie wieder aus seinem Büro zu bekommen. Plötzlich fiel ihm etwas ein. Er ging zu seinem Aktenschrank und zog eine Schublade heraus. Ungeduldig überflog er die verschiedenen Kategorien, bis er auf eine Mappe mit willkürlich zusammengewürfelten Zeitungsausschnitten stieß. Er kippte die Ausschnitte auf seinen Schreibtisch und begann sie durchzublättern: Prozessberichte, Interviews mit Verbrechensopfern, Statistiken über die Häufigkeit von Verbrechen. Nichts davon erschien ihm passend, bis er schließlich an einer Nachricht hängen blieb.
»Sie wollen eine Person?«, fragte er. »Bitte schön, hier ist eine. Haben Sie schon mal von Frieda Klein gehört?«
»Nein.«
Tearle holte tief Luft. Wieder einmal fragte er sich, ob seine Studenten eigentlich irgendetwas mitbekamen – abgesehen von dem, was er ihnen mühsam mit dem Löffel einflößte. »Frieda Klein ist Psychotherapeutin. Vor etwa zehn Jahren hatte sie den Verdacht, dass einer ihrer Patienten in die Entführung von Matthew Faraday verwickelt war. Erinnern Sie sich?«
»Damals war ich noch ein Kind.«
»Jedenfalls wurde sie dadurch irgendwie zu einer Art informellen, inoffiziellen Beraterin der Polizei. Sie war an den Ermittlungen im Mordfall Robert Poole beteiligt, und auch im Fall Lawrence Dawes. Irgendwann wurde es dann ein bisschen kompliziert. Vielleicht haben Sie in der Zeitung gelesen, dass sie verhaftet wurde. Mehr als einmal, glaube ich.«
»Nein, davon weiß ich nichts.«
»Lola, Sie studieren Kriminologie. Da sollten Sie solche Sachen eigentlich wissen.«
»In meinen Seminaren wurde das Thema nie angesprochen.«
»An den Ermittlungen im Fall Hannah Docherty war sie ebenfalls beteiligt. Darüber haben Sie bestimmt etwas gelesen.«
»Der Name kommt mir bekannt vor«, antwortete Lola, klang aber nicht sehr überzeugend.
»Oder, noch aktueller, in den Nachahmungstäterfällen unten in Silvertown.«
»A-ah ja.«
»Jetzt haben Sie die Chance, alles über Frieda Klein in Erfahrung zu bringen. Analysieren Sie die Frau. Nehmen Sie sie auseinander. Dekonstruieren Sie sie.«
»Wie soll ich da vorgehen?«
»Das bleibt Ihnen überlassen. Stellen Sie einfach Fragen. Warum braucht die Polizei die Hilfe einer Psychotherapeutin? Sind polizeiliche Ermittlungen eigentlich eine Form von Therapie? Impliziert das ein Scheitern der herkömmlichen Polizeiarbeit?«
»Wie fange ich an?«
»Indem Sie einfach anfangen!«, antwortete Tearle schärfer als beabsichtigt. Er riss sich am Riemen. »Gehen Sie in die Bibliothek, informieren Sie sich über sie. Lesen Sie ihre wissenschaftlichen Arbeiten oder diejenigen, die andere über sie geschrieben haben. Sehen Sie die Zeitungsberichte durch. Die Frau hat im Lauf der Jahre eine ziemliche Spur hinterlassen.«
»Super«, sagte Lola. »Kann ich diesen Ausschnitt hier behalten?«
»Klar.« Lola stand auf und wandte sich bereits zum Gehen, als Tearle noch etwas einfiel. »Es gibt hier an der Uni jemanden, der sie kennt oder zumindest über sie Bescheid weiß. Professor Hal Bradshaw unten in der Psychologie.«
»Den kenne ich«, verkündete Lola. »Ich habe ihn im Fernsehen gesehen.«
»Die Welt der Psychologie ist recht klein. Ich glaube, die beiden sind sich ein paarmal über den Weg gelaufen.«
Fünf Minuten später klopfte Lola drei Stockwerke tiefer an eine Tür, auf der Hal Bradshaws Name stand.
»Herein«, sagte eine Stimme.
Sie öffnete die Tür und trat ein. Nachdem sie gerade aus Simon Tearles Büro kam, hatte sie jetzt das Gefühl, in eine ganz andere Welt geraten zu sein. Tearles Zimmer war voller Bücherregale gewesen und jede Ablagefläche mit Zeitungen und Fachzeitschriften bedeckt. Verglichen damit, sah dieser Raum so gut wie leer aus. Die kahlen Wände waren in einem weißlichen Blauton gestrichen, der fast schon grau wirkte. Es fanden sich dort weder Bilder noch Bücher und, abgesehen von einem Schreibtisch und zwei Stühlen, auch keine Möbel. Auf dem Schreibtisch thronte ein großer Laptop-Computer, flankiert von einem Block und einem Stift. Der Mann hinter dem Schreibtisch blickte zu Lola hoch. Sie war ihrerseits derart fasziniert von seiner Brille – deren Fassung eher unterhalb als oberhalb der Gläser angebracht war – und von seiner in Gelbtönen, Orangerot und Blau gesprenkelten Krawatte, dass sie die Person dahinter kaum wahrnahm.
»Ja?«, fragte er.
Da sprudelte Lola los: »Es ist überhaupt nicht in Ordnung, dass ich hier völlig unangemeldet hereinplatze, aber Simon Tearle ist mein Dozent, und ich habe gerade mit ihm gesprochen. Ich glaube, ich werde meine Seminararbeit über diese Frau schreiben, diese Frieda Klein. Er hat gesagt, Sie kennen sie, und deswegen dachte ich mir, ich könnte vielleicht kurz mit Ihnen reden.«
Bradshaw runzelte die Stirn, forderte Lola dann aber mit einer Handbewegung auf, ihm gegenüber Platz zu nehmen. Mittlerweile war Lola in der Lage, ihn genauer zu betrachten. Er wirkte sehr gepflegt, sein Gesicht glatt, das kurze Haar tadellos. Bei der Arbeit hier in seinem Büro machte er exakt den gleichen Eindruck wie im Fernsehen.
»Frieda Klein«, wiederholte er langsam, als würde er sich den Klang der Worte auf der Zunge zergehen lassen.
»Kennen Sie sie persönlich?«, fragte Lola.
»Ja.«
Es folgte eine Pause.
»Ich hatte gehofft, Sie könnten mir etwas über sie erzählen. Mich in die richtige Richtung lenken.«
»Sie studieren Kriminologie, oder?«
»Ja.«
»Dann haben Sie ja wahrscheinlich schon gelesen, dass polizeiliche Ermittlungen oft Spinner, Scharlatane und geistig Gestörte anziehen?«
»Meinen Sie damit Frieda Klein?«
»Ich meine nur, dass Sie an das Phänomen, dass eine Amateurin sich in polizeiliche Ermittlungen hineinmogelt, mit einer gewissen Objektivität herangehen sollten.«
»Ich dachte, sie hätte zur Aufklärung mehrerer Fälle beigetragen.«
Bradshaw reagierte mit einem traurigen Lächeln. »Ich würde Ihnen dringend raten, Frieda Kleins Selbsteinschätzung nicht zu übernehmen. Wenn Sie richtig recherchieren, werden Sie womöglich feststellen, dass Klein eine Spur der Verwüstung hinter sich herzieht.«
»Das klingt, als würden Sie sie ganz und gar nicht mögen.«
Bradshaw schüttelte den Kopf. »Ich bin Wissenschaftler. Als solcher analysiere ich lediglich die Fakten. Wenn manche Leute sie als Betrügerin, Wichtigtuerin oder sogar als Bedrohung sehen, dann ist das deren Sache. Oder Ihre.«
4
Wo ist der her? Los, raten Sie!«
Dan Quarry griff nach dem frisch eingeschenkten Glas Whisky, roch daran und nahm dann einen Schluck. Eigentlich trank er schon seit Monaten keinen Alkohol mehr. Er hatte es seiner Frau versprochen. Aber nun gab es diesen besonderen Anlass, außerdem gehörte ein Kneipenbesuch mit seinem neuen Chef zum Job, also zum Pflichtprogramm. Erneut schnupperte und kostete er. Das war bereits der vierte – oder gar schon der fünfte? Mittlerweile schienen sie alle gleich zu schmecken.
»Schottland?«, mutmaßte er.
Detective Inspector Bill Dugdale wirkte enttäuscht. »Schottland? Wenn er aus Schottland wäre, hätte ich Sie gar nicht erst gefragt. Nein, der kommt aus Japan. Feines Zeug. Mild. Hat durchaus Klasse.«
»Ich wusste gar nicht, dass die in Japan Whisky machen.«
»Sie müssen noch eine Menge lernen, sowohl über Polizeiarbeit als auch über Whisky.« Dugdale hob sein Glas. »Auf alle Schuldsprüche!«
Quarry trank aus. Kurz nach drei Uhr nachmittags waren sie über das Urteil informiert worden und schnurstracks ins Pub gegangen, die Detectives und auch die uniformierten Kollegen. Nach ein paar Stunden, geprägt von Lachen, Schulterklopfen und spöttischen Scherzen über die missglückte Strategie der Verteidigung, hatte Dugdale seinem neuen Kollegen zugenickt, und sie waren in eine Seitenstraße der Tottenham Court Road gegangen, in eine Kneipe, wo nur Mitglieder Zutritt hatten. Dugdale hatte von einer Whiskyprobe gesprochen, als handelte es sich dabei um ein wissenschaftliches Experiment.
»Jedes Mal, wenn wir zu einem guten Abschluss kommen«, hatte Dugdale erklärt, »dann probiere ich ein halbes Dutzend Whiskys, die ich noch nicht kenne.«
Ein halbes Dutzend, wiederholte Quarry in Gedanken. Das hieß, dass noch einer ausstand. Womöglich blühten ihm sogar noch zwei. Verstohlen musterte er seinen neuen Chef. Dugdale hatte einen großen Kopf, kurz geschorenes Haar und ein rundes, meist gerötetes Gesicht mit weichen Konturen und leicht schwammiger Haut. Der warme Grauton seiner Augen verlieh ihm einen sanften Blick, aber Quarrys früherer Chef unten in Camberwell hatte gemeint, er solle sich in Acht nehmen. Dugdales vorheriger Assistent war ganz plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Niemand wollte Quarry den genauen Grund nennen, doch gerade das machte ihn nervös. Ansatzweise hatte er selbst bereits mitbekommen, was passierte, wenn sein Chef nicht zufrieden war.
»Also, welcher ist Ihr bisheriger Favorit?«, wollte Dugdale jetzt wissen.
Quarry versuchte sich zu erinnern. Einer hatte unangenehm karamellig geschmeckt, ein anderer gerochen wie das Zeug, das man auf Schnitt- oder Schürfwunden tupfte. Dann war da noch der gewesen, der laut Dugdale Fassstärke hatte: »Zu dem werden Sie einen Schuss Wasser brauchen, mein Junge.«
Quarrys ehrliche Antwort wäre gewesen: keiner. Er mochte keinen Whisky. Diesen Teil seines Jobs mochte er überhaupt nicht besonders – das Trinken, die derben Scherze, das kameradschaftliche Getue, als wäre alles bestens, auch wenn das gar nicht stimmte. Nachdenklich ließ er den Blick durch den kleinen, im oberen Stockwerk gelegenen Raum schweifen, in dem sie sich gerade befanden. Es herrschte eine Atmosphäre wie in einem Freimaurerklub. Grüppchen von Männern in Anzügen tranken und redeten miteinander, um Geschäfte zu machen, Kontakte zu knüpfen, Netzwerke aufzubauen. Wie sie ihn wohl einschätzten? Er warf einen Blick in den Spiegel hinter der Theke und sah darin ein Gesicht, das er kaum als das seine erkannte: bleich, unrasiert, leicht verspannt. Am liebsten hätte er jetzt einen Moment seine Ruhe gehabt, um draußen vor der Tür eine zu rauchen und seine Gedanken zu ordnen. Aber er musste eine Wahl treffen.
Der Japaner schmeckte am wenigsten wie Whisky, was fast so gut war, wie gar keinen Whisky zu trinken.
»Dieser hier«, sagte er. »Der ist so …« – er suchte nach einem passenden Wort – »… unaufdringlich.«
»Unaufdringlich«, wiederholte Dugdale und lachte schallend. »Das gefällt mir! Unaufdringlich. Übrigens eine gute Wahl. Ich schätze, dann werden Sie den nächsten auch mögen.«
Doch bevor er bestellen konnte, klingelte sein Telefon. Im ersten Moment wirkte Dugdale gereizt, doch innerhalb weniger Sekunden schien sich sein ganzes Gesicht zu verändern, zu verhärten. Er stellte ein paar knappe Fragen, aber hauptsächlich hörte er zu. Als er das Telefon schließlich wieder einsteckte, wirkte er gedankenverloren, als hätte er vollkommen vergessen, dass Quarry auch noch da war. Dann blickte er sich um.
»Wir werden den Bourbon aufs nächste Mal verschieben müssen«, erklärte er.
»Wie schade.«
Dugdale musterte ihn aus zusammengekniffenen Augen. Mit einem Anflug von Nervosität fragte sich Quarry, ob er gerade sarkastisch geklungen hatte.
»In Hampstead ist doch dieser Wagen völlig außer Kontrolle die Heath Street hinuntergeschossen und hat einen Mann totgefahren«, erklärte Dugdale. »Im Wageninneren wurde eine weitere Leiche gefunden. Haben Sie das gelesen?«
»Nein«, antwortete Quarry.
Aus Dugdales Miene sprach Missbilligung, als fände er, dass es zu Quarrys Job gehörte, so etwas zu wissen. »Der Fall ist jetzt unser Problem.«
Am nächsten Morgen um zehn saß Quarry seinem Chef an dessen Schreibtisch gegenüber. Auf den Knien balancierte er eine Akte und ein Notizbuch, beides in gefährlicher Schieflage. Dugdale nahm einen Karton Milch von dem Tablett auf seinem Tisch und gab einen Schuss in seinen Kaffee.
»Trinken Sie keinen, Dan?«, fragte er.
Quarry schüttelte den Kopf. »Ich hatte schon zu viele.« Er war bereits vor sieben ins Büro gekommen, um das Material zu dem Fall zu sichten.
Dugdale lachte in sich hinein. »Sie sehen aus, als hätten Sie gestern Abend auch ein paar zu viel erwischt.«
Quarry gingen mehrere Antworten durch den Kopf, die er ihm darauf hätte geben können, doch er behielt sie lieber für sich.
»Ich stelle gerade ein Team zusammen«, fuhr Dugdale fort. »Aber bevor wir die erste Besprechung einberufen, sollten wir erst mal klären, wo wir stehen.«
»Deswegen habe ich heute schon so früh angefangen.«
»Also, wo stehen wir?«
»Ich bin die Befragungen der Augenzeugen durchgegangen«, begann Quarry.
»Zeitverschwendung«, meinte Dugdale. »Die haben alle was anderes gesehen. Einer hat behauptet, in dem Wagen wären zwei Personen gewesen. Ein anderer will gesehen haben, dass der Fahrer mit beiden Händen das Steuerrad umklammerte und dabei grinste.« Er nahm einen Schluck Kaffee. »Manchmal frage ich mich, warum wir uns überhaupt die Mühe machen, mit Augenzeugen zu sprechen.«
»Der Wagen wurde in Didcot gestohlen«, informierte ihn Quarry. »Der Besitzer ist in Urlaub. Deswegen wurde der Diebstahl nicht gemeldet.«
Dugdale runzelte die Stirn. »Sind Sie sicher, dass der Besitzer in Urlaub ist? Hat das jemand überprüft?«
Quarry warf einen Blick in seine Unterlagen. »Ja, die Kollegen haben das überprüft. Er ist auf den Kanaren.«
»So ein Glückspilz«, meinte Dugdale.
»So ein Glückspilz nun auch wieder nicht«, entgegnete Quarry. »Immerhin wurde ihm das Auto gestohlen.«
»Vergessen Sie diesen ganzen Mist«, meinte Dugdale. »Fangen wir mit den wichtigen Punkten an. Ein Wagen rast außer Kontrolle eine Londoner Straße hinunter. Die einzige Person im Wagen ist bereits tot. Ermordet. Saß der Mann eigentlich auf dem Fahrersitz?«
Es folgte eine Pause.
»Ich überprüfe das«, sagte Quarry.
»Die Zeugen, die gesehen haben, wie der Wagen in das Schaufenster krachte, spielen im Moment keine Rolle. Entscheidend ist erst einmal, was oben auf dem Hügel passiert ist. Dafür brauchen wir Zeugen.«
»Soweit ich das bisher beurteilen kann, hat die Polizei nur die Leute am eigentlichen Unfallort befragt.«
»Wir sind die Polizei. Wir können weitere Zeugen finden. Wer auch immer für die Sache verantwortlich ist, hat das Auto von einem uns unbekannten Ort zur Heath Street gefahren, ist oben an der Kuppe ausgestiegen und hat dann irgendwie dafür gesorgt, dass der Wagen den Hügel hinunterraste. So etwas muss doch jemandem aufgefallen sein.«
»Falls dem so war, wissen wir nichts darüber.«
»Also ist es nun an uns, die betreffenden Leute in die Finger zu kriegen. Vielleicht gibt es ja Aufzeichnungen von Überwachungskameras.«
»Wir wissen nicht genau, wo das Ganze stattgefunden hat.«
»Dann ziehen Sie los und finden Sie es heraus!« Dugdale rieb sich das Gesicht. »Jemand tötet einen Mann, setzt ihn in einen Wagen und lässt ihn einen Hügel hinuntersausen, mitten hinein in eine Gruppe unschuldiger Leute. Was hat das für einen Sinn?«
Es folgte eine lange Pause.
»Wollen Sie da jetzt eine Antwort hören?«, fragte Quarry.
»Ich will Kameraaufzeichnungen«, entgegnete Dugdale, »oder einen Zeugen. Aber darum können Sie sich später kümmern. Als Erstes müssen wir zu der Witwe. Ihr sagen, dass ihr Mann ermordet wurde.«
5
Eine gute Stunde später standen die beiden Detectives in Barking vor Sarah Kernans Tür. Dugdale drückte auf die Klingel und trat dann wieder einen Schritt zurück. Als schließlich die Tür aufschwang, starrte ihnen das unrasierte Gesicht eines jungen Mannes entgegen. Er war im Schlafanzug, und das Haar stand ihm strubbelig vom Kopf ab. Überrascht starrte Dugdale ihn an.
»Sie sind bestimmt Ned Kernan«, sagte Quarry. »Der Sohn, nicht wahr?«
»Und wer sind Sie?«
Dugdale hielt ihm seinen Ausweis hin. »Wir müssen mit Ihnen und Ihrer Mutter reden.«
In der Küche fanden sie Sarah Kernan am Tisch vor, ebenfalls noch in ihrem Schlafgewand, einem blauen Baumwollnachthemd, über dem sie einen gestreiften Bademantel trug. Ihre Füße steckten in fröhlich gemusterten Hausschuhen. Eine zweite Frau stand an der Spüle, mit dem Rücken zu ihnen.
»Mum, da ist noch mal die Polizei.«
Sie hob die Hand an den Ausschnitt ihres Bademantels. »Damit habe ich nicht gerechnet. Ich bin noch nicht angezogen.«
»Das ist schon in Ordnung«, entgegnete Dugdale. »Wir müssen Ihnen etwas sagen.« Er nickte zu Ned hinüber. »Vielleicht setzen Sie sich besser.«
»Mein Mann ist tot«, sagte Sarah Kernan mit schriller, zittriger Stimme. »Was gibt es denn da noch zu sagen?«
»Soll ich gehen?«, meldete sich die andere Frau zu Wort.
»Nein, bleib da.« Sarah Kernan griff nach ihrem Arm. »Das ist meine Schwester Peggy.«
»Ja, die Familienähnlichkeit ist nicht zu übersehen«, meinte Dugdale.
»Sie sind aber nicht dieselben Polizisten wie beim letzten Mal.«
»Wir haben den Fall übernommen. Also, ich muss Ihnen Folgendes mitteilen: Ihr Mann wurde ermordet.«
Aufmerksam ließ er den Blick zwischen ihr und dem Sohn hin und her wandern, um bei beiden die erste Reaktion mitzubekommen. Ihm war klar, dass Quarry, der hinter ihm neben der Tür stand, das Gleiche tat. Auf der Herfahrt hatte er betont, wie wichtig es sei, Angehörige nicht aus den Augen zu lassen, wenn sie die Neuigkeit erfuhren. So unvorbereitet erwischte man sie nie wieder. In diesem Fall aber bekam er nur Bestürzung zu sehen. Sarah Kernan stieß einen kleinen Schrei aus. Sie klang dabei wie ein gequältes Tier. Ihr Sohn wirkte einfach nur sprachlos. Die Schwester schlug eine Hand vor den Mund und riss die Augen auf.
»Wie kann das sein?«, fragte Sarah Kernan schließlich.
»Wer hat das getan?«, warf Ned Kernan in rauem Ton ein. Dugdale sah, dass er sich bemühte, wie ein Mann zu reagieren, obwohl seine Augen noch die eines Kindes waren und voller Angst.
»Wir beginnen gerade erst mit den Ermittlungen«, erklärte Dugdale. Er wünschte, er könnte etwas Positiveres sagen, ein Versprechen abgeben.
»Dann hat er mich also nicht alleingelassen. Ich wusste doch, er würde mich nicht alleinlassen.«
»Bis jetzt wissen wir nur«, antwortete Dugdale an Mrs. Kernan gewandt, »dass Sie ihn drei Tage bevor seine Leiche in Hampstead in einem Auto gefunden wurde, vermisst gemeldet haben.«
Sie nickte.
»Am dreizehnten September«, warf Quarry ein.
»Ja, ich glaube, es war der Dreizehnte«, antwortete Sarah Kernan. »Oder, Peggy?«
Peggy nickte. »Ja, das müsste stimmen. Möchten Sie Tee?«, fügte sie hinzu.
»Nein danke«, lehnte Dugdale ab.
»Einen Schuss Milch, keinen Zucker«, sagte Quarry, während er sich einen Stuhl heranzog und neben Ned niederließ. »Das Ganze ist natürlich für alle ein Schock.«
»Sie haben ihn vermisst gemeldet«, fuhr Dugdale fort, »bekamen aber die Auskunft, es handle sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um einen Fall für die Polizei. Sehe ich das richtig?«
»Ich hätte mich nicht abwimmeln lassen sollen. Ich war mir sicher, dass die nicht recht hatten.«
»So dürfen Sie nicht denken«, entgegnete Dugdale, »schließlich konnten Sie es doch nicht wissen.«
»Wir hatten uns ein bisschen gezankt«, gestand Sarah Kernan. »Es war so schwer, nur noch zu zweit zu sein, nachdem Ned nicht mehr hier lebte.«
»Mum«, sagte der Junge, der vor Kummer das Gesicht verzog. »Nicht!«
»Jetzt ist es zu spät, um es wieder gutzumachen.« Sie schlug die Hände vors Gesicht.
»Wir müssen herausfinden, was mit Ihrem Mann passiert ist, und damit uns das gelingt, müssen wir Ihnen ein paar Fragen stellen«, erklärte er sanft. »Fühlen Sie sich dem gewachsen?«
Sie ließ die Hände sinken und nickte.
Quarry sah zu, wie Dugdale ihr langsam und geduldig eine Information nach der anderen entlockte. Wie sie bereits wussten, hatte ihr Mann als Vertreter Sanitärbedarf verkauft – Toilettenpapier, Seife, Papiertücher – und viel Zeit in seinem Auto verbracht. Sie selbst arbeitete in einem Gartencenter, obwohl sie nicht viel über Pflanzen wusste. Davor hatte sie eine Stelle als Chefsekretärin in einem Architekturbüro gehabt, aber die Firma war vor ein paar Jahren pleitegegangen. Verheiratet waren sie seit siebenundzwanzig Jahren, und Geoffrey Kernans Mutter lebte noch. Er hatte einen älteren Bruder, dem er nicht nahestand. Sarah Kernan berichtete, er habe in letzter Zeit um seine Arbeit gebangt und deswegen härter geschuftet als je zuvor.
»Alle haben im Moment Probleme«, erklärte sie. »Ich war selber auch schon arbeitslos.«