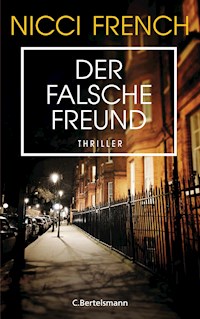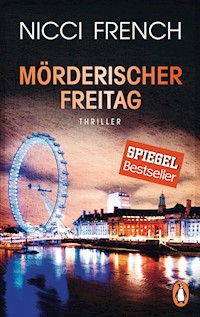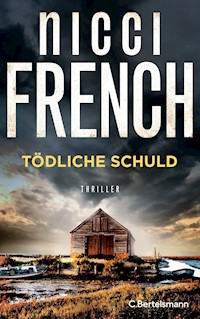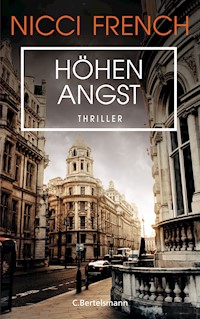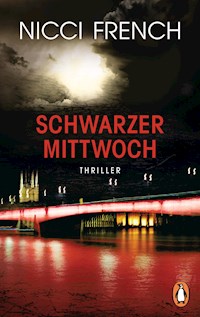
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Psychologin Frieda Klein als Ermittlerin
- Sprache: Deutsch
Ruth Lennox, Mutter von drei Kindern und glücklich verheiratet, wird ermordet aufgefunden. Doch warum musste die allseits beliebte und sozial engagierte Frau sterben? Inspektor Karlsson ruft Psychotherapeutin Frieda Klein zu Hilfe – obwohl diese seit ihrem gemeinsamen letzten Fall strikte Anweisung hat, sich aus jeglichen Ermittlungen rauszuhalten. Frieda hat bald ihre Zweifel am Idyll: Das Leben der Familie Lennox scheint einfach zu perfekt, um wahr zu sein. Und je tiefer sie hinter die Fassaden blickt, desto größer wird die Zahl der Tatverdächtigen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 746
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
NICCI FRENCH
SCHWARZER MITTWOCH
PSYCHOTHRILLER
Deutsch von Birgit Moosmüller
C. Bertelsmann
Die Originalausgabe erschien 2013unter dem Titel »Waiting for Wednesday« bei Michael Joseph (Penguin), London.
1. AuflageCopyright © 2013 by Joined-Up Writing, Ltd.Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2013beim C. Bertelsmann Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbHKarte: Peter Palm, BerlinSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-11765-8
www.cbertelsmann.de
1
Nichts deutete darauf hin, dass etwas nicht stimmte. Es handelte sich um ein ganz normales Reihenhaus an einem ganz normalen Mittwochnachmittag im April. Genau wie all die anderen Häuser in der Straße besaß es einen langen, schmalen Garten. Derjenige zu seiner Linken wurde seit Jahren nicht mehr richtig gepflegt, er war inzwischen von Nesseln und Gestrüpp überwuchert. In dem alten Plastiksandkasten am hinteren Ende staute sich fauliges Wasser, und daneben lag ein umgekipptes Fußballtor in Kindergröße. Der Garten auf der rechten Seite war asphaltiert und gekiest. Dort standen ein paar Pflanzen in Terrakottakübeln, eine Sitzgruppe, die den Winter über zusammengeklappt im Schuppen verstaut wurde, und ein mit schwarzer Abdeckplane geschützter Grill, den die Besitzer während der Sommermonate in die Mitte der Terrasse rollten.
Der Garten dazwischen aber bestand aus einer Rasenfläche, die vor Kurzem zum ersten Mal in diesem Jahr gemäht worden war. An einem alten, knorrigen Apfelbaum leuchteten weiße Blüten. Die Rosensträucher und Büsche, die den Rasen begrenzten, waren so weit zurückgeschnitten, dass ihre Zweige wie Stöcke aus dem Boden ragten. Nahe der Küchentür blühten mehrere Grüppchen orangeroter Tulpen. Unterhalb des Fensters standen leere Blumentöpfe, daneben lag ein einzelner Turnschuh mit gebundenen Schnürsenkeln. Auf einem Brett, das als Futterplatz für die Vögel diente, waren ein paar Samenkörner verstreut. Neben dem Fußabstreifer standen zwei leere Bierflaschen.
Die Katze kam gemächlich den Garten entlang. Vor der Tür blieb sie einen Moment stehen und hob den Kopf, als wartete sie auf etwas. Dann schob sie sich mit einer geschmeidigen Bewegung durch die Katzenklappe in die geflieste Küche, deren Tisch sechs oder mehr Leuten Platz bot und von einer Anrichte flankiert wurde, die eigentlich zu groß für den Raum wirkte. Sie war mit Geschirr vollgestellt, und dazwischen lag allerlei Krimskrams: mehrere Tuben eingetrockneter Kleber, etliche Rechnungen, die noch in ihren Umschlägen steckten, ein Kochbuch, bei dem ein Rezept für Seeteufel mit eingemachten Zitronen aufgeschlagen war, ein Paar zusammengerollte Socken, eine Fünfpfundnote, eine kleine Haarbürste. Von einer Stahlstange über dem Herd hingen mehrere Pfannen. Neben der Spüle stand ein Korb mit Gemüse, in einem kleinen Regalfach waren weitere Kochbücher aufgereiht, auf dem Fensterbrett thronte eine Vase mit Blumen, die schon ein wenig die Köpfe hängen ließen, und auf dem Tisch lag ein aufgeschlagenes Schulbuch. An einer Weißwandtafel war mit rotem Filzstift eine Reihe zu erledigender Punkte aufgelistet. Auf der Arbeitsplatte stand ein Teller mit dem kalt gewordenen Rest einer Toastscheibe und daneben eine Tasse Tee.
Die Katze fraß ein, zwei Bröckchen Trockenfutter aus ihrer Schüssel und fuhr sich anschließend mit der Pfote übers Gesicht, ehe sie ihren Weg durchs Haus fortsetzte: hinaus aus der Küche, deren Tür immer offen stand, vorbei an der kleinen Toilette zur Linken, dann die zwei Stufen hinauf. Sie wich einer zerbrochenen Glasschale aus und umrundete die lederne Umhängetasche auf dem Flurboden. Die Tasche lag mit der Öffnung nach unten; ihr Inhalt war über die Eichendielen verstreut: Lippenstift und Gesichtspuder, ein bereits aufgerissenes Päckchen Papiertaschentücher, der Autoschlüssel, eine Haarbürste, ein kleiner blauer Terminkalender mit einem daran befestigten Stift, eine Packung Paracetamol, ein Spiralblock. Etwas weiter vorne lagen eine aufgeklappte schwarze Brieftasche und rundherum ein paar Mitgliedskarten, unter anderem fürs British Museum. Nicht weit davon entfernt hing ein gerahmter Druck aus einer alten Van-Gogh-Ausstellung ganz schief an der cremefarben gestrichenen Wand, und ein großes Familienfoto war mit gebrochenem Rahmen auf dem Boden gelandet: ein Mann, eine Frau und drei Kinder, die alle breit lächelten.
Vorsichtig schlängelte sich die Katze zwischen den herumliegenden Sachen hindurch. Auf dem Weg ins Wohnzimmer, das auf die Vorderseite des Hauses hinausging, musste sie über einen ausgestreckten Arm steigen. Die Hand war rundlich und fest, mit kurz geschnittenen Nägeln und einem goldenen Ring am vierten Finger. Die Katze roch daran und leckte dann flüchtig übers Handgelenk. Sie kletterte halb auf den Körper, der in einer himmelblauen Bluse und einer schwarzen Hose steckte – Kleidung für die Arbeit. Schnurrend grub sie die Krallen in den weichen Bauch. Um die gewünschte Aufmerksamkeit zu erhalten, schmiegte sie sich schließlich fest an den Kopf mit dem braunen Haar, das schon ein wenig grau wurde und an diesem Tag zu einem lockeren Knoten geschlungen war. An den Ohrläppchen funkelten kleine goldene Stecker, und um den Hals hing eine feine Kette. Die Haut roch nach Rosen und etwas anderem. Die Katze rieb ihren Körper an dem Gesicht und krümmte dabei den Rücken.
Nach einer Weile gab sie auf und stolzierte hinüber zum Sessel, um sich darauf zu putzen, denn mittlerweile war ihr Fell feucht und verklebt.
Dora Lennox ging langsam von der Schule nach Hause. Sie war müde. Mittwochs hatte sie zum Schluss immer eine Doppelstunde Biologie und anschließend noch Swing-Band-Probe. Sie spielte Saxofon, allerdings so schlecht, dass ihr die meisten Töne entgleisten, was den Musiklehrer jedoch nicht zu stören schien. Sie hatte sich nur bereit erklärt mitzumachen, weil ihre Freundin Cam sie dazu überredet hatte, doch wie es aussah, war Cam inzwischen nicht mehr ihre Freundin. Sie flüsterte und kicherte mit anderen Mädchen, die keine Zahnspange trugen und auch nicht mager und schüchtern waren, sondern kühn und kurvig – Mädchen mit schwarzen Spitzen-BHs, schimmernden Lippen und leuchtenden Augen.
Bei jedem Schritt spürte Dora den schweren Rucksack voller Schulbücher am Rücken und den Instrumentenkoffer am Schienbein, während ihre Plastiktragetasche – prall gefüllt mit Kochutensilien und einer Dose verbrannter Scones, die sie an diesem Vormittag in der Hauswirtschaftsstunde gebacken hatte – an einer Seite bereits einriss. Dora war froh, als sie nicht weit vom Haus entfernt den Wagen ihrer Mutter entdeckte, weil das bedeutete, dass diese zu Hause war. Sie kam nicht gern in ein leeres Haus zurück, in dem keine Lichter brannten und über jedem Raum eine graue Stille hing. Ihre Mutter hauchte den Dingen Leben ein: Wenn sie da war, rumpelte der Geschirrspüler oder die Waschmaschine, aus dem Ofen duftete meist Kuchen oder zumindest ein Blech Kekse, im Kessel sprudelte Wasser für den Tee, und im ganzen Haus herrschte eine geordnete Geschäftigkeit, die Dora als tröstlich empfand.
Als sie das Tor aufgemacht hatte und den kurzen, gepflasterten Gartenweg entlangging, bemerkte sie, dass die Haustür offen stand. War ihre Mutter gerade erst heimgekommen? Oder ihr Bruder? Sie hörte auch ein Geräusch, einen pulsierenden, elektronisch klingenden Ton. Im Näherkommen sah sie, dass das kleine Mattglasfenster gleich neben der Tür zerbrochen war. Die Scheibe wies ein Loch auf und hing nach innen. Als Dora wegen des ungewohnten Anblicks stehen blieb, spürte sie etwas an ihrem Bein und blickte nach unten. Die Katze schmiegte sich dagegen. Dora fiel auf, dass dabei ein rostbrauner Fleck auf ihrer neuen Jeans zurückblieb. Verwirrt trat sie ins Haus und ließ die Taschen zu Boden gleiten. Auf den Holzdielen lagen die Scherben des Fensters. Das musste gerichtet werden. Wenigstens war nicht sie daran schuld, sondern höchstwahrscheinlich ihr Bruder Ted. Er machte die ganze Zeit etwas kaputt: Teetassen, Gläser, Fensterscheiben – alles, was zerbrechlich war. Ein beißender Geruch stieg Dora in die Nase. Irgendetwas war gerade am Verbrennen.
»Mum, ich bin da!«, rief sie.
Auf dem Boden lag noch mehr: das große Familienfoto, die Tasche ihrer Mutter, rundherum verstreuter Kleinkram. Es war, als wäre ein Sturm durchs Haus gefegt und hätte alles durcheinandergewirbelt. Einen Augenblick sah Dora in dem Spiegel über dem kleinen Tisch ihr eigenes Spiegelbild: ein kleines bleiches Gesicht, eingerahmt von dünnen braunen Zöpfen. Sie ging hinüber in die Küche, wo der Brandgeruch am stärksten war. Als sie die Ofentür aufzog, schlug ihr Qualm entgegen. Hustend griff sie nach einem Topfhandschuh, nahm rasch das in der höchsten Schiene eingehängte Backblech heraus und stellte es auf den Herd. Vor ihr lagen sechs völlig verkohlte und geschrumpfte Küchlein, nicht mehr zu retten. Dora schloss die Ofentür und drehte das Gas aus. Nun war ihr alles klar: Der Ofen war nicht abgeschaltet worden und das Gebäck daher verbrannt. Der Alarm und der Rauch hatten Mimi erschreckt, so dass sie durch die Wohnung gerannt war und alles Mögliche zerbrochen hatte. Aber warum waren die Kekse verbrannt?
Sie rief noch einmal nach ihrer Mutter. Ihr Blick fiel auf die etwas offen stehende Verbindungstür zum Wohnzimmer, wo auf dem Boden eine Hand mit leicht gekrümmten Fingern zu erkennen war. Einen Moment rührte Dora sich trotzdem nicht von der Stelle, sondern rief noch einmal: »Mum, ich bin da!«
Dann ging sie wie in Trance zurück in die Diele, während sie weiter nach ihrer Mutter rief. Die Tür, die von der Diele ins Wohnzimmer führte, stand ebenfalls einen Spaltbreit offen. Dora sah drinnen etwas liegen, schob die Tür auf, so weit es ging, und zwängte sich in den Raum.
»Mum?«
Zuerst hielt sie die roten Flecken an der hinteren Wand irrtümlicherweise für Farbe. Auf dem Sofa und dem Boden befanden sich ebenfalls große Kleckse von diesem Rot. Plötzlich fuhr ihre Hand wie von selbst an ihren Mund, und sie hörte, wie ein kleines Stöhnen durch ihren Hals nach oben drängte und in diesem schrecklichen Raum zu einem lauten Kreischen anschwoll, das nicht enden wollte. Sie hielt sich mit beiden Händen die Ohren zu, um das Geräusch nicht mehr hören zu müssen, doch es war bereits in ihrem Kopf. Bei dem Rot handelte es sich nicht um Farbe, sondern um Blut, Ströme von Blut, und dann wurde daraus ein dunkler, dunkler See, gleich neben dem Ding, das zu ihren Füßen lag. Ein ausgestreckter Arm, am Handgelenk eine Uhr, die immer noch die Zeit anzeigte, ein Körper in einer bequemen blauen Bluse und einer schwarzen Hose, ein halb abgestreifter Schuh. All das kannte Dora. Das Gesicht aber war kein Gesicht mehr, weil ein Auge fehlte und der zerschmetterte Mund sie durch eine breiige Masse aus zerborstenen Zähnen lautlos anschrie. Eine ganze Seite des Kopfes war eingedrückt und voller Blut, Knorpeln und Knochen, als hätte jemand versucht, möglichst viel davon zu zerstören.
2
Das Haus lag in Chalk Farm, ein paar Straßen entfernt vom Lärm von Camden Lock. Vor dem Eingang parkten ein Krankenwagen und mehrere Streifenwagen. Der Tatort war bereits mit Absperrband gesichert, und ein paar Schaulustige hatten sich auch schon eingefunden.
Detective Constable Yvette Long schob sich unter dem Band hindurch und betrachtete zuerst einmal das Gebäude, ein spätviktorianisches Reihenhaus mit kleinem Vorgarten und Erkerfenster. Als sie gerade hineingehen wollte, sah sie ihren Chef, Detective Chief Inspector Malcolm Karlsson, aus einem Wagen steigen und wartete auf ihn. Er wirkte ernst und in Gedanken versunken, bis er sie schließlich entdeckte und mit einem Nicken begrüßte.
»Waren Sie schon drin?«
»Ich bin auch eben erst gekommen«, antwortete Yvette. Nach kurzem Zögern platzte sie heraus: »Es ist komisch, Sie ohne Frieda zu sehen.«
Karlssons Ausdruck wurde hart.
»Sie meinen, Sie sind froh, dass sie nicht mehr für uns arbeitet.«
»Nein … nein, so habe ich das nicht gemeint«, stammelte Yvette.
»Ich weiß doch, wie sehr es Sie gestört hat, dass sie immer mit von der Partie war«, entgegnete Karlsson, »aber das ist inzwischen ja geklärt. Der Chef hat entschieden, dass sie raus ist aus dem Team, und im Verlauf dieser ganzen Aktion wäre sie fast ermordet worden. Ist das der Teil, den Sie so lustig finden?«
Yvette lief rot an, gab ihm aber keine Antwort.
»Haben Sie sie besucht?«, fragte Karlsson.
»Ja, im Krankenhaus.«
»Das reicht nicht. Sie sollten mit ihr reden. Aber vorher …«
Er deutete auf das Gebäude, woraufhin sie sich beide in Bewegung setzten. Drinnen wimmelte es bereits von Leuten, die alle Überschuhe, Overalls und Handschuhe trugen. Es wurde nur wenig gesprochen, und wenn, dann in gedämpftem Ton. Karlsson und Yvette zogen ihrerseits Überschuhe und Handschuhe an. Als sie schließlich den Flur entlanggingen, kamen sie zunächst an einer Handtasche vorbei, die auf dem Holzboden lag, dann an einem Foto in einem zerbrochenen Rahmen und schließlich an einem Mann, der die Umgebung auf Fingerabdrücke untersuchte. Im Wohnzimmer waren bereits Scheinwerfer installiert.
In dem gleißenden Licht wirkte die Frau, als befände sie sich auf einer Bühne. Sie lag auf dem Rücken, einen Arm ausgestreckt, den anderen nah am Körper, die Hand zur Faust geballt. Ihr braunes Haar war schon leicht ergraut. Der zerschlagene Mund erinnerte an die gefletschten Lefzen eines vor Angst halb wahnsinnigen Tiers, auch wenn Karlsson von dort, wo er stand, eine Füllung zwischen den zerborstenen Zähnen schimmern sehen konnte. An der einen Gesichtshälfte wirkte die Haut recht glatt – aber manchmal glättet der Tod die Spuren des Lebens, um stattdessen seine eigenen zu hinterlassen, ging Karlsson durch den Kopf. Die Falten am Hals wiesen auf eine Frau mittleren Alters hin.
Das rechte, weit aufgerissene Auge starrte blicklos in den Raum. Die linke Gesichtshälfte war eingedrückt, eine klebrige, mit Knochenstücken durchsetzte Masse. Rundherum war der beigefarbene Teppich blutgetränkt, der ganze restliche Boden mit angetrockneten Flecken übersät und auch die nächstgelegene Wand von oben bis unten mit Blut gesprenkelt. Das konventionell eingerichtete Wohnzimmer hatte sich in einen Schlachthof verwandelt.
»Da hat jemand heftig zugeschlagen«, murmelte Karlsson, während er sich aufrichtete.
»Einbruch«, verkündete eine Stimme in seinem Rücken. Karlsson blickte sich um. Hinter ihm stand, eine Spur zu nahe, ein noch sehr jung und pickelig aussehender Detective, der leicht verlegen lächelte.
»Was?«, blaffte Karlsson. »Wer sind Sie überhaupt?«
»Riley«, stellte der Beamte sich vor.
»Sie hatten etwas gesagt.«
»Einbruch«, wiederholte Riley. »Der Täter wurde überrascht und schlug zu.«
Als er Karlssons Gesichtsausdruck sah, erstarb Rileys Lächeln.
»Ich habe nur laut gedacht«, erklärte er. »Ich versuche, positiv an den Fall heranzugehen. Proaktiv.«
»Proaktiv«, wiederholte Karlsson. »Und ich war der Meinung, wir sollten vielleicht erst mal den Tatort auf Fingerabdrücke, Haare und Fasern untersuchen und ein paar Zeugenaussagen aufnehmen, bevor wir Schlüsse daraus ziehen, was passiert ist. Falls Sie damit einverstanden sind.«
»Natürlich, Sir.«
»Gut.«
»Chef …«
Chris Munster hatte den Raum betreten. Er blieb einen Moment stehen und betrachtete die Leiche.
»Was gibt es, Chris? Wissen wir schon Genaueres?«
Es kostete Munster sichtlich Mühe, seine Aufmerksamkeit wieder auf Karlsson zu richten.
»Ich werde mich nie daran gewöhnen«, erklärte er.
»Versuchen Sie es«, sagte Karlsson. »Die Angehörigen haben nichts davon, wenn Sie auch noch leiden.«
»Stimmt«, gab Munster ihm recht, während er gleichzeitig einen Blick in sein Notizbuch warf. »Ihr Name ist Ruth Lennox. Sie hat als Gesundheitsschwester für die örtlichen Behörden gearbeitet. Sie wissen schon, Besuche bei alten Leuten und jungen Müttern, solche Sachen. Vierundvierzig Jahre alt, verheiratet, drei Kinder. Die jüngste Tochter hat sie gefunden, als sie gegen halb sechs von der Schule nach Hause kam.«
»Ist das Mädchen da?«
»Oben, mit dem Vater und den anderen beiden Kindern.«
»Geschätzter Todeszeitpunkt?«
»Nach Mittag, vor achtzehn Uhr.«
»Das bringt uns aber nicht viel weiter.«
»Ich gebe nur wieder, was Doktor Heath mir gesagt hat. Er meinte, es sei zu bedenken, dass das Haus geheizt war und heute außerdem ein warmer Tag, so dass zusätzlich Sonne durchs Fenster hereinfiel. Und dass es sich bei seiner Arbeit nicht um eine exakte Wissenschaft handelt.«
»Na, wunderbar. Mordwaffe?«
Munster zuckte mit den Achseln.
»Etwas Schweres, hat Doktor Heath gemeint, mit scharfer Kante. Aber keine Klinge.«
»Nimmt jemand die Fingerabdrücke der Angehörigen?«
»Ich kümmere mich darum.«
»Wurde etwas gestohlen?«, meldete Yvette sich zu Wort.
Karlsson wandte sich ihr zu. Es war das Erste, was sie sagte, seit sie das Haus betreten hatten. Trotzdem klang ihre Stimme immer noch zittrig. Wahrscheinlich war er zu hart mit ihr umgesprungen.
»Der Ehemann steht unter Schock«, antwortete Munster. »Aber wie es aussieht, wurde ihre Brieftasche geleert.«
»Ich rede besser mal mit der Familie«, erklärte Karlsson. »Oben, sagen Sie?«
»In seinem Arbeitszimmer. Es ist gleich der erste Raum, wenn man die Treppe hochkommt, neben dem Bad. Melanie Hackett ist bei ihnen.«
»Gut.« Karlsson überlegte einen Moment. »Hier in der Gegend hat lange Zeit ein Detective namens Harry Curzon gearbeitet. Ich glaube, inzwischen ist er pensioniert. Könnten Sie mir seine Nummer beschaffen? Die örtliche Polizei kennt ihn bestimmt noch.«
»Wozu brauchen Sie ihn?«
»Er weiß über das Viertel Bescheid. Vielleicht kann er uns ein bisschen Mühe und Arbeit ersparen.«
»Ich werde sehen, was ich tun kann.«
»Und reden Sie mal ein Wort mit unserem jungen Riley hier. Er weiß nämlich bereits, was passiert ist.« Mit diesen Worten wandte Karlsson sich an Yvette und forderte sie mit einer Handbewegung auf, ihn nach oben zu begleiten. An der Tür zum Arbeitszimmer blieb er stehen und lauschte, doch es waren keinerlei Geräusche zu hören. Er hasste diesen Teil seiner Arbeit. Oft waren die Leute böse auf ihn, weil er ihnen die schlimme Nachricht überbrachte, und gleichzeitig klammerten sie sich an ihn, weil sie sich von ihm eine Art Lösung erwarteten. In diesem Fall hatte er es noch dazu mit einer ganzen Familie zu tun. Drei Kinder, hatte Munster gesagt. Die Ärmsten. Dem Aussehen nach war ihre Mutter eine nette Frau gewesen, ging ihm durch den Kopf.
»Bereit?«
Yvette nickte, woraufhin er dreimal kurz klopfte, ehe er die Tür öffnete.
Der Vater saß auf einem Bürostuhl und drehte sich abwechselnd in die eine und die andere Richtung. Er trug noch seine dicke Winterjacke und hatte einen Baumwollschal um den Hals gebunden. Sein pausbäckiges Gesicht war rot gefleckt, als wäre er gerade erst aus der Kälte hereingekommen, und ständig blinzelte er, als hätte er Staub in den Augen, leckte sich dabei immer wieder über die Lippen und zupfte gleichzeitig am linken Ohrläppchen herum. Auf dem Boden zu seinen Füßen hatte sich die jüngere Tochter – diejenige, die Ruth Lennox gefunden hatte – in Fötushaltung zusammengerollt. Halb schluchzend, halb würgend rang sie nach Luft. Karlsson fand, dass sie sich anhörte wie ein verwundetes Tier. Viel sehen konnte er von ihr nicht, nur dass sie recht dünn war und braune Zöpfe hatte, die sich allmählich auflösten. Der Vater legte ihr hilflos eine Hand auf die Schulter, zog sie aber gleich wieder zurück. Die andere Tochter, die Karlsson auf fünfzehn oder sechzehn schätzte, saß ihnen gegenüber, die Beine unter den Körper gezogen und beide Arme um sich geschlungen, als versuchte sie sich zu wärmen und gleichzeitig so klein wie möglich zu machen. Sie hatte kastanienbraune Locken und das runde Gesicht ihres Vaters, mit vollen roten Lippen, blauen Augen und Sommersprossen. Ihre Wimperntusche war auf einer Seite verschmiert, wodurch sie auf eine theatralische Weise angemalt wirkte, fast wie ein Clown. Trotzdem erkannte Karlsson sofort, dass sie eine sinnliche Anziehungskraft besaß, der nicht einmal ihr ruiniertes Make-up und ihre extreme Blässe etwas anhaben konnten. Sie trug rötlich braune Shorts über einer schwarzen Strumpfhose und dazu ein T-Shirt mit einem Logo, das Karlsson nichts sagte. Seit er den Raum betreten hatte, starrte sie ihn unverwandt an und kaute dabei hektisch auf ihrer Unterlippe herum. Der Junge – fast schon ein junger Mann –, saß in der Ecke, die Knie bis unters Kinn gezogen, das Gesicht hinter einem dunkelblonden Haarschopf verborgen. Hin und wieder schauderte er heftig, hob aber nicht einmal den Kopf, als Karlsson sich vorstellte.
»Es tut mir so leid«, sagte Karlsson. »Aber ich bin hier, um zu helfen, und muss deswegen ein paar Fragen stellen.«
»Warum?«, flüsterte der Vater. »Warum sollte jemand den Wunsch haben, Ruth zu töten?«
Woraufhin das ältere Mädchen plötzlich laut aufschluchzte.
»Ihre jüngere Tochter hat sie gefunden«, fuhr Karlsson in sanftem Ton fort. »Ist das richtig?«
»Dora, ja.« Lennox wischte sich mit dem Handrücken über den Mund. »Wie soll sie das jemals verkraften?«
»Mister Lennox«, mischte Yvette sich ein, »es gibt Fachleute, die Ihnen da helfen können.«
»Russell. Kein Mensch nennt mich Mister Lennox.«
»Wir müssen mit Dora über das sprechen, was sie gesehen hat.«
Die kleine Gestalt auf dem Boden stieß ein gequältes Wimmern aus. Yvette wandte sich Hilfe suchend an Karlsson.
»Dein Vater kann bei dem Gespräch dabei sein.« Karlsson beugte sich zu Dora hinunter. »Oder wenn du lieber mit einer Frau sprichst als mit einem Mann, dann …«
»Sie will nicht«, fiel ihm die ältere Schwester ins Wort. »Haben Sie das denn nicht verstanden?«
»Wie heißt du?«, fragte Karlsson.
»Judith.«
»Und wie alt bist du?«
»Fünfzehn. Hilft Ihnen das irgendwie weiter?« Sie funkelte Karlsson mit ihren stechenden blauen Augen an.
»Es ist eine schreckliche Tragödie«, gab er ihr zur Antwort, »aber wir müssen alle Einzelheiten in Erfahrung bringen. Nur dann können wir denjenigen finden, der das getan hat.«
Ruckartig hob ihr Bruder den Kopf. Er rappelte sich hoch und eilte zur Tür. Er war groß und schlaksig und hatte die grauen Augen seiner Mutter.
»Ist sie noch da?«, wandte er sich an Karlsson.
»Wie bitte?«
»Ted«, sagte Russell Lennox in beruhigendem Ton, während er auf seinen Sohn zuging und die Hand nach ihm ausstreckte, »ist schon gut, Ted.«
»Meine Mutter«, stieß der Junge hervor, ohne den Blick von Karlsson abzuwenden, »ist sie noch da?«
»Ja.«
Ted riss die Tür auf und stürmte die Treppe hinunter. Karlsson rannte hinter ihm her, erwischte ihn aber nicht mehr rechtzeitig. Ein Schrei gellte durchs Haus.
»Nein!«, rief Ted dann immer wieder. »Nein, nein, nein!« Er war neben der Leiche seiner Mutter auf die Knie gesunken. Karlsson schlang einen Arm um ihn, hievte ihn hoch und zog ihn aus dem Raum.
»Beruhige dich, Ted!«
Karlsson drehte sich um. Eine Frau stand in der Haustür. Er schätzte sie auf Ende dreißig. Sie war stämmig gebaut und hatte dunkelbraunes, zu einem altmodischen Pagenkopf geschnittenes Haar. Bekleidet war sie mit einem knielangen Tweedrock, und um ihre Brust hing eine gelbe Stoffschlinge, in der sie etwas trug. Erst auf den zweiten Blick realisierte Karlsson, dass es sich um ein noch sehr kleines Baby handelte. Oben sah man das kahle Köpfchen hervorlugen, unten zwei winzige Füße. Die Frau richtete den Blick auf Russell, der seinem Sohn nach unten gefolgt war. Ihre Augen glänzten feucht.
»Ich habe mich sofort auf den Weg gemacht«, erklärte sie. »Es ist so schrecklich.«
Sie ging auf Russell zu und begrüßte ihn mit einer langen Umarmung, die etwas linkisch ausfiel, weil der zwischen ihnen eingeklemmte Säugling sie auf Abstand hielt. Russell blickte dabei mit hilfloser Miene über die Schulter der Frau hinweg, bis diese sich schließlich Karlsson zuwandte.
»Ich bin Ruths Schwester«, erklärte sie. Das Bündel vor ihrer Brust bewegte sich und wimmerte leise, woraufhin sie es sanft tätschelte und dabei beruhigend mit der Zunge schnalzte.
Sie strahlte jene aufgeregte Ruhe aus, die manche Leute in Krisensituationen an den Tag legten. Karlsson hatte das schon öfter erlebt. Katastrophen zogen die Menschen an. Verwandte, Freunde und Nachbarn versammelten sich, um zu helfen, Trost zu spenden oder einfach auf irgendeine Art am Geschehen teilzuhaben und sich an seiner schrecklichen Glut zu wärmen.
»Das ist Louise«, stellte Russell sie vor, »Louise Weller. Ich habe ein paar von unseren Verwandten angerufen, damit sie es nicht von jemand anderem erfahren müssen.«
»Wir nehmen gerade eine Aussage auf«, erklärte Karlsson. »Es tut mir leid, aber …«
»Ich bin nur hier, um zu helfen«, fiel Louise ihm energisch ins Wort. »Schließlich geht es um meine Schwester.« Abgesehen von ein paar roten Flecken auf den Wangen wirkte ihr Gesicht sehr bleich. »Meine beiden anderen Kinder sind noch im Auto«, fuhr sie fort. »Ich werde sie gleich holen und irgendwo einen Platz für sie finden, wo sie nicht stören. Aber erst will ich wissen, was passiert ist.«
»Ich lasse Ihnen ein paar Minuten Zeit«, erklärte Karlsson. »Wenn Sie dann so weit sind, können wir reden.«
Er geleitete sie die Treppe hinauf und gab Yvette ein Zeichen, ihm aus dem Raum zu folgen.
»Zu allem Überfluss«, sagte er draußen zu ihr, »müssen die Ärmsten nun auch noch für ein paar Tage das Haus räumen. Können Sie ihnen das beibringen, Yvette? Mit möglichst viel Fingerspitzengefühl? Vielleicht hat die Familie ja nette Nachbarn oder Freunde, die in der Nähe wohnen.« Als er sich umblickte, sah er Riley die Treppe heraufkommen.
»Da ist jemand, der Sie sehen möchte, Sir«, verkündete der junge Beamte. »Er sagt, Sie kennen ihn.«
»Wer ist es denn?«, fragte Karlsson.
»Ein Doktor Bradshaw«, antwortete Riley. »Wie ein Polizist sieht er nicht aus.«
»Er ist auch keiner«, bestätigte Karlsson, »sondern so eine Art psychologischer Berater. Aber was spielt es überhaupt für eine Rolle, wie er aussieht? Wir lassen ihn besser herein und geben ihm die Chance, sich sein Geld zu verdienen.«
Als Karlsson die Treppe hinunterging und Hal Bradshaw unten in der Diele warten sah, wurde ihm klar, was Riley meinte. Der Mann sah tatsächlich nicht aus wie ein Detective. Er trug einen Anzug, dessen Grau mit einer Spur von Gelb gesprenkelt war, und dazu ein weißes Hemd mit offenem Kragen. Karlsson fielen besonders die ockerfarbenen Wildlederschuhe und das große, wuchtig wirkende Brillengestell auf. Bradshaw begrüßte ihn mit einem Nicken.
»Wie haben Sie so schnell von der Sache hier erfahren?«, wollte Karlsson wissen.
»Das ist eine neue Regelung.« Bradshaw blickte sich nachdenklich um. »Ich bin gern am Tatort, solange er noch frisch ist. Je eher ich vor Ort eintreffe, desto nützlicher kann ich sein.«
»Mich hat über diese neue Regelung niemand informiert«, entgegnete Karlsson.
Bradshaw schien seinen Worten keinerlei Beachtung zu schenken. Stattdessen blickte er sich suchend um.
»Ist Ihre Freundin gar nicht da?«
»Welche Freundin?«
»Doktor Klein«, antwortete er, »Frieda Klein. Ich habe fest damit gerechnet, sie hier beim Herumschnüffeln anzutreffen.«
Hal Bradshaw und Frieda hatten beide am selben Fall gearbeitet, wobei Frieda fast ums Leben gekommen wäre. Alles hatte damit begonnen, dass in der Wohnung einer geistig gestörten Frau namens Michelle Doyce eine nackte, bereits verwesende Männerleiche gefunden wurde. Bradshaw war davon überzeugt gewesen, dass Michelle Doyce den Mann getötet hatte. Frieda hingegen hatte aus den wirren Worten der Frau eine Art Sinn herausgehört, einen verworrenen Versuch, die Wahrheit zu sagen. Mühsam hatten sie und Karlsson Teilchen für Teilchen zusammengefügt und schließlich herausgefunden, wer der Mann war: ein Betrüger, der eine Spur von zahlreichen Opfern hinterlassen hatte, alle mit einem Rachemotiv. Friedas unorthodoxe, oft instinktive Arbeitsmethode und ihre manchmal fast zwanghaften, selbstzerstörerischen Verhaltensweisen hatten dazu geführt, dass sie im Rahmen der letzten Personalkürzungen als Beraterin der Polizei gestrichen worden war. Aber Bradshaw reichte das offenbar nicht. Sie hatte ihn blamiert, und nun wollte er ihr den Rest geben. Das alles ging Karlsson in diesem Moment durch den Kopf. Dann dachte er wieder an die Tote, die nur ein paar Schritte von ihnen entfernt lag, und an ihre trauernde Familie. Rasch schluckte er seine wütenden Worte hinunter.
»Doktor Klein arbeitet nicht mehr für uns.«
»Ach ja«, sagte Bradshaw, »stimmt. Gegen Ende des letzten Falls lief es nicht so gut für sie.«
»Kommt darauf an, was Sie unter ›gut‹ verstehen«, entgegnete Karlsson. »Immerhin wurden drei Mörder aus dem Verkehr gezogen.«
Bradshaw schnitt eine Grimasse.
»Wenn die Polizeipsychologin am Ende in eine Messerstecherei gerät und einen ganzen Monat auf der Intensivstation verbringt, ist das nicht gerade ein Paradebeispiel für einen erfolgreich gelösten Fall. Zumindest nicht nach meinen Maßstäben.«
Karlsson stand schon wieder kurz davor, dem Mann die Meinung zu sagen, rief sich aber erneut ins Gedächtnis, wo er sich befand.
»Das ist wohl kaum der richtige Ort für eine derartige Diskussion«, erwiderte er kühl. »Eine Mutter ist ermordet worden. Ihre Familie befindet sich oben.«
Bradshaw machte eine abwehrende Handbewegung.
»Sollen wir also mit dem Gerede aufhören und hineingehen?«
»Ich habe mit dem Gerede nicht angefangen.«
Bradshaw trat ins Wohnzimmer und holte tief Luft, als versuchte er auf diese Weise, das Aroma des Raums in sich aufzusaugen. Nachdem er sich einen Moment umgeblickt hatte, steuerte er auf die Leiche von Ruth Lennox zu, wobei er darauf achtete, nur ja nicht in eine Blutlache zu treten.
»Also, wissen Sie, blindlings in einen Tatort zu stolpern und sich dort auch noch überfallen zu lassen, gilt nicht gerade als die klassische Art, ein Verbrechen aufzuklären,« wandte er sich erneut an Karlsson.
»Reden wir jetzt wieder über Frieda?«
»Doktor Kleins Fehler ist, dass sie sich emotional in den Fall hineinziehen lässt«, fuhr Bradshaw fort. »Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie sogar mit dem Mann geschlafen hat, der am Ende verhaftet wurde.«
»Sie hat nicht mit ihm geschlafen«, widersprach Karlsson kalt, »sondern nur gesellschaftlich mit ihm verkehrt. Weil sie ihn verdächtigte.«
Bradshaw musterte Karlsson mit einem halben Lächeln.
»Beunruhigt Sie die Vorstellung?«
»Ich werde Ihnen sagen, was mich beunruhigt«, entgegnete Karlsson. »Mich beunruhigt, dass Sie offenbar mit Frieda Klein konkurrieren.«
»Ich? Nein, keineswegs. Ich mache mir nur Sorgen um eine Kollegin, bei der wohl einiges aus dem Ruder gelaufen ist.« Er setzte ein mitfühlendes Lächeln auf. »Die Frau tut mir leid. Wie ich höre, leidet sie unter Depressionen.«
»Ich dachte, Sie wären gekommen, um einen Tatort in Augenschein zu nehmen. Wenn Sie über einen früheren Fall diskutieren wollen, sollten wir anderswohin gehen.«
Bradshaw schüttelte lediglich den Kopf.
»Finden Sie nicht auch, dass das hier etwas von einem Kunstwerk hat?«
»Nein, das finde ich nicht.«
»Wir müssen uns überlegen, was der Mörder damit zum Ausdruck bringen will. Was versucht er der Welt mitzuteilen?«
»Vielleicht sollte ich Sie einfach allein lassen«, meinte Karlsson.
»Ich schätze, Sie halten das Ganze nur für einen missglückten Einbruch.«
»Ich bemühe mich, keine voreiligen Schlüsse zu ziehen«, widersprach Karlsson. »Wir sind damit beschäftigt, Beweismaterial zu sammeln. Die Theorien kommen später.«
Bradshaw schüttelte wieder den Kopf. »Das ist die falsche Reihenfolge. Ohne Theorie ergeben die gesammelten Fakten nur ein wirres Durcheinander. Man sollte stets offen sein für erste Eindrücke.«
»Was ist denn Ihr erster Eindruck?«
»Ich liefere Ihnen einen schriftlichen Bericht«, entgegnete Bradshaw, »aber Sie können gerne eine kostenlose Vorschau haben: Ein Einbruch ist nicht nur ein Einbruch.«
»Das müssen Sie mir genauer erklären.«
Bradshaw machte eine ausladende Handbewegung.
»Sehen Sie sich doch um. Ein Einbruch ist ein gewaltsames Eindringen in einen geschützten Raum, eine Grenzübertretung, um nicht zu sagen eine Vergewaltigung. Dieser Mann hat seine Wut zum Ausdruck gebracht – seine Wut auf einen ganzen Lebensbereich, der ihm verschlossen blieb, geprägt von Besitz, familiären Bindungen und gesellschaftlichem Status. Und als er dann auf diese Frau traf, sah er in ihr die Personifizierung all dessen, was er nicht haben konnte: Sie war zugleich eine gut situierte Frau, eine begehrenswerte Frau, eine Mutter und eine Ehefrau. Er hätte einfach die Flucht ergreifen oder sie mit einem leichteren Schlag außer Gefecht setzen können, aber stattdessen hinterließ er uns eine Nachricht – und ihr auch. Die Verletzungen wurden in erster Linie ihrem Gesicht zugefügt und nicht so sehr dem restlichen Körper. Sehen Sie sich die Blutspritzer an der Wand an. Das steht in keinem Verhältnis zu dem, was die Situation erforderte. Er hat im wahrsten Sinn des Wortes versucht, dieser Frau einen bestimmten Ausdruck aus dem Gesicht zu schlagen, einen Ausdruck der Überlegenheit. Er hat den Raum mit ihrem Blut neu gestaltet. Auf eine fast schon liebevolle Weise.«
»Eine seltsame Art von Liebe«, bemerkte Karlsson.
»Genau deswegen musste das Ganze so heftig ausfallen«, erklärte Bradshaw. »Hätte es ihm nichts bedeutet, so hätte er nichts derartig Extremes tun müssen. Es wäre nicht so wichtig gewesen. Das hier hat eine emotionale Intensität.«
»Nach welchem Tätertyp sollen wir demnach Ausschau halten?«
Bevor Bradshaw antwortete, schloss er die Augen, als sähe er jemanden, den außer ihm niemand sehen konnte.
»Nach einem Weißen«, sagte er. »Anfang bis Mitte dreißig. Kräftig gebaut. Unverheiratet. Ohne festen Wohnsitz. Ohne festen Job, ohne feste Beziehung. Ohne familiäre Bindungen.«
Bradshaw zückte sein Handy und hielt es in verschiedene Richtungen.
»Sie müssen vorsichtig sein mit solchen Fotos«, warnte ihn Karlsson. »Auf wundersame Weise landet so was gern online.«
»Ich darf das«, konterte Bradshaw. »Sie sollten mal einen Blick in meinen Vertrag werfen. Ich bin Kriminalpsychologe. Das gehört zu meinem Job.«
»Schon gut«, antwortete Karlsson. »Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir jetzt gehen sollten, damit die Spurensicherung übernehmen kann.«
Bradshaw steckte das Handy zurück in seine Jackentasche.
»Kein Problem, ich bin fertig. Ach, übrigens, richten Sie Doktor Klein meine besten Wünsche aus. Sagen Sie ihr, dass ich oft an sie gedacht habe.«
Auf dem Weg nach draußen begegneten sie Louise Weller, die gerade wieder hereinkam. Das Baby trug sie immer noch vor der Brust, hielt nun aber zusätzlich einen kleinen Jungen an der Hand. Hinter ihnen trottete ein nur wenig älteres Mädchen her, das die gleiche stämmige Statur aufwies wie die Mutter. Obwohl die Kleine ein rosa Nachthemd trug und einen Spielzeugkinderwagen mit einer warm verpackten Puppe vor sich her schob, erinnerte sie Karlsson irgendwie an Yvette.
Louise Weller bedachte ihn mit einem knappen Nicken. »Familien sollten in solchen Zeiten eng zusammenrücken«, verkündete sie. Wie ein General, gefolgt von einer widerstrebenden Armee, ließ sie ihre Kinder ins Haus marschieren.
3
Um drei Uhr fünfundzwanzig morgens, als es nicht mehr Nacht, aber auch noch nicht Tag war, wachte Frieda Klein auf. Ihr Herz raste, und ihr Mund fühlte sich trocken an. Schweißperlen standen ihr auf der Stirn. Es fiel ihr schwer zu schlucken, ja sogar zu atmen. Alles tat ihr weh: die Beine, die Schultern, die Rippen, das Gesicht. Alte Blutergüsse pochten wieder. Ein paar Sekunden lang war sie unfähig, die Augen zu öffnen. Als sie es schließlich doch schaffte, drückte die Dunkelheit sie nieder und breitete sich in alle Richtungen aus. Frieda wandte den Kopf zum Fenster. Sie wartete auf den Mittwoch – auf das Tageslicht, das die Träume verblassen ließ.
Stattdessen kamen die Wellen, eine nach der anderen, jede noch heftiger als die vorherige. Sie türmten sich auf und donnerten über sie hinweg, rissen sie nach unten und spuckten sie anschließend wieder aus. Diese Wellen waren in ihr, sie peitschten durch ihren Körper und ihren Geist, und zugleich waren sie auch außen. Während Frieda so dalag, auf eine dumpfe Weise wach, mischten sich Erinnerungen in die verblassenden Träume. Gesichter leuchteten in der Dunkelheit auf, Hände streckten sich nach ihr aus. Frieda versuchte sich an das zu klammern, was Sandy Nacht für Nacht zu ihr gesagt hatte, und sich selbst aus dem Chaos zu ziehen, das sich in ihr breitgemacht hatte: Es ist vorbei. Du bist in Sicherheit, ich bin hier bei dir.
Sie tastete nach der Stelle, wo eigentlich Sandy liegen sollte. Aber er war nach Amerika zurückgekehrt, sie hatte ihn sogar zum Flughafen begleitet. Dabei waren ihre Augen trocken geblieben, und nach außen hin bewahrte sie selbst dann die Fassung, als er sie mit gequälter Miene in seine Arme nahm, um sich von ihr zu verabschieden. Während er durch die Kontrolle in den Abflugbereich ging, blickte sie ihm nach, bis von seiner hohen Gestalt nichts mehr zu sehen war. Sie hatte ihm nie verraten, wie knapp sie davor gewesen war, ihn zu bitten, bei ihr zu bleiben, oder sich bereit zu erklären, ihn zu begleiten. In ihren letzten paar gemeinsamen Wochen war zwischen ihnen eine große Vertrautheit entstanden. Frieda hatte zugelassen, dass sich jemand um sie kümmerte, und ihre eigene Schwäche gespürt. Dabei waren Gefühle in ihr hochgekommen, die sie bis dahin nie gekannt hatte und nun nicht einfach zurück in die Tiefe sinken lassen konnte. Letztendlich fürchtete sie sich gar nicht so sehr vor dem schmerzlichen Gefühl, ihn zu vermissen, sondern mehr vor dem langsamen Nachlassen dieses Schmerzes – davor, dass ihr geschäftiges Leben allmählich wieder die Leerräume füllen würde, die Sandy hinterlassen hatte. Manchmal setzte sie sich in ihr kleines Arbeitszimmer unter dem Dach und skizzierte mit einem weichen Bleistift sein Gesicht. Sie rief sich die genaue Form seines Mundes ins Gedächtnis, die kleinen Furchen, die die Zeit in seine Haut gegraben hatte, den Ausdruck seiner Augen. Dann legte sie den Stift beiseite und ließ sich von der Erinnerung an ihn durchfluten, einem langsamen, tiefen Fluss in ihrem Innern.
Einen Moment lang gestattete sie sich, ihn sich an ihrer Seite vorzustellen – was für ein Gefühl es wäre, sich jetzt umzudrehen und ihn neben sich zu sehen. Aber er war fort und sie allein in einem Haus, das ihr früher wie ein sicheres, behagliches Refugium erschienen war, seit ein paar Wochen jedoch – seit dem Überfall, der sie fast das Leben gekostet hatte – bedrohlich knarrte und knisterte. Sie lauschte. Erst hörte sie nur den Puls ihres eigenen Herzens, doch dann, ja, ein Rascheln an der Tür, ein schwaches Geräusch. Aber es war nur die Katze, die im Raum umherwanderte. In diesem Schwebezustand vor dem Morgengrauen empfand Frieda das Tier manchmal als eine sehr düstere Kreatur. Seine zwei früheren Besitzer waren beide tot.
Noch immer fragte sie sich, was sie wohl geweckt hatte. Sie wurde das dumpfe Gefühl nicht los, dass ein Geräusch in ihren Halbschlaf gedrungen war – nicht das ferne Rauschen des Verkehrs, das in London niemals aufhört, sondern etwas anderes. Im Haus.
Frieda setzte sich auf und lauschte noch einmal angestrengt, vernahm aber nur den leichten Wind draußen. Als sie schließlich die Beine aus dem Bett schwang, spürte sie, wie die Katze sich schnurrend dagegenschmiegte. Mühsam stand sie auf. Sie fühlte sich immer noch schwach und flau von den Schrecken der Nacht. Sie hatte etwas gehört, da war sie ganz sicher. Irgendwo unten. Vorsichtig schlich sie bis zum Treppenabsatz, griff nach dem Geländer und begann die Treppe hinunterzusteigen. Auf halber Höhe hielt sie einen Moment inne. Das Haus, das sie so gut kannte, war ihr fremd geworden, es steckte plötzlich voller Schatten und Geheimnisse. Unten in der Diele angekommen, blieb sie erneut stehen und lauschte, aber da war nichts, niemand. Sie schaltete das Licht an und blinzelte kurz, weil die plötzliche Helligkeit sie blendete. Dann entdeckte sie es: ein großes braunes Kuvert auf der Fußmatte. Sie beugte sich hinunter und griff danach. Auf dem Umschlag prangte in kühnen Lettern ihr Name: Frieda Klein. Dick unterstrichen. Die Linie verlief leicht diagonal und schnitt hinten in das ›n‹.
Frieda starrte gebannt auf die wenigen Buchstaben. Sie kannte die Schrift. Nun wusste sie endgültig, dass er in der Gegend war – draußen auf der Straße, ganz nahe an ihrem Zuhause, ihrem Zufluchtsort.
Wie in Trance zog sie eine Jogginghose, ein T-Shirt und einen Trenchcoat an, schlüpfte barfuß in die Stiefel, die neben der Haustür standen, nahm den Schlüssel vom Haken und trat hinaus in die Dunkelheit. Ein kühler Aprilwind wehte ihr entgegen, und auch ein Hauch von Regen. Frieda starrte die gepflasterte kleine Gasse entlang, in der früher Stallungen gestanden hatten, doch es war niemand zu sehen. So schnell ihr schmerzender Körper es erlaubte, stürmte sie – halb humpelnd, halb laufend –, auf die Straße hinaus, wo die Lampen bereits ausgeschaltet waren. Sie ließ den Blick in beide Richtungen schweifen. Wohin war er wohl gegangen, nach Osten, Westen, Norden oder Süden? In Richtung Fluss oder hinein ins Labyrinth der Straßen? Oder versteckte er sich in irgendeinem Hauseingang? Sie wandte sich nach links und eilte den feuchten Gehsteig entlang, wobei sie leise vor sich hinfluchte, weil sie sich nicht schneller bewegen konnte.
Als Frieda schließlich auf eine breitere Straße gelangte, erkannte sie etwas in der Ferne – eine unförmige Gestalt, die sich auf sie zubewegte: definitiv ein menschliches Wesen, aber dennoch größer und seltsamer, als ein Mensch eigentlich aussehen konnte. Die Rechte ans Herz gepresst, stand sie da und wartete, während die Gestalt sich ihr näherte, bis sie sich schließlich als Radfahrer entpuppte, der am Rahmen seines Rades Dutzende von Plastiktüten hängen hatte und daher nur ganz langsam vorwärtskam. Frieda kannte den Mann vom Sehen, sie begegnete ihm fast täglich. Er hatte einen wilden Rauschebart und radelte mit ruhiger Entschlossenheit dahin. Als er schließlich auf seinem fahrbaren Untersatz an ihr vorbeischwankte, starrte er blicklos durch sie hindurch. Frieda fand, dass er ein bisschen aussah wie ein Weihnachtsmann – aber einer aus einem schlimmen Traum.
Es hatte keinen Sinn. Dean Reeve, der ursprünglich von ihr gejagte Verbrecher, der sie nun seinerseits wie ein Stalker verfolgte, konnte inzwischen weiß Gott wo sein. Sechzehn Monate zuvor war er durch ihre Mithilfe als Kindesentführer und Mörder entlarvt worden, hatte sich jedoch durch vorgetäuschten Selbstmord der Festnahme entzogen. Vor zwei Monaten war Frieda dahintergekommen, dass er noch lebte. Der Mann, der damals von einer Brücke am Kanal hing, war in Wirklichkeit sein eineiiger Zwilling Alan gewesen, ein früherer Patient Friedas. Dean trieb sich immer noch irgendwo herum und wachte über sie – schützend und tödlich zugleich. Er war derjenige gewesen, der ihr das Leben gerettet hatte, als sie von einer gestörten jungen Frau mit einem Messer attackiert worden war, wobei allerdings für die alte Frau, zu deren Rettung Frieda eigentlich herbeigeeilt war, jede Hilfe zu spät kam. Dean war damals aus dem Schatten aufgetaucht wie eine Kreatur aus Friedas schlimmsten Albträumen und hatte sie aus der Dunkelheit zurückgeholt. Nun ließ er sie wissen, dass er immer noch über sie wachte. Ihr verhasster Beschützer. Ständig hatte sie das Gefühl, aus verborgenen Winkeln seinen Blick zu spüren, wenn sich irgendwo ein Vorhang leicht bewegte oder eine Tür sich leise schloss. Würde das nun immer so bleiben?
Sie drehte sich um und machte sich auf den Heimweg. Zu Hause angekommen, griff sie erneut nach dem Umschlag und ging damit in die Küche. Da sie genau wusste, dass sie nun sowieso nicht mehr schlafen konnte, brühte sie sich Tee auf. Erst als er fertig war, ließ sie sich am Küchentisch nieder und schob den Finger unter die Gummierung des Umschlags. Sie zog ein steifes Blatt Papier heraus und legte es auf den Tisch. Es handelte sich um eine Bleistiftzeichnung, besser gesagt um ein Muster, das ein bisschen aussah wie die mathematische Darstellung einer gefüllten Rose, mit sieben vollkommen symmetrischen Seiten. Die Linien waren offensichtlich mit einem Lineal gezogen. Als Frieda das Ganze genauer unter die Lupe nahm, stellte sie fest, dass an manchen Stellen Fehler ausradiert worden waren.
Nachdem sie eine Weile mit gerunzelter Stirn auf das vor ihr liegende Bild hinuntergestarrt hatte, schob sie es behutsam zurück in den Umschlag. Wut loderte in ihr hoch wie ein Feuer. Frieda war froh darüber: Lieber wollte sie vor Wut verbrennen als in Angst ertrinken. Reglos blieb sie in den Flammen dieses Feuers sitzen, bis der Morgen kam.
Viele Kilometer entfernt schenkte Jim Fearby sich ein Glas Whisky ein. Die Flasche war nur noch knapp zu einem Drittel gefüllt. Höchste Zeit, eine neue zu besorgen. Es war wie beim Sprit: Man musste dafür sorgen, dass der Tank immer mindestens zu einem Viertel voll war, sonst ging einem womöglich das Benzin aus. Er zog den alten Zeitungsausschnitt aus seiner Brieftasche und faltete ihn auf dem Schreibtisch auseinander. Er kannte ihn auswendig. Der Text war für ihn wie ein Talisman, er konnte ihn auch dann noch sehen, wenn er die Augen schloss.
Monster »möglicherweise nie wieder auf freiem Fuß«
James Fearby
Im Hattonbrook Crown Court kam es gestern zu dramatischen Szenen, als der des Mordes an Hazel Barton überführte George Conley für seine Tat zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Richter Lawson erklärte Conley, 31: »Es handelt sich hierbei um ein abscheuliches Verbrechen. Trotz Ihres Schuldbekenntnisses haben Sie keinerlei Reue gezeigt. Ich bin der festen Überzeugung, dass Sie auch in Zukunft eine Gefahr für Frauen darstellen und es möglicherweise niemals unbedenklich sein wird, Sie auf freien Fuß zu setzen.«
Als Richter Lawson Conley abführen ließ, wurden bei den Angehörigen des Opfers, die auf den öffentlichen Rängen saßen, Rufe laut. Draußen vor dem Gericht äußerte Hazels Onkel Clive Barton gegenüber Reportern: »Hazel war unser schöner jungerLiebling. Sie hatte ihr ganzes Leben noch vor sich, und er hat es ihr genommen. Ich hoffe, er verrottet in der Hölle.«
Die blonde, achtzehnjährige Schülerin Hazel Barton wurde im Mai dieses Jahres im Dorf Dorlbrook unweit ihres Elternhauses erdrosselt aufgefunden. Ihre Leiche lag neben der Straße. George Conley wurde in unmittelbarer Nähe des Tatorts festgenommen. Er hatte Spuren an der Leiche hinterlassen und legte innerhalb weniger Tage ein Geständnis ab.
In seiner Stellungnahme nach der Urteilsverkündung sprach Detective Inspector Geoffrey Whitlam der Familie Barton erneut sein Beileid aus: »Wir können höchstens erahnen, durch welche Hölle die Angehörigen gegangen sind. Ich kann nur hoffen, dass die rasche Aufklärung des Verbrechens durch unsere gründlichen Ermittlungen für sie einen gewissen Schlussstrich bedeutet.« Er dankte auch seinen Kollegen. »Ich bin der festen Überzeugung, dass es sich bei George Conley um einen gefährlichen Sexualstraftäter handelt, der hinter Gitter gehört, und ich möchte mich bei den Leuten aus meinem Team dafür bedanken, dass sie ihn dorthin gebracht haben.«
Es heißt, Hazel Barton sei allein nach Hause gegangen, weil ihr Bus nicht gekommen sei. Eine Sprecherin von FastCoach, dem örtlichen Busunternehmen, kommentierte: »Der Familie von Hazel Barton gilt unser aufrichtiges Beileid. Wir bemühen uns nach Kräften, unseren Kunden einen effektiven Service zu bieten.«
Unter der Schlagzeile waren zwei Fotos abgedruckt. Bei dem einen handelte es sich um eine von der Polizei stammende Aufnahme von Conley. Sein großes Gesicht sah darauf fleckig aus. Er hatte einen Bluterguss an der Stirn, und sein linkes Auge wirkte schief. Das zweite Bild war ein Familienfoto von Hazel Barton, offenbar ein Urlaubsfoto, denn sie trug darauf Shorts und ein buntes T-Shirt, und hinter ihr war das Meer zu sehen. Sie lachte, als hätte der Fotograf gerade einen Witz gemacht.
Fearby las seinen sieben Jahre alten Bericht noch einmal genau durch, wobei er den Zeigefinger die Zeilen entlanggleiten ließ. Er nahm einen Schluck von seinem Whisky. Kaum ein Wort in dem Bericht entsprach der Wahrheit. FastCoach bot seinen Kunden keinen effektiven Service. Außerdem handelte es sich um Fahrgäste, nicht um Kunden. Whitlam hatte nicht gründlich ermittelt. Sogar die Zeile mit seinem eigenen Namen erschien ihm falsch. Nur seine Mutter hatte ihn jemals James genannt. Das Unzutreffendste von allem aber war die Überschrift – die nicht von ihm stammte und die er schon damals auf keinen Fall so formuliert hätte. Der arme alte Conley war vieles, aber kein Monster, und wie es nun aussah, würde er sehr wohl freikommen.
Fearby faltete den Ausschnitt sorgfältig zusammen und steckte ihn zurück in seine Brieftasche, hinter seinen Presseausweis. Ein kostbares Relikt.
4
Als Sasha am Donnerstagmorgen um Viertel vor neun eintraf, war Frieda gerade damit fertig, die Pflanzen auf ihrer kleinen Terrasse zu gießen. Sie trug Jeans und einen beigebraunen Pullover, und ihre Augenringe wirkten noch dunkler und auffallender als sonst.
»Schlecht geschlafen?«, fragte Sasha.
»Nein.«
»Ich weiß nicht so recht, ob ich dir das glauben soll.«
»Möchtest du eine Tasse Kaffee?«
»Haben wir dafür denn noch Zeit? Meine Parkuhr läuft zwar erst in einer Viertelstunde ab, aber wir müssen um halb zehn im Krankenhaus sein, und es herrscht ein fürchterlicher Verkehr.«
Sasha hatte darauf bestanden, sich den Tag freizunehmen, um Frieda zu dem Arzt zu chauffieren, bei dem sie ihren Nachsorgetermin hatte, und anschließend zur Physiotherapie.
»Wir fahren nicht ins Krankenhaus.«
»Warum nicht? Haben sie den Termin abgesagt?«
»Nein, ich.«
»Wieso denn das?«
»Ich habe etwas anderes zu erledigen.«
»Du musst zu deinem Arzt, Frieda, und zur Physiotherapie auch. Du warst sehr krank. Du wärst fast gestorben. Da kannst du nicht einfach die ganze Nachsorge sausen lassen.«
»Ich weiß genau, was der Arzt sagen wird: dass ich gute Fortschritte mache, aber noch nicht wieder ans Arbeiten denken darf, weil meine Arbeit vorerst darin besteht, gesund zu werden. Was wir Ärzte unseren Patienten halt so erzählen.«
»Das klingt jetzt aber ein bisschen negativ.«
»Jedenfalls habe ich etwas Wichtigeres zu erledigen.«
»Was könnte wichtiger sein, als gesund zu werden?«
»Ich habe mir gedacht, ich zeige es dir lieber, statt es dir des Langen und Breiten zu erklären. Es sei denn, du möchtest doch zur Arbeit gehen.«
Sasha seufzte.
»Ich habe mir den Tag freigenommen. Ich würde ihn gern mit
dir verbringen. Also, lass uns erst mal Kaffee trinken.«
Die Straße verengte sich zu einer schmalen kleinen Allee, deren Bäume gerade austrieben. Frieda registrierte den Schwarzdorn. Sie starrte ihn wie gebannt an: Manche Dinge veränderten sich, andere blieben gleich, aber man selbst blieb nie gleich – wenn man alles mit anderen Augen sah, bekamen sogar die vertrautesten Anblicke etwas Seltsames, Gespenstisches: das strohgedeckte Häuschen mit dem kleinen, schlammigen Teich voller Enten davor, die plötzlich so weite Sicht auf die Straße, die sich durch ein Flickwerk aus Feldern zog, das Bauernhaus mit seinen Silos und der eingezäunten, schlammigen Kuhweide, ja selbst die Reihe schlanker Pappeln, die sich nun vor ihnen erstreckte. Sogar die Art, wie das Licht auf diese flache Landschaft fiel, und der schwache Salzgeruch des Meeres hatten etwas Fremdes.
Der Friedhof wirkte vollgepfercht. Die meisten der Grabsteine waren alt und mit einer grünen Schicht aus Moos überzogen, so dass es nicht mehr möglich war, die eingemeißelten Inschriften zu entziffern. Es gab aber auch einige neuere, blumengeschmückte Gräber, auf deren glänzenden Steinen gut lesbar die Namen der innig geliebten und schmerzhaft vermissten Menschen prangten.
»Scharen von Toten«, sagte Frieda mehr zu sich selbst als zu Sasha.
»Warum sind wir hier?«
»Ich zeige es dir gleich.«
Vor einem der Grabsteine blieb sie stehen und deutete darauf. Sasha beugte sich vor, um die Inschrift besser lesen zu können: Jacob Klein, 1943–1988, innig geliebter Ehemann und Vater.
»Ist das dein Vater?« Sasha wusste, dass Frieda ihn als Teenager tot aufgefunden hatte, und versuchte sich nun die schmerzvolle Geschichte vorzustellen, die sich hinter diesem schlichten Stein verbarg.
Frieda nickte, ohne den Blick vom Grab abzuwenden.
»Ja, das ist mein Vater.« Sie trat einen kleinen Schritt zurück und fügte hinzu: »Sieh dir die Gravierung an, oberhalb des Namens.«
»Sehr schön«, antwortete Sasha lahm, nachdem sie das symmetrische Muster in Augenschein genommen hatte. »Hast du das ausgesucht?«
»Nein.«
Frieda griff in ihre Tasche, zog ein Stück dickes Papier heraus, betrachtete für einen Moment die Zeichnung darauf und ließ dann den Blick zwischen Zeichnung und Gravierung hin- und herwandern.
»Fällt dir etwas auf?«, wandte sie sich dann an Sasha.
»Das gleiche Muster.«
»Ja, nicht wahr? Genau das gleiche.«
»Hast du es gezeichnet?«
»Nein.«
»Dann …?«
»Jemand hat es mir zukommen lassen. Gestern Morgen.«
»Das verstehe ich jetzt nicht.«
»Die betreffende Person hat es mir in den frühen Morgenstunden unter der Tür durchgeschoben.«
»Warum?«
»Das ist die Frage.« Frieda sprach inzwischen wieder mehr mit sich selbst als mit Sasha.
»Hast du vor, mir zu verraten, worum es hier eigentlich geht?«
»Es war Dean.«
»Dean? Dean Reeve?«
Sasha wusste über Dean Reeve Bescheid: den Mann, der einen kleinen Jungen entführt und Frieda gegen ihren Willen in die Welt hinausgezerrt hatte – fort von der Sicherheit ihres Sprechzimmers und den seltsamen Geheimnissen des menschlichen Geistes. Sasha hatte Frieda sogar geholfen, indem sie durch einen DNA-Test nachwies, dass Deans Ehefrau Terry in Wirklichkeit die kleine Joanna war, die zwei Jahrzehnte zuvor spurlos verschwunden war, als hätte sie sich in Luft aufgelöst. Für Frieda stand inzwischen fest, dass Dean Reeve, der für die Polizei längst als tot galt, doch noch lebte. Er war ihr unsichtbarer Verfolger geworden: der Tote, der über sie wachte und sie niemals in Ruhe lassen würde.
»Ja, Dean Reeve. Ich kenne seine Handschrift. Ich habe sie auf einem Aussageprotokoll gesehen, das er damals auf dem Polizeirevier unterschreiben musste. Aber selbst wenn ich die Schrift nicht kennen würde, wäre mir klar, dass nur er infrage kommt. Auf diese Weise will er mir mitteilen, dass er über meine Familie Bescheid weiß. Darüber, wie mein Vater ums Leben gekommen ist. Er war hier, wo wir jetzt stehen, am Grab meines Vaters.«
»Dein Vater liegt auf einem normalen Friedhof begraben. Dabei dachte ich, du wärst Jüdin«, stellte Sasha fest.
Sie saßen in einem kleinen Café mit Blick aufs Meer. Es war gerade Ebbe. Langbeinige Seevögel staksten über die nass glänzenden Schlammflächen. Weit draußen schob sich ein Containerschiff von der Größe einer Stadt den Horizont entlang. Sie waren die einzigen Gäste in dem Café, und auch der Strand war menschenleer. Sasha fühlte sich wie am Ende der Welt.
»Wirklich?«
»Ja. Du bist also keine?«
»Nein.« Frieda zögerte einen Moment. Es fiel ihr sichtlich schwer weiterzusprechen. »Mein Großvater war jüdischen Glaubens, meine Großmutter jedoch nicht, deswegen waren seine Kinder keine Juden mehr, und für mich gilt das natürlich erst recht. Meine Mutter«, fügte sie trocken hinzu, »hat definitiv nichts Jüdisches an sich.«
»Lebt sie noch?«
»Wenn meine Brüder nicht vergessen haben, mich über ihr Ableben zu informieren, ja.«
Sasha beugte sich blinzelnd vor.
»Brüder?«
»Ja.«
»Du hast mehr als nur einen?«
»Ja, zwei.«
»Du hast immer nur von David gesprochen. Ich hatte keine Ahnung, dass es noch einen zweiten gibt.«
»Es war nicht von Bedeutung.«
»Nicht von Bedeutung? Ein Bruder?«
»Über David weißt du auch nur Bescheid, weil er Olivias Ex und Chloës Vater ist.«
»Verstehe«, murmelte Sasha, die klug genug war, jetzt nicht nachzuhaken. Ihr ging durch den Kopf, dass sie in den vergangenen paar Stunden mehr über Friedas Leben erfahren hatte als während der ganzen bisherigen Dauer ihrer Freundschaft.
Nachdenklich stach sie in ihr pochiertes Ei und beobachtete, wie der Dotter hervorquoll und sich auf den Teller ergoss.
»Was wirst du jetzt unternehmen?«, wandte sie sich schließlich wieder an Frieda.
»Das weiß ich noch nicht. Außerdem, hast du es denn noch nicht gehört? Er ist tot.«
Während der Rückfahrt sprach Frieda kaum ein Wort. Als Sasha sie fragte, woran sie gerade denke, gab sie ihr zunächst keine Antwort.
»Tja«, meinte sie schließlich, »eigentlich nichts Bestimmtes.«
»Von einem deiner Patienten würdest du das aber nicht als Antwort akzeptieren.«
»Als Patientin habe ich noch nie viel getaugt.«
Nachdem Sasha gefahren war, sperrte Frieda die Haustür auf. Drinnen schloss sie wieder ab, legte die Kette vor und verriegelte die Tür zusätzlich. Dann ging sie nach oben ins Schlafzimmer, wo sie ihre Jacke auszog und aufs Bett warf. Sie würde ein langes, heißes Bad nehmen und dann in ihr kleines Arbeitszimmer unter dem Dach hinaufsteigen und eine Zeichnung anfertigen: sich konzentrieren und dabei trotzdem an nichts denken. Vor ihrem geistigen Auge tauchte der Friedhof auf. Die verlassene Küstenlandschaft. Rasch zog sie sich den Pulli über den Kopf. Als sie gerade ihre Bluse aufknöpfen wollte, hielt sie plötzlich inne. Sie hatte etwas gehört, war aber nicht sicher, ob es ein Geräusch im Haus war oder ein viel lauteres, weiter entferntes, das von draußen kam. Sie blieb mucksmäuschenstill stehen und hielt sogar den Atem an. Da hörte sie es wieder, ein leises Schaben. Es kam aus dem Haus, noch dazu aus dem Stockwerk, in dem sie sich gerade befand. Inzwischen konnte sie es fast vibrieren spüren. Sie dachte an die verriegelte Haustür mit der vorgelegten Kette und versuchte abzuschätzen, wie lange es dauern würde, die Treppe hinunterzustürmen und die Kette aufzufummeln. Nein, das würde sie nicht schaffen. Das Handy in ihrer Tasche fiel ihr ein. Selbst wenn es ihr gelang, eine Nachricht hineinzuflüstern, was brachte das schon? Es würde zehn, fünfzehn Minuten dauern, bis Hilfe eintraf, und dann war da immer noch die abgeschlossene und zusätzlich verriegelte Tür.
Frieda spürte, wie ihr Puls raste. Sie zwang sich, tief durchzuatmen und dabei langsam bis zehn zu zählen. Dann blickte sie sich nach einem Versteck um, verwarf den Plan aber sofort wieder als hoffnungslos. Beim Hereinkommen hatte sie viel zu viel Lärm gemacht. Sie nahm eine Bürste von ihrer Kommode. Das Ding war so windig, dass man es als Waffe völlig vergessen konnte. Als sie daraufhin ihre Jackentasche durchwühlte, stieß sie auf einen Stift. Sie nahm ihn fest in die Faust und hielt ihn vor sich hin. Zumindest besaß er eine Spitze. Obwohl es ihr wie das Allerschlimmste auf der Welt vorkam, schob sie sich vorsichtig aus dem Schlafzimmer hinaus auf den Treppenabsatz. Es würde nur ein paar Sekunden dauern. Wenn sie es schaffte, die Treppe hinunterzuschleichen, ohne dass die Stufen knarrten, dann …
Wieder war ein Schaben zu hören, diesmal lauter, und dann noch ein anderes Geräusch, eine Art Pfeifen. Es kam von gegenüber, aus dem Badezimmer. Das Gepfeife ging weiter. Frieda lauschte ein paar Sekunden, trat dann näher und gab der Badezimmertür einen Schubs, so dass sie aufschwang. Einen Moment lang hatte sie das Gefühl, im falschen Raum oder sogar im falschen Haus zu sein. Nichts befand sich mehr an seinem angestammten Platz. Ein Stück Wand mit Leitungen war freigelegt und daneben eine große Fläche Boden. Der ganze Raum erschien Frieda größer, als sie ihn in Erinnerung gehabt hatte. Und in der Ecke stand eine vornübergebeugte Gestalt, die gerade an etwas zerrte.
»Josef«, sagte Frieda mit schwacher Stimme, »was machst du hier?«
Josef blickte sich lächelnd um, wirkte dabei aber leicht zerknirscht.
»Frieda«, antwortete er, »ich habe dich gar nicht kommen hören.«
»Was machst du hier? Wie bist du hereingekommen?«
»Mit dem Schlüssel, den du mir mal gegeben hast.«
»Aber der war doch nur dafür gedacht, dass du während meiner Abwesenheit die Katze fütterst.« Sie blickte sich um. »Was ist hier überhaupt los?«
Josef richtete sich auf. Er hatte einen großen Schraubenschlüssel in der Hand.
»Frieda. Es geht dir zurzeit nicht gut. Wenn ich dich anschaue, dann sehe ich, dass du traurig bist und Schmerzen hast und alles so beschwerlich für dich ist.« Frieda wollte etwas sagen, doch Josef ließ sie nicht zu Wort kommen. »Nein, nein, warte. Es ist nicht leicht, dir zu helfen, aber ich kenne dich, ich weiß, dass du gerne stundenlang sehr heiß badest, wenn es dir schlecht geht.«
»Na ja, nicht stundenlang«, widersprach Frieda. »Aber wo ist überhaupt meine Wanne? Ich wollte sie gleich benutzen.«
»Deine Wanne ist weg«, erklärte Josef. »Während du mit deiner Freundin Sasha unterwegs warst, haben ich und mein Freund Stefan deine Wanne abgeholt und entsorgt. Sie war aus einem schlechten Material – aus Plastik und viel zu klein. Man konnte nicht gut darin liegen.«
»Man konnte sogar sehr gut darin liegen!«, widersprach Frieda.
»Nein«, entgegnete Josef in entschiedenem Ton. »Jedenfalls ist sie weg. Ich habe im Moment großes Glück. Ich arbeite an einem Haus in Islington. Der Besitzer gibt viel Geld dafür aus. Er lässt mich alles rausreißen, in vier große Container entsorgen und anschließend alles neu machen. Dabei wirft er viele schöne Sachen weg, aber das Allerschönste ist eine große gusseiserne Badewanne. Als ich sie gesehen habe, musste ich sofort an dich denken. Sie ist perfekt.«
Frieda nahm das Bad genauer in Augenschein. Wo vorher die Wanne gestanden hatte, lagen nun Wand und Boden frei. Man sah etliche gesprungene Fliesen, nackte Bodendielen und eine große Rohröffnung. Josef selbst war mit einer Staubschicht überzogen, die sein dunkles Haar wie grau meliert aussehen ließ.
»Josef, du hättest mich vorher fragen sollen.«
Josef breitete hilflos die Arme aus.
»Wenn ich dich gefragt hätte, dann hättest du Nein gesagt.«
»Genau deswegen hättest du mich ja fragen sollen.«
Josef machte plötzlich einen traurigen, nachdenklichen Eindruck.
»Frieda, du beschützt alle anderen Leute, und manchmal wirst du dadurch verletzt. Du musst auch mal zulassen, dass andere dir helfen.« Josef betrachtete Frieda genauer. »Warum hältst du deinen Stift so komisch?«
Frieda blickte an sich hinunter. Noch immer umklammerte sie den Stift wie einen Dolch.
»Ich dachte, du wärst ein Einbrecher«, erklärte sie. Erneut zwang sie sich, tief Luft zu holen. Sie sagte sich, dass es gut gemeint war. »Wie lange dauert es, bis meine alte Wanne wieder genau da ist, wo sie war?«
Josef setzte erneut seine nachdenkliche Miene auf.
»Das wird schwierig«, meinte er schließlich. »Als wir die Wanne von der Wand und dem Rohr gelöst haben, bekam sie große Risse. Die Wanne war einfach richtiger Mist. Außerdem liegt sie jetzt auf der Müllkippe.«
Frieda überlegte einen Moment.
»Was du gemacht hast, könnte man wahrscheinlich als eine Art Verbrechen bezeichnen. Aber egal, wie soll es jetzt weitergehen?«
»Die schöne Badewanne ist im Moment in der Werkstatt eines anderen Freundes von mir, der Klaus heißt. Das ist kein Problem. Aber hier …« Er deutete mit dem Schraubenschlüssel auf den Schaden, den er angerichtet hatte, und stieß dabei einen tiefen Seufzer aus. »Hier habe ich ein Problem.«
»Wie meinst du das?«, fragte Frieda. »Dieses Problem hast doch du verursacht.«
»Nein, nein«, widersprach Josef. »Das ist …« Er sagte etwas in seiner eigenen Sprache. Es klang verächtlich. »Das Verbindungsrohr hier ist sehr schlecht. Sehr schlecht.«
»Es hat immer gut funktioniert.«
»Das war nur Glück. Ein Ruck der Badewanne, und …« Er macht eine vielsagende Geste, mit der er eine katastrophale, alles zerstörende Überschwemmung andeutete. »Ich werde hier ein anständiges Rohr einbauen, die Wand ausbessern und den Boden fliesen. Das wird mein Geschenk an dich. Du bekommst ein Bad, das dein Wohlfühlplatz sein wird.«
»Wann?«, fragte Frieda.
»Ich werde tun, was getan werden muss«, antwortete Josef.
»Ja, aber wann wirst du es tun?«
»Es dauert nur ein paar Tage, wirklich nur ein paar.«
»Ich wollte jetzt ein Bad nehmen. Schon während der ganzen Heimfahrt habe ich daran gedacht, wie gut mir das tun wird und wie sehr ich das jetzt brauche.«
»Du wirst schon sehen, das Warten lohnt sich.«