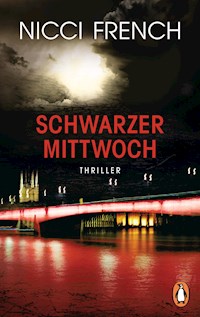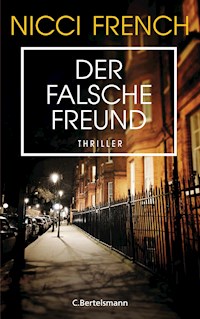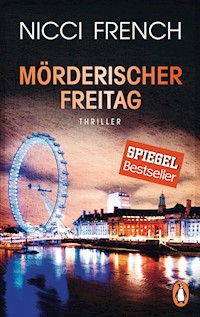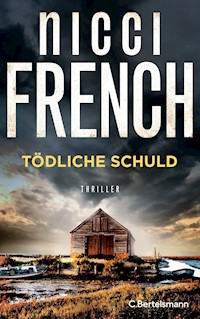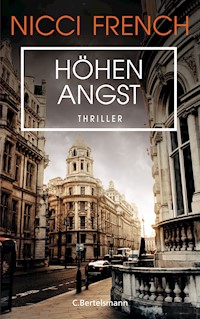9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Sie ist keine Mörderin. Oder doch? Der packende Thriller des Bestsellerduos Nicci French: intelligent konstruiert und absolut süchtigmachend!
Erst seit Kurzem lebt Tabitha wieder im Ort ihrer Kindheit, einem idyllischen Dorf an der englischen Küste. Doch der Wunsch, dort Ruhe zu finden, verwandelt sich in einen Alptraum, als sie des Mordes an ihrem Nachbarn beschuldigt wird. Alle Indizien sprechen gegen sie. Und sie kann sich nicht erinnern, was an jenem 21. Dezember geschehen ist, als im Schuppen hinter ihrem Haus die schlimm zugerichtete Leiche gefunden wurde. Nun sitzt sie in Untersuchungshaft und wartet auf ihren Prozess. Ihre Anwältin rät ihr, sich schuldig zu bekennen. Doch Tabitha spürt, dass sie nicht die Mörderin ist. Und nur sie selbst kann das beweisen.
Ausgezeichnet mit dem Prädikat »Besonders empfehlenswert« vom Gold Dagger Award der britischen Crime Writers’ Association, auf der Shortlist für den besten englischsprachigen Krimi des Jahres!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 576
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zum Buch:
Erst seit Kurzem lebt Tabitha wieder im Ort ihrer Kindheit, einem idyllischen Dorf an der englischen Küste. Doch der Wunsch, dort Ruhe zu finden, verwandelt sich in einen Albtraum als sie des Mordes an ihrem Nachbarn beschuldigt wird. Alle Indizien sprechen gegen sie. Und sie kann sich nicht erinnern, was an jenem 21. Dezember geschehen ist, als im Schuppen hinter ihrem Haus die schlimm zugerichtete Leiche gefunden wurde. Nun sitzt sie in Untersuchungshaft und wartet auf ihren Prozess. Ihre Anwältin rät ihr, sich schuldig zu bekennen. Doch Tabitha spürt, dass sie nicht die Mörderin ist. Und nur sie selbst kann das beweisen.
Zu den Autoren:
Nicci French – hinter diesem Namen verbirgt sich das Ehepaar Nicci Gerrard und Sean French. Seit über 20 Jahren sorgen sie mit ihren außergewöhnlichen Thrillern international für Furore und verkauften weltweit über acht Millionen Bücher. Die beiden leben in Südengland. Zuletzt erschien die achtteilige Bestsellerserie um Ermittlerin Frieda Klein sowie der Thriller Was sie nicht wusste, der sofort nach Erscheinen in die Top Ten der Spiegel-Bestsellerliste und auf Platz 3 der Krimi-Bestenliste (Die Zeit) aufstieg. Eine bittere Wahrheit ist der neueste Roman des Erfolgsduos.
NICCI FRENCH
EINE BITTERE WAHRHEIT
THRILLER
Aus dem Englischen von Birgit Moosmüller
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »House of Correction« bei Simon & Schuster UK Ltd.
Copyright © 2020 Nicci French
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe 2020 bei C. Bertelsmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: www.buerosued.de
Coverabbildung: Getty Images/Joe Daniel Price; Plainpicture/Dave Wall
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-24117-9V004
www.penguin.de
ERSTER TEIL Drinnen
1
Das Geschrei begann um drei Uhr morgens. Tabitha hatte noch nie ein menschliches Wesen auf eine solche Weise schreien hören. Es klang wie das Kreischen eines Tiers, das gerade in eine Falle geraten war. Als Reaktion kamen Rufe, weit entfernt, wie ein Echo. Das Geschrei schwächte sich zu einem Schluchzen ab, doch selbst das wurde durch das Metall verstärkt, durch die Treppen und Böden. Tabitha empfand es wie ein Echo in ihrem Kopf.
Sie spürte eine Bewegung auf der Pritsche über sich. Offenbar war die andere Frau wach.
»Da ist jemand in Schwierigkeiten.«
Schweigen. Tabitha fragte sich, ob die Frau sie bloß ignorierte oder tatsächlich schlief, doch dann kam eine Stimme aus der Dunkelheit, langsam und bedächtig, als spräche die Frau mit sich selbst. Es war eine tiefe, raue Stimme, die Morgenstimme einer Raucherin.
»Alle stecken in Schwierigkeiten«, sagte sie. »Deswegen sind sie hier. Deswegen weinen sie, wenn sie an ihre Kinder denken oder an das, was sie getan haben – oder daran, was sie ihren Kindern angetan haben. Wenn es hier wirklich Probleme gibt, hört man kein Geschrei. Dann hört man nur Getrampel auf den Gängen. Wenn es richtig schlimm ist, landet draußen auf dem Feld ein Hubschrauber. Das ist schon drei-, viermal passiert, seit ich hier bin.«
»Was bedeutet das dann?«, fragte Tabitha.
»Was glaubst du?«
Tabitha versuchte, nicht darüber nachzudenken, was eine Hubschrauberlandung mitten in der Nacht wohl zu bedeuten hatte. Sie versuchte, jeden Gedanken auszublenden, während sie so dalag, doch es gelang ihr nicht. Den Blick auf die Pritsche über sich gerichtet, die Schluchzer und Rufe noch im Ohr, hörte sie erneut jemanden schreien. Schlagartig schnitt eine Erkenntnis mit absoluter Klarheit durch den Nebel in ihrem Kopf: Das hier war real.
Bisher hatte sich alles so seltsam angefühlt, so ganz und gar außerhalb ihrer Erfahrung, dass es ihr vorgekommen war wie ein schräges Märchen über eine andere Frau, die ins Gefängnis musste, eine Person, über die sie etwas las oder einen Film sah, obwohl sie es in Wirklichkeit selbst erlebte. Daran hatte sich auch nichts geändert, als sie in dem winzigen, fensterlosen Abteil des Transporters saß, der sie vom Gericht herbrachte; als sie ihre Kleidung auszog, sich auf den Boden kauerte, angestarrt und untersucht wurde und eine Frau über ihre kleinen Brüste und haarigen Achseln lachen hörte; als sie hinterher unter der Dusche stand. Ausgestattet mit Bettzeug, einer kratzigen blauen Decke und einem dünnen Handtuch war sie durch eine Tür nach der anderen eskortiert worden. Die Türen bestanden tatsächlich aus schwerem Metall. Sie fielen tatsächlich laut ins Schloss. Die Aufseher und Aufseherinnen trugen tatsächlich riesige Schlüsselbunde, die mit einer Kette an ihrem Gürtel befestigt waren. Das Gefängnis war genauso, wie man sich ein Gefängnis vorstellte.
Als man sie am Vortag durch den großen Mittelgang geführt hatte, der zu beiden Seiten und auch im Stockwerk darüber von Zellen gesäumt war, hatte sie das Gefühl gehabt, von mehreren Frauengruppen angestarrt zu werden. Am liebsten hätte sie ihnen zugerufen: Das ist nicht real! Ich bin keine von euch, ich gehöre nicht hierher!
Nun lag sie auf ihrer Pritsche und versuchte, sich das Ganze nicht ins Gedächtnis zu rufen, es nicht vor ihrem geistigen Auge Revue passieren zu lassen. Doch selbst das war besser, als daran zu denken, wo sie sich gerade befand: in diesem Moment, in diesem Raum.
Tabitha hatte Aufzüge noch nie gemocht. Was, wenn sie abstürzten? Was, wenn sie stecken blieben? Deswegen nahm sie immer die Treppe. In London fuhr sie nur höchst ungern mit der U-Bahn. Einmal hatte sie während der Rushhour in einem Zug gestanden, eingepfercht zwischen den heißen Leibern der anderen Fahrgäste, als die Bahn plötzlich mitten im Tunnel hielt. Es folgte eine genuschelte Ansage, deren Inhalt sie nicht verstand. Der Zug blieb etliche Minuten stehen. Es war Sommer und die Hitze erdrückend. Tabitha bekam allmählich Beklemmungen, sie musste an die dicke Lehm- und Ziegelschicht zwischen ihr und der Oberfläche denken. Sie stellte sich auch den Zug vor, in dessen Mitte sie feststeckte, Waggon für Waggon, vollgestopft mit Menschen, vor ihr und hinter hier, bis sie den Drang, sich schreiend nach draußen zu kämpfen, kaum noch unterdrücken konnte.
Jetzt befand sie sich in einer Zelle, die vier Schritte lang und drei Schritte breit war. Ein winziges, verriegeltes Fenster ging hinaus auf einen Hof, begrenzt durch eine von Stacheldraht gekrönte Mauer, hinter der man gerade noch die dunstigen Hügel in der Ferne ausmachen konnte. Am Vortag hatte sie einen Blick aus diesem Fenster geworfen und gemeint, auf einem der Hügel eine kleine Gestalt zu erkennen, eine Person, die dort wanderte – dort draußen, in Freiheit. Mittlerweile jedoch war es dunkel und draußen nichts mehr zu sehen als die Scheinwerfer, die den Hof beleuchteten. Die Zellentür blieb bis in den Vormittag hinein abgeschlossen. Wenn sie darüber nachdachte, bekam sie das Gefühl, lebendig begraben zu sein, und hätte am liebsten laut um Hilfe gerufen. Vielleicht war das auch der Grund, warum die Frau so geschrien hatte.
Wenn Tabitha schon nicht schreien konnte, dann konnte sie wenigstens weinen. Doch sie wusste, wenn sie weinte, würde sie nicht mehr aufhören können. Außerdem war es wahrscheinlich nicht gut, wenn man sie weinen sah.
Sie fand es in der Zelle sehr kalt und die einzelne Decke nicht ausreichend. Um sich zu wärmen, zog sie die Knie fast bis zur Brust und schlang in der Dunkelheit die Arme um sich selbst. Dabei stellte sie fest, dass sie bereits anders roch: nach Gefängnisseife, nach fettigem Haar, das dringend gewaschen gehörte, und irgendwie leicht modrig. Sie schloss die Augen, dachte ans Meer, an Wellen, die sich auftürmten, brachen und dann gegen das felsige Ufer klatschten. Gedanken kamen in langen, dunklen Wirbeln. Sie versuchte, sie wegzuschieben. Wieder ertönte irgendwo ein Schrei. Jemand schlug gegen eine weit entfernte Tür.
Obwohl es ihr unmöglich erschien, musste sie ein wenig geschlafen haben, denn sie wachte auf, als die Frau von der oberen Pritsche glitt. Es fühlte sich an, als nähme das sehr viel Zeit in Anspruch. Erst tauchten die Füße auf, lang und schmal, mit dunkelrot lackierten Nägeln und einer tätowierten Spinne am rechten Knöchel. Dann folgten die Beine, die in ihrer grauen Jogginghose kein Ende zu nehmen schienen, dann ein schwarzes, hochgerutschtes T-Shirt, unter dem ein Nabelring hervorblitzte, schließlich ein glattes, ovales Gesicht mit großen Kreolen in den Ohrläppchen, umrahmt von langem, dichtem Haar mit Pony. Sie war sehr groß, etwa eins fünfundachtzig, und machte einen kräftigen Eindruck. Tabitha schätzte sie auf Ende zwanzig, obwohl das schwer zu sagen war. Am Vorabend hatte sie die Frau gar nicht richtig wahrgenommen, sondern sich sofort die Decke über den Kopf gezogen, nachdem sie ins Bett gekrochen war.
»Hallo«, sagte sie jetzt.
Ohne ihr eine Antwort zu geben, durchquerte die Frau die Zelle und zog den kleinen Vorhang auf.
Das war noch so eine Sache. Die Zelle war eigentlich nur für eine Person gedacht. Nun befanden sich darin ein Stockbett, zwei Stühle, zwei schmale Tische, zwei winzige Kommoden und eine Toilette mit einem Waschbecken daneben, abgeschirmt durch einen kleinen Vorhang. Die Frau zog sich die Hose herunter und setzte sich auf die Schüssel. Sie wirkte dabei ganz gelassen, als wäre sie allein. Tabitha drehte das Gesicht zur Wand und wickelte sich bis über die Ohren in die Decke, um nichts hören zu müssen.
Die Spülung wurde betätigt, ein Wasserhahn aufgedreht. Tabitha wartete, bis die Frau fertig war, dann stieg sie ihrerseits aus dem Bett, um sich unter den Achseln zu waschen und Wasser ins Gesicht zu klatschen. Anschließend schlüpfte sie in eine Leinenhose, ein T-Shirt und ein Sweatshirt und zog ihre Sportschuhe unter dem Bett heraus.
»Ich bin Tabitha«, stellte sie sich vor.
Die Frau bürstete sich gerade energisch die Haare. Sie blickte auf Tabitha herab. Sie muss fast dreißig Zentimeter größer sein als ich, dachte Tabitha.
»Das hast du mir gestern Abend schon gesagt.«
Es folgte eine Pause.
»Wie heißt du?«, fragte Tabitha.
»Michaela. Das habe ich dir auch schon gesagt.«
Es klapperte an der Tür. Sie wurde entriegelt und nach innen aufgeschoben. Eine sehnige, farblose Frau stand neben einem Rollwagen mit zwei urnenförmigen Stahlgefäßen darauf.
»Tee«, sagte Michaela.
»Tee«, wiederholte Tabitha.
Die Frau füllte zwei Becher und reichte sie ihnen.
Tabithas Frühstückspäckchen lag auf dem Tisch. Sie öffnete es und nahm den Inhalt heraus: eine Plastikschüssel, einen Plastiklöffel, eine Minitüte Reiscrispies, einen kleinen Karton H-Milch, zwei in Plastikfolie gehüllte Scheiben braunes Brot, in Alu verpackte Butter, ein kleines Schälchen Himbeermarmelade. Messer gab es keines, deswegen verteilte sie die Butter und die Marmelade mit dem Stiel ihres Löffels auf dem Brot.
Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann sie das letzte Mal etwas gegessen hatte, und verspeiste die Sandwiches in schnellen Bissen. Das Brot war trocken, aber sie spülte es mit ein paar Schlucken Tee hinunter. Dann kippte sie die Zerealien in die Schüssel und goss die Milch darüber. Letztere war warm und hatte einen leicht säuerlichen Beigeschmack, der Tabitha fast würgen ließ. Trotzdem aß sie alles auf. Als sie fertig war, hielt sie sogar die Schüssel schräg, um den letzten Rest Milch zu trinken.
Immer noch hungrig, begab sie sich auf die Toilette hinter dem Vorhang. Sie kam sich vor wie ein Tier. Während sie da so saß, die Hose um die Fußknöchel, hatte sie das Gefühl, als würde rundherum Blitzlicht flackern und es in ihren Ohren klingeln. Plötzlich hatte sie das Bedürfnis, das Gesicht gegen die Wand zu knallen, nicht nur einmal, sondern immer wieder. Vielleicht würde ihr das Erleichterung verschaffen – dem Ganzen womöglich sogar ein Ende setzen.
Stattdessen wischte sie sich ab, zog die Hose hoch, wusch sich die Hände und setzte sich wieder aufs Bett, den Rücken an die Wand gestützt. Sie hatte nichts zu lesen und auch sonst nichts zu tun. Der Tag lag formlos und schier endlos vor ihr. Andererseits, hätte sie dort gesessen und gelesen, dann hätte es sich womöglich so angefühlt, als wäre das jetzt ihr Leben und nicht nur ein albtraumhafter Irrtum – ein Irrtum, der korrigiert werden würde, sobald allen klar war, dass sie nicht hierher gehörte, und man sie wieder gehen ließ.
Michaela stand inzwischen über das Waschbecken gebeugt, damit beschäftigt, sich die Zähne zu putzen. Sie nahm sich dafür viel Zeit. Zum Schluss spuckte sie ins Becken, beugte sich tiefer und trank gleich aus dem Hahn. Dann richtete sie sich auf, legte den Kopf in den Nacken und gurgelte lautstark. Tabitha war das alles viel zu viel: die Geräusche, die Gerüche, die körperliche Nähe der anderen Frau. Michaela band ihr Haar zu einem Pferdeschwanz zusammen und verließ die Zelle. Ein paar Augenblicke später kam sie wieder herein, stützte sich auf den Tisch und blickte auf Tabitha hinunter.
»Sitz nicht bloß herum.«
Tabitha gab ihr keine Antwort. Dazu fehlte ihr die Kraft.
»Damit machst du es nur schlimmer. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, schließlich bin ich schon seit vierzehn Monaten hier.«
»Was hast du getan?«
Michaela starrte sie mit ausdrucksloser Miene an. »Haben sie dir den Wisch mit dem ganzen Scheiß über Sport und Duschen und die Öffnungszeiten der Bibliothek gegeben?«
»Ja, der muss hier irgendwo sein«, antwortete Tabitha, »aber das interessiert mich alles nicht. In meinem Fall handelt es sich nur um einen Irrtum.«
»Ach ja? Glaub bloß nicht, dass du dich einfach hier drin verstecken kannst und damit durchkommst, ohne dass es jemand merkt. Es ist wie auf dem Schulhof: Das kleine Mädchen, das in der Ecke steht, weil es in Ruhe gelassen werden will, ist genau das Kind, das sich die anderen herauspicken. Du musst aufstehen. Du musst aufstehen und duschen.«
»Mir ist nicht danach. Nicht heute.«
Michaela griff unter den kleinen Tisch, der für Tabitha reserviert war.
»Hier.« Sie warf Tabitha das Handtuch zu, das man ihr bei ihrer Ankunft gegeben hatte. »Du nimmst jetzt das Handtuch und die Seife und gehst duschen!«
Mit diesen Worten verließ sie die Zelle, ohne die Tür hinter sich zuzuziehen. Tabitha rappelte sich hoch. Sie fror bis auf die Knochen. Erneut warf sie einen Blick durch das kleine vergitterte Fenster. Der Himmel wirkte inzwischen fast weiß. Vielleicht schneit es bald, dachte sie. Das wäre doch was: ein dichter Wirbel aus fedrigen Flocken, nur wenige Zentimeter von dort entfernt, wo sie gerade stand, und alles verhüllt von einer Decke der Fremdheit.
Sie griff nach dem Handtuch, nahm die Seife von der Ablage des Waschbeckens und trat hinaus in den Mittelgang, durch den eine Vielzahl von Geräuschen hallte: Schritte, das Schlagen von Türen, laute Stimmen, Gelächter, Husten, das Klatschen eines Wischmopps. Eine sehr dünne Frau mit langem grauem Haar und einem Gesicht voller Falten humpelte auf sie zu. Sie trug ein dickes braunes Kleid, das ihr bis zu den Schienbeinen reichte. Ihre Hände waren von Arthritis geschwollen. Sie hielt einen Stapel Papiere an die Brust gedrückt.
»Du bist auch hier«, sagte sie lächelnd.
»Ja, ich bin auch hier«, antwortete Tabitha. Sie ging bis ans Ende des Gangs und bog in den kleinen Flügel ein, in dem sich die Duschen befanden, eine lange Reihe von Kabinen. An der hinteren Wand waren über einer Holzbank Kleiderhaken angebracht. Dort zogen sich gerade mehrere Frauen an und aus. Der Fliesenboden glänzte feucht, und es roch nach Seife, Schweiß und menschlichen Körpern. Schlagartig fühlte sich Tabitha an die Umkleideräume ihrer Schulzeit erinnert, jenen beißenden Geruch, der einem fast schmerzhaft in die Nase stach. Langsam streifte sie ihre Sachen ab, wobei sie den Blick auf die Wand gerichtet hielt, um ja niemandes Blick aufzufangen. Ehe sie ihren Slip auszog, wickelte sie sich in das dünne, alte Handtuch, wie ein scheuer Teenager am Strand, und ließ ihn dann nach unten gleiten.
Sie trat in eine freie Kabine, zog den Vorhang zu und hängte das Handtuch an einen Haken. Als sie den Hahn aufdrehte, tröpfelte nur ganz wenig Wasser aus dem Duschkopf. Vergeblich versuchte sie, den Hahn weiter aufzudrehen.
»Man muss dagegen schlagen«, informierte sie eine Stimme. »Gegen das Rohr.«
Sie klopfte dagegen. Nichts passierte.
»Fester«, sagte die Stimme. »Richtig fest!«
Tabitha ballte die Hand zur Faust und schlug gegen das Rohr. In der Leitung gurgelte und hustete es ein wenig, dann verstärkte sich das Tröpfeln zu einem schwachen Rinnsal, das gerade mal ausreichte, um sich richtig nass zu machen, aber nichts Wohltuendes hatte, nichts, worin sie sich verlieren konnte – nichts Tröstliches.
2
Hier lang.« Die kräftig gebaute Aufseherin trug eine gelangweilte Miene zur Schau. Ihr Gang wirkte plump und hart.
»Was?«
»Ihr Beistand wartet.«
»Mein Beistand?«
»Ihre Anwältin. Das hat man Ihnen doch schon gestern gesagt.«
Tabitha konnte sich nicht erinnern. Allerdings konnte sie sich an den Vortag ohnehin kaum erinnern, geschweige denn an die Tage davor. In ihrem Kopf wirbelte alles durcheinander: Gesichter, starrende Blicke, Fragen, die sie nicht beantworten konnte, Worte, die für sie keinen Sinn ergaben, Menschen, die immer wieder ihren Namen nannten – ihren Namen, ihre Adresse und ihr Geburtsdatum –, Formulare, die man ihr hinschob, Rekorder, die klickend ansprangen, um aufzunehmen, was sie von sich gab, lange Gänge, Neonröhren, Türen, Schlüssel und Gitterstäbe.
»Im Besucherraum«, erklärte die Frau. An ihrer Taille klirrten Schlüssel. »Heute ist kein Besuchstag.«
Der große, rechteckige Raum war grell beleuchtet und mit Reihen kleiner Tische ausgestattet, an denen sich je zwei Stühle gegenüberstanden. An der Wand hingen zwei Getränkeautomaten. Abgesehen von einer Frau mittleren Alters, die an einem der Tische saß und auf den Bildschirm eines Laptops starrte, war der Raum leer. Die Frau nahm die Brille ab, rieb sich das runde Gesicht und setzte sie dann wieder auf, um stirnrunzelnd weiterzulesen. Als Tabitha näher kam, blickte sie auf, erhob sich mit einem kleinen Lächeln und streckte ihr die Hand entgegen. Ihr Händedruck fühlte sich kräftig und warm an. Sie hatte grau meliertes Haar und einen ruhigen Blick. Tabitha empfand einen Anflug von Hoffnung. Diese Frau würde alles regeln.
»Ich bin Mora Piozzi«, stellte sie sich vor. »Man hat mich gebeten, Sie zu vertreten.«
»Was ist mit dem anderen passiert?«, fragte Tabitha. Er war jung und munter gewesen, allerdings auf eine hektische, wenig vertrauenerweckende Art.
»Das war Ihr Pflichtverteidiger. Er hat Ihren Fall auf mich übertragen.«
Sie setzten sich einander gegenüber, wobei ihre Stühle laut über den Linoleumboden streiften.
»Wie geht es Ihnen?«
»Wie es mir geht?« Tabitha widerstand dem Drang, sie anzuschreien. Was war denn das für eine Frage? »Ich bin im Gefängnis eingesperrt und habe keinen blassen Schimmer, was eigentlich gerade abläuft.«
»Es ist meine Aufgabe, Klarheit in die Sache zu bringen und Ihnen zu helfen.«
»Ja.«
»Fangen wir mit den grundlegenden Dingen an. Als Erstes müssen Sie mir sagen, ob Sie damit einverstanden sind, dass ich Sie vertrete.«
»Ja.«
»Gut. Ich habe hier Ihre Gefangenennummer, für den Fall, dass man sie Ihnen noch nicht gegeben hat.«
»Gefangenennummer? Aber ich bin hier doch bald wieder raus. Wieso brauche ich eine Nummer?«
»Hier, bitte.«
Sie schob ihr ein Kärtchen hin, von dem Tabitha laut ablas: »AO3573.« Sie blickte hoch. »Dann bin ich jetzt also eine Nummer.«
»Das ist bloß Bürokratie. Sie brauchen sie für Ihre Besucher.«
»Besucher?«
»Da Sie in Untersuchungshaft sind, haben Sie ein Recht auf drei Besucher pro Woche. Hat Ihnen das noch niemand erklärt?«
»In meinem Kopf schwirrt alles ein bisschen durcheinander.«
Mora Piozzi nickte. »Am Anfang ist es schwer.«
»Ich möchte einfach nur so schnell wie möglich hier raus.«
»Natürlich. Deswegen bin ich ja da. Aber Ihnen ist schon klar, wie die Anklage lautet, Tabitha?«
»Ich weiß, was ich angeblich getan haben soll.«
»Gut. Unser Plan für heute sieht folgendermaßen aus: Ich werde erst einmal für Sie zusammenfassen, was man Ihnen zur Last legt. Anschließend erzählen Sie mir in eigenen Worten, was am einundzwanzigsten Dezember passiert ist.«
»Kann ich Sie vorher noch was fragen?«
»Natürlich.«
»Was für einen Tag haben wir heute?«
»Mittwoch, den neunten Januar.«
»Verstehe.«
Weihnachten und Silvester waren ins Land gezogen, sodass sie sich nun in einem neuen Jahr befand – und in einer neuen Welt.
»Also«, begann Mora Piozzi mit einem Blick auf ihren Laptop. »Hier die Kurzversion: Ihnen wird zur Last gelegt, am Freitag, dem einundzwanzigsten Dezember zwischen halb elf Uhr vormittags und halb vier Uhr nachmittags Stuart Robert Rees ermordet zu haben.«
»Warum?«
»Wie bitte?«
»Warum in diesem Zeitraum?«
Piozzi überflog ihre Notizen.
»Es gibt eine Überwachungskamera. Sie ist am Dorfladen angebracht. Sein Wagen ist dort vorbeigefahren.« Sie blickte erneut auf den Laptop. »Um zehn Uhr vierunddreißig. Und wie Sie wissen, wurde seine Leiche um halb fünf entdeckt.«
»Ja«, antwortete Tabitha mit schwacher Stimme. Nach einer kurzen Pause fügte sie hinzu: »Aber dann bleibt doch eine Stunde übrig, zwischen halb vier und halb fünf.«
»Wenn ich das richtig verstanden habe, geht der Gerichtsmediziner davon aus, dass Rees mindestens schon eine Stunde tot war, als seine Leiche entdeckt wurde.«
Piozzi sprach in leisem, ruhigem Ton weiter, als wäre das alles reine Routine. »Seine Leiche wurde von Andrew Kane in einem Schuppen nahe Ihrer Hintertür aufgefunden, eingehüllt in Plastikfolie. Sie selbst befanden sich zu dem Zeitpunkt im Haus. Stuart Rees’ Wagen stand hinter Ihrem Haus, außer Sichtweite von der Straße. Seine Leiche wies etliche Messerstiche auf, doch die eigentliche Todesursache war die Durchtrennung der Arteria carotis«. Sie blickte hoch. »Das ist die Halsschlagader. Sie waren von oben bis unten voll Blut, seinem Blut, und auch das Sofa, auf dem Sie saßen, hat eine Menge davon abbekommen.«
»Aber das ist doch erst passiert, nachdem er schon tot war«, wandte Tabitha ein.
Piozzi tippte auf die Tastatur des Laptops. »Die Polizei hat alle im Dorf befragt und …«
»Moment mal.«
»Ja?«
»Da muss doch viel Betrieb gewesen sein, ein Kommen und Gehen. Die Polizei kann unmöglich alle befragt haben.«
»An dem Tag war das anders.«
»Wie meinen Sie das?«
»Erinnern Sie sich denn nicht? Es war ein sehr stürmischer Tag, und eine riesige, von Braunfäule befallene Kastanie wurde vom Sturm entwurzelt und fiel quer über die Straße. Niemand kam ins Dorf rein oder raus. Allem Anschein nach dauerte es einen Großteil des Tages, bis die Durchfahrt wieder frei war.«
»Das wusste ich nicht.«
»Aber Sie waren doch dort, Tabitha, und zwar den ganzen Tag. Sie müssen es gewusst haben.«
»Ich wusste es nicht«, wiederholte Tabitha. Es kam ihr vor, als würden ihr die letzten Bruchstücke von Erinnerung wie Wasser durch die Finger rinnen. »Besser gesagt, ich weiß nicht mehr, ob ich es wusste.«
»Die Polizei hat eine Liste von allen, die sich am einundzwanzigsten Dezember in Okeham aufhielten. Es liegt auch Ihre Aussage vor, der zufolge Sie die meiste Zeit des Tages in Ihrem Haus verbracht haben. Darüber hinaus liegen der Polizei etliche Zeugenaussagen vor, die ich bisher allerdings noch nicht einsehen konnte. Vorerst haben wir nur einen zusammenfassenden Polizeibericht. Den Rest bekomme ich später, rechtzeitig vor dem ersten Gerichtstermin.«
»Der Verhandlung, meinen Sie?«
»Nein. Am siebten Februar findet erst einmal die offizielle Anklageerhebung statt. Da müssen Sie dann sagen, worauf Sie plädieren. Sie wissen schon, schuldig oder nicht schuldig.«
»Besteht denn nicht die Chance, dass sich das Ganze bis dahin als Irrtum entpuppt und man mich gehen lässt?«
Mora Piozzi zog eine Grimasse, die wenig Ähnlichkeit mit einem Lächeln hatte. »Wir sollten nicht zu weit vorausgreifen. Jetzt erzählen Sie mir doch bitte mal, woran Sie sich in Bezug auf den einundzwanzigsten Dezember erinnern. Lassen Sie sich Zeit.«
Tabitha nickte. Sie schloss die Augen, öffnete sie jedoch gleich wieder. Woran erinnerte sie sich? Es war, als versuchte sie in ein nächtliches Schneetreiben zu blicken, ein schwindelerregendes Zwielicht, in dem alles auf den Kopf gestellt war und der Boden unter ihren Füßen wankte.
»Ich bin früh aufgewacht«, begann sie. »Aber ich glaube nicht, dass ich gleich aufgestanden bin. Es war kalt draußen, ein scheußlicher Tag. Ich erinnere mich an Schneeregen, richtiges Matschwetter, mit heftigem Wind. Als ich mir dann Frühstück machen wollte, merkte ich, dass ich keine Milch mehr hatte, deswegen zog ich einfach eine Jacke über meinen Schlafanzug und ging zum Dorfladen. Ich glaube, ich habe mir auch eine Zeitung gekauft.«
»Um welche Zeit war das?«
»Keine Ahnung, ich habe nicht auf die Uhr gesehen. Danach bin ich wieder nach Hause gegangen.«
»Sind Sie später noch mal raus?«
»Ich war schwimmen. Ich gehe immer schwimmen.«
»In welchem Bad?«
»Was meinen Sie?«
»Wo ist das nächste Schwimmbad, und wie sind Sie da hingekommen? Vergessen Sie nicht, die Straße war nach zehn nicht mehr passierbar, also müssen Sie vorher hin- und zurückgekommen sein.« Sie sprach mit einem warnenden Unterton.
»Im Meer.«
Piozzis Augenbrauen schossen hoch. »Sie waren mitten im Winter im Meer schwimmen, an einem Tag, den Sie gerade als scheußlich beschrieben haben?«
»Das mache ich jeden Tag«, antwortete Tabitha. »Ohne Ausnahme. Das ist eine Regel, die ich für mich selbst aufgestellt habe. Ich brauche das.«
»Darum beneide ich Sie aber nicht. Auch wenn Sie bestimmt einen Neoprenanzug tragen.«
»Ich spüre gern das kalte Wasser auf der Haut. Das tut fast schon weh.« Sie sah Mora Piozzi leicht die Lippen schürzen, als hätte Tabitha gerade etwas gesagt, das ihr nicht gefiel. »Die Leute in Okeham halten mich wahrscheinlich für verrückt. Wie auch immer, jedenfalls war ich an dem Tag schwimmen.« Sie glaubte, sich an das harte Klatschen der Wellen gegen ihren Körper zu erinnern und an die scharfkantigen, eiskalten Steine unter ihren Fußsohlen, aber vielleicht bildete sie sich das nur ein. Sie schwamm schließlich jeden Tag. Wie sollte sie da einen Tag vom anderen unterscheiden können?
»Um welche Uhrzeit?«
»Keine Ahnung, daran erinnere ich mich nicht. Vormittags? Ich schätze, es war am Vormittag, wie üblich.«
»Haben Sie jemanden getroffen?«
»Keine Ahnung. Vielleicht. Ich kann gerade keinen klaren Gedanken fassen. Ich gehe jeden Tag ans Meer, deswegen fließt das in meinem Gedächtnis alles ineinander.«
»Und nach dem Schwimmen?«
»Bin ich wieder nach Hause.«
»Haben Sie danach noch einmal das Haus verlassen?«
»Ich glaube schon, aber genau weiß ich es nicht. Man hat mir so viele Fragen gestellt, dass ich die Dinge nicht mehr auseinanderhalten kann.«
»Was haben Sie zu Hause gemacht?«
»Nicht viel. Auch daran kann ich mich eigentlich kaum erinnern.«
»Haben Sie mit jemandem telefoniert?«
»Nein.«
»Oder Nachrichten verschickt oder Ihren Computer benutzt – Sie haben doch einen Computer?«
Tabitha nickte. »Ich habe nichts davon getan.«
»Keine Mails verschickt?«
»Ich glaube nicht. Vielleicht habe ich ein bisschen gearbeitet.« Sie wusste, dass sie nicht gearbeitet hatte. Es war einer jener schrecklichen Tage gewesen, an denen sie einfach nur zu überleben versuchte.
»Sie haben also keine klare Erinnerung daran, was Sie an dem besagten Tag gemacht haben?«
»Nein.«
»Aber Sie wissen noch, dass Andrew Kane vorbeigekommen ist?«
»Andy, ja.«
»Erzählen Sie mir davon. Lassen Sie sich Zeit.«
Tabitha fragte sich, warum sie das immer wieder sagte: Lassen Sie sich Zeit. Aber es spielte ohnehin keine Rolle. Sie hatte so viel Zeit.
»Er hat an die Tür geklopft. Ich war im Wohnzimmer und habe ihm aufgemacht. Oder vielleicht hat er die Tür auch selbst aufgemacht. Es war schon dunkel und sehr kalt. Ich kann mich an den eisigen Wind erinnern, der hereinwehte. Andy war ganz nass. Er hat den Boden vollgetropft.«
»Haben Sie ihn erwartet?«
»Nein. Aber er schaut oft unangemeldet vorbei.« Sie registrierte Mora Piozzis fragenden Blick. »Er hilft mir beim Renovieren des Hauses. Es war eine Bruchbude, als ich im November eingezogen bin. Wir richten es gemeinsam her. Ich zahle ihm einen Stundenlohn, und er schiebt mich zwischen seinen anderen Aufträgen ein. Wir hatten vor, am nächsten Tag ein paar Bodendielen zu verlegen, deswegen wollte er sich alles vorab noch einmal ansehen.«
Sie holte tief Luft. An dieser Stelle klärte sich ihre Erinnerung, als fiele ein Lichtstrahl in die Düsternis.
»Er ging hinaus zu dem Schuppen, wo die Dielen lagern. Plötzlich hörte ich ihn schreien. Ich weiß nicht, was er rief, vielleicht waren es auch gar keine Worte. Ich stürmte zu ihm hinaus, und da lag er im Schuppen auf dem Boden, auf irgendwas drauf.« Sie schluckte heftig. Ihre Kehle fühlte sich an wie zugeschnürt. »Ich beugte mich zu ihm hinunter, um ihm zu helfen, und spürte dabei etwas Nasses, Klebriges. Alles war voll davon. Als ich ihn auf die Füße zog, sagte er immer wieder: »O Gott, o Gott!« Immer wieder. Ich glaube, er hat auch geweint.«
Tabitha verstummte, doch Piozzi sagte nichts, sondern wartete nur mit zusammengekniffenen Augen.
»Es war dunkel«, fuhr Tabitha schließlich fort. »Wir konnten kaum etwas sehen. Andy holte sein Handy heraus, aber es fiel ihm hinunter, sodass er erst eine Weile herumfummeln musste, bis er es wieder zu fassen bekam. Dann leuchtete er damit auf den Boden, und da lag eine Leiche. Andy war überall voller Blut, sogar im Gesicht. Ich blickte auf meine Hände hinunter und stellte fest, dass es bei mir genauso war.« Während sie sprach, sah sie alles wieder vor sich: den kleinen Strahl der Handytaschenlampe, der über die starrenden Augen glitt, die klaffende Wunde am Hals, die unnatürlich verrenkten Gliedmaßen.
»Wussten Sie gleich, wer es war?«
»Ich kann mich nicht erinnern, was mir durch den Kopf ging. Als Andy sagte, es sei Stuart, begriff ich, dass er recht hatte.«
»Nur, um das klarzustellen: Sie kannten Stuart Rees?«
»Ja, er ist jetzt mein Nachbar.« Sie biss sich auf die Lippen. »Ich schätze, ich sollte sagen, er war mein Nachbar. Und vor vielen Jahren war er einer meiner Lehrer.«
»Sie kannten ihn also gut?«
»Was soll ich sagen? Er war mein Lehrer.«
»Sind Sie gut miteinander ausgekommen?«
»Jedenfalls nicht schlecht. Allerdings haben wir uns nicht oft gesehen, bloß hin und wieder Hallo gesagt.«
»Wie ging es dann weiter?«
»Wir sind zurück ins Haus. Andy hat den Notruf gewählt. Dann haben wir gewartet, bis der Krankenwagen und die Polizei eintrafen und das Ganze losging. Den Rest kennen Sie.«
Mora Piozzi klappte den Laptop zu.
»Sie sehen also, dass das alles keinen Sinn ergibt«, fuhr Tabitha eilig fort. »Wenn ich vorher da draußen in dem Schuppen jemanden umgebracht und liegen gelassen hätte, warum hätte ich dann Andy zu den Holzdielen hinausschicken sollen, damit er über die Leiche fiel? Warum hätte ich Stuart überhaupt umbringen sollen? Die Vorstellung ist einfach verrückt. Das ist Ihnen doch klar, oder etwa nicht?«
Die Anwältin warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Das war schon mal ein guter Anfang. Ich komme bald wieder. Bis dahin weiß ich hoffentlich schon Genaueres über die Beweislage gegen Sie.«
Tabitha nickte.
»In den nächsten paar Tagen wird man Sie einer eingehenden medizinischen Beurteilung unterziehen.«
»Warum denn das? Mir fehlt nichts. Ich mag ja klein sein, aber ich bin trotzdem stark. Das verdanke ich dem Schwimmen.« Ihre Stimme klang kratzig. Sie fror und fühlte sich leicht wackelig. Auf keinen Fall wollte sie zurück in den großen Mittelgang, wo alle sie beobachteten und die Stimmen so hallten, oder in ihre Zelle, wo sie mit sich selbst eingesperrt war. Der vor ihr liegende Tag erschien ihr endlos, doch auf den Tag folgte zwangsläufig die Nacht, und das war noch schlimmer.
»Die Beurteilung durch einen Arzt gehört einfach zu dem ganzen Prozedere. Außerdem möchte ich, dass Sie alles aufschreiben, was Ihnen einfällt und Ihrer Meinung nach wichtig sein könnte.«
»Woran denken Sie da?«
»Die zeitliche Abfolge: wann genau Sie was getan haben. Leute, die Sie gesehen oder gesprochen haben. Geben Sie mir eine Liste der Dorfbewohner, mit denen Sie befreundet sind.«
»Ich bin doch erst vor ein paar Wochen wieder hingezogen.«
»Sie sollten mir alles sagen, was für Ihre Verteidigung hilfreich oder relevant sein könnte. Ich würde wichtige Fakten wesentlich lieber von Ihnen als von der Staatsanwaltschaft erfahren.«
Tabitha nickte.
»Sorgen Sie dafür, das Sie Besuch bekommen. Familienangehörige, Freunde. Haben Sie Ihre persönlichen Sachen schon hier?«
»Nein.«
»Beauftragen Sie jemanden damit, sie Ihnen zu bringen. Suchen Sie sich eine Beschäftigung. Achten Sie auf Ihre Gesundheit.«
»Und Sie holen mich hier raus, ja?«
»Das ist mein Job«, antwortete Mora Piozzi. »Ich werde tun, was ich kann.«
Tabitha sah ihr nach, bis die Tür des Besucherraums hinter ihr zufiel. Sie stellte sich vor, wie Mora durch eine Tür nach der anderen ging, eine nach der anderen hinter ihr abgeschlossen wurde, bis sie schließlich den Ausgang erreichte und in die Welt hinaustrat, in die frische Luft – die Freiheit.
3
Tabitha konnte sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal angestanden hatte, um ein öffentliches Telefon zu benutzen. In Okeham gab es noch eine alte rote Telefonzelle, aber sie enthielt kein Telefon mehr, sondern diente als Lagerraum für Secondhandbücher, die man sich dort ausleihen konnte. Jetzt stand sie als Dritte in der Schlange und wartete darauf, dass die stämmige Frau, die vorne gerade telefonierte, den Streit mit ihrem Gesprächspartner beendete, bei dem es sich allem Anschein nach um einen nichtsnutzigen Ehemann oder Freund handelte.
Tabitha blickte sich die ganze Zeit nervös um. Es war fast schon Zeit fürs Mittagessen. Sie hatte gehört, dass jederzeit ein Aufseher erscheinen und sie alle wegschicken konnte. Von der Beamtin mit dem grimmigen Gesicht, die, wie sie inzwischen in Erfahrung gebracht hatte, Mary Guy hieß, war sie darüber informiert worden, dass sie vorab ein Formular ausfüllen und jede Telefonnummer registrieren und absegnen lassen musste. Abgesehen von ihrer eigenen hatte sie jedoch keine Nummern im Kopf. Ihre Kontakte waren in ihrem Handy gespeichert. Wie konnte man von ihr erwarten, dass sie alle auswendig wusste? Sie fragte Mary Guy, ob irgendeine Möglichkeit bestehe, an ihr Handy heranzukommen, nur wegen der Nummern, bekam als Antwort aber bloß ein Lachen.
Sie hatte keine Eltern, die sie anrufen konnte, keine nahen Verwandten. Sie zermarterte sich das Gehirn nach Freunden, Kontakten, doch sie hatte etliche Jahre im Ausland verbracht und die Leute aus den Augen verloren. Bestimmt waren viele inzwischen umgezogen, irgendwohin verschwunden. Eine Nummer hatte sie allerdings: die der Anwältin, Mora Piozzi. Das war schon mal ein Anfang. Aber gab es sonst noch jemanden? Sie ging in Gedanken die Leute durch, die sie im Dorf kannte. Stuarts Ehefrau Laura fiel ihr ein. Das wäre unpassend, wahrscheinlich auch nicht erlaubt. Dann war da noch Andy. Seine Nummer konnte sie von Mora erfragen. Mit wem im Dorf sprach sie sonst eigentlich noch? Mit Terry, der Frau, die den Dorfladen betrieb. Sie plauderten meistens ein wenig, wenn Tabitha Milch kaufte, aber direkt befreundet waren sie nicht.
Ihr kam ein Gedanke: Shona Fry. Shona war mit ihr zur Schule gegangen und im Dorf geblieben, nachdem alle anderen es verlassen hatten. Shonas Handynummer kannte sie zwar nicht, sehr wohl jedoch ihre Festnetznummer, weil diese eine spiegelverkehrte Version ihrer eigenen war: 525607.
Als sie schließlich die Spitze der Schlange erreichte, blieben nur noch fünf Minuten bis zum Mittagessen.
»Tabitha! Man hat mir gesagt, dass du anrufen wirst«, verkündete Shona, die vor Aufregung atemlos klang.
»Ich weiß.«
»Sie haben mich gefragt, ob es für mich in Ordnung wäre. Sie wollten mein Einverständnis, was ein bisschen seltsam ist, findest du nicht? Natürlich habe ich Ja gesagt. Das weißt du bestimmt, weil …«
»Entschuldige«, unterbrach Tabitha sie. »Ich habe fast keine Münzen für diesen Anruf und auch fast keine Zeit. Ich muss dich um ein paar Gefälligkeiten bitten.«
»Ja, klar. Was auch immer.«
»Erstens, kannst du mich besuchen kommen?«
»Ich?«
»Ja.«
»Auf jeden Fall«, antwortete Shona langsam. »Ja, gern. Ich meine, natürlich, sicher, ich …« Sie schien nicht zu wissen, wie sie den Satz zu Ende bringen sollte, deswegen fiel ihr Tabitha erneut ins Wort.
»Großartig. Könntest du mir ein paar Sachen mitbringen?«
»Ja, klar. Ich schätze aber, es gibt Regeln?«
»Ich brauche Klamotten.«
»Ich dachte, im Gefängnis tragen die Leute so eine Art Gefangenenuniform.«
»Nein.«
»Verstehe. Wahnsinn, das ist alles so schräg! Was willst du haben?«
»Nur bequeme Sachen. Eine zweite Hose, ein paar langärmelige Shirts und Pullis. Hier drin ist es eisig kalt.«
»Demnach ist es dir egal, was genau ich bringe?«
»Ja, eigentlich schon. Ich bin sowieso bald wieder draußen, es ist also nur für die nächsten paar Wochen. Ach ja, und Unterwäsche.«
»Slips und so?« Shona klang fast peinlich berührt.
»Ja. Und Socken. Dicke Socken.«
»Wo finde ich die?«
Tabitha stellte sich ihr Schlafzimmer vor. Es lag im obersten Stockwerk des Hauses, direkt unter dem schräg abfallenden Dach. Sie hatte es gewählt, weil ein Fenster aufs Meer hinausging und die anderen auf die Klippen. Sie schlief immer noch auf einer Matratze auf dem Boden, das einzige Möbelstück im Raum war eine Kommode. Der Rest ihrer Sachen befand sich in Koffern und Kisten.
»In meinem Zimmer ganz oben«, antwortete sie. »Du musst einfach ein bisschen stöbern.«
»Sonst noch was?«
»Ein paar Stifte. Notizblöcke. Seife und Shampoo. Mehr Zahnpasta.«
»Ich muss mir das aufschreiben.«
»Am wichtigsten sind die Stifte und das Papier. Auf dem Küchentisch liegen mehrere Notizblöcke, glaube ich, und Stifte findest du in einem großen Glaskrug auf dem Fensterbrett.«
»Verstanden.«
»Und könntest du Briefpapier und Umschläge für mich kaufen? Im Dorfladen gibt es auch Notizbücher. Sie haben schwarze oder braune Umschläge und sind unliniert. Würdest du mir da ebenfalls eines besorgen?«
»In Ordnung.« Inzwischen klang sie widerwillig.
»Ich bezahle die Sachen natürlich.«
»Tut mir leid, ich weiß, das hört sich übel an, aber ich bin völlig pleite. War’s das?«
Tabitha überlegte einen Moment. »Bücher. Neben meinem Bett liegen ein paar. Kannst du mir die mitbringen?«
»Klar. Aber wie komme ich ins Haus?«
»Unter einem Stein neben der Haustür liegt ein Schlüssel. Ach ja, und Briefmarken«, fügte Tabitha hinzu.
»Wie viele?«
»Zehn. Nein, zwanzig.«
»Expresszustellung oder normal?«
»Expresszustellung, würde ich sagen. Ich habe keine Zeit für lange Warterei.«
»Geht es dir gut?«, fragte Shona. »Ich meine, das ist alles so schrecklich! Ich kann gar nicht glauben, dass es wirklich passiert ist.«
»Ich auch nicht. Keine Ahnung, wie es mir geht. Ich versuche klarzukommen. Wie läuft es im Dorf?«
»Na ja, im Moment gibt es natürlich nur ein einziges Thema.«
Tabitha kam plötzlich ein Gedanke. »Könntest du mir die Telefonnummern von ein paar Leuten im Dorf mitbringen?«
»Von welchen?«
»Egal. Alle Nummern, die hilfreich sein könnten. Festnetznummern, falls die Leute welche haben. Anrufe sind hier richtig teuer, und ich habe nicht viel Geld.«
»Ich weiß nicht, an wen du da denkst. Könntest du mir ein paar Namen nennen?«
Tabitha setzte zu einer Antwort an, doch in dem Moment tauchte von der Seite eine Hand auf und beendete das Gespräch. Sie blickte sich um. Es handelte sich um einen Aufseher, den sie noch nicht kannte. Er wirkte blass, leicht aufgedunsen und übergewichtig – irgendwie aufgeblasen.
»Hey, was zum Teufel …? Das war wichtig!«, rief Tabitha entrüstet.
»Mittagessen«, sagte er und wandte sich ab.
4
Sie lag fest zusammengerollt auf ihrem Bett. Dabei war ihr dumpf bewusst, dass Michaela sich in der kleinen Zelle bewegte. Sie hörte sie das Klo benutzen. Sie hörte gedämpftes Wasserrauschen, leise Schritte. Unter ihrer Decke, die sie bis über den Kopf gezogen hatte, hielt sie die Augen geschlossen. Sie wollte sich weder bewegen noch Tageslicht sehen, sondern in ihrer persönlichen, säuerlich riechenden Höhle bleiben. Denken konnte sie nur wie in Zeitlupe, zäh und träge.
»Steh auf.« Michaelas Stimme klang nüchtern.
Tabitha gab ihr keine Antwort.
»Steh auf, Tabitha!« Die Decke wurde ihr vom Gesicht gezogen.
»Kann nicht.«
»Doch, du kannst. Du musst.«
Tabitha öffnete die Augen. Sie hatte ein pelziges Gefühl im Mund.
»Auf!«, befahl Michaela.
»Wie geht es Ihnen?«
Tabitha warf einen Blick auf das laminierte Namensschild, das der Psychiater an einem Band um den Hals trug. Dr. David Hartson. Das dazugehörige Foto stammte aus einer Zeit, als er noch mehr Haare hatte und eine andere Brille trug. Die sehnige Aufseherin mit dem langen, schlaffen Haar, die sie von jenem ersten Morgen kannte, hatte sie in ihrer Zelle abgeholt und nach unten gebracht, vorbei an den anderen Zellen. Dabei hatte die Beamtin eine Reihe von Türen auf- und wieder abgesperrt, sie einen Gang entlanggeführt und dann in einen Raum, wo man überhaupt nicht das Gefühl hatte, in einem Gefängnis zu sein. Der Raum sah eher nach einer ziemlich heruntergekommenen Arztpraxis aus, wie man sie überall finden konnte.
»Darf ich Ihnen erst eine Frage stellen?«, erwiderte Tabitha.
»Natürlich.«
»Für wen machen Sie das?«
Dr. Hartson musterte sie mit einem leicht verlegenen Lächeln. »Ich weiß nicht, was Sie meinen.«
»Sie sind Arzt. Sind Sie hier, um mir zu helfen oder um mich zu beurteilen?«
Er nickte. »Eine gute Frage. Eigentlich handle ich im Auftrag des Gerichts. Sollte ich jedoch irgendetwas Bedenkliches feststellen, tue ich selbstverständlich, was ich kann. Also, wie geht es Ihnen?«
»Ich bin im Gefängnis. Man hat mich des Mordes angeklagt. Ich schätze mal, das bedeutet, dass es mir nicht gut geht.«
»Verspüren Sie irgendwie das Bedürfnis, sich selbst etwas anzutun?«
Tabitha schüttelte den Kopf. »Ich habe erst zwei Nächte hier verbracht. Es kommt mir immer noch vor, als befände ich mich mitten in einem Autounfall – einem Unfall, der kein Ende nimmt. Aber bald wird sich herausstellen, dass das alles Schwachsinn ist, und man wird mich gehen lassen.«
Dr. Hartson griff nach einem Formular und strich es auf dem Tisch glatt. Dann zog er einen Kugelschreiber aus der Tasche, klickte ihn einsatzbereit und machte sich zunächst Notizen zu ihrem Lebenslauf: ihrer Schulbildung, ihren Eltern, dem Tod ihres Vaters, der einen Herzinfarkt gehabt hatte, als sie dreizehn war, und dem Tod ihrer Mutter vor gerade mal zwei Jahren. Er fragte sie, ob diese Verluste für sie schwer gewesen seien, worauf sie antwortete, ja, sie seien schwer für sie gewesen. Er wollte von ihr wissen, ob sie ihren Eltern nahegestanden habe. Sie überlegte einen Moment, ehe sie antwortete, es habe Höhen und Tiefen gegeben. Er schien an nichts, was sie sagte, viel Anteil zu nehmen, sondern runzelte bloß vor Konzentration die Stirn, während er das Formular ausfüllte. Tabitha konnte nicht lesen, was er schrieb.
»Sind Sie berufstätig?«, erkundigte er sich.
»Ich arbeite freiberuflich als Redakteurin wissenschaftlicher Lehrbücher.«
»Gab es je irgendwelche Anzeichen für eine geistige Erkrankung?«
»Woran denken Sie da?«
»Alles, was eine medizinische Behandlung erforderte.«
»Ich war phasenweise ein bisschen deprimiert.«
»Nehmen Sie zurzeit Medikamente?«
»Nicht mehr.«
»Mit welchen Medikamenten wurden Sie in der Vergangenheit behandelt?«
Tabitha nannte ein, zwei Namen, obwohl sie nicht sicher war, ob sie sie richtig in Erinnerung hatte. Dr. Hartson notierte sie.
»Welche Auswirkungen hatten diese Medikamente auf Sie?«
»Unterschiedliche.«
»Hatten Sie Gedächtnislücken? Aussetzer?«
»Daran kann ich mich nicht erinnern.« Sie stieß ein nervöses Lachen aus. »Entschuldigen Sie, das war jetzt kein Witz. Auf jeden Fall hat es mir widerstrebt, die Medikamente zu nehmen.«
»Waren Sie wegen Ihrer Probleme je im Krankenhaus?«
»Während meiner Zeit an der Uni hatte ich mal eine besonders schlimme Phase.« Sie bemühte sich um einen beiläufigen Ton. »Ich habe das Studium abgebrochen.«
»Und da waren Sie im Krankenhaus?«
»Kurz, aber nicht in einem richtigen Krankenhaus, sondern eher in einer Art Klinik.« Sie hörte seinen Stift über das Papier gleiten. »Das ist schon Jahre her«, fügte sie hinzu.
»Natürlich. Haben Sie Ihr Studium fortgesetzt?«
»Nein.«
»Was hatten Sie studiert?«
»Architektur.«
»Und jetzt sind Sie Redakteurin?«
»Ja.«
»Macht Ihnen die Arbeit Spaß?«
»Ich bin mein eigener Chef.«
»Gefällt es Ihnen, Ihr eigener Chef zu sein?«
»Jedenfalls besser, als nicht mein eigener Chef zu sein«, erwiderte sie, woraufhin er sie prüfend musterte.
Am liebsten hätte sie ihm einen Finger ins Auge gerammt.
»Wie ist es Ihnen in letzter Zeit gegangen?«, fragte er nach einer Pause.
Tabitha zuckte die Achseln. »Ich bin wie alle anderen auch: Ich habe gute Tage und schlechte Tage. Das Dorf kann im Winter ein bisschen trist sein. Sie wissen schon – wenn es nachmittags um vier schon dunkel wird.«
Hartson lächelte, doch das Lächeln erreichte nicht die Augen. »Ich weiß genau, was Sie meinen. Warum sind Sie in das Dorf zurückgezogen?«
»Ich habe etwas geerbt, als meine Mutter starb. Damit kaufte ich diese Bruchbude von einem Haus. Das war so eine Art Traum von mir.«
»Interessant. Wie hat sich der Traum in der Realität entwickelt?«
»Ich mag das Haus. Es macht mir Spaß, es wieder herzurichten. Ich arbeite gerne handwerklich.«
»Wie war Ihre Stimmung in den Wochen vor dem Mord?«
»Eigentlich nicht anders als sonst.«
»Auf und ab?«
»Ja. Wahrscheinlich mehr auf als ab.« Das war gelogen.
»Und am Tag des Mordes?«
»Was?«
»Wie war Ihre Stimmung an dem Tag?«
Tabitha betrachtete den Stift, den er schreibbereit über dem Papier hielt und seinen kleinen, feuchten Mund. Eigentlich hatte sie überhaupt keine Lust, diesem Mann irgendetwas zu erzählen.
»So lala«, sagte sie.
»Haben Sie eine klare Erinnerung daran?«
»Nein.«
»Sie erinnern sich nicht an die Ereignisse des Tages?«
»Es ist alles ein bisschen verschwommen.«
»Verstehe«, sagte er. »Verstehe.«
»Das bezweifle ich.«
»Wie bitte?«
»Ich bezweifle, dass Sie es verstehen«, antwortete Tabitha. Sie wusste, sie sollte sich am Riemen reißen. »Es war bloß einer jener Tage. Einer von denen, die man einfach überstehen muss. Die meisten Leute haben solche Tage. Sie nicht?«
»Es geht hier nicht um mich, sondern um Sie und Ihren geistigen Zustand.«
»Schon gut, ich sage ja nur, dass ich mich nicht an viel erinnere, was aber nichts zu bedeuten hat. Richtig?«
Dr. Hartson ließ sich mit seiner Antwort Zeit. »Richtig«, meinte er schließlich in neutralem Ton. Er wandte sich wieder dem Formular zu. »Haben Sie Freunde im Dorf? Leute, mit denen Sie über Ihre Probleme sprechen?«
»Ich spreche eigentlich gar nicht über meine Probleme.«
»Hatten Sie das Gefühl, dass es ein Fehler war, dorthin zurückzukehren?«
Einen Moment lang fiel es Tabitha schwer zu sprechen. »Im Moment fühlt es sich nach einem gottverdammten Fehler an.«
Er blickte zu ihr hoch. »Ich meinte, in den Tagen vor dem Mord.«
»Ich war noch nicht lange dort. Ich war damit beschäftigt, das Haus herzurichten. Dabei ging mir vieles durch den Kopf.«
»Was ging Ihnen denn durch den Kopf?«
»Die Frage, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich nehme mal an, das Problem hat sich vorerst von selbst erledigt.«
Tabitha meinte das als eine Art säuerlichen Witz, doch Dr. Hartson reagierte nicht darauf. Allerdings stellte er das Schreiben ein und blickte nachdenklich vor sich hin.
»Ich glaube, das wäre alles.« Er schob das Formular zur Seite. Darunter kam ein zweites zum Vorschein. »Wären Sie damit einverstanden, mir Zugang zu Ihrer gesundheitlichen Vorgeschichte zu gewähren?«
»Haben Sie da als Arzt nicht sowieso Zugriff?«
»Ich brauche Ihre Unterschrift.« Er drehte das Formular um und schob es ihr zu.
Tabitha griff nach dem Stift, den er ihr hinhielt, und unterschrieb.
»Wie ist Ihre Einschätzung?«, fragte sie anschließend. »War das, was ich Ihnen erzählt habe, in Ordnung?«
»Es scheint mir alles recht klar auf der Hand zu liegen.«
»Was werden Sie schreiben?«
»Was hätten Sie denn gern, dass ich schreibe?«
»Dass ich so etwas unmöglich getan haben kann.«
Er gab ihr keine Antwort. Stattdessen bedachte er sie lediglich mit einem Lächeln der Art, wie es viele am Ende von gesellschaftlichen Anlässen aufsetzen, bevor sie verkünden: Ich sollte jetzt wohl aufbrechen. In diesem Fall aber war es Tabitha, die aufbrechen sollte. Sie blickte sich um. Es widerstrebte ihr, diesen Raum zu verlassen und ins richtige Gefängnis zurückzukehren.
»Es kommt mir alles so irreal vor«, bemerkte sie.
»Das ist normal.« Sie erhoben sich beide. »Auf Wiedersehen, Miss Hardy.«
»Niemand nennt mich Miss. Miz ist mir lieber. Nicht dass es eine Rolle spielen würde. Ach, übrigens, wenn ich angegeben hätte, Selbstmordgedanken zu haben, was hätten Sie dann gemacht?«
Ihre Frage schien Dr. Hartson zu überraschen. »Ich hätte Ihnen empfohlen, mit dem Gefängnisarzt zu sprechen.«
Tabitha war versucht, ihm eine zornige Antwort zu geben, am liebsten hätte sie ihn gefragt, ob er selber denn kein Arzt sei. War es nicht eigentlich seine Aufgabe, Menschen zu helfen, denen es schlecht ging? Aber sie wusste, dass sie diesen Mann auf ihrer Seite brauchte. Deshalb verkniff sie sich jeden weiteren Kommentar über ihre kurze Begegnung und verließ den Raum. Draußen wurde sie von Mary Guy erwartet, an deren Gürtel sie den schweren Schlüsselbund baumeln sah.
5
Tabitha war in der Bibliothek. Auch dort fand sie es noch kalt, aber besser als in ihrer Zelle. Man fühlte sich weniger wie im Gefängnis, auch wenn durch das Fenster nur eine abblätternde weiße Mauer zu sehen war, gekrönt von Stacheldraht. Die Bibliothekarin, eine große Frau mit knochigen Händen und hellbraunem Haar, hieß sie mit einem Lächeln willkommen.
»Wir kennen uns noch gar nicht.«
Tabitha nickte. Sie brachte plötzlich kein Wort mehr heraus.
»Ich bin Galia. Es freut mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben.«
»Tabitha.« Ihre Stimme klang schroff.
»Sie lesen gern?«
»Ja. Meine eigenen Bücher habe ich noch nicht da, eine Freundin bringt sie mir demnächst vorbei.«
Galia nickte. »Na, dann sind Sie hier genau richtig. Ich wünschte, mehr Leute würden die Bibliothek benutzen.«
Tabitha blickte sich um. Abgesehen von einer Frau, die lesend an einem der Tische saß, war der Raum leer.
»Kann ich nehmen, was ich will?«
»Solange Sie es hier drin lesen, selbstverständlich. Wenn Sie die Bücher mit in Ihre Zelle nehmen, müssen Sie sie eintragen. Und sollten Sie besondere Titel wollen, kann ich sie für Sie bestellen.«
»Wie in einer richtigen Bibliothek?«
»Das ist eine richtige Bibliothek.«
Tabitha ließ den Blick über die Regale schweifen. Es handelte sich hauptsächlich um Literatur, aber es gab auch einen Bereich mit Berichten über reale Kriminalfälle und einen weiteren mit diversen Erotika für verschiedene Geschmäcker. Tabitha wandte sich wieder an die Bibliothekarin.
»Ist irgendetwas nicht erlaubt?«
»Im Grunde nicht. Abgesehen von Berichten über Verbrechen, die von gegenwärtigen Gefangenen begangen wurden.«
»Das leuchtet mir ein«, meinte Tabitha.
»Und Bücher mit Landkarten der Region. Aber ich gehe nicht davon aus, dass Sie es auf solche abgesehen haben.«
Tabitha warf erneut einen Blick durch das vergitterte Fenster, auf die Mauern mit den Metallspitzen und dem Stacheldraht obenauf. »Nein«, bestätigte sie. »Ich werde nicht versuchen auszubrechen. Außerdem bin ich sowieso nicht lange hier.«
Galia nickte. »Dann lasse ich Sie mal stöbern.«
Neben den Romanen und der Pornografie gab es ein paar Klassiker und eine umfangreiche Fremdsprachenabteilung. Ein kleinerer Abschnitt war der Gärtnerei und handwerklichen Hobbys gewidmet, ein weiterer dem Thema Gesundheit und Wohlbefinden. Es gab Bücher mit Kreuzworträtseln und Sudokus, von denen viele schon ausgefüllt waren. Tabitha fand einen Band über Island, ein Land, das sie schon seit Langem mal bereisen wollte. Sie nahm es mit hinüber zu dem großen Tisch in der Mitte und ließ sich gegenüber der anderen Frau nieder. Sie war mittleren Alters, hatte dunkles, von grauen Strähnen durchzogenes Haar, das schön geschnitten war, und trug einen melierten Rollkragenpullover über einem schmalen Rock. Tabitha fragte sich, ob sie eine weitere Bibliothekarin war, und betrachtete deshalb ihre Lektüre, woraufhin die Frau, die ihren Blick bemerkt hatte, das Buch hochhielt. Es handelte sich um eine Sammlung von Kochrezepten.
»Meine heimliche Leidenschaft«, erklärte sie. »Lächerlich, nicht wahr? Über Rezepten zu hocken, während ich hier festsitze!«
»Macht es das nicht noch schlimmer?«
»Ich träume von den Mahlzeiten, die ich kochen werde, wenn ich hier rauskomme. Was lesen Sie denn?«
Tabitha hielt ihr Buch ebenfalls hoch. »Über Island.«
»Auch nicht besser.«
»Da haben Sie wohl recht.«
Sich in einer winzigen Zelle Wale, Gletscher und weite, wilde Landschaften vorzustellen, machte es tatsächlich nur noch schlimmer. Tabitha schaute auf das Buch hinunter, krank vor Sehnsucht nach einem weiten Himmel und salzigem Wind im Gesicht.
»Warum Sind Sie hier?«
Die Frau legte den Kopf schief. Ein neugieriges Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. »Sie wollen wissen, was ich getan habe?«
»Ja.«
Die Frau wirkte plötzlich nachdenklich. »Es war eigentlich richtig dumm. Ich habe für eine Firma gearbeitet, die in eine finanzielle Krise geriet. Bis ich kapierte, was da ablief, war es schon zu spät. Die brauchten einen Sündenbock, und ich saß gerade am richtigen Platz, besser gesagt, am falschen. Jedenfalls sehe ich meine Geschichte so. Jede hier erzählt eine Geschichte darüber, welches Pech sie hatte, und jede behauptet, unschuldig zu sein.«
»Verstehe«, sagte Tabitha.
»Sie sind neu hier, oder?«
»Es ist alles ein Irrtum«, antwortete Tabitha. »Ich glaube, meine Anwältin kann das ganz schnell klären.«
»Wie heißen Sie? Ich bin übrigens Ingrid.«
»Tabitha.«
»Schön, Tabitha, dann gebe ich Ihnen jetzt ein paar gute Ratschläge. Ich wünschte, jemand hätte sie mir gegeben, als ich hier ankam. Regel Nummer eins: Fragen Sie nie nach dem Grund, warum die Leute hier sind.«
»Oh! Entschuldigung! Ich wollte nicht … Ich meine, ich wusste nicht …« Sie hatte die gleiche Frage auch schon Michaela gestellt, fiel ihr ein. Sie musste daran denken, wie sich die Miene ihrer Zellengenossin daraufhin verfinstert hatte.
»Mir macht es nichts aus, vielen anderen aber schon. Regel Nummer zwei: Wenn Sie ein Problem haben, beispielsweise der Meinung sind, dass etwas ungerecht ist oder jemand es auf Sie abgesehen hat, dann melden Sie es nicht.«
»Sondern?«
»Sondern gar nichts. Regel Nummer drei: Die Direktorin ist eine schreckliche Person. Trauen Sie ihr niemals über den Weg, und verscherzen Sie es sich nicht mit ihr.«
»Diese Regeln bewirken nicht gerade, dass ich mich besser fühle.«
»Regel Nummer vier: Wenn Sie aus irgendeinem Grund in Schwierigkeiten geraten, dann denken Sie daran, wie es auf dem Schulhof war.« Tabitha zog eine Grimasse. Das hatte Michaela auch schon zu ihr gesagt, und sie hatte die Zeit auf dem Schulhof als brutale Phase erlebt. »Man bringt die Leute nicht dazu, einen zu mögen, indem man sich schwach zeigt.«
Sie schien fertig zu sein.
»War’s das?«
»Es sind eher Ratschläge als Regeln. Bleiben Sie aktiv. Ach ja, und das Essen ist fürchterlich. Beschränken Sie sich aufs Grünzeug.«
»Das tue ich sowieso. Ist das vegetarische Essen gut?«
»Gut nicht, aber nicht ganz so schlecht.« Sie beugte sich vor. »Sie dürfen sich einfach nicht hängen lassen, Tabitha. Dann kommen Sie schon zurecht.«
6
Eine halbe Stunde auf dem Exerzierplatz, einem schmuddeligen Rechteck aus Asphalt und Stacheldrahtzaun, bei heftigem, kaltem Wind. Tabitha hatte keine Handschuhe, und ihr Mantel wärmte nicht so recht. Trotzdem war sie wenigstens draußen und über ihr Himmel.
Die Frauen standen in Gruppen beieinander, die meisten mit Zigaretten. Tabitha unternahm nicht den Versuch, sich einer von ihnen anzuschließen. Stattdessen reckte sie ihr Gesicht dem Himmel entgegen, um die dahinziehenden Wolken zu beobachten und dabei gierig die frische Luft einzuatmen, als wäre sie kurz vor dem Ertrinken.
Auf dem großen Mittelgang begegnete ihr die dünne alte Frau mit den arthritischen Händen, die sie schon am ersten Tag gesehen hatte, als sie auf dem Weg zu den Duschen war. Mit lauter Stimme, aber ohne sich dabei an jemand Bestimmten zu wenden, verkündete die Frau: »Ich glaube, ich habe es gefunden. Das werde ich ihnen zeigen. Seht her!« Sie fummelte an ihrem dicken Papierstapel herum. »Seht her!«
Die Hälfte des Papiers entglitt ihr und fiel zu Boden. Sie ging in die Knie, um die Blätter aufzusammeln, hatte dann jedoch Schwierigkeiten, wieder hochzukommen. Die Umstehenden lachten, Häftlinge ebenso wie Wachpersonal. Tabitha trat vor, um ihr zu helfen, doch einer der Beamten – der Aufgedunsene, der ihrem Gespräch mit Shona ein Ende gesetzt hatte – kam ihr zuvor, schob die Hände unter die Achseln der alten Frau und hob sie hoch wie eine überdimensionale Lumpenpuppe. Grinsend sah er Tabitha an und schraubte dabei mit einem dicken Zeigefinger an seiner Schläfe herum.
Sie spielte mit dem Gedanken, seinem Schienbein einen schönen, harten Tritt zu verpassen, doch stattdessen lächelte sie der alten Frau zu und wandte sich dann ab.
»Michaela«, sagte sie in die Dunkelheit hinein.
Aus dem Bett über ihr kam ein Grunzen, dann: »Was?«
»Es tut mir leid, dass ich dich gefragt habe, was du getan hast. Mir war nicht klar, dass man das nicht soll.«
Keine Antwort.
»Heute Nacht ist es ruhiger.«
»Das liegt daran, dass alle schlafen außer dir – und jetzt auch mir, verdammt!«
»Entschuldige.«
Sie starrte in die undurchdringliche Dunkelheit, während Michaela sich über ihr hin und her wälzte. Nach einer Weile kam sie wieder zur Ruhe. Tabitha hörte ihre Atemzüge. Ihre eigenen hörte sie auch. Das war nun ihre vierte Nacht. In sechsundzwanzig Tagen würde sie vor das Gericht treten, und man würde ihren Fall ad acta legen. Vier Nächte von dreißig, zwei Fünfzehntel, in Prozent umgerechnet 13,333 Periode. Morgen würde Shona ihr Kleidung, Bücher, Stifte und Papier bringen. Sie, Tabitha, war dem gewachsen, sie konnte es schaffen. Irgendwann würde es ihr vorkommen wie ein schlimmer Traum – die Sorte Albtraum, aus der man nachts schweißgebadet hochschreckt. Aber es würde nicht mehr real sein.
Doch noch war sie hier und alles so kalt und dunkel. Und in der Dunkelheit wehten ihr Gedanken und Erinnerungen entgegen wie ein übler Wind, der durch sie hindurchblies, sodass ihr Herz hämmerte und ihr Atem ganz flach wurde, bis er kaum noch zu spüren war. Womöglich würde sie an sich selbst ersticken.
Sie musste daran denken, wie der Arzt sie nach ihrer Stimmung gefragt hatte, nach den Medikamenten, die sie nahm, und der Zeit, die sie in der Klinik gewesen war. Sie hatte nicht mit ihm darüber sprechen wollen, genauso wenig wie mit der Anwältin, weil es so eindeutig und klar definiert klang, wenn man darüber redete, während sich der Zustand der Depression für Tabitha jedes Mal anfühlte wie ein Sumpf, in dem sie langsam versank – ein farbloser, formloser Sumpf ohne Horizont, ohne Sonnenlicht, ohne Ausweg.
An jenem Tag – dem Tag, der sie hierher in die Zelle geführt hatte, wo sie sich in dieser Nacht fühlte wie in einem Sarg – hatte sie in dem besagten Sumpf gesteckt. Sie konnte sich nicht an viel erinnern, nur an die unendliche Mühe, die es sie gekostet hatte, sich aus dem Bett zu hieven, während ihr Körper sich so schwer und nutzlos anfühlte wie ein Sack nasser Erde. Mühsam hatte sie sich in den Dorfladen geschleppt, sich danach gezwungen, schwimmen zu gehen, weil sie sich das geschworen hatte. Nun war sie hier, wo es ihr nicht mehr möglich war, im Meer zu schwimmen oder Holz zu hacken oder durch den kalten Regen zu wandern. Sie wusste, dass sie sich nicht wieder zurücksaugen lassen durfte in den düsteren Abgrund ihres eigenen Selbst, aber sie hing nur noch an einer Fingerspitze.
7
Man hat mir alles abgenommen.«
Ein wenig atemlos ließ Shona sich gegenüber Tabitha nieder. Ihr Blick zuckte hierhin und dorthin. Mit einem Gesichtsausdruck, der halb nervös, halb aufgeregt wirkte, nahm sie alles ganz genau in Augenschein. Sie trug eine blaue Satinbluse und große Ohrringe. Das grelle Neonlicht ließ ihren kastanienbraunen Kurzhaarschnitt glänzen. Tabitha konnte ihr Parfüm riechen. Sie wirkte frisch und hübsch – und somit an diesem Ort völlig fehl am Platz. Im Vergleich zu ihr fühlte Tabitha sich klein, schäbig, unansehnlich und schmuddelig. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann sie sich das letzte Mal die Haare gewaschen hatte, und ihr letzter Schnitt lag schon Monate zurück. Egal, wie gründlich sie sich die Zähne putzte, sie hatte immer ein pelziges Gefühl im Mund, und ihre Mundwinkel waren entzündet. Sie brauchte dringend frische Luft und gesundes Essen: knackige Äpfel, grünen Salat, nahrhafte Gemüsesuppe.
»Vermutlich müssen sie die ganzen Sachen erst mal kontrollieren. Hast du alles bekommen?«
Shona nickte. Die Bewegung ließ ihre Ohrringe schwingen. »Ich glaube schon.«
»Das ist so lieb von dir.«
Shona zog einen Zettel aus der Tasche und faltete ihn auseinander.
»Ich habe aufgeschrieben, wie viel es gekostet hat. Ist das in Ordnung? Bei mir sieht es im Moment wirklich düster aus.«
Bargeld war im Gefängnis nicht erlaubt. Tabitha überlegte krampfhaft.
»Wende dich an Andy«, sagte sie schließlich. »Andy Kane. Ich habe ihm vorab ein bisschen Geld für Baumaterial gegeben. Er müsste dir deine Auslagen erstatten können.«
»Es tut mir leid.« Shona biss sich auf ihre volle Unterlippe. Schlagartig tauchte vor Tabithas geistigem Auge ein Bild auf, so klar, als wäre es erst gestern gewesen: Shona und sie selbst in einer Warteschlange vor dem städtischen Schwimmbad, beide etwa zwölf Jahre alt. Sie konnte sich nicht erinnern, warum sie sich dort zusammengefunden hatten, denn sie waren nicht wirklich Schulfreundinnen gewesen, aber sie wusste noch genau, dass es ein sehr heißer Tag gewesen war und Shona einen bauchfreien Kurzarmpulli getragen hatte, dessen enger Schnitt ihre knospenden Brüste betont hatte.
»Es gibt zwei Hauttypen«, hatte Shona mit großer Ernsthaftigkeit erklärt. »Ölig und trocken. Welcher bist du?«
Die zwölfjährige Tabitha fasste sich an die Wange. »Keine Ahnung.«
»Ich bin ölig«, verkündete Shona. »Das bedeutet, dass ich zwar eine fleckigere, dafür aber keine so runzlige Haut bekomme, wenn ich alt bin.« Sie beugte sich vor und untersuchte Tabithas Gesicht. »Trocken«, lautete ihr Urteil.
Nun, achtzehn Jahre später, betrachtete Tabitha Shonas Haut. Sie war glatt und schimmerte seidig.
»Tabitha?«
»Entschuldige, was hast du gesagt?«
»Ich fühle mich wirklich mies, weil ich das Geld von dir verlange.«
»Das ist schon in Ordnung.«