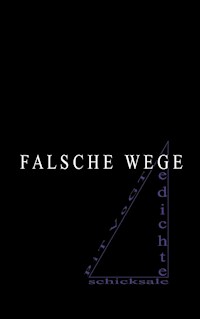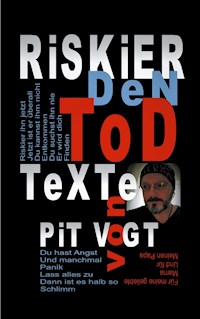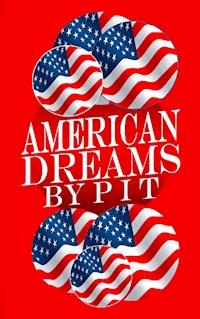
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Sind amerikanische Träume poetisch, unfassbar oder sogar geisterhaft? In diesem Buch erfahren Sie es! Hier zu lesen sind Geschichten, die man sich nicht so recht zu erklären vermag, Gedichte und Beschreibungen über dramatische und doch ganz normale Schicksale. Kommen Sie mit auf eine Reise in die Fantasie, in eine Welt mysteriöser Lebenswendungen und geisterhafter Wirklichkeiten. Entdecken Sie das, von dem Sie glaubten, es würde nicht wirklich existieren. Und entdecken Sie eine Realität zwischen den Wahrheiten. Vielleicht finden Sie etwas, dass Sie schon verloren glaubten, vielleicht entdecken Sie etwas Unfassbares, eine Sehnsucht, die tief in Ihnen träumt? Vielleicht entdecken Sie sich selbst wieder völlig neu und anders?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ideen, Cover & Design: PiT
Alle Stories & Texte sind frei erfunden
Inhaltsverzeichnis
STORIES
Ghost 1
Ghost 2 & 3
Kollision
Vermisst
City of Stupidity
Albtraum
Telefonzelle
Rosen
Verfahren
Die Bar
Einbruch
Der Helm
Der Fluch
Mordfall
Begegnung
Spritztour
Schwimmbad
Loch
Banküberfall
Buße
Stadt der Engel
Schreckensfahrt
Weihnachtsengel
Die Kette
Seemannsgarn
Traum
Wunschbuch
Letzter Arbeitstag
Jungbrunnen
Alpträume
Brücke
Schmetterlinge
Soße
Flug 2033
USB-Stick
Hauch des Lebens
Fantasien
Bommel-Mütze
Letzter Fall
Sandra
Hexe
Kredithai
Stein
Apotheke
Kleine Elfe
Kronleuchter
Knoten
Tatoo
Steppenbrand
Basecap
Der Flug
Lebensbrunnen
Erbschaft
Pullover
Gelber Eimer
Hotel
Fuchs
Ausfahrt 77
TEXTE
Die Angestellte
Stopp
Spiegelbild
Weihnachtsfrau
Nacht
Die Wärterin
An der Grenze
Der Mann im Wald
Eine Frau
Kriegskinder
Das Kind
Ruhe
Der Trinker
Für Locke
Sehnsucht
Besuch
Clown
Schicksal
Der Stieglitz
Kraniche
Die Tänzerin
Störche
Am Straßenrand
Drogentod
Engel
Die Herde
Späte Heimkehr
Hoffnung
Autist
Fremde
Der Bund
American Dreams
Ghost 1
Vor langer Zeit, als sich die Erde noch entwickelte und es noch keine Menschen gab, hatte es sich zugetragen, dass aus den schwarzen Tiefen des Universums eine riesige Hand durchs Universum fuhr. Es war das Böse, das nach dem Guten suchte, um es zu vernichten. Wer die Hand lenkte war nicht zu erkennen. Doch sie bewegte sich stetig und ohne Unterlass durch die unergründlichen und unermesslichen Weiten der zahllosen Galaxien. Schließlich traf sie auf die noch junge Erde und sie sah, wie dutzende Vulkane auf ihr eine Atmosphäre begannen zu bilden. Die Hand spürte, dass es das Leben war, das sich auf diesem kleinen Planeten herausbildete. Sie fühlte, dass es das Gute war, dass da entstand und sie wollte es vernichten. Schon holte sie zum vernichtenden Schlag aus und zielte geradewegs auf den Planeten. Doch die stetige Bewegung des Planeten um die Sonne bewirkte, dass die Hand den Planeten leicht verfehlte und nur ein Stück des Planeten abschlagen konnte. Sie glaubte jedoch, den Planeten für immer vernichtet zu haben und zog sich in die Tiefen des Universums zurück. Dorthin, woher sie einst gekommen war. Die beiden Bruchstücke des Planeten, ein kleines und ein großes, trieben seitdem umeinander und es formten sich über Millionen von Jahren die Erde und der Mond. Er umkreist den Planeten und zieht wie ehedem die Meere an und lässt sie wieder frei. Man nennt dieses Phänomen Ebbe und Flut und immer, wenn Menschen traurig oder glücklich sind, schauen sie sehnsuchtsvoll in den schwach leuchtenden Mond und haben Tränen in den Augen. Und immer dann, wenn sich auf der Erde das Böse formiert, um zum Schlag gegen das Gute zu wappnen, gleitet der Mond darüber hinweg und versucht, alles wieder zu glätten. Es war im Jahr 2222, als sich die Menschen derart verstritten hatten, dass sie nicht mehr gemeinsam auf der Erde leben konnten. Die Bösen vertrieben die Guten, die fortan auf dem Mond ihre Zuflucht fanden. Doch der Mond war viel zu klein für all die vielen guten Menschen und sie wollten wieder zurück auf die Erde. Doch die bösen Menschen hatten Waffen entwickelt, die mit ihrer verheerenden Wirkung alles Leben vernichten konnten. Deswegen gelang es den Guten nicht, die Erde wieder zu bevölkern. Traurig lebten sie in ihren engen kleinen Mondstädten und mussten zusehen, woher sie die Rohstoffe zur Energiegewinnung und letztendlich zur Bewirtschaftung des toten Mondgesteins beschafften. Immer weiter gelangten sie bei ihrer Suche ins Universum und irgendwann stießen sie auf ein Areal, welches von Ferne wie eine unfassbar große, leuchtende Gaswolke aussah. Die Raumfahrer begriffen nicht, was es war und flogen mitten in die Gaswolke hinein. In einer wabernden Masse entdeckten sie eine riesige schwarze Hand. Sie lag regungslos in der schmatzenden Masse und die Raumfahrer glaubten, es sei lediglich eine überdimensionale Gesteinsformation, die vollkommen gefahrlos war. Doch sie irrten gewaltig, denn die vermeintliche Gesteinsformation war die Hand des Bösen, die nur auf die guten Menschen gewartet zu haben schien. Als die Raumfahrer über sie hinweg glitten, holte sie aus und schnappte nach dem Raumschiff der Menschen. Nur einem Zufall war es zu verdanken, dass das Raumschiff dieser Hand entkommen konnte. Doch es war schwer beschädigt worden und kaum noch manövrierfähig. Es trieb durch die dichte Gaswolke und hatte vollkommen die Orientierung verloren. Die Raumfahrer glaubten, ihre Heimat, den Mond niemals mehr wieder zu sehen. Doch es war ganz seltsam- sie entdeckten, dass die schwarze Hand ihren Ursprung in einem riesigen „Schwarzen Loch“ hatte, welches sich im Zentrum der fremden Galaxis befand. Das musste der Zugang zur Hölle, zum Satan sein. Wenn es den Menschen gelänge, diesen Zugang für immer zu verschließen, dann könnte diese Hand auch nicht mehr leben und das Böse wäre für alle Ewigkeiten besiegt. Aber wie konnte man ein solch riesiges kosmisches Objekt wie dieses „Schwarze Loch“ verschließen? Es schien vollkommen unmöglich und mit den Mitteln, die die Menschen zur Verfügung hatten, unerreichbar. Da wurden die Raumfahrer so traurig, dass sie bitterlich weinten. Sie konnten sich einfach nicht mehr beruhigen und weinten hundert Tage und hundert Nächte und irgendwann hatten sie so viele Tränen geweint, dass die Automatik des Raumschiffes all diese Tränen nicht mehr in verwendbares Wasser umwandeln konnte oder gar anderweitig zu verarbeiten vermochte. So musste all das salzhaltige Tränenwasser ins All abgelassen werden. Ein riesiger Schwall ergoss sich in die Schwerelosigkeit des Raumes und zerfiel in die kleinsten Kristalle. Da es derart viele Tränen waren, war es auch ein riesiger Kristallschwall, der durchs All flog. Wie magisch wurde er von dem starken Schwerefeld des „Schwarzen Loches“ angezogen und drang schließlich wie ein scharfer Pfeil in dieses Loch ein. Doch da geschah etwas Seltsames – die Myriaden von Kristallen, welche die guten Menschen einst geweint hatten, vermochten sich nicht mit dem Bösen in diesem „Schwarzen Loch“ zu verbinden. Es war, als würde Antimaterie auf Materie treffen und eine unglaublich heftige Explosion vernichtete das schwarze Loch. Das gesamte Areal wurde neutralisiert und die Hand verging bevor sie die guten Menschen vernichten konnte. Sie verschwand einfach wie das schwarze Loch in der Unendlichkeit. Augenblicklich löste sich die Gaswolke auf und verfrachtete durch die Wucht ihrer Explosion das manövrierunfähige Raumschiff der guten Menschen zum Erdmond zurück. Dort hatte sich bereits Merkwürdiges ereignet. Der Mond war auf die Erde gestürzt und hatte sich mit ihr vereinigt. Der einstige Zauber der bösen Hand war durch die Vernichtung des „Schwarzen Loches“ beseitigt worden und es gab keine Trennung mehr. Das Gute hatte gesiegt und die Menschen lebten fortan in Ruhe und Frieden, in Eintracht und Liebe miteinander auf der blühenden, fruchtbaren Erde. Als eines fernen Tages ein junger Astronom die Grenzen des Universums untersuchte, stellte er eine sonderbare Erscheinung fest. Am Rande des Universums, am Rande aller Zeiten hatten sich mysteriöse Schatten formiert, die vor sich hin pulsierten wie die Zeiger einer überdimensionalen Uhr. Der Astronom konnte sich das nicht erklären, waren doch nach dem Zerbersten des „Schwarzen Loches“ auch alle übrigen schwarzen Löcher des Universums vernichtet worden. Doch als er genau hinsah und die Leistung des Teleskops noch ein wenig verstärkte, erstarrte er vor Schreck!
Was er dort draußen am Rande des Universums erblickte, waren die Fingerkuppen einer unfassbar riesigen Hand, die das gesamte Universum in sich zu tragen schien…
Ghost 2
Lisa war auf dem Weg von einer kleinen Geburtstagsparty, die ihre Freundin gegeben hatte, zu sich nach Hause. Es regnete und der Wind frischte ein wenig auf, doch das allerschlimmste war, dass sie durch ein dichtes Waldstück fahren musste. Es dämmerte bereits, als sie bei „Drivers Run“ in den düsteren Wald einbog. Die Straße glänzte im Scheinwerferlicht, denn sie war nass und spiegelte das Licht ganz merkwürdig zurück. Weil Lisa ein wenig sonderbar wurde, legte sie sich eine CD ins Autoradio und lauschte dem leisen Blues. Plötzlich jedoch mischte sich ein anderes Geräusch, welches sich wie das Stöhnen eines alten Mannes anhörte, in die Musik. Zunächst glaubte Lisa, es sei ein Instrument, welches ja bei Blues nicht unmöglich sein mochte. Doch als es immer wieder ertönte, schaltete sie das Radio aus. Und wirklich, es war vielleicht ein sonderbarer Windhauch oder doch nur der Regen. Jedenfalls breitete sich ein monotones Stöhnen über dem Wald und der Straße aus. Lisa bekam eine Gänsehaut, was konnte das nur sein? Nervös schaute sie in den Rückspiegel, doch da war nichts. Die Straße lag schwarz glänzend hinter ihr wie das Trauerband auf einem Kranz. Irgendwie war es der jungen Mittdreißigerin gar nicht mehr so gleichgültig wie eben noch. Doch sollte sie ausgerechnet hier anhalten? Sollte sie in einer völlig unbekannten Gegend, die nicht einmal den allerbesten Ruf bei den Leuten hatte, einfach so den Wagen stoppen? Sie tat es, wollte der Sache auf den Grund gehen. Und so fuhr sie in einer kleinen Schneise von der Straße ab und hielt an. Jetzt hörte sie es ganz genau, dieses gruselige Geräusch, als wenn jemand vor Schmerzen stöhnte. Haaa … es wollte einfach nicht mehr enden. Lisa spürte ein leichtes Zittern, und als sie in den dunklen Wald hineinschaute, glaubte sie, rote Lichtblitze zwischen den Bäumen zu erkennen. Jetzt bekam sie Angst, sprang schnurstracks in ihren Wagen und startete den Motor. Mit quietschenden Reifen raste sie los und glaubte sich schon in Sicherheit. Aber da beugten sich urplötzlich die Wipfel der Bäume zur Straße herab und versperrten ihr den Weg. Sie bremste scharf und verriss das Steuer. Der Wagen gehorchte ihr nicht mehr und kam von der Fahrbahn ab. Zwischen Sträuchern und Büschen kam er schließlich zum Stehen und bewegte sich nicht. Lisa starrte auf die dicht stehenden Bäume um sich herum und fürchtete sich sehr. Das Stöhnen war nun so deutlich, dass sie glaubte, jemand wäre neben ihr. Und warum hatten sich die Wipfel eigentlich so plötzlich auf die Straße gebeugt? Panisch verriegelte sie die Wagentüren und rutschte ängstlich unters Armaturenbrett. Immer wieder hörte sie es, dieses „Haaa“, welches so unheimlich war, wie diese gesamte unbegreifliche Situation. Wollte sie nicht längst daheim sein? Mit zitternden Händen kramte sie ihr Mobiltelefon aus ihrer Handtasche und wollte ihre Freundin anrufen. Doch als sie aufs Display schaute, bemerkte sie, dass sie gar kein Funknetz hatte. Natürlich war ihr klar, dass es hier in diesem Wald nur selten ein Funknetz gab, aber was sollte sie nur tun? Plötzlich beugten sich die Wipfel der umstehenden Bäume noch weiter herab und der Wagen mit der darin befindlichen jungen Frau löste sich einfach in Luft auf. Als er verschwunden war, ertönte noch einmal dieses mysteriöse, unheilvolle Stöhnen: Haaa. Dann wurde es still und die Bäume standen so, wie sie immer standen. Nur ein leichter Wind verfing sich in den Ästen und der Regen tropfte auf die einsame Waldstraße, als wenn er die Spuren der letzten untrüglichen Minuten verwischen wollte.
Ghost 3
Als der letzte Schüler der Gymnasialklasse in den Zug eingestiegen war, schloss der Schaffner die Tür und blies inbrünstig in die Pfeife, um dem Zug das Abfahrtsignal zu geben. Langsam setzte sich die Lok mit ihren zwei Waggons in Bewegung, und die Schüler saßen müde an den Fenstern und waren schon zu kaputt, um sich noch endlos lange zu unterhalten. Einige schliefen bereits, als der Zug in ein dichtes Waldstück bog. Er fuhr sehr langsam und der Zugbegleiter trottete gelangweilt durch den Wagen, um die Fahrkarten zu kontrollieren.
Es musste auf der Höhe von „Drivers Run“ gewesen sein, als der Zug plötzlich hielt. „Merkwürdig“, zischte der Zugbegleiter, „Hier haben wir sonst nie angehalten!“ Ungläubig schauten die Schüler aus den Fenstern, doch sie konnten nichts Genaues erkennen. Da sprang der Lokführer von seiner Diesellokomotive und rief: „Ein Baum liegt auf dem Gleis! Wenn ihr mal helfen könntet!“ Die Schüler, die auf einmal gar nicht mehr so müde waren, fanden alles sehr aufregend und spannend und sprangen aus dem Waggon, um zusammen mit dem Lokführer und dem Zugbegleiter den schweren Stamm beiseite zu rollen. Es gelang und schon waren alle wieder im Zug, um endlich weiterzufahren. Doch nichts passierte, dafür aber erklang ein unheilvolles Geräusch. Es hörte sich an wie ein lautes Stöhnen, dass sich wie ein unsichtbarer Wurm durch den umliegenden Wald und über die Baumwipfel schob, bis es schließlich wie ein böser Geist durch den gesamten Zug kroch.
Das Licht in den Waggons begann zu flackern und der Zugbegleiter konnte sich auch nicht erklären, was da vor sich ging. Draußen war es stockdunkel geworden und nur das immer lauter werdende Stöhnen konnte man noch hören. Die Schüler, die eben noch glaubten, alles wäre in Ordnung, gerieten in große Angst. Plötzlich bogen sich die Wipfel der am Bahndamm stehenden Bäume zum Zug herab und hüllten ihn vollständig ein. Es dauerte keine fünf Sekunden, da hatte sich der gesamte Zug in Luft aufgelöst und es wurde wieder still. Nur der Wind verfing sich im Geäst der Bäume als sei gar nichts geschehen. Diesmal allerdings schien etwas anders, denn niemand hatte bemerkt, dass Jimmy, ein Schüler aus dem eben noch vorhandenen Zug, fehlte. Er hatte sich im Wald umgeschaut, wollte wissen, woher das seltsame Stöhnen gekommen war und fand sich in der Dunkelheit nicht mehr zurecht. Als er am Bahndamm stand, verstand er die Welt nicht mehr. Sein Zug war weg, aber wie war das nur möglich? Eben noch war er doch noch da und so schnell fuhr die Bahn ja nun auch nicht. Nachdenklich und fröstelnd setzte er sich auf das Gleis und starrte in die Dunkelheit. Was sollte er nur tun, vielleicht nach Hause laufen? Aber er wusste ja gar nicht, wie weit das noch war. So fand er, dass er sich im Wald umsehen könnte, um im dichten Buschwerk die Nacht abzuwarten. Es hatte ohnehin keinen Zweck, in der Dunkelheit umherzuirren. Glücklicherweise hatte er seinen Rucksack auf dem Rücken. Darin befanden sich noch ein paar belegte Brote und eine Flasche Mineralwasser. Damit würde er schon irgendwie auskommen und so lief er los. Es war schon beschwerlich, sich den Weg durchs Gestrüpp zu bahnen, aber dann glaubte er, einen schwachen Lichtschein zu sehen. Doch nein, es waren rote Lichtblitze, die ganz schwach durchs Geäst flackerten. „Da muss jemand sein!“, dachte er sich und lief geradewegs darauf zu.
Als er einen dichten Busch auseinanderdrückte, sah er es, dieses winzige alte Holzhaus, aus dessen kleinen Fensterchen rotes flackerndes Licht wie der Schein einer Laterne herausfiel. Erleichtert lief der Junge bis vor die Tür und hielt dann doch inne. Irgendwie schien ihm das Ganze nicht geheuer zu sein, und so lief er erst mal ganz vorsichtig um das Häuschen herum. An einem der kleinen Fenster blieb er stehen und schaute neugierig ins Innere. In dem kleinen Raum befand sich nicht viel; nur ein paar alte Möbel, eine Truhe und ein alter Lehnsessel, in dem tatsächlich jemand saß. Es war ein alter Mann, der wohl ein wenig schlief, denn er hatte seine Augen geschlossen. Doch gerade als Jimmy an das Fenster pochen wollte, um sich bemerkbar zu machen, öffnete der Alte seine Augen. Jimmy erschrak fürchterlich, denn es waren keine menschlichen Augen, die da in seine Richtung schauten! Es waren zwei stechende rote Lichter, die in Jimmys Richtung starrten und dabei flackerten wie ein Warnlicht! Der aufgeregte Junge versteckte sich schnell unterhalb des Fensters und glaubte schon, der Alte hätte ihn längst bemerkt. Doch dem schien nicht so zu sein, denn es kam niemand. Dafür drang wieder dieses sonderbare Stöhnen an Jimmys Ohren. Er fürchtete sich wirklich sehr, und er wusste auch nicht so genau, was er tun sollte. Allerdings musste er schnellstens sehen, dass er unbemerkt von hier verschwand. Da knarrte die hölzerne Tür und der Alte erschien. Hatte er Jimmy doch bemerkt, dann wäre wohl alles verloren! Der Alte aber schritt geradewegs auf einen dicken Baum zu und sprach: „Öffne dich und gib mir das, was du heut gefangen hast!“ Augenblicklich öffnete sich die Erde und gab den Blick auf etwas frei, dass Jimmy nicht glauben konnte. Es war ein Kanalsystem, welches offenbar alle Bäume des Waldes miteinander zu verbinden schien. Lange rote und blaue Fasern verbanden die Wurzeln der Bäume und es war, als wenn durch all diese Fasern und Leitungen irgendeine Flüssigkeit strömte. Wie konnte so etwas nur sein? Sollte am Ende gar der gesamte Wald unterirdisch mit diesen Fasern und Leitungen verbunden sein? War am Ende der gesamte Wald nur ein künstlich angelegtes Areal? Jimmy spürte, wie sein Herz bis zum Halse pochte. Er zitterte vor Angst und glaubte sich schon in der tiefsten Hölle. Doch da verschwand der Alte in der Erde, die sich hinter ihm langsam wieder zusammenschob. Erleichtert atmete Jimmy auf, doch wie sollte er unerkannt von diesem unheiligen Ort verschwinden? Neben der Holzhütte entdeckte er ein Motorrad. Das musste dem Alten gehören, und weil er bereits Motorrad fahren konnte, schlich er sich dorthin und schwang sich darauf. Er wusste, wie man eine solche Maschine kurzschloss und das tat er auch. Augenblicklich heulte der Motor auf und sogleich öffnete sich auch die Erde und der Alte stürmte wutschnaubend heraus. Zischend und schreiend rannte er auf Jimmy zu, doch der war schneller. Er gab der Maschine die Sporen und raste auf den kleinen Waldweg vor der Hütte. Der Alte schien allerdings auch ziemlich schnell zu sein und jagte wie ein Wirbelwind dem Motorrad hinterher. Jimmy schaffte es, den Alten abzuschütteln und auch das merkwürdige Stöhnen hielt ihn nicht mehr auf. Dafür senkten sich die Wipfel der Bäume auf den Waldweg herab und Jimmy glaubte sich bereits verloren. Aber er schaffte es, aus dem Wald zu entkommen, noch bevor die Baumkronen den Waldweg versperrten. Schließlich gelangte er auf eine Asphaltstraße, die irgendwann an einem Motel vorüberführte. Dort hielt er an und schaute sich ängstlich um. Von dem Alten und dem sonderbaren Wald war nichts mehr zu sehen und zu hören.
In der kleinen Gastwirtschaft allerdings wunderte man sich über den aufgeregten Jungen und gab ihm erst einmal ein Nachtlager und eine Kleinigkeit zu essen. Jimmy war hundemüde und legte sich alsbald ins Bett, wo er sofort einschlief.
Irgendwann rüttelte ihn jemand ziemlich heftig an der Schulter, und als er seine Augen öffnete, starrte er ungläubig in das liebevolle Gesicht einer recht vertrauten Person. Es war seine Mutter, die neben seinem Bett stand und ziemlich besorgt zu sein schien. Jimmy stotterte nur herum: „Was ist passiert? Warum bist du hier, in diesem Motel?“ Die Mutter schien die merkwürdige Frage nicht zu verstehen. „Welches Motel? Du bist daheim in deinem gemütlichen, warmen Bettchen. Wie geht es dir, mein Schatz?“ Jimmy verstand gar nichts mehr und Stück für Stück kehrten seine vermeintlichen Erinnerungen zurück. Diese Klassenfahrt, der bedrohlich düstere Wald, das Stöhnen, dieser sonderbare Alte, es war doch alles so unglaublich real. Doch seine Mutter beruhigte ihn und meinte, dass die Klassenfahrt erst bevorstand. Sicher hatte ihr aufgeweckter Sohn alles nur geträumt.
Einige Zeit später ging es ihm schon erheblich besser und er saß am Frühstückstisch und schaute neugierig aus dem offenen Küchenfenster. Die Sonne stand schon hoch am Himmel und es versprach ein schöner Sommertag zu werden. Gleich würde er in die Schule gehen, da tönte eine sonderbare Meldung aus dem Radio: „Seit drei Tagen wird eine junge Frau mit Namen Lisa M. vermisst. Sie war mit ihrem Wagen in einem entfernten Waldstück unterwegs, bevor sich ihre Spur verlor. Außerdem brach der Kontakt zu einer Schulklasse abrupt ab, die ebenfalls in diesem Wald unterwegs gewesen war.“
Wie versteinert saß Jimmy am Tisch und starrte erschrocken aus dem Fenster.
Plötzlich war alles wieder ganz nah und doch glaubte er, dass er alles nur geträumt hatte. Wie konnte so etwas nur möglich sein? Eine Antwort gab es nicht. Nur kam plötzlich aus dem nahen Wäldchen am Haus solch ein merkwürdiges Geräusch, und es hörte sich an, als wenn die Bäume stöhnten und sich ihre Wipfel über dem Haus merkwürdig knisternd zu beugen begannen…
Kollision
Es war trübe geworden und der Herbst hielt mit aller Macht Einzug in die wundersame Welt. Milla war eine junge Frau, die gerade erst ihr Psychologiestudium erfolgreich hinter sich gebracht hatte und nun in der großen Stadt Atlantic-City lebte. Der Regen an diesem Tage gefiel ihr gar nicht, doch sie ließ sich davon nicht abhalten, ein wenig durch die breiten Straßen ihrer schönen Stadt zu laufen. Sie wollte abschalten und es sah ganz so aus, als wenn es ihr auch gelingen mochte. Aber da waren auch die Probleme und die Sorgen, all die Rechnungen, die sie erhielt, nicht mehr begleichen zu können. Denn obwohl sie ihr Studium so erfolgreich abschließen konnte, hatte sie noch immer keinen Job gefunden und das Geld, welches sie sich zusammengespart hatte, ging ihr langsam aus. Wie sollte es nur weitergehen, wie sollte sie nur ihr Leben auf die Reihe bekommen, wenn doch so ganz und gar nichts richtig lief? Sollte sie vielleicht stempeln gehen, so jung, wie sie war? War das wirklich eine Lösung? Wo blieb das Glück, von dem sie oft träumte?
Da begegnete ihr ein kleines Mädchen. Mit seinen großen Kulleraugen schaute es zu Milla auf und schien sie irgendetwas fragen zu wollen. Natürlich blieb Milla stehen und sprach zu dem Kind, wollte wissen, warum es so schaute. Das kleine Mädchen aber schwieg zunächst, wollte wohl nicht sprechen, vielleicht war es aber auch einfach nur verstockt, aber dann sagte es doch noch etwas: „In drei Stunden geht die Welt unter und dann ist alles vorbei!“
Milla hatte ja so einiges erwartet und war auch schon einiges gewohnt, aber eine solche unfassbare Antwort hatte sie nicht erwartet. Was war nur mit diesem eigenartigen Mädchen los? Ging es ihr nicht gut oder war sie gar psychisch … nein! Milla schaute in den wolkenverhangenen Himmel und wischte sich dann den herniederprasselnden Regen von der Stirn. Als sie wieder nach unten schaute, war das kleine Mädchen verschwunden. Irritiert schaute sie sich nach allen Seiten um, aber zwischen den vorbeieilenden Menschen konnte sie die Kleine nirgends mehr entdecken. Nachdenklich lief sie zu einem angrenzenden Park und setzte sich auf eine der vielen vom Regen durchnässten Bänke. Sie kam einfach nicht über diesen furchterregenden Satz hinweg. Wie kam diese Kleine nur auf einen solchen, zugegebenermaßen unglaublichen Gedanken? Wer hatte ihr das nur gesagt – den Weltuntergang gab es doch gar nicht, das wussten doch schon die Kinder in der Schule. Doch so sehr sie auch versuchte, das soeben Erlebte wegzuschieben, es gelang ihr einfach nicht. Stattdessen fielen ihr nun auch noch die Naturkatastrophen ein, über die in den Morgennachrichten berichtet wurde. Nein, sie musste unbedingt etwas Sinnvolles anstellen, bevor sie gänzlich in Panik verfiel. So setzte sie einfach ihren Spaziergang durch den Regen fort und zwang sich streng, nicht mehr daran zu denken. Als sie daheim war, schaltete sie den Fernsehapparat ein und war sprachlos. Denn da wurde eindrucksvoll berichtet, dass sich aus bisher ungeklärten Gründen der Nachbarplanet der Erde, der Mars aus seinem Orbit gelöst habe und sich nun auf die Erde zubewegte. Das Ganze geschah so schnell, dass bereits Notfallpläne veröffentlich wurden. Milla schoss der Schreck in alle Glieder und sie spürte, wie ihr Magen rebellieren wollte. Sollte das wirklich alles wahr sein, und woher wusste dieses kleine Mädchen von all diesem Übel? Hatte es diese Nachricht vielleicht schon irgendwo gelesen? Panisch stürzte Milla in die Küche und nahm sich eine Schreibe trockenes Brot. Irgendetwas musste sie jetzt zu sich nehmen, bevor sie das Haus wieder verließ. Immerhin dachte sie schon darüber nach, wie die Evakuierung ablaufen könnte. Doch draußen blieb es ruhig und nur der Regen plätscherte gleichmäßig gegen die Scheiben. Nervös setzte sich Milla wider auf ihr Sofa und verfolgte weiterhin die verhängnisvolle Nachrichtensendung.
Nun wurde ein Filmbericht gezeigt, indem man den Mars sehen konnte. Er war ein winziger Lichtpunkt, der sich rasch über den Himmel bewegte. Sollte das wirklich der nahende Planet, dieses nahende Unglück sein?
Wieder schaute sie aus dem Fenster, und diesmal hatten sich schon sehr viele Menschen aus ihren Häusern begeben, um zum Himmel zu starren und auf die Katastrophe zu warten. Milla aber wollte das nicht, sie nahm den Telefonhörer und rief Ken, einen Freund im Institut an, um sich nach dieser vermeintlichen Katastrophe zu erkundigen. Zu allem Unglück bestätigte Ken das nahende Desaster und meinte, dass er ihr einen Platz in einem Atombunker, nicht weit von der Stadt, anbieten könnte. Milla nahm dankend an, wollte aber erst einmal sehen, wie es weiterging. Nun hielt sie es doch nicht mehr in der Wohnung aus! Schnell packte sie sich einige Sachen in ihre Umhängetasche und stürmte ebenfalls hinaus zu den anderen auf die Straße. Unterdessen hatte sich der Regen verzogen und die Menschen konnten ungehindert in den klaren Himmel schauen. Auch Milla schloss sich der Masse an und starrte nach oben. Der immer größer werdende Lichtpunkt versetzte die ganze Stadt, ja sogar die ganze Welt in Angst und Schrecken. Als schließlich der gesamte Horizont von der mächtigen dunkelroten Scheibe des Mars verdeckt wurde, liefen einige Leute weinend davon. Andere suchten in ihren Häusern und Wohnungen Schutz, obwohl sie wussten, dass diese Notfallmaßnahme, dieser verzweifelte Rettungsversuch vollkommen unnötig war. Milla blieb, denn sie wollte auf einmal der tödlichen Gefahr ins Auge schauen. Wenn sie schon sterben musste, so dachte sie sich, dann wenigstens hoch erhobenen Hauptes! Schon konnte sie einzelne Krater und eigenartige Landschaftsformationen auf dem fremden Planeten ausmachen und es würde wohl nicht mehr lange dauern, bis er mit der Erde kollidierte. Um den dabei entstehenden Krawall nicht mehr hören zu müssen, hatte sie sich Ohrstöpsel mitgenommen, die sie sich nun fest in die Ohren stopfte. Irgendwie wurde sie immer ruhiger und der nahende Tod ließ sie plötzlich kalt. „Wie schön der Mars doch ist“ flüsterte sie so vor sich hin, und in Gedanken flogen all die vielen Erlebnisse und die schönen und weniger schönen Stunden wie Eilzüge an ihr vorüber. Sie dachte an ihre Lieben und an die, die sie nicht so sehr mochte. Und sie dachte an das, was sie vielleicht noch erlebt hätte. „Schade“ raunte sie einsilbig dahin und war traurig, dass sie in Kürze auf eine ziemlich komische Art und Weise aus dem Leben gerissen werden würde. Plötzlich spürte sie etwas Warmes in ihrer Hand. Als sie herunterschaute, sah sie das kleine Mädchen. Es stand einfach neben ihr und hielt ihre Hand ganz fest. Doch es weinte nicht und es sprach auch kein einziges Wort, es stand nur einfach da und schaute zusammen mit den anderen zu dem riesigen Planeten dort oben am Himmelszelt. Schließlich sagte es doch noch etwas: „Siehst du, ich habe es dir ja gesagt“, und Milla musste sich die Tränen aus dem Gesicht wischen. Aber nicht wegen der drohenden Katastrophe, nein, wegen der Traurigkeit des kleinen Mädchens, dass sein ganzes Leben noch vor sich hatte und es doch nicht leben sollte! Und auf einmal waren all die vielen Sorgen und Nöte wie weggeblasen. Wie ein Wasserfall, der mit aller Kraft an spitzen mächtigen Felsen nach unten stürzt, machten sich eine unendliche Klarheit und eine nie gekannte Leichtigkeit in Milla breit. Wieso hatte sie so etwas nicht schon viel früher gespürt? Warum sich immer nur über Nichtigkeiten aufregen, über Dinge, die man am Ende doch nicht ändern konnte? Warum eigentlich an all den vielen Tagen, dem vermeintlichen Glück hinterherrennen, und es dann doch nicht ergreifen können? Was war denn eigentlich dieses Glück? Geld, Reichtum, Erfolg, vielleicht ein supertoller Sportwagen? Sie wusste, dass es all das nicht sein konnte. Und als sie den riesigen roten Planeten da vor sich erblickte, drückte sie die Hand des kleinen Mädchens ganz fest an sich und wusste auf einmal, was das Glück wirklich war – es war dieser eine Augenblick, dass Leben selbst, der Himmel, die Luft, die sie atmen konnte und der Frieden, in welchem sie sein durfte. Ja, und es war dieses kleine Mädchen, das nicht viel sprach, aber doch so viel sagte, wie sie es noch nie erlebte. Ja, das alles war das Glück und sie würde alles darum geben, wenn sie einfach nur zwangslos und ohne alle Konventionen weiterleben dürfte, ja, dass würde sie! Und wie sie das so dachte und sich im Klaren war, dass selbst dieser eine kurze Moment, als ihr diese weitreichende Erkenntnis kam, unglaubliches Glück bedeutete, wurde es schwarz um sie herum! Sie glaubte, den Boden unter ihren Füßen zu verlieren, und auch das kleine Mädchen schien nicht mehr da zu sein. Was war nur geschehen; war das die befürchtete Kollision, war das das erwartete Ende? Es dauerte einige Zeit, bis sie ihre Augen wieder öffnen konnte. Sehr hell war es um sie herum, gleißend hell sogar. War sie vielleicht im Paradies oder war das die Hölle? Es war nichts dergleichen! Sie lag auf ihrem Sofa und hatte wohl alles nur geträumt. Stöhnend erhob sie sich und fühlte sich auf einmal recht wach und ausgeschlafen. Draußen war es hell und die Sonne schien zwanglos vom azurblauen Himmel. Ein wenig nervös und mit einer leichten Spur von Ängstlichkeit schaute sie zum Himmel. Doch da war weder der riesige Planet Mars, noch irgendein anderes Unheil, dass sich sogleich über sie und die Welt wie ein Schwarm Asteroiden niederwalzen mochte. Nein, da hing nur die wärmende Sonne und der endlose blaue Himmel. Und plötzlich spürte sie eine unbändige Kraft in sich und den alles beherrschenden Wunsch, in die Welt hinaus zu gehen, zu den anderen Menschen zu gehen und ohne Unterlass zu singen und zu tanzen. Und eine innere Stimme sagte zu ihr: Warum tust du dann nicht! Noch einmal schaute sie sich im Zimmer um - auf dem Tisch lagen noch drei unbezahlte Rechnungen, doch das störte sie überhaupt nicht mehr. Sie würde schon einen Weg finden, und so lief sie aus der Wohnung, die Stufen hinab, hinaus auf die belebte Straße. Auf dem Bordstein saßen zwei junge Männer. Neben ihnen lag ein riesiges Kofferradio, welches sie auf Volltouren gestellt hatten; und plötzlich begann Milla zu der überlauten, verrückten Musik zu singen und zu tanzen. Tja, und es war wirklich total irre, aber die anderen Leute tanzten einfach mit. Es schien, als ob alle nur auf diesen einen Moment gewartet hätten. Die ganze Straße sang und tanzte – dabei kam es weder auf Können, noch auf Stimme oder einen sicheren Text an – es ging nur um die Fröhlichkeit und um das Leben! Einfach nur leben, das dachten sich wohl alle; und ganz sicher hatte jeder dieser vielen Menschen mit irgendeiner Kollision im Leben zu kämpfen. Da gab es nur noch eines, rausgehen und leben, einfach nur leben!
Als Milla so unbeschwert durch die Straßen tanzte, bemerkte sie plötzlich ein Mädchen, welches schweigend am Straßenrand stand und sich freute, dass alle Menschen so glücklich waren. Milla erkannte es sofort – es war das kleine Mädchen aus ihrem Traum. Aber, war es überhaupt ein Traum? Egal, frohen Mutes winkte sie dem Mädchen zu und das winkte zurück und verschwand plötzlich in der Menschenmenge. Milla sah es niemals wieder, doch sie hatte ja auch schon das wichtigste im Leben wiedergefunden, das Glück!
Vermisst
Lori lebte in Pheonix/Arizona. Sie war eine glückliche Ehefrau und ihr Ehemann, der Bauunternehmer Jim Campbell, war erfolgreich und konnte gut für die Familie sorgen. Eines Tages jedoch schien dieses Glück zu zerplatzen wie eine Seifenblase im Wind. Jim kam nach Hause und unterbreitete seiner Ehefrau, dass die Firma pleite sei und kein Geld mehr vorhanden war. Melli wurde zwar sehr traurig über diese schlimme Nachricht, doch sie schwor Jim, dass sie immer zu ihm stehen wollte. Die Familie musste aus ihrem Haus in der Washington Ave ausziehen und in eine heruntergekommene Siedlung ziehen. Doch obwohl sich die beiden ewige Treue gelobten, schien das traute Familienleben innerhalb der folgenden sechs Monate erheblich unter den bestehenden Schwierigkeiten zu leiden. Da Jim oft unterwegs war, um einen neuen Job zu suchen, was sich als mehr als schwierig herausstellte, weil er nicht mehr so jung war, hatte er sich daran gewöhnt, dass Melli manchmal nicht zu Hause wartete, wenn er wieder nach Hause kam. Auch an jenem Freitag war das wieder so. Nach einem anstrengenden Tag, der mal wieder gar nichts brachte, kehrte Jim nach Hause zurück. Und zunächst wunderte er sich auch nicht, dass Melli nicht daheim war. Sie hatte ihrem Ehemann einen Topf auf den Herd gestellt, in welchem sie das Mittagessen, eine leckere Linsensuppe, vorgekocht hatte. Jim deckte den Tisch und wartete eine kleine Weile. Als Melli jedoch nicht kam, begann er zu essen. Doch nach einer halben Stunde, als Melli noch immer nicht erschienen war, begann sich der Mittvierziger Sorgen um seine Frau zu machen. Er stellte den Teller beiseite, holte sich auch keinen Nachschlag, obwohl die Suppe an diesem Tag besonders gut schmeckte und schaute aus dem Fenster. Draußen hatte es zu regnen begonnen, doch Melli war nirgends zu sehen. Jim wurde immer nervöser, er spürte, dass irgendetwas nicht stimmte, er fühlte es genau, aber was sollte er tun, wo sollte er suchen? Melli hatte nicht einmal einen Zettel auf den Tisch gelegt, so wie immer, wenn sie mal etwas länger von Zuhause fort war. Weil er es einfach nicht mehr aushielt, zog er sich eine Jacke über, nahm den Schirm und verließ das Haus. Draußen auf der Straße schaute er sich um, sein Blick schweifte über den Vorgarten bis zu den Häusern auf der anderen Straßenseite, doch nirgends, nicht einmal in irgendeinem Garten der angrenzenden Häuser konnte er seine Melli entdecken. Ihm wurde übel, denn er fühlte, dass etwas Schlimmes geschehen sein musste. Er fühlte genau, dass es etwas Außergewöhnliches war, dass sich wie ein scharfes Schwert in sein Leben geschnitten hatte, doch er wollte es nicht wahrhaben. Noch immer glaubte er, dass sich Melli doch noch meldete, dass sie wieder zurückkehrte, egal, wo auch immer sie war. Immer hatten sich die beiden Eheleute geschworen, dass sie zusammenbleiben wollten und sich immer ehrlich sagen würden, wenn etwas nicht stimmte. Diesmal aber gab es nicht ein Wort, keine geschriebene Zeile, keine Hinweise und auch kein Zeichen, nichts. Ein wenig panisch schwang sich Jim in den Wagen und fuhr mit quietschenden Reifen los. Er raste durch die breiten Straßen der großen Stadt, ließ seinen Blick über die Straßenränder schweifen, blieb stehen, um sich wieder umzuschauen und fuhr wieder weiter. Irgendwann kam er bei „Bills Drive Inn“ vorbei, einer kleinen Kneipe, wo sie immer mal gemeinsam waren. Doch auch Bill wusste nicht, was mit Melli passiert sein konnte.
Weit war Jim hinausgefahren, bis dorthin, wo er als Kind oft war, wenn er nicht mehr weiterwusste. Die einsame Gegend brachte ihm schon in der Kindheit so manche brauchbare Idee, die ihm dann irgendwie weitergeholfen hatte. Er hielt den Wagen an und schaute auf sein Mobiltelefon. Niemand hatte angerufen, auch Melli nicht. Mutlos und geschwächt setzte er sich auf einen herumliegenden Stein und schaute auf die mannshohen stacheligen Kakteen am Straßenrand. Aus der Ferme hörte er Geräusche, die sich wie Kinderlachen anhörten. Als er sich umschaute, versuchte, in der Ferne irgendetwas zu erkennen, war da jedoch nichts. Er blieb bis es dämmerte und auch da wollte er einfach nicht mehr heim. Weil er keine Kinder mit Melli hatte, schien es ihm auch nicht mehr so wichtig, nach Hause zu fahren. Er wollte einfach weitersuchen, doch irgendwann musste er die Polizei einschalten, denn allein konnte er nichts mehr tun. Plötzlich machte sich dichter weißer Nebel breit. Er kam so schnell, dass es Jim nicht mehr schaffte, in seinen Wagen zu steigen um wegzufahren. Er wollte abwarten, bis sich die dichten Schwaden wieder verzogen, doch sie gingen nicht weg und wurden stattdessen immer stärker und immer dichter. Durch den weißen Nebel hörte sich das vermeintliche Kinderlachen noch unheimlicher an als eben noch. Jim stand regungslos in diesem undurchdringlichen Nebel und rührte sich nicht, da spürte er, wie ihn jemand ganz sacht an der Schulter berührte. Als er sich umdrehte, stand da Melli. Sie stand einfach nur da und rührte sich nicht. Ihr Blick war sorgenvoll und ihr rotgeschminkter Mund drückte Trauer und Bestürzung aus. Jim wollte etwas sagen, doch Melli hielt ihm den Zeigefinger auf den Mund, was so viel bedeuten sollte, dass er nicht sprechen möge. Vorsichtig aber auch entschlossen nahm sie seine Hand und zog ihn hinter sich her. Jim folgte widerstandslos und die beiden erhoben sich auf einmal in die Luft und flogen durch den dichten Nebel hindurch. Jim fragte schon lange nicht mehr, wie all das sein konnte, wie es möglich war, dass seine Frau so plötzlich bei ihm war, dass sie so unbehelligt sein konnte und das sie schließlich durch diesen Nebel flogen als seien sie Vögel. Er fand sich einfach damit ab und machte alles mit, so, als wenn es ganz normal sei, was da mit ihnen ablief. Die beiden flogen durch die undurchdringlich wirkenden Nebelschleier und schienen überhaupt kein Ziel mehr zu haben. Irgendwann blieben sie stehen und Melli sagte: „Wir sind da.“ Jim wunderte sich, konnte er doch nichts entdecken, außer Nebel. Aber plötzlich verfärbte sich der Nebel und gab den Blick auf eine eigenartige Konstruktion frei. Wie Federn schwebten sie im Universum, alles um sie herum war dunkel und die Planeten des Sonnensystems drehten sich langsam und mächtig um sie herum. Plötzlich aber wurden sie immer kleiner und verschwanden in einer Art flirrenden Edelstein. Der driftete riesig groß und wuchtig im samtschwarzen Raum vor ihnen und Jim verstand überhaupt nicht, was das alles zu bedeuten hatte. Er wollte Melli danach fragen, doch die kam ihm zuvor und flüsterte: „Das ist unser Universum, alles wird vergehen, schon in Kürze. Das Universum zieht sich zusammen und wir werden alle vergehen. Ich bin auserwählt, um es den Menschen zu berichten. Dann wird alles neu beginnen.“
Fassungslos starrte Jim auf den Edelstein und dann zu Melli. Er konnte nichts damit anfangen und schloss seine Augen, weil ihm alles zu viel wurde. Als er sie wieder öffnete befand er sich nicht mehr im Universum und es war auch nicht schwarz um ihn herum und auch nicht neblig. Friedlich lag er in seinem Bett und neben ihm lag tatsächlich seine Ehefrau Melli.
Wie konnte das nur möglich sein, wie war er so schnell in sein Bett gekommen, waren sie doch eben noch im Universum. Aber es war so wie es immer war, er musste das Ganze wohl einfach nur geträumt haben.
Als gegen Morgen die beiden Eheleute aufstanden und Melli das Frühstück zubereitete, hatte Jim seinen verrückten Traum erfolgreich beiseitegeschoben, wenngleich er ihm nicht ganz aus dem Kopf gehen wollte. Zu realistisch schienen die Erlebnisse und zu echt waren der Nebel und dieses Universum, durch den er mit Melli gefahren war. Dennoch schmeckte der starke Kaffee an diesem sonnigen Morgen ganz wunderbar und die beiden unterhielten sich angeregt über dies und das. Als Melli ihrem Mann noch etwas Kaffee nachschenkte, fiel dessen Blick auf ihre Hand. Was er dort erblickte, jagte ihm einen eiskalten Schauer über den Rücken. Denn an ihrem kleinen Finger glitzerte ein Ring mit einem großen Edelstein, den Jim bis dahin noch nie bemerkt hatte. Es glich aufs Haar jenem Edelstein, der in seinem vermeintlichen Traum im Universum schwebte, und plötzlich schaute Melli ganz seltsam zu ihm herüber. Es war ein Blick, der ihm durch Mark und Bein ging und wieder hörte er dieses seltsame Kinderlachen, während Melli flüsterte: „Schon bald wird es geschehen. Das Universum wird vergehen.“
City of Stupidity
Irgendwo, ganz tief im Osten oder Westen einer sonst recht aufgeräumt erscheinenden Welt lag eine Stadt, die man weder gerne sah noch gern dort leben mochte. Als Paul mit seiner Frau Christin aus der großen Welt wegen des Jobs dorthin zog, waren die Verhältnisse gar nicht mehr schön. Eine einzige Partei regierte dies Provinznest und die Bewohner trauten sich nicht dagegen vorzugehen. Es war die Partei der Heimlichkeit und der Totalität! Und es war die Partei der Ignoranz und der grenzenlosen Dämlichkeit! Als die noch anständigen Leute sich dann doch auflehnten, trauten sie ihren eigenen Augen und Ohren nicht mehr. Denn nicht etwa sie selbst, die diese Revolte angezettelt hatten, waren die Nutznießer dieses respektablen Aufstandes. Nein, die Macht wurde von dummen, geldgierigen und oberflächlichen Lebewesen übernommen, die nichts anderes im Schilde führten, als mit ihrer Dummheit die übrigen Bewohner dieser Stadt zu malträtieren. Alles verkam, verdreckte und vergammelte und es regierte der besoffene und zugekiffte Mob, der nur Angst, Zwietracht und Aggressivität schürte! Paul, der all das miterleben musste, konnte es nicht fassen. Sollten allen Ernstes nun die Dummheit und der Pöbel regieren? Sollte all das, was er und die anderen intelligenten, gebildeten Menschen aufgebaut hatten, unter dem Schweiße ihres Angesichts und mit ihren eigenen Händen errichtet hatten, für alle Zeit verloren sein? Alles nur wegen solch dummen Wesen? Er konnte es nicht begreifen, wollte es nicht wahrhaben und zog sich wie all die anderen umgänglichen Leute in sein Schneckenhaus zurück. Nächtelang sannen er und seine kleine Familie nach einer Lösung und tagelang ertrug er die Dummheit, welche fortan diese arme Stadt regierte. Er sah die feisten fettbeschmierten aufgedunsenen und leeren Gesichter dieser üblen Brut, und er hörte, wie primitiv und gewöhnlich sie miteinander zu kommunizieren pflegten, wenn sie sich nicht gerade niederschlugen! Er sah, wie die Intelligenten und Gebildeten ganz langsam an unerklärlichen Nervenkrankheiten dahinsiechten und er erlebte, wie jene Leute, welche noch gesund waren, die Stadt und die gesamte Region der Dummheit für immer verließen. Er wusste es und er spürte es mit jeder Faser seines Körpers, dass er handeln musste, so schnell es nur ging! Und so verabredete er sich mit Conny, der ebenfalls zu den wissenden Leuten gehörte und den Niedergang dieser Stadt nicht mehr ertragen konnte. Die beiden verabredeten sich heimlich und trafen sich im Keller von Pauls kleinem Häuschen, denn die Dummen hatten ihre intriganten falschen Augen beinahe überall und liefen in ihrer Dämlichkeit sofort zum Bürgermeister oder der Polizei, wenn sie eine ihnen sonderbar erscheinende menschliche Ansammlung beobachteten. Die beiden Männer unterhielten sich lange und kamen doch zu keinem einzigen Ergebnis. Längst war Mitternacht vorüber und Pauls Ehefrau Christin wollte schon schimpfen, da meinte Conny, dass sie vielleicht ebenfalls diese heruntergekommene Stadt verlassen sollten. Warum sollten sie diese Dummheit, diese Aggressivität auf den stinkenden Straßen und den Verfall der Moral und der Sitten, den allgemeinen Niedergang dieser einstmals so glorreichen Stadt, wo man mal wunderschöne Autos gebaut hatte, bis sie dann vollkommen verfiel, noch länger ertragen? Warum sich selbst zerstören, wenn es anderswo viel schöner und viel besser, viel anständiger und viel lebendiger zuging? Christin konnte Connys Vorschlag nur zustimmen und so beschlossen sie traurigen Herzens, die Stadt schon in der nächsten Nacht heimlich zu verlassen. Die Reisetaschen waren schnell gepackt und die Sachen flink übergeworfen. Doch als sie in der dunklen diesigen Nacht schließlich ihre Autos bestiegen und ihre kleinen Häuser, ihren doch so geliebten Lebensmittelpunkt so traurig hinter sich in der Dunkelheit liegen sahen, wurde es ihnen ganz schwer ums Herze. Sollten sie das wirklich tun? Einfach alles, sogar das Mobiliar, einfach so zurücklassen? Sollten sie wirklich all ihr Eigentum diesen Dümmlingen, die diese Stadt so bösartig heruntergerichtet hatten, überlassen? Nein, das wollten sie nicht! Und als sie wieder ausstiegen, fielen sie sich weinend in die Arme. Dennoch war das Problem nicht beseitigt - die Stadt musste dringend verändert werden. Und plötzlich wussten sie, was zu tun war!
Wovor hatte die Dummheit Angst? Richtig, vor Intelligenz und Wissen, sie bekam Panik vor Schönheit und Leben, vor Hoffnung und Glauben, vor Selbstbewusstsein und Courage! Und genau das mussten sie den Leuten wieder beibringen – Klugheit und Wissen, Selbstbewusstsein und Courage! Natürlich würde es schwer werden, gegen die alles bestimmende und regierende Dummheit, die sich schon im Rathaus und in den Stadtverwaltungen breitgemacht hatte, vorzugehen. Dennoch mussten sie es wenigstens versuchen. Denn kampflos wollten sie ihre geliebte Stadt, ihre einst lieb gewonnene Heimat keinesfalls hergeben! Sie wollten kämpfen und das Gute wieder in ihre Stadt zurückbringen!
Schon am darauf folgenden Tag begannen sie, ihr mutiges Vorhaben in die Tat umzusetzen. Sie zogen sich ordentlich an und traten entschlossen und hoch erhobenen Hauptes hinaus auf die Straße. Dort schlichen die Dummen mit dunkler Einheitskleidung und gesenktem Kopf an ihnen vorüber und taten mit versteinerter eisig kalter Miene so, als bemerkten sie nichts. Doch Paul und seine Freunde liefen mit aufrechtem Gang, lächelnd und mit selbstbewusstem Schritt die Straßen entlang. Und es war ganz seltsam, hinter den Gardinen der meisten Häuser bewegten sich plötzlich menschliche Silhouetten. Und auf einmal öffneten sich die sonst stets verschlossenen Türen der Häuser, die bislang trübe und trist, einsam und kalt in der Düsternis lagen und Dutzende von aufrecht laufenden, lachenden und singenden Menschen strömten ans Tageslicht. Es waren all jene, welche sich über die Zeit total zurückgezogen und abgeschottet hatten. Es waren all jene, die klug und intelligent, sympathisch und charismatisch waren. Es war die anständige Bevölkerung der Stadt, die von den Dummen bis eben noch unterjocht wurde. Sie alle besannen sich angesichts des entschlossenen Auftretens von Paul und seinen Freunden ganz plötzlich auf ihre Stärken und schlugen sich bis zum Rathaus durch. Und es war kaum zu glauben – es waren schließlich so unglaublich viele Menschen, dass die Dummen nicht wagten, sie anzugreifen. Die Intelligenten waren einfach in der Überzahl und es wurden von Minute zu Minute mehr. Schließlich versuchte der poltrige herumbrüllende Bürgermeister der Dummen den eingeschüchterten Mob gegen die selbstbewusste Stadtbevölkerung aufzuwiegeln. Doch die waren nicht nur dumm, sondern auch mächtig feige. Und so trauten sie sich nicht an die Revoltierenden heran. Sie gaben schließlich auf und wollten sich in ihrer Feigheit den Demonstranten anschließen. Die ließen sich jedoch nicht beirren und jagten den vermeintlichen Bürgermeister mit Hieben und mit Schimpf und Schande aus der Stadt! Da verzogen sich die dunklen Wolken über den Häusern, der Gestank in den Straßen wich einer neuen wohlduftenden optimistischen Brise und die Stadt erstrahlte hell im freiheitlichen warmen Sonnenlicht einer bes