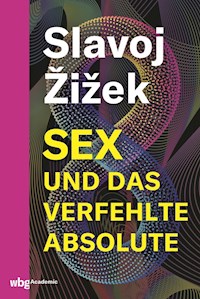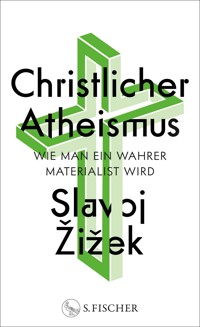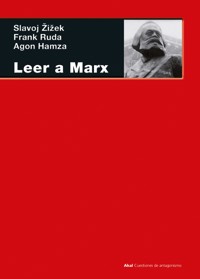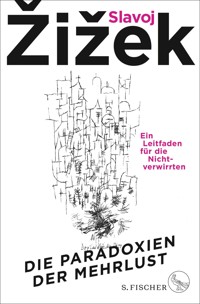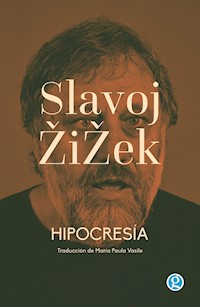15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der Kapitalismus, so Slavoj Žižek, gleiche einer Comicfigur, die stolz über den Dachfirst hinaus ins Leere läuft – um dann jäh abzustürzen. In seinem neuen, kämpferischen Buch setzt sich Žižek mit den Perspektiven der Linken auseinander: Er entlarvt die Widersprüche des Neoliberalismus, diskutiert die Positionen von Alain Badiou und Antonio Negri und erklärt, warum wir angesichts von Wirtschaftskrise, Biotechnologie und Umweltkollaps der Diktatur des Proletariats eine neue Chance geben sollten. Dabei erweist er sich wieder einmal als das externe Hirn seiner Leser: Er sieht die Filme, registriert die Nachrichten und macht sich darüber die Gedanken, für die wir keine Zeit haben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 473
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Der Kapitalismus, so Slavoj Žižek, gleiche einer Comicfigur, die stolz über den Dachfirst hinaus ins Leere läuft – um dann jäh abzustürzen. In seinem neuen, kämpferischen Buch setzt sich Žižek mit den Perspektiven der Linken auseinander: Er entlarvt die Widersprüche des Neoliberalismus, diskutiert die Positionen von Alain Badiou und Antonio Negri und erklärt, warum wir angesichts von Wirtschaftskrise, Biotechnologie und Umweltkollaps der Diktatur des Proletariats eine neue Chance geben sollten. Dabei erweist er sich wieder einmal als das externe Hirn seiner Leser: Er sieht die Filme, registriert die Nachrichten und macht sich darüber die Gedanken, für die wir keine Zeit haben.
Slavoj Žižek ist Professor für Philosophie an der Universität Ljubljana in Slowenien. Im Suhrkamp Verlag erschienen zuletzt: Parallaxe (2006), Die politische Suspension des Ethischen (es 2414) und Die Revolution steht bevor. Dreizehn Versuche über Lenin (es 2298).
Slavoj Žižek
Auf verlorenem Posten
Aus dem Englischen von Frank Born
Suhrkamp
Eine englische Fassung des vorliegenden Bandes ist 2008 bei Verso (London/New York) unter dem Titel In Defence of Lost Causes erschienen.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2009
Originalausgabe
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlag gestaltet nach einem Konzept von Willy Fleckhaus: Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-73425-4
www.suhrkamp.de
Inhalt
Vorrede: Das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce
Einleitung: Causa locuta, Roma finita
I. Diagnose: Die atonale Welt des globalen Kapitalismus
Die liberale Utopie
Die verstörenden Klänge des »Türkischen Marsches«
Die Politik der Reinkarnation
Das chinesische Tal der Tränen
Der utopische Mechanismus
Multikulturalismus: Die Realität einer Illusion
Die Basis der Freiheit
Subjektivität im postideologischen Zeitalter
Atonalität
Polen als Symptom
Spaß am Foltern?
Die namenlose jouissance und ihre Launen
II. Die Krise der bestimmten Negation
Macht und Widerstand
Die Politik des Widerstands
»Goodbye Mister Widerstands-Nomade«
Negri in Davos
Expression, Repräsentation, Macht
Governance und Bewegungen
Die Gewalt der Subtraktion
Materialismus, demokratischer und dialektischer
Reaktionen auf das Ereignis
Brauchen wir eine neue Welt?
Die Lehren der Kulturrevolution
Welche Subtraktion?
III. Was zu tun ist
Jenseits von Fukuyama
Das Beispiel Haiti
Gebt der Diktatur des Proletariats eine Chance!
3 + 1
Von der Furcht zum Zittern
Das Unbehagen in der Natur
Ökologie ohne Natur
Der Gebrauch und Mißbrauch Heideggers
Wege zum Akt
Als Alain Badiou einmal bei einem meiner Vorträge im Publikum saß, fing plötzlich sein Handy an zu klingeln (und was noch schlimmer war: Es war mein Handy – ich hatte es ihm geliehen). Anstatt es auszuschalten, unterbrach er mich sachte und bat mich, doch bitte ein wenig leiser zu sprechen, damit er seinen Gesprächspartner am Telefon besser verstehen könnte ... Wenn das, was Alain tat, kein Akt wahrer Freundschaft war, dann weiß ich nicht, was Freundschaft ist. Daher ist dieses Buch Alain Badiou gewidmet.
Vorrede: Das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce
Marx eröffnet seinen Achtzehnten Brumaire mit einer Korrektur der Hegelschen Idee, nach der sich Geschichte notwendig wiederhole: Hegel habe vergessen hinzuzufügen, daß sie sich zunächst als Tragödie und dann als Farce ereigne. Gilt das nicht auch für die zwei Ereignisse, die den Anfang und das Ende der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts kennzeichnen, die Terroranschläge des 11. September und die Finanzkrise von 2008?
Die Ähnlichkeiten der Sprache, in der Präsident George W. Bush nach dem 11. September und nach der Finanzkrise seine Ansprachen an das amerikanische Volk hielt, sind nicht zu übersehen: Sie klingen wie zwei Versionen derselben Rede. Beide Male beschwor er die Bedrohung des American way of life und die Notwendigkeit schnellen und entschiedenen Eingreifens, um der Gefahr Herr zu werden. Beide Male forderte er die teilweise Aufhebung US-amerikanischer Werte, um genau diese Werte zu schützen. Woher aber rührt diese Ähnlichkeit?
Am 11. September wurden die Twin Towers getroffen; zwölf Jahre früher, am 9. November 1989, fiel die Berliner Mauer. Der 9. November kündigte die »fröhlichen Neunziger« an, die trügerische Realisierung der Utopie, die Francis Fukuyama mit seiner Formulierung vom »Ende der Geschichte« entworfen hatte: Die liberale Demokratie habe im Prinzip gewonnen, die Suche sei vorüber, die Ankunft einer globalen liberalen Weltgemeinschaft stehe vor der Tür, auf dem Weg zu diesem überzeichneten Hollywood-Happy-End gebe es nur noch letzte empirische und letztlich kontingente Hindernisse (nämlich einige lokale Widerstandsnester, deren Anführer nur noch nicht begriffen hätten, daß ihre Zeit vorüber sei). Der 11. September dagegen markiert das Ende der fröhlichen Neunziger, der Clinton-Jahre, er kündigt eine Ära an, in der überall neue Mauern auftauchen – zwischen Israel und dem Westjordanland, um die Europäische Union herum, an der Grenze zwischen den USA und Mexiko.
Es hat jedoch den Eindruck, als müsse Fukuyamas Vision zweimal sterben: Der Zusammenbruch der liberal-demokratischen politischen Utopie am 11. September stellte die ökonomische des globalen Marktkapitalismus nicht infrage. Doch wenn die Finanzkrise von 2008 einen historischen Sinn hat, dann jenen, daß sie nun auch das Ende der ökonomischen Aspekte von Fukuyamas Entwurf einläutet.
1.
Das führt uns zu Marx’ Paraphrase von Hegel zurück: Man sollte sich in Erinnerung rufen, daß Herbert Marcuse in seiner Einleitung zu einer Ausgabe des Achtzehnten Brumaire in den sechziger Jahren noch einen Schritt weiter ging: Manchmal könne die Wiederholung im Gewand der Farce furchterregender sein als die ursprüngliche Tragödie. Durch ihren furchterregend komischen Charakter machte es die Finanzkrise unmöglich, die offenkundige Irrationalität des globalen Kapitalismus zu ignorieren – wie Alain Badiou es prägnant ausgedrückt hat:
»Von gewöhnlichen Bürgern wird bedingungslos verlangt zu ›verstehen‹, daß es vollkommen unmöglich sei, das finanzielle Loch in der Sozialversicherung zu stopfen, daß man aber, ohne nachzuzählen, Milliarden in das Bankenloch stopfen müsse. Wir sollen allen Ernstes zustimmen, daß es anscheinend für niemanden mehr in Betracht kommt, eine Fabrik, und zwar eine mit Tausenden von Arbeitern, zu verstaatlichen, die sich aufgrund der Marktkonkurrenz in wirtschaftliche Schwierigkeiten manövriert hat, daß das gleiche aber völlig auf der Hand liege bei einer Bank, die sich durch Spekulation ruiniert hat.«1
Man sollte diese Aussage verallgemeinern: Wenn es um die Bekämpfung von AIDS, Hunger, Wassermangel, globaler Erwärmung usw. geht, gibt es, obwohl wir die Dringlichkeit dieser Probleme erkennen, immer genug Zeit, um zu überlegen und um Entscheidungen zu vertagen (man erinnere sich, daß viele Beobachter sich darin einig waren, daß es das wichtigste und absolut begrüßenswerte Ergebnis des letzten Klimagipfels auf Bali gewesen sei, sich in zwei Jahren erneut treffen zu wollen, um dann die Gespräche fortzuführen ...) – aber bei der Finanzkrise mußte unbedingt sofort gehandelt werden, man trieb sofort eine Summe auf, die jenseits aller Vorstellungskraft liegt. Die Rettung bedrohter Tierarten, die Rettung des Planeten vor der globalen Erwärmung, die Rettung von AIDS-Patienten oder von Kranken, die aufgrund des Mangels an Geld für teure Behandlungen oder Operationen sterben, die Rettung verhungernder Kinder – das alles kann ein bißchen warten, aber der Ruf »Rettet die Banken!« ist ein bedingungsloser Imperativ, der nach sofortigem Eingreifen schreit, und das auch noch erfolgreich. In diesem Fall war die Panik absolut, eine transnationale und überparteiliche Position wurde sofort gefunden und jeglicher Groll zwischen den Weltmächten war augenblicklich vergessen, als es darum ging, DIE Katastrophe abzuwenden. (Und diese vielgelobte Überparteilichkeit bedeutet im übrigen letzten Endes nichts anderes, als daß sogar die demokratischen Verfahren de facto außer Kraft gesetzt wurden: Es war keine Zeit für normale parlamentarische Prozeduren; diejenigen, die den Plan im amerikanischen Kongreß zunächst ablehnten, wurden bald gezwungen, mit der Mehrheit zu marschieren.) Und vergessen wir außerdem nicht, daß diese unvorstellbare Geldsumme nicht für eine »reale« Maßnahme ausgegeben wurde, sondern allein, um das Vertrauen in die Märkte wieder herzustellen – es ging also um eine Sache des Glaubens! Bedarf es eines weiteren Beweises dafür, daß das Kapital das Reale unseres Lebens ist, ein Reales, dessen Forderungen viel absoluter sind als selbst die dringlichsten Forderungen unserer sozialen und natürlichen Realität?
Vergleichen wir die 700 Milliarden, die allein die USA mobilisiert haben, um das Bankensystem zu stabilisieren, mit der Tatsache, daß die reichen Nationen von den 22 Milliarden Dollar, die sie zugesichert haben, um die Landwirtschaft der ärmeren Nationen in diesem Jahr der Nahrungsmittelkrise zu unterstützen, nur 2,2 Milliarden bereitgestellt haben. Und dieses Mal kann man die Schuld für die Krise nicht auf die üblichen Verdächtigen (Korruption, Ineffizienz oder interventionistische Regierungen in der Dritten Welt) schieben – sie hängt im Gegenteil direkt mit der Globalisierung der Landwirtschaft zusammen. Darauf hat kein Geringerer (so berichtete es die Associated Press am 23. Oktober 2008) hingewiesen als Bill Clinton in einer Rede, die er am Welternährungstag vor einer UN-Versammlung zur Nahrungskrise hielt. Die Rede hatte den bezeichnenden Titel »›We blew it.‹ On global food«, und ihre Quintessenz war, daß die derzeitige globale Nahrungsmittelkrise zeige, daß »wir – ich eingeschlossen, als ich noch Präsident war – es vergeigt haben«, indem wir zugelassen hätten, so Clinton, daß Nahrungsmittel als Waren behandelt werden und nicht als etwas, worauf die Armen dieser Welt ein prinzipielles Recht haben. Er gab die Schuld ausdrücklich nicht einzelnen Staaten oder Regierungen, sondern der langfristigen globalen Politik des Westens, die von den USA und der Europäischen Union diktiert und über Jahrzehnte von der Weltbank, dem Internationalen Währungsfond und anderen internationalen Institutionen umgesetzt wurde; diese Politik zwang afrikanische und asiatische Regierungen, Kredite nicht für Düngemittel, verbessertes Saatgut und andere landwirtschaftliche Investitionen zu vergeben. Das führte zum massenhaften Anbau von Gütern für den Export auf den ertragreichsten Böden, mit der Folge, daß diese Länder nicht länger in der Lage waren, sich selbst mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Das Ergebnis dieser »strukturellen Anpassung« war die Integration lokaler Landwirtschaften in die globale Ökonomie: Während die Ernte exportiert wurde, mußten die Bauern ihr Land aufgeben und in Ghettos abwandern, wo sie nun als billige Arbeitskräfte für ausgelagerte sweat shops zur Verfügung stehen. Gleichzeitig sind diese Länder nun auf Lebensmittelimporte angewiesen. Auf diese Weise werden sie in postkolonialer Abhängigkeit gehalten, sie sind viel stärker als früher den Schwankungen auf den globalen Märkten ausgesetzt – der sprunghafte Anstieg der Getreidepreise (bei dem auch die Tatsache eine Rolle spielte, daß immer mehr Getreide als Biokraftstoff Verwendung findet) hat von Haiti bis Äthiopien Hungersnöte ausgelöst. Clinton sagte zu Recht, daß »Nahrungsmittel keine Ware wie andere sind« und wir deshalb »zu einer Politik zurückkehren müssen, welche die möglichst weitgehende Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln in den Mittelpunkt stellt. Es ist Wahnsinn, zu glauben, wir könnten die Entwicklung von Ländern auf der ganzen Welt fördern, ohne sie in die Lage zu versetzen, sich selbst zu ernähren.« An dieser Stelle muß man wenigstens zwei Dinge ergänzen: Erstens, daß die entwickelten Länder des Westens sehr wohl ihre eigene Autarkie verteidigen, indem sie ihren Bauern Subventionen zahlen usw. (man bedenke, daß die Agrarsubventionen mehr als die Hälfte des Budgets der EU ausmachen) – der Westen selbst hat die Politik der »möglichst weitgehenden Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln« also nie aufgegeben. Zweitens sollte man sich klarmachen, daß die Liste der Dinge, die keine »Waren wie andere« sind, noch wesentlich länger ist: Es geht nicht nur um Lebensmittel, sondern auch um Verteidigung (das wissen die »Patrioten« nur zu genau), Wasser, Energie, die Umwelt insgesamt, Kultur und Erziehung, das Gesundheitssystem ... Wer soll hier über Prioritäten entscheiden, nach welchen Regeln soll überhaupt entschieden werden, wenn wir sie nicht länger dem freien Markt überantworten können? An dieser Stelle müssen wir noch einmal den Kommunismus ins Spiel bringen.
2.
Noch dringlicher wird diese Frage angesichts der Situation in den Ländern der Dritten Welt. Es gibt eine alte Anekdote über eine Gruppe von Ethnologen, die auf der Suche nach einem mysteriösen Stamm, der Gerüchten zufolge einen gruseligen Totentanz mit Masken aus Schlamm und Holz praktizierte, in das Herz der Finsternis Neuseelands vordrangen. Eines Tages erreichten sie endlich spät am Abend den Stamm. Sie erklärten den Eingeborenen mit Händen und Füßen, was sie suchten, und legten sich schlafen; am nächsten Morgen führten die Stammesmitglieder einen Tanz auf, der all ihren Erwartungen entsprach, und so konnten die Ethnologen zufrieden in die Zivilisation zurückkehren und einen Bericht über ihre Entdeckung schreiben. Unglücklicherweise besuchte aber einige Jahre später eine andere Expedition den gleichen Stamm, versuchte ernsthafter, mit den Menschen zu kommunizieren, und erfuhr die Wahrheit über die erste Expedition: Die Stammesmitglieder hatten irgendwie verstanden, daß die Fremden einen furchterregenden Totentanz sehen wollten. Also bastelten sie, geleitet von ihrem hohen Sinn für Gastfreundschaft und der Hoffnung, ihre Gäste nicht zu enttäuschen, die ganze Nacht hindurch an den Masken und studierten einen erfundenen Tanz ein, um die Ethnologen zufriedenzustellen – die Europäer, die einen Blick auf ein seltsames exotisches Ritual zu erhaschen meinten, bekamen tatsächlich eine hastig improvisierte Aufführung ihres eigenen Wunsches präsentiert ...
Passiert heute im Kongo nicht etwas ganz Ähnliches, in einem Land, das sich wieder zum afrikanischen Herz der Finsternis entwickelt? Die Titelgeschichte des Nachrichtenmagazins Time vom 5. Juni 2006 trug die Überschrift »The deadliest war in the world«, es handelte sich um eine detaillierte Dokumentation darüber, wie im Kongo innerhalb der letzten zehn Jahre ungefähr vier Millionen Menschen im Zusammenhang mit politischer Gewalt gestorben sind.
Es folgte nicht der übliche humanitäre Aufschrei, sondern nur ein paar Leserbriefe – als ob eine Art Filtermechanismus verhinderte, daß diese Nachricht ihre volle Schockwirkung entfalten konnte. Time setzte, um es zynisch zu formulieren, auf das falsche Opfer im Kampf um die mediale Vorherrschaft in Sachen Leid – man hätte bei der Liste der üblichen Verdächtigen bleiben sollen: der Notlage muslimischer Frauen, der Unterdrückung in Tibet ... Kongo hat sich heute gewissermaßen wieder in das Conradsche »Herz der Finsternis« verwandelt: Niemand wagt es, das Thema frontal anzugehen. Der Tod eines Palästinenserkinds aus dem Westjordanland, ganz zu schweigen von einem Israeli oder einem Amerikaner, ist medial tausendmal mehr wert als der Tod eines namenlosen Kongolesen. Warum diese Ignoranz?
Am 30. Oktober 2008 berichtete Associated Press, Laurent Nkunda, der Rebellengeneral, der die Hauptstadt einer östlichen Provinz, Goma, belagert, habe gesagt, er wolle direkte Gespräche mit der Regierung führen über seine Einwände gegen einen Milliardendeal, der China im Austausch gegen den Bau einer Bahnstrecke und einer Autobahn Zugang zu den gewaltigen Bodenschätzen sichern würde. So problematisch (weil neokolonial) dieser Deal auch sein mag, er stellt eine entscheidende Bedrohung der Interessen lokaler Kriegsherren dar, weil sein Erfolg die infrastrukturellen Grundlagen für die Demokratische Republik Kongo als einen funktionsfähigen, geeinten Staat schaffen würde.
Zuvor hatte im Jahr 2001 eine UN-Untersuchung zur illegalen Ausbeutung natürlicher Ressourcen im Kongo gezeigt, daß es bei dem Konflikt im Land hauptsächlich um den Zugang zu, die Kontrolle über und den Handel mit den fünf wichtigsten Bodenschätzen geht: Coltan, Kobalt, Kupfer, Gold und Diamanten. Laut dieser Studie beuten lokale Kriegsherren die Ressourcen des Landes »systematisch und systemisch« aus, insbesondere die Warlords aus Uganda und Ruanda (knapp gefolgt von jenen aus Simbabwe und Angola) hätten ihre Soldaten in eine Busineßarmee verwandelt: Ruandas Armee habe innerhalb von 18 Monaten mindestens 250 Millionen Dollar mit dem Verkauf von Coltan verdient, das für die Produktion von Handys und Laptops benötigt wird. Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, daß der andauernde Bürgerkrieg und die Desintegration des Kongo »eine ›Win-Win‹-Situation für alle Kriegsteilnehmer geschaffen hat. Der einzige Verlierer dieses riesigen geschäftlichen Unterfangens ist das kongolesische Volk.«
Hinter der Fassade ethnischer Konflikte entdecken wir also die Konturen des globalen Kapitalismus. Seit dem Sturz Mobutus gibt es in diesem Land kein funktionierendes Staatswesen mehr; gerade der Osten des Kongos besteht aus einer Vielzahl von Territorien, die von Warlords beherrscht werden, die einen Flecken Land mit einer Armee kontrollieren, in der regelmäßig drogenabhängige Kinder kämpfen; jeder dieser Kriegsherren unterhält Geschäftsverbindungen zu einem ausländischen Unternehmen, das (in der Hauptsache) die Bodenschätze der Region ausbeutet. Von diesem Arrangement profitieren beide Seiten: Das Unternehmen erhält die Abbaurechte, ohne Steuern bezahlen zu müssen, der Warlord bekommt Geld ... Die Ironie liegt darin, daß die meisten dieser Bodenschätze, wie etwa das Coltan, in High-Tech-Produkten Verwendung finden – kurz: Vergeßt die angeblich wilden Bräuche der Bevölkerung vor Ort! Wenn man die ausländischen High-Tech-Firmen einmal aus der Gleichung streicht, fällt das ganze Kartenhaus der ethnischen Konflikte, die vorgeblich von alten Leidenschaften angetrieben werden, in sich zusammen.
Eine besondere Ironie der Geschichte besteht darin, daß zu den größten Ausbeutern ruandische Tutsi zählen, die 1994 selbst Opfer eines entsetzlichen Genozids wurden. Im August 2008 legte die ruandische Regierung zahlreiche Dokumente vor, die eine Mitschuld Präsident Mitterrands (und seiner Regierung) am Genozid an den Tutsi belegen sollten: Frankreich habe den Plan der Hutu zur Machtergreifung unterstützt; man habe auch die Bewaffnung der Hutu-Einheiten hingenommen, um den Einfluß Frankreichs in der Region auf Kosten der anglophonen Tutsi zu stärken.2 Wenn es gelänge, Mitterrand postum vor das Tribunal in Den Haag zu bringen, um diese Vorwürfe zu klären, wäre das eine wahre Großtat. Doch das Äußerste, zu dem sich die vom Westen dominierten internationalen juristischen Organisationen bislang in einem solchen Fall durchringen konnten, war die Festnahme Augusto Pinochets im Oktober 1998 – der ehemalige chilenische Diktator galt freilich schon vorher als politischer Schurke. Würde man einen Staatsmann wie Mitterrand (wenngleich postum) oder die französische Regierung anklagen, wäre eine wichtige Grenze überschritten: Zum erstenmal müßten sich führende westliche Politiker vor Gericht verantworten, die sich zuvor als Beschützer von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten gaben. Von einem solchen Prozeß könnte man vieles lernen über die Komplizenschaft liberaler Mächte des Westens mit jenen Kräften, die von den Medien als Auslöser von Explosionen »authentischer« Barbarei in der Dritten Welt dargestellt werden. Im dichten kongolesischen Dschungel herrscht vermutlich wirklich tiefe Dunkelheit – doch ihr Herz schlägt anderswo: in den hell erleuchteten Chefetagen unserer High-Tech-Unternehmen.
3.
Das Mißverhältnis zwischen der gigantischen Fluktuation auf dem Finanzmarkt und dem beschränkten Volumen der »realen Wirtschaft« nimmt ein noch groteskeres Ausmaß an, wenn wir es mit kleinen Staaten zu tun haben, deren Reichtum von ihrer Integration in die globalen Finanzmärkte abhängt. Exemplarisch ist hier der Fall Islands, dem Land, das am härtesten von der Krise getroffen wurde.3 Noch im April 2007 präsentierte die isländische Regierung das Land wie folgt: »Lange Zeit lebte diese Nation unter harten Bedingungen, aber nachdem sie einmal Freiheit und Unabhängigkeit erlangt hatte, schaffte sie in weniger als einem Jahrhundert den Sprung von einem Entwicklungsland zu einem der reichsten Länder der Welt.« Im Oktober 2008, nur eineinhalb Jahre später, mußte sich Island auf Grund seiner der Dritten Welt vergleichbaren Inflationsrate die gemeine Bezeichnung »nordeuropäisches Simbabwe« gefallen lassen: Seine drei größten Banken kollabierten innerhalb einer Woche und ließen dabei Verbindlichkeiten zurück, die sich auf das Dreifache des Bruttoinlandsprodukts beliefen. Als die Regierung, nachdem sie die Banken verstaatlicht hatte, erklärte, Island werde diese Schulden nicht begleichen, wendete die englische Regierung (viele britische Bürger hatten ihr Geld bei isländischen Banken angelegt) ein Anti-Terror-Gesetz an, um das Vermögen dieser Banken in Großbritannien einzufrieren. Der Schock, den diese Maßnahme in Island auslöste, brachte Rassismus in seiner reinsten Form zum Vorschein: »Ja, aber ... Seht ihr denn nicht, daß wir Weiße sind?!«
Und so fühlt sich die Krise im Land selbst an: 30 000 Euro schuldet der durchschnittliche Isländer Kreditinstitutionen – die Leute leihen sich nicht nur Geld, um ihre Wohnungen zu bezahlen, sondern auch um die Universität zu besuchen, ein Auto zu kaufen, zu reisen. »Junge Menschen, die hohe Kredite aufgenommen haben, um ihre überteuerten Wohnungen auf einem überhitzten Markt zu bezahlen, sind nun an diese Wohnungen gefesselt, die sie jedoch auf dem kollabierten Immobilienmarkt nicht verkaufen können, während – und puh, stellen Sie sich das einmal vor – die Kredite an einen Verbraucherindex gekoppelt sind, so daß in Zeiten der Inflation die Schulden proportional zu den Preisen steigen. Die Hypotheken der Leute sind in den letzten Monaten gewachsen: Sie schulden der Bank buchstäblich desto mehr Geld, je mehr sie zahlen.« Alle latenten Spannungen innerhalb der isländischen Gesellschaft sind also explodiert: »Negativität und finanzielle Probleme« galten bislang »als Tabus, als etwas, worüber man nicht spricht«, gleichzeitig boomte der »spiritistische New-Age-Eskapismus« und die Isländer halten den »Weltrekord im Verbrauchen von Antidepressiva«. »[S]o laufen die Dinge normalerweise in Island, wo Monopoly-Geld lange Zeit die grundlegende Tatsache verdeckte, daß das ganze Land 14 Familien gehört, die darüber entscheiden, wie die Dinge laufen sollen.«
In der gegenwärtigen ideologischen Konstellation wird die Krise zweifellos nach den Regeln genutzt werden, die Naomi Klein in Die Schock-Strategie beschrieben hat: Starr vor Schreck werden die Isländer empfänglich für die Botschaft sein, es gelte in diesem Augenblick der Krise alle noch nicht verstummten Einwände von Umweltschützern, Feministen und Sozialisten zu ignorieren, die einzige Rettung bestünde vielmehr darin, alle öffentlichen Leistungen, die noch übrig sind, zu privatisieren: das Erziehungs- und das Gesundheitssystem, die Wasser- und die Energieversorgung etc. Und das wird nicht nur in Island passieren, sondern auf der ganzen Welt – die ersten Anzeichen für solche Manöver sind schon da.
4.
Marx schrieb, die bourgeoise Ideologe liebe es, zu historisieren: Jede soziale, religiöse oder kulturelle Form sei historisch, kontingent, relativ – jede mit Ausnahme der eigenen. Es habe eine Geschichte gegeben, doch diese sei jetzt vorbei. Im Modell des kapitalistischen Liberalismus sei sie an ihrem Ziel angelangt, die »natürliche« Gestalt sei gefunden. Heute gilt genau dasselbe für den liberal-demokratischen Kapitalismus: Er ist, wie Fukuyama es ausdrückt, das Ende der Geschichte. Und vernehmen wir nicht das Echo dieser Position im zeitgenössischen »diskursiven«, »anti-essentialistischen« Historismus (von Ernesto Laclau bis zu Judith Butler), der jede sozial-ideologische Einheit als das Produkt eines kontingenten diskursiven Kampfes um Hegemonie ansieht? Wie bereits Fredric Jameson bemerkte, hat der universalisierte Historismus einen eigenartigen ahistorischen Beigeschmack: Wenn wir einmal die radikale Kontingenz unserer Identität vollkommen akzeptieren und praktizieren, lösen sich irgendwie alle authentischen historischen Spannungen in die endlosen performativen Spiele einer ewigen Gegenwart auf. Hier ist eine schöne selbstbezügliche Ironie am Werk: Geschichte gibt es nur insofern, als noch Reste eines ahistorischen Essentialismus fortbestehen. Deshalb müssen radikale Anti-Essentialisten ihre ganze hermeneutisch-dekonstruktive Kunst aufwenden, um versteckte Spuren von »Essentialismus« in der scheinbar postmodernen »Risikogesellschaft« der Kontingenzen aufzuspüren. Just in dem Moment, in dem sie zuzugeben bereit wären, daß wir schon in einer »anti-essentialistischen« Gesellschaft leben, müßten sie sich nämlich der wahrhaft schwierigen Frage nach dem historischen Charakter des herrschenden radikalen Historismus stellen und klären, ob dieser nicht doch nur die ideologische Gestalt des »postmodernen« globalen Kapitalismus ist.
Dieses alte Paradox der liberalen Ideologie ist in den zeitgenössischen Apologien des Endes der Geschichte mit neuer Wucht hervorgetreten. Kein Wunder, daß die Debatte über die Grenzen der liberalen Ideologie gerade in Frankreich so heftig ausfällt: Der Grund dafür ist nicht die lange französische Tradition des Etatismus, der dem Liberalismus mißtraut; der Grund ist vielmehr, daß die französische Distanz zum Mainstream des angelsächsischen Liberalismus eine externe Position bereitstellt, die nicht nur eine kritische Haltung ermöglicht, sondern überdies, die grundlegende ideologische Struktur des Liberalismus deutlicher wahrzunehmen. Es ist also wenig erstaunlich, daß man sich mit dem neoliberalen französischen Publizisten Guy Sorman befassen muß, wenn man wissen will, wie die klinisch reine, gleichsam im Labor destillierte Version der zeitgenössischen kapitalistischen Ideologie aussieht. Schon der Titel eines Interviews, das er kürzlich in Argentinien gegeben hat (»Diese Krise wird ziemlich schnell vorüber sein«) signalisiert, daß Sorman die wesentliche Anforderung erfüllt, der die Ideologie im Zusammenhang mit der Finanzkrise genügen muß. Es gilt, die Situation so rasch als möglich als normal erscheinen zu lassen: Im Moment sähe die Lage vielleicht tatsächlich übel aus, doch die Krise werde bald vorüber sein, sie sei lediglich ein Teil des Schumpeterschen Kreislaufs der kreativen Zerstörung, durch die sich der Kapitalismus nun einmal entwickle: Solche Krisen »sind unvermeidbar. Das ökonomische System basiert auf Innovation. Ohne Innovation gibt es keinen Fortschritt. Ohne Innovation und Fortschritt gibt es keine Krisen. [...] Tatsächlich gehen alle Krisen des Kapitalismus auf gescheiterte Innovationen zurück oder auf solche, die schlecht gemanagt wurden.« Der Kapitalismus habe unsere »Lebensbedingungen komplett verändert«, er habe »die Menschheit aus dem Elend geführt«, dennoch sei er bei den Menschen nicht beliebt, niemand gehe »auf die Straße, um für den Kapitalismus zu demonstrieren«. Es gehe darum, »dieses Paradox effizient zu verwalten« etc.4 (Zeitgleich zu dieser Normalisierung erleben wir das exakte Gegenteil: eine Panik, die von der Obrigkeit noch geschürt wird, um einen Schock in der breiteren Öffentlichkeit auszulösen. »Die Grundlagen unserer Lebensweise stehen auf dem Spiel!« heißt es dann, und solche Appelle sollen die Menschen darauf vorbereiten, die vorgeschlagenen, offensichtlich ungerechten Lösungen hinzunehmen.) Sorman geht dabei von der Annahme aus, daß sich die Ökonomie in den letzten Jahren, genauer seit dem Zusammenbruch des Sozialismus, in eine »harte« Wissenschaft verwandelt habe. Quasi unter Laborbedingungen sei erprobt worden, welches System das bessere sei: »Die besten Beispiele sind das geteilte Korea und das geteilte Deutschland. Man nahm ein Land, teilte es in zwei Hälften, setzte im Norden bzw. im Osten auf den Kommunismus und im Süden bzw. Westen auf den Kapitalismus; man wartete vierzig Jahre ab und verglich dann die Ergebnisse.« Und diese seien natürlich eindeutig.
Aber ist die Ökonomie wirklich eine Wissenschaft? Beweist die gegenwärtige Krise nicht vielmehr – und das sagen sogar manche Experten –, daß niemand wirklich weiß, was zu tun ist? Der Grund hierfür ist, daß Erwartungen Teil des Spieles sind: Wie der Markt reagieren wird, hängt nicht nur davon ab, wie groß das Vertrauen der Menschen in bestimmte Interventionen ist, sondern vor allem davon, als wie stark sie das Vertrauen der anderen in diese Interventionen einschätzen. Man kann also nicht vorhersehen, welche Folgen die eigenen Handlungen haben werden. Sorman gibt durchaus zu, die Krise zeige, »daß die Selbstregulierung der Märkte nicht perfekt funktioniert«, daß »die ökonomischen Akteure nicht vollständig rational handeln und Gefühle in der Wirtschaft eine wichtige Rolle spielen«. Die Lösung dürfe dennoch nicht beim Staat gesucht werden. Zwar mehrten sich in der Krise die Stimmen, die staatliche Eingriffe fordern, doch die Staaten handelten »auch nicht rationaler als die ökonomischen Akteure«. Historisch hätten sie viel mehr Opfer zu verantworten als der Kapitalismus. »Die Politik ist also viel weniger rational als der Markt.« Die wichtigste Lehre der Krise bestehe also nicht darin, mehr staatliche Regulierung zu fordern, der Staat solle lediglich die Transparenz der Informationen garantieren. Außerdem gelte es in turbulenten Zeiten, den Kapitalismus, der zwar effizient, aber nicht immer beliebt sei, gegen seine Kritiker zu verteidigen. Selten wurde die Funktion der Ideologie in klareren Worten veranschaulicht: Die Überlegenheit des Kapitalismus wird aus der Natur des Menschen, seiner Emotionalität und seiner mangelnden Rationalität, selbst erklärt.
5.
Es ist demnach keineswegs ausgemacht, daß sich die Finanzkrise des Jahres 2008 langfristig als verkappter Segen erweisen wird oder als das Erwachen aus einem bösen Traum. Alles hängt davon ab, wie sie symbolisiert wird, welche ideologische Interpretation oder Erzählung sich durchsetzt und die allgemeine Wahrnehmung der Krise bestimmt. Wenn der normale Lauf der Dinge auf traumatische Weise gestört wird, öffnet sich das Feld für einen »diskursiven« ideologischen Wettstreit. So hat z. B. Hitler sich durchgesetzt, als es darum ging, den Deutschen in den zwanziger und frühen dreißiger Jahren die Krise der Weimarer Republik zu erklären und ihnen einen Ausweg zu weisen (er setzte dabei auf den »jüdischen Plot«); im Frankreich der vierziger Jahre war es dann Marschall Pétain, der die französische Niederlage am überzeugendsten erklärte. Die wichtigste Aufgabe der herrschenden Ideologie besteht folglich angesichts der aktuellen Krise darin, eine Erzählung zu etablieren, welche die Schuld für den Zusammenbruch nicht dem globalen kapitalistischen System als solchem zuschreibt, sondern lediglich sekundären, zufälligen Abweichungen vom ursprünglichen Plan: der zu lockeren rechtlichen Regulierung, der Korruption in den großen finanziellen Institutionen usw. Man sollte gegen diesen Trend auf der Schlüsselfrage beharren: Welcher »Fehler« im System als solchem macht eine solche Krise, einen solchen Zusammenbruch möglich? Man muß dabei vor allem im Hinterkopf behalten, daß die Maßnahmen, die uns in diese Situation gebracht haben, zunächst gut gemeint waren: Nach dem Platzen der Dotcom-Blase in den Jahren 2000/2001 war man sich bald parteiübergreifend einig, es gelte nun, Investitionen in Immobilien zu fördern, um die Wirtschaft am Laufen zu halten und eine Rezession in den USA zu verhindern – dafür zahlen wir heute den Preis.
Die Gefahr besteht also darin, daß sich am Ende eine Erzählung durchsetzt, die uns nicht aufweckt, sondern die es uns ermöglicht, weiterzuträumen. Und wir sollten anfangen, uns nicht nur wegen der wirtschaftlichen Konsequenzen der Krise Sorgen zu machen, sondern auch, weil sie offensichtlich eine Versuchung darstellt, den »Krieg gegen den Terror« und den US-amerikanischen Interventionismus wiederzubeleben, um die Wirtschaft in Schwung zu halten.
Die Lösung? Immanuel Kant setzte dem konservativen Motto »Räsonniert nicht, gehorcht!« bekanntlich nicht den Satz »Gehorcht nicht, räsonniert!« entgegen, sondern die Losung »Räsonniert so viel ihr wollt und worüber ihr wollt, aber gehorcht«. Wenn wir mit Dingen wie den diversen Rettungs- und »Bailout«-Plänen erpreßt werden, dann sollten wir uns zwar klarmachen, daß wir erpreßt werden, wir sollten aber auch der populistischen Versuchung widerstehen, unsere Wut auszuleben und uns damit am Ende selbst zu schaden. Anstatt unseren Ärger auf solch impotente Weise auszuagieren, sollten wir ihn lieber zügeln und in eine kalte Entschlossenheit verwandeln: Wir sollten entschlossen und auf wirklich radikalen Wegen anfangen darüber nachzudenken, in welcher Gesellschaft wir leben, wenn solche Formen der Erpressung möglich sind.
(November 2008)
Aus dem Englischen von Martin Stempfhuber
Einleitung: Causa locuta, Roma finita
Roma locuta, causa finita – so funktioniert das hierarchische Machtuniversum: Das Einschreiten der höchsten Autorität – von »die Kirchensynode hat entschieden« bis »das Zentralkomitee hat beschlossen« und »die Menschen haben bei der Wahl ihren Willen deutlich gemacht« – setzt dem Streit ein Ende. Die Wette der Psychoanalyse lautet genau umgekehrt: Die Causa selbst soll sprechen, und Rom (das Imperium, das heißt der globale Kapitalismus) wird untergehen. Ablata causa tolluntur effectus heißt, »daß es Wirkungen nur wohlergeht in Abwesenheit der Ursache«.1 Was, wenn wir diesen Satz einfach umdrehen? Wenn die Ursache einschreitet, werden die Wirkungen vertrieben ...
Aber welche (Ur-)Sache soll überhaupt sprechen? Für die »große Sache« sieht es heute, in der Ära der »Postmoderne«, schlecht aus, denn auch, wenn sich die ideologische Szene in viele verschiedene Positionen aufgeteilt hat, die um die Vormachtstellung ringen, besteht doch in einem Punkt weitgehend Einigkeit: Die Zeit der großen Erklärungen ist vorbei, gegen all die Fundierungstheorien ist ein »schwaches Denken« erforderlich, welches der rhizomatischen Textur der Realität gerecht wird; auch in der Politik sollten wir nicht mehr nach alles erklärenden Systemen und globalen emanzipatorischen Projekten streben, vielmehr sollte die gewaltsame Durchsetzung großer Lösungen spezifischen Formen des Widerstands und der Intervention Platz machen ... Sollten Sie auch nur die geringste Sympathie für diese Position empfinden, können Sie aufhören zu lesen und das vorliegende Büchlein wegwerfen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!