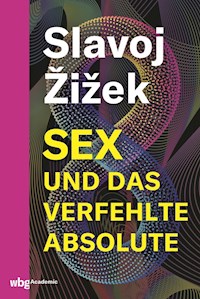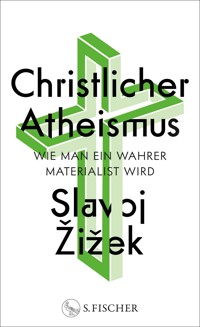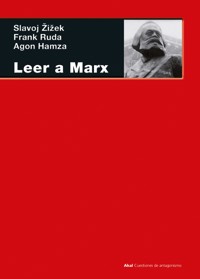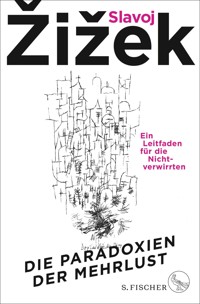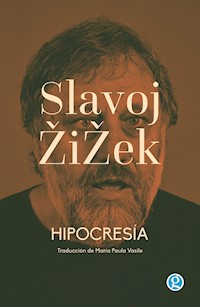17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Heute, in einer Zeit, in der die Analysen des Historischen Materialismus meist »undercover« und fast nie unter ihrem richtigen Namen betrieben werden und in der die theologische Dimension in Gestalt des postsäkularen Denkens eine neue Wendung genommen hat, ist es an der Zeit, die erste von Benjamins Thesen über den Begriff der Geschichte umzukehren: »Gewinnen soll immer die Puppe, die man ›Theologie‹ nennt. Sie kann es ohne weiteres mit jedem aufnehmen, wenn sie den Historischen Materialismus in ihren Dienst nimmt, der bekanntlich heute klein und häßlich ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen.« Die Puppe und der Zwerg erkundet die konkreten Formen dieser merkwürdigen Koexistenz. Zu Beginn steht eine Analyse des fundamentalen Bruchs zwischen dem abendländischen kosmisch-holistischen Weltbild und dem jüdisch-christlichen. Weiter geht das Buch der Spannung zwischen dem perversen Funktionieren des »realexistierenden Christentums« und dem subversiven Kern der christlichen Erfahrung nach. Schließlich versucht es, diesen subversiven Kern in der gegenwärtigen Ideologie der Hegemonie zu verorten, deren Koordinaten durch die nietzscheanische Unterscheidung zwischen aktivem und passivem Nihilismus vorgegeben sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 327
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Slavoj Žižek
Die Puppe und der Zwerg
Das Christentum zwischen Perversion und Subversion
Aus dem Englischen von Nikolaus G. Schneider
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023
Der vorliegende Text folgt der 5. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuch wissenschaft, 1681.
© 2003, Suhrkamp Verlag AG, Berlin
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlag nach Entwürfen von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt
eISBN 978-3-518-77833-3
www.suhrkamp.de
Inhalt
Einleitung: Die Puppe namens Theologie
1 Ost und West begegnen sich
2 Das »aufregende Abenteuer der Orthodoxie«
3 Das Reale des Christentums
4 Vom Gesetz zur Liebe ... und zurück
5 Subtraktion, jüdische und christliche
Anhang: Ideologie heute
Einleitung: Die Puppe namens Theologie
Heute, da sich die historisch-materialistische Analyse auf dem Rückzug befindet, sozusagen nur noch im verborgenen praktiziert und selten bei ihrem richtigen Namen genannt wird, während die theologische Dimension in Gestalt der »postsäkularen« messianischen Wende der Dekonstruktion neuen Schwung erhält, ist es an der Zeit, Walter Benjamins erste geschichtsphilosophische These umzukehren: »Gewinnen soll immer die Puppe, die man ›Theologie‹ nennt. Sie kann es ohne weiteres mit jedem aufnehmen, wenn sie den historischen Materialismus in ihren Dienst nimmt, der heute bekanntlich klein und häßlich ist und sich ohnehin nicht darf blicken lassen.«
Eine der möglichen Definitionen der Moderne lautet: Jene gesellschaftliche Ordnung, in der die Religion nicht mehr in eine bestimmte kulturelle Lebensform integriert ist und mit dieser identifiziert wird, sondern autonom geworden ist, so daß sie als dieselbe Religion in verschiedenen Kulturen überleben kann. Diese Extraktion ermöglicht es der Religion, global zu werden, und ist die Ursache dafür, daß es heute überall Christen, Moslems und Buddhisten gibt. Doch dafür muß die Religion den Preis entrichten, daß sie infolge der säkularen Funktionsweise der gesellschaftlichen Totalität auf ein Randphänomen reduziert wird. In dieser neuen globalen Ordnung hat die Religion zwei mögliche Rollen zur Auswahl, eine therapeutische oder eine kritische. Entweder hilft sie den Menschen dabei, im Rahmen der existierenden Ordnung besser zu funktionieren, oder sie versucht, sich als kritische Institution zu etablieren, die das, was mit der Ordnung an sich nicht stimmt, zur Sprache bringt und einen Raum für abweichende, kritische Stimmen bietet. Im zweiten Fall tendiert die Religion als solche dazu, die Rolle der Häresie zu spielen.
In unserer Epoche der politischen Korrektheit empfiehlt es sich immer, mit all den ungeschriebenen Verboten zu beginnen, die festlegen, welche Positionen man einnehmen darf. Zunächst gilt es, im Hinblick auf religiöse Fragen festzustellen, daß der Verweis auf »tiefe Spiritualität« wieder ausgesprochen »in« ist. Der Materialismus hingegen ist »out«. Statt dessen wird dringend empfohlen, sich die Offenheit für eine radikale Andersheit jenseits des onto-theologischen Gottes zu bewahren. Wenn man heute einen Intellektuellen mit der Frage »Also gut, lassen wir das ganze Getue und kommen gleich zum Wesentlichen: Glauben Sie an irgendeine Form des Göttlichen oder nicht?« konfrontiert, ist die erste Reaktion ein peinlich berührtes Zurückweichen, so als sei diese Frage zu intim, zu persönlich. In der Regel wird dieses Zurückweichen dann »theoretisch« begründet: »Das ist die falsche Frage! Es geht nicht darum, ob man glaubt oder nicht, sondern es geht um eine bestimmte radikale Erfahrung, um die Fähigkeit, sich für eine bestimmte, unerhörte Dimension zu öffnen, um die Art und Weise, wie es uns unsere Offenheit gegenüber der radikalen Andersheit ermöglicht, einen bestimmten ethischen Standpunkt zu beziehen und eine überwältigende Form des Genießens zu erleben ...« Wir haben es heute mit einer Art »suspendiertem« Glauben zu tun, einem Glauben, der sich nur dann entfalten kann, wenn er (in der Öffentlichkeit) nicht vollständig eingestanden wird, sondern ein privates obszönes Geheimnis bleibt. Im Widerspruch zu dieser Haltung sollte man jedoch mehr denn je zuvor darauf beharren, daß die »vulgäre« Frage »Glauben Sie wirklich oder nicht?« von entscheidender Bedeutung ist und zwar möglicherweise mehr denn je zuvor. Ich behaupte damit nicht nur, daß ich durch und durch Materialist bin und daß man zum subversiven Kern des Christentums auch mittels eines materialistischen Ansatzes Zugang hat, sondern meine These ist wesentlich weitreichender. Ich behaupte, daß man nur mittels eines materialistischen Ansatzes Zugang zu diesem Kern hat und vice versa: Um ein wahrer dialektischer Materialist zu werden, muß man die christliche Erfahrung durchlaufen.
Aber gab es eigentlich überhaupt je eine Zeit, in der die Menschen »wirklich glaubten«? Wie Robert Pfaller in Die Illusionen der Anderen1 gezeigt hat, ist der direkte Glaube an eine Wahrheit, von der man subjektiv völlig überzeugt ist (»Hier stehe ich!«), ein modernes Phänomen, das einen Gegensatz zu traditionellen, auf einer gewissen Distanzierung beruhenden Verhaltensweisen wie Höflichkeit oder bestimmten Ritualen bildet. Vormoderne Gesellschaften glaubten nicht unmittelbar, sondern vermittels einer gewissen Distanznahme, und eben dies ist auch die Fehldeutung »primitiver« Mythen, etwa durch die Kritiker aus der Zeit der Aufklärung. Zunächst behaupten die Aufklärungsphilosophen, der Ursprung eines Stammes gehe auf den unmittelbaren direkten Glauben an einen Fisch oder Vogel zurück, und dann weisen sie diesen Glauben als töricht, »fetischistisch« und naiv zurück. Auf diese Weise stülpen sie dem von ihnen zum Primitiven erklärten Anderen ihren eigenen Glaubensbegriff über. (Und ist dies nicht auch das Paradox von Wartons The Age of Innocence? Newtons Frau glaubte nicht auf naive [»unschuldige«] Weise an die Treue ihres Mannes, sondern sie wußte von seiner leidenschaftlichen Liebe zur Gräfin Olenska, ignorierte diese jedoch höflicherweise und tat so, als glaube sie an seine Treue ...) Pfaller hat recht, wenn er betont, daß wir heute mehr denn je zuvor glauben. Die skeptischste Haltung, die der Dekonstruktion, beruht auf der Figur eines Anderen, der »wirklich glaubt«; das postmoderne Bedürfnis, ständig irgendwelche ironischen Distanzierungssignale wie Anführungszeichen usw. einzusetzen, verrät die Furcht, daß der Glaube ohne diese Signale direkt und unmittelbar wäre, so als ob es sich um einen unmittelbar angenommenen Glauben handelt, wenn ich »Ich liebe dich« sage, statt des ironisch verbrämten »Wie der Dichter sagen würde: ›Ich liebe dich‹«, das heißt so, als ob die Distanzierung nicht bereits in der Aussage »Ich liebe dich« vorhanden wäre.
Und vielleicht steht ja genau dies bei der heutigen Bezugnahme auf die »Kultur« als zentraler lebensweltlicher Kategorie auf dem Spiel. Im Hinblick auf die Religion »glauben wir also nicht mehr wirklich«, sondern befolgen einfach einige der religiösen Rituale und Sitten aus Rücksicht auf den »Lebensstil« der Gemeinschaft, der wir angehören (nichtgläubige Juden befolgen die Regel, nur koschere Speisen zu sich zu nehmen, »aus Achtung vor der Tradition« usw.). Die Aussage »Ich glaube nicht wirklich daran, aber es ist ein Teil meiner Kultur« scheint die vorherrschende Form des für unsere Zeit charakteristischen geleugneten/verschobenen Glaubens zu veranschaulichen. Denn was anderes ist denn ein kulturell bestimmter Lebensstil, wenn nicht die Tatsache, daß jedes Jahr im Dezember in jedem Haus und sogar an öffentlichen Plätzen ein Weihnachtsbaum steht, obwohl niemand von uns an den Weihnachtsmann glaubt? Vielleicht ist also der »nichtfundamentalistische« Begriff der »Kultur« im Unterschied zur »wirklichen« Religion, Kunst usw. im Grunde der Name für das Feld der nicht anerkannten/unpersönlichen Glaubensüberzeugungen – »Kultur« ist der Name für all jene Dinge, die wir tun, ohne wirklich an sie zu glauben, ohne sie »ernstzunehmen«. Und ist die Wissenschaft nicht genau deshalb kein Teil dieses Kulturbegriffs, weil sie zu real ist? Und verurteilen wir nicht auch deshalb fundamentalistische Gläubige als »Barbaren«, als Feinde und als Bedrohung der Kultur, weil sie es wagen, ihre Glaubensüberzeugungen zu ernst zu nehmen? Man erinnere sich an die allgemeine Entrüstung, als die Taliban vor zwei Jahren die alten Buddhastatuen in Bamiyan zerstörten. Obwohl keiner von uns aufgeklärten Westlern an die göttliche Natur Buddhas glaubt, waren wir so empört, weil die Taliban-Moslems dem »kulturellen Erbe« ihres eigenen Landes und der gesamten Menschheit nicht den nötigen Respekt entgegenbrachten. Statt vermittels des anderen zu glauben wie alle kultivierten Menschen, glaubten die Taliban tatsächlich an ihre eigene Religion und besaßen daher kein ausgeprägtes Gespür für den kulturellen Wert von Monumenten anderer Religionen. Für sie waren die Buddhastatuen einfach nur falsche Götzenbilder und keine »kulturellen Schätze«.
Innerhalb dieses Rahmens des suspendierten Glaubens gibt es drei sogenannte »postsäkulare« Optionen: Entweder man preist den Reichtum an polytheistischen vormodernen Religionen, der durch das jüdisch-christliche patriarchalische Erbe unterdrückt wurde, oder man hält, im Gegensatz zum Christentum, an der Einzigartigkeit des jüdischen Erbes, an seiner Treue zu der Begegnung mit der radikalen Andersheit fest. Um aber jeglichem Mißverständnis vorzubeugen: Ich bin nicht der Ansicht, daß der gegenwärtige vage Spiritualismus, die Konzentration auf die Offenheit für die Andersartigkeit und ihre unbedingte Anrufung, jene Form, in der das Judentum zur nahezu hegemonialen ethisch-spirituellen Grundhaltung der heutigen Intellektuellen wird, die »natürliche« Form dessen ist, was sich traditionell ausgedrückt als die jüdische Spiritualität bezeichnen läßt. Vielmehr bin ich fast versucht zu sagen, daß wir es hier mit etwas zu tun haben, das der gnostischen Häresie des Christentums entspricht, und daß das eigentliche Opfer dieses »Pyrrhussieges« die kostbarsten Elemente der jüdischen Spiritualität und ihrer Konzentration auf eine einzigartige kollektive Erfahrung sein werden. Wer erinnert sich heute noch an den Kibbutz, den deutlichsten Beweis dafür, daß Juden nicht »von Natur aus« finanzielle Zwischenhändler sind?
Die einzigen christlichen Versionen, die neben diesen beiden Optionen erlaubt sind, sind die gnostischen oder mystischen Traditionen, die ausgeschlossen und verdrängt werden mußten, damit sich die hegemoniale Gestalt des Christentums durchsetzen konnte. Christus selbst ist akzeptabel, wenn wir versuchen, den »ursprünglichen« Christus herauszulösen, den »Rabbi Jesus«, der der eigentlichen christlichen Tradition noch nicht eingeschrieben ist. Agnes Heller spricht in diesem Zusammenhang ironischerweise von der »Wiederauferstehung des jüdischen Christus«2; unsere Aufgabe heute besteht darin, den wahren Jesus aus der mystifizierenden christlichen Tradition des Jesus (als) Christus wieder zum Leben zu erwecken. Dies alles macht einen positiven Umgang mit dem heiligen Paulus zu einer heiklen Angelegenheit, denn ist nicht gerade er der Inbegriff der Etablierung der christlichen Orthodoxie? Gleichwohl hat sich im letzten Jahrzehnt eine kleine Lücke aufgetan, eine Art Tausch, der zwischen den Zeilen möglich geworden ist: Man darf Paulus loben, solange man ihn wieder in das jüdische Erbe einschreibt, Paulus als radikaler Jude, als Autor der jüdischen politischen Theologie.
Aber auch wenn ich mit diesem Ansatz übereinstimme, möchte ich doch betonen, daß er wesentlich gravierendere Konsequenzen nach sich zieht, als es zunächst den Anschein haben mag. Bei der Lektüre der Paulusbriefe kommt man nicht umhin festzustellen, daß Paulus gegenüber Jesus als lebendigem Menschen, das heißt gegenüber dem Jesus, der noch nicht Christus ist, dem vorösterlichen Jesus, dem Jesus des Evangeliums, schrecklich gleichgültig ist. Paulus ignoriert die besonderen Handlungen, Lehren und Gleichnisse Jesu, all das, was Hegel später als das mythische Element der märchenartigen Erzählung, die reine Vorstellung bezeichnete, so gut wie vollständig. Nirgendwo in seinen Schriften betätigt er sich hermeneutisch und versucht den »tieferen Sinn« eines Gleichnisses oder einer Tat Jesu zu ergründen. Für ihn zählt nicht Jesus als historische Gestalt, sondern ausschließlich die Tatsache, daß Jesus den Kreuzestod starb und von den Toten auferstanden ist. Nachdem er sich des Todes und der Auferstehung Jesu vergewissert hat, macht sich Paulus an sein wahrhaft leninistisches Werk und organisiert eine neue Partei, die er die christliche Gemeinschaft nennt ... Paulus als Leninist: War Paulus nicht wie Lenin der große »Institutionalisierer« und wurde als solcher von den Anhängern des marxistischen »Ur«-Christentums geschmäht? Und entspricht die paulinische Zeitlichkeit des »schon, aber noch nicht jetzt« nicht Lenins Situation zwischen den beiden Revolutionen vom Februar und Oktober 1917? Die Revolution liegt bereits hinter uns, die alte Regierung ist abgeschafft, die Freiheit ist da, aber die wirklich harte Arbeit steht uns noch bevor.
Bereits 1956 schlug Lacan eine kurze und bündige Definition des Heiligen Geistes vor: »Der Heilige Geist ist der Eintritt des Signifikanten in die Welt. Genau das ist es, was Freud uns unter dem Titel des Todestriebs gebracht hat.«3 In dieser Phase seines Denkens meint Lacan damit, daß der Heilige Geist für die symbolische Ordnung als dasjenige steht, was den gesamten Bereich des »Lebens«, die gelebte Erfahrung, den libidinösen Fluß, die Fülle der Emotionen, oder, in Kantischer Terminologie, das »Pathologische« auslöscht (oder vielmehr suspendiert). Wenn wir uns selbst innerhalb des Heiligen Geistes verorten, werden wir transsubstanziiert, gelangen wir in ein anderes Leben jenseits des biologischen. Und geht dieser paulinische Begriff des Lebens nicht auf ein anderes charakteristisches Merkmal von Paulus zurück? Nur die Tatsache, daß er nicht zum »inner circle« Christi gehörte, ermöglichte es ihm, das Christentum von einer jüdischen Sekte zu einer universellen Religion, zu einer Religion der Universalität, zu erheben. So kann man sich beispielsweise vorstellen, wie ein Jünger während einer gemeinsamen Mahlzeit sagt: »Erinnert ihr euch, wie Jesus mich während des letzten Abendmahls bat, ihm das Salz zu reichen?« Dergleichen ist bei Paulus nicht möglich. Er steht außerhalb und ersetzt als solcher symbolisch (die Stelle von) Judas unter den Aposteln. Auch Paulus »verriet« Christus gewissermaßen, indem er sich nicht um dessen Idiosynkrasien kümmerte, sondern ihn rücksichtslos auf das Grundsätzliche reduzierte und keine Geduld aufbrachte für seine Weisheiten, Wunder und ähnliche »Randerscheinungen« ...
Daher gilt: Ja, man sollte Paulus aus der jüdischen Tradition heraus lesen, da genau solch eine Lektüre die wahre Radikalität seines Bruches deutlich macht, die Art, wie er die jüdische Tradition von innen heraus unterwanderte. Um einen bekannten Kierkegaardschen Gegensatz zu verwenden: Den heiligen Paulus aus dem Inneren der jüdischen Tradition heraus zu lesen, als denjenigen, der in dieser Tradition beheimatet ist, ermöglicht uns das Verständnis des »im Werden begriffenen Christentums«: noch nicht des etablierten, eindeutigen Dogmas, sondern der gewaltsamen Geste seiner Postulierung, des »verschwindenden Vermittlers« zwischen Judentum und Christentum, von etwas, das Benjamins rechtssetzender Gewalt nahekommt. Mit anderen Worten, das, was innerhalb des etablierten christlichen Doxa »verdrängt« wird, sind weniger seine jüdischen Wurzeln, das, was es dem Judentum verdankt, sondern vielmehr der Bruch selbst, die tatsächliche Lokalisierung des Bruchs des Christentums mit dem Judentum. Paulus ging nicht einfach von der jüdischen Position zu einer anderen über, sondern er machte etwas innerhalb der jüdischen Position und mit dieser selbst. Aber worum genau handelte es sich dabei?
1Siehe Robert Pfaller, Die Illusionen der Anderen, Frankfurt am Main 2002.
2Agnes Heller, Die Auferstehung des jüdischen Christus, Berlin 2002.
3Jacques Lacan, Le seminaire, livre IV: La relation d'objet, Paris 1994, S. 48.
1 Ost und West begegnen sich
Ein angemessener Ausgangspunkt wäre die folgende Schellingsche Frage gewesen: Was bedeutet die Menschwerdung Gottes in Gestalt Christi, sein Herabsteigen aus der Ewigkeit in das zeitliche Reich unserer Wirklichkeit, für Gott selbst? Was, wenn das, was uns sterblichen Menschen als Herabsteigen Gottes zu uns erscheint, vom Standpunkt Gottes aus ein Aufstieg wäre? Was, wenn die Ewigkeit, wie von Schelling impliziert, weniger wäre als die Zeitlichkeit? Was, wenn die Ewigkeit ein steriler, ohnmächtig-impotenter, lebloser Bereich reiner Potentialitäten ist, der eine zeitliche Existenz durchlaufen muß, um sich zu aktualisieren? Was, wenn Gottes Herabsteigen zu den Menschen, weit davon entfernt, ein Akt der Gnade gegenüber den Menschen zu sein, für Gott die einzige Möglichkeit wäre, volle Aktualität zu erlangen und sich von den beklemmenden Zwängen der Ewigkeit zu befreien? Was, wenn sich Gott nur dadurch aktualisierte, daß er von den Menschen anerkannt wird?1
Es gilt, sich des alten platonischen Topos der Liebe als Eros, der sich allmählich von der Liebe zu einem bestimmten Individuum über die Liebe zur Schönheit eines menschlichen Körpers im allgemeinen und der Liebe der schönen Form als solcher zur Liebe zum höchsten Guten jenseits aller Formen erhebt, zu entledigen. Wahre Liebe ist genau das Gegenteil, nämlich der Verzicht auf die Verheißung der Ewigkeit zugunsten eines unvollkommenen Individuums. Die Verlokkung der Ewigkeit kann vielfältige Gestalt annehmen, vom postumen Ruhm bis zur Erfüllung der eigenen gesellschaftlichen Aufgabe. Was aber, wenn die Geste, eine zeitliche Existenz zu wählen und das ewige Leben aus Liebe aufzugeben, der höchste ethische Akt wäre, also weg von Christus und hin zu Siegmund im 2. Akt von Wagners Die Walküre, in dem Siegmund es vorzieht, ein gewöhnlicher Sterblicher zu bleiben, wenn seine geliebte Sieglinde ihm nicht nach Walhalla folgen kann, der ewigen Bleibe der toten Helden? Die niedergeschlagene Brunhilde kommentiert diesen Verzicht folgendermaßen: »So wenig achtest du ewige Wonne? Alles wär dir das arme Weib, das müd und harmvoll matt von dem Schoße dir hängt? Nichts sonst hieltest: du hehr?« Ernst Bloch hatte ganz recht mit seiner Bemerkung, daß es der deutschen Geschichte genau an solchen Gesten wie derjenigen Siegmunds mangelt.
Es wird gerne behauptet, Zeit sei das eigentliche Gefängnis (»Niemand kann aus seiner Zeit heraus«), und alle Philosophie und Religion kreisten nur um ein einziges Thema, nämlich den Ausbruch aus diesem Gefängnis in die Ewigkeit. Was aber, wenn, wie Schelling suggeriert, die Ewigkeit das eigentliche Gefängnis ist, eine beklemmende Schließung, und nur der Sturz in die Zeit der menschlichen Erfahrung eine Öffnung bietet? Ist Zeit nicht der eigentliche Name für die ontologische Öffnung? Beim Ereignis der »Inkarnation« handelt es sich daher nicht so sehr um die Zeit, in der die gewöhnliche zeitliche Wirklichkeit mit der Ewigkeit in Berührung kommt, sondern vielmehr um die Zeit, wenn die Ewigkeit in die Zeit hineinreicht. Dieser Punkt wurde von intelligenten Konservativen wie G. K. Chesterton, der wie Hitchcock ein englischer Katholik war, ganz deutlich gesehen, als er im Hinblick auf »die angebliche spirituelle Identität von Buddhismus und Christentum« folgendes schrieb:
»Liebe will das Individuelle; Liebe will daher das Geschiedensein. Daß Gott die Welt in kleine Stücke zerbrochen hat, begrüßt das Christentum mit instinktiver Freude [. . .] Genau darin besteht die philosophische Kluft zwischen Buddhismus und Christentum; für den Buddhisten oder Theosophen ist die Persönlichkeit der Sündenfall des Menschen, für den Christen ist sie von Gott gewollt, der Kern seiner Idee des Kosmos. Die Weltseele der Theosophen will vom Menschen geliebt werden, damit er sich in sie hineinstürzt. Das göttliche Zentrum des Christentums hingegen hat den Menschen aus sich herausgeschleudert, damit er es lieben kann. [...] Alle modernen Philosophen sind Ketten, die binden und behindern; das Christentum hingegen ist ein Schwert, das scheidet und befreit. Keine andere Weltanschauung läßt zu, daß Gott über die Aufspaltung der Welt in lebendige Seelen frohlockt.«2
Und Chesterton ist sich völlig im klaren darüber, daß es nicht ausreicht, den Menschen von IHM zu trennen, damit die Menschheit IHN liebt, sondern daß diese Trennung in GOTT SELBST zurückgespiegelt werden muß, so daß Gott von sich selbst verlassen wird.
»Als die Erde erbebte und die Sonne am Himmel erlosch, geschah es nicht wegen der Kreuzigung, sondern wegen des Schreis, der vom Kreuz kam und der bekannte, daß Gott von Gott verlassen war. Und nun mögen sich die Anhänger der Revolution unter den Religionen einen Glauben und unter den Göttern der Welt einen Gott aussuchen, sie mögen alle Götter, deren Wiederkehr unausweichlich und deren Macht unwandelbar ist, sorgsam vergleichen. Sie werden keinen zweiten Gott finden, der selbst ein Rebell war. Mehr noch (und hier wird es zu schwer für die menschliche Sprache), auch die Atheisten mögen sich einen Gott aussuchen. Sie werden nur einen einzigen finden, der ihre Einsamkeit in Worte gefaßt hat, nur eine einzige Religion, in der Gott eine Sekunde lang Atheist zu sein schien.«3
Aufgrund dieser Überschneidung der Isolierung des Menschen von Gott und Gottes Isolierung von sich selbst ist das Christentum so »unglaublich revolutionär. Daß ein braver Mann mit dem Rücken zur Wand stehen kann, wußten wir längst; daß Gott mit dem Rücken zur Wand stehen kann, darauf können die Rebellen aller Zeiten stolz sein. Weltweit ist das Christentum die einzige Religion, die begriffen hat, daß einem allmächtigen Gott etwas fehlt. Nur das Christentum hat begriffen, daß Gott, um ganz und gar Gott zu sein, nicht nur König, sondern auch Rebell sein muß.«4
Für Chesterton ist dabei völlig klar, daß wir es hier mit einem Gegenstand zu tun haben, »vor dem die größten Heiligen und Denker sich zu Recht gefürchtet haben. Aber in der dramatischen Geschichte vom Leidensweg Christi gibt es eine deutliche Gefühlsäußerung, die zeigt, daß der Schöpfer aller Dinge (obgleich es unausdenkbar scheint) nicht bloß Todesqualen, sondern auch Qualen des Zweifels durchlitten hat.«5 In der gängigen Form des Atheismus stirbt Gott für die Menschen, die aufgehört haben, an ihn zu glauben; im Christentum stirbt Gott für sich selbst. Mit seinem Ausruf »Vater, warum hast du mich verlassen?« läßt Christus selbst sich das zuschulden kommen, was für einen Christen die Sünde schlechthin ist: Er wankt in seinem Glauben.
Diese »Angelegenheit, die finsterer und schlimmer ist, als daß sich leicht darüber sprechen ließe« betrifft das, was zwangsläufig als der verborgene perverse Kern des Christentums erscheinen muß: Wenn es verboten ist, im Paradies vom Baum der Erkenntnis zu essen, warum hat Gott den Baum dort überhaupt aufgestellt? Ist dies nicht Teil seiner perversen Strategie, Adam und Eva erst zum Sündenfall zu verleiten, um sie danach zu retten? Das heißt, sollte man die Einsicht des heiligen Paulus, daß das verbietende Gesetz die Sünde überhaupt erst hervorbringt, nicht auch auf dieses erste Verbot anwenden? Auch der Rolle des Judas beim Tod Christi haftet eine ähnlich zwielichtige Doppeldeutigkeit an: Benötigte Christus den Judas denn nicht, da dessen Verrat für die Erfüllung seiner Mission, die Erlösung der Menschheit durch den Kreuzestod, unabdingbar war? Sind seine ominösen Worte während des letzten Abendmahls nicht eine heimliche Aufforderung an Judas, ihn zu verraten? »Da fragte Judas, der ihn verriet: Bin ich es etwa, Rabbi? Jesus sagte zu ihm: Du sagst es.« (Mt 26, 25) Die rhetorische Figur der Antwort Christi ist natürlich die einer geleugneten Aufforderung. Judas wird als derjenige angesprochen, der Christus den Machthabern aushändigen wird, jedoch nicht direkt (»Du bist derjenige, der mich verraten wird!«), sondern so, daß dem anderen die Verantwortung zugeschrieben wird. Ist Judas daher nicht der eigentliche Held des Neuen Testaments, derjenige, der bereit war, seine Seele zu verlieren und der ewigen Verdammnis anheimzufallen, damit der göttliche Plan in Erfüllung ging?6
In allen anderen Religionen verlangt Gott von seinen Anhängern, ihm treu zu bleiben, nur Christus forderte seine Jünger auf, ihn zu verraten, damit er seine Mission erfüllen kann. Man ist versucht zu behaupten, daß das gesamte Schicksal des Christentums, sein innerster Kern, von der Möglichkeit abhängt, diese Taten auf nichtperverse Weise zu interpretieren. Denn die offensichtliche, sich förmlich aufdrängende Lesart ist die perverse: Während er sich über den bevorstehenden Verrat beklagte, forderte Christus Judas zwischen den Zeilen auf, ihn zu verraten und verlangte auf diese Weise das höchste Opfer von ihm: nicht nur das Opfer seines Lebens sondern auch das seines »zweiten Lebens«, seiner postumen Reputation. Das Problem, der finstere ethische Knoten in dieser Sache ist daher nicht Judas, sondern Christus selbst. Mußte er sich zur Erfüllung seiner Mission tatsächlich einer derart obskuren, erzstalinististischen Manipulation bedienen? Oder läßt sich das Verhältnis zwischen Judas und Christus auf andere Weise lesen, außerhalb dieser perversen Ökonomie?
Im Januar 2002 kam es in Lauderhill, Florida, zu einem bizarren freudschen »Versprecher«. Eine Gedenkplakette mit der der Schauspieler James Earl Jones anläßlich einer Feier zu Ehren Martin Luther Kings gewürdigt werden sollte, trug versehentlich die folgende Inschrift: »Thank you James Earl Ray for keeping the dream alive«, eine Anspielung auf die berühmte »I have a dream«-Rede Kings. Bekanntlich war Ray der Mann, der wegen des Attentats auf King verurteilt wurde. Natürlich war dies aller Wahrscheinlichkeit nach ein durch und durch rassistisches »Versehen«, und dennoch birgt es eine merkwürdige Wahrheit. Tatsächlich trug Ray nämlich auf zwei verschiedenen Ebenen dazu bei, den Traum Kings »am Leben zu halten«. Zum einen ist dessen gewaltsamer Tod Teil seines Renommees als heroische, überlebensgroße Gestalt. Ohne seinen Tod wäre Martin Luther King sicherlich nicht das Symbol geworden, das er heute ist, da Straßen nach ihm benannt sind und sein Geburtstag ein staatlicher Feiertag ist. Ja, man könnte soweit gehen zu sagen, daß King genau im richtigen Augenblick gestorben ist. In den Wochen vor seinem Tod hatte er sich stärker in Richtung eines radikaleren Antikapitalismus’ orientiert. Hätte er sich noch weiter in diese Richtung bewegt, wäre er für den Pantheon amerikanischer Helden eindeutig nicht mehr in Frage gekommen.
Kings Tod folgt somit der von Hegel im Hinblick auf Julius Cäsar entwickelten Logik. Das Individuum Cäsar mußte sterben, um den allgemeinen Begriff Cäsar hervorzubringen. Nietzsches an Brutus gebildeter Begriff des »noblen Verrats« bleibt der Verrat des Individuums zugunsten der höheren Idee (Cäsar muß um der Rettung der Republik willen beseitigt werden) und kann insoweit durch die historische »List der Vernunft« erklärt werden (der Name Cäsar kehrte als der allgemeine Begriff-Titel »Cäsar« zurück). Offenbar gilt das gleiche für Christus: Der Verrat war Teil des Plans; Christus befahl Judas, ihn zu verraten, um so den göttlichen Plan zu erfüllen, das heißt, Judas’ Verrat war das höchste Opfer, der Inbegriff der Treue. Dennoch gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen dem Tod Christi und demjenigen Cäsars: Cäsar war erst ein Name und mußte als ein Name sterben (das kontingente einzelne Individuum), um ein allgemeiner Begriff-Titel zu werden (Cäsar); Christus hingegen war zunächst, vor seinem Tod, ein allgemeiner Begriff und wurde durch seinen Tod zu dem einzigartigen, singulären »Jesus Christus«. Die Allgemeinheit ist hier in der Singularität aufgehoben und nicht umgekehrt.
Wie aber verhält es sich mit einem eher Kierkegaardschen Verrat – nicht des Individuums zugunsten der Allgemeinheit, sondern der Allgemeinheit selbst zugunsten des singulären Punktes der Ausnahme (der »religiösen Suspendierung des Ethischen«)? Und darüber hinaus, wie steht es mit dem »reinen« Verrat, dem Verrat aus Liebe, dem Verrat als schlechthinnigem Liebesbeweis? Und wie verhält es sich darüber hinaus mit dem Selbstverrat: Da ich das, was ich bin, durch »meine anderen« bin, ist der Verrat an dem geliebten anderen der Verrat an mir selbst. Ist ein solcher Verrat nicht Teil jeder schwierigen ethischen Entscheidung? Man muß das verraten, was einem am nächsten steht, so wie Freud dies in Der Mann Moses und die monotheistische Religion tat, indem er die Juden ihrer Gründerfigur beraubte.
Judas ist der »verschwindende Vermittler« zwischen dem ursprünglichen Kreis der zwölf Apostel und Paulus, dem Gründer der universellen Kirche. Paulus ersetzt Judas buchstäblich und nimmt in einer Art metaphorischen Ersetzung dessen freigewordenen Platz unter den Zwölfen ein. Und es ist von entscheidender Bedeutung, die Notwendigkeit dieser Ersetzung im Gedächtnis zu behalten: Nur durch Judas’ »Verrat« und den Tod Christi konnte sich die universelle Kirche etablieren, das heißt der Weg zum Allgemeinen führt über die Ermordung des Besonderen. Oder etwas anders gewendet: Damit Paulus dem Christentum von außen ein Fundament verleihen konnte, als derjenige, der kein Mitglied des inneren Kreises um Christus war, mußte dieser Kreis durch einen schrecklichen Verrat von innen her aufgebrochen werden. Nicht nur Christus als der Held als solcher muß verraten werden, um einen allgemeinen Status zu erlangen; sondern der Held ist, wie Lacan es in seinem Seminar VII formulierte, derjenige, der betrogen werden kann, ohne daß ihm ein Schaden widerfährt.
John le Carrés Formulierung aus The Perfect Spy »Liebe ist all das, was sich noch verraten läßt«, ist daher wesentlich weitreichender, als es zunächst den Anschein haben mag. Wer unter uns hat nicht schon einmal das perverse Verlangen verspürt, das Vertrauen, das uns ein geliebter Mensch entgegenbringt, der sich vorbehaltlos auf uns verläßt, zu verraten und diesen Menschen schwer zu verletzen, ja, seine ganze Existenz aufs Spiel zu setzen? Dieser »Verrat als die radikalste Form der Treue« läßt sich nicht mit einem Verweis auf den Unterschied zwischen der empirischen Person und dem, wofür diese steht, »wegerklären« – nach dem Muster, wir verraten diesen Menschen gerade aus Treue zu dem, wofür sie steht. Eine weitere Version dieses Unterschieds ist der Verrat genau zu dem Zeitpunkt, zu dem die eigene Ohnmacht öffentlich geworden wäre. Auf diese Weise wird die Illusion aufrechterhalten, alles wäre gutgegangen, gesetzt man hätte überlebt. So wäre es etwa der einzige echte Treuebeweis gegenüber Alexander dem Großen gewesen, ihn »rechtzeitig« zu töten. Denn hätte er weitergelebt, wäre er auf den Status eines ohnmächtigen Beobachters des Niedergangs seines Reiches reduziert worden. Es ist hier eine höhere Kierkegaardsche Notwendigkeit im Spiel, nämlich die, die (ethische) Universalität selbst zu verraten. Jenseits des »ästhetischen« Verrats (des Verrats des Allgemeinen im Namen »pathologischer« Interessen – Profit, Lust, Stolz, dem Wunsch, anderen Schmerz zuzufügen und sie zu erniedrigen -, also der einfachen Bosheit) und dem »ethischen« Verrat (dem Verrat an der Person im Namen der Universalität, der in Aristoteles berühmter Aussage »Ich bin ein Freund Platons, aber ich bin ein noch größerer Freund der Wahrheit« zum Ausdruck kommt), gibt es noch den »religiösen« Verrat, den Verrat aus Liebe. Ich respektiere dich aufgrund deiner allgemeinen Merkmale, aber ich liebe dich aufgrund eines Faktors X jenseits dieser Merkmale, und um dieses X zu erkennen, bedarf es des Verrats. Ich verrate dich, und wenn du infolge meines Verrats am Boden zerstört bist, tauschen wir Blicke: Wenn du meinen Akt des Verrats verstehst, und nur dann, bist du ein echter Held. Jeder echte Führer, ob auf dem Gebiet der Religion, der Politik oder der Theorie, muß unter seinen engsten Anhängern einen solchen Verrat provozieren. Und sollte man nicht auch so die Anredeform in einer von Lacans späten öffentlichen Verlautbarungen lesen: »A ceux qui m’aiment . . .«, an diejenigen, die mich lieben, das heißt an diejenigen, die mich so sehr lieben, daß sie mich verraten. Der temporäre Verrat ist der einzige Weg zur Ewigkeit – oder, wie es Kierkegaard im Hinblick auf Abraham formulierte, als diesem befohlen wird, Isaak zu opfern, sein Dilemma »ist, daß es eine Prüfung, wohlgemerkt eine solche ist, bei der das Ethische die Versuchung ist«7.
Inwieweit spielte Christus also mit Judas kein perverses Spiel und veranlaßte einen seiner Jünger zu dem Verrat, der für die Erfüllung seines Auftrags unerläßlich war? Möglicherweise könnte ein Umweg über das beste (bzw. schlechteste) Hollywood-Melodram hier hilfreich sein. Die entscheidende Lehre aus King Vidors Film Rhapsody lautet: Ein Mann, der die Liebe einer von ihm begehrten Frau erlangen will, muß ihr beweisen, daß er auch ohne sie überleben kann, daß er ihr gegenüber seinen Auftrag oder seinen Beruf vorzieht. Die beiden unmittelbaren Alternativen (die berufliche Laufbahn steht im Vordergrund, die Frau ist nur zum Vergnügen da, ist etwas, das mich vom Entscheidenden ablenkt, oder aber sie bedeutet mir alles, und ich bin bereit, mich zu erniedrigen, ihr zuliebe mein öffentliches und berufliches Ansehen aufs Spiel zu setzen) sind falsch und führen dazu, daß der Mann von der Frau abgewiesen wird. Die Botschaft der wahren Liebe lautet: Selbst, wenn du alles für mich bist, kann ich auch ohne dich leben und bin bereit, zugunsten meines Auftrags oder meines Berufes auf dich zu verzichten. Am besten kann die Frau die Liebe ihres Mannes auf die Probe stellen, indem sie ihn im entscheidenden Moment seiner Karriere (dem ersten öffentlichen Konzert im Film, dem ausschlaggebenden Examen, der Verhandlung, die die Weichen für seine weitere Karriere stellen wird, usw.) »verrät«. Nur wenn er diese Feuerprobe übersteht und seine Aufgabe erfolgreich bewältigt, obwohl er völlig traumatisiert ist davon, daß sie ihn im Stich gelassen hat, wird er sich ihrer als würdig erweisen und wird sie zu ihm zurückkehren. Das Paradox, das diesem Sachverhalt zugrunde liegt, besteht darin, daß die Liebe, genau deshalb, weil sie das Absolute ist, nicht als direktes Ziel postuliert werden, sondern den Status eines Nebenproduktes, das heißt von etwas, das uns als unverdiente Gnade zuteil wird, behalten muß. Vielleicht gibt es keine größere Liebe als die eines Paares von Revolutionären, bei dem jeder der beiden Liebenden bereit ist, den anderen aufzugeben, sollte die Revolution dies erforderlich machen. Und in diesem Sinne sollte man sich auch um eine nicht-perverse Lesart des Opfers Christi und seiner Botschaft für Judas bemühen: »Beweise mir, daß ich alles für dich bin und verrate mich im Namen des revolutionären Auftrags, den wir beide zu erfüllen haben!«
Chesterton lag auch völlig richtig damit, als er diesen finsteren Kern des Christentums mit dem Gegensatz von Innen (der Versenkung in die innere Wahrheit) und Außen (der traumatischen Begegnung mit der Wahrheit) verband: »Der Buddhist blickt mit extremer Anspannung nach innen. Der Christ starrt mit fieberhafter Anspannung nach außen.«8 Chesterton bezieht sich hier auf den bekannten Unterschied zwischen der Darstellung Buddhas auf Gemälden und durch Statuen, die ihn mit wohlwollend-friedlichem Gesichtsausdruck zeigen, und der Art, wie christliche Heilige normalerweise dargestellt werden, nämlich mit einem durchdringenden, fast paranoiden, ekstatischen Blick. Der »Blick Buddhas« wird häufig als Alternative zum westlichen aggressiv-paranoiden Blick bezeichnet, dem es um die vollständige Kontrolle des Gegenübers geht und der sich in ständiger Alarmbereitschaft befindet, weil er dauernd mit einer Bedrohung rechnet. Im Falle Buddhas hingegen haben wir es mit einem wohlwollenden, friedlichen Blick zu tun, der die Dinge so sein läßt, wie sie sind, und keine Anstalten unternimmt, sie kontrollieren zu wollen. Doch obwohl die Botschaft des Buddhismus der innere Frieden ist, läßt das eigentümliche Detail, das bei der Weihe von Buddhastatuen eine Rolle spielt (die Augen des Buddha werden bemalt), diesen Frieden in einem merkwürdigen Licht erscheinen. Doch während der Künstler diese Augen bemalt,
»darf er der Statue nicht ins Antlitz blicken, sondern arbeitet, indem er ihr den Rücken zuwendet und sie von der Seite oder über die Schulter hinweg bemalt, wobei er einen Spiegel benutzt, der den Blick jenes Bildes einfängt, dem er Leben einhaucht. Wenn er sein Werk vollendet hat, hat er nun selbst den gefährlichen Blick angenommen und wird daher mit verbundenen Augen weggeführt. Die Augenbinde wird erst dann wieder entfernt, wenn seine Augen auf einen Gegenstand fallen können, den er dann symbolisch zerstört. Was Gombrich zu folgendem trockenen Kommentar veranlaßte: »Der Geist dieser Zeremonie läßt sich nicht mit der buddhistischen Lehre vereinbaren, so daß erst gar niemand einen solchen Versuch unternimmt.‹ Aber ist diese seltsame Heterogenität nicht gerade der Schlüssel zu diesem Widerspruch? Die Tatsache, daß der grauenerregende, böswillige Blick symbolisch ausgeschlossen werden muß, damit die gemäßigte und beruhigende Realität des buddhistischen Universums funktionieren kann. Der böse Blick muß gezähmt werden.«9
Ist dieses Ritual nicht ein »empirischer« Beweis dafür, daß die buddhistische Erfahrung des Nirwanafriedens nicht die ultimative Tatsache ist, sondern daß etwas ausgeschlossen werden muß, damit wir diesen Frieden erlangen, nämlich der Blick des Anderen?10 Auch dies ist ein Hinweis darauf, daß der »Lacansche« böse Blick, der für das Subjekt eine Bedrohung darstellt, nicht einfach nur eine ideologische Hypostase der westlichen Haltung der Kontrolle und Beherrschung ist, sondern auch in den östlichen Kulturen eine Rolle spielt. Diese ausgeschlossene Dimension ist letztlich die des Aktes. Was also ist ein Akt, der auf dem Abgrund einer freien Entscheidung gründet? Man erinnere sich an C. S. Lewis’ Beschreibung seiner religiösen Entscheidung in seiner Autobiographie Überrascht von Freude. Was diesen Text so unwiderstehlich macht, ist sein typisch »britischer«, nüchternskeptischer Stil, weit entfernt von den üblichen pathetischen Schilderungen mystischer Verzückung. C. S. Lewis verzichtet in seiner Beschreibung des Aktes geschickt auf jegliches ekstatische Pathos im Stil der heiligen Theresa, auf alle multiple Orgasmen hervorrufenden Penetrationen durch die Engel Gottes. Bei der mystischen Erfahrung Gottes treten wir (in der Ex-stase) nicht aus unserer normalen Wirklichkeitserfahrung heraus, sondern diese »normale« Erfahrung selbst ist »ex-statisch« (Heidegger), in ihr werden wir nach außen in Entitäten geworfen, und die mystische Erfahrung selbst ist Ausdruck des Rückzugs aus dieser Ekstase. Lewis bezeichnet diese Erfahrung einfach als »das Merkwürdige«; er erwähnt den unspektakulären Ort, an dem sie sich ereignete (»Ich fuhr oben auf einem Bus den Headington Hill hinauf«), und er verwendet Formulierungen wie »in gewissem Sinne«, »oder, wenn Sie so wollen«, »Sie könnten einwenden, daß ... doch ich neige eher zu der Auffassung ...«, »vielleicht«, »ich mochte dieses Gefühl nicht besonders«.
»Das Merkwürdige war, daß ich, bevor Gott mich einholte, sogar etwas geboten bekam, was heute wie ein Moment der vollkommen freien Wahl erscheint. In einem gewissen Sinne jedenfalls. Ich fuhr oben auf einem Bus den Headington Hill hinauf. Ohne Worte und (ich glaube) beinahe ohne Bilder wurde mir irgendwie eine Tatsache über mich selbst präsentiert. Mir wurde bewußt, daß ich etwas auf Abstand hielt oder etwas aussperrte. Oder, wenn Sie so wollen, daß ich irgendeine steife Kleidung trug, wie ein Korsett oder gar eine Rüstung, als wäre ich ein Hummer. Ich spürte, wie mir dort und in diesem Moment eine freie Wahl angeboten wurde. Ich konnte die Tür öffnen oder verschlossen lassen; ich konnte die Rüstung ablegen oder anbehalten. Keine der Alternativen wurde mir als Pflicht dargestellt; und an keine waren Drohungen oder Verheißungen geknüpft, obwohl ich wußte, daß ich mich auf etwas Unberechenbares einließ, wenn ich die Tür öffnete oder das Korsett abnahm. Die Wahl schien von tiefgreifender Bedeutung zu sein, doch sie war gleichzeitig merkwürdig emotionslos. Ich wurde nicht von Wünschen oder Ängsten getrieben. In gewissem Sinne wurde ich von gar nichts getrieben. Ich entschied mich, aufzumachen, die Rüstung abzulegen, die Zügel zu lockern.
Ich sage ›Ich entschied mich.‹ Doch es schien eigentlich gar nicht möglich zu sein, das Gegenteil zu tun. Auf der anderen Seite waren mir keinerlei Motive bewußt. Sie könnten einwenden, daß ich hier nicht frei handeln konnte, doch ich neige eher zu der Auffassung, daß dies einer vollkommen freien Handlung ähnlicher war als das meiste andere, das ich je getan habe. Notwendigkeit ist vielleicht nicht das Gegenteil der Freiheit, und vielleicht ist ein Mensch am freisten dann, wenn er, statt Motive vorzubringen, nur sagen kann: ›Ich bin, was ich tue.‹ Dann kam die Erschütterung auf der imaginativen Ebene. Ich fühlte mich wie ein Schneemann, der endlich zu schmelzen beginnt. Die Schmelze begann in meinem Rücken – zuerst tropftropf und dann plätscher-plätscher. Ich mochte das Gefühl nicht besonders.«11
In gewisser Hinsicht kommt hier alles zusammen: Die Entscheidung ist rein formaler Natur. Letztlich geht es nur darum, sich zu entscheiden, ohne eindeutige Vorstellung davon, was das Subjekt entscheidet. Es ist ein nicht-psychologischer Akt, emotionslos, ohne Motive, Wünsche oder Ängste. Er ist unvorhersehbar, nicht das Ergebnis strategischen Kalküls, sondern ein völlig freier Akt, selbst dann, wenn man gar nicht anders handeln könnte. Erst hinterher wird dieser reine Akt »subjektiviert«, in eine (eher unerfreuliche) psychologische Erfahrung übersetzt. Nur ein Aspekt an der Formulierung von Lewis ist potentiell problematisch. Der Akt im Lacanschen Sinne hat nicht mit der mystischen Suspendierung jener Bande zu tun, die uns mit der alltäglichen Wirklichkeit verbinden, nichts mit der Erlangung des Glücks der radikalen Indifferenz, bei der Leben oder Tod oder andere weltliche Unterscheidungen keine Rolle mehr spielen, in der Subjekt und Objekt, Gedanke und Tat völlig miteinander übereinstimmen. Aus mystischer Sicht ist der Lacansche Akt vielmehr das genaue Gegenteil dieser »Rückkehr zur Unschuld«, nämlich die Erbsünde selbst, die abgrundartige Störung des ursprünglichen Friedens, die primordiale »pathologische« Entscheidung für die bedingungslose Bindung an ein singuläres Objekt (etwa wenn man sich in einen bestimmten Menschen verliebt, der uns danach mehr bedeutet als alles andere).
Im buddhistischen Sinne ist ein Akt also die genaue strukturelle Kehrseite der Aufklärung, das Eingehen ins Nirwana – genau jene Geste, durch die die Leere gestört wird und die Differenz (und mit ihr der falsche Schein und das Leiden) in die Welt kommt. Der Akt erinnert daher an die Geste des Boddhisattva, der, nachdem er ins Nirwana eingegangen ist, aus Mitleid, das heißt um des Gemeinwohls willen, in die Wirklichkeit der Phänomene zurückkehrt, um allen Lebewesen dabei zu helfen, ins Nirwana einzugehen. Der Unterschied zur Psychoanalyse besteht darin, daß die Opfergeste Boddhisattvas aus psychoanalytischer Sicht ein Fehler ist. Um zum Akt im eigentlichen Sinne zu gelangen, sollte man jeglichen Bezug auf das Gemeinwohl bzw. das Gute vermeiden und den Akt ausschließlich um seiner selbst willen vollziehen. (Dieser Verweis auf Boddhisattva ermöglicht es uns auch, die »schwerwiegende Frage« zu beantworten: Wenn wir uns jetzt bemühen müssen, aus dem Teufelskreis des Begehrens auszubrechen und in den glücklichen Frieden des Nirwana einzugehen, wie war es dann eigentlich überhaupt möglich, daß das Nirwana »regredierte« und in den Kreislauf des Begehrens geriet? Die einzige schlüssige Antwort hierauf lautet: Boddhisattva