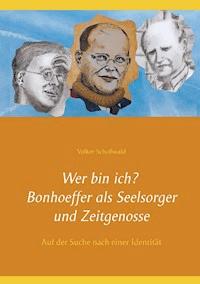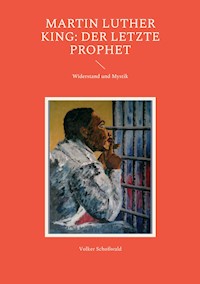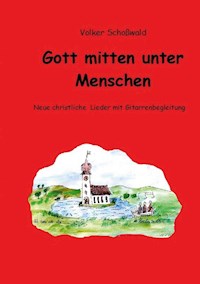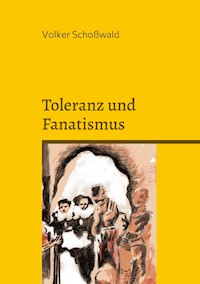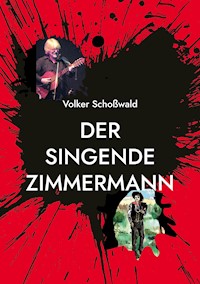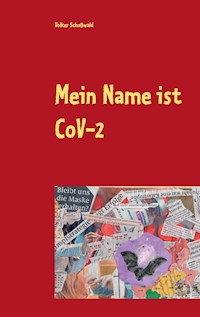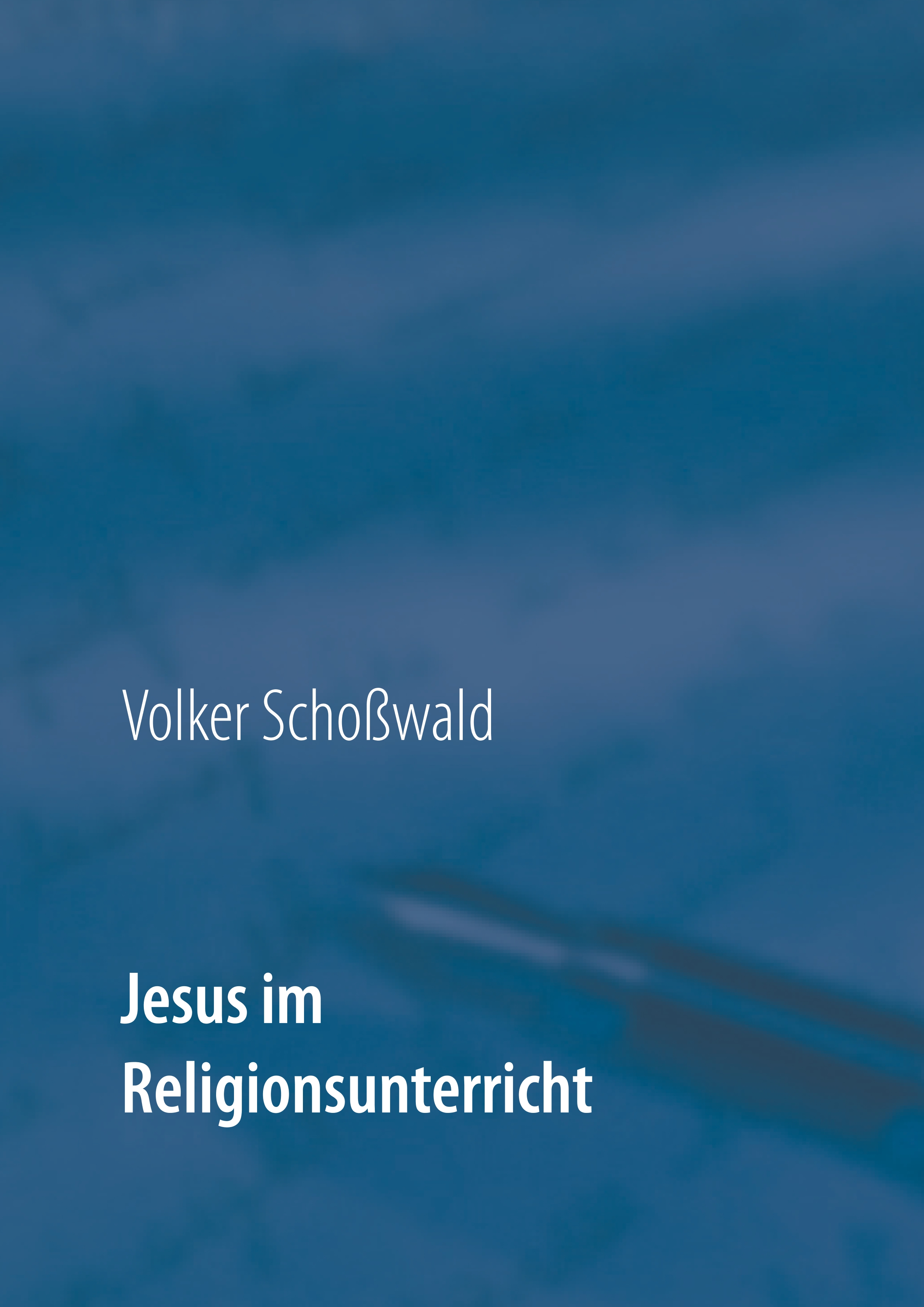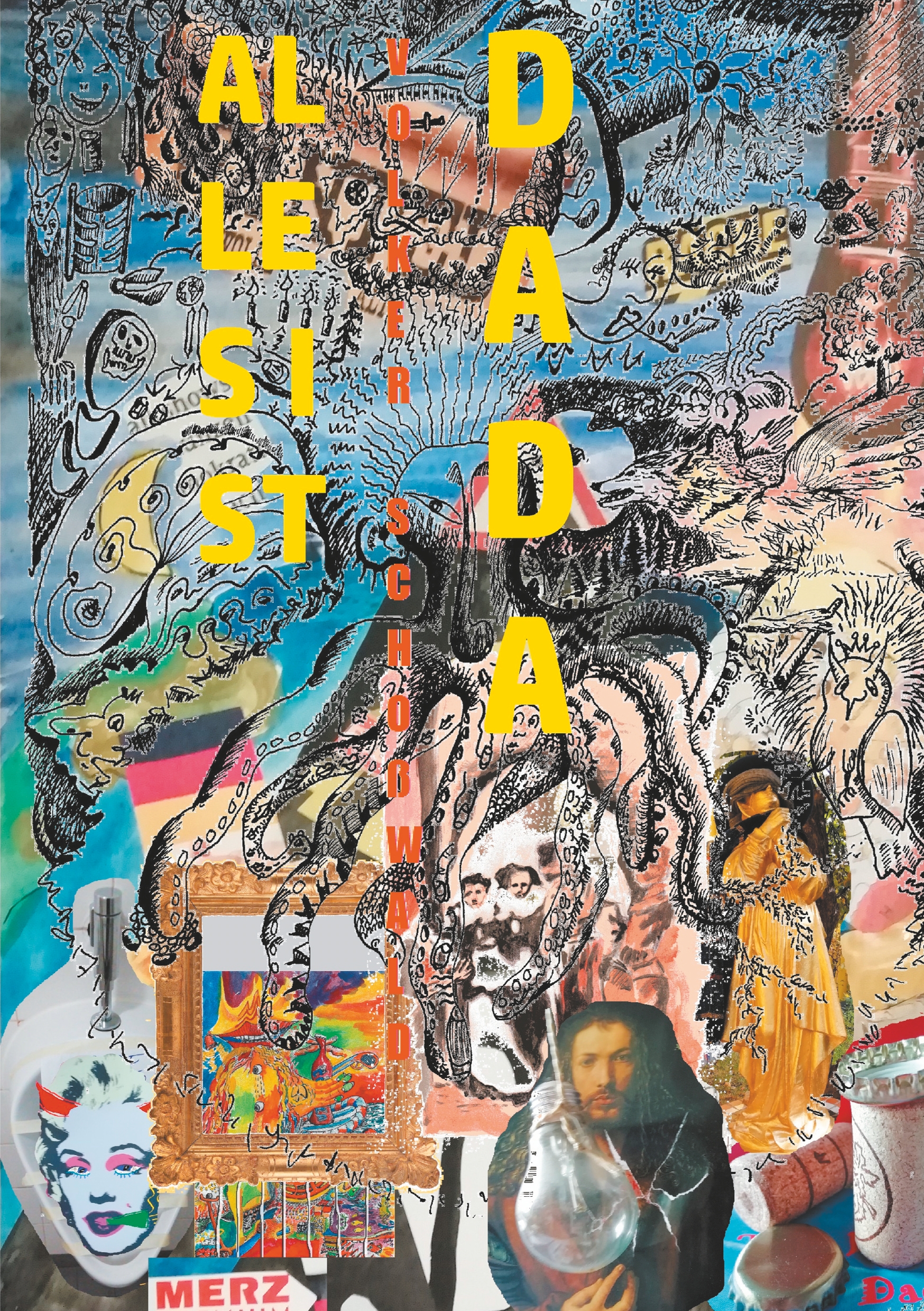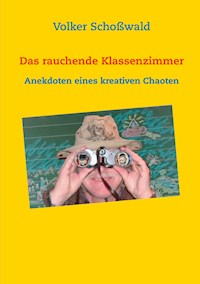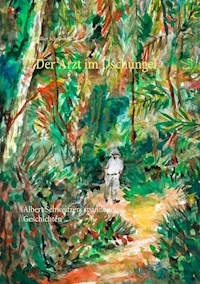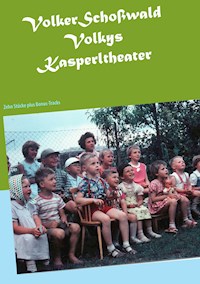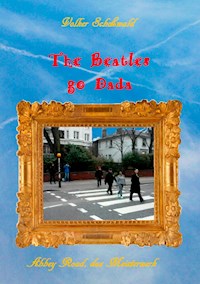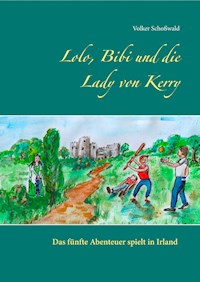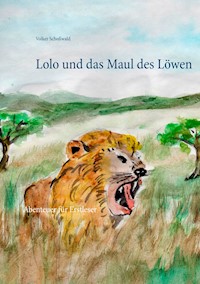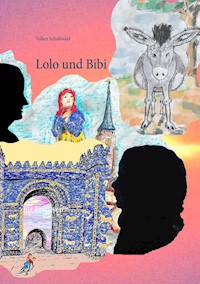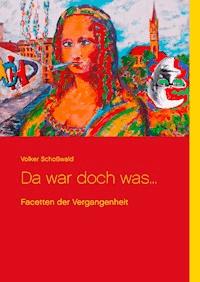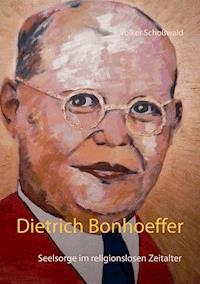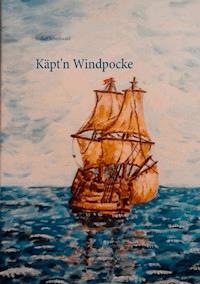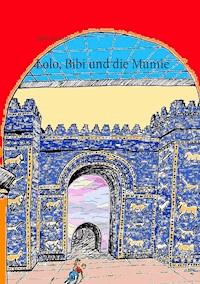Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
In seinem Buch über den Bauernkrieg 1525 mit einem besonderen Blick auf Thomas Müntzer taucht Volker Schoßwald tief in jene Zeiten ein und versucht sie plastisch zu machen. Die unglaublichen sozialen Verwerfungen mit krassen Ungerechtigkeiten bis hin zur als Leibeigenschaft beschönigten Sklaverei zeigt er als Nährboden für einen Flächenbrand. Doch er beschreibt auch, warum es scheitern musste: Der Bauer muss wieder aufs Feld, der Adlige schickt die Soldaten und kann damit gewinnen. Gleichzeitig strömte Thomas Müntzer eine große, geistliche Kraft aus, die man noch 500 Jahre später spüren kann. Durch den Blick auf weitere Rebellen der Reformation lässt der Autor jene Zeit mit neuem Leben vor den Augen des Lesers auferstehen. Dabei schafft er lebendige Beziehungen zu unserer heutigen gesellschaftlichen, politischen und kirchlichen Gegenwart.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Grundlegend überarbeitete Neuauflage, Schwabach, 2024
Mit Fotos und Bildern des Autors
1 Teil 1: Der Bauernkrieg und Thomas Müntzer
1.1 Bauern: Ohne Krieg kein Überleben
1.2 Das neue Zeitalter! Welches?
1.3 Thomas Müntzer: Gottesstreiter für Gerechtigkeit
1.4 Stationen des mitteldeutschen Bauernkrieges
1.5 Endzeit: Die Schlacht bei Frankenhausen
1.6 Sie darf nicht übersehen werden: Ottilie Müntzer
2 Teil 2: Rebellen der Reformation
2.1 Prolog: Anschlag auf die Kirche
2.2 Rebellen der Reformation
2.3 Ritter als Rebellen in eigener Sache
2.4 Andreas Karlstadt wider die teuflischen Ölgötzen
2.5 Feuer und Geist in Melchior Hofmann
2.6 Exkurs: Albrecht Dürers Apokalypse
2.7 Versiegelung zur Endzeit: Hans Hut
2.8 Hans Hergots tödliche Utopie eines Christenstaates
2.9 Exkurs: „Utopia“ und „Reich Gottes auf Erden“
2.10 Martin Luther: Rebell im Dienste der Wahrheit
2.11 Gut, Böse, Freund, Feind, Gott und Teufel
2.12 Münster 1534: Das chiliastische Täuferreich
2.13 Epilog: Dreizehn Rebellen für einen Messias
3 Literatur
4 Aphorismen
5 Index
Detailliertes Verzeichnis
1 Teil 1: Der Bauernkrieg und Thomas Müntzer
1.1 Bauern: Ohne Krieg kein Überleben
1.2 Das neue Zeitalter! Welches?
1.3 Thomas Müntzer: Gottesstreiter für Gerechtigkeit
1.3.1 Biographische Stationen
1.3.2 Rebellion durch Bibelauslegung
1.3.3 Ist „Gottes Wort“ ohne „Gottes Geist“ zu verstehen?
1.3.4 Rebellion aufgrund der Bibel
1.3.5 Gott, Schwert und Gerechtigkeit
1.4 Stationen des mitteldeutschen Bauernkrieges
1.4.1 Mühlhausen und Müntzer
1.4.2 Abgötterei und Regenbogenfahne in Allstedt
1.5 Endzeit: Die Schlacht bei Frankenhausen
1.5.2 Am Ende des Regenbogens: die Niederlage
1.5.3 Das Ende im 16. Jahrhundert
1.5.4 Krieg und evangelisch?
1.5.5 Frankenhausen: Gerechtigkeit und Untergang
1.5.6 Und heute?
1.6 Sie darf nicht übersehen werden: Ottilie Müntzer
2 Teil 2: Rebellen der Reformation
2.1 Prolog: Anschlag auf die Kirche
2.2 Rebellen der Reformation
2.2.1 Weltbilder zerbrechen
2.2.2 Das Individuum im Mittelpunkt der Welt
2.2.3 Müntzer – Luther, ein Kontrast
2.3 Ritter als Rebellen in eigener Sache
2.3.1 Franz von Sickingen
2.3.2 Gottfried „Götz“ von Berlichingen
2.3.3 Ulrich Hutten und die Rebellen ohne Waffen
2.4 Andreas Karlstadt wider die teuflischen Ölgötzen
2.4.1 Der universitäre Weg des Theologen Bodenstein
2.4.2 Karlstadt rebelliert
2.4.3 Im Bilderstreit
2.4.4 Bilderstürmer
2.4.5 Der Unangepasste geht nach Ostfriesland
2.4.6 Nach vielen Kämpfen am Ziel
2.5 Feuer und Geist in Melchior Hofmann
2.5.1 Der Pelzer
2.5.2 Ein Prediger der neuen Lehre umrundet die Ostsee
2.5.3 Der Weg nach innen zur Straßburger Apokalypse
2.5.4 Taufen in der Erwartung von Christi Wiederkunft
2.6 Exkurs: Albrecht Dürers Apokalypse
2.7 Versiegelung zur Endzeit: Hans Hut
2.7.1 Exkurs: (Wieder-)Täufer und Taufe
2.7.2 Bluttaufe und Augsburger (Täufer-)Synode
2.8 Hans Hergots tödliche Utopie eines Christenstaates
2.9 Exkurs: „Utopia“ und „Reich Gottes auf Erden“
2.9.1 Die biblische Urform der Utopie
2.9.2 Thomas Morus und Johann Valentin Andreae
2.9.3 Die Reformierten: Calvin und Karl Barth
2.9.4 Marx als Vollender Müntzers
2.10 Martin Luther: Rebell im Dienste der Wahrheit
2.10.1 Katharina, die entlaufene Nonne an Luthers Seite
2.10.2 Bemerkungen zum Antisemitismus der Luthers und zur nach Luther benannten Kirchenleitung
2.11 Gut, Böse, Freund, Feind, Gott und Teufel
2.11.1 „Dort sind die Bösen!“
2.11.2 „Wir sind die Guten!“
2.11.3 „Wie können Menschen so etwas tun?“ Hirnforschung
2.11.4 Falschmüntzer, Pharisäer und Gegenbilder
2.11.5 Müntzer und Martin-Luther-King
2.11.6 Führungspersönlichkeiten: Einzelgänger oder soziale Wesen?
2.12 Münster 1534: Das chiliastische Täuferreich
2.12.1 Taufrebellen in Münster
2.12.2 Münster als Täuferhochburg
2.12.3 Jan Mathys Täuferreich und das Ende der Weltzeit
2.12.4 König „Johann I“: Jan van Leiden
2.13 Epilog: Dreizehn Rebellen für einen Messias
3 Literatur
4 Aphorismen
5 Index
1 Teil 1: Der Bauernkrieg und Thomas Müntzer
1.1 Bauern: Ohne Krieg kein Überleben
Einfach waren sie, die Bauern, die vor 500 Jahren für ihre Rechte kämpften. Schwerlich kann man die bäuerlichen Gerätschaften, die sie im Krieg einsetzten, als Waffen bezeichnen. Von Kriegsführung hatten sie keine Ahnung, spürten aber die Wut in sich, die ein Vertrauen auf Sieg erzeugen kann. Wenig wohlgenährte Menschen müssen wir uns vorstellen, denn das Essen war einfach: Brot und Milchprodukte, Gemüse und Obst der Jahreszeiten. Nota bene: am 23. April 1516 erließ der bayerische König sein heute bewundertes Reinheitsgebot.1 Aber was war der Grund? Er wollte, dass für das Bier kein wertvolles Getreide, sondern nur die minderwertige Gerste verwendet werden sollte. Das Reinheitsgebot sollte der Mangelernährung gegensteuern. Dass Bier, welches auch als Biersuppe konsumiert wurde, der Volksgesundheit diente, wissen wir erst heute. Grund war die Hygiene, die zum Brauen nötig war sowie der desinfizierende Alkohol.
Was aber wussten die Bauern über die Welt? Lese- und schreibunkundig mussten sie sich auf Erzählungen stützen, auf das, was die Kundigen zu sagen hatten oder die besser gebildeten Pfarrer. Wenige Straßen und üble Pfade beschränkten den Verkehr auf die nähere Umgebung. Freilich, in Kutschen wäre man schon herum gekommen oder zu Pferd. Die Handwerker, die sich auf die Walz begaben, erweiterten ihren Horizont („Das Wandern ist des Müllers Lust“). Die Walz wurde in jener Zeit gerade erst eingeführt und sollte, wie man heute sagen würde, den Transfer von Fachwissen beflügeln.
Die Unterdrückungen der bäuerlichen Bevölkerung, die Entwicklung hin zur Leibeigenschaft waren derart krass geworden, dass sich fast gleichzeitig ab Ende des 15. Jahrhunderts in verschiedenen Gegenden Südwestdeutschlands Bauern erhoben. Auf ihre Fahnen malten sie den bäuerlichen gebundenen Schuh, und so wurde ihre Bewegung Bundschuh genannt.
Zunächst waren die lokalen Erhebungen mit Verschwörungscharakter noch nicht vernetzt. Wo sie zu tatsächlichen Revolten führten, wurden diese von den militärisch überlegenen Fürsten niedergeschlagen. Da jedoch nicht gleichzeitig die Ursachen bekämpft wurden, entlud sich die Unruhe zwei Jahrzehnte später im Bauernkrieg.
Die Geschichtsrezeption der DDR unterschied sich von der der BRD. 1983 war auch in der DDR das „Luther-Jahr“, von dem man wirtschaftlich zu profitieren versuchte und dem man zugleich ideologisch das Karl-Marx-Jahr zur Seite stellte: Jener war 500 Jahre zuvor geboren, dieser 100 Jahre zuvor gestorben.2
In einer Dokumentation des Bauernkrieges3 aus jenem Jubiläumsjahr gibt es vorgeschriebene ideologische Einordnungen: „Die drei oberschwäbischen Bauernhaufen, die ein riesiges Gebiet beherrschten, stellten eine gewaltige Macht des organisierten Volkes dar. Und dennoch offenbaren sich hier Inkonsequenzen, die für den Aufstand selbst verhängnisvoll wurden.“4 Diese Inkonsequenzen sieht der Verfasser Werner Lenk darin, dass die „Christliche Vereinigung“ sich nicht „als die alleinige Macht, sondern als ein Defensivbündnis“ konstituierte, „das erstens die bestehende feudale Obrigkeit neben sich gelten lässt und zweitens die Berechnung der alten Staatsgewalt und ihrer militärischen Macht nicht selbst in die Hand nimmt.“ Lenk meinte, es wäre der richtige Zeitpunkt für eine Revolution der Unterdrückten gewesen. Dass die Bauern zur Schlichtung der Gerechtigkeitsfragen „unparteiische Richter, evangelische Prediger – selbst Luther wird dafür vorgesehen“ haben wollen, bedeutete für den Vertreter der DDR den „Tod des Aufstandes“5. Diese alternative Sicht aus DDR-Perspektive sollten wir im Blick behalten. Die Geschichte der Menschheit hat immer wieder gezeigt, dass auch die Strömungen, die unterlegen waren, ihre Wahrheiten transportierten und nur bornierte Sieger dies zum eigenen Schaden nicht in ihre Sicht integrieren konnten. Geschichte muss immer dialektisch wahrgenommen werden.6
So waren sich etwa die Bauern von Ebern nahe Bamberg nicht sicher, wie sie sich im Kriegsfall als handelnde Partei verhalten sollten und fragten den benachbarten „Bildhäuser Bauernhaufen“ bei Münnerstadt an. Sie ließen sich beraten, welche Form des Raubens angesagt wäre. In einer ernsthaften Antwort konnten sie lesen: „Die von Ebern sollen, soviel sie auf den Zug gelegt, herabnehmen. Zum andern, dass man niemand Beut geben solle, dann denjenigen, so bei der Tat gewest.“7
Damals entstand die Ordnung des „Bildhäuser Bauernhaufens“, der zu entnehmen ist, dass sie in gewisser Weise urchristlich kommunistisch dachten8. Dabei ging es weniger darum, dass allen alles gemeinsam gehören solle, als vielmehr darum, dass es allen gleich gehen solle, niemand mehr oder weniger habe solle. Das zeigt sich an der geforderten Behandlung der Adligen. Diese sollten nicht bestraft werden, sondern lediglich einen Lebensstandard haben, wie er allgemein üblich ist – also: Schlösser abreißen, Häuschen bauen. Auffallend ist, dass die Juden explizit erwähnt werden: „daß allen und jeden Schultheißen und Dorfmeistern geschreiben werde, die Juden in ihren Häuseren, wie bishere beschehen, bleiben zu lassen…“9 Die Gefahr, dass die „Wutbürger“ antisemitische Exzesse ausleben könnten, hatten die Anführer offenbar im Blick.
1.2 Das neue Zeitalter! Welches?
Am 11.9.2001 riefen nach dem Anschlag auf das WTB eifrige Journalisten ein neues Zeitalter aus: „Dieses Ereignis hat die Welt verändert.“ Oder begann das neue Zeitalter 1945, als die USA die (bisher einzigen!) Atombomben über Japan abwarfen? Oder schon im ersten Weltkrieg, als die Deutschen zum ersten Mal Giftgas einsetzten… oder im 16. Jahrhundert, als edle Ritter wie Götz von Berlichingen von feigen Feuerwaffenbenutzern marginalisiert wurden. Manche bevorzugen andere Parameter, etwa digitale Revolution mit weltweiter Vernetzung, KI mit Fake News... oder der Siegeszug des Fernsehens, des Rundfunks, der Tageszeitung… oder der Kauf der Blut-WM durch Katar, die Besatzung TV-Deutschlands bei der EM durch symbolträchtig verschleierte Emiratsfrauen.
Schon 106 Wörter belegen die Uneindeutigkeit einer „Zeitalter“-Definition, bei der es mit der Nähe zur Gegenwart immer schwammiger und interessengesteuerter wird. Klassische Historiker datieren den Anbruch der Neuzeit ins 15. bis 16. Jahrhundert mit den Stichwörtern Buchdruck, „Entdeckung Amerikas“ oder Martin Luther. Ist auch der Bauernkrieg trotz seines blutigen Endes ein Zeitenwende-Fanal? Der Kampf um soziale Gerechtigkeit kumulierte in einer Gegend, in der heute unsere Demokratie angegriffen wird.
DDR-Geschichtsbücher aus Thüringen und Sachsen interpretieren den Bauernkrieg als Beginn der frühbürgerlichen Revolutionen.10 Doch ein wirklicher „Bauernkrieg“ fand nicht statt. Die regionalen Aufstände scheiterten an fehlender Koordination, Eigensinn und mangelnder Strategie. Die Adeligen und Kirchenfürsten agierten strukturierter und gewannen.
Wir beschäftigen uns hier zunächst mit der führenden Persönlichkeit im mitteldeutschen Raum, Thomas Müntzer. Sein Lebensweg führt auf besondere Weise in den Bauernkrieg hinein, aber es ist nicht der Weg eines Bauern, sondern eines Theologen. Nach dem Ende von Thomas Müntzer und mit ihm auch vom Bauernkrieg werfen wir einen Blick auf seine Zeitgenossen, die ebenfalls von rebellischem Eifer erfasst waren.
Wir schauen in das feudalistische Zeitalter. Die soziale Schere war extrem. Sklaverei war an der Tagesordnung, auch wenn sie nicht so genannt wurde. Leibeigenschaft drückt dasselbe aus. Aber auch die, die nicht versklavt waren, lebten in prekären Umständen. Der Adel hatte immer mehr Lebensgrundlagen an sich gerissen. Inzwischen war der Bogen so überspannt, dass es zu lokalen Revolten kam. Thomas Müntzer, seinerseits christlicher Prediger, formulierte es mit seinem Gespür für Ungerechtigkeit plastisch: “Sieh zu, die Grundsuppe des Wuchers, der Dieberei und der Räuberei sind unsere Herren und Fürsten; sie nehmen alle Kreaturen als Eigentum: die Fische im Wasser, die Vögel in der Luft, das Gewächs auf Erden muss alles ihrer sein.”11
Man hört schon den Vorklang zu: „Wacht auf, Verdammte dieser Erde!“, der „Internationale“. „Wacht auf, Verdammte dieser Erde, / die stets man noch zum Hungern zwingt! / Das Recht wie Glut im Kraterherde / nun mit Macht zum Durchbruch dringt. / Reinen Tisch macht mit dem Bedränger! / Heer der Sklaven, wache auf! / Ein Nichts zu sein, tragt es nicht länger / Alles zu werden, strömt zuhauf! Völker, hört die Signale! / Auf zum letzten Gefecht! / Die Internationale / erkämpft das Menschenrecht.“
1.3 Thomas Müntzer: Gottesstreiter für Gerechtigkeit
Für Thomas Müntzer, zunächst Anhänger, Mitstreiter und dann Konkurrent Luthers trifft das Prädikat Rebell besonders augenfällig zu und es ist kein Wunder, dass die DDR bei dem Versuch, eine parallele Symbolfigur zu Luther aufzubauen, auf Thomas Müntzer stieß.
1.3.1 Biographische Stationen
Thomas Müntzer wurde in der spannungsvollen Phase des Paradigmenwechsels vom Mittelalter zur Neuzeit 1489 in Stolberg im Harz geboren; die Familie zog 1501 nach Quedlinburg um, weil der Vater in politische Schwierigkeiten kam. Die Darstellung Müntzer mit Pelzkragen deutet auf einen wohlhabenden Hintergrund.
1506 immatrikulierte sich Thomas an der fortschrittlichen Universität von Leipzig, studierte Theologie und wurde 1514 zum Priester im Bistum Halberstadt geweiht. Zwei Jahre später legte er sein Magisterexamen ab und traf nach weiteren zwei Jahren auf Martin Luther, dem allmählich bekannt werdenden reformistischen Professor in Wittenberg. 1519, als die Reformation voll angelaufen war, verfolgte er als Beobachter wiederum in Leipzig die Disputation der kritischen Geister Luther und Karlstadt mit Roms Vertreter Eck. Karlstadt seinerseits konnte ihm mit seinen schwärmerischen, charismatischen Facetten Impulse geben, die ihn auf seine Stelle als Prediger in Zwickau begleiteten. Dorthin hatte ihn Luther persönlich empfohlen.
Müntzer mit Pelzkragen und das Müntzerdenkmal in Stolberg. Von den der Ideologie der DDR verpflichteten Historikern wurde er ganz anders eingeordnet als in der BRD, wo er deswegen sogar ein Stück weit verpönt war.
1.3.1.1 Zwickau
Thomas Müntzer traf 1520 in Zwickau ein. Dort tummelten sich als neue geistliche Bewegung die Zwickauer Propheten. Mit dieser charismatisch geprägten Gruppierung konnte Müntzer sich angeregt austauschen. Parallel dazu entstanden in der Stadt soziale Bewegungen. Verbesserungen vom Rat der Stadt forderten vor allem die Tuchmachergesellen. Da Müntzer nicht zuletzt wegen persönlichen geistlichen Freundschaften dies beredt unterstützte, setzte der Magistrat ihn ab12.
1.3.1.2 Der Heilige Geist und die „Zwickauer Propheten“
„Gott spricht direkt zu mir, ich brauche dafür keine Priester, keine Kleriker. Der Heilige Geist erfüllt mich.“ Dies hörten einfache Leute aus der neuen Botschaft des Wittenberger Mönches und Professors Martin Luther heraus. Die geistliche und berufliche Reputation unterstützte die Glaubwürdigkeit seiner Positionen. Luther stellte für den religiösen Bereich alle menschlichen Autoritäten in Frage. Außer Bibel und Gott hatte der individuelle Glaube nichts über sich.
In der kleinen sächsischen Stadt Zwickau erfasste der Heilige Geist vor allem Handwerker. Sie spürten die Nähe Gottes; sie spürten: Gott spricht in mir und durch mich. Diese Erfahrung machten auch Nikolaus Storch und Thomas Drechsel, zwei Zwickauer Tuchknappen, Gesellen der Tuchmacherzunft. Zu ihnen gesellten sich andere Handwerker, z.B. Schuster. Gemeinsam legten sie die Bibel aus. Sie galt ihnen als einzige Autorität, studierte Theologen hatten keinen Vorrang. Für die Auslegung beanspruchten sie die Wirkung des Heiligen Geistes bei sich. Nach ihrem Wortführer nannte sie der Volksmund die „Zwickauer Storchianer“. Luther verhöhnte sie als „Zwickauer Propheten“, wobei diese Abwertung ein reales Moment enthielt: Die Propheten verkünden die direkte Botschaft Gottes ohne Umweg über Buchstaben.
Einer ihrer führenden Köpfe, Theologiestudent „Stübner“, Markus Badstübner aus Elsterberg, stand seinerseits Thomas Müntzer persönlich sehr nahe und gewann ihn für den Kreis, der den heiligen Zahlen der Bibel folgend genau 72 Nachfolgern Jesu umfassen sollte.
Von der Herkunft her war Müntzer im Vergleich zu diesen „Jüngern“ „etwas Besseres“, doch seine Theologie nivellierte den sozialen Status. Die stimmige geistliche Gemeinschaft erquickte seine Seele.
Ab Mai 1520 vertrat er Sylvius Egranus als Pfarrer in der Marienkirche in Zwickau. Nach dessen Rückkehr wurde er Prediger an der Katharinenkirche. Mit seinen profilierten Predigten fand er Zugang zu den „Storchianern“, brüskierte aber die örtlichen Franziskaner, da er Gott höher als die Kirche positionierte.13 Der Klerus und die Monasten sahen ihnen Einfluss schwinden. Den Mönchen in der Tradition des Franziskus von Assisi mangelte es offenbar an sozialem Bewusstsein. Auch dieser Orden war in die Oberflächlichkeit abgedriftet.
Zur Botschaft der „Zwickauer Propheten“ gehörte, dass Gott die Herrschaft ergreifen will. Als vom Geist Gottes geleitet spürten sie, dass sie nicht einfach abwarten sollten, bis sich am Sankt-Nimmerleinstag etwas als Gottes Werkzeug dem Ergreifen seiner Herrschaft den Weg bereiten. So versuchten sie, 1521 den Magistrat abzusetzen. Machtübernahme ist nicht der selbstverständliche Kompetenzbereich von Handwerkern. Da half auch nicht der Heilige Geist, und die Aktion misslang. Die Rädelsführer flüchteten nach Wittenberg, quasi in das Zentrum der Rebellion gegen die Obrigkeiten. Von dort kamen mit Schriften wie „Von der Freiheit eines Christenmenschen“ gut lesbare Thesen des Professors Luther.
Auch der Prediger Müntzer wurde am 17. April aus Zwickau verbannt, erhielt jedoch noch sein Salär, dessen Empfang er quittierte: „Thomas Müntzer, qui pro veritate militat in mundo“14. Das Wort „militat“ näherte sich in den folgenden Jahren seiner deutschen Bedeutung.
1521 erschienen die „Schwärmer“ in Wittenberg und fanden dort, weil dieser Ort eine große Ausstrahlungskraft und damit eine kräftige Anziehungskraft hatte, mehr Aufmerksamkeit. Viele, vor allem jüngere Leute auf der Suche nach dem richtigen Weg trafen sich dort. Luther selbst, der Charismatikern sehr kritisch gegenüberstand, war jedoch abwesend, da er auf dem Reichstag in Worms für seine Sache zu kämpfen hatte und anschließend zur Sicherheit auf der Wartburg untertauchte. Dass er die „Schwärmer“15 ablehnte und letztlich bekämpfte, hing auch damit zusammen, dass für diese Bewegung die universitäre Bildung eine negative Konnotation hatte. Ihre Erfahrungen mit scholastischen Grundeinstellungen und vielleicht auch dem aktuellen Humanismus waren schlecht. Wer die hochgestochenen wie auch inhaltsleeren universitären Äußerungen ihrer Zeitgenossen wahrnimmt, versteht zumindest die Ablehnung dieser leblosen universitären „Bildung“. Dies zeigen die satirischen Briefe der „Dunkelmänner“ um Ulrich von Hutten, denen Dominikanermönche als Beschreibung der Realität jubelnd zustimmten.
Die unmittelbare Auslegung der Bibel durch ihre Leser war zwar von Luther ermöglicht und ursprünglich auch angepeilt, aber hier entglitt ihm seine Fangemeinde. Aus der Bibel, speziell aus dem Neuen Testament, lassen sich auch regimekritische Aussagen ableiten. Die Schwärmer erwarteten, dass auch ihre Obrigkeit sich zum Glauben, zum „neuen“ Glauben bekennen müsste. Wegen ihrer frappanten biblischen Argumentationsfähigkeit interessierte sich selbst Melanchthon für sie. Andreas Karlstadt stand ihnen vorübergehend sehr nahe.
Aus den biblischen Interpretationen ergab sich auch viel Sozialkritik. Das Potential dafür finden wir nicht zuletzt bei den großen Propheten, aber auch im Magnificat der Maria, die einen sozialen Umsturz besingt16. Gerade die Propheten konnten ja recht drastisch werden, ihre mittelalterlichen Nachfolger ebenfalls. Friedrich der Weise erhielt Hilferufe aus Wittenberg, weil der Rat der Stadt theologisch nicht mehr mithalten konnte, aber andererseits die Religion einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft und auch der lokalen Politik hatte. Parallel zu den Schwärmern hatte Andreas Karlstadt seine ikonoklastischen Reden gehalten und den Bildersturm initiiert. Da musste der Erzengel von der Wartburg vor Ort erscheinen und mit dem Flammenschwert seines Mundes dem höllischen Treiben ein Ende bereiten. „Luther kommt!“ hieß es und der Reformator hielt seine markanten Invokavitpredigten, in denen er die Reformen verdammte und nur seine Reförmchen bestehen ließ.
Dieser Macht mussten die Propheten weichen – mit ihnen vielleicht auch zeitweise der Heilige Geist. Manche mögen Thomas Müntzer gefolgt sein, der immer stärker in die eschatologisch motivierte Sozialrevolution überging.
Die Zwickauer Propheten zeigen: Religion bedarf immer auch der unvermittelten, direkten Erfahrung.
1.3.1.3 Müntzer auf Wanderung, nach Prag und Allstedt
Müntzer zog nach Prag. An Allerheiligen veröffentlichte er das sozialkritische „Prager Manifest“, in dem er den Mangel an Glaubensverkündigung beklagt: „Von keinem Gelehrten habe ich auch nur ein einziges Wörtlein von der in allen Kreaturen ausgedrückten Ordnung Gottes vernommen, (…) sonderlich nicht von den verfluchten Pfaffen (…) Aber Sankt Paulus schreibt den Korinthern am dritten der anderen Epistel, dass die Herzen der Menschen das Papier oder Pergament sind, da (hinein) Gott mit seinem Finger, nicht mit Tinte, seinen unverrücklichen Willen und ewige Weisheit einschreibt. (…) Das tut Gott deshalb von Anbeginn in seinen Auserwählten, damit sie nicht ein ungewisses, sondern ein unüberwindliches Zeugnis vom Heiligen Geist haben, der da genugsam Zeugnis gibt unserm Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Denn wer den Geist Christi nicht in sich spürt, ja der ihn nicht gewiss hat, der ist nicht ein Glied Christi, sondern des Teufels.“17 Von Prag aus wanderte er wieder in sächsische Lande. Dort pulsierte die Reformation, zu der er in der Tiefe seines Herzens gehörte.
Die St. Johannis-Kirche von Allstedt
Nach etlichen Irrwegen beriefen ihn die Allstedter 1523 als Pfarrer an die Johanniskirche. Dort arbeitete er an der Öffnung des lateinischen Gottesdienstes zur deutschen Sprache („Deutsches Kirchenamt“) und bereitete so Luthers „Deutsche Messe“ vor. Im gleichen Jahr heiratete er Ottilie von Gersen, also zwei Jahre vor der empörenden Eheschließung von Martin und Käthe. Im März 1524 wurde er Vater.
Als Müntzer im März 1524 in Allstedt gegen die „Abgötterey“ in der Mallerbacher Kapelle predigte, legten einige Hörer Feuer, was als Brandstiftung und zugleich als Landesverrat gewertet wurde: Der Landesherr Friedrich der Weise forderte die Auslieferung der Täter. Die Allstedter widersetzten sich und gründeten im Gegenzug einen (natürlich „heiligen“) „Bund“ mit den Mansfelder Burgknappen, um militant den Gotteswillen durchzusetzen.18
1.3.1.4 Mühlhausen und die Endzeit
Nach seiner aufrührerischen „Fürstenpredigt“ musste Müntzer Anfang August fliehen. Er hatte in einer Auslegung des Propheten Daniel dem gemeinen Volk eine neue Position gegeben. Es wäre nun das heilige Volk, von daher auch frei und nicht mehr den Fürsten untertan, die es entgegen Gottes Willen knechteten. Die Fürsten hätten nun die Aufgabe, das Volk in die Freiheit zu begleiten, etwa auch im Widerstand gegen andere Fürsten. Wenn sie sich nicht in Gottes Willen einfügten, würden sie in der Hölle landen. Wer die Predigt aufmerksam studiert, merkt, dass Müntzer hier gar nicht sozialkritisch argumentiert, sondern religiös. Es geht ihm um die Glaubensfreiheit. Das schien ab schon systemkritisch.
In Mühlhausen19 fand Müntzer eine neue Predigtstelle. Dort begegnete er Heinrich Pfeiffer, mit dem ihn viele Grundeinstellungen verbanden. Sie bildeten daraufhin eine Art „Doppelgespann“ in der Führung der Gemeinschaft und gründeten den „Ewigen Bund Gottes“. Müntzer und Pfeiffer unternahmen etliche Reisen, darunter in die Kaiserstadt Nürnberg, wo sie die „Ausgedrückte Entblößung“ veröffentlichten. Mittels der sehr erfolgreichen und engagierten Nürnberger Multiplikatoren konnten provokante Sentenzen in die Welt geschickt werden: „Ja, lieber Thomas, du schwärmest! Die Schriftgelehrten sollen schöne Bücher lesen, und der Bauer soll ihnen zuhören, denn der Glaube kommt durchs Gehör! Ach ja, da haben sie ein feinen Griff gefunden, der wurde viel ärger Buben an die Statt der Pfaffen und Mönche setzen, denn vom Anbeginn der Welt geschehen ist.“20 In der „Entblößung“ bezeichnete sich Müntzer selbstironisch als Schwärmer und stellte das Hören auf die Schrift in den Kontext des Analphabetismus, den sich nicht nur die Papisten, sondern auch die Lutheraner zunutze machen konnten. Höhnisch titulierte er sie als „Allerchristlichste“ und ihren Anführer als „mönchischen Abgott“: „Wollen auch die Allerchristlichsten genannt sein und gaukeln hin und her, die Gottlosen, ihre Gesellen, zu verteidigen; und sprechen aus dem Bart, sie wollen nicht wehren, wenn ihre Untertanen von ihren Nachbauren ums Evangelium verfolgt werden. Sie wollen nur schlechte Diebhenker und gute, prächtige Büttel sein. Die frommen Leute, ihre Pfaffen, die ihnen das Evangelium predigen, freien alte Weiber mit großen Reichtümern. Denn sie haben Sorge, sie müssen zuletzt nach Brot gehen. Ja, wahrlich, es sind feine evangelische Leute, sie haben gar einen festen, starken Glauben. Er sollte wohl zutreffen, wer sich auf ihre scheinbarliche Larve und Geschwätz mit ihrem mönchischen Abgott verließe, denn sie pochen gar sehr drauf und aufmutzen ihren buchstabischen Glauben viel höher, denn niemand sagen kann.“21 Für die Fabrikation dieses Machwerks geriet der Nürnberger Drucker Hergot unter Druck und wurde drei Jahre später in Leipzig hingerichtet.
Durch seine Reise in die oberrheinischen Bauernerhebungsgebiete bekam Müntzer hautnahen Kontakt zu militanten Gruppierungen. Als er 1525 Pfarrer von Sankt Marien in Mühlhausen wurde, beschleunigte sich das Tempo: am 9. März die Mobilmachung in Mühlhausen, eine Woche später Wahl des neuen „Ewigen Rates“, einen Monat später das Hissen der „Regenbogenfahne“ als Zeichen der ewigen Gültigkeit des göttlichen Wortes in Sankt Marien. Im Mai kochte der Zorn der Bauern über; sie griffen zu den „Waffen“, also Sensen und anderen bodenständigen Gerätschaften. Am 15. Mai kam es zur Schlacht bei Frankenhausen unter dem Himmelszeichen des Regenbogens. Die militärisch dilettantischen Bauern verloren nach wenigen Minuten ihre Disziplin – es gab ein heilloses Fluchtdurcheinander. Müntzer wurde ausgeliefert, in Schloss Heldrungen verhört und gefoltert – in der Anwesenheit u.a. von Landgraf Philipp von Hessen, dem Förderer der Reformation. Im Fürstenlager vor Mühlhausen wurde Müntzer zusammen mit seinem Christenfreund Pfeiffer am 27. Mai 1525 enthauptet und die Köpfe zur Schau gestellt.
1.3.2 Rebellion durch Bibelauslegung
Müntzer ging den Weg von der Kanzel zum Schlachtfeld, aber er blieb dabei Theologe - wie auch Zwingli fünf Jahre nach ihm. Beide blieben bis zum Schluss Theologen, nicht Kriegstheologen22, sondern offen für die kritische Kraft der Heiligen Schriften. Aus diesen Schriften bezogen die Reformatoren viele ihrer Impulse. Die sozialrevolutionären Ansätze, die sich bei Jesus, aber auch bei seinen biblischen Auslegern finden, wurden neu aufgegriffen. Zugleich empfingen die Reformatoren auch Impulse aus ihrer jeweiligen Gegenwart. Sie waren Kinder ihrer Zeit, also auch ihres Zeitgeistes, und der war weder friedvoll noch sozial. So braute sich eine Grundsuppe für revolutionäre Aktivitäten zusammen.
Schon damals zeigte sich: Wenn Kontrahenten von „Gott“ redeten, bezogen sie sich nicht unbedingt auf denselben „Gott“.
Ich verfluche die, die mit der „Begründung“ „Es gibt nur einen Herrgott“23 plappern: „Alle Religionen sind gleich“ Sie haben keine Ahnung und machen apodiktisch diese Ahnungslosigkeit zum Maßstab.
Was für ein Theologe! Müntzers Exegetik erscheint als die Beziehung eines spritzigen Geistes mit dem Heiligen Geist. Durch seine vitale Interpretation scheint Gott zu sprechen. Der Mit-Reformator schätzte die Heilige Schrift weniger als Norma normans denn als spirituelle Impulsgeberin, was mehr ihrer Geschichte als ihrem Status Quo entsprach. Dennoch wollte er sie nicht als Steinbruch für seine Ideologien missbrauchen, sondern durch den heiligen Geist richtig verstehen und zeitgemäß interpretieren. Statt geistloser Paraphrasendrescherei frönte er vitaler Allegorisierung.
Für Müntzer wirkte zunächst der humanistische Aufbruch mit seiner Forderung nach dem erfrischenden Gang „zu den Quellen“ motivierend. So ging es auch Melanchthon, dem Großneffen von Reuchlin24. Die seit kurzem mögliche und euphorisch praktizierte Massenproduktion von Schriften deutscher und lateinischer Sprache beschleunigte den authentischen Informationsfluss. Als Müntzer 1518 Luther begegnete, kamen auch die Adressaten der Bibelübersetzung neu ins Blickfeld: Jedermann! Jedermann sollte Gottes Wort selbst lesen und verstehen können - dank Guttenberg und Luther.25
Hermeneutik war schon bei Müntzer sehr spannend. Im Konflikt von Landbesitzern und verarmter Bevölkerung, die zur Selbsthilfe griff, argumentierte Müntzer offensiv exegetisch beispielsweise mit Joh. 8, der Begegnung Jesu mit der Ehebrecherin.26 Die eigentlich biografisch-paränetische Geschichte interpretierte er wie ein Gleichnis und identifizierte die Ehebrecherin mit den aufständischen Bauern, die er von ihren Motiven her rechtfertigte. Interessant, aber bedenklich: Immerhin argumentierte er mit der Heiligen Schrift, die göttliche Autorität repräsentiert. Das entspricht einer sekundären Legitimation des Arguments.
1.3.3 Ist „Gottes Wort“ ohne „Gottes Geist“ zu verstehen?
Der humanistisch geprägte Professor an der Universität zu Wittenberg, Dr. Luther hatte das einfach formulierbare Anliegen, dass die Heiligen Schriften als Gottes Wort jedermann verstehen sollte. Seine Übersetzungen ergänzte er durch unterweisende volkstümliche Schriften, wie etwa den beiden Katechismen.
Für Müntzer trat jedoch zu Luthers pädagogischem Impetus ein wichtiger Gesichtspunkt hinzu: Das Verstehen sollte über den Heiligen Geist laufen. Luther reagierte hier auffällig zögerlich. Der Jurist schätzte das nachprüfbare schriftliche Wort Gottes höher als das wenig verifizierbare Wirken des Geistes. Immerhin bereitete Thomas Müntzer seinem Mentor Luther den Weg zur deutschen Liturgie, als er 1523 in Allstedt zu in Deutsch gehaltenen Messen überging.
Andererseits löste auch er sich nicht einfach von den volkskirchlichen Fesseln: Obwohl er die Kindertaufe für christlich getarnten Aberglauben hielt, behielt er diese in der Praxis bei. Die Lutheraner haben es nie geschafft, sich von der Fessel der Kindertaufe zu lösen27, sondern beharren mit dem starren Argument „Geschenk der Taufe“ auf einer illusorischen Praxis, die heutzutage in aller Regel von der Kirche wegführt28. Wenn Müntzer Luthers „Sola gratia“ als menschlichen Trick deutet, sich die Konsequenzen des Glaubens vom Leibe zu halten29, so hat er bereits in der ersten Phase der Reformation das Teufelchen entdeckt, das inzwischen ein nicht mehr wegzudenkendes Kirchenglied geworden ist. „Hauptsache getauft“ ist bis heute ein Status Confessionis vieler Vertreter der Volkskirchen, die ihre Ausreden angesichts der Realität so schnell finden wie Alkoholiker.
Das pädagogische Anliegen der Ermöglichung eines selbstverantworteten Glaubens durch Kenntnis der Quellen, das Reformatoren wie Melanchthon30 hatten, war für ihren Mitstreiter Müntzer zu kurz gegriffen: Es ging um Gottes Wort. Zu seinem Verständnis und seiner Verkündigung gehörte unverzichtbar der Geist Gottes, der Heilige Geist. Den vermisste er bei seinem ehemaligen Lehrmeister. Das wird nicht ganz stimmen, denn Luthers kraftvolle Auslegung bedurfte seines persönlichen Gepackt-Seins, welches Exegese und Eisegese verbindet31. Darin glich er Müntzer, dem er zu nüchtern war. Wenn überhaupt, dann wirkte der Heilige Geist durch Luther wie Müntzer. Aber “der Herren eigner Geist” (Faust zu Wagner) spüren wir in Aggression und Unflätigkeit. Hier prallten zwei Hitzköpfe aufeinander, die ein vergleichbares intellektuelles Niveau hatten, welches verbal zu unterschreiten sie sich äußerst willig zeigten.
Beides, die Hochschätzung der Schrift wie auch platteste Polemik demonstrierte Müntzers Nürnberger Schrift 1524: “Hochverursachte Schutzrede und Antwort wider das geistlose, sanftlebende Fleisch zu Wittenberg, welches mit verkehrter Weise durch den Diebstahl der Heiligen Schrift die erbarmungswürdige Christenheit so ganz jämmerlich besudelt hat.”32 Luther ließ sich in der Bibelauslegung durch gesellschaftliche Zwänge bremsen. Luther war erfolgreicher, Müntzer aber der unerschrockenere Exeget, der durchgehend auf Bibelstelle um Bibelstelle als absolute Autorität verwies, zugleich hochemotional den Gegenpart denunzierend: „der allerehrgeizigste Dr. Lügner“, „Doktor Ludibrii” oder „der tückische Kolkrabe”.
Unverhohlen psychologisierend unterstellte er dem Wittenberger Professor narzisstischen Ehrgeiz: „Die jetzigen Schriftgelehrten tun nichts anderes als vor Zeiten die Pharisäer, rühmen sich der Heiligen Schrift, schreiben und klecksen alle Bücher voll und schwatzen je länger je mehr.“33 Luthers Opus belegt diese Vermutung - denken wir nur an seine selbstgefällige Unangreifbarkeit im „Sendbrief vom Dolmetschen" 1530.34
Luther war durch Erfolg anders zu bestechen als durch Geld. Seine Herkunftsfamilie verwöhnte ihn keineswegs mit Anerkennung, die Anerkennung durch arrivierte Zeitgenossen streichelte das Ego.
Luthers Vater hatte sich aus kleinen Verhältnissen zum erfolgreichen Unternehmer hochgearbeitet. Vielleicht aufgrund der Anerkennung von „oben“ und zahlreichen Anhängern ließ Luther mit den Jahren zunehmend Selbstkritik vermissen. So beanspruchte er Erfolge der Reformation exklusiv: „Wiewohl sie unseres Sieges gebrauchen und genießen, nehmen Weibe und lassen päpstliche Gesetze nach, was sie doch nicht erstritten haben, und ihr Blut hat deswegen nicht in der Gefahr gestanden, sondern ich hab’s müssen mit meinem bisher drangewagtem Leib und Leben erlangen.“35
Nicht nur drangewagt, sondern auch dabei verloren hat seinen Leib und sein irdisches Leben allerdings Müntzer, nicht Luther.
Solch ein Wagnis, das Leben für seine Überzeugung einzusetzen scheint bei uns kaum gefordert. In der islamischen Welt hingegen gibt es solche Aufrufe. Im Gegensatz zu den reaktionären, revanchistischen, ja, faschistoiden Inhalten der Islamisten wirkt ihre Bereitschaft, ihr Leben einzusetzen, beeindruckend.
Dabei sind weder im Mittelalter noch in der Gegenwart die Motive einfach sozial oder nationalistisch bedingt. Ein "heiliger Eifer" klingt selbst bei teuflischen Aktionen durch. Die Attentäter von New York und Washington am 11.9.01 schienen aus guten Familien zu stammen und hatten gediegene Ausbildungen. Eben das trifft auch für Müntzer zu. Die Motivsuche wird uns in beiden Fällen nicht ausschließlich in den sozialen Bereich führen. Wenn die islamistischen Fanatiker tatsächlich die eigenen Motive mit denen Allahs identifizieren, so können sie entgegen beschwichtigenden Behauptungen konfliktscheuer progressiver Weltversteher den Koran zitieren: "Und so soll kämpfen in Allahs Weg, wer das irdische Leben verkauft für das Jenseits. Und wer da kämpft in Allahs Weg, falle er oder siege er, wahrlich, dem geben wir gewaltigen Lohn."36 Eben auch dem, der im "heiligen Krieg" fällt, sei es dadurch, dass er ein Flugzeug in Hochhäuser steuert, in Cafés unschuldige Menschen abknallend erschossen wird oder im afghanischen Gebirge umkommt, winkt der himmlische Preis.
Wer die Selbstdarstellungen der Islamisten zur Kenntnis nimmt, stößt auf viel Eitelkeit. Das demonstrierte bereits der ermordete Bin Laden in seinen Videobotschaften. Selbstgefälligkeit bei der Begründungen von Morden scheint dazu zu gehören. Sie verhindert zugleich die Infragestellung des eigenen Tuns.37 Jean-Paul Sartre, der sehr gradlinig denkende Philosoph verwies unerbittlich auf die Verantwortung eines Jeden und sah uns zur Freiheit verdammt: „Jupiter: … Das schmerzliche Geheimnis der Götter und der Könige: daß nämlich die Menschen frei sind. Sie sind frei, Ägist. Du weißt es, und sie wissen es nicht.“38
1.3.4 Rebellion aufgrund der Bibel
Müntzer argumentierte mit der Bibel. Dabei standen ihm nur die hermeneutischen Möglichkeiten des 16. Jahrhunderts, nicht aber des 20. Jahrhunderts zur Verfügung.
Der Begriff Hermeneutik leitet sich vom Götterboten Hermes her: Die göttliche Botschaft soll den Menschen gebracht werden. In der theologischen Hermeneutik sind die Götterboten die Theologen, die die Heiligen Schriften für die einfachen Menschen ergründen und auslegen. Die Auslegung der Bibel hat Vorrang vor allen anderen Ordnungen. Egal, was der Staat oder die Kirche sagt: Hier ist Gottes Wort und dies hat einen höheren Seinsrang. Diese Gewichtung ist in sich ein Aufruhr gegen die herrschende Ordnung. Angeblich hat Luther sie in Worms auf dem Reichstag dem Kaiser gegenüber artikuliert. Die Folge für ihn war die Reichsacht. Auf diesen Aufruhr stand der Tod. Der Rebell wurde anschließend zur eigenen Sicherheit auf die Wartburg gebracht, wo er inkognito lebte.
In der Ernsthaftigkeit des Schriftverständnisses waren sich Müntzer und Luther einig: Das ist Gottes Wort. Und dieses Wort Gottes muss allen Menschen gebracht werden. Hier lagen sie im Trend der Zeit: Der Humanismus hatte einen pädagogischen Impetus, der uns in Reuchlin und seinem Neffen Melanchthon begegnet. Für seinen Impetus „ad fontes“ brauchte man die Sprachen der Quellen, um sie lesen zu können. Zugleich hieß dies: Wenn ich an die Quelle herankomme, nämlich die Heiligen Schriften in ihrer Ursprungssprache, dann bin ich dem Wort Gottes ganz nahe. Da, so dachten Luther, Müntzer und ihre Gesinnungsgenossen, ist Gottes Wort unverfälscht. Im 20. Jahrhundert formulierte man „Gottes Wort im Menschenwort“, weil man realisiert hatte, dass die Bibel von Menschen geschrieben worden war und – anders als Moslems es heute noch vom Koran behauptet – nicht direkt von Gott eingegeben worden ist. Im 16. Jahrhundert sah man das auch in Zentraleuropa noch unbefangener.
Umso folgenreicher war der Zugang zu den Heiligen Schriften in der Muttersprache. In Hinblick auf den Zugang für alle zu den Heiligen Schriften wurde das 16.Jahrhundert von der katholischen Kirche durch das zweite vatikanische Konzil im 20.Jahrhundert erreicht; erst durch dieses Konzil wurde die Muttersprache mit der Kirchensprache gleichberechtigt.39 Bemerkenswerter Nebenaspekt: Die biblischen Ursprachen Hebräisch, Aramäisch und Griechisch (Koine) hatten ebenfalls gegenüber der Kirchensprache Latein eine untergeordnete Autorität. Daran hatte selbst die Autorität des großen Erasmus von Rotterdam mit seiner humanistischen Bewegung nur marginal etwas geändert.40
Geistesgeschichtlich leitete Luther die Neuzeit ein, als er der individuellen Religionsfreiheit den Weg bereitete. Briefpartner in diesem Prozess war immerhin Henry VIII., der die englische Kirche von Rom löste und als anglikanische Kirche mit King (später war es mitunter eine Queen) als Oberhaupt weiterführte41.
Der Synergieeffekt des humanistischen Aufbruchs zum erfrischenden Gang „zu den Quellen“ mit der euphorisch praktizierten Massenproduktion von aktuellen Schriften beschleunigte den authentischen Informationsfluss. Dank Guttenberg und Luther sollte jedermann Gottes Wort selbst lesen können. Der Rückgriff auf die Ursprachen verband Luther mit dem Humanismus. Daraus entwickelte sich kontinuierlich der historisch-kritische Umgang mit den Schriften. Dabei wollte man so exakt wie möglich die älteste Form der Schrift herausfinden. Aber wer hätte es gewagt, „Gottes Wort“ zu verändern? Die Quellenlage ist freilich eindeutig: Selbst wenn es nur durch Abschreibfehler wäre, wurde Gottes Wort immer wieder verändert. Mitunter geschah dies auch gezielt, etwa um den ursprünglichen Sinn, den ein Schreiber vermutete, wieder herzustellen.42
„Jesus verkündete das Reich Gottes und es kam die Kirche.“ Diese kirchengeschichtliche Erkenntnis wird in der evangelischen Theologie gerne kolportiert. Eigentlich gehört sie in die argwöhnisch beäugte Pneumatologie.43 „Luther wollte die Kirche reformieren und zeugte die lutherische Orthodoxie“, könnte man kirchengeschichtlich analog formulieren und auch hier stellt sich die religiöse Frage nach dem Wirken des göttlichen Geistes: Müntzer gab sich dem Geist Gottes hin und wurde geköpft. Die Lutherischen sind zwar nicht kopflos. Aber wirken sie nicht oft genug geistlos?
Viele Kirchenmitglieder wären irritiert, wenn man ihnen sagt, dass in der Bibel das steht, was Gott will. Für sie ist die Bibel eine Art Machwerk der Kirche und besitzt keine belastbare normative Gültigkeit. Die Bibel ist für die Mehrheit argumentativ obsolet.44
Theologen sehen dies differenzierter. Die meisten sprechen vom „Wort Gottes“, gehen aber davon aus, dass es von Menschen formuliert wurde und daher den gleichen Problemen wie alle übrigen Dokumenten unterliegt. Selbst Luther hat, lange vor der historisch-kritischen Forschung, bezüglich der Stimmigkeit der Bibel Probleme erkannt und speziell bezüglich der Stimmigkeit biblischer Texte zu seiner Grunderkenntnis der Rechtfertigung des Sünders allein aus Gnade. Er formulierte als Norma normans in der Norma normata: „Wo sie Christum treibet.“ Für Luther ist die Bibel reines Wort Gottes nur durch das „Sola fide“.