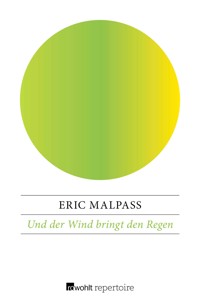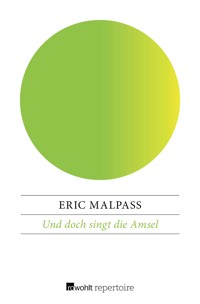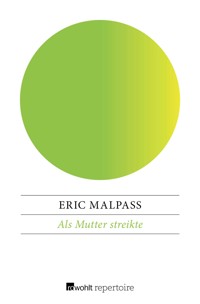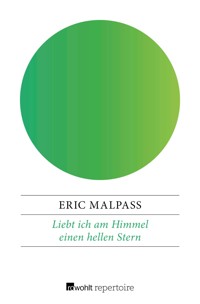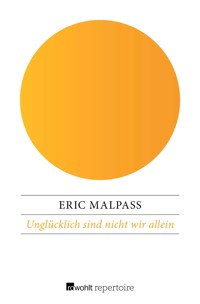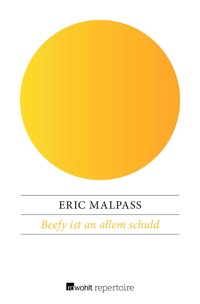
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Beefy ist ein ausgewachsener, bärenstarker Bursche und in den Augen der Gesetzeshüter sogar ein regelrechter Gauner. Aber er hat ein kindliches Gemüt und ein goldenes Herz. Das wissen vor allem seine Spießgesellen: Wenn Heck, Lofty Langfinger, Wodka-Joe, Willie Einauge und Holzbein Evans ein «Ding drehen», fallen Beefy wie von ungefähr immer die undankbarsten und riskantesten Aufgaben zu. Und wenn dann, wie fast jedesmal, irgend etwas schiefgeht, ist Beefy natürlich an allem schuld. Der Kirchenvorstand von St. Judas beschließt, ein neues Gemeindehaus zu errichten. Aber ein Unstern scheint über diesem Bauvorhaben zu schweben: Erst verschwinden die Baupläne, dann der Grundstein und schließlich sogar ein Bischof. Auch sonst ereignet sich eine Serie von höchst sonderbaren Vorfällen, Unfällen und Überfällen, und keiner ahnt, warum in der kleinen Stadt Danby die Welt nicht mehr in Ordnung ist. Verschmitzt und augenzwinkernd erzählt Eric Malpass, was sich Beefys listige Freunde alles einfallen lassen und wie an der treuherzigen Einfalt Beefys all ihre schlimmen Pläne scheitern. Mit warmherzigem Humor zeichnet Malpass das Bild eines liebenswerten Unglücksraben, dem alles, was er anpackt, mißlingt, der Unheil anrichtet, wenn er Gutes tun will, und ebensooft Gutes bewirkt, ohne es zu ahnen, der in tausend Nöte gerät, aber dessen bescheidener Traum vom kleinen Glück am Ende wie durch ein Wunder doch noch in Erfüllung geht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Eric Malpass
Beefy ist an allem schuld
Aus dem Englischen von Susanne Lepsius
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Beefy ist ein ausgewachsener, bärenstarker Bursche und in den Augen der Gesetzeshüter sogar ein regelrechter Gauner. Aber er hat ein kindliches Gemüt und ein goldenes Herz. Das wissen vor allem seine Spießgesellen: Wenn Heck, Lofty Langfinger, Wodka-Joe, Willie Einauge und Holzbein Evans ein «Ding drehen», fallen Beefy wie von ungefähr immer die undankbarsten und riskantesten Aufgaben zu. Und wenn dann, wie fast jedesmal, irgend etwas schiefgeht, ist Beefy natürlich an allem schuld.
Der Kirchenvorstand von St. Judas beschließt, ein neues Gemeindehaus zu errichten. Aber ein Unstern scheint über diesem Bauvorhaben zu schweben: Erst verschwinden die Baupläne, dann der Grundstein und schließlich sogar ein Bischof. Auch sonst ereignet sich eine Serie von höchst sonderbaren Vorfällen, Unfällen und Überfällen, und keiner ahnt, warum in der kleinen Stadt Danby die Welt nicht mehr in Ordnung ist.
Verschmitzt und augenzwinkernd erzählt Eric Malpass, was sich Beefys listige Freunde alles einfallen lassen und wie an der treuherzigen Einfalt Beefys all ihre schlimmen Pläne scheitern. Mit warmherzigem Humor zeichnet Malpass das Bild eines liebenswerten Unglücksraben, dem alles, was er anpackt, mißlingt, der Unheil anrichtet, wenn er Gutes tun will, und ebensooft Gutes bewirkt, ohne es zu ahnen, der in tausend Nöte gerät, aber dessen bescheidener Traum vom kleinen Glück am Ende wie durch ein Wunder doch noch in Erfüllung geht.
Über Eric Malpass
Eric Malpass (1910–1996) hat in seinem Heimatland Großbritannien lange Jahre als Bankangestellter gearbeitet. 1947 wurde er Mitarbeiter der BBC, außerdem schrieb er für diverse Zeitungen. Er verfasste zahlreiche Romane und lebte als freier Schriftsteller in Long Eton, nahe Nottingham.
Inhaltsübersicht
Für Muriel Gladys
1
Schon eine ganze Zeitlang versuchte ein hohler Zahn, durch das granitartige Gefüge von Beefys Unterkiefer eine Nachricht zu senden. Endlich gelang es. Die Nachricht erreichte das Gehirn.
Niemand hätte Beefys Gehirn je für ein Präzisionsinstrument gehalten, aber Schmerzen registrierte es sofort. ‹Heda, Beefy!› rief es. ‹Dir tut die Backe weh!›
Aber Beefy Jones, der in der warmen Dunkelheit eines Kinos saß, hörte nicht darauf. Er trug wie immer Jeans und ein blau-weiß gestreiftes Trikot. Seine dicken Finger umklammerten die stämmigen Knie. Sein Mund stand offen, sein Atem ging stoßweise; verzückt starrte er auf die Leinwand, wo der Sheriff mit seinen Männern die Bösewichte erbarmungslos verfolgte. Einer der Schurken hatte sich gerade im Sattel umgedreht; man sah, wie er den Finger am Abzug krümmte …
‹Heda, Beefy! Dir tut die Backe weh!› rief sein Gehirn wieder, diesmal schon leicht gereizt.
‹Nach Hause!› jammerte der hohle Zahn mit dünner schmerzverzerrter Stimme. ‹Bring mich nach Hause.›
Beefy rieb sich die Backe. Wie gemein von diesem Zahn, ihn so zu quälen, gerade jetzt, wo es dem Helden an den Kragen ging! Sehnsüchtig dachte Beefy an sein Bett – an die alte Linoleumrolle, in der man sich so gut verkriechen konnte –, an das abgewetzte Fußkissen, das er sich nachts unter den Kopf schob. Schlafen! Vergessen!
Er wandte sich an seinen Nachbarn. «Heck», sagte er, «mir tut die Backe weh.»
Heck starrte unverwandt auf die Leinwand. Verzagt musterte Beefy das kantige Profil seines Idols: die scharfe Nase, die flotten schwarzen Koteletten, das pomadenglatte Haar. Vielleicht hatte Heck ihn nicht gehört. «Mir tut die Backe weh!» wiederholte Beefy kläglich.
Ungerührt verfolgte Heck das Geschehen auf der Leinwand. «Na und, kann ich vielleicht was dafür?» zischte er aus dem Mundwinkel.
«Nein, nein», sagte Beefy hastig, «ich meine bloß, ich geh jetzt nach Hause, ins Bett, weißt du.»
«Ach, stell dich nicht so an», sagte Heck gereizt und fischte, den Blick auf die Leinwand geheftet, einen Kaugummi aus der Tasche, wickelte ihn aus und steckte ihn in den Mund.
‹Bring mich nach Hause›, stöhnte der Zahn, aber Beefy, der seinen Freund nicht noch einmal zu stören wagte, entschloß sich zu bleiben und wartete geduldig auf das Ende des Films.
Nach dem Film kam wieder Reklame: Ein wunderschönes Mädchen pries mit verführerischem Lächeln Eiskonfekt an. Als das Licht anging, stand die graue Wirklichkeit in Gestalt von Bessie Brown da. Mit mürrischer Verachtung sah sie über die Zuschauer hinweg, schielte mit dem einen Auge auf ihr Tablett mit dem Eiskonfekt und mit dem anderen zur Decke.
Wieder zeterte der Zahn: ‹Nach Hause! Nach Hause! Nach Hause!›
Beefy überlegte hin und her. Er hatte den Film erst einmal gesehen, und wenn er jetzt schon ginge, käme er vielleicht nicht einmal ins Haus, und außerdem wäre Heck sicher ärgerlich.
Aber dann dachte er wieder an seine gemütliche Linoleumrolle und an die alte Ingwerkruke, die man sich mit kochendem Wasser gefüllt ans Fußende schieben konnte. Eine geradezu unwiderstehliche Vorstellung.
«Bleib nur da, Heck, und sieh dir den Film noch mal an», sagte er. «Ich hau jetzt ab.»
Heck grunzte. Beefy sah ihn beklommen an; er hatte auf einen freundlichen Blick gehofft, aber Heck schien ihn bereits vergessen zu haben.
Trübselig machte sich Beefy auf den Heimweg.
Es gibt wohl nur wenige Orte auf der Welt, die die Stadt Danby in den Midlands an Reizlosigkeit noch übertreffen.
Schmutzigere Orte sicherlich, vielleicht sogar häßlichere, aber wenn man von absoluter Mittelmäßigkeit spricht, muß man zu allererst Danby nennen. Die Stadt ist so fade wie eine altbackene Semmel, so öde wie ein Bahnhofswartesaal.
In gewisser Weise gleicht Danby wirklich einem Wartesaal. Tag und Nacht rasseln Züge durch die Stadt und entführen die vom Glück Begünstigten in aufregende Fernen, in die wildreichen Wälder Schottlands, in das wimmelnde London mit seinen goldgepflasterten Straßen und der untergehenden Sonne entgegen nach Wales. An lauen Herbstabenden stehen die Einwohner Danbys am Bahnhof und sehen dem feuerspeienden Ungetüm nach, das eine Kette anheimelnd erhellter Wagen in die Finsternis zieht … dann seufzen sie, gehen wieder nach Hause, legen noch ein paar Scheite Holz aufs Feuer und träumen am Kamin sehnsüchtig von der Ferne.
Vor fast zweihundert Jahren hatte man in der Gegend viel Geld verdient. Man hatte die trostlose Ebene der Midlands mit Kanälen durchzogen, und wie heute die Eisenbahnschienen liefen diese Kanäle in Danby zusammen. Lange, längst vergessene Sommertage hindurch hatten auf den Treidelpfaden der Uferwiesen geduldige Pferde zigeunerbunte Kohlenkähne die Kanäle entlanggezogen, und im Winter hatte das Eis unter den scharfen Kufen der Schlittschuhläufer gesungen. Heute sind die Pferde verschwunden, und auch die Schiffer mit ihren goldenen Ohrringen gibt es nicht mehr. Die Kanäle sind verschilft, nur noch eine schmale Fahrrinne ist übriggeblieben. Sonntags morgens wandert nun ganz Danby in Gummistiefeln und Wollschals, mit Angeln, Blechbüchsen voller Köder und mit belegten Broten hier hinaus, um am Rande des stillen Wassers beschaulich den Tag zu verbringen.
Heute kann man auf breiten Asphaltstraßen von Danby in alle Himmelsrichtungen fahren, nach Leicester, nach Coventry und – Gott behüte – auch nach Birmingham.
Wenn man von Danby spricht, fängt man vielleicht am besten damit an zu beschreiben, wie man am schnellsten wieder hinauskommt. Aber wir kommen nicht hinaus, wir müssen uns damit abfinden, in Danby zu bleiben. Und da das nun einmal so ist, wollen wir einen Blick auf das Gemeindeviertel von St. Judas dem Finsteren werfen.
In Danby gibt es zwanzig Kirchengemeinden, einige sind orthodox-anglikanisch, andere pietistisch-protestantisch. Nur St. Judas ist weder das eine noch das andere.
Die Gemeinde von St. Judas ist genauso reizlos wie die übrige Stadt. In ihrem Bereich leben fünfzehntausend Einwohner; es gibt hier zwei Kinos, das Majestic und das Gloria, fünf Fischbratküchen (Täglich frische Fische!) und eine beachtliche Anzahl von Kneipen.
Auch ein staubiger Park fehlt nicht. Um seinen schmiedeeisernen, grün angestrichenen Musikpavillon versammeln sich an Sommer-Sonntagabenden adrett gekleidete Bürger, um hier beliebten Opernmelodien zu lauschen, die verschwitzte Männer in viel zu dicken Uniformen erklingen lassen.
Die geistige Spannweite der Gemeinde reicht von Hochwürden John Adams, Magister Artium, bis zur alten Lizzie Tubb, die in der Überzeugung lebt, die Erde sei flach und die Sterne am Himmel seien auf einen Vorhang gemalt; von der kleinen Miss Titterton, die so drollige Stücke für den Theaterverein schreibt, bis zum alten Lord Wapentake, der nicht gerade eine große Leuchte ist; von Heck, der gerissener ist als eine ganze Wagenladung Füchse, bis zu unserem Freund Beefy.
Die Kirche ist ein wahres Schauergebilde aus gelben Ziegelsteinen. Ihr Inneres ist öde, kalt und kahl. Beim Abendgottesdienst, wenn das Licht brennt und die Kerzen auf dem Altar in der Zugluft flackern, zucken unheimliche Schatten über die Decke, und bei der Früh-Kommunion, an nebligen Morgen, ist die Kirche so freudlos wie eine Gruft.
So also sieht es aus in der eintönigen, häßlichen Gemeinde des heiligen Judas des Finsteren. Doch auch hier findet man Schönheit, man muß sie nur suchen. Alte Ziegel glänzen im warmen Sonnenlicht, eine Mutter betrachtet ihr schlafendes Kind – und manchmal läßt es der Himmel auch schneien und verhüllt für einige Tage die ganze Häßlichkeit mit glitzerndem Zuckerguß. Hier gibt es keine wolkenumwehten Türme, keine Berge, die am Horizont emporragen, aber zuweilen Wolken, die sich wie Gebirge ausnehmen. Und wenn du von Danby genug hast, erhebe deine Augen, denn auch über Danby wölbt sich ein englischer Himmel.
Beefy aber sah nicht zu ihm auf, als er durch die abendlichen Straßen ging, in denen die Laternen wie Sterne aufleuchteten. Er hielt den Blick gesenkt. Heck war sicher böse, daß er sich davongemacht hatte. Und diese Schmerzen! Sie hörten und hörten nicht auf, es war so, als versuchte jemand, ihm den Kiefer aufzumeißeln.
Nun hatte er die Hauptstraße hinter sich gelassen und ging durch armselige Gassen, wo sich rote Ziegelhäuser aneinanderreihten und Kinder spielten, die längst ins Bett gehörten. Er gelangte zu der Kreuzung, auf der Lord Nelson auf seinem Sockel stand und sehnsüchtig zur Fischbratküche und zum Bierausschank hinüberschaute. Und hinter dem Helden von Trafalgar hob sich vor dem klaren Abendhimmel die häßliche Silhouette des Gemeindehauses von St. Judas ab.
Beefy ging auf die Tür zu, zog ein Bund Nachschlüssel heraus und schloß auf. Doch seine vorzeitige Heimkehr sollte ihm nicht die ersehnte Ruhe bringen, sondern ihm einen Plan entdecken, der darauf abzielte, nicht nur ihn, sondern auch verschiedene andere ehrenwerte Mitbürger um ihr pied-à-terre, ihren kleinen Zipfel Behaglichkeit in dieser rauhen Welt zu bringen.
2
Der Kirchenvorstand von St. Judas tagte in wichtiger Angelegenheit.
Den Vorsitz führte der Pfarrer John Adams, ein vierschrötiger junger Mann in Tweedjacke und grauen Flanellhosen. Sein blasses, sommersprossiges Gesicht über dem steifen Pastorenkragen zeigte den üblichen wohlwollenden Ausdruck, in den sich jetzt leichte Gereiztheit mischte.
Er schien zu denken, wenn es sich doch hier bloß um Rugby handelte, dann würde ich schon mit meinen Problemen fertig werden. Ein kräftiger Tritt vors Schienbein, und der Gegner ginge zu Boden. Aber Schulden von fünfzehntausend Pfund konnte man so nicht beikommen. Ihm war, als spiele er Rugby gegen eine Geistermannschaft.
Zur Rechten des Pfarrers thronte, kerzengerade und zugeknöpft, Mr. Edward Macmillan, Kirchenältester und Direktor der Filiale der Northern Counties Bank. Ein wahrer Eiszapfen, dachte John Adams, ein Mann, der jeden durchschaut, aber sich selbst nicht in die Karten blicken läßt.
Zur Linken des Pfarrers hockte wie ein graues Mäuschen die kleine Miss Titterton, Sekretärin des Kirchenvorstands, und hielt unentwegt kritzelnd alles fest, Kluges und Närrisches, Beifall und Lachen, und verwandelte das alles in ein trockenes Protokoll.
Dem Pfarrer gegenüber saß der Vorstand, zwölf Herren und neun Damen: einundzwanzig Unberechenbare, die, ohne mit der Wimper zu zucken, einer Ausgabe von fünfhundert Pfund zustimmten, um dann eine halbe Stunde lang über eine Rechnung von ein paar Shillingen zu debattieren. Der Pfarrer kam sich vor wie König Karl I. vor seinem gestrengen Parlament, und doch wußte er, daß sie im entscheidenden Augenblick geschlossen zu ihm stehen würden.
An diesem Abend standen als letzte Punkte auf der Tagesordnung: Konfetti bei Hochzeiten – Bau eines neuen Gemeindehauses.
Im Grunde war nur der letzte Punkt wichtig, und da es dabei lange und ernste Diskussionen geben würde, wäre der Pfarrer am liebsten rasch zu diesem Punkt übergegangen, aber irgendwie war die Sitzung im Konfetti steckengeblieben. Man hatte überlegt, wie man der Konfetti-Pest bei Hochzeiten entgegentreten könnte, und den Vorschlag gemacht, gedruckte Zettel an die Gemeinde zu verteilen mit der Bitte, weder in der Kirche noch auf dem Kirchhof Konfetti zu werfen. Der Vorschlag war so gut wie angenommen, doch da hatte jemand die Frage nach der Farbe der Zettel aufgeworfen.
«Blau», sagte Miss Fribble entschieden.
«Nein, bloß keine Kitschfarben», sagte George Bloodshot. «Wir brauchen eine Farbe, die gleich ins Auge springt: rot. Rot ist nicht zu schlagen, rot fällt jedem auf.»
Der Pfarrer wurde ungeduldig. «Also, will nicht bitte jemand den Antrag stellen, daß wir weiße Zettel mit roter Schrift nehmen?» fragte er und blickte erwartungsvoll in die Runde. Aber die Versammelten schienen nicht gewillt, sich so ohne weiteres festzulegen.
«Ich habe das Gefühl – bitte verstehen Sie mich nicht falsch, nur so das Gefühl, daß rot nicht mit den Altarvorhängen harmoniert», sagte Mrs. Fosdyke.
Miss Austin meinte, gelb sei doch so eine hübsche, heitere Farbe, man denke sogleich an Narzissen und so weiter.
Bert Briggs war für schwarz.
«Wir sprechen über Hochzeiten, Bert, nicht über Beerdigungen», warf Joe Grayson ein.
John Adams klopfte mit dem Hammer auf den Tisch. «Meine Damen und Herren, wir vergeuden unsere Zeit», sagte er, «jemand sollte den Antrag stellen, daß wir weiße Zettel mit blauer Schrift nehmen.»
«Wären nicht vielleicht blaue Zettel mit weißer Schrift ganz wirkungsvoll?» schlug Cyril Mayflower vor, ein künstlerisch angehauchter junger Mann.
Die Debatte ging weiter, bis es George Bloodshot und Bert Briggs plötzlich einfiel, daß ihr Stammlokal, der Dichter und Bauer, schließen könnte, noch ehe diese Sitzung ein Ende fand, wenn nicht sofort etwas geschah. Sie schlugen deshalb gemeinsam vor, ein kleines Damenkomitee zu beauftragen, diese schwierige Frage zu prüfen und dem Kirchenvorstand Bericht zu erstatten.
«Wer ist dafür?»
«Einstimmig angenommen.»
John Adams warf einen kurzen Blick auf seine Armbanduhr. «Und nun», sagte er feierlich, «kommen wir zum wichtigsten Punkt unserer heutigen Tagesordnung. Ja, zum wichtigsten, den dieser Kirchenvorstand seit Jahren behandelt hat: Es geht um den Bau des neuen Gemeindehauses.»
Die Sache lag ihm ganz besonders am Herzen. Das jetzige Haus, in dem sie augenblicklich tagten, war ein Relikt viktorianischer Häßlichkeit, für eine lebendige und wachsende Gemeinde völlig unzureichend. Es war verbaut, finster und wirkte unbeschreiblich deprimierend. Vor seinem geistigen Auge stand schon ein neues lichtes, heiteres und geräumiges Gebäude.
Aber würde es ihm gelingen, dem Kirchenvorstand diese Vision überzeugend nahezubringen? Würde er die eigene Begeisterung auf die Versammelten übertragen können? Ohne ihre Mithilfe war er machtlos.
Er blickte auf die Anwesenden. Ja! Sie waren ganz bei der Sache. Miss Titterton saß mit gezücktem Bleistift da, der alte Willie Ironmonger schob den Pfefferminzbonbon in seinem Mund geräuschvoll von Backbord nach Steuerbord – dreiundzwanzig Augenpaare starrten den Pfarrer erwartungsvoll an. Beherzt und überzeugend ergriff er das Wort. Doch da erhob sich zu seinem Entsetzen der alte Lord Wapentake und blickte, Aufmerksamkeit heischend, in die Runde.
«Ich frage mich», sagte er, «ob wir uns nicht mit unserer Annahme, rot sei eine auffallende Farbe, möglicherweise irren? Wird rot nicht vielleicht nur deshalb für Warnsignale verwendet, weil es die Farbe des Blutes ist?» Er steckte die Hände in die Hosentaschen und nahm eine etwas ungezwungenere Haltung ein. «Ich habe schon Menschen getroffen, die farbenblind sind und die ein dunkles Rot von Braun nicht zu unterscheiden vermochten», erklärte er.
John Adams, der endlich zum Thema kommen wollte, sagte mit gequältem Lächeln: «Aber diesen Punkt hatten wir doch schon erledigt, Lord Wapentake, wir sind jetzt beim neuen Gemeindehaus.» – «Oh», sagte Lord Wapentake und ließ sich wieder nieder. Der Pfarrer setzte erneut zu seiner Rede an, aber Lord Wapentake erzählte jetzt seinem Nachbarn von einem Burschen, den er einmal in Simla kennengelernt hatte, und der sei absolut farbenblind gewesen. «Sah gelb statt blau. Und der Witz dabei», fuhr Lord Wapentake fort – seine Stimme dröhnte plötzlich laut und klar wie ein auf volle Lautstärke eingestelltes Radio –, «der Witz dabei war, der Kerl war ein Blaukreuzler.»
Der alte Herr lehnte sich zurück und wischte sich kichernd die Tränen aus den Augen. Der Pfarrer seufzte und versuchte ein drittes Mal die Versammlung für seine Träume zu begeistern. Er sprach über die Unzulänglichkeiten des jetzigen Gebäudes, aber neben der Kirche gäbe es ja glücklicherweise genug Platz für ein neues Gemeindehaus. Er schilderte ihnen die hellen, luftigen Räume, den großen Saal mit modernen Stapelstühlen. Seine Augen leuchteten. Er spürte, daß er die Anwesenden mitriß. Er war am Ball, spielte vor sich und durchbrach die gegnerische Verteidigung – das Tor war in Schußweite.
Da unterbrach ihn Mr. Macmillan.
«Könnten Sie uns vielleicht eine ungefähre Vorstellung von den Kosten dieses Projekts geben, Herr Pfarrer?»
John Adams Gesichtszüge spannten sich. Mit fester Stimme sagte er: «Etwa fünfzehntausend Pfund.»
Geradezu hörbar schnappte der gesamte Kirchenvorstand nach Luft.
«Vielleicht verrät uns der Herr Schatzmeister erst einmal den Stand unseres Bankkontos», sagte Mr. Macmillan.
«Neun Pfund, drei Shilling und vier Pennies», war die niederschmetternde Antwort.
Joe Grayson war an diesem Abend groß in Form und hatte die Lacher auf seiner Seite, als er sagte: «Na, der kleine Differenzbetrag wird sich doch wohl noch beschaffen lassen.»
«Ich denke doch, daß uns das gelingt», sagte der Pfarrer.
Aber alle wichen seinem Blick aus und schienen vor dem kühnen Projekt zurückzuschrecken.
«Klammern wir uns doch nicht an die von mir genannte Summe», sagte er beschwichtigend. «Wir können bestimmt mit einer Finanzierungshilfe der Diözese rechnen. Und vergessen wir auch nicht, daß das Haus, in dem wir hier versammelt sind, schließlich uns gehört. Ich bin fest davon überzeugt, daß man es als Lagerhaus an eine der Fabriken hier in der Nähe verkaufen kann.»
In diesem Augenblick wurde die Versammlung durch ein Geräusch an der Tür abgelenkt, das unverkennbar ein Niesen gewesen war.
«Schon wieder diese Bengel! Entschuldigen Sie, Herr Pfarrer», sagte George Bloodshot, eilte zur Tür und riß sie auf.
Man blickte auf einen kurzen, hochgewölbten Gang, auf dessen einer Seite sich die Küche befand, während auf der anderen Seite eine Tür nach draußen führte. Oben, ziemlich hoch in der Wand und nur mit einer Leiter erreichbar, war die Einstiegluke zum Dachboden zu sehen. George Bloodshot knipste das Licht an. Aber zu seiner Verwunderung war der Gang leer. Er öffnete die Tür nach draußen, die auf eine schmale, unbeleuchtete Gasse zwischen dem Gemeindehaus und einer hohen Ziegelmauer führte. In der Dunkelheit glaubte Bloodshot, einen untersetzten Burschen in gestreiftem Trikot um die Ecke verschwinden zu sehen.
Er nahm die Verfolgung nicht auf, sondern ging, die Tür geräuschlos hinter sich schließend, wieder in den Sitzungsraum zurück.
«Diese Kinder sind eine wahre Plage», sagte Bert Briggs, «keine Disziplin heutzutage mehr.»
«Es waren gar keine Kinder», sagte Bloodshot, «ich glaube, es war ein Mann.»
Nervös fragte Miss Fribble daraufhin: «Meinen Sie, daß uns jemand belauscht hat?»
«Das hoffe ich nicht», rief der Pfarrer, der wieder Mut geschöpft hatte. Er schlug mit der Faust auf den Tisch, sprang auf und sagte: «Ich hoffe, daß uns niemand dabei belauscht hat, wie wir kleinmütig gewesen sind, statt voller Begeisterung daranzugehen, dieser Gemeinde das neue Haus, das sie braucht, zu geben und für unsere Kinder und Kindeskinder etwas zu bauen, auf das wir stolz sein können.» Er setzte sich wieder. Er steckte die Pfeife in den Mund, nahm sie wieder heraus, starrte auf den gestopften Tabak, legte die Pfeife auf den Tisch und blickte herausfordernd in die Runde.
Miss Titterton kaute an ihrem Bleistift. Das kommt wohl besser nicht ins Protokoll, entschied sie.
Der Kirchenvorstand war äußerst betreten. Ganz unenglisch, so ein Ausbruch.
Doch dann kamen ihnen Zweifel. Mußte ein wahrer Streiter der Kirche nicht gelegentlich so sprechen?
Der Pfarrer seufzte; der günstige Augenblick schien verpaßt. Doch dann sah er zu seiner Freude, wie sich der zuverlässige Alfred Mason erhob.
Mit einem seltsamen Glanz in den Augen sagte dieser langsam: «Ich schlage vor, daß wir den Herrn Pfarrer bevollmächtigen, den Kirchenarchitekten zu beauftragen, Pläne für den Bau eines neuen Gemeindehauses auszuarbeiten. Ungefähre Kostenhöhe: fünfzehntausend Pfund.»
«Unterstützt jemand diesen Antrag?» fragte der Pfarrer gelassen.
Nachdenkliche Stille. Alle schienen ihr Gewissen zu befragen.
Dann erhob sich George Bloodshot und sagte: «Ich unterstütze den Antrag.»
Es gelang dem Pfarrer zwar, in seiner Stimme die freudige Erregung zu unterdrücken, aber in seinen Augen schimmerte sie deutlich. «Wer ist noch dafür?» fragte er. Die Hände schnellten in die Höhe. John Adams’ Herz hämmerte. «Jemand dagegen?» fragte er.
Keiner rührte sich. «Einstimmig angenommen», konstatierte der Pfarrer.
Die Sitzung war zu Ende. «Lila ist übrigens auch eine hübsche Farbe», sagte Lord Wapentake, als man ihm in den Mantel half.
3
Stockdunkle Nacht. Alles sehnt sich für ein paar Stunden nach Geborgenheit. Fuchs und Hase schlüpfen in ihre Löcher und rollen sich in der Finsternis zusammen. Die Vögel haben sich im Gezweig niedergelassen, während die alte Erde auf ihrem Nebengleis im Weltraum wie ein Güterzug wieder durch den Tunnel der Dunkelheit rast. Vor verlöschenden Kaminfeuern liegen die Hunde und zucken zuweilen im Schlaf; nur die Katzen streichen noch umher und tragen Schrecken und Würde des Dschungels in die schmutzigen Hinterhöfe.
George Bloodshot und Bert Briggs, die sich im Dichter und Bauer noch einen kräftigen Schluck genehmigt hatten, machten sich auf den Heimweg. Lord Wapentake, der bereits zu Hause war, erzählte zwischen zwei Whiskies seiner Frau, daß man den ganzen gottverdammten Abend damit zugebracht habe, über die Farbkombination der neuen Altarvorhänge zu diskutieren. John Adams schloß die Tür des großen, stillen Pfarrhauses auf; doch nichts anderes als der vertraute Geruch von Gas, feuchten Wänden und gekochtem Kohl begrüßte ihn. Er aß eine Scheibe Brot mit Käse und trank dazu eine Tasse Tee.
Beefy Jones aber kehrte wieder zu dem jetzt dunklen und verlassenen Gemeindehaus zurück und öffnete mit seinem Nachschlüssel die Tür. In der Küche setzte er den Wasserkessel auf; dann lehnte er die Leiter an die Wand und kletterte auf den Dachboden, um seine alte Ingwerkruke zu holen.
Der Appetit aufs Abendbrot war ihm vergangen, und daran waren nicht nur seine Zahnschmerzen schuld, sondern vor allem der Schock, den ihm dieser Abend versetzt hatte.
In der Regel war das Gemeindehaus leer, wenn er heimkehrte: die Pfadfinder, Jugendklubs oder Männervereine hatten das Haus dann schon verlassen. Aber man durfte eben nicht zu früh heimkehren, wenn man sich ohne Wissen und Zustimmung des Pfarrers in dessen Gemeindehaus einnistete. Beefy hatte es nicht gewagt, auf den Dachboden zu klettern, als er Licht unter der Tür gesehen und Stimmengemurmel gehört hatte.
Statt dessen war er an die Tür des kleinen Raumes geschlichen, um durchs Schlüsselloch zu spähen. Viel konnte er nicht sehen, nur den Pfarrer und neben ihm einen großen, bleichen Mann, der so aussah, als hielte er nicht viel von dem, was der Pfarrer sagte.
Davon hielt allerdings auch Beefy nicht viel. Wenn er auch nicht alles verstand, so verstand er doch genug, um zu begreifen, daß man sein Zuhause an eine Fabrik verkaufen wollte. Dann hatte er niesen müssen und war schleunigst davongerannt.
Jetzt stand er da und füllte bekümmert seine Kruke mit heißem Wasser. Dann kletterte er auf den Boden und kroch in seine Linoleumrolle. Seine schmerzende Wange preßte er gegen das Fußkissen. Er starrte verzweifelt in das grelle Licht der elektrischen Birne und wünschte, die anderen kämen bald. Die Jungens waren auf Draht, sie würden schon wissen, was zu tun war.
Wie immer, wenn ihn etwas bedrückte, floh er in Gedanken in sein Heimatdorf. Dort, in Shepherd’s Delight, wollte er sich eines Tages, wenn er zu etwas Geld gekommen war, zur Ruhe setzen. Er träumte von einem Häuschen mit einem Garten, einem Schwein und ein paar Hühnern. An Sommerabenden würde er sich über die Stalltür lehnen und dem Schwein so lange mit einem Stock den Rücken schubbern, bis es sich mit angewandtem Blick wohlig in der Streu wälzte. Dann würde er ins Haus gehen, sich etwas zu essen machen und sich schließlich in einem kleinen Zimmer mit schrägen Wänden in einem richtigen Bett schlafen legen, bis die Sonne ihn weckte. Keine krummen Sachen mehr, keine Zahnschmerzen. Bis dahin hatte er dann auch lesen gelernt und würde den ganzen Tag lang Wildwestschmöker verschlingen.
Er war freilich lange nicht mehr in Shepherd’s Delight gewesen. Als kleiner Junge hatte er am Rande des Dorfes gewohnt und oft seine Tante Nellie besucht und mit seiner kleinen Cousine Sally gespielt. Sally gefiel ihm. Sie war hübsch, freundlich und lustig. Wo sie jetzt wohl stecken mochte? Zum erstenmal wurde ihm klar, daß sie ja kein kleines Mädchen mehr sein konnte. Sich selbst schätzte er auf etwa fünfundzwanzig, und Sally war drei Jahre jünger. Er zählte an seinen Fingern. Mein Gott! Sally mußte zweiundzwanzig sein. Eine erwachsene Frau, die ihn womöglich wegen seiner großen roten Hände und seiner plumpen Füße auslachen würde. Vielleicht war sie mit so einem superklugen Burschen verheiratet, der über ihn, Beefy, nur die Nase rümpfte.
Diese Vorstellung gefiel ihm gar nicht. Und so wanderten seine Gedanken wieder nach Shepherd’s Delight.
Das Dorf lag oben in den Bergen, man erreichte es über einen verwilderten Pfad, der an einem Wald entlangführte, hinter dem sich blau, fern, geheimnisvoll eine Bergspitze erhob. In seinen Träumen ging Beefy oft diesen Pfad hinauf und sah den blauen Rauch vor sich, der aus den Schornsteinen von Shepherd’s Delight aufstieg, aber bis ins Dorf gelangte er dabei nie. Immer wachte er zu früh wieder auf, wenn die graue Morgendämmerung durch die schmutzige Dachluke hereinkroch und die Jungens noch alle schnarchten.
Da kamen sie auch endlich. Er hörte unten die Tür knarren, dann Tritte auf der Leiter. Die Bodenklappe wurde aufgestoßen, und der Kopf von Holzbein Evans tauchte auf.
Holzbein war völlig glatzköpfig. Sein Schädel sah aus, als sei er aus Teakholz geschnitzt und mit Leinsamenöl sorgfältig poliert worden. Rechts und links von seinem schmalen Mund zogen sich zwei tiefe Kerben von der Nase zu den Kinnladen. Er hatte stechend gelbe Augen.
«Schon zu Hause, Beefy?»
«Schon ’ne ganze Zeit», sagte Beefy. «Meine Backe tut mir weh.»
Holzbein Evans hievte sich auf den Dachboden. «Armer alter Beefy. Hast du’s mal mit Cognac versucht?» Er zog eine Flasche aus der Tasche. «Hier, reib’s mal damit ein.»
«Danke, Holzbein», sagte Beefy. Ohne sich viel davon zu versprechen, bearbeitete er sein Zahnfleisch mit der scharfen Flüssigkeit. Es schmeckte scheußlich. Beefys Lieblingsgetränk war Brauselimonade.
Jetzt tauchte ein kleines munteres Gesicht in der Luke auf. «He, Joe!» rief Holzbein. «Was tut man denn in Rußland gegen Zahnschmerzen?»
Wodka-Joe schwang sich auf den Dachboden. «Bitte, was sein Zahnschmerzen?» fragte er.
Holzbein machte eine schmerzverzerrte Grimasse. Joe grinste; er hatte verstanden. Auch er brachte eine Flasche zum Vorschein. «Wodka», sagte er, «viel Wodka», und gab Holzbein die Flasche.
Holzbein reichte sie an Beefy weiter. «Hier, nimm mal ’nen kräftigen Zug, Alter», sagte er aufmunternd.
Beefy trank gehorsam und schüttelte sich.
Nun erschienen Lofty Langfinger und Willie Einauge. «Was ist denn mit Beefy los?» fragten sie.
«Mir tut die Backe weh», sagte Beefy, «und mies ist mir auch.»
«Da gibt’s nur eins: Whisky», sagte Willie Einauge.
«Gin ist noch besser», sagte Lofty.
Beide zogen Flaschen hervor. Willie schob einen whisky-feuchten Finger in Beefys Mund und rieb kräftig. Lofty tat das gleiche mit Gin.
«Besser?» fragten sie.
«Ein bißchen», log Beefy gutmütig. «Übrigens, ich hab schlechte Nachrichten.»
Aber in diesem Augenblick erschien Heck. «Ich hab eben Ida getroffen», sagte er. «Sie hat für morgen früh ’ne Vorstandssitzung einberufen. Hier unten bei uns. Sowie die alte Putzfrau fertig ist.» Er betrachtete sich in dem zersprungenen Spiegel und zog wie ein gereizter Hund die Oberlippe hoch, so daß man seine gelben Zähne sah.
Beefy stöhnte. Er mochte diese Sitzungen gar nicht. Und dazu diese Zahnschmerzen. Er stöhnte wieder.
«Was ist denn mit dem los?» fragte Heck.
«Ihm tut die Backe weh.»
«Weiß schon», sagte Heck, der ungerührt weiter seine Zähne untersuchte, «er hat schon im Kino gejammert.»
Keiner fragte mehr nach Beefys schlechten Nachrichten. Heck schlüpfte aus seiner Kordsamtjacke und faltete sie sorgfältig zusammen. Willie nahm sein Glasauge heraus und legte es in eine zersprungene Tasse – eine Prozedur, die Beefy jeden Abend von neuem faszinierte. Lofty Langfinger streckte sich der Länge nach auf dem Fußboden aus. «Hoffe, du kannst wenigstens pennen», sagte er freundlich.
«Ich hab schlechte Nachrichten», fing Beefy wieder an. Er gab sich verzweifelte Mühe, die richtigen Worte zu finden. «Sie wollen das Haus an eine Fabrik verkaufen.»
Er konnte mit der Wirkung seiner Worte sehr zufrieden sein. Gewöhnlich nahm niemand Notiz von ihm, aber diesmal horchten alle auf. Lofty fuhr erschreckt hoch. Heck starrte Beefy an, dessen Kopf kläglich aus der Linoleumrolle herausragte. Holzbein Evans, der seine Hosen eben sorgfältig über eine ausgediente Totenbahre hängen wollte, blieb regungslos stehen. Sogar Wodka-Joe spürte die allgemeine Besorgnis. «Bitte, was sein Fabrik?» fragte er.
Heck fragte: «Woher willst du das wissen?»
«Ich hab sie unten reden hören», sagte Beefy. «Sie wollen ein neues Gemeindehaus bauen und das hier an eine Fabrik verkaufen.»
Bestürztes Schweigen. «Das müssen wir verhindern», sagte Holzbein. «Koste es, was es wolle.»
«Was ist das überhaupt für ’ne Art, anderer Leute Zuhause an ’ne Fabrik zu verkaufen», sagte Langfinger. «Die schämen sich wohl gar nicht.»
«Aber sie wissen doch nicht, daß wir hier wohnen», sagte Holzbein, der es immer mit der Logik hatte.
«Na, wenn sie’s wüßten, würden sie uns hier erst recht rausschmeißen», sagte Langfinger.
Beefy versuchte, ihren Worten zu folgen, und ihm wurde immer elender zumute. Aber die ethische Seite des Falles ließ ihn kalt. Alles, was er wußte, war, daß ihm irgendwelche Leute seine Bleibe nehmen wollten, das erste Zuhause, seit er das Häuschen seiner Großmutter verlassen hatte. Er kam sich verloren, bedroht und hilflos vor.
Heck sah ihn aus kalten, wässerigen Augen an. «Das mußt du morgen in der Sitzung zur Sprache bringen, wenn wir zum Punkt ‹Verschiedenes› kommen. Vielleicht hat Ida eine Idee.»
Beefy starrte seinen Freund schreckensbleich an. «Ich», rief er, «ich soll das zur Sprache bringen? Aber ich weiß doch gar nicht, wie man das macht.»
Heck fluchte und ging wieder zum Spiegel.
«Kannst du es nicht in der Sitzung sagen, Heck?» flehte Beefy.
«Fall mir nicht auf den Wecker», sagte Heck und prüfte weiter sein Gebiß.
Holzbein Evans brummte: «Das mußt du schon selbst machen, Beefy. Schließlich hast du es ja auch gehört.»
«Ruhe, jetzt wird geschlafen», sagte Heck und streckte sich wohlig auf seinem Kunstrasen aus, einem ehemaligen Bühnenrequisit des Theatervereins von St. Judas. «Mach mal jemand das Licht aus.»
Keiner rührte sich. Also krabbelte Beefy aus seiner Linoleumrolle, kletterte die Leiter hinunter, machte das Licht aus und tastete sich wieder auf den Dachboden zurück zu seiner Lagerstätte. Über dem trüben, schmutzigen Oberlicht standen hell und klar die Sterne. Beefy blickte zu ihnen auf. Der Schlaf wollte nicht kommen. Seine Backe war geschwollen, der Zahn pochte schmerzhaft. Aber noch qualvoller waren seine Ängste. Nicht nur Obdachlosigkeit drohte ihm, nein, morgen sollte er auch noch eine Rede halten, vielleicht sogar Fragen beantworten. ‹Liegt sonst noch was vor?› würde Ida fragen, und dann würden sie alle Beefy ansehen, und er mußte aufstehen und sagen – ja, was eigentlich? Er versuchte sich die Worte zurechtzulegen, aber sie verhielten sich wie kleine Fische im Fluß: eben waren sie noch da, doch sobald man sie fassen wollte, schossen sie davon. Er stöhnte laut auf.
«Halt’s Maul», brummte Heck im Schlaf.
Am nächsten Morgen ging die Sonne ohne Rücksicht auf Beefy und seine Sorgen unbarmherzig auf. In der Nottingham Road kroch die alte Lizzie Tubb aus dem Bett und streifte sich einen Pullover vom Wohltätigkeitsbasar über. Sie stieg in einen Rock, der von Mrs. Fosdyke stammte, und schlüpfte in ein Paar schmuddelige Turnschuhe, die sie weiß der Himmel wo, aufgegabelt hatte. Auf den Kopf stülpte sie sich ein Kapotthütchen, das sie sich zum sechzigsten Geburtstag geleistet hatte, befestigte die Stahlbügel ihrer Brille hinter den Ohren und band sich ihre Schürze um, einen Sack mit der Aufschrift ‹Feinstes Knochenmehl›. Sie stellte Blackie, ihrem Hund, einen Napf hin und schlurfte zum Gemeindehaus hinüber.
Als sie mit dem Putzen fertig war und fortging, beobachtete Beefy sie durch einen Spalt der Dachluke. Er hätte zu gern gewußt, was auf ihrer Schürze stand. Ob es wohl ihr Name war? Oder womöglich ihre Adresse? Aber er war an diesem Morgen viel zu bedrückt, um sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Er mußte ja eine Rede halten. Und der Uhrzeiger rückte unerbittlich der schrecklichen Minute näher, wo Ida fragen würde: ‹Liegt sonst noch was vor?›
Er stieg nach unten. In der Küche herrschte jetzt ein emsiges Treiben. Heck rasierte sich, Langfinger stellte die Tassen des Müttervereins für das Frühstück bereit, Wodka-Joe grillte Heringe.
«Was macht deine Backe, Beefy?» fragte Holzbein. «Du siehst nicht gerade munter aus.»
«Ich hab Sorgen», sagte Beefy kläglich. Dann fragte er verstohlen: «Wenn ich dir die Rede jetzt hersag, Holzbein, würdest du sie dann für mich aufschreiben?»
«Selbst wenn ich es täte, Beefy, du kannst es ja doch nicht lesen», erklärte ihm Holzbein freundlich.
Nicht zum erstenmal wünschte sich Beefy, daß er einen so klaren und durchdringenden Verstand wie Holzbein besäße, dessen starke Seite die Logik war.
«Daran hab ich nicht gedacht», murmelte er. Er schlenderte ins nächste Zimmer und dachte so lange nach, bis sich ihm der Kopf drehte. «‹Liegt sonst noch was vor›, sagte Ida, und dann steh ich auf und sage: ‹Meine Damen und Herren, sie wollen es an eine Fabrik verkaufen, weil sie ein neues bauen. Es war nämlich so: Mir tat die Backe weh, drum ging ich früh nach Haus. Und da sagten sie, sie wollen ein neues neben der Kirche bauen.›»
Das hörte sich doch eigentlich ganz klar an, fand er. Und klar mußte es sein, sonst würden sie anfangen, ihm Fragen zu stellen. Aber wie klar es auch sein mochte, er wußte, im entscheidenden Augenblick würde er die Worte nicht zusammenbringen.
Die verschiedenen Alkoholika hatten seinem Zahn offenbar gutgetan. Doch Appetit auf Frühstück hatte er nicht, er war zu bedrückt.
Langfinger und Willie Einauge fingen an, den Raum für die Sitzung herzurichten. Sie stellten Stühle um den Tisch, sammelten alte, vom Kirchenvorstand zurückgelassene Notizblocks zusammen und legten einen auf jeden Platz. Heck widmete sich übertrieben geschäftig seinem Protokollbuch.
Dann hörte man, wie sich ein Nachschlüssel im Schloß drehte. Die Eingangstür wurde aufgestoßen, und gleich darauf stand Ida in voller Lebensgröße und in voller Kriegsbemalung im Türrahmen.