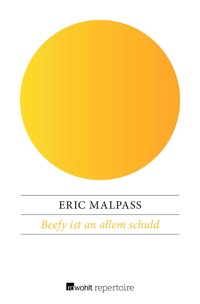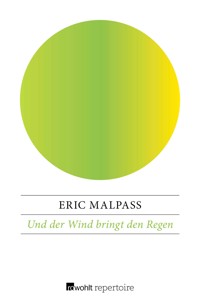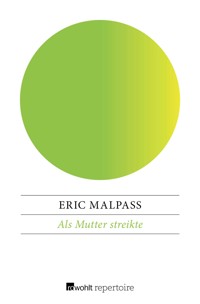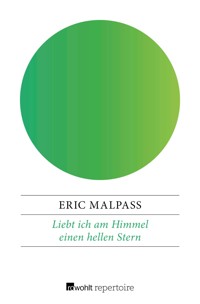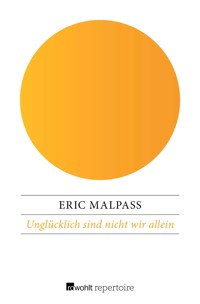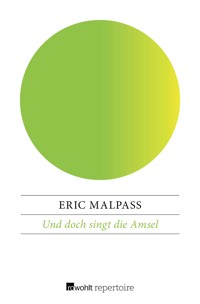
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Gaylord-Romane
- Sprache: Deutsch
Wer kennt sie nicht, die liebenswerten Pentecosts, den pfiffigen Gaylord, seine sanft-energische Mutter May, seinen versponnenen Vater Jocelyn und den kauzigen Opa. Mit heiterer Gelassenheit erzählt Eric Malpass von den kleinen und großen Gefahren, die das Glück seiner Helden und den ländlichen Frieden, in dem sie leben, bedrohen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 302
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Eric Malpass
Und doch singt die Amsel
Aus dem Englischen von Susanne Lepsius
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Wer kennt sie nicht, die liebenswerten Pentecosts, den pfiffigen Gaylord, seine sanft-energische Mutter May, seinen versponnenen Vater Jocelyn und den kauzigen Opa. Mit heiterer Gelassenheit erzählt Eric Malpass von den kleinen und großen Gefahren, die das Glück seiner Helden und den ländlichen Frieden, in dem sie leben, bedrohen.
Über Eric Malpass
Eric Malpass (1910–1996) hat in seinem Heimatland Großbritannien lange Jahre als Bankangestellter gearbeitet. 1947 wurde er Mitarbeiter der BBC, außerdem schrieb er für diverse Zeitungen. Er verfasste zahlreiche Romane und lebte als freier Schriftsteller in Long Eton, nahe Nottingham. Mit dem kleinen Herzensbrecher Gaylord ist Eric Malpass eine der originellsten Jungenfiguren der modernen Literatur gelungen, ernsthaft und liebenswert zugleich.
Inhaltsübersicht
Das Gedicht von Thomas Hardy wurde von H.M. Ledig-Rowohlt übersetzt
Für Heinrich Maria Ledig-Rowohlt in Freundschaft und Zuneigung
Ich stand allein am Waldesrand,
Gespenstisch-grau lag Frost
Auf trübem, wintermüdem Land,
Der Tag die Lider schloß.
Am Himmel dürrer Äste Drohn,
Ein Geisterfingertraum.
Die Menschen suchten Zuflucht schon
Im heimisch-warmen Raum.
Ein süßer Schall da zu mir drang
Aus kahlem Astwerk dort.
Ein unverzagter Jubel klang
Voll Freude fort und fort.
Die Amsel, die dort oben sang,
Die Federn windverspannt,
Warf ihrer Seele Überschwang
Hinaus ins düstre Land.
So wenig Grund für Frohgesang
Von so verzücktem Ton,
Fand sich in dieser Erde Gang
Hierum und weit davon,
Daß ich gedacht, da zittre leis
In dieser Amsel Lied
Auch Hoffnung durch, von der sie weiß,
Die mir sich noch entzieht.
Thomas Hardy: Die Schwarzamsel
1
Wenn Gaylord Pentecost etwas mit seinem Hund William gemeinsam hatte, so war es die allzeitige Bereitschaft, anderen Lebewesen zu helfen.
Bedauerlicherweise waren die anderen Lebewesen nicht immer so bereit, sich helfen zu lassen.
Zum Beispiel Duncan Mackintosh, der Verwalter. Er mühte sich mutterseelenallein ab, eine Schafsherde in einen Lastwagen zu verfrachten. Er hatte eine Rampe an den Lastwagen gelehnt und zwischen dem Pferch und der Rampe rechts und links Hürden aufgestellt, und just als er sich anschickte, seine Opfer durch diesen Gang zu scheuchen, erscholl eine muntere junge Stimme: «Können wir Ihnen helfen, Mr. Mackintosh?»
Selbst Duncan, ein Mann von granitener Natur, scheute davor zurück, dem Enkelsohn seines Chefs zu sagen, er solle in den nächstbesten Teich springen. Statt dessen grunzte er mißvergnügt: «Hm.»
Ein wenig mehr Begeisterung hatte Gaylord schon erwartet, aber sogar er hatte gelernt, daß man von einem Mann aus Aberdeen keinen übertriebenen Dank erwarten darf. «Was können wir tun?» rief er.
«Bleiben, wo ihr seid!» schrie Duncan aufgeregt, als ein Dutzend Schafe plötzlich die Rampe mit dem Elan eines angreifenden Kavallerieregiments hochjagte. Erleichtert ging er zur hinteren Wagenklappe, um sie zu schließen. Aber er hatte nicht mit dem sechs Monate alten William gerechnet.
William war ein altenglischer Schäferhund, aber in seinem kurzen Leben hatte er erst die elementarsten Dinge erfaßt (wie zum Beispiel den Respekt vor seinem jungen Herrn und die Wichtigkeit des Fressens). Doch der Anblick der Schafe mußte irgendwelche atavistischen Erinnerungen bei ihm erweckt haben. Schafe, fand er instinktiv, waren sein Geschäft.
In Sekundenschnelle raste er die Rampe hinauf und in den Lastwagen hinein.
Die verschreckten Schafe flüchteten aus dem Lastwagen, durchbrachen die Hürden und stoben in alle Richtungen.
Duncan Mackintosh packte den Hund wutentbrannt beim Wickel.
William, dem sein Erfolg zu Kopf gestiegen war, biß Duncan.
Duncan preßte sein Taschentuch auf die blutende Wunde an seiner Hand und verfluchte alles Englische, angefangen von Hunden bis zu Kindern. Gaylord ignorierte er geflissentlich.
Gaylord war ein wohlerzogenes Kind und erwartete daher auch Wohlerzogenheit von seinen Mitmenschen, im übrigen schätzte er es nicht, ignoriert zu werden. Andererseits mußte er zugeben – denn er hatte ein ausgesprochenes Gefühl für Gerechtigkeit –, daß er und William vielleicht nicht ganz so hilfreich wie sonst gewesen waren. «Können wir Ihnen helfen, die Schafe wieder einzufangen, Mr. Mackintosh?»
Mr. Mackintosh antwortete nicht. Er war ein schweigsamer, tüchtiger Mann, der auf bewunderungswürdige Weise mit den vielen Schwierigkeiten des Lebens fertig wurde; eine davon war, seine mutterlose, lahme achtjährige Tochter aufzuziehen. Aber den Engländern, stellte er resigniert fest, war er nicht gewachsen. Sie nahmen nichts wirklich wichtig, sie legten sich nie wirklich ins Zeug, aber das schwerste Kreuz, das die Briten ihm auferlegten, war, daß er nie wußte, wann sie einen Scherz machten. Er blickte auf seine Hand, nur ein kleiner Biß – aber schmerzhaft. Er blickte auf seine Schafe, die ihn verstört aus der Ferne beobachteten, die zierlichen Hufe zur Flucht bereit, die dümmlichen Augen vor Angst und Schrecken geweitet. Er blickte auf das Trent-Tal, das wie ein flacher Teller vor ihm lag, und dachte an die Grampian-Berge. O Kaledonien – düster und wild! Ach, dachte er, könnte ich nur nach Schottland zurückkehren. Und der heutige kleine Zwischenfall hatte diesen Wunsch vermutlich wieder um einiges verstärkt. Aber da gab es noch eine ungelöste Frage. Und die betraf Wendy Thompson, die Lehrerin seiner Tochter. Julia würde sie sehr vermissen. Und er? Wendy war ein anziehendes kleines Geschöpf, und er mochte sie gern. Aber – unentbehrlich war sie für ihn nicht. Duncan hielt niemanden für unentbehrlich, dazu war dieser muskulöse, grauhaarige, finster blickende Schotte viel zu unabhängig.
Zur gleichen Zeit war auf dem Flughafen Gatwick eine andere, aber nicht unähnliche Aktion im Gange, nur daß dort statt Schafen Passagiere zu Herden zusammengetrieben, durch Gänge gescheucht und schließlich in ein wartendes Flugzeug gepfercht wurden.
Angefangen hatte diese langwierige Prozedur am Check-in-Schalter, wo Miss Cranford die Passagierlisten überprüfte. Plötzlich stieß sie ein erstauntes «Oh!» aus.
Ihre Kollegin beugte sich über ihre Schulter und war enttäuscht, als der rotlackierte Fingernagel auf «Pentecost, J.» wies.
«Nie von ihm gehört», sagte sie.
«Der Autor! Ich wette, er ist schrecklich nett. Seine Bücher sind ganz reizend.»
«Nun, wenn er nicht bald hier ist, dann versäumt er das Flugzeug», sagte Miss Cranfords Kollegin achselzuckend. (Autoren interessierten sie nicht; wenn er ein Fernsehstar gewesen wäre – ja, dann …)
Jocelyn war tatsächlich verspätet. Die Vorbereitungen für den Flug RU 777 näherten sich ihrem Ende. Die Caravelle stand auf ihrer Position, gut versorgt mit Treibstoff sowie Essen, Zigaretten und Alkohol. Die Passagierliste war geprüft und wieder überprüft worden; die Besatzung hatte die Jacken angezogen und schlenderte nunmehr mit ihren Reisetaschen zum Flugzeug. Die Stewardess Patricia Lunn war bereits an Bord und vergewisserte sich, daß nichts fehlte. Der Einsteigetunnel kroch wie eine riesige, gierige Raupe auf das Flugzeug zu und heftete sich an. Der Lautsprecher verkündete: «Die Passagiere für den Flug RU 777 nach Zürich werden gebeten, sich zum Ausgang 19 zu begeben.»
«Wo bleiben Sie, Mr. Pentecost», murmelte seine Bewunderin und starrte besorgt in die leere große Halle. «Ich würde gern wissen, wie Sie aussehen!»
Aber kein Mr. Pentecost!
Die Besatzung der RU 777 führte ihre Routinekontrolle durch: Checken und Gegenchecken, während die Nadeln zitterten, die Lichter aufblitzten, die Funksignale funkten und der letzte Fluggast die Sicherheitskontrolle passierte. Der Lautsprecher krächzte noch einmal: «Letzter Aufruf für die Passagiere des Fluges RU 777 nach Zürich. Bitte begeben Sie sich umgehend zum Ausgang 19.» Ein letztes Gedrängel. Dann hob die Raupe den Kopf und schlängelte sich seitwärts fort.
«Nun, soviel für Mr. Jocelyn Pentecost», sagte seine Bewunderin am Check-in-Schalter und fügte ein wenig verachtungsvoll hinzu: «Er hat seinen Flug verpaßt, der Trottel.»
Jocelyn, der seit drei Stunden in der Autobahnwerkstatt auf der M 1 festsaß, wußte, daß er seinen Flug verpaßt hatte. Aber nicht nur das, er hatte auch die Party verpaßt, die seine Verleger zu Ehren seines neuen Romans heute abend gaben. Aber was half’s? Ihm blieb nichts anderes übrig, als wieder nach Hause zu fahren. Wenn … ja, wenn irgend jemand dieses magisch geheimnisvolle Ding – seinen Motor – wieder ins Leben zurückrufen könnte!
Er war zu sehr damit beschäftigt, sich mit Selbstvorwürfen zu überhäufen, um seine Enttäuschung voll auskosten zu können. Aber er war enttäuscht! Jahraus, jahrein schrieb er seine mittel-erfolgreichen Romane, eine einsame, ereignislose und oft recht unbefriedigende Arbeit. Und dann war diese Einladung aus dem Ausland gekommen – zu einer eigens für ihn gegebenen Party. Aber statt nun seinem Ziel entgegenzueilen, saß er hier im tiefsten Bedfordshire fest. Flugzeuge rauschten über seinen Kopf hinweg; Fernlaster rollten grollend an ihm vorbei; Autos schlängelten sich in einer endlosen Reihe südwärts; Schnellzüge rasten dahin, die mit Sicherheit in dreißig Minuten in London ankommen würden, während für ihn Zürich unerreichbar war. Und dann plötzlich hörte er ein Aufbrüllen, das in ein stetes, zufriedenes Schnurren überging. Der Mechaniker zog seinen Kopf unter der Motorhaube hervor und blieb lauschend stehen. Dann verzog sich sein Mund zu einem breiten Grinsen. «Das wär’s, Sir, die Karre ist wieder okay.»
«Vielen Dank, ich bin Ihnen wirklich sehr dankbar. Aber … woran hat es denn gelegen?» Jocelyn war es völlig egal, was an seinem Wagen kaputt gewesen war, und selbst wenn man es ihm erklärt hätte – er hätte es nicht begriffen. Aber es gehörte zu jenen Fragen, die ein Mann stellen mußte, wenn er nicht in den Verdacht kommen wollte, ein technischer Idiot zu sein. Der Mechaniker erging sich in ausführlichen Details. Jocelyn nickte und hörte nicht zu. Das Flugzeug würde in einer Stunde starten, aber er brauchte noch mindestens zwei Stunden bis Gatwick, selbst wenn ihn sein Wagen nicht ein zweites Mal im Stich lassen würde. (Er hegte ein tiefes Mißtrauen gegen alles Mechanische.) Und selbst mit einem späteren Flugzeug käme er nicht mehr rechtzeitig an. Er war fast krank vor Enttäuschung und Selbstverachtung, als er Zürich anrief und sich für sein Nichterscheinen entschuldigte. Er kehrte zur nächsten Kreuzung zurück, überquerte die Autobahnbrücke und fuhr nordwärts. Was für ein Narr er doch war! Warum hatte er nicht Mays Ratschlag befolgt und war früher aufgebrochen? Er hätte wissen müssen, daß irgend etwas mit dem Wagen schiefgehen konnte. Warum hatte er nie gelernt, einen Motor zu reparieren? Warum hatte er sich stets unter dem Vorwand seiner Arbeit vor allen praktischen Dingen gedrückt? Wirklich, er war hilflos wie ein neugeborenes Baby, völlig abhängig von May, Automechanikern, Klempnern, Elektrikern. Und nun hatte er auch noch seine Gastgeber in Schwierigkeiten gebracht, weil er heute abend die angekündigte Rede nicht halten konnte. Es war zu peinlich! Nein, das einzige, was er konnte, war das Bücherschreiben. Und sogar die waren nicht welterschütternd. Er wußte seit Jahren, daß er nie so erfolgreich wie Barbara Cartland oder so gut wie Graham Greene sein würde. Ja, nicht mal zu einem Interview im Fernsehen hatte er es gebracht.
Das Flugzeug nach Zürich rollte vorsichtig und bedächtig zur Startbahn, dort blieb es stehen (während der Kapitän – oder so stellt man es sich vor – tief Atem holte, sich bekreuzigte und seine Seele dem Allmächtigen empfahl, bevor er auf den Gashebel trat). Dann ging es los. Mit einem ohrenbetäubenden, markerschütternden Gedonner brauste die Maschine die Rollbahn entlang, schneller und immer schneller, bis die Erde plötzlich fortzuschwimmen schien: grün und lieblich im nachmittäglichen Sonnenschein. Und immer höher bohrte sich das Flugzeug in den Himmel und zerriß hier und da kleine Wolkenfetzen. Das bösartige Brüllen des Motors ging in ein friedliches Brummen über und schließlich in ein zufriedenes Schnurren. Sally Lunn griff nach dem Mikrofon: «Meine Damen und Herren, Sie können jetzt rauchen. Wir würden Ihnen jedoch empfehlen, während des ganzen Fluges angeschnallt zu bleiben …» Plötzlich schnürte ein harter Arm ihr die Kehle zu, riß ihren Kopf zurück und erwürgte sie fast. Ihre Beine wurden schwach, und sie dachte: Jetzt ist’s passiert. Gott steh uns bei!
Gaylord, dem es nicht gelungen war, jemanden zu finden, der seine Hilfe brauchte, schlenderte mit William am Flußufer entlang, in der Hoffnung, einen Wal oder eine Seejungfrau zu sehen, aber wie immer sah er nur Elritzen. Nicht einmal eine tote Katze. Das Leben war fade, einfach fade.
Mit einer Ausnahme: der Eremitenhöhle. Die Eremitenhöhle war alles andere als fad, Gaylord wurde ihrer nie überdrüssig. Sie war aus einer Sandsteinklippe gehauen und lauerte fern und einsam am Fluß. Sie gehörte nicht in unsere Zeit, sie schien jenseits aller Zeiten. Legenden umwoben sie: ein Ort voll Magie. Mummi mochte die Höhle nicht, aber das war typisch für Mummi. Kaum gefiel ihm, Gaylord, irgend etwas, schon war Mummi aus Prinzip dagegen. Oder so schien es ihm jedenfalls.
Aber da die Höhle auf Opas Land lag, hatte sie ihm den Zutritt nicht verboten. Opa und sein Verwalter Mackintosh verfolgten Eindringlinge sonst so unerbittlich, daß sogar der Präsident der Archäologischen Gesellschaft von Ingerby, der in aller Naivität die Höhle hatte erkunden wollen, mit knapper Not einer Schrotladung entkommen war.
Zur größten Beruhigung von May Pentecost übrigens, die sich sagte, daß Gaylord auf einem so scharf bewachten Besitz keinen unerwünschten Kumpanen begegnen würde.
Und so hatte die Höhle, abgesehen von allen anderen Vorzügen, noch den zusätzlichen Reiz, daß sie ein Ort war, den Mummi nicht mochte, aber auch nicht direkt gesperrt hatte. War es daher verwunderlich, daß Gaylord so oft wie möglich seine Freunde Henry Bartlett und Julia Mackintosh einlud, die Nachmittage dort zu verbringen, die unterirdischen Gänge zu erforschen, Steine in den Fluß zu werfen und sogar, wenn Henry und er in der Laune waren, Julia zu erlauben, einen nicht existierenden Tee in nicht existierende Tassen zu gießen?
Heute jedoch war er allein – und starr vor Staunen. Jemand hatte ein Feuer in der Höhle angezündet. Ein Haufen Holzasche war übriggeblieben – und noch warm!
Gaylord hielt es nicht für ausgeschlossen, daß der Geist des Eremiten das Feuer angezündet hatte. Aber wäre es dann noch warm? Wärme und Geister paßten irgendwie nicht zusammen. Er plagte sich noch mit diesem metaphysischen Problem ab, als er seinen Großvater am Flußufer erspähte. «Opa, warte mal!» Opa würde es ihm erklären können. Die Erwachsenen hatten auf alles eine Antwort.
Tatsächlich gab es eine ganz einfache Erklärung für das Feuer. Ein gewisser Evan Evans aus Aberystwith hatte es angezündet.
Es war eine traurige Geschichte. Er und die Seinen hatten in ihrer Heimat Wales vergebens ihr Glück versucht: Sein Sohn Ivor kaufte Schrottautos und verwandelte sie in neue oder doch wenigstens fahrtüchtige Wagen. Dai bastelte alte Fernseh- und Radiogeräte zurecht und verkaufte sie weiter. Lange pflegten sie allerdings nicht zu funktionieren. Mutter Evans veranstaltete Wohltätigkeitssammlungen im Namen der verschiedensten Organisationen. Der Inhalt ihrer Sammelbüchse kam allerdings ausschließlich ihr selber und der Familie zugute. Prosser und Robert hatten eine alte Teermaschine gekauft, mit der sie jedem Hausbesitzer, der sich darauf einließ, die Zufahrt asphaltierten.
Die wirtschaftliche Lage in Wales hatte die verschiedenen Geschäftszweige der Familie verdorren lassen. Evan Evans hatte ihnen jedoch wie einst Moses den Israeliten das gelobte Land verheißen, und so waren sie eines Tages mit Kind und Kegel, Schrottwagen und Teermaschine nach England aufgebrochen.
Aber auch hier machte sich die Rezession bemerkbar. Es fiel kein Manna vom Himmel, sondern der kalte Regen des Herbstes. Und so war Evan Evans auf der Suche nach einer Unterkunft für den Winter in der Umgebung von Ingerby auf die Höhle gestoßen. Er war es leid, in einem Schrottwagen die kalten Nächte zu verbringen. Hier in der Höhle konnte er nach Belieben die Beine ausstrecken, und Brennholz fand sich in der Umgebung noch für viele Winter.
«Opa, warte mal!» Es war sinnlos, so zu tun, als hätte er diesen Ruf nicht gehört. Der alte Mann wußte aus Erfahrung, daß er in dieser Situation das gestellte Wild und sein Enkel der siegreiche Löwe war. Er dachte ärgerlich: Man kann diesem Gaylord einfach nicht entkommen. Und ein Mann seines Alters hatte schließlich doch das Recht, in seine eigenen Erinnerungen versunken, ungestört den Fluß entlangzugehen. Ein Mann, der siebzig wurde, brauchte Einsamkeit, Zeit zu meditieren. Aber war dies möglich mit einem Jungen wie Gaylord in der Familie? Wohl kaum, dachte er voller Grimm.
Gaylord holte ihn ein, ging neben ihm her und grinste ihn vergnügt an. «War das nicht ein Glück, daß ich dich gesehen habe? Eine Minute später, und du wärst weg gewesen.»
«Glück für wen?» fragte John Pentecost.
«Für uns beide natürlich.»
«Natürlich», wiederholte John.
Gaylord sagte aufgeregt: «Jemand hat ein Feuer in der Eremitenhöhle angezündet.»
Zu Gaylords großer Enttäuschung geriet Opa nicht in Harnisch. Dem alten Herrn gingen wichtigere Dinge durch den Kopf. So, jemand hatte also ohne seine Genehmigung sein Land betreten. Na und? Es würde nicht mehr lange sein Land sein. Doch dann durchfuhr ihn plötzlich ein anderer Gedanke: O Gott, ich fang an, die Dinge treiben zu lassen. Noch vor sechs Monaten hätte ich zur Flinte gegriffen, und wehe dem Kerl …
Gaylord versuchte, seinen Großvater aufzustacheln. «Meinst du, der Geist des Eremiten hat das Feuer angezündet?»
«Sehr gut möglich», erwiderte Opa und stapfte weiter. Unter dem blauen Herbsthimmel schienen die Bäume in Flammen zu stehen. Herbst, dachte er. Und mein Herbst. Mein Herbst? fragte er sich. Nein, mein Herbst ist längst vergangen. Für mich, statistisch gesehen, ist es dunkler Januar. Ein Winter ohne Frühjahr. Seit wann bin ich so melancholisch? dachte er.
Gaylord blickte fragend zu ihm auf. «Opa?»
«Ja, was?»
«Opa, was heißt zelebrieren?»
War er etwa ein verdammtes wandelndes Lexikon? Wo er sich nichts mehr wünschte, als in Ruhe über Dinge wie Leben, Tod, Himmel und Hölle nachzudenken. «Zelebrieren heißt, irgendeine Gelegenheit feierlich zu begehen.»
Gaylord brauchte eine ganze Weile, um diese Erklärung in sich einsinken zu lassen. Schließlich sagte er empört: «Dann versteh ich aber nicht, warum Mummi und Paps davon reden, daß sie deinen siebzigsten Geburtstag zelebrieren wollen. Das bedeutet doch, daß du so gut wie tot bist, nicht?»
«Nein, zum Teufel, das bedeutet es nicht!» schnaubte sein Großvater. Es war schon schlimm genug, sich selbst halb eingestehen zu müssen, daß alle Statistiken gegen einen sprachen, aber daß andere ähnliche Ideen hatten, darauf wäre er allerdings nie gekommen. Besonders da er sich keinen Tag älter als fünfzig fühlte und auch um keinen Tag älter aussah, versicherte er sich selbst.
Gaylord sagte: «Aber so steht’s in der Bibel. In der Bibel heißt es: ‹Die Fülle unserer Jahre ist siebzig.› Glaub’s mir, Opa.»
«Red nicht so geschwollen daher.»
«Was heißt: geschwollen?»
John Pentecost ging schweigend weiter. Das milde Sonnenlicht fiel schräg durch die Bäume, das dichte Laubwerk leuchtete, und er stand mit beiden Füßen fest auf seiner englischen Erde. Er versetzte dem rostfarbenen Farnkraut einen zornigen Hieb mit dem Stock. Sein Kopf steckte nicht voller poetischer Flausen wie der seines Sohnes. Er wußte genau, was ihm gefiel: jede Art von Wetter, kräftiges Essen, gute Weine, die vier Jahreszeiten, die Gemütlichkeit vor einem Kaminfeuer, aber vor allem liebte er es, allein sein kleines Reich abzuschreiten mit der Sonne oder dem Regen im Gesicht, und die Kraft und den Segen der Erde unter seinen Füßen zu spüren. Konnte einem Mann all dies fortgenommen werden? Ja. Es konnte. Und es würde ihm eines Tages fortgenommen werden. Plötzlich – das Verlöschen einer Kerze; das Zurücklassen all der schönen Gottesgaben, die die anderen vielleicht nie zu schätzen lernen würden und die sie vielleicht nicht einmal verdienten.
Ausnahmsweise wiederholte Gaylord diesmal nicht seine Frage, aus dem einfachen Grund, weil er das Wort vergessen hatte. Und so wanderten seine jungen Gedanken vergnüglichere Pfade entlang.
«Ich wette, Gott wird sich freuen, dich zu sehen, Opa», sagte er. Soweit er es beurteilen konnte, hatte Opa mit Gott vieles gemein, und sie mußten auch ungefähr gleichaltrig sein.
Aber nun riß dem alten Herrn der Geduldsfaden, er stieß seinen schweren Stock wütend in die Erde. «Zum Teufel, noch bin ich ja nicht tot.»
Gaylord war tief verletzt. Natürlich war Opa nicht tot – noch nicht. Er, Gaylord, wußte alles über Tote. Schließlich hatte er seinen Hund Schultz gesehen und Großtante Marigold.
«Abgesehen davon, bin ich gar nicht so sicher, ob sich Gott freuen würde, mich zu sehen», fügte der alte Mann müde hinzu.
Gaylord war fassungslos. «Ja, warum denn nicht? Hast du mal etwas Schlimmes angerichtet?»
«Ich glaube nicht, aber sehr viel Gutes habe ich auch nicht getan.»
Gaylord fiel auf, daß sein Großvater etwas wehmütig klang, und einen Augenblick fragte er sich sogar, ob irgend etwas, das er gesagt hatte, schuld daran sei. Doch da er freundlich von Natur war, beschloß er, seinen Großvater aufzuheitern. Sicher hatte Opa irgend etwas getan, das Gott gefallen hatte. Aber was? Ah – natürlich! «Du hast Paps gezeugt, und Paps hat mich gezeugt.» Er strahlte vor Selbstzufriedenheit und hielt es durchaus für möglich, daß sein Großvater für diese Leistung eine goldene Krone erhalten würde.
«Und du meinst, das spricht zu meinen Gunsten?»
«Bestimmt», sagte Gaylord. «Schließlich werden eine Menge Leute in der Bibel namentlich erwähnt, nur weil sie irgend jemanden gezeugt haben.»
Eine abendliche Brise kräuselte den seidigen Fluß. Die trockenen Blätter knisterten und raschelten. Die Sonnenstrahlen hatten sich jetzt auf Augenhöhe gesenkt, die Baumstämme wirkten wie Stäbe vor einem erleuchteten Fenster. Die Welt war ein heiterer heller Raum. John Pentecost betrachtete sie durch die Stäbe. Er stand davor und blickte hinein und schaute zu, wie ein weiterer Tag langsam dahinstarb.
«Opa?» sagte Gaylord.
«Ja?» klang es überdrüssig zurück.
«Opa? Wie zeugt man eigentlich?»
Der alte Mann stand unbeweglich im goldenen Licht der sinkenden Sonne. Er hakte die Krücke seines Stocks um Gaylords Hals. «Komm jetzt nach Hause, vielen Dank für deine Begleitung», brummte er mürrisch. Im stillen jedoch sagte er sich, daß er ohne dieses lästige Geplauder womöglich in Selbstmitleid verfallen wäre, und das ging natürlich nicht an. Gaylord war erleichtert. Er hatte sich nämlich schon ernstlich gefragt, ob Großvater über seine Begleitung wirklich so froh war, wie man hätte annehmen sollen.
2
May Pentecost war eine heitere und tüchtige Frau. Sie führte ruhig und umsichtig ihren großen Haushalt, bändigte ihren störrischen Schwiegervater mit sanfter Hand und hatte ein stets wachsames Auge auf ihre zwei Kinder und ihren meist etwas zerstreuten Mann.
Doch diese scheinbar so ausgeglichene Frau litt unter einer geheimen Angst – einer Angst, die sie mit vielen Ehefrauen teilte –, nur daß sie bei ihr tiefer saß, an die Wurzeln ihres Wesens rührte. May Pentecost hatte Angst, ihren Mann Jocelyn durch irgendeinen Unglücksfall zu verlieren. Ihre Liebe zu ihrem Mann, über die Jahre durch Verständnis und gegenseitigen Respekt gefestigt, war zum Angelpunkt ihres Lebens geworden, was nicht heißen soll, daß sie blind für seine Fehler war, aber sie wußte auch seine Tugenden zu schätzen. Sie machte sich zuweilen über ihn lustig, brachte ihn auf Trab, bemutterte ihn, doch vor allem liebte sie ihn. Das einzige an ihm, was sie immer wieder aufs neue in Schrecken versetzte, war seine Sterblichkeit.
An den meisten Tagen wurde diese Angst durch die beruhigende Gewißheit gemildert, daß Jocelyn in der Sicherheit seines Arbeitszimmers saß oder in nächstem Umkreis durch die friedliche Landschaft wanderte. Aber nicht so heute. Heute war er der hastenden, rücksichtslosen Welt der achtziger Jahre ausgesetzt. Während sie in der Küche stand, nahm er an dem wilden Ben-Hur-Wagenrennen auf der M 1 teil. Während sie erdgebunden blieb, schwebte er am Himmel – nur die Luft zwischen sich und den kalten Wassern des Ärmelkanals. Allein die Vorstellung, daß ein so zerfahrener Mensch wie er seinen Weg von dem entlegenen Derbyshire zu einem Hotel in Zürich finden mußte, machte ihr das Herz schwer.
Sie zählte sich alle tröstenden Statistiken auf: daß es sicherer war, in einem Flugzeug zu sitzen, als ins Nachbardorf zu fahren; daß die Unfallquote auf der M 1 berühmt niedrig war; daß der Herrgott die Winde besänftigt, um hilflose Lämmer wie Jocelyn zu schützen. Es half alles nichts. Sie wollte ihren Jocelyn in Reichweite haben, um jederzeit nachprüfen zu können, daß er noch atmete.
Ärgerlich mit sich selbst, stellte sie das Radio an, es war vier Uhr, und irgendein Theaterstück wurde gesendet. Ungeduldig drehte sie das Radio wieder ab. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund hatte sie geglaubt, daß stündlich Nachrichten durchgegeben würden. Und überhaupt, was hatte sie eigentlich erwartet. Einzelne Unfälle auf der M 1 wurden nie durchgegeben. Sie mußte einfach auf die Sechs-Uhr-Nachrichten warten, die sie und Jocelyn immer gemeinsam bei einem Glas Sherry anhörten. Das würde auch ihrer Selbstachtung guttun.
Aber um fünf Uhr, Selbstachtung hin oder her, schaltete sie das Radio wieder an. Man weiß ja nie, dachte sie, wohl wissend, daß sie sich töricht benahm. Sie beschloß, um sich zu beruhigen, Jocelyns Socken zu stopfen.
4 Uhr 57, sie setzte sich hin, fädelte einen Faden ein und machte sich an die erste Socke. Eine häuslichere Beschäftigung konnte man sich kaum vorstellen, und dennoch war ihr Mund trocken, und ihr Herz klopfte. Zu albern!
Dann erklangen die Fanfaren der Fünf-Uhr-Nachrichten, gefolgt von der Programmvorschau bis sechs Uhr. «Aber zuerst die Nachrichten.»
Das übliche weltweite Chaos, Katastrophenmeldungen, aber natürlich keine solchen Nichtigkeiten, wie sie ihrem geliebten Jocelyn zustoßen könnten. Kriege, die Tausende von Menschen vernichteten, Hungersnöte, die Millionen von Opfern forderten. Haß, der die Erde entweihte, aber nichts, was Jocelyn betraf. Nichts, was den steten Rhythmus von Mays Nadel und Faden stören konnte.
Und dann, ganz zum Schluß, als sie bereits über ihre unsinnigen Ängste lächelte: «Eben erhalten wir die Nachricht, daß die Funkverbindung mit einer Maschine, die sich auf dem Weg von Gatwick nach Zürich befindet, unterbrochen ist. Die Maschine startete plangemäß um vier Uhr. Aber um 4 Uhr 10 brach aus bislang noch nicht bekannten Ursachen die Funkverbindung ab. Die Maschine sollte um 5 Uhr 30 in Zürich landen. Sobald weitere Informationen eintreffen, schalten wir uns ins laufende Programm ein.»
Ja, war das denn möglich! Jocelyn sollte um vier Uhr abfliegen und um 5 Uhr 30 in Zürich ankommen. Sie sprang auf und warf ihre Stopfarbeit auf den Tisch. Sie mußte etwas tun, mehr herausfinden, jemanden anrufen. Aber wen? Die Polizei? Aber woher sollte die Polizei mehr wissen als sie? Gatwick? Die hatten genug um die Ohren. Sie durfte nicht anderer Leute Zeit vergeuden – das keinesfalls.
Sie zitterte am ganzen Körper. Es konnte nicht wahr sein. Es gab zahllose Menschen, die täglich, wöchentlich, seit Jahren in der Welt herumflogen und denen nie etwas passierte. Jocelyn konnte nicht bei seinem ersten Flug abgestürzt sein. Es wäre zu ungerecht.
Da sie eine vernünftige Frau war, wurde ihr bald klar, daß es nur eine Möglichkeit gab, Näheres herauszufinden: nämlich sich ruhig hinzusetzen und Radio zu hören.
Und so saß sie vor dem billigen kleinen Kofferradio, von dessen krächzender Stimme ihr ganzes Glück abhing. Und plötzlich beschlich sie eine andere, vernunftswidrige Angst: Was wäre, wenn nun ihr Schwiegervater oder Gaylord gerade in dem Moment ins Zimmer gestürzt kämen, wenn eine neue Meldung durchgegeben würde und sie nichts verstehen könnte? Sie mußte etwas unternehmen. Sie schlich auf Zehenspitzen zur Tür und schloß sie ab, dann setzte sie sich wieder hin und wartete.
Das Übliche: Interviews mit Gewerkschaftsführern, mit Politikern, mit Wirtschaftsexperten. Eine allgemeine Rundschau, die Arbeitslosen, Demonstrationen, lauter Dinge, an denen sie gestern noch brennend interessiert gewesen wäre, die ihr aber jetzt fast den Schrei entlockt hätten: Schweigt schon! Sagt mir, was ich wissen will!
Einem – ihrem – Mann war in dieser Welt der Katastrophen, unter denen Millionen litten, etwas zugestoßen, aber die Millionen waren ihr im Augenblick gleichgültig, denn nur er zählte für sie.
In den Kurznachrichten um 5 Uhr 30 hieß es nur: «Wir haben noch keine weiteren Informationen über die Maschine von Gatwick nach Zürich, mit der zehn Minuten nach dem Start die Funkverbindung abriß. Eine Luft- und See-Rettungsaktion ist bereits eingeleitet.»
Das schloß alle Zweifel aus. Die zuständigen Stellen glaubten offenbar nicht an ein technisches Versagen. Schiffe, Flugzeuge und Helikopter suchten bereits die grausame See nach Jocelyn ab. Nach Jocelyn, der seinen Alltag damit zubrachte, still in seinem Kämmerchen Romane zu schreiben. So einem Mann konnte doch nichts so Dramatisches zustoßen – oder doch?
Äußerlich blieb sie ruhig; sogar in dieser Krise, in ihrer einsamen Verzweiflung, war ein Gefühlsausbruch für sie etwas Undenkbares.
Um 5 Uhr 45 betete sie zu ihrem anglikanischen Gott: «O Allmächtiger, bitte laß sie ansagen, daß die Maschine einen Radiodefekt hatte, aber in Zürich gelandet ist.»
Aber keine solche Ansage erfolgte. Sie wartete unruhig im Zimmer auf und ab gehend. Um sechs Uhr war das vermißte Flugzeug die Sensation des Tages. Es war nicht in Zürich gelandet, und auch Funksprüche waren nicht aufgefangen worden. Es bestünde jedoch die Möglichkeit, daß es irgendwo zur Landung gezwungen worden sei. Jedenfalls wäre es voreilig, einen Absturz anzunehmen. Für die Angehörigen wäre eine Vermittlungsstelle eingerichtet worden, die Nummer sei die folgende … Der Sprecher ging zur nächsten Nachricht über.
Eine Telefonnummer! Wenigstens das! Anrufen konnte keinesfalls schaden. Vielleicht waren neue Nachrichten eingetroffen. Sie hatte sich die Nummer notiert. Sie ergriff den Zettel und lief in die Halle.
Jocelyn fuhr in trübseliger Stimmung heimwärts. Er sah auf die Autouhr. 5 Uhr 40. Wäre er nicht so ein Narr, würde sich ihm jetzt eine fremde, unbekannte, aufregende Stadt eröffnen. Statt dessen kehrte er in die flachen alltäglichen Midlands zurück.
Oh, natürlich würde es May ehrlich leid tun, daß er sein Festessen mit allem Drum und Dran versäumt hatte. Aber ein kleines mokantes Lächeln würde sie sich nicht verkneifen können. Sie hätte ihm ja angeraten, zwei oder drei Stunden früher loszufahren, aber er, Jocelyn, hätte es ja besser gewußt.
Und sein Vater – er würde nicht einmal versuchen, seine Verachtung zu verbergen. Armer alter Jocelyn! Von A nach B zu gelangen, das bringt er einfach nicht fertig, aber was anderes kann man erwarten von einem Mann, der in einem Wolkenkuckucksheim lebt. Und Gaylord? Gaylord würde aus dem Häuschen sein. Katastrophen jeder Art waren für ihn wie Manna. Er würde jede Einzelheit wissen wollen.
Und hier waren sie, direkt vor ihm – sein Vater, sein Sohn und William, der Hund, gemeinsam trotteten sie die Flußstraße entlang. Er verminderte das Tempo. Gaylord drehte sich um und rief strahlend: «Paps! Opa, es ist Paps!» Er lief auf den Wagen zu. «Paps, streiken die Flugzeuge?»
«Nein, aber mein Auto hat auf der M 1 gestreikt.»
John Pentecost sah seinen Sohn erstaunt an. «Ich dachte, du würdest in zwei Stunden in Berlin oder sonstwo eine Rede halten?»
«Zürich – um präzise zu sein. Ich habe gerade Gaylord gesagt, daß mein Wagen eine Panne hatte.»
«Ach so. Jetzt scheint er mir aber ganz in Ordnung zu sein.»
«Die Reparaturwerkstatt hat drei Stunden gebraucht, um ihn wieder in Gang zu bringen. Und danach –» er seufzte – «wäre es sinnlos gewesen, nach Gatwick zu fahren. Wollt ihr nicht einsteigen?»
Es dauerte fünf Minuten, um William die Grundregeln für das Besteigen eines Autos zu erklären, und als er endlich drin war, dauerte es weitere fünf Minuten, um ihn zu überreden, den anderen Platz zu machen.
Jocelyn hielt vor der Haustür, zutiefst deprimiert. Er überließ es seinem Vater und Gaylord, William aus dem Wagen zu locken. Er selbst ging gesenkten Hauptes ins Haus.
May lief durch die Halle zum Telefon, griff nach dem Hörer und murmelte wie eine Irre die Telefonnummer vor sich hin.
Die Haustür sprang auf, und Jocelyn kam herein; Jocelyn, groß und schlaksig, aber unverkennbar Jocelyn, trotz des ungewohnten dunkelblauen Anzugs, der seine übliche Tweedjacke und die grauen Hosen ersetzt hatte.
May tat etwas für sie höchst Unerwartetes, etwas, worüber sie selbst äußerst erstaunt war: Sie stieß einen Schrei aus – einen schrillen, spitzen Schrei. Danach wippte sie auf ihren Hacken, starrte ihren Mann an mit offenem Mund und ungläubigen Augen, so als sei er ein aus dem Jenseits Zurückgekehrter. Gaylord hörte den Schrei, und das köstliche Gefühl einer bevorstehenden Katastrophe durchrieselte ihn. Er überließ William seinem Großvater und raste ins Haus. «Mummi! Was hast du …? Was ist los?» Er war eher enttäuscht, als er sah, daß seine Eltern sich wortlos mit starren Blicken gegenüberstanden. Dann aber lief seine Mutter auf Paps zu und schlang ihre Arme um seinen Hals (das war schon etwas vielversprechender), preßte ihr Gesicht gegen seine Brust und weinte herzzerbrechend, während sich ihre Finger in seinen Rücken verkrallten.
«May? Ist dir nicht gut? Oder ist irgendwas Schreckliches passiert?» fragte Jocelyn beunruhigt. Nur ein grausamer Schicksalsschlag konnte seine sonst so beherrschte Frau in diesen aufgelösten Zustand versetzen. «Ist was … mit Amanda?»
Sie löste sich von ihm, um in sein Gesicht zu sehen. «Aber nein, du Idiot. Es geht um dein Flugzeug. Oh, Jocelyn, wie kannst du nur so gleichmütig sein? Wieso bist du hier? Du warst doch für den Flug gebucht.»
«William hat Mr. Mackintosh gebissen», sagte Gaylord. Niemand beachtete ihn.
«Flugzeug?» fragte Jocelyn verwirrt. «Was ist damit?»
«Und jemand hat in der Eremitenhöhle ein Feuer angezündet», sagte Gaylord.
Aber auch seine zweite Bombe schlug nicht ein. Typisch, dachte er, kaum spricht man mit Erwachsenen, ist aus der dramatischsten Situation der Dampf raus. Doch dann horchte er auf, denn Mummi sagte: «Heißt das etwa … ich meine … du weißt nichts? Hast du nicht gehört …?» Sogar May in dieser emotionsgeladenen Situation empfand eine leise Genugtuung, daß sie die einzige war, die von dem Drama Kenntnis hatte. «Liebling, es ist verschwunden, die Funkverbindung brach zehn Minuten nach dem Start ab. Hast … hast du das wirklich nicht gewußt?»
Das war eine Sensation, die Gaylords kühnste Träume weit übertraf. «Ich wette, es ist ins Meer gestürzt. Ich wette …» Er vollführte mit der linken Hand eine sturzflugartige Bewegung, die er mit einem lauten, schrillen Klageschrei begleitete.
Jocelyn fuhr ihn barsch an. «Genug, Gaylord, geh raus und spiel.» Dann befreite er sich aus den Armen seiner Frau und ging ins Wohnzimmer. «Komm hierher!» befahl er. (Jocelyn befahl!)
Sie folgte ihm. Er stand am Fenster mit dem Rücken zum Zimmer und starrte auf den Rasen und die dämmerige Landschaft. «Erzähl schon, was du weißt», sagte er. «Von Anfang an.»
Sie berichtete kurz, dann ging sie zu ihm, stellte sich hinter ihn und schlang ihre Arme liebevoll um seinen Hals. «Aber Hauptsache, du bist hier», sagte sie. «Hier und am Leben.» Ihre Stimme brach. «Oh, ja, ich weiß, es klingt herzlos, was ich sage, aber nur du bist mir wichtig.»
Er starrte noch immer durch das Fenster. «Wann kommen die nächsten Meldungen?» fragte er.
«Um sieben.» Wie merkwürdig kühl und reserviert er ist. Normalerweise wäre sie beunruhigt, besorgt gewesen und hätte nicht eher geruht, bis sie diesen Gefühlsumschwung bei ihm verstanden hätte. Aber er lebte, er war an ihrer Seite, in Sicherheit. Nur das zählte.
Er blickte auf seine Uhr. «Bist du sicher, es gibt keine Nachrichten um 6 Uhr 30?»
«Absolut.» Sie fühlte sich plötzlich schwerelos. Jocelyn war zurück und gesund, und solange das so blieb, würde sie nie wieder über etwas klagen. «Komm, setz dich hin und entspann dich, und laß uns einen Sherry trinken. Ich hab mir meinen verdient.» Sie hatte noch immer die Arme um ihn geschlungen, als wage sie nicht, ihn loszulassen, ihre Finger berührten sein Gesicht und streichelten seine Wangen. Sie versuchte, ihn sanft zu einem Stuhl zu geleiten, aber er blieb unbeweglich stehen und starrte in die sinkende Dämmerung.
«Vielleicht wäre ich jetzt tot», sagte er tonlos.
«Aber du bist es nicht, Gott sei Dank.»
«Mein Wagen hatte eine Panne», sagte er. «Ein kaputter Draht, ein wenig Schmutz – irgend so was. Und das rettet einem dann das Leben.»
Sie zwang sich, ihn loszulassen, und schenkte den Sherry ein. Er rührte sich nicht. «Warum?» fragte er.
«Warum was, Liebling?»
«Warum dieser vielleicht rettende Zufall?»
Sie war plötzlich auf der Hut, ein sechster Sinn sagte ihr, daß dies ein Moment war, in dem sie unbedingt das Richtige sagen mußte. May wußte immer, wenn irgendein Familienmitglied ihre Hilfe brauchte. Sie sagte: «Das werden wir nie erfahren. Komm, setz dich, Liebling.»
Er ließ sich von ihr zum Sofa führen; und sie behielt seine Hand in der ihren. Dann sagte sie, um ihn von seinen düsteren Gedanken abzulenken: «Ich habe lange über das Menü für den Geburtstag deines Vaters nachgedacht. Ich möchte es ihm so schön wie möglich machen. Es ist schließlich ein großer Tag für ihn. Und ich habe den alten Knaben ehrlich gern.»
Er blickte auf seine Uhr.
«Willst du nicht meine Vorschläge hören?»
«Ja», sagte er wie aus weiter Ferne. «Ja, vielen Dank, May. Was haben sie noch gleich über das Flugzeug gesagt?»
«Daß es unauffindbar ist, eine Rettungsaktion ist eingeleitet.»
«O Gott», sagte er schaudernd, dann leerte er hastig sein Glas und hielt es ihr zum Auffüllen hin. «Was hast du gerade über meinen Vater gesagt?» fragte er wie jemand, der sich an einen Traum erinnert.