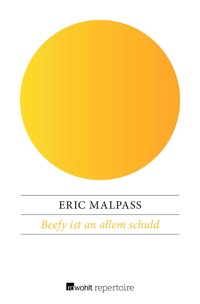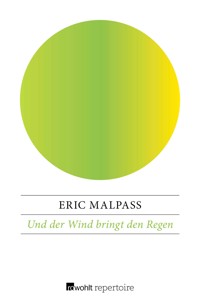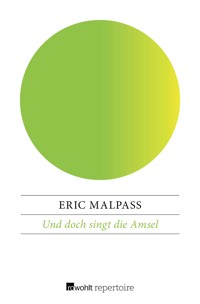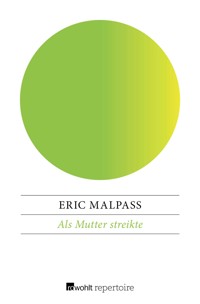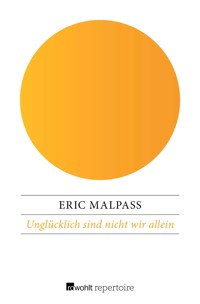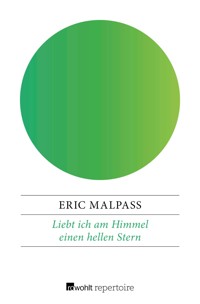
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Shakespeare-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Eric Malpass erzählt mit menschlicher Wärme, großem Einfühlungsvermögen und historischer Genauigkeit die bewegende Geschichte einer großen Liebe: der tiefen und mitreißenden Beziehung William Shakespeares zu Anne Hathaway, einer jungen Frau von sanfter, ländlicher Schönheit. Wir nehmen teil an Shakespeares glanzvollem Aufstieg zum berühmten Künstler in der brodelnden englischen Metropole und werden auf unterhaltsam-lehrreiche Weise Zeugen einer versunkenen und doch in Shakespeare bis heute lebendigen Epoche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Eric Malpass
Liebt ich am Himmel einen hellen Stern
Ein Roman um William Shakespeare und Anne Hathaway
Aus dem Englischen von Susanne Lepsius
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Eric Malpass erzählt mit menschlicher Wärme, großem Einfühlungsvermögen und historischer Genauigkeit die bewegende Geschichte einer großen Liebe: der tiefen und mitreißenden Beziehung William Shakespeares zu Anne Hathaway, einer jungen Frau von sanfter, ländlicher Schönheit. Wir nehmen teil an Shakespeares glanzvollem Aufstieg zum berühmten Künstler in der brodelnden englischen Metropole und werden auf unterhaltsam-lehrreiche Weise Zeugen einer versunkenen und doch in Shakespeare bis heute lebendigen Epoche.
Über Eric Malpass
Eric Malpass (1910–1996) hat in seinem Heimatland Großbritannien lange Jahre als Bankangestellter gearbeitet. 1947 wurde er Mitarbeiter der BBC, außerdem schrieb er für diverse Zeitungen. Er verfasste zahlreiche Romane und lebte als freier Schriftsteller in Long Eton, nahe Nottingham.
Inhaltsübersicht
Der Titel der deutschen Ausgabe und die Kapitelüberschriften sind Zitate aus Werken von William Shakespeare
Für John und Nicky
Gleichviel ja wär’s,
Liebt ich am Himmel einen hellen Stern
Und wünscht ihn zum Gemahl; er steht
so hoch.
An seinem hellen Glanz und lichten Strahl
Freun darf ich mich, in seiner Sphäre nie.
William Shakespeare
Ende gut, alles gut
1 Und als ich ein winzig Bübchen war …
Draußen schimmerte alles silbern. Die Dächer der kleinen Stadt glänzten im Mondlicht wie funkelnde Diamanten. Glitzernd floß unter den silbrigen Weiden der Avon dahin. Über den Feldern lag eine silberweiße Decke, die der Aprilfrost gewoben hatte.
Drinnen, im Wohnzimmer des Hauses in der Henley Street, glänzte goldener Kerzenschein auf dem Ahnenbild an der dunkel getäfelten Wand. Das gleiche warme Licht fiel auf die breiten Hände, die vollen Wangen und den kugelrunden kahlen Kopf John Shakespeares.
Er saß allein vor dem verglimmenden Feuer. Er hatte ein bescheidenes Maß gezuckerten Südweins getrunken, um das glückliche Ereignis zu feiern. Ein Sohn war ihm geboren! Nach sechs Jahren Ehe hatte er einen Sohn, einen Sohn, der einmal das Geschäft weiterführen konnte. Nun würde der Name Shakespeare in Stratford wohl doch nicht in Vergessenheit geraten, wenn er einst nicht mehr lebte. Er war tief bewegt. «William Shakespeare, Handschuhmacher für den Adel», sagte er leise vor sich hin. Und in Gedanken sah er draußen an der Tür das gediegene braune Holzschild mit der Inschrift in Gold. «Handschuhmacher für den Adel».
Er stand auf. Gern hätte er noch einen zweiten Becher Wein getrunken. Aber er widerstand der Versuchung. Er war ein Mann von starkem Ehrgeiz und einem ebenso starken Willen, und gezuckerter Wein würde ihm auf dem Weg, den er vor sich sah, nicht weiterhelfen.
Es war Zeit, ins Bett zu gehen. Er nahm den Leuchter. Die Schatten schwankten wie ein Schiff im Sturm. Er ging nach oben, wo Mary Shakespeare, geborene Arden, in dem großen Ehebett lag und ihren Sohn in den Armen hielt.
Es war ein schöner, sonniger Frühlingstag gewesen. Weiße Sommerwolken hatten sich am Himmel gejagt. Sie waren am Abend einer klaren Frostnacht gewichen. Aber die traurigen Wintermonate, die Zeit des Pökelfleischs, der bitteren Kälte, der dunklen Tage und des Skorbuts – all das war nun vorüber, und man konnte sich auf Wärme und Sonnenschein freuen. Außerdem brauchte man sich in den kommenden Wochen nicht vor der Pest zu fürchten. Der April war ein schöner Monat, selbst wenn verspäteter Frost alles mit Flittersilber bedeckte.
Elisabeth Tudor, die bleichwangige Tochter Heinrichs VIII., saß auf dem Thron der Macht. Und niemand würde sie von dort vertreiben! So bleichwangig sie auch sein mochte, wenn Elisabeth die Stirn runzelte, erblaßten die mächtigsten Männer. Jedenfalls sagten das alle, dachte Mary Shakespeare. Die Vorstellung, daß eine Frau auf dem Thron saß, gefiel ihr, zumal sie insgeheim fest glaubte, daß die meisten Frauen mehr Verstand im kleinen Finger hatten als die meisten Männer in ihren großen Köpfen. Aber der kleine Will würde anders sein als die meisten Männer! Ihr süßer kleiner Will, der jetzt, satt und schläfrig von der Milch aus ihrer Brust, mit seinen dunklen Augen auf die Bettvorhänge blickte. Er würde einst ein freier Bauer sein. Sie sah ihn über seine eigenen Felder schreiten, hier in der Grafschaft Warwick, und schnurgerade Furchen durch das Herz von England pflügen. Er war ein Arden, er hatte das Blut ihrer Vorfahren in den Adern. Er würde mit beiden Füßen fest auf englischer Erde stehen, wenn sie und John längst zu Staub geworden waren. William Shakespeare, ein freier Bauer.
Der kleine Will hatte die winzigen Händchen zur Faust geballt, und seine Augen waren ihm zugefallen. Mary ließ ihre Lippen über den schwarzen, flaumigen Kopf gleiten. Sie war stolz auf ihren Sohn und von zärtlicher Liebe zu ihm erfüllt. Sie, Mary Shakespeare, hat dieses wunderbare kleine Geschöpf zur Welt gebracht. Geduldig und mit Schmerzen hatte sie ihm das Leben geschenkt. «Mein süßer kleiner Will», murmelte sie, und wieder berührte sie sein weiches Haar mit ihren Lippen.
Sie war eine stille, heitere Frau und liebte ihren Mann. Freilich hatte sie, die aus einer der ältesten Landadelsfamilien der Grafschaft stammte, unter ihrem Stand geheiratet, als sie einen Kaufmann ehelichte. John Shakespeare war gewiß ein tüchtiger Geschäftsmann. Er war ein angesehener Bierschmecker und ein von allen geachteter Stadtkämmerer. Er war gewitzt und klug. Aber er hatte nicht wie Mary einen Edelmann zum Vater gehabt.
Mary war stolz auf ihren Vater, so stolz wie auf ihren kleinen Sohn, den sie jetzt an sich drückte. Ja, er würde ein freier Bauer werden!
Die Eichenbohlen der Treppe knarrten. John kam herauf.
Oben angelangt, würde er stehenbleiben und die Kerze ausblasen. Sie wußte es im voraus, sie kannte die Zeremonie. Dann würde er den Riegel heben, die Tür würde sich quietschend öffnen und John würde eintreten. Wortlos würde er Wasser aus dem Krug in die Schüssel gießen und sich sein Gesicht waschen. Schließlich würde er ans Bett treten und zu ihr herunterblicken. «Nun, Frau?» würde er sagen.
Die Schritte hielten auf dem Treppenabsatz inne, der Riegel sprang auf, die Tür öffnete sich, John trat ein, goß Wasser in die Schüssel und benetzte sein Gesicht, trat dann ans Bett heran und blickte zu ihr herunter. «Nun, Frau?» sagte er. Aber heute abend lächelte er.
«Nun, Mann?» Auch sie lächelte. Es war ein stolzes, strahlendes Lächeln. Sie war erschöpft und köstlich ermattet, aber ihre Augen leuchteten triumphierend: nach sechs Jahren vergeblichen Wartens hatte sie der Welt einen Mann geschenkt.
Der Vater blickte auf seinen Sohn.
Der kleine Will verzog im Schlaf das Gesichtchen, und seine winzigen Ärmchen zuckten wie im Schmerz. Aber dann lag er wieder zufrieden da. John Shakespeare legte seinen breiten Daumen in das vollkommen geformte Händchen, und die kleinen Fingerchen umschlossen ihn vertrauensvoll. John war gerührt. Wie seltsam, sich vorzustellen, daß diese Händchen eines Tages das Handschuhleder unten im Laden zusammenschneiden würden. «Ein niedlicher Bub», sagte er liebevoll. «Der Laden soll ihm gehören.» Seine Stimme klang jetzt fast demütig, dachte Mary. So hatte er immer mit ihrem verstorbenen Vater gesprochen. «William Shakespeare, Handschuhmacher für den Adel.»
«Ja, John», sagte Mary. Oh, sie würde das zu verhüten wissen. Ihr Will war ein Arden, und ein Arden wurde kein Kaufmann. Aber damit hatte es noch eine gute Weile.
Sie wandte ihm ihr schmales, kluges Gesicht zu und sah ihn mit ihren dunklen Augen prüfend an. Ihre Unterlippe schob sich ein wenig nach vorn, immer ein Zeichen, daß ihr scharfer Verstand angestrengt arbeitete. Sie klopfte leicht auf die Bettdecke. «Setz dich, John.»
Das Bett ächzte unter seinem Gewicht. Meine ganze kleine Welt ächzt, dachte sie erheitert, die Treppenstufen, die Tür, das Bett, der Karren, der unten vorbeifährt, und, wer weiß, vielleicht sogar der große Erdball, der sich auf Gottes Geheiß so dreht, daß es abwechselnd Tag und Nacht wird.
Der große Erdball, Sonne, Mond und Sterne, Gott, ein neugeborenes Kind, ein neues Leben, das viele verschlungene Wege gehen und sich doch stetig dem Grab nähern würde, Mann und Frau, vereint im Geist und im Fleisch – es gab genug Geheimnisse, um ein ganzes Universum zu füllen. «Erzähl mir, was du heute getan hast», sagte sie, ergriff seine Hand und lächelte über ihre ernsten Gedanken.
«Das Geschäft auf dem Markt war gut. Alle kamen herbei und beglückwünschten mich freundlich zu meinem Sohn.» Er machte sich daran, seine Schuhriemen zu lösen.
Sie sah ihn lächelnd an. Sie war glücklich, daß er glücklich war.
«Einer schenkte mir ein Zaubermittel, um das Kind vor Hexen zu schützen», sagte er. «Und ein anderer einen Balsam gegen die Krätze.»
«Ein Zaubermittel? Zeig her.» Eine Tante von ihr war durch Hexerei im Alter von dreißig Jahren kläglich zugrunde gegangen. Mary fürchtete sich vor Hexen fast noch mehr als vor der Pest.
Das Zaubermittel bestand aus einem mit Froschdärmen gebundenen Petersiliensträußchen. Mary berührte es mit den Lippen und legte es dem Kind auf die Brust. Das Zaubermittel war ihr eine große Beruhigung. Mary war eine verständige Frau und überließ, soweit sie es vermochte, nichts dem Zufall.
«Alle haben sie mir gratuliert», sagte John, während er seinen mit Pelz besetzten Schlafrock auszog. Er legte sich ins Bett, seufzte zufrieden und blies die Kerze aus. «Die Leute von Stratford sind ein guter Menschenschlag. Sie freuen sich mit den Glücklichen und trauern mit den Trauernden. Ja, es sind gute Leute.»
Er hatte recht. Die Bürger von Stratford hielten zusammen und suchten gemeinsam Schutz vor den Gefahren, die ihnen von Hexen, Kobolden und Unholden drohten, von den Geistern der Mörder und der meuchlings Ermordeten. Ganz zu schweigen von der Pest, dem Schlagfluß, den marodierenden Räubern und den grausamen Späßen des Adels. Ganz zu schweigen auch von der schwarzen Finsternis der Nacht, dem Würgegriff des Windes oder von den Heilkünsten der Quacksalber, die einem Kranken auf gut Glück den Arm oder das Bein absägten und ihm Salbe aus Fledermausblut auf die offene Wunde strichen. Doch gab es noch andere Gefahren. Wehe dem Bürger, der vom wahren Glauben abwich – ihm drohte der Scheiterhaufen. Wer gegen die Mächtigen aufbegehrte, riskierte den Kopf. Und wer den Pfad der Tugend verließ, lief Gefahr, bis in alle Ewigkeit auf einem rotglühenden Rost in der Hölle zu braten.
Und doch waren sie ein glückliches Völkchen. Sie taten fast alles mit Wonne, ob sie nun um den Maibaum tanzten oder Madrigale sangen, sich liebten oder gegeneinander Prozesse führten, ob sie trauerten oder sich bei der Bärenhatz vergnügten. Allen Sorgen und Ängsten zum Trotz freuten sie sich ihres Lebens.
An den östlichen Hängen blinzelten die Schäfer in die Strahlen der aufgehenden Sonne. Fröstelnd und noch steif von ihren harten Lagern, griffen sie gleichwohl zu ihren Hirtenflöten und bliesen ihre schlichten Morgenweisen.
Eine leichte Brise strich über England hin und fegte die nächtlichen Schwaden fort, so wie eine flinke Magd die Spinnweben verschwinden läßt. Die Bäume, Felder, Wiesen und Hecken legten schon ihr neues Frühlingskleid an. Aus den Schornsteinen der Katen stiegen blaue Rauchwölkchen auf, die der Wind sogleich ergriff und im Tanz herumwirbelte.
Das erwachende London glich einem aufgestörten Ameisenhaufen. Am Tower jagte der Wind die entrüsteten Raben und blies milde Frühlingsluft in hundert feuchtkalte Zellen. Auf der Richtstätte in Tyburn prüften die Henker die Stricke, schärften die Messer und schürten das Feuer unter den Kesseln. Es waren fröhliche Burschen, und an diesem frischen, strahlenden Morgen gingen sie heiter ihrer Arbeit nach. Schon sammelte sich die Menschenmenge an, ehrbare Frauen und Männer, die liebevoll ihre Hände auf die Schultern ihrer Kleinen legten. Die Kinder waren sauber geschrubbt, und jedes hielt ein frisch gewaschenes Stück Linnen in der Hand. («Tauche dein Tüchlein in das Blut des Herren, mein Liebes.»)
In Kenilworth blätterte Robert Dudley, der Graf von Leicester, in seinen Rechnungsbüchern. Er hoffte zu Gott, daß es Elisabeth nicht in den Sinn kommen würde, auch in diesem Jahr ihren lieben Robin, wie sie ihn nannte, zu besuchen. Er konnte sich die Ausgaben, die mit dem Besuch der Königin verbunden waren, nicht leisten. Zum Teufel auch! Wußte sie denn nicht, daß solche Ehren Geld kosteten?
Und ein paar Meilen entfernt, in Stratford, wurden John und Mary Shakespeare vom leisen Wimmern ihres kleinen Sohnes geweckt. Sie sahen einander glücklich an. Ihr größter Wunsch war in Erfüllung gegangen.
Die erste Hälfte des Mai war kühl und naß, doch dann kam plötzlich warm und strahlend die Sonne hervor. Draußen dampfte es, und alles war erfüllt vom süßen, schweren Duft der Blüten, aber auch vom dumpfen, fauligen Gestank des Flusses. Die Gerüche des Wachstums, der Reife und des Verfalls hingen in der unbewegten feuchtwarmen Luft.
Das war Wetter für die Pest.
Und sie kam. Sie kam trotz aller Gebete zur Jungfrau Maria und zu den alten, halb vergessenen Göttern des Arden-Waldes. Sie kam, obwohl die Bürger von Stratford in ihren Häusern Kamille verbrannten und den Boden mit Weinessig besprengten. Sie kam trotz oder, wie manche sagen, wegen der Bemühungen der Ärzte.
Sie kam zuerst in eine dumpfe Hütte unten am Fluß und holte sich das Balg einer Schlampe, die Meg Bates hieß. (Niemand verzieh Meg, daß sie die schreckliche Plage in die Stadt gebracht hatte, und kaum war das Schlimmste vorbei, wurde sie der Hexerei beschuldigt und bei lebendigem Leibe verbrannt.)
Die Pest! Ein Wort, das ins Herz traf, das alle Fröhlichkeit verbrannte und jeden Gedanken an die Zukunft verscheuchte, ein Wort, das an den Kräften zehrte und allen Mut raubte.
Das Haus in der Henley Street verwandelte sich in eine Festung. Mary, die sonst so heitere Mary, drückte verzweifelt ihren William an die Brust und beobachtete ängstlich ihren Mann und ihre kleine Tochter, ob sich auch ja keine Veränderung der Hautfarbe oder der Atmung bei ihnen bemerkbar machte. Doch blieben sie alle verschont. Der Tod schwang seine grausame Sense in der Stadt und ging dann seiner Wege.
Die Bürger von Stratford atmeten erleichtert auf. Sie läuteten fröhlich die Kirchenglocken, und in den Straßen herrschte bald wieder das gewohnte Leben und Treiben. Mary öffnete die Fensterläden, John schlug seinen Stand auf dem Markt wieder auf, und Williams Schwester durfte wieder zum Spielen ins Freie hinaus. Der kleine Will trank begierig oder schlummerte friedlich, als wäre nichts geschehen. Er wußte nicht, daß die erste Hürde seines Daseins hinter ihm lag.
Und nun fing er an, seine Welt wahrzunehmen. Die Bäume, die sich im Wind bewegten und ihre grünen Finger in den blauen Himmel streckten, das Zimmer, das er aus seiner Schaukelwiege betrachtete, die dunklen Wände und die kleinen Fenster. Abends blickte er oft lange in den goldenen Kerzenschein.
Aber all diese Dinge waren fast so fern für ihn wie die Sterne am Himmel. Seine eigentliche Welt waren noch immer die Arme und die Brust seiner Mutter, ihr lieblich lächelndes Gesicht. Eine zärtliche Welt.
Aber die Welt wurde weiter. Manchmal saß er jetzt, von bunten Bändern und farbigen Planen umgeben, auf dem Markttisch seines Vaters, blickte in all die fremden Gesichter, lauschte dem Geschrei, dem Gelächter und dem Geplauder, das wie ein Bach unermüdlich dahinplätscherte, und atmete den Geruch von Pferden und Leinen und Leder ein. Daheim staunte er des Abends über die tanzenden Schatten rings um das große Feuer im Kamin. Am liebsten aber lief er im Sonnenschein mit seiner Schwester zu den grünen, mit Gänseblümchen übersäten Wiesen am strudelnden Avon. So lernte er nach und nach das Leben kennen, das verschwenderische, blühende und pulsierende Leben, das ihn umgab.
Mit zehn Jahren schon liebte er es in seiner ganzen Mannigfaltigkeit, mit seinen guten und schlechten, seinen schönen und häßlichen Seiten. Vor allem aber liebte er alles Schöne. Die Schönheit war seine erste Freundin, und er sollte ihr sein Leben lang treu bleiben.
Doch mit elf Jahren entdeckte er bei einem Aufenthalt in Kenilworth abermals etwas, woran er sein Herz verlor …
Robert Dudley, der Graf von Leicester, erging sich mit seiner neuen Angebeteten in den Gärten des Schlosses zu Kenilworth. Er war ein beherzter Mann. Aber ihm bangte vor dem Geständnis, das er seiner Geliebten jetzt machen mußte. Er räusperte sich. «Liebling», sagte er schließlich, «die Königin kommt nach Kenilworth.»
«Was? Dieses Luder!» sagte Lettice Knollys barsch und sah den Grafen drohend an. «Ich werde sie so eifersüchtig machen, daß sie darauf brennen wird, mir und dir die Augen auszukratzen.»
«Aber Liebes», sagte er besorgt, «das alles ist doch längst vorbei. Elisabeth und ich … wir sind jetzt nur noch Freunde.»
Er hoffte, daß er recht behielt. Sonst würden sich die beiden Frauen wie zwei Hündinnen um einen Knochen raufen, und der Knochen würde er sein. Einen Augenblick lang erwog er sogar, Lettice ins Verlies zu stoßen. Doch nein! Der Gedanke, daß dann vielleicht für den Rest seiner Tage ihr Geist im Schloß herumspukte, behagte ihm noch weniger.
Aber ihre Eifersucht war nicht seine einzige Sorge. Der Besuch der Königin würde ihn teuer zu stehen kommen. Er dachte an die Schar der Höflinge und Hofbeamten, der Diener und Schmarotzer, die er verköstigen mußte, an die abgerichteten Bären, Pferde, Hunde und Falken, die zu beschaffen waren, an die Unordnung und den Schmutz im Schloß und an die vielen kleinen Bastarde, die seine Besucher in der Stadt hinterlassen würden.
So viel war gewiß, ihm standen schwere und kostspielige Tage bevor!
Jung-William war verdrossen. Er wollte daheim bleiben und am Fluß spielen. John Shakespeare dagegen barst vor Stolz. Eine Einladung zu den königlichen Lustbarkeiten auf Schloß Kenilworth! Er zog sich in sein Zimmer zurück und machte eine tiefe Verbeugung: «Darf ich Euer Majestät mein Weib und meinen Sohn Will vorstellen? Sehr wohl, Majestät. Ja, ein guter Junge. Er wird einmal in die bescheidenen Fußstapfen seines Vaters treten. Handschuhmacher, Majestät, und zwar, wenn ich das hinzufügen darf, für den Adelsstand.» Ehrerbietig hauchte er einen Kuß auf die königliche Hand.
Mary Shakespeare blickte wie immer gelassen und ein wenig belustigt drein. Auch sie war nach Kenilworth gebeten, aber wohlgemerkt nicht als Tochter des ehrenwerten Edelmanns Robert Arden, sondern als Ehefrau eines der beiden Stadtkämmerer von Stratford. Sie würde unter den wohlhabenderen Kaufleuten sitzen, sehr viel weiter hinten und auf einem härteren Stuhl, als ihr von Geburt aus zustand. Doch das bekümmerte sie nicht. Es war der Platz, den ihr John sich durch seine Stellung erworben hatte. Sie würde ihn mit Stolz einnehmen.
Sie hatte Robert Dudley vor vielen Jahren kennengelernt. Und noch jetzt, da sie längst Ehefrau und Mutter war, schlug ihr Herz höher, wenn sie an den schmucken, kecken jungen Mann dachte, den die Königin zum Grafen von Leicester ernannt und mit einem königlichen Schloß und dem Kosenamen «Robin» bedacht hatte. Ob er sie wiedererkennen würde? «Mary Shakespeare, gnädiger Herr. Damals war ich Mary Arden. Ja, unser William ist ein braver Bub, gnädiger Herr, und sein Herz gehört der Grafschaft Warwick, der Heimat seiner Vorfahren.»
Ja, Will war ein guter, gelehriger Junge. Er besuchte die Lateinschule, war artig und höflich zu Simon Hunt, seinem Lehrer, und lernte beflissen Latein und Logik und Arithmetik. Er hörte aufmerksam zu, wenn sein Vater ihn in die Geheimnisse seines Gewerbes einweihte und ihm anriet, seine Gedanken aufs Handschuhmachen zu richten. Doch ebenso aufmerksam hörte er zu, wenn seine Mutter ihm die Aufgaben und Freuden eines freien Bauern beschrieb. Und war er manchmal ein wenig verwirrt, so zeigte er es nicht. Er wollte alles tun, was in seinen Kräften stand, um seine geliebten Eltern beide zufriedenzustellen. Nur wußte er nicht recht, wie er das bewerkstelligen sollte.
Er hatte Elisabeth falsch eingeschätzt, dachte Robert Dudley mit finsterer Miene. Und es war ihm nur ein schwacher Trost, daß auch andere sich in der Königin immer wieder täuschten. Ein Wiedersehen zweier alter Freunde, die traurig ihrer erloschenen Leidenschaft füreinander gedenken – so hatte er sich ihre Begegnung vorgestellt. Nun, die Leidenschaft mochte verglüht sein, aber die Eifersucht loderte noch. Bei Elisabeth überdauerte die Eifersucht alles andere, die Liebe, die Leidenschaft und selbst die Hoffnung.
Welch ein Glück, daß er für ihren Aufenthalt so viele Lustbarkeiten geplant hatte. Sollte es da nicht gelingen, selbst eine eifersüchtige Königin aus ihrer Schmollecke zu locken? Nun konnte er nur noch dafür sorgen, daß auch ja nichts fehlschlug. Und er tat sein Bestes. Böllerschüsse, Trompetenschall und Trommelklang rissen Schloß Kenilworth aus seinem Schlaf und erweckten es zu neuem Leben. Festliche Zelte und bunte Pavillons waren errichtet, und von überall her kamen die Menschen herbeigeströmt, aus Coventry und Warwick, aus Stratford und dem Dörfchen Birmingham, manche zu Roß und manche zu Fuß, andere in Kaleschen und wieder andere mit der Postkutsche. Denn hier wurde ihnen geboten, was sie über alles liebten: Lärm und Gedränge, fröhliche Lustbarkeiten und die Gelegenheit, einen Blick auf die erhabenen Wesen zu werfen, die den Engeln so viel näher waren als dem gemeinen Volk.
Aber Robert Dudley hatte sich zuviel von den Lustbarkeiten erhofft. Er saß wie auf Kohlen. Lächelte er die Königin an, schmollte Lettice tagelang. Blickte er Lettice flüchtig in die Augen, zürnte ihm die Königin. Und es gab noch andere Schwierigkeiten. Die als Nymphen und Göttinnen verkleideten jungen Mädchen führten Klage über die lüsternen Krieger der Königin, die ihnen nachstellten.
Die Königin war verzweifelt. Jedesmal wenn sie sich erhob, hinausging oder hereinkam, einen Schluck Wein trank oder sich in ihr Schlafgemach begab, wurde eine Salve abgefeuert. Und wenn die Kanonen schwiegen, musizierten die Lautenspieler oder es gab ein ohrenbetäubendes Feuerwerk. Zwischendurch rezitierte man lateinische Verse, oder ein Maskenspiel wurde aufgeführt, bei dem sie die Königin der Schönheit und der Ehre darstellen mußte. Und natürlich gab es jeden Abend ein Bankett, bei dem Akrobaten und Narren auftraten. Die Nächte waren vom Gekreisch der Nymphen und Göttinnen erfüllt, die draußen auf dem Rasen vor den waffenklirrenden Soldaten flohen. Elisabeth sehnte sich nach der friedlichen Stille von Whitehall zurück. Ihr Robin hatte des Guten zuviel getan.
Aber hatte er nicht, dachte sie traurig, immer schon etwas von einem Emporkömmling gehabt? Nein, sie konnte ihm seine Großtuerei nicht verargen. Jedermann prahlte und protzte. Auch sie selbst, sofern es nicht allzuviel kostete. Aber daß er sie, die Königin, ermüdete, nur um ihre Aufmerksamkeit von einer Dirne wie Lettice Knollys abzulenken – das war unverzeihlich.
Es dämmerte eben, als die Shakespeares sich im milchigen Frühnebel des Julimorgens zum Aufbruch nach Kenilworth anschickten. Das Licht der Stallaterne schimmerte golden über den dampfenden Pferdeleibern.
Unten am Fluß würde der Nebel erst spät am Morgen weichen. Die Schwaden würden zerreißen und die Sonne, das glitzernde Wasser und eine neu erschaffene Welt enthüllen. William vermeinte zu spüren, wie das kühle Wasser ihn umfing, wie die Sommersonne auf seine Wangen und seine Stirn brannte. Er meinte, das taufeuchte Gras unter seinen bloßen Füßen zu fühlen. Er dachte an die langen Ferientage im Sommer, wenn er faulenzen, spielen, schwimmen und träumen durfte. «Mutter, muß ich mit?»
«Aber Will, Liebling, natürlich mußt du mit. Die Königin wird dort sein, und Kenilworth ist ein herrliches großes Schloß.»
«Größer als das Haus von Großmutter Arden?»
«Viel, viel größer», sagte Mary lachend.
William konnte es nicht glauben. Ein größeres Haus als das von Großmutter Arden gab es bestimmt nicht auf der Welt. Allein die riesige Halle war beinahe so groß wie der Marktplatz von Stratford, dachte er. Doch jetzt mischte sich sein Vater ein. «Was ist los mit dem Jungen?» fragte er ungeduldig.
«Er möchte zu Hause bleiben und schwimmen», sagte Mary belustigt und wartete auf den unausbleiblichen Zornausbruch.
«Schwimmen? So, schwimmen will er! Ist ihm das wichtiger, als die Adligen und vielleicht sogar die Königin zu sehen?» John Shakespeare war empört. Wer lieber schwimmen wollte, als mit den hohen Damen und Herren zu plaudern, der war ein Narr. Und John hoffte, daß er keinen Narren zum Sohn hatte. Will war ein guter Junge. Aber manchmal mußte John sich doch sehr über ihn wundern. «Genug des Unsinns», sagte er, hob Will auf das kleine, gedrungene Pferd und schwang sich ungelenk hinter ihm auf.
John und sein Pferd hatten manches gemeinsam; beide waren kurzbeinig, rundlich und schwerfällig. Mary dagegen ritt ein schmales, ungeduldiges, hochtrabendes Tier. John hing auf seinem Pferd wie ein Hafersack. Mary saß stolz und aufrecht im Sattel. Am liebsten wäre sie laut jubelnd davongaloppiert.
Will ließ die Augen nicht von seiner Mutter. Sie war so schlank, so schön und so fraulich. Er vergötterte seine Mutter, er liebte ihre Sanftheit, ihre Fröhlichkeit und ihren sprühenden Geist. Sie war eine Mutter, auf die man stolz sein konnte. Eine Arden. Sie trug den gleichen Namen wie der große Wald im Herzen Englands. Und sie vergaß nie, daß sie eine Arden war. Und sorgte dafür, daß auch ihr Ehemann und ihre Kinder es nie vergaßen.
Sie ritten durch den stillen Morgen. Nur das Klappern der Pferdehufe und das Knirschen des Leders war zu hören. Will blickte furchtsam um sich. Gewiß, im traulichen Schein der Laterne, die am Hals des Pferdes leuchtete, und mit seinem Vater hinter sich saß er hier oben so sicher wie in Abrahams Schoß. Trotzdem ängstigten ihn die Bäume, die wie Riesen aus dem Nebel ragten, sich über die Reiter beugten und mit langen Armen nach ihnen griffen. Dichte Schwaden lauerten im Gezweig, schwankende Spukgestalten, die Grimassen schnitten. Er sah die Gespenster nicht wirklich, aber sie waren da, überall, flüchteten vom Wege vor den klappernden Pferdehufen und schwatzten in den Baumwipfeln. Er wußte es. Und wenn nun plötzlich ein böser Geist auf dem Weg vor ihnen erschien? Das Pferd würde sich aufbäumen und ihn, Will, vor die Füße des Ungeheuers schleudern! Er schmiegte sich noch enger in die schützenden Arme seines Vaters. Robin Dells Großmutter hatte einmal mit eigenen Augen einen solchen Unhold gesehen, und das war an einem nebligen Morgen gewesen. Sie hatte es Robin und seinen Freunden erzählt, und noch bei der Erinnerung daran sträubten sich Will die Haare.
Sein Vater sagte: «Der heutige Tag, mein Junge, kann, wenn du Augen und Ohren offenhältst, ein Markstein in deinem Leben werden.»
«Ja, Vater», sagte Will.
«Und paß gut auf, wie ich den hohen Herrschaften gegenübertrete. Nicht zu vertraulich, lieber ein wenig devot. Das kann nie schaden.»
Eine Ringeltaube flatterte von einer hohen Ulme auf, und Wills Herz klopfte wie rasend.
«Die Adligen schätzen es, wenn man ihnen ein wenig devot begegnet.»
«Ja, Vater.»
Mary, die ein Stück vorausgeritten war, wartete an einer Biegung des Weges und wies mit der ausgestreckten Hand gen Süden. «Da drüben», rief sie, «liegen Ländereien der Ardens.»
Will spähte in die Ferne. Aber er sah weit und breit nichts als Nebel, ein von dichten Schwaden verhängtes Gespensterland. Und er malte sich aus, wie er dort hinter dem Pflug einherschritt, während die bösen Geister um ihn herumtanzten und ihn ins Ohr zwickten. Vielleicht sollte ich doch lieber Handschuhmacher werden, dachte er.
«Ein Kaufmann», sagte John, «kann viel Nützliches lernen, wenn er die Adligen beobachtet. Sie fühlen sich geschmeichelt, wenn man ihre feine Lebensart nachahmt. Man darf es nur nicht übertreiben, sonst fordert man ihren Zorn heraus.»
Mit ruhiger, energischer Stimme fragte Mary: «Aber was hat unser Will mit Händlern zu tun?»
Ihr scharfer Ton gefiel John nicht. «Er ist der Sohn eines Kaufmanns», sagte er, «und ich habe die Absicht, ihn auch Kaufmann werden zu lassen.»
«Schon recht, Vater. Ich glaube, ich würde ein schlechter Bauer werden.»
Mary zügelte ihr Pferd. Sie wollte etwas sagen, besann sich aber anders. Die Zeit war noch nicht reif. Ärgerlich galoppierte sie voraus. Will sah ihr besorgt nach. Seine Mutter war offenbar mit ihm unzufrieden. Bekümmert blickte er in den Nebel, in die Richtung, wo die Ardenschen Ländereien lagen. Vermutlich würde ihm gar nichts anderes übrigbleiben, als Bauer zu werden. Er konnte seine Mutter nicht enttäuschen.
Langsam wurde es heller, und bald war es auch nicht mehr so unheimlich still. Man hörte Stimmen, Hufgeklapper und Räderknirschen, und hin und wieder tauchten Gesichter aus dem Nebel auf. Und dann erblickten sie im Morgendunst die Silhouette einer Stadt. «Kenilworth», verkündete sein Vater.
Sie ritten weiter, durchquerten eine schmale Furt, und plötzlich rief seine Mutter: «Will, sieh mal! Dort!»
Er blickte auf, und der Atem stockte ihm vor Staunen und Entzücken. Vor ihm ragte im strudelnden Nebel ein gewaltiges Bauwerk aus rotem Sandstein empor, grimmig, gebieterisch und geheimnisvoll. In dem unsteten Licht war es unmöglich, seine Größe zu ermessen. Lichter glühten gelb im Maßwerk der Fenster. Es war mehr als ein Gebäude, mehr als eine menschliche Behausung. Es war ein Wahrzeichen des königlichen England, schöner und erschreckender als alles, was Will je gesehen hatte. Ihm wurde vor Aufregung ganz schwindelig.
Irgendwo ertönte ein Horn. Die Menschenmenge, die sie jetzt umgab, verharrte einen Augenblick lang und räumte dann in aller Eile die Straße. Reiter in gräflicher Livree sprengten vorbei, dem Schloß entgegen. Ihnen folgten gemächlich einige Damen und Herren zu Pferde, die hochmütig geradeaus blickten, so als seien die vielen Menschen, die sich zu beiden Seiten der Straße an die Hecken drückten, gar nicht vorhanden.
Nur eine der Damen, eine Frau, die in einen weiten Reitmantel mit Kapuze gehüllt war, wandte ihre Blicke dem Volk auf der Straße zu, und ein Raunen, das William an das Rascheln des Schilfs im Sommerwind erinnerte, ging durch die Menge: «Die Königin! Die Königin! Die Königin!»
Die Männer zogen untertänig ihre Hüte, und die Frauen machten einen tiefen Knicks. Die Königin hielt an. William erblickte ein bleiches, lebhaftes Gesicht und eine rötliche Haarlocke unter der grünen Kapuze. Ehrfurchtsvolle Liebe durchglühte ihn. Und sogleich malte er sich aus, wie er in der Schlacht sein Leben für die Königin ließ. Nichts anderes wünschte er sich in diesem Augenblick. Er schwenkte stürmisch seinen Hut und rief ergriffen: «Gott erhalte Eure Majestät!»
Die Königin liebte ihre Untertanen. Doch gab es Zeiten, da sie ungehalten war und weniger Liebe für sie empfand. So war es an diesem trüben Morgen. Sie hatte noch nicht gefrühstückt, und Robin war gerade mit Lettice im Nebel entschwunden. Elisabeth starrte ihr Volk zornig an. Dann stieß sie ein hohes, schneidendes «Ha!» hervor und sprengte davon. Ohne ein Lächeln, ohne ein Wort. Gleich darauf ritt sie über die Brücke von Schloß Kenilworth, und die Kanonen donnerten zu ihrer Begrüßung. In diesem Augenblick zerriß der Nebel, die Sonne brach hervor, und Will sah das Schloß in all seiner kühnen Pracht vor sich.
Die Fenster flammten im Sonnenlicht. Die Rüstungen, die Hellebarden und Pieken blitzten und glänzten. Der riesige Sandsteinbau war mit Wimpeln und Bannern geschmückt. Davor waren buntgestreifte Zelte errichtet. Damen in Seidengewändern und Herren in steifem Brokat belebten das Bild. Mary Shakespeare lächelte. Was der Graf von Leicester auch unternahm, er tat es, wie es sich gehörte. Sie blickte zu ihrem Sohn hinunter.
William saß schweigend da, in den Anblick des Schlosses versunken. Sein munteres sonnenverbranntes Gesicht drückte Verwunderung aus, als traute er seinen Augen nicht. Er liebte so vieles: den Fluß, die Wiesen, die Blumen, das fröhliche Treiben auf dem Marktplatz von Stratford, die Pferde, die zarten Rehe im Wald und die streunenden hungrigen Hunde. Aber was er hier erblickte, hatte er noch nie gesehen. Diese Schönheit und dieser Reichtum übertrafen alle seine Vorstellungen.
Das Festprogramm war auch an diesem Tag vielfältig und abwechslungsreich. Da gab es eine Rezitation aus den ‹Metamorphosen› von Ovid, einen Madrigal-Wettbewerb, einen Kampf, bei dem Doggen auf einen Löwen gehetzt wurden, ein Feuerwerk, einen Gedicht-Vortrag, eine Gigue, einen fröhlichen Reigen und ein Maskenspiel über Juno, das Leicesters Hofpoet George Gascoigne verfaßt hatte, ein Meister der englischen Prosa.
Gleichwohl war es ein schlechtes Stück. In Eile geschrieben, anmaßend und hochtrabend. Obendrein hatten die Schauspieler nicht genügend geprobt. Und Lettice, die als Juno auftrat, war so sehr damit beschäftigt, Robert Dudley, der neben der Königin saß, eifersüchtig im Auge zu behalten, daß sie nicht einmal so tat, als habe sie ihre Rolle gelernt. Jedesmal wenn sie den Mund auftat, gähnte Elisabeth betont gelangweilt, und jedesmal wenn die Königin gähnte, gähnten auch alle anderen Zuschauer.
Bis auf William. Er war entzückt. Zwar hatte er in Stratford einige Male Schauspielertruppen, die durch das Land zogen, ihre Stücke spielen sehen, doch was er damals nicht verstanden hatte, das gewann für ihn nun plötzlich Schönheit und Bedeutung. Die prächtigen Kostüme, die Reden und Gegenreden, die Gesten! Erwachsene Männer und Frauen spielten die Götter und Göttinnen alter Zeiten! Welch eine wunderbare Idee! Bisher war ihm nie klargeworden, daß Erwachsene auch spielen konnten. Wenn er einmal groß war, würde er auch spielen, sagte er sich. Aber in einem besseren Stück als diesem. All die Worte, die hier gesagt wurden, waren so unnütz! Er wollte Handlung sehen, Kampf und Streit, nicht dieses alberne und übertriebene Getue. Er versank in einem Traum, in dem er Waffen klirren hörte, in dem er Liebe und Haß unerbittlich zusammenprallen sah. Seine Mutter sah ihn an und erschrak. Mit weit aufgerissenen Augen starrte das Kind verzückt ins Leere. Hatte eine Hexe ihren William verwünscht? Ängstlich ergriff sie seinen Arm. «Will, was ist dir?»
Er sah sie aus seinen großen braunen Augen an. «Nichts, Mutter.» Dann wies er mit einem Kopfnicken auf die Schauspieler und fragte sie: «Mutter, darf ich, wenn ich erwachsen bin, auch so spielen?»
Mary war bekümmert, daß sie ihn enttäuschen mußte. «Nein, mein Kleiner, das ist nur etwas für die hochadligen Damen und Herren», sagte sie.
William schwieg. In seinem Kopf fochten noch immer Könige und Königinnen, Prinzen und Prälaten ihre Fehden aus.
Nach dieser elenden Vorführung hatte Robert Dudley das Verlangen, sich die Beine zu vertreten, und er beschloß, sich seinen Gästen zu zeigen.
Er gab sich gern huldvoll, vor allem, wenn seine Huld ihn nichts kostete, und er wußte, daß der Anblick des mächtigsten Mannes von England den Frauen und Töchtern der kleinen Händler und Landbesitzer großes Vergnügen bereitete. Außerdem wollte er sich vergewissern, daß keine schöne Frau seiner Aufmerksamkeit entging. Es war erstaunlich, was für anziehende und schöne Geschöpfe das einfache Volk zuweilen hervorbrachte.
Sein Blick fiel auf eine hochgewachsene, schlanke Person. Kein junges Mädchen mehr, sagte er sich, aber eine reizende und, nach ihrem Äußeren zu schließen, höchst lebhafte Frau. Zwar hatte er mit Lettice und der Königin von lebhaften Frauen fürs erste genug, doch konnte er Schönheit nie widerstehen. Er zog sein Barett. Und da die Dame unter den Händlern und ihren Frauen stand, verbeugte er sich ein wenig nachlässig und herablassend. «Madame …» murmelte er fragend.
Sie deutete anmutig einen Knicks an und lächelte. Es war ein belustigtes Lächeln, das ihn verwirrte. Gewöhnlich waren die armen Gänse so überwältigt, wenn er sie eines Grußes würdigte, daß sie fast über ihre eigenen Füße stolperten. Er war auf Ehrfurcht, Dankbarkeit oder Entzücken gefaßt, nicht aber auf unverhüllte Belustigung. «Mary Shakespeare, gnädiger Herr», antwortete sie gelassen.
Gott, welch ein schwieriger Name, dachte er.
«Aber Ihr habt mich einst als Mary Arden kennengelernt.»
«Ah!» Das war schon besser. Eine gute Familie. Aber er hatte das Gefühl, daß er auf diese Frau keinen so großen Eindruck machte, wie er es sonst bei Frauen gewohnt war. Und so versuchte er es mit dem alten Spiel, indem er die Mutter nach ihrem Sprößling fragte: «Ist der Bub Euer einziges Kind?»
«Nein, gnäd’ger Herr, die jüngeren Kinder sind bei ihrer Großmutter Arden. Und dann gab es noch zwei kleine Mädchen, die jung starben.»
Er wandte sich Will zu: «Und gefällt es dir auf Kenilworth?»
«O ja, gnäd’ger Herr. Nur das Maskenspiel – das fand ich schlecht.»
«William!» rief Mary, und jetzt war sie nicht mehr gelassen. Sie wußte von Familien, die für harmlosere Bemerkungen ihres Besitzes beraubt und vertrieben worden waren. Besorgt sah sie die zwei tiefen Furchen zwischen Dudleys Augenbrauen.
«So, wirklich, Master William? Und was ist so schlecht an dem Stück?»
«Es sollte mit Eurem Barte zum Balbier, gnäd’ger Herr, es gehört zurechtgestutzt.»
«Ich verstehe.» Er richtete sich mit ernster Miene auf. «Was habt Ihr mit dem Buben vor, Mistress Shakespeare?»
«Ein guter, feiner Bauer soll er werden. Wie seine Ardenschen Vorfahren es waren.» Sie wollte das Eisen schmieden, solange es heiß und John aus dem Wege war. «Es wäre eine Ehre für den Jungen und für uns alle, wenn er für Eure Lordschaft arbeiten dürfte.»
Eine der Händlerstöchter warf dem Grafen begehrliche Blicke zu – ein hübsches, geistloses Frauenzimmer, schon halb erobert. Was sollte er da mit dieser Mary Shakespeare und ihrem scharfsinnigen, aber altklugen Sprößling seine Zeit vergeuden? Er sagte hastig: «Laßt ihn zur Schule gehen, bis ein Mann aus ihm geworden ist, und dann bringt ihn meinem Landvogt. Wir werden schon Arbeit finden für Master Shakespeare.»
«Ich dank Euch auch. Eure Lordschaft ist sehr gütig.» Sie machte einen tiefen Knicks. Aber der mächtigste Mann von England war schon seiner Wege gegangen, um einer anderen Frau aus dem Volk seine Huld zu schenken.
«Will», sagte Mary erregt, «du mußt vorsichtig sein. Schon manch einer, der so sprach wie du zum Grafen, bekam die Ohren abgeschnitten.»
«Aber ich hab doch die Wahrheit gesagt, Mutter.»
«Um so schlimmer. Oh, da ist dein Vater. John, stell dir vor! Ich habe mit dem Grafen gesprochen. Und Will hat einen guten Eindruck gemacht. Der Graf will ihn in seine Dienste nehmen.»
«Oh!» John platzte fast vor Stolz. «Unser Sohn im Dienst des Grafen von Leicester! Wer weiß, vielleicht ist das der Weg zum Hof der Königin.»
Mary schwieg. Und dann erinnerte sich John. «Aber das Geschäft! Ich wollte doch so gern …»
Sie schob ihren Arm unter den seinen. «Ich weiß, John, ich weiß, was dir am Herzen liegt. Nun, dann muß dem Grafen abgesagt werden.» Sie lächelte ihn strahlend an.
«Ja», murmelte John Shakespeare. «Dem Grafen muß abgesagt werden.» Aber es klang, als sei er seiner Sache nicht sehr sicher.
2 Das Schauspiel sei die Schlinge …
In dem kleinen Dorf Shottery hatte man eine Hochzeit gefeiert. Ein armseliges Fest! Eine langweilige Zeremonie in der Kirche, und danach ein karges Hochzeitsmahl mit wenig Bier und ohne derbe Späße. Aber was konnte man schon von einer Hochzeit erwarten, wenn der Brautvater in einem frisch geschaufelten Grab lag und die Stiefmutter der Braut sich vor lauter Kummer noch törichter aufführte als gewöhnlich. Und wenn zwei gestrenge Puritaner, Fulk Sandells und John Richardson, an Stelle ihres verstorbenen Freundes Richard Hathaway das Fest ausrichteten!
Jetzt waren die wenigen Gäste heimgegangen, und keiner der Männer hatte getaumelt, eine wahre Schande für die Gastgeber. Der graue Frühlingstag ging unmerklich in einen trübseligen Abend über. Irgendwo bellte ein Hund, und sein beharrliches Lärmen betonte noch die ländliche Stille. Blütenblätter, die der wolkenreiche Mai vorzeitig hatte welken lassen, fielen müde zu Boden, und das Abendlied der Amseln klang wie ein Trauergesang an diesem traurigen Hochzeitstag in Shottery.
In dem strohgedeckten Bauernhaus aus roten Ziegeln saßen die beiden Neuvermählten, die Stiefmutter der Braut und die Brautjungfer schweigend vor dem leeren Kamin. Die frisch gebackenen Eheleute warteten schüchtern und freudig erregt, daß es Zeit wurde, zu Bett zu gehen. Mistress Hathaway nähte, obwohl ihre Augen vor Tränen halb blind waren, aber als Hausfrau konnte sie es sich nicht erlauben, auch nur eine Minute lang untätig zu sein.
Der junge Ehemann stand auf und ergriff zärtlich die Hände seiner Frau. Sie erhob sich und umarmte zuerst ihre Stiefmutter und dann die Brautjungfer. «Gute Nacht, meine süße Schwester Anne», sagte sie liebevoll und dachte traurig daran, daß mit diesem Abend vieles, was sie miteinander verband, zu Ende ging oder sich ändern würde, und auch daran, daß ihre um sieben Jahre ältere Schwester nicht mehr auf einen Ehemann hoffen konnte. Langsam stieg sie die Leiter hinauf. Der junge Ehemann folgte ihr.
Anne spürte eine Träne auf ihrer Wange und wischte sie fort. Sie stand auf und ging zur Tür. «Darf ich noch ein wenig hinaus, Mutter?»
Ihre Stiefmutter sah sie mürrisch an. «Wie, gehören wir jetzt zum Adel, daß wir im Sonntagsstaat in Samt und Seide draußen umherspazieren?»
«Ich … ich möchte mich jetzt nicht oben umziehen.»
«Also gut. Aber nimm dich in acht. Ein Glück, daß dir in deinem Alter jedenfalls kein Bursche ein grünes Kleid machen wird», fügte sie grausam hinzu.
Anne stürzte aus dem Haus, lief zur Gartenpforte und trat hinaus auf den Feldweg. Die Amseln sangen noch, und in der Ferne, hinter dem Wald, bellte noch immer der Hund. Sie brach in bittere Tränen aus. Kein Mann wollte sie haben. Sie wußte, daß sie für immer an dieses düstere, halb unter Bäumen versteckte Dorf und an ihre verbitterte Stiefmutter gefesselt war. Und da ihr Vater gestorben war, würde es ein Leben in Elend und Armut sein. Es gab kein Entrinnen. Sie würde eine alte Jungfer werden. Kein Mann würde ihr Freude bringen und Kinder schenken, keiner würde sie vor Hunger bewahren und vor Gefahren schützen.
Sie schritt im dunklen Schatten der Bäume dahin. Zu ihrer Linken schlängelte sich ein Pfad durchs hohe Weidegras, und da die Düsternis unter den Bäumen sie schreckte, bog sie links ab.
Will Shakespeare schlenderte vergnügt durch die Wiesen.
Er war jetzt achtzehn und der ganze Stolz seiner Mutter. Er sah gut aus mit seinem offenen bäuerlichen Gesicht unter dem kastanienbraunen Haar, war von kräftiger, fast robuster Statur und im Wesen noch immer so freundlich wie als Knabe, immer darauf bedacht, jedermann zu gefallen.
Als er jetzt ein Mädchen in dieser einsamen Gegend des Weges kommen sah, schlug sein Herz schneller. Sie trug ein Kleid aus blauer Seide mit hübschen Bändern und Spitzen, und einen Augenblick dachte er, sie gehöre zum Landadel. Aber nein. Sie ließ schüchtern den Kopf hängen wie eine Glockenblume. Wäre sie ein adliges Fräulein gewesen, hätte sie ihn hochmütig angestarrt. Sie mußte ein Landmädchen sein, obwohl sie sich so herausgeputzt hatte. Er bebte vor Neugierde.
Und Anne auch. Trotz ihres Kummers hatte sie doch den jungen, schmucken Burschen, der ihr da entgegenkam, sogleich bemerkt. Sein Gesicht war gebräunt und leuchtete wie eine eben aus der Schale gesprungene Kastanie. Sein Wams und seine Hose waren aus Kordsamt, die Strümpfe aus grober Wolle.
Anne war erleichtert, aber in ihrer verzweifelten Stimmung zugleich auch ein wenig enttäuscht, daß er nicht zum Landadel gehörte. Wäre ihr auf dieser einsamen Wiese ein Edelmann begegnet, hätte es sicherlich eine Balgerei im Gras gegeben. Für die Adligen waren Bauernmädchen Freiwild wie Rehe, Eber oder Füchse.
Als sie im Näherkommen den Kopf hob, bemerkte Will, daß ihre Augen von dem gleichen zarten Blau waren wie ihr Kleid. Und diese Augen hatten offensichtlich geweint. Mitleid wallte in ihm auf, und schnell schob er den Gedanken beiseite, daß sie allem Anschein nach kein junges Mädchen mehr war.
Und so wie er sich als Knabe in Blumen, Wolken und Sonnenschein verliebt hatte, so verliebte er sich nun zum erstenmal in eine Frau. Ein Mädchen, bleich wie der Mond, zart wie Distelwolle und sanft wie die Brustfedern einer Taube. «Wer seid Ihr?» fragte er sie leise.
Sie sagte es ihm. Ihre Stimme war tief und melodisch. «Anne Hathaway.»
Ein schöner, wohlklingender Name, ein Name, den man liebevoll an den Rand von Buchseiten schreiben konnte. Wie die anderen, die er schon so oft geschrieben hatte: Regina, Elisabeth Tudor, Will, William Shakespeare.
Seine ruhige Stimme flößte ihr Vertrauen ein. Sie bemerkte, daß sein Blick auf ihrem tief ausgeschnittenen Mieder ruhte, und dachte sogleich, daß er ihr nur um ihres festlichen Kleides willen Beachtung geschenkt habe. «Meine Schwester hatte heute Hochzeit», erklärte sie. «Ich war Brautjungfer.»
«Ah so.»
Sein Lächeln und der freundliche Ton seiner Stimme machten ihr Mut, und sie fragte: «Ihr seid nicht aus Shottery, Sir, nicht wahr?»
«Nein. Ich bin Will Shakespeare aus Stratford», antwortete er und fügte wichtigtuerisch hinzu: «Ich stehe im Dienste des Grafen von Leicester.»
Das Mädchen erbleichte. Man brauchte nur den Namen des Grafen zu erwähnen, und die Leute in den Dörfern schlotterten vor Angst. Gleich wird sie mir davonlaufen, dachte er und sagte rasch: «Aber ich pflüge nur das Land des gnädigen Herrn.» Sie sah erleichtert aus, aber er wollte es bei dieser Auskunft nicht belassen. «Ich stamme von den Ardens ab», erklärte er. «Ich lerne bei dem Grafen Ackerbau, damit ich später das Land meiner Familie besser bewirtschaften kann.»
Zum Teufel, jetzt hatte er sie zum zweitenmal erschreckt. Mit seinem liebenswürdigsten Lächeln sagte er: «Es dunkelt, Mistress Anne, und es heißt, daß die Kobolde frei umherstreifen dürfen, wenn die Sonne den Erdrand berührt. Erlaubt Ihr mir, daß ich Euch heimbegleite?»
Anne errötete. Kobolde, ein junger Arden, der im Dienst des edlen Grafen stand, das alles war zu viel für sie. Aber der junge Mann war so freundlich, und was er über die Kobolde gesagt hatte, war ihr wohlbekannt.
Zusammen gingen sie auf die verschwommenen gelben Lichter von Shottery zu. Anne schwieg. Aber auch Will brachte keine Silbe heraus, was bei ihm durchaus ungewöhnlich war.
Sie kamen an die Gartenpforte. Anne drehte sich um und sah ihn an. Verzweifelt suchte sie nach Worten. Sie, Anne Hathaway, erlebte jetzt etwas, das sie bisher immer nur voll Sehnsucht bei anderen Mädchen beobachtet hatte – sie stand in der Dämmerung mit einem jungen Burschen an der Gartenpforte. Doch wenn sie nicht bald etwas sagte, würde er auf Nimmerwiedersehen verschwinden. Stammelnd murmelte sie: «Ich danke Euch, daß Ihr mich begleitet habt, Sir.»
Und wieder dieses freundliche Lächeln. Es schien die Dämmerung zu erhellen und die Abendkühle zu verscheuchen. Sie blickte ihm in die Augen. Und da plötzlich wußte sie, daß sie verliebt war – in einen jungen Mann, der fünf, sechs, sieben Jahre jünger sein mußte als sie! In einen Fremden! Und dieser Fremde nahm jetzt ihre Hand und hielt sie in der seinen, so wie man einen erschreckten Vogel hält, und sagte leise: «Mistress Anne, Ihr habt geweint.»
«Aber jetzt weine ich nicht mehr», sagte sie lächelnd mit einem tiefen Seufzer.
«Werden wir uns wiedersehen?» fragte er.
Sie senkte den Kopf. «Wenn … wenn Ihr es wollt», murmelte sie.
Er verbeugte sich. So anmutig wie ein galanter Höfling, dachte Anne. Und dann schritt er davon, nachdenklich und verwirrt von dem Sturm seiner Gefühle, beschwingt und zugleich besorgt. Wie konnte dieses Mädchen je so einen Grünschnabel wie ihn lieben?
Mistress Hathaway sah ihre Stieftochter vorwurfsvoll an. «Was treibst du dich draußen herum zu einer Stunde, da nur die Hexen unterwegs sind? Hast du Ausschau gehalten nach dem Kobold Puck, weil kein richtiger Mann dich ansieht?»
«Laß mich in Frieden, Mutter», sagte Anne. Und hätte ihre Stiefmutter Augen im Kopf gehabt, wäre ihr aufgefallen, daß die Anne, die da verwirrt und verzückt vor ihr stand, nicht dieselbe Anne war, die vor einer Stunde traurig und verzagt das Haus verlassen hatte.
Niemand außer der Königin liebte Robert Dudley, den Grafen von Leicester. Man fürchtete ihn vielmehr. Einer der Gründe dafür war, daß jedermann, ob zu Recht oder zu Unrecht, glaubte, er habe, um die Königin heiraten zu können, seine Frau Amye ermordet. Die Ironie des Schicksals wollte es, daß die Königin ihn deshalb gar nicht heiraten konnte. Und dieser Fehlschlag trug ihm mehr Verachtung ein als der Mord, dessen man ihn verdächtigte.
Das war ungerecht. Er verdiente Achtung. Wie so viele seiner Zeitgenossen vereinigte er in sich wilden Ehrgeiz und rücksichtslose Selbstsucht mit dem selbstlosen Wunsch, seinem Land zu Ruhm und Ehren zu verhelfen.
Außerdem liebte und förderte er das Theater. So kam es, daß ihm bei einer Begegnung mit seinem neuen Diener Will sogleich der elfjährige Knabe wieder vor Augen stand, der damals ein so reges Interesse am Theater gezeigt hatte. «Ah, da ist ja Master Shakeshaft, der das Theaterstück meines Dichters George Gascoigne so schlecht fand.»
Die Stimme des Grafen klang höhnisch. Will schluckte und zitterte. Aber seine jugendliche Dreistigkeit war stärker als seine Furcht. «Shakespeare, gnädiger Herr. Will Shakespeare.»
«Zum Teufel! Ich nenne dich, wie ich will», brüllte er und starrte Will mit einem kalten Blick an.
Will schwitzte. Würde der Graf ihn für seine Unbotmäßigkeit ins Verlies sperren oder ihn auspeitschen lassen?
Dann kam die Frage, und sie klang wie ein Peitschenhieb. «Kannst du es besser machen, Bürschchen?»
«Ich … ich könnte es versuchen, gnädiger Herr.»
«So. Dann schreib mir ein halbstündiges Schauspiel für die Bühne. Aber in deiner freien Zeit, hast du verstanden?»
Schreiben! Eine Feder in der Hand halten, Personen, Kampf und Streit im Kopf erstehen lassen und zu Papier bringen! Der Graf fuhr fort: «Du bekommst von mir Federn, Tinte und Papier. Geh zu Gascoigne, er soll dir geben, was du brauchst.»
«Aber … aber, gnädiger Herr», rief Will.
«Was noch?» Der Graf war wütend. Er hatte das Gespräch beendet.
«Gnädiger Herr, was kann man in einer halben Stunde auf der Bühne sagen? Mein Spiel braucht vier, fünf Stunden.»
«Eine halbe Stunde, hab ich gesagt. Wenn du schreiben kannst, was ich bezweifle, dann werden wir es in den ersten fünf Minuten wissen.»
Wutschnaubend ging der Graf von dannen. Ein eitler Geck, dieser Will Shakespeare. Er hatte sich erdreistet, ihn zu korrigieren! ‹Shakespeare, gnädiger Herr.› Bei Gott, er würde diesen Bauernlümmel lehren, in einem anderen Ton zu krähen!
Aber bei aller Frechheit und unziemlichen Selbstsicherheit hatte der Bursche Eindruck auf ihn gemacht. Da war irgend etwas an ihm, das seine Neugier reizte. Und er wollte nicht Gefahr laufen, sich einen nützlichen Schreiberling entgehen zu lassen.
Er sprach mit George Gascoigne. «Da ist ein Junge, Shakespeare oder so ähnlich. Gib ihm Federn, Tinte und Papier. Und einen Raum, wenn er ihn braucht. Er soll mir ein halbstündiges Meisterschauspiel schreiben.»
«So, so!» George Gascoigne machte eine halb belustigte, halb verächtliche Miene. Er war der Dichter. Und er wollte keine jungen Füchse neben sich haben, die ihm das Brot wegnahmen. «Was wissen wir über ihn?»
«Nichts. Außer daß er dein Maskenspiel ‹Juno› schlecht fand.»
«Aha. Welch eine seltsame Empfehlung!» Meister Gascoigne setzte ein dünnes Lächeln auf.
«Es war schlecht», sagte Leicester trocken.
Gascoigne schwieg. Er war es gewohnt, Kränkungen hinzunehmen, und er tat es wortlos. Aber er schluckte sie nicht herunter, sondern behielt sie wie Galle in der Kehle und spuckte sie denen ins Gesicht, die nicht zurückspucken konnten.
Der Graf sagte: «Wir werden das Stück in der großen Halle aufführen, zusammen mit ein paar Madrigalen und Tänzen. Wenn es gut ist, um so besser. Und wenn es so miserabel ist wie deine ‹Juno›, werden wir mit dem Burschen unseren Spott treiben.» Er versank in nachdenkliches Schweigen. Gascoigne, der ihn beobachtete, sah, wie seine kalten Augen böse funkelten und verzog seine schmalen Lippen zu einem beifälligen Lächeln.
In Wills Kopf summte und surrte es wie in einem Bienenkorb. Worte schwirrten durch die Luft, Kanonendonner und Waffengeklirr hallten in seinen Ohren, und er sah die kämpfenden Gestalten deutlich vor sich. Aber was half ihm das alles ohne eine richtige Handlung? In seinem fiebernden Geist gärte und grollte es, aber ihm fehlte der Pflock, an dem er das, was er vor sich sah, aufhängen konnte.
Er ging zu George Gascoigne. «Sir, der gnädige Herr hat gesagt, Ihr möchtet mir Federn und Papier geben.»
Gascoigne rekelte sich in einem Sessel und sah ihn unverschämt von oben bis unten an. Will unterdrückte die innere Stimme, die immer wieder rief: ‹Du kannst kein Schauspiel schreiben›, und sagte in gewichtigem Ton: «Ich soll ein Schauspiel für den Grafen schreiben.»
«Und worüber?» fragte Gascoigne. Er warf Will ein paar Gänsekiele und ein paar Bogen Papier über den Tisch. Sie fielen zu Boden.
Will bückte sich und hob sie auf. «Oh, über irgend etwas, Sir.»