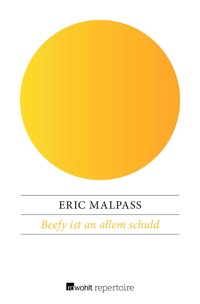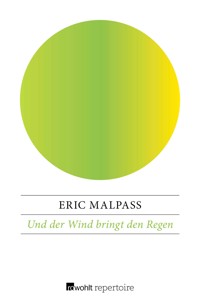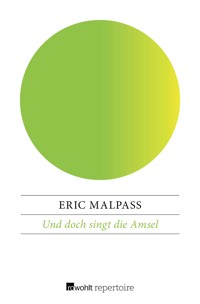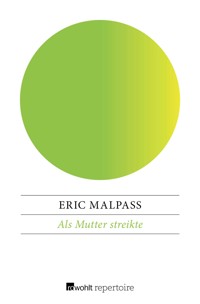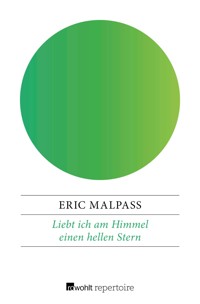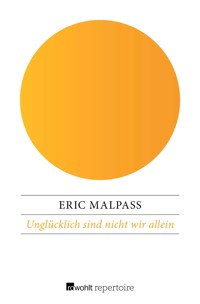4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Zeitromane
- Sprache: Deutsch
Eric Malpass erzählt in seinem Roman aus dem viktorianischen England eine einfache und bewegende Geschichte vom Alltag und den Sonntagsfreuden einer Familie, von Menschen, die das Glück des Lebens im Füreinander finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Eric Malpass
Lampenschein und Sternenlicht
Aus dem Englischen von Anne Uhde
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Eric Malpass, Vater der Sippe Pentecost mit dem Schlingel Gaylord, erzählt in seinem Roman aus dem viktorianischen England eine einfache und bewegende Geschichte vom Alltag und den Sonntagsfreuden einer Familie, von Menschen, die das Glück des Lebens im Füreinander finden.
Über Eric Malpass
Eric Malpass (1910–1996) hat in seinem Heimatland Großbritannien lange Jahre als Bankangestellter gearbeitet. 1947 wurde er Mitarbeiter der BBC, außerdem schrieb er für diverse Zeitungen. Er verfasste zahlreiche Romane und lebte als freier Schriftsteller in Long Eton, nahe Nottingham.
Inhaltsübersicht
1
An dem Tag, als Nathan Cranswicks drittes Kind geboren wurde, läuteten in der ganzen Welt die Kirchenglocken. In hunderten von Städten sprengte die Kavallerie durch die Straßen, und lärmende Freudenfeuer schossen bunte Strahlen in die dunkle Nacht. Ein Rausch der Begeisterung schien die Welt erfaßt zu haben.
Das alles hatte natürlich mit der Geburt des Kindes gar nichts zu tun. Es war einfach so, daß Jack an eben dem Tag das Licht der Welt erblickte, da das britische Empire einen letzten großen Triumph feierte: das diamantene Regierungsjubiläum der Queen. Victoria, Regina Imperatrix, war Herrin der Ozeane, Pax Britannica herrschte über Land und Meer, und die nächsten sechzig Jahre – darüber waren sich alle einig – würden ebenso ruhmreich verlaufen wie die letzten sechzig.
Draußen auf der Straße vor dem nach vorn gelegenen bescheidenen Schlafzimmer der Cranswicks war ein Straßenfest im Gang, doch drinnen gab es neben Freude und Dankbarkeit auch noch andere Gefühle. Blanche war zwar angefüllt mit zärtlicher Liebe für das winzige neue Lebewesen, aber sie wußte auch, was Sorgen und Verantwortung hießen. Sie war die Älteste, und für sie war es selbstverständlich, daß sie nun zwei kleine Brüder wie eine Glucke unter ihre Flügel nahm.
Auch die Mutter des Kindes war nicht nur erfreut, denn der ganze Kreislauf war ihr im Grunde zuwider: der animalische Vorgang der Zeugung, die ermüdende Zeit der Schwangerschaft, die Schmerzen der Geburt, die Windeln und die Übelkeit, das gierige Trinken und die kleinen Fäuste, die immer wieder an ihre Brust schlugen. Gut, es war nicht immer so gewesen. Aber dies war ihr sechstes – das reichte. Allerdings waren drei nach kurzen unklaren Schmerzen aus der zweifelhaften Sicherheit des Mutterschoßes hinübergewechselt in die sichere Zuflucht des Grabes. Aber damit blieben immer noch drei, die ihr an der Schürze hingen. Und Zilla hatte einfach keinen Sinn für Ordnung und das Praktische und würde ihn auch nie haben. Außerdem: wo sollte das enden? Sie war ein viel zu weicher und liebevoller Mensch, um jemals Nein zu sagen. Und Zeugung war nun ganz gewiß kein Thema, über das sich zwei Eheleute ruhig und sachlich unterhalten konnten.
So würde also alles so weitergehen wie bisher. Zilla war auch nie auf den Gedanken gekommen, daß sich das Leben irgendwie steuern ließe. Sie war nun einmal eine liebe, gutherzige kleine Schlampe, nachgiebig und bequem wie das Federbett, unter dem sie jetzt lag. Und daran würde sich auch nichts ändern.
Jetzt krachte Musik ins Zimmer: laute abgehackte Töne, militärische Pauken und Trompeten, es war einer der neuen Sousa-Märsche. Nathan Cranswick, glücklich im Bewußtsein, daß er einen weiteren Sohn hatte, spürte dabei, wie eine Woge freudiger Erregung in ihm aufstieg, wie sein Herz sich hob, als wolle es ihn hoch in die Luft tragen. Ein Sohn, am Jubiläumstag der Königin! Ein Sohn, und nun spielte die Kapelle in der Ferne Rule Britannia! Er schwamm in Seligkeit. Der Name –? Zilla meinte, Jack wäre hübsch. Aber es gab doch noch zweite Namen. Jack Jubilee Cranswick? Jack Britannia Cranswick? Wie alle Väter dachte er keinen Augenblick daran, was Jacks spätere Schulfreunde aus solchen Namen machen würden.
Ja, er war gerührt, er war zutiefst dankbar. Die Kapelle kam jetzt näher. In das Gewirr der ärmlichen, wenn auch soliden kleinen Straßen kam sie zwar sicher nicht, aber sie war immerhin deutlich zu hören. Nathan legte seinem älteren Sohn die Hand auf den langen Kopf und fuhr ihm mit den Fingern durch das schwarze Haar. «Was meinst du zu deinem kleinen Bruder, Jungchen?» fragte er mit halb erstickter Stimme.
Tom ließ die Augen keinen Augenblick von dem lebenden Wunder, seinem Bruder. Es war kaum zu fassen. Vor einer Stunde noch waren sie vier gewesen, Ma und Pa, Blanche und er. Dann holte man ihn ins Schlafzimmer, und nun – waren sie fünf! Als hätte Ma ein Zauberkunststück vollführt. Er wußte nicht, wie es geschehen war, aber es war so. «Brüderchen», flüsterte er leise vor sich hin. «Mein Bruder. Mein kleiner Bruder.» Für ihn war dies das schönste Wort der ganzen Sprache. Unsicher trat er näher ans Bett und schluckte. «Kann ich ihn mal anfassen?» flüsterte er.
«Natürlich, Jungchen. Aber weck ihn nicht auf, wenn’s geht.» Tom streckte seine Hand so zögernd aus, als habe er hauchdünnes Porzellan vor sich, und faßte die winzige runzlige Babyhand. Erstaunt und entzückt merkte er, wie sie sich in seiner bewegte, stark und lebendig. «Oh», seufzte er tief auf. «Mein Bruder», sagte er sich wieder. «Mein kleines Brüderchen.» Und es kam ihm vor, als seien er und sein Bruder durch dieses vertrauensvolle Hand-in-Hand für alle Zeit miteinander verbunden.
Es klopfte an der Tür. «Darf ich hereinkommen und den Neuankömmling sehen?» Nathans von allen geliebte Schwester Edith kam ins Zimmer, groß und schlank; in der einen Hand trug sie ein Gebetbuch, in der anderen einen Sonnenschirm. In dem unansehnlichen Zimmer wirkte sie wie eine Taube im Hühnerhof, aber alle freuten sich, als sie kam. Sie umarmte Blanche und Tom stürmisch, drückte mit verständnisvollem Lächeln zärtlich den Arm ihres Bruders, küßte Zilla und betrachtete kritisch das rote runzlige Bündelchen Jack. «Na, er wird sich noch herausmachen», sagte sie endlich.
«Häßlicher kann er nicht werden, das ist sicher», sagte Zilla fröhlich.
Tom war tief gekränkt. «Ich finde ihn sehr schön», sagte er aufgebracht. Blanche sah die Tränen in seinen Augen und legte schwesterlich den Arm um ihn. «Sie machen nur Spaß», sagte sie beschwichtigend. Aber das brachte Tom noch mehr auf. Sein kleiner Bruder war kein Thema für Späße. Es drängte ihn plötzlich, das Zimmer und die Erwachsenen mit ihren dummen Scherzen hinter sich zu lassen. «Kann ich jetzt raus und spielen?» fragte er bockig.
«Ja», sagte Nathan. «Komm mit, Blanche. Edith, bleib du ein bißchen hier und schwatz mit Zilla. Ich muß mich mal draußen bei den Leuten sehen lassen. Und der Pfarrer wollte auch um diese Zeit hereinschauen, hat er gesagt.»
«Mr. Clulow, meinst du?» Edith stand über das Baby gebeugt und blickte nicht auf, aber sie sah aus, als warte sie gespannt auf seine Antwort.
«Ja», sagte Nathan, der es jetzt offenbar eilig hatte, seine Frau und das Neugeborene zu verlassen.
«Ich kann nicht sehr lange bleiben», sagte Edith. Aber Nathan und die Kinder waren schon draußen.
Die Straße glich einer grauen Schlucht; fast alle Häuser erhoben sich wie Felswände aus dem grauen Steinpflaster. Nur wenige – und darunter das Haus Nr. 37 der Cranswicks – standen etwas zurück und boten Platz für einen kleinen Vorgarten und ein Erkerfenster oben und unten. Immerhin: in einer Straße mit schäbigen Reihenhäusern erhoben Erkerfenster und Vorgarten ein Haus schon beinahe in die Klasse der Aristokratie.
Aber nicht deshalb wurde Nathan Cranswick draußen so stürmisch begrüßt. Er war ein Mann, wie ihn jedes Straßenfest braucht: ein warmherziger und fröhlicher Mensch mit unkomplizierten Gefühlen, die – ob Liebe, Glück oder auch Zorn – überschäumen konnten wie ein Glas Ingwerbier.
Alle umringten ihn, wie er da stand, die eine Hand stolz auf Toms, die andere auf Blanches Schulter gelegt. «Was macht deine Frau, Nathan?»
Nathan strahlte über das ganze faltige Gesicht. «Ein Junge ist es, Freunde!»
Die Mützen flogen in die Luft, alle schrien und lachten und fanden schnell Platz an einem Tisch, wo die drei sich hinsetzen mußten und wo im Umsehen vor Nathan ein Glas Bier und vor Blanche und Tom je ein Glas herrliche, lauwarme Limonade stand. Nathan hat einen Sohn, am Jubiläumstag! Hahnenkampf war nichts dagegen. Und wenn sie Tom ansahen, dachten sie: vielleicht wuchs in dem neuen Sohn ein Ersatz heran. Wär nicht schlecht, denn Tom sah aus, als könne ihn ein Windstoß umblasen. Einige meinten bei sich, Tom werde sich wohl nicht mehr allzu lange dieser Welt erfreuen.
Tom sah sich mit großen staunenden Augen um. Stafford Street, seine Straße, war nicht wiederzuerkennen. Rot-weiß-blau in den Fenstern, an den Türen, auf den Brettertischen, die wie durch ein Wunder überall standen. Überall der Union Jack. Mr. Potter hatte sich sogar einen um den Hut gebunden. Und die Kleider! Alle kleinen Mädchen in hübschen Kleidchen und Schürzen, alle kleinen Jungen mit blankgescheuerten Gesichtern, fest angeklebten Haaren und blanken Stiefeln. Fast wie sonntags, nur daß sie heute alle so übermütig waren. Tom schlürfte seine Limonade und sah mit dunklen empfindsamen Augen um sich, verzaubert und leicht erschreckt ob dieses ungekannten Feierns, voller Angst davor, daß womöglich auf einmal die Königin selber in der Stafford Street erschien, und doch tief im Innern warm und glückselig in dem Bewußtsein, daß er einen Bruder hatte. Dieses Wissen war ein ruhiger Pol im Wirrwarr all seiner Ängste, die ihn seit eh und je bedrängten.
Jetzt stand Nathan Cranswick auf und hob sein Glas. «Auf die Königin, Freunde. Gott segne sie.»
«Gott segne sie!» riefen alle in Hörweite. Es war ein Segenswunsch, der ihnen aus dem Herzen kam, und der mehr Kraft in sich trug, als die Segnungen der Geistlichkeit. «Gott segne sie.» In dieser Straße gab es keinen Mann, der die rundliche, runzlige alte Dame im fernen London nicht liebte: die alte Frau, die das Empire war, so wie ihre Vorgängerin Elizabeth England gewesen war. «Gott segne sie», sagten alle. Unbewußt meinten sie damit Windsor und Indien und das dunkelste Afrika und all die grauen und doch gemütlichen, hungrigen Gassen Englands. Gott segne die Königin, die alle diese Dinge verkörperte!
Tom hätte sich nicht zu ängstigen brauchen: Die Königin erschien nicht in der Stafford Street von Ingerby.
Wer erschien, war der Pfarrer, Mr. Clulow.
Der Pfarrer Martin Clulow, war ein einsamer und verschlossener Mann. Einsam war er immer gewesen, besonders seit dem Tode seiner Frau vor einem Jahr. Auch verschlossen war er stets gewesen, getrennt von seinen Schäflein durch seine Stellung, sein Wissen und seine herbe Natur.
Die Gemeinde akzeptierte ihn als freundlich-reservierten Mann von anderem Schlag als gewöhnliche Menschen: ein Wesen etwa zwischen ihnen selber und dem Allmächtigen: allwissend, ohne Sünde und dennoch sterblich.
Aber er war nicht ohne Sünde. Martin Clulow hatte ein böses Geheimnis: ein Geheimnis, das ihn – hätte man es gekannt – weit unter den Verworfensten seiner Gemeinde gestellt hätte; ein Geheimnis, das so schrecklich, so finster war, daß Martin nicht einmal mit seinem Gott darüber sprach. Beide vermieden das Thema, obgleich es natürlich am Jüngsten Tag nicht mehr umgangen werden konnte, denn dann würde der ruchlose Martin Clulow trotz all seiner Gelehrtheit in den finstersten Schlund der Hölle geschleudert werden.
Kein rot-weiß-blaues Band schmückte den Pfarrer. Er war wie immer von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet, bis auf den weißen Priesterkragen, und den sah man kaum unter dem krausen grauen Bart.
Das lag nicht etwa an einem Mangel an Respekt; er war genauso patriotisch wie jeder andere. Nur war er der Meinung, man solle an einem solchen Jubeltag dem Allmächtigen in der Methodistenkapelle von Zion für seine Güte danken, nicht aber in einer aufgeputzten Straße, wo überdies so unübersehbar an jedem Tisch ein Faß Bier aufgestellt war.
Doch er war kein Spielverderber; er machte gute Miene und behielt sie sogar bei, als er bestürzt und traurig einen neuernannten Laienprediger mit einem Glas Bier in der Hand erblickte. «Ah, Mr. Cranswick», sagte er und bemühte sich, den Alkohol zu übersehen, «wie geht es Ihrer lieben Frau?»
Nathan erhob sich und behielt tapfer das Glas in der Hand. «Sie hat mir heute einen Sohn geschenkt, Mr. Clulow.»
«Oh, da gratuliere ich Ihnen, lieber Mr. Cranswick! Und an einem solchen Jubeltag! Gewiß ist Ihr Herz voller Dankbarkeit.» Er hätte gern noch etwas darüber hinzugefügt, daß ein dankbares Herz keiner alkoholischen Anregung bedürfe. Da er jedoch ein gütiger und vernünftiger Mensch war, sagte er nichts – und machte sich dann Vorwürfe, weil er feige gewesen war und nicht offen geredet hatte.
«Ja, das ist es», sagte Nathan ernst. Er wollte sein Glas an den Mund führen, besann sich aber und stellte es auf den Tisch. «Sie werden doch die Taufe vornehmen, Mr. Clulow?»
«Ja, natürlich. Mit Freuden. Ich … glauben Sie, Sie können Ihre Eltern zum Kommen überreden?»
Nathans frohe Miene bewölkte sich. «Ich werde mein Bestes versuchen, Mr. Clulow. Aber …»
Mr. Clulow berührte ihn am Arm. «Ich weiß, ich weiß. Aber sehen Sie nur zu, was Sie tun können.» Bis vor wenigen Jahren waren Mr. und Mrs. Cranswick senior wahre Säulen der Methodistengemeinde gewesen. Und dann, von einem Tag zum anderen, hatten sie keinen Fuß mehr in die Kapelle gesetzt. Niemand kannte den Grund, ihre dünnen Lippen verrieten nichts. Mr. Clulow war sehr betrübt; vermutlich hatte er irgend etwas Falsches gesagt. Und obgleich es ohne die beiden in der Kapelle Zion viel heiterer zuging, versuchte er bei jeder Gelegenheit, sie in seine Herde zurückzuholen.
Doch jetzt hatte er noch etwas anderes im Kopf. Er sagte: «Nicht wahr, Sie halten am Sonntag Ihren ersten Gottesdienst als Laienprediger, Mr. Cranswick.»
«Ja, das stimmt. In Moreland.»
«Sehr schön. Sehr schön. Wenn man bedenkt, daß Sie keine Vorbildung hatten, so haben Sie es wirklich zu etwas gebracht, Mr. Cranswick.»
Nathan strahlte. Er war ein hochgewachsener starkknochiger Mann, die langen Gliedmaßen waren locker zusammengefügt wie bei einer Puppe; er hatte ein graues, fleischiges Gesicht voller Falten und Fältchen, das nicht so leicht ein Gefühl ausdrücken konnte. War es jedoch einmal so weit, dann war das Ergebnis beeindruckend und überzeugend. Nathans strahlendes Gesicht drückte jetzt Freude, Dankbarkeit, Zuneigung und Wärme aus. «Danke, Mr. Clulow. Ich hab’s ja auch Ihnen zu danken, meine ich.»
Mr. Clulow bestritt das nicht. «Nur – trauen Sie sich zu Anfang nicht gar zuviel zu. Nicht gleich nach den Sternen greifen, nicht wahr. Jedenfalls nicht bei Ihrem begrenzten Wissen. Aber wenn Sie mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben, werden Sie gewiß zurechtkommen.» Er lächelte Nathan ermutigend zu. «Ja, übrigens – wird denn Ihre liebe Frau auch ohne Sie fertig, am Sonntag?»
«Ja. Ich nehme Tom mit, dann ist sie den los.» Er fuhr Blanche liebevoll durchs Haar. «Und du, mein Mädchen, du wirst ihr helfen, was?»
Blanche nickte schüchtern.
«Sie ist schon eine richtige kleine Hausfrau», sagte Nathan stolz. «Bringt im Handumdrehen ein Essen für die ganze Familie auf den Tisch.»
«Du bist ein gutes Kind, Blanche», sagte Mr. Clulow freundlich. Das Mädchen errötete. «Aber du mußt auch spielen und nicht nur arbeiten, weißt du.»
«Ja, Mr. Clulow.» Blanche senkte den Kopf. Der Pfarrer wandte sich zu Nathan. «Ein schüchternes kleines Ding», sagte er herzlich. «Aber ich denke, sie ist ganz glücklich dabei. Und wie steht es mit Tom?»
Tom erhob sich ungeschickt und nahm die Mütze ab. Mr. Clulow sagte: «Du mußt doch stolz sein, daß du einen Bruder hast, Tom.»
«Das bin ich auch», sagte Tom. Wie stolz er war, das ahnte keiner.
Der Pfarrer seufzte. «Beneidenswert, diese jungen Menschen was, Cranswick? Was erben sie alles! Das größte Empire, das die Welt je gesehen hat. Das Leben hat ihnen so viel zu bieten.»
«Das ist gewiß wahr, Mr. Clulow.»
«Und nun Ihr Jüngster. Genau an dem Tag auf die Welt gekommen, da Ihre Majestät … Sicher nehmen Sie das als ein Omen? Welche Namen geben Sie ihm denn?»
«Jack Jubilee.»
«Aha, ja. Ja, gewiß. Jack Jubilee.» Der Pfarrer tat etwas, was er in der Öffentlichkeit selten tat: er erlaubte sich ein kurzes Lachen. «Wir leben in einer ruhmreichen Zeit, Mr. Cranswick. Der Herr hat dieses unser Land gesegnet.»
Er brach ab. England und sein Empire waren ihm auf einmal nicht mehr wichtig. Er strich sich über den grauen Bart und glättete die dichten Augenbrauen. «Ist das nicht Ihre Schwester?»
«Ja.» Edith war gerade aus dem Hause gekommen und hatte sie bereits entdeckt; mit knappen eleganten Schritten kam sie eilig herüber. «Ich gehe jetzt, Nathan. Oh – guten Tag, Mr. Clulow.»
Er zog den Hut. «Guten Tag, Miss Cranswick. Ich wollte gerade gehen. Darf – darf ich Sie begleiten?»
«Nein – nein, vielen Dank. Ich muß noch einen Besuch machen.»
Er senkte höflich den Kopf. Und dann – so schien es Nathan – starrten sie einander lange an: sehnsüchtig, verzweifelt, hungrig. Bis die schöne und nicht mehr ganz junge Frau in die eine Richtung forteilte, und der gutaussehende, würdevolle, nicht mehr ganz junge Mann in die andere.
Und dem betroffenen Nathan kam es vor, als sei bei der Trennung eine Sehne mitten durchgerissen.
Nathan mahnte das Gewissen an seine Pflichten, und so ging er zurück und setzte sich ans Bett seiner Frau. Blanche sagte zu Tom: «In der Leicester Street braten sie einen Ochsen am Spieß. Wollen wir hingehen?»
Tom erhob sich, trank den Rest der köstlichen Limonade aus und folgte seiner Schwester ohne große Begeisterung. Er hatte eigentlich gar keine Lust auf einen Ochsen am Spieß. Der Vorwurf in den großen geduldigen Tieraugen – das würde er so leicht nicht vergessen können. Deshalb war er sehr erleichtert, als er hinkam und feststellte, daß der Ochse gar keinen Kopf hatte und erst recht keine Augen. Der unförmige fetttriefende Fleischklumpen sah überhaupt nicht wie ein Ochse aus. Wenn er je so ein starkes und edles Tier gewesen war, so hatte man ihn erniedrigt, entwürdigt, zu einem abstoßenden Stück Fleisch gemacht.
Tom war zu jung für solche Gedanken, aber ähnliches empfand er fast körperlich: Man hatte einem Lebewesen Schmerz zugefügt; bei dem Anblick zog sich alles in ihm zusammen, und seine junge Seele schauderte.
Trotzdem schämte er sich seiner Gefühle. Das siedende brodelnde Fleisch drehte sich an dem großen Spieß, die Zuschauer drängten mit ihren Tellern nach vorn, und Schlachter Hardcastle schob die Ärmel zurück; das Zischen des Messers auf dem Stahl glich dem Zischen von Schlangen, lauter als das Brutzeln und Spritzen der Fettklümpchen, wenn sie in das lodernde Feuer fielen. Tom betrachtete die grauen Gesichter unter den grauen Mützen und sah in keinem einzigen einen Ausdruck des Abscheus oder des Mitleids für die mißhandelte Kreatur. Alles was er sah, war Gier, wortloser Triumph beim Anblick von soviel gefällter Kraft, und animalischer Hunger. Und er schämte sich, daß offenbar er allein unter all diesen Menschen so unpatriotisch und unmännlich war und an diesem Jubeltag nur Mitleid mit der Kreatur aufbrachte.
«Du brauchst ’n Teller», sagte eine dünne Stimme, und Tom sah, wie Bessy Truman Blanche einen Teller hinhielt. Er war überrascht, als Blanche heftig den Kopf schüttelte und zurückwich.
Bessy warf ihr einen kurzen Blick voller Verachtung und Ärger zu. Bessy (mit Mütze, Pantoffeln und Schürze, selbst an diesem festlichen Tag) hatte den Verdacht, daß die Cranswicks sich für etwas Besseres hielten, besonders seit der Hausherr zum Laienpriester berufen worden war. Die verbitterten Augen in dem hageren Gesicht beobachteten Tom aufmerksam, als sie jetzt ihm einen Teller entgegenstreckte.
Tom wich noch heftiger zurück als Blanche. «Ganz wie du willst», murmelte Bessy und ging weiter. «Ist ihm wohl nicht gut genug», sagte sie zu Toms Nachbarn und machte eine Kopfbewegung zu Tom hinüber.
Tom wußte, daß man ihm das Erröten ansah; davor schützte ihn auch die Abenddämmerung nicht. Das Fett rann immer noch aus dem riesigen Fleischklumpen, und wenn die Spritzer auf die Kohlen fielen, schossen die Flammen hoch und erhellten die Szene wie Wetterleuchten: die flachbrüstigen Häuser, die Fenster mit den Spitzengardinen, die Mützen und die Zylinder und die mit Blumen und Früchten verzierten Hüte der Frauen; die hungrigen, listig-wölfischen Gesichter der Zuschauer, hundemüde nach einem solchen langen Feiertag; und Toms errötendes Gesicht.
Doch nun war er aufmerksam geworden. Warum war Blanche vor dem Teller zurückgewichen, als wäre er rotglühend? Sicher hatte doch keiner außer ihm dieses absurde und unnatürliche Mitgefühl für ein totes Tier? Blanche war ein Mädchen. Schlimmer, eine Schwester. Noch schlimmer, eine große Schwester. Große Schwestern hatten keine Gefühle, sie waren einfach da. Blanche war Blanche, so wie Pa eben Pa und Ma Ma war. Immerhin, plötzlich interessierte sie ihn, und er betrachtete ihr Profil.
Was er da im Dämmerlicht und im flackernden Feuerschein sah, war ein süßes, zartes, blasses und empfindsames Gesicht, umrahmt von dichtem schwarzem Haar. Er sah eine weiße Schürze, schwarze Baumwollstrümpfe und schwarze Schuhe: er sah Blanche. Aber er sah noch mehr: er sah ein menschliches Wesen.
Loll Hardcastle, der Sohn des Schlachters, reichte ebenfalls Teller herum. Wieder sah Tom, wie Blanche zurückwich. Aber damit kam sie bei Loll schlecht an. «Hier, los – nimm», sagte er ungeduldig.
«Ich will nichts», sagte Blanche und verschränkte die Arme.
«Los – nimm doch!» Loll drängte ihr den weißen Teller auf; er zwängte ihn ihr fast zwischen die vor der Brust gekreuzten Arme. Blanche ließ mit einem leisen Ausruf des Widerwillens die Arme fallen, und der Teller zerbrach auf dem Kopfsteinpflaster.
«Dumme Kuh!» schrie Loll Hardcastle.
«Du glaubst wohl, die Teller wachsen auf den Bäumen!» rief der Schlachter, der noch immer geräuschvoll das Messer am Stahl wetzte.
Blanche wäre am liebsten im Boden versunken. Tom stand jetzt zu ihr. «Das sagst du nicht noch mal zu meiner Schwester!» rief er Loll zu.
Loll kam zu ihm zurück. «Was soll ich nicht sagen?» fragte er grinsend.
Tom schluckte. Er brachte es nicht fertig, ein Schimpfwort wie «dumme Kuh» auszusprechen. «Was du eben gesagt hast», erwiderte er lahm.
«Na, was hab ich denn gesagt? Was hab ich gesagt zu der dummen Kuh?»
Jeder kannte Tom als netten, höflichen gesitteten Jungen, der keiner Fliege ein Leid antun konnte. (Wie auch? Mit dem kleinen abgemagerten Gesicht, den dünnen Fingern, die aus der zu großen Jacke herauslugten, und den spindeldürren Beinen war er ja selber nicht mehr als ein Fliegengewicht.) Das fand Tom im Grunde auch selber. Doch nur er wußte, daß hinter der ruhigen Verhaltenheit eine Peitsche des Zorns steckte, die sich monate- oder jahrelang nicht rührte, die ihn aber innerhalb einer Sekunde in einen anderen Menschen verwandeln konnte. Er war fast selbst überrascht, als er mit seiner kleinen knochigen Faust Loll einen knallharten Schlag auf die Nase versetzte.
Der Schlag war ungeübt, aber wirksam. Loll Hardcastle heulte auf, griff sich an die Nase und ließ dabei den ganzen Tellerstapel fallen.
Tom war jetzt schrecklich verwirrt; sein Zorn war so schnell verflogen, wie er gekommen war. Er ließ sich auf die Knie nieder, durchsuchte die Scherben und fand zwei heile Teller, die er schweigend und demütig Mr. Hardcastle hinhielt.
Doch Mr. Hardcastle hatte mit dem Servieren begonnen. Sein Messer fuhr spritzend durch das saftige, würzige Fleisch, und auf Toms oberen Teller ließ er eine dicke Scheibe fallen – fettes, siedendes, aromatisches Ochsenfleisch.
Tom war nahe daran sich zu übergeben, aber er bezwang sich. Er war ein sehr zurückhaltender Junge und hatte für heute schon reichlich viel im Rampenlicht gestanden. Unbemerkt stellte er die Teller auf eine weiße Steinstufe und gesellte sich dann vorsichtig und leise zu Blanche. «Warum wolltest du keinen Teller?» flüsterte er.
«Ich mochte das nicht», sagte sie. «Mir waren einfach alle zuwider. Das arme Tier», fügte sie erklärend hinzu.
«Ja.» Einträchtig begaben sich die Geschwister fort von der Freßorgie. Dann sagte Blanche zögernd: «Vielleicht müssen sie sonst immer hungern. Und dann gibt’s auf einmal so viel zu essen – kaum zu fassen. Da wollten sie einfach nichts verpassen.»
«Ja», sagte Tom noch einmal. Plötzlich war er froh. Ja, so war es sicher. Die Menschen waren gar nicht gierig. Aber was konnte man erwarten, wenn man einer Menge hungriger Menschen plötzlich einen ganzen gebratenen Ochsen vorsetzte? Tom war froh, daß Blanche das nicht gesagt hatte. Er mochte nicht gern schlecht von den Menschen denken.
Sie hatten jetzt die hektisch-heiße Straßenschlucht hinter sich gelassen. Hier war die Luft kühl und frisch; die Häuser waren etwas zurückgesetzt, so daß die beiden am Himmel den goldenen Nachglanz des großen Tages sehen konnten. Während sie dort noch standen, schoß eine Rakete in den Abendhimmel, hing einen Augenblick still, zerbarst dann und fiel in einem Schauer glitzernder Sterne zur Erde nieder, unter den spöttischen Augen des Abendsterns, der hell und rein ohne jegliche Hilfe vom britischen Empire am Himmel erschienen war und der noch hell und rein dort stehen würde, wenn das Empire – so unwahrscheinlich das anmutete – längst zu Staub zerfallen war.
Wieder durchdrang die weiche Abendluft das zischende Geräusch und das Platzen einer Rakete. «Hoffentlich wacht unser Jack nicht davon auf», sagte Tom besorgt und vorwurfsvoll.
Blanche lächelte. «Schade», sagte sie, «das alles an seinem Geburtstag, und er weiß nichts davon. Er wird sich an gar nichts erinnern.» Sie schob ihre Hand in Toms Hand. «Aber wir vergessen das nicht, nicht wahr?»
Hand in Hand schlenderten sie nach Hause: zwei kleine Menschen, älter als ihre Jahre, die kurz vom Glück der Erwachsenen gekostet hatten.
2
«Ich muß es den alten Herrschaften wohl sagen», meinte Nathan Cranswick mißmutig.
«Wenn du’s nicht tust, gibt’s Ärger», meinte Zilla und fügte dann nachdenklich hinzu: «Und wenn du’s tust, auch.»
Sie lächelten einander zu. Es war das etwas schiefe Lächeln, mit dem sie so viele der kleinen täglichen Ärgernisse aufnahmen. «Ja. Und dem Pfarrer liegt daran, daß sie zur Taufe kommen. Das werden sie auch nicht gern schlucken.» Er seufzte. «Ich bring’s am besten gleich hinter mich», sagte er, stand auf und drückte seiner Frau einen Kuß auf die Stirn. «Auf bald, mein Kleiner», flüsterte er dem schlafenden Jack Jubilee zu. Dann machte er sich auf den Weg zu den Eltern.
Er war noch nicht draußen, als Blanche und Tom ins Zimmer stoben, dann anhielten, kicherten und artig stillschwiegen.
«Na, na, die Mutter kann keinen Lärm gebrauchen», sagte Nathan munter. Nicht, daß ihm etwa munter zumute war, und von dem Besuch bei seinen Eltern war auch nicht viel Aufmunterung zu erwarten. Leise schloß er die Tür hinter sich.
Blanche – wie immer die Wortführerin – fragte: «Können wir Tante Täubchen besuchen?»
«Ja, wenn ihr nichts Besseres zu tun habt.» Zilla nickte lächelnd. «Komm her, Tom, laß mal sehen, wie du aussiehst.»
Tom trat vor, und Zilla blickte ihn zärtlich an. Sie wußte, eine Mutter sollte kein Lieblingskind haben. Aber Tom –? Es war, als sei das Kind mit dem traurig-nachdenklichen kleinen Gesicht durch unsichtbare Bande mit ihrem Herzen verbunden. Was immer Tom zu leiden hatte, das litt sie mit. Die langen Nächte mit Ohrenschmerzen oder Zahnweh: bei Kerzenlicht hatten sie und Tom gemeinsam sie durchgestanden. Und sie hätte geschworen, daß sie dabei ebenso gelitten hatte wie er.
Trotzdem musterte sie ihn streng. Er stand da, den schmalen Körper eingepackt in den auf Zuwachs berechneten Anzug, und wartete schweigend und geduldig auf ihr Urteil.
Endlich lächelte sie und sagte: «Es geht. Aber bleibt nicht zu lange. Ich will nicht, daß ihr die halbe Nacht draußen seid, Diamant-Jubiläum hin, Diamant-Jubiläum her.»
«Ja, Ma», sagten sie, ohne auf ihre Worte zu achten. Sie wußten, Ma hatte ihre Anweisungen noch schneller vergessen als die Kinder.
Dann waren sie fort, und Zilla wandte sich wieder um und starrte fast mit Abneigung auf ihre jüngste Bürde. «Kann mir nicht vorstellen, daß du viel leiden wirst», flüsterte sie. «Nicht wie Blanche – die leidet für alle mit. Aber sie ist stark. Und auch nicht wie Tom. Nein, nicht wie Tom, der arme kleine Kerl.»
Mit einer halbherzigen Geste versuchte sie, die Bettdecke glattzuziehen, aber sie ließ sich nicht glattziehen, und Zilla gab es bald auf. Zilla gab immer bald auf. Sie hatte sich längst damit abgefunden, daß sie keinerlei Macht über leblose Gegenstände hatte. Sie boten ihr einfach Trotz. Wenn sie, was selten geschah, ihre Küche aufzuräumen versuchte, so sah das Ende stets genauso aus wie der Anfang: ein Haufen schmutziger Kochtöpfe, mehrere Krüge, die alle einen Fingerbreit Milch enthielten, auf jedem Stuhl ein Stapel Zeitungen, Schränke, die beim Öffnen ihren Inhalt auf den Fußboden ergossen, ein Wäscheständer, der stets mit zwei Wäschestücken vor dem Feuer stand. Nathan pflegte scherzend zu sagen, bevor man in Zillas Küche irgend etwas tun könne, müsse man erst immer etwas aus dem Weg räumen.
Nathan Cranswick wohnte in einer der vielen grauen Gassen einer reizlosen Stadt in den Midlands, und doch war es ihm nie in den Sinn gekommen, sich zu fragen, warum er deshalb nicht der glücklichste Mensch auf der Welt sein sollte. Was er im Grunde auch fast immer war.
Doch woher er auch seinen Frohsinn hatte: von seinen Eltern hatte er ihn nicht.
Mr. Cranswick senior sah aus, als sei sein Gesicht aus graurotem Sandstein geschnitten und daher außerstande, jemals zu lächeln oder sonst ein Gefühl zu zeigen, außer grämlicher Ablehnung. Es war eigentlich nur der Rahmen für zwei gelbliche Augen, einen Mund, der einer stählernen Falle glich, und Nasenlöchern, die jeden üblen Geruch aufnahmen, doch niemals den Duft einer Rose bemerkten. Das also war das Gesicht, von dem Nathan an der unwillig geöffneten Haustür begrüßt wurde.
Vater und Sohn sahen einander an. Dann rief der alte Mann in die Küche: «Nathan isses, Ma.»
«Soll reinkommen», hörte man eine schrille unmelodische Stimme.
«Komm rein», sagte Nathans Vater.
«Tag.» Nathan trat in den schäbigen Flur. «Geh nur durch», sagte sein Vater.
Nathan ging nach hinten. «Hallo, Ma.»
«Du hast was getrunken», sagte seine Mutter. Ihr starrer Blick wirkte durch die dicken Brillengläser noch aggressiver.
Es war seltsam. Auf der Kanzel, mit seinen Freunden oder im Kreise seiner Familie war Nathan ein selbstsicherer, natürlicher und heiterer Mann. Sobald er vor seinen Eltern stand, war er wieder zwölf Jahre alt. «Nur ein Glas, Ma», sagte er.
Emily Cranswick schnaubte. «Willst dich setzen?» Sie wies auf einen ungepolsterten Stuhl.
«Danke.» Er setzte sich. «Wir haben wieder eins», sagte er.
Sie starrten ihn an. Endlich sagte sein Vater ungläubig: «Du willst doch nicht sagen …»
Nathan nickte. Sie starrten immer noch. Dann sagte sein Vater:
«Du mußt ja wohl verrückt sein.»
«Ihre Schuld isses», sagte seine Mutter gelassen. «Hat nie keinen Verstand gehabt.»
Nathan, wieder zwölf Jahre alt, sagte: «Es war nicht ihre Schuld. Meine war’s.»
«Dann solltest du dich schämen», erwiderte sein Vater.
«Ich dachte, du hättest genug Münder zu füttern», sagte seine Mutter.
Nathan schwieg. Sie schwiegen alle. Doch Mrs. Cranswick besaß zwar so viel Mutterinstinkt wie ein weiblicher Kuckuck, war aber nicht ohne großmütterliche Neugier. «Was isses?» wollte sie wissen.
«’n Junge.»
«Wie soll er heißen?»
«Jack Jubilee. Oder Jack Britannia.»
«Oha», sagte sein Vater.
«Was für ’n Name, wenn man jeden Morgen damit aufstehen muß», sagte seine Mutter.
Wieder schwiegen sie. Dann sagte Nathan: «Wir würden uns freuen, wenn ihr zur Taufe kommen könntet.»
Sie starrten, blickten einander fragend an, dann ging der Blick zurück zu ihrem Sohn. «Da wird er wohl auftreten, was?» fragte Bert Cranswick angewidert.
«Mr. Clulow? Ja, natürlich.»
Emily verkündete den gemeinsamen Beschluß. «Vielleicht. Vielleicht auch nicht.»
«So ist es», sagte Bert. «Vielleicht. Oder vielleicht auch nicht.»
«Kommt drauf an», sagte Emily.
«Ja. Auf allerhand», sagte Bert.
Ende des Wechselgesangs. Nathan erhob sich halb. «Dann will ich mal gehen», sagte er.
«Wie geht’s ihr?» fragte seine Mutter.
«Gut, danke.» Er ging zur Tür.
«Warte.» Die Mutter verschwand in der Küche und kam mit einem Krug zurück, den sie ihm in die Hand drückte. «Kannst du ihr geben», sagte sie. «Pfeffergurken.»
«Danke», sagte Nathan. «Danke, Ma.»
«Pfeffergurken», sagte sie. «Wird sie mögen.» Beschämt und verlegen, daß sie Gefühl gezeigt hatte, schloß sie die Tür hinter ihrem Sohn und ging schnell in die Küche zurück. «Jack Jubilee», sagte sie abfällig zu ihrem Mann. «Nicht zu glauben.»
«Hätten ihn ja auch Bert nennen können», sagte Bert. «Aber sie tun doch, was sie wollen.»
«Kann man nichts machen», sagte Emily. Und sie erstarrten wieder in Schweigen, wie Glut in der Asche.
Zu den vielen Dingen, die Tante Täubchen eine besondere Aura verliehen, gehörte die Tatsache, daß sie in einer Wohnung lebte, während alle anderen in Häusern wohnten.
Die Wohnung lag über der Schlachterei Hardcastle; das hieß, daß sie sich meistens hoch über allen anderen aufhielt, und wenn sie sich zu gewöhnlichen Sterblichen gesellen wollte – zu Besuchen oder beim Einkaufen oder auf dem Weg zur Bücherei, wo sie arbeitete –, dann mußte sie herabsteigen. Wie der Erzengel Gabriel, oder der Allmächtige selber. «Seht, sie steigt herab aus den Wolken», hatte Nathan einmal gesagt. Doch der Scherz hatte nicht gezündet, denn die Kinder hatten ihn wörtlich genommen, und Zilla wußte nicht recht, ob er es an Respekt für das methodistische Gesangbuch oder für den Allmächtigen fehlen ließ, und mochte ihn daher in keinem Fall gutheißen.
Jetzt lag Abenddämmerung über der kleinen Stadt; die Straßen waren verlassen, denn alle Leute waren entweder zum Feuerwerk in den Park gezogen, oder sie saßen im Pub, oder sie waren schon berauscht zu Hause. Die beiden Kinder waren deshalb überrascht, als plötzlich Pfarrer Clulow vor ihnen auftauchte, gerade als sie auf die Tür zugingen, die zu Tante Täubchens Treppenhaus führte. Eben war er noch nicht da, und im nächsten Moment stand er vor ihnen. Tom wußte zwar, daß ein methodistischer Pfarrer mit Zauberei nichts zu tun haben konnte, aber sie erschraken trotzdem.
Und das Seltsame war, daß Mr. Clulow offenbar genauso erschrocken war. «Ah – hallo ihr – Kinder», sagte er offenbar verwirrt. «Wo wollt ihr denn hin?»
«Zu Tante Täubchen, Mr. Clulow», sagte Blanche und knickste.
«Ah ja, zu Miss Cranswick. Nun, dann geht nur zu.»
Abwartend sah er ihnen nach, als sie die Tür aufschoben.
«Guten Abend, Mr. Clulow», riefen sie.
«Guten Abend», sagte er. Dann wandte er sich um und ging die Straße hinunter, ein einsamer Mann unter dem Licht der Gaslaternen.
Blanche und Tom stiegen bedächtig die linoleumbelegten Stufen zu Tante Täubchens Wohnung empor. Ihre Mutter hatte zwar belustigt gesagt: «Wenn ihr nichts Besseres zu tun habt», aber es gab ja auch gar nichts Besseres als einen Besuch bei Tante Täubchen. Denn alles um Tante Täubchen war so ganz anders als das tägliche Leben daheim.
Weder sie selber noch sonst jemand wußte, wie sie zu diesem ungewöhnlichen Namen gekommen war. Aber er paßte zu ihr, denn sie hatte wirklich etwas Taubenhaftes. Die Stimme – im Gegensatz zu dem harten Akzent der Midlands ringsum – war sanft und gurrend. Alle ihre Bewegungen waren sacht und ruhig. Sie nahm kleine Bissen beim Essen; sie war adrett und gelassen und sah immer gepflegt aus. Taubengrau war die Farbe, die ihr am besten stand und die sie fast immer trug. Das Gesicht war oval, weich und heiter, und der Busen war so sanft gerundet wie eine Vogelbrust.
«Hallo, ihr zwei», sagte sie, als sie die Tür geöffnet hatte. Merkwürdigerweise schien sie nicht recht zu wissen, was sie weiter sagen sollte; erst nach einer Weile fragte sie, als suche sie verzweifelt nach einem Gesprächsthema: «Habt ihr es denn schön gehabt heute?»
Sie kamen ins Zimmer und setzten sich. Tom ließ sich offenbar erschöpft in einen der bequemen Sessel fallen. «Ja, danke schön, Tantchen.»
«Und was hast du gemacht, Tantchen?» fragte Blanche höflich.
«Ich bin zur Messe gegangen. Und danach bin ich zu Hause geblieben.»
«Du warst in der Kirche?» fragte Blanche erstaunt.
Tante Täubchen nickte lächelnd.
«Es ist doch gar nicht Sonntag heute.»
«Nein. Aber die Königin ist das weltliche Oberhaupt meiner Kirche, und da gehört es sich wohl, daß wir ihr Jubiläum feiern, meint ihr nicht?»
Das war wieder eins der geheimnisvollen Dinge um Tante Täubchen: ihr anglikanischer Glaube. Manchmal nahm sie Sonntag morgens Blanche mit zum Hochamt; das war für Blanche eine Welt, die dem Himmel näher war als der Erde. Der Gottesdienst in der Methodistenkapelle von Zion war einfach wie eine Fortsetzung des Alltagslebens im Hause Cranswick: dort waltete Mr. Clulow in seinem üblichen dunklen Anzug schlicht und unauffällig seines Amtes in einer Umgebung aus Kiefernholz und braunem Farbanstrich; während die anglikanische Kirche von St. Lukas angefüllt war mit göttlichen Wundern: Priester in Gold und Weiß, Meßdiener in Leinen und Spitzen, der Chor rotberockt. Unablässig geschah etwas: man roch Weihrauch und Kerzenwachs, die Augen tranken Helligkeit und Farben, in den Ohren klangen helle Knabenstimmen, die Seele trank Ehrfurcht und Gottesnähe. Da saß man, blickte auf die alten Steine und die Gedenktafeln für die Toten; man hatte neben sich Tante Täubchen, die heiter und aufrecht stand oder die Knie beugte oder in der Bank niederkniete oder sich bekreuzigte: das alles war, als nähme ein Engel einen bei der Hand und sagte: «Sieh, eine Stadt von lauterem Golde gleich dem reinen Glase.»
Tante Täubchen sah ihre kleinen Freunde lächelnd an. «Und ihr habt euch schön amüsiert bei dem Straßenfest?»
Sie nickten, schon etwas schläfrig.
«Hungrig seid ihr also nicht –?»
Tom lachte. «Doch –»
Tante Täubchen ging in die Küche und kam gleich darauf wieder mit einem Steinkrug voll Ingwerbier, zwei Gläsern und einem prachtvollen dunklen klebrigen Kuchen.
Zwei Paar Augen hefteten sich hungrig an die Ingwerbierflasche. In ihrem jungen Leben war so eine Flasche das Symbol für ein außergewöhnliches und ausgedehntes Fest, vom ersten schäumenden Glas bis zum letzten säuerlichen kleinen Tropfen. Zu Hause wurde der Inhalt millimetergenau eingeteilt und dann in dem Bewußtsein getrunken, daß jeder Schluck die Anzahl der restlichen Schlucke verminderte. Bei Tante Täubchen hingegen konnte man ganz unbekümmert trinken, ihre Flasche hatte etwas vom biblischen Ölkrüglein der Witwe. Tom räkelte sich und trank und stopfte sich mit Kuchen voll. Tante Täubchen sah ihn mit leichtem Mißfallen an und sagte:
«Mein Junge, beim Essen und Trinken läßt man die Schultern nicht hängen. Man setzt sich gerade hin und gibt sich den Anschein, daß man interessiert und dankbar ist und freut sich, daß es einem schmeckt.»
Tom setzte sich hastig gerade. Der kleinste Tadel brachte ihn aus der Fassung. Auch Blanche, die kerzengerade am Tisch saß, versteifte sich. Ihr lag viel daran, von Tante Täubchen zu lernen; sie hätte es zwar nicht ausdrücken können, aber Vornehmheit gefiel ihr, und Tante Täubchen war der einzige Mensch, den sie kannte, der ein bißchen vornehm war.
«Wir haben Mr. Clulow unten auf der Straße getroffen», erzählte Tom.
«Ja –?» sagte Tante Täubchen und faßte mit der schlanken Hand leicht an ihren Halskragen, bevor sie noch einen kleinen Schluck Wein trank. «Er wird sicher euer neues Brüderchen taufen, nicht wahr?»
«Ja. Er war gerade unten vor deiner Haustür.»
«Wirklich?» Tante Täubchen schien von diesem Zufall nicht weiter beeindruckt zu sein. Doch im stillen sagte sie sich, wieder und wieder: ‹O Martin, mein Liebster, mein lieber Liebster – wir sind ja verrückt. Wir spielen mit dem Feuer. Es kann nicht gutgehen, Martin. Es kann einfach nicht gutgehen.›
3
Die Methodistenkirche hatte still und unauffällig dafür gesorgt, daß Nathan so etwas wie Bildung erhielt.
Er war vom Beruf her ein kleiner, aber erfolgreicher selbständiger Maurer. Das Besondere an ihm war die Arbeit, die er außerhalb seiner Werkstatt leistete: Abendunterricht, Sonntagsschule, Betstunden; dort traf er – zu seinem heimlichen Stolz – auf fast gleicher Stufe mit Männern zusammen, die ihm an Bildung und Wissen überlegen waren. Und nun war es so weit, daß seine Ausbildung sonntags auf die Probe gestellt und gerechtfertigt werden sollte. Denn er war jetzt als Laienprediger in der Methodistenkirche angenommen worden, und das erfüllte ihn mit Demut und Dankbarkeit und stillem Stolz. Er war auch ehrlich genug sich zu sagen, wenn die jahrelange Arbeit ihn sowohl geistig wie sozial weitergebracht hatte, dann war eben beides wichtig für ihn.
Am folgenden Sonntag legte er also alle Spuren des Maurermeisters Nathan Cranswick ab und verwandelte sich in den Laienprediger Mr. Nathan Cranswick. Dazu setzte er nicht etwa eine wichtigtuerische Miene auf oder dachte in frommen Sprüchen. Nein: er blieb der gleiche Nathan – amüsiert, freundlich, witzig, handfest-irdisch und dabei stets fest im Glauben an den himmlischen Vater. Die Verwandlung ging so vor sich, daß er in das Kragenbündchen seines Flanellhemds vorn und hinten einen Knopf einsteckte und daran den steifen weißen Kragen mit der Steckkrawatte befestigte. Dann wurden an die Hemdsärmel zwei steife weiße Manschetten geknöpft, worauf Nathan Rock und Zylinder anlegte, die Manschetten herunterschüttelte, Bibel, Gesangbuch und Stock ergriff und seine Frau zum Abschied küßte. Dann machte er sich auf den langen Weg in das Dorf, in dem er den Gottesdienst zu halten hatte und wo – wäre er nicht gewesen – die Methodisten nur die schwere Wahl zwischen dem Anglikanismus und dem blanken Nichts gehabt hätten.
Er ging mit beschwingten Schritten und kam bald aus den grauen Straßen in hübsche Vororte und dann hinaus aufs Land, wo Wildmöhren und Löwenzahn die Wege säumten. Beglückt sah er, wie sich die Welt von hartem Grau in weiches Grün verwandelte, wie Fabrikschornsteine Ulmen und Pappeln wichen und das Steinpflaster weichen Sandwegen Platz machte. Seine Stimmung hob sich bei jedem Schritt, beim Anblick jedes Vogels und jedes grünen Busches. Und nach etwa vier Meilen war sein Herz weit geöffnet zum Lobe des Herrn.
Er ging nicht allein. Tom, sauber und blankgescheuert wie ein Hirtenjunge aus Porzellan, schritt ernsthaft neben ihm.
Anfangs waren beide gehemmt und redeten kaum; Väter und Söhne haben oft wenig Gemeinsames. Tom und sein Vater fanden es ganz natürlich, daß einer, der nichts zu sagen hatte, auch nichts sagte. Plätschernde Unterhaltung war ihnen so fremd wie ein Frack mit weißer Binde. Außerdem war Tom angefüllt mit Ängsten und Spannung. Er kannte bisher nichts als karge städtische Straßen und sollte nun «das Land» kennenlernen, für ihn eine vage formlose Gegend mit Kühen und Pferden und Bullen und bissigen Hunden. Landwege hatte er nie gesehen, und als er die vielen Blumen am Rande der staubigen Landstraße sah, fragte er:
«Wer hat all die Blumen gepflanzt, Pa?»
«Gott», sagte Nathan. Für ihn war das eine ganz vernünftige und annehmbare Antwort; außerdem war er in Gedanken bei seiner Predigt.
Tom sah im Geist Gott mit einer kleinen Schaufel am Werk, und das Bild gefiel ihm. Es mußte allerhand Arbeit gewesen sein, selbst für jemanden, der Himmel und Erde in sechs Tagen erschaffen hatte. Vielleicht hatte er sich am Sabbat erst mal schön ausgeruht und das hier am achten Tag vollbracht.
Tom stapfte weiter. Die Spitzen weiß vom Staub, schleiften seine Schuhe über den steinigen Boden. Pa nahm seine Hand; ihm fiel erst jetzt ein, daß Toms Schulweg nur etwa zwei Meilen lang war und daß der Junge auch nicht zu den Stärksten gehörte. «Ist nicht mehr weit», sagte er tröstend. Er hatte keine Ahnung, wie weit es noch war. Doch zu seiner großen Erleichterung bog die Landstraße jetzt ab zum Fluß. Einen Fluß hatte Tom noch nie gesehen, und so war die Müdigkeit schnell vergessen.
Robert Heron, Gutsherr auf Moreland Hall in Derbyshire, war auf dem Weg ins Dorf, um seinen neuen Laienprediger zu begrüßen. Der stille Sonntagmittag tat ihm wohl. Er war nicht der Mann, so etwas mit poetischen Etiketten zu versehen oder seinem Herrgott dafür zu danken. Er genoß einfach den Tag, so wie Rover, sein goldfarbener Retriever, ihn genoß. Eine sonnendurchflutete englische Landschaft und zu Mittag dann ein zarter Lammrücken: mehr konnte sich ein Mensch nicht wünschen.
Robert Heron gehörte zu den Engländern, die man sich in ihren besten Jahren vor einem Hintergrund aus Tudors, Kricket, Roastbeef mit Yorkshire Pudding, erstklassigem Tweed und Landleben vorstellt. Sein Gesicht war frisch, von Sonne, Wind und Regen gebräunt, der Blick klug und freundlich. Drei Mahlzeiten am Tag verzehrte er mit gutem Appetit. Er war kein eifernder Methodist; Alkohol war für ihn ein guter und geschätzter Freund.
Er war verheiratet, und seine Frau wäre außer sich gewesen, hätte man ihr gesagt, was zweifellos zutraf, daß er sie weit besser verstand als sie ihn. Sie hätte es niemals geglaubt. Das Gesinde liebte und verehrte ihn.
Doch an seinem Horizont gab es an diesem schönen Morgen eine Wolke. Seine Frau hatte gewollt, daß dieser Prediger zusammen mit der Dienerschaft in der Küche zu Mittag aß. «Wie ich höre», hatte sie abfällig erklärt, «ist er –» dramatische Pause, dann mit verengten Augen und mitleidiger Herablassung – «ein Handwerker.»
«Das ist mir egal, und wenn er Straßenkehrer ist. An seinem einzigen freien Tag geht der Mann meilenweit, um Leuten wie Martha Kenwoody ein wenig Erbauung zu bringen. Er ißt mit uns.»
Widerspruch schätzte Dorothy Heron nicht. Sie war dann beleidigt, aber zum Streit ließ sie es selten kommen, «ach, Robert, er wird sich bei den Dienern viel wohler fühlen, glaub mir.» Sie troff geradezu vor Mitgefühl mit dem abwesenden und ihr unbekannten Nathan Cranswick. «Diese Leute können sehr oft gar nicht mit Messer und Gabel umgehen, weißt du.»
«Liebe Doll, wenn er die Bibel auszulegen versteht, dann werden ihm Messer und Gabel auch keine Schwierigkeiten machen.»
«Darum geht es nicht. Er wird sich bei uns nicht wohlfühlen, und wir uns auch nicht. Und nenne mich bitte nicht Doll.»
«Sorry. Dorothy. Wir essen also zu dritt.» Damit wandte er sich ab – anscheinend ungerührt, anscheinend durchaus der Herr im eigenen Haus und auf dem eigenen Besitz. Doch er wußte, ganz so einfach war es nicht. Eine Niederlage für Dorothy war niemals ein uneingeschränkter Sieg für ihn. Der Abnutzungskrieg, der darauf folgte, war immer ermüdend und nervenaufreibend.
Er traf auf einen Mann mit großen knochigen Händen, großen Füßen und einem ledernen faltigen Gesicht, das einer alten ramponierten Reisetasche glich. Da der Mann staubige Stiefel hatte und eine Bibel mit Gesangbuch in der Hand trug, streckte ihm Robert Heron freundlich die Hand entgegen. «Mr. Cranswick? Sie haben einen tüchtigen Marsch hinter sich. Willkommen. Und hier haben wir –?» Er lächelte Tom zu.
Tom hielt ihm seine müde Hand entgegen und nahm die Mütze ab. Lächeln konnte er nicht mehr, Nathan sagte: «Mein Sohn Tom.» Er sah Roberts großkarierten Tweedanzug, die Stiefel, blank wie frischgefallene Kastanien, den steifen niedrigen Hut. Er sah auch das gute offene Gesicht, das fast so blank schien wie die Stiefel. In den Fingern spürte er noch den warmen Willkommensdruck der Hand. Von diesem Augenblick an gehörte er Robert Heron mit Leib und Seele.
Nie hatte Nathan jemanden gekannt, der so viel Autorität und gleichzeitig so viel Charme besaß wie Robert Heron. Solche Männer gab es nicht in Nathans Welt. Die besten Lehrer Englands hatten ihn erzogen, die besten Schneider Englands arbeiteten für ihn, Fuchs- und Moorhuhnjagd hatten ihm ihren Stempel aufgedrückt. Doch das alles hätte Nathan Cranswick ohne die Wärme und Freundlichkeit dieses Mannes nicht weiter beeindruckt.
Robert sagte: «Hallo, Tom, du siehst müde aus.» Er lächelte Nathan zu. «Sie sind zum Lunch bei uns.»
Nathans offenes Gesicht verzog sich zu einem breiten Lächeln. «Das kann ich gebrauchen. Danke! Ich muß zugeben, daß ich ziemlich hungrig bin. Danke!» Sie stiegen den Hügel hinauf.
Jetzt bogen sie in die kiesbedeckte Einfahrt ein, die von Rhododendron und Lorbeerbäumen eingefaßt war. Die Bäume hörten auf und das Haus stand vor ihnen, breit und viereckig, aber nicht eigentlich imposant, mit einem Säulenvorbau, der Nathans ganzes Haus hätte aufnehmen können, der aber in dieser Umgebung eher bescheiden wirkte.
Als Tom das Haus sah, blieb er abrupt stehen. Da konnten sie doch nicht hineingehen!
Jetzt stellte Robert Heron eine Frage, die, wie er meinte, geklärt werden mußte. «Mr. Cranswick, ich trinke gewöhnlich ein Glas Bier vor dem Essen. Aber heute sind Sie ja mein geistlicher Mentor. Ich möchte Sie nicht irgendwie in Verlegenheit bringen.»
«Ich würde gern eins mittrinken», sagte Nathan einfach.
«Wirklich? Das ist großartig, mein Bester.»
Nathan nahm Tom an die Hand und setzte ihn wieder in Bewegung. Sie gingen also tatsächlich auf die enorme Haustür zu. Sie wurde von einem Mann in schwarzem Rock geöffnet, der Tom etwas beunruhigte, weil er ihm die Mütze abnahm und sie irgendwo verschwinden ließ. Ein Trost war nur, daß er das gleiche mit Pas Hut und Stock tat.
Dorothy mußte bei Tisch enttäuscht feststellen, daß dieser Prediger sehr wohl mit Messer und Gabel umzugehen wußte. Oder er war so aufmerksam und umsichtig, daß es wenigstens so aussah.
Um Punkt zwei Uhr fünfundvierzig führte Robert Heron – jetzt in Gehrock und Zylinder – sein Gefolge hinunter zum Nachmittags-Gottesdienst.
Neben ihm schritt sein neuer Freund Nathan Cranswick, und beide Männer unterhielten sich so zwanglos und froh, als hätten sie einander ihr Leben lang gekannt. Dann kam Dorothy Heron, groß und stattlich. Es folgten Mrs. Hill, die Köchin, mit Mr. Hill, dem Butler, und zuletzt Dina, das Kleinmädchen, das sich laut Anweisung ihrer Herrin um den Sohn des Predigers zu kümmern hatte.
Tom blickte Dina schüchtern von der Seite an und stellte fest, daß Mädchen doch nicht immer nur Jungens zweiter Ordnung waren. Es waren Wesen, die zwar als Bestandteil zur Welt gehörten, die aber der Welt einen Glanz und Zauber verliehen, von dem man nur träumen konnte. Dina war von den Mädchen in der Stadt, die Tom bisher kannte, so verschieden wie ein sonnenreifer Apfel von einer gelben Quitte. Ihre Haut war fest und gebräunt von Sonne und Wind; und vor allem strahlte sie vor unbekümmerter Lebensfreude. Tom starrte sie an wie einen sehr irdischen Engel.
Ein Sonntagnachmittag im Sommer ist nicht ganz die richtige Zeit für einen Gottesdienst. Die Jungen treten unruhig gegen die Kirchenbank, weil sie Wiesengras unter den Füßen haben und im Fluß herumtoben wollen. Die Alten, angefüllt mit Roastbeef, Yorkshire Pudding und Apfelauflauf, kämpfen heroisch gegen die blamable Versuchung des Einschlafens während der Predigt. Einige machen es wie Martha Kenwoody und zählen entschlossen bis tausend, wobei sie bei Fünfzig jedesmal ein lautes «Hallelujah!» von sich geben, ein Trick, der nicht nur sie selber wachhält, sondern auch ihre Altersgenossen nicht einschlafen läßt.
Die Liebenden aber haben nur Blicke für die Geliebten und denken weit mehr an stille Waldgründe und einsame Wiesen als an die Epistel des Paulus, an die Epheser, die Mr. Cranswick soeben als den heutigen Text angekündigt hatte.
Tom hatte einen Marsch von vier Meilen hinter sich, den gleichen noch einmal vor sich und zwei große Portionen Apfelauflauf in sich; er versuchte gar nicht erst wach zu bleiben. Gleich als die Predigt begann, betrachtete Mrs. Hill den blassen, müden kleinen Stadtjungen, legte mit liebevollem Lächeln den Arm um ihn und zog ihn an sich. Tom nahm das als direkte Aufforderung zum Schlaf und schlief prompt ein. Als Sohn des Predigers hatte er ein Gefühl, das er im Leben nur selten haben sollte: er war hier privilegiert.
Es gab in der methodistischen Kirche bessere Prediger als Nathan Cranswick, auch unter den Laien. Doch keiner war einfacher, redlicher und aufrichtiger, und gewiß gab es keinen, der seine Gemeinde mehr liebte als er. Als Nathan seinen Text angesagt hatte, hielt er inne und blickte sich um.
Die Methodistenkapelle in Moreland war kein architektonisches Glanzstück. Das Innere war anspruchslos eingerichtet mit Holzbänken, Öllampen, Kanzel und Harmonium. Als Teppich diente der nachmittägliche Sonnenschein. Vor den Fenstern sah man Bäume und ferne Hügel. Es roch nach Paraffin, feuchten Gesangbüchern und Sonntagskleidern.
Nathan nahm sich zusammen und wiederholte den Text. «Hallelujah!» rief Martha Kenwoody, die bei den ersten Fünfzig angekommen war. Nathans Mut sank. Es war zwar schmeichelhaft (und auch ganz üblich), daß die Predigt von Rufen wie «Hallelujah» und «Lobe den Herrn» unterbrochen wurde, nur kam es vor, daß so etwas die Jungen zum Kichern brachte und die weniger Andächtigen irritierte. Doch er fuhr fort mit seiner Predigt, und er sprach von der Liebe Gottes mit einer Wärme, die nur ein Herz voller Liebe aufbringen konnte. Jetzt störten ihn auch die wiederholten «Hallelujahs» nicht mehr als das Summen der Fliegen oder das Schnarchen des alten Mr. Harvey an diesem verschlafenen Sommernachmittag.
Es war vermutlich eine ziemlich durchschnittliche Landgemeinde: sie nahm etwa zehn Prozent auf von dem, was der Prediger sagte. Die Gedanken schweiften manchmal ab, kehrten aber immer wieder zurück, wie Hausschwalben zu ihrem Nest.
Erst nach einer Weile merkte Nathan, daß ein Mensch da unten saß, dessen Gedanken nicht abschweiften. Zwei Augen, amüsiert und sehr blau, blieben fest auf sein Gesicht geheftet. Nun ist Amüsiertheit in der Gemeinde für einen ungeübten Prediger nicht gerade das, was er sich wünscht. Doch es störte Nathan nicht. Er spürte, daß diese gutgekleidete und überaus intelligent aussehende Dame nicht über seine schlichten Gedanken oder seinen ungeschickten Vortrag lachte. Sie gehörte zu den seltenen Menschen, die die Frage, ob das Leben eine Komödie oder eine Tragödie sei, längst beantwortet und sich für die Komödie entschieden haben, wobei sie die tragische Seite nolens volens in Kauf nehmen.
Neben ihr saß ein junger Mann, sicher ihr Sohn. Beide hatten die klar blickenden Augen, die schmale sportliche Figur und den prachtvoll gesunden Teint englischer Landleute.
Endlich war es soweit: das Harmonium ächzte und schrillte, als der Organist kraftvoll zur letzten Hymne ansetzte. Dann waren sie draußen in der warmen Sonne, jeder schüttelte jedem die Hand, besonders Tom, der das Gefühl des Privilegiertseins schon verloren hatte und nun schüchtern und verwirrt in der Menge stand.
Robert Heron machte Nathan mit einigen Leuten bekannt und sagte dann: «Ah, Vin, da bist du ja. Darf ich dir unseren neuen Prediger vorstellen?»
Die Dame mit den klaren Augen kam heran und lächelte freundlich. «Dies ist Mr. Cranswick», sagte Heron und wandte sich an Nathan. «Das ist Mrs. Lavinia Musgrove von der Hall Farm, meine gute Nachbarin.»
Nathan streckte ihr die große knochige Hand entgegen, und Lavinia Musgrove schüttelte sie herzlich. «Guten Tag. War eine gute Predigt. Hat mir gefallen.»
Auch Nathan lächelte herzlich. «Ich danke Ihnen.»
«Hier ist mein Sohn Adam. Adam, dies ist Mr. Cranswick, der Prediger.»
«Guten Tag, Sir.» Adam lächelte und schüttelte Nathan höflich die Hand.
Es muß leider gesagt werden, daß Nathan sich geradezu erhaben vorkam, als ihn jemand von der Hall Farm «Sir» nannte (und dabei hatte Paulus ausdrücklich vor so etwas gewarnt!). Jetzt nahm ihn Robert Heron beim Arm und sagte: «Nun trinken Sie aber noch eine Tasse Tee mit uns, bevor Sie sich auf den Rückweg machen, Mr. Cranswick. Und ihr natürlich auch, Vin und Adam. Dina, du gehst mit Tom hinunter und zeigst ihm den Fluß.»
Dina ergriff Toms Hand. «Komm mit», befahl sie, aber sie lächelte sehr lieb dabei, und schon liefen sie fort. Tom wurde von seiner quecksilbrigen Gefährtin mitgezogen; ihm fiel das Laufen über Gras und Wiesen nicht leicht, denn er war bisher nur über gepflasterte Straßen gelaufen.
Er war so verwirrt, als habe ein Engel ihn bei der Hand genommen. Er wußte, er war langsam und linkisch. Und als sie endlich stehenblieb, fand er sich an einem sehr seltsamen Ort: eine kleine Bucht aus Sand und Kies, mit hoher Uferböschung auf der einen und dem großen rauschenden Fluß auf der anderen Seite.
Der Nachmittag war windstill und heiß. Die meisten Kinder hätten gejubelt beim Anblick des kühlen plätschernden Wassers. Für Tom, den Städter, war Wasser ein feindliches Element. Die einsame kleine Bucht erschreckte ihn. Und am meisten erschreckte ihn das Mädchen neben ihm – ein Mädchen, das keine Schwester war. Er wollte zu Pa zurück. Er wollte nach Hause. Er fand alles auf dem Lande einfach schrecklich. Und diese Dina mit den grünen Augen starrte ihn so fest an, daß er an sein Brennglas denken mußte, das wie viele von Toms wenigen Schätzen ursprünglich etwas anderes gewesen war, nämlich eine Linse in einem Fernglas. Er wand sich fast unter ihrem Blick, obgleich der ganz freundlich war. Und dieser Fluß da unten, der so hastig und drohend vorbeijagte … Gab es nicht etwas wie eine Flut? Wer weiß, ob nicht die Flut auf einmal in diese geschützte Bucht hereinschoß und sie beide hinaus ins Meer trug …
Dann kam etwas noch Schlimmeres. Dina warf sich in den Sand und begann eilig ihre Stiefelbänder aufzubinden. «Ich will jetzt waten», sagte sie. «Los – zieh doch Stiefel und Strümpfe aus!»
Tom konnte sie nur erstaunt anstarren. «Da – da hinein?» fragte er und wies auf den Fluß.
«’türlich – was dachtest du denn? Im Nachttopf?» Sie lachte schrill auf und zog den ersten Stiefel aus.
Tom war schon vorher wehrlos gewesen – diese ländlichgrobe Bemerkung warf ihn um. Langsam und tief errötend schüttelte er den Kopf.
Dina erkannte seine Verlegenheit und sprang auf die Füße. Sie lachte nicht mehr. Mit der einen Hand stützte sie sich auf seine Schulter und zog den anderen Stiefel aus. «Entschuldige, du, jetzt hab ich dich erschreckt, was?»
«Nein, woher denn.» Männlich-erhaben schüttelte er den Kopf.
«Doch, hab ich. Bei dir zu Hause reden sie wohl nicht so. Nun komm doch mit runter, waten», drängte sie ihn und machte sich daran, ihre langen schwarzen Strümpfe auszuziehen.
Tom sah sich in einem gräßlichen Dilemma. Gegen das Waten im Wasser gab es unüberwindliche Einwände. Zunächst mal: wenn am Sabbat etwas Spaß machte, so war es Sünde. Und er würde es auch nie wagen, Stiefel und Strümpfe abzulegen und seine Beine so nackt zu zeigen, wie Dina es tat. Nacktheit war noch viel schlimmer und sündiger, das hatte man ihm aus dem Moralkodex schon beigebracht. Ein paar Minuten Waten im kühlen Wasser – so was würde bestimmt mit ewigem Fegefeuer geahndet. Das lohnte sich einfach nicht. Aber es gab noch einen dringenderen Grund, den er Dina unmöglich nennen konnte: Er hatte einfach nicht den Mut, einen Schritt in das fremde Element zu tun, so wenig wie er einen Gang über glühende Kohlen gewagt hätte.
Dina hielt sich immer noch an seiner Schulter fest und musterte ernsthaft das verängstigte Jungengesicht. Und dann verstand sie. «Gut, du», sagte sie. «Dann geh ich allein rein und du wartest hier.»
Lachend und juchzend lief sie ins Wasser; der Ernst war von ihr abgefallen. «O Tom, es ist herrlich!» Schlamm stieg vom Flußboden auf und legte sich wolkig um ihre Beine. Sie spreizte lachend die Zehen in dem mulmigen Boden, nahm Wasser in die Hände und warf es spritzend hoch, so daß die Tropfen glitzernd wie Diamanten vor ihr herflogen. Sie war in einem Paradies aus Sonnenlicht und Himmelsblau und herrlich kaltem Wasser. Und sie sah zu Tom hinüber, der ängstlich und verlegen in seinem armen dunklen Knickerbocker-Anzug und den engen Stiefeln allein am Ufer stand – sie betrachtete ihn, wie ein fröhlicher Cherub eine verlorene Seele betrachtet, der die Hölle einen freien Nachmittag gewährt hat.
Auf dem Rückweg ins Herrenhaus ging Lavinia Musgrove an Nathans Seite. Sie schritt aus, als habe sie Freude am Gehen und stach dabei mit der Spitze ihres Sonnenschirms in den sandigen Boden. «Wo wohnen Sie, Mr. Cranswick», fragte sie, wie immer mit freundlichem Lächeln.
«In Ingerby.»
«Wie sind Sie denn hergekommen?»
«Zu Fuß, Mrs. Musgrove.»
«Alle Achtung – ein tüchtiger Weg. Und der Junge auch? Der wird gut schlafen heute nacht.»
«Ja.»
«Darf ich wohl mal etwas sagen, das mich nichts angeht?»
«Selbstverständlich», sagte Nathan und wappnete sich. Vermutlich wollte sie an seiner Predigt Kritik üben.
«Sieht mir nicht sehr gesund aus, das Schmaltierchen. Er müßte auf dem Lande leben. Ah – da sind wir schon. Tasse Tee wird uns gut tun, was?»
Und damit hatte sie recht. Der Nachmittagstee hier im Herrenhaus, dachte Nathan, unterschied sich wie der Gottesdienst bei einer Eucharistiefeier in St. Lukas von der Morgenandacht im methodistischen Zionssaal oder vom Tee zu Haus in der Küche. Es war vor allem das Ritual, das alles beherrschte. Der Tee war blaß und schwach, und von den Gurkensandwiches wäre kein Sperling satt geworden. Aber Mr. Hill, der unter devoten Verbeugungen silberne Schüsseln darbot, verlieh der Mahlzeit eine fast priesterliche Note. Nathan sah erstaunt, wie mit feierlicher Geste Wasser in die silberne Teekanne gefüllt wurde. Er spürte einen Blick und sah sich um. Mrs. Musgrove beobachtete ihn, amüsiert wie stets, und als sie seinen Blick auffing, verwirrte sie ihn noch mehr und blinzelte ihm heimlich zu. Beim Abschied schüttelte sie ihm fest und freundschaftlich die Hand und sagte:
«Großartig, daß Sie gekommen sind, Mr. Cranswick. Wir sind Ihnen sehr dankbar. Und ich bitte um Verzeihung, daß ich dem Laienprediger zugeblinzelt habe. Sie wußten gar nicht mehr wohin, was?» Und dabei lachte sie so laut, wie man es von einem so eleganten Geschöpf kaum erwartet hätte. Dann beugte sie sich zu Tom hinunter, nahm seine mageren Wangen in beide Hände und gab ihm einen schallenden Kuß. «Dich sollte man aufpäppeln, mein Jungchen», sagte sie ernst.