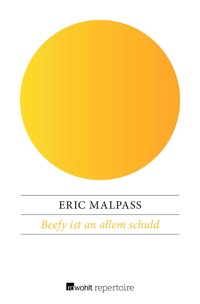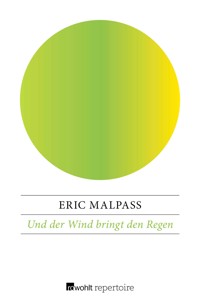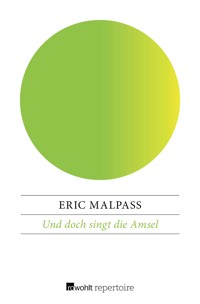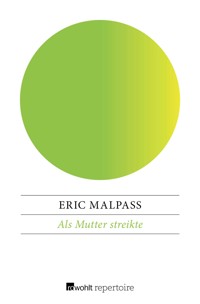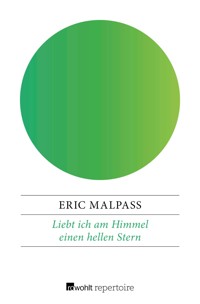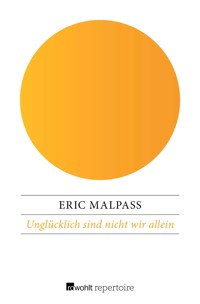
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Shakespeare-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Mit diesem farbig-historischen und in sich abgeschlossenen Roman setzt Eric Malpass den Zyklus über die turbulente Epoche des Dichtergenies William Shakespeare fort, den er mit «Liebt ich am Himmel einen hellen Stern» begonnen hatte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 356
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Eric Malpass
Unglücklich sind nicht wir allein
Ein Roman um William Shakespeare und seine Zeit
Aus dem Englischen von Susanne Lepsius
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Mit diesem farbig-historischen und in sich abgeschlossenen Roman setzt Eric Malpass den Zyklus über die turbulente Epoche des Dichtergenies William Shakespeare fort, den er mit «Liebt ich am Himmel einen hellen Stern» begonnen hatte.
Über Eric Malpass
Eric Malpass (1910–1996) hat in seinem Heimatland Großbritannien lange Jahre als Bankangestellter gearbeitet. 1947 wurde er Mitarbeiter der BBC, außerdem schrieb er für diverse Zeitungen. Er verfasste zahlreiche Romane und lebte als freier Schriftsteller in Long Eton, nahe Nottingham.
Inhaltsübersicht
Der Titel der deutschen Ausgabe und die Kapitelüberschriften sind Zitate aus Werken von William Shakespeare
Für Heather Malpass
HERZOG: Du siehst, unglücklich sind nicht wir allein,
Und dieser weite, allgemeine Schauplatz
Beut mehr betrübte Szenen dar, als unsre,
Worin du spielst.
JAQUES: Die ganze Welt ist Bühne,
Und alle Fraun und Männer bloße Spieler.
Sie treten auf und gehen wieder ab …
William Shakespeare
‹Wie es euch gefällt›
Prolog
Frühling! Der Tod selbst, so schien es, war mit den Wintertagen dahingestorben. Überall herrschte neues Leben, lärmendes, blühendes, üppiges Leben. Leuchtend weiße Wolken segelten am tiefblauen Himmel dahin. Hunde jagten durch die Wiesen und schnappten nach dem wirbelnden Wind. Der Winter war vergangen und mit ihm der Tod.
Aber der Mann, der im kühlen Schatten der Kirche von Stratford am Grab seines Sohnes stand, wußte, daß der Tod nicht gestorben war. Er blickte auf den Grabstein: «Hamnet Shakespeare. Geboren 1585. Gestorben 1596.» Ein kleiner Stein für eine kleine Spanne. Eine kurze Inschrift für ein kurzes Leben. Ein alter Kummer, zuweilen halb vergessen und doch immer wieder lebendig. Vor sieben Jahren hatten sie hier den kleinen Hamnet begraben.
Der Morgenwind zerrte an seinem grauen Umhang und fuhr ihm durch sein kastanienbraunes Haar.
Er seufzte. Dann wandte er sich ab. Er bestieg sein Pferd. Und er schlug, wieder einmal, den Weg nach London ein – nicht weil er es wollte, sondern weil er nicht anders konnte. Es trieb ihn nach London, so wie es im Frühjahr die Schwalben nach Norden und die Rehe wieder in die Tiefe der Wälder trieb.
1 Ließ’ Euren Namen an die Hügel hallen …
Jene ersten stürmischen Frühlingstage waren so frisch und belebend wie eine kräftige Brise am Gischt sprühenden Meer.
Die Menschen schienen von einer seltsamen Unruhe ergriffen. Denn mit dem Frühling war zugleich ein neues Zeitalter angebrochen. Von der Turmspitze der St. Pauls-Kirche aus, auf der, wie alle Welt wußte, der Teufel jeden Tag ein Weilchen hockte (viele hatte ihn mit eigenen Augen dort beobachtet), hätte man sehen können, wie es auf den Straßen draußen vor London von Reitern wimmelte. Und hätte man mit den Zugvögeln nordwärts fliegen können, so hätte man irgendwo auf der Heerstraße von Edinburgh nach London einen langen prächtigen Zug von Kutschen und Planwagen und Berittenen und Bewaffneten gesehen. Der Nachfolger Königin Elisabeths näherte sich London: Jakob VI. von Schottland, der als Jakob I. zum König von England gekrönt werden sollte. Er, der Sohn Maria Stuarts, schickte sich an, die beiden Königreiche England und Schottland nach jahrhundertelangem, oft blutigem Streit zu vermählen.
Es würde, so glaubten viele, eine unruhige Hochzeitsnacht werden.
William Shakespeare dachte nicht lange über den neuen König nach, während er in leichtem Trab nach London ritt. Er hatte in den zwei Jahren, in denen er in Frieden in Stratford gelebt hatte, so manches gelernt. Er hatte erkannt, daß sein unruhiges Leben in London oft nichts anderes gewesen war als die Jagd eines törichten Kindes nach schillernden Seifenblasen. Die zwei Jahre in seiner alten Heimat hatten ihm neue Kraft und einen klaren Blick gegeben. Der innere Zwiespalt, unter dem er so lange gelitten hatte, die Zerrissenheit war plötzlich einer inneren Sicherheit gewichen. Zum erstenmal wußte er, wo er leben wollte: in Stratford. Seine Wurzeln, seine Gefühle, seine Liebe, eine friedliche Umgebung – alles, was er zum Leben brauchte, hatte er in der stillen Welt der Grafschaft Warwick wiedergefunden. London – das war Aufregung, Unruhe, Gefahr gewesen, ein Leben, wie man es in der Jugend begehrte. Doch mit annähernd vierzig Jahren wußte man Ruhe, Sicherheit und seinen inneren Frieden zu schätzen. Darum wollte er diesmal und auch bei künftigen Besuchen nur kurz in London verweilen. Vielleicht würde er ein neues Stück für die Schauspielertruppe des Lord-Kämmerers schreiben, und vielleicht konnte er selbst in der einen oder anderen Rolle auftreten. (Wer je auf der Bühne gestanden hatte, vergaß nie das erregende Gefühl, wenn die Spannung der Zuschauer immer mehr zunahm und sich schließlich in zornigem Gebrüll oder in Gelächter entlud.) Und er würde dafür sorgen, daß die Schauspieler sich in seinen Stücken an seinen Text und an seine Anweisungen hielten und nicht etwa in den hochtrabenden Stil des berühmten Edward Alleyn verfielen! Und dann – zurück nach Stratford, zu Anne, zu seiner lieblichen Tochter Susanna und zu der armen, verschüchterten Judith, der Zwillingsschwester seines toten Sohnes Hamnet. Nun, bist du zufrieden, mein Gewissen? murmelte er. Es war das erste Mal, daß er nach London ritt, ohne daß Gewissensbisse ihn wie schwarze Höllenhunde verfolgten. Jahrelang hatte er Stratford jedesmal so verlassen, wie man einem Gefängnis entflieht. Doch nun war alles anders. Er war älter und weiser geworden.
Oder so glaubte er doch.
Richard Burbage, der größte Schauspieler der Truppe des Lord-Kämmerers und gleichwohl ein bescheidener, liebenswürdiger Mann, war der Verzweiflung nahe.
Es durften keine Aufführungen stattfinden. Gewiß, es wäre auch unziemlich gewesen, Theater zu spielen, solange die alte Königin, Elisabeth von England, noch nicht begraben war. Außerdem hätte ein solcher Mangel an Respekt den Puritanern noch einen Vorwand mehr gegeben, über die armen Schauspieler herzufallen.
Da er jedoch wie die anderen Schauspieler der beliebten Truppe ein vielbeschäftigter Mann war, hatte er die erzwungene Ruhepause nutzen und einen Knabenschauspieler einstellen wollen. Und bei diesem Versuch war er bald zu dem Schluß gekommen, daß offenbar jeder Knabe, der einen Satz stotterfrei herausbringen konnte, schon einer jener Kindertruppen angehörte, die beim Publikum so beliebt waren und den richtigen Schauspielern darum sehr zu schaffen machten.
Seine Halskrause scheuerte hinten am Nacken, sein Wams und seine Kniehose waren durchgeschwitzt, und seine nach einem langen Winter bei Pökelfleisch und Brot ausgetrocknete Haut juckte und brannte, als würden tausend Teufel mit ihren Nadeln auf ihn einstechen. Er hatte nur noch den einen Wunsch, nach Hause zu gehen und sich einen weiten Schlafrock anzuziehen. Ja, er fühlte sich so unbehaglich, daß er ernsthaft mit dem Gedanken spielte, ein Bad zu nehmen.
Was für ein Tag! Als sei es nicht schon genug, sich mit zehn nichtsnutzigen Bälgern – und ihren in sie vernarrten Müttern – abzuplagen, war er auch noch seinem Rivalen Philip Henslowe in die Arme gelaufen, und das ausgerechnet vor Henslowes Theater, dem ‹Fortune›!
Er hatte nicht mehr fliehen können. Henslowe hatte ihn am Arm gegrapscht, als griffe er nach einem Geldbeutel, und hatte ihm sein bläßliches bigottes Gesicht entgegengereckt. «Schreckliche Zeiten, Master Burbage, schreckliche Zeiten! Es heißt, der neue König werde die Theater für immer schließen.» Er verdrehte die Augen und schickte ein stummes Gebet zum Himmel.
«Vielleicht ist es nur ein Gerücht», sagte Richard, bemüht, sich nicht niederdrücken zu lassen.
Henslowe sah ihn ernst an. «Gebe Gott, daß Ihr recht habt.» Er schüttelte zweifelnd den Kopf. «Ich jedenfalls danke unserem gütigen Schöpfer jeden Abend auf den Knien für meine Bierkneipen und Bordelle. Ich würde nicht gern von meinen Schauspielern abhängig sein in diesen schrecklichen Zeiten.»
«Da habt Ihr recht», sagte Richard Burbage, der weder Bierkneipen noch Bordelle besaß und im Gegensatz zu Henslowe von seinen Schauspielern abhängig war. Er wollte weitergehen, aber die Hand, die seinen Arm unklammert hielt, ließ nicht locker. Wäre Henslowe nicht ein so frommer Christ gewesen, hätte man meinen können, er wolle noch mehr Salz in eine offene Wunde streuen, doch sicherlich entsprangen seine Worte reiner Nächstenliebe. Er zog Richard Burbage noch näher zu sich heran, stieß ihm seinen nach Hering riechenden Atem ins Gesicht und fragte mit gedämpfter Stimme: «Sagt, Dick, ich mache mir Sorgen um den guten William Shakespeare. Er ist doch hoffentlich nicht etwa krank?»
«Nein, nein.» Als erfahrener Schauspieler gab Burbage seiner Stimme einen sorglosen Klang. «Ich glaube, irgendwelche Geschäfte, die sich in die Länge ziehen, halten ihn in Stratford fest.»
Henslowe tat so, als atmete er erleichtert auf. Wieder wandte er die Augen gen Himmel, diesmal scheinbar in tiefer Dankbarkeit. «Das freut mich zu hören, Dick. Man hat in London schon so lange kein neues Stück mehr von ihm gesehen, daß ich allmählich fürchtete …»
Burbage sah ihn mit einem haßerfüllten Lächeln an und ging weiter. Nein, Henslowe hatte sich nicht täuschen lassen, dieser verdammte Kerl! Und dieser verdammte William! dachte er wütend. Warum versteckte er sich im fernen Stratford? Er war der beste Mann, den die Truppe je gehabt hatte, stets willig und zu allem bereit. Und auch nachdem er Teilhaber geworden war, hatte man sich immer darauf verlassen können, daß er jederzeit einsprang, wo Not am Manne war, sei es, daß er eine Rolle übernahm oder mit drei Trompetenstößen den Beginn der Aufführung anzeigte oder gar in den Pausen Quitten an die Zuschauer verkaufte, wenn die Lohnarbeiter krank waren. Und vor allem hatte er ein paar gute Stücke geschrieben. Richard Burbage war sogar bereit, zuzugeben, daß Williams Stücke und sein Gespür für das, was die Zuschauer wollten, ebensosehr zum Erfolg der Truppe beigetragen hatten wie seine eigene Schauspielkunst und John Heminges Geschäftssinn.
Und nach zwei oder drei Gläsern Wein hätte er sogar hinzugefügt, daß Wills Stücke wie Zwiebeln waren – bei jeder Aufführung schälte man eine Hautschicht ab und entdeckte darunter eine weitere. Er wußte, daß er von Will, der ihn schon so tief in die Labyrinthe des menschlichen Denkens und Fühlens geführt hatte, noch vieles lernen konnte. Sie alle liebten und achteten Will, und er, Richard Burbage, ganz besonders, und insgeheim war er ein wenig enttäuscht, daß der Freund sie so lange im Stich ließ.
Doch jetzt war es Zeit, nach Hause zu gehen und die stickige, vollgestopfte Garderobe zu verlassen, wo er den ganzen Tag lang die lärmenden und zappeligen Kinder ertragen hatte. Es war Zeit, nach Hause zu gehen, in die Halliwell Street, wo – Allmächtiger! – acht weitere Kinder auf ihn warteten. Seine Kinder.
Er räumte auf und stellte die Schwerter und Lanzen wieder an ihren Platz – warum griffen diese kleinen Teufel immer sofort nach den Waffen? Zumal sie sich doch darum bewarben, daß man sie lehrte, Frauenrollen zu spielen. Freilich, heute war nicht ein einziger unter den Bewerbern gewesen, der dafür getaugt hätte.
Er nahm einen beschriebenen Quartbogen in die Hand und las: ‹Ich baut’ an Eurer Tür ein Weidenhüttchen und riefe meiner Seel’ im Hause zu, schrieb fromme Lieder der verschmähten Liebe … › O Gott, er hatte diese Zeilen aus ‹Was ihr wollt› immer sehr hübsch gefunden, aber heute waren sie von so vielen piepsigen, quiekenden, dröhnenden und brummigen Kinderstimmen deklamiert worden, daß sie jede Poesie, ja sogar ihren Sinn verloren hatten. Kinder! Kinder waren kleine Störenfriede. Sie störten den Frieden, die Eintracht, die Ordnung. Und nun mußte er nach Hause und weitere acht über sich ergehen lassen!
Jemand klopfte an die Tür. Richard Burbage erstarrte. Er wollte nur noch seine Ruhe. Hätte es eine Hintertür gegeben, wäre er leise davongeschlichen.
Aber es gab keine Hintertür. «Herein», rief er wütend.
Sie war zu sehr aufgeputzt. Nein, so kleidete sich keine Dame.
Sie trug einen kanariengelben Rock. Und ihre Halskrause war so groß wie ein Wagenrad. Zahllose goldene Ringe bedeckten ihre Finger. Und doch war sie hübsch. Ja, sie war ein stattliches Frauenzimmer. Richard Burbage ertappte sich dabei, wie er sich die weichen, üppigen Rundungen unter all dem Brokat vorstellte. «Ich bringe Euch meinen Sohn Nicholas», sagte sie. «Ich möchte, daß er bei Euch in die Lehre geht und Schauspieler wird. Ich bin Mistress Fox – Helen Fox. Meine Freunde nennen mich allerdings Nell.» Dabei sah sie ihn so an, als wollte sie sagen, daß ein kleiner, dicker Schauspieler wie er sicherlich nie zu dem Kreis ihrer Freunde zählen würde. «Nicholas, sag auf, was du gelernt hast.»
Nicholas stellte sich in Positur – er stand auf den Zehenspitzen, die Knie durchgedrückt, leicht nach vorn geneigt und den linken Arm halb über dem Kopf. Wie ein alberner Kerzenhalter, dachte Burbage mürrisch.
Jetzt hob der Junge die rechte Hand, die Handfläche nach außen gekehrt, und spreizte die Finger vor seinem angstverzerrten Gesicht.
«‹Welch gräßlich Schrei reißt mich aus meinem harten Bett›», kreischte er. «‹Welch eisig Hauch –›»
«Halt!» brüllte Burbage. Was fiel diesem Burschen ein, hier hereinzuplatzen und ausgerechnet aus Thomas Kyds ‹Spanischer Tragödie›, diesem uralten Rührstück, vorzusprechen!
Der Knabe blieb in der gleichen Pose stehen, machte jetzt aber ein beleidigtes Gesicht. Seine Mutter sagt: «Ihr dürft ihn nicht gleich unterbrechen, Herr. Ich wette, wenn er zu der Stelle kommt, wo es heißt: ‹Oh, es ist Horatio, mein geliebter Sohn›, werdet Ihr die Tränen nicht zurückhalten können.»
Burbage hielt das für unwahrscheinlich. Er nahm den abgegriffenen Quartbogen vom Tisch und hielt ihn dem Jungen hin. «Lies das hier», sagte er kurzangebunden.
Der Knabe stellte sich wieder leicht vorgeneigt auf die Zehenspitzen und begann: «‹Ich baut’ an Eurer Tür ein Weidenhüttchen und riefe …›»
Für eine taube alte Frau in der hintersten Reihe des Theaters wäre es die richtige Lautstärke gewesen. Hier, in dem kleinen Seitenraum, zerriß es einem schier das Trommelfell. Burbage brachte den Jungen wütend mit einer wedelnden Handbewegung zum Schweigen. «Wo, um Himmels willen, hast du diese aberwitzige Art zu schauspielern gelernt?»
Der Junge schmollte. Seine Mutter antwortete für ihn: «Das hat er sich bei Master Alleyn im ‹Fortune› abgesehen!»
Zweierlei ging Richard Burbage durch den Kopf: Warum ließen Mütter nie, aber auch nie ihre Söhne selber antworten? Und warum hatte diese Person ihren geliebten Sprößling nicht im ‹Fortune› in die Lehre gegeben? Henslowe und Edward Alleyn hätten solche Fähigkeiten bestimmt zu schätzen gewußt. Er wandte sich der Mutter zu: «Warum versucht Ihr es mit Eurem Sohn nicht im ‹Fortune›?»
«Oh, ich habe es versucht, aber man braucht dort zur Zeit keine neuen Knabenschauspieler.»
Aha. Im ‹Fortune› hatte man also genügend Knaben. Das hörte er gar nicht gern. Um so wichtiger war es, diesem Mangel im ‹Globe› möglichst schnell abzuhelfen. Er wappnete sich mit Geduld und sagte: «So, mein Junge. Jetzt noch einmal. Und denke daran, daß du kein Marktschreier bist. Du bist eine junge Frauensperson, die als Mann verkleidet ist und im Namen ihres Herren um eine Frau wirbt, die sich in dich verliebt hat – sie denkt natürlich, du wärst ein Mann.»
«Habt Ihr von solch einem Wirrwarr schon einmal gehört?» bemerkte Nell Fox.
Aber der Junge hatte das Wort ‹werben› vernommen, und das genügte. Er sank auf die Knie und hob flehend die Arme. «‹Ich baut’ an Eurer Tür ein Weidenhüttchen›», begann er wieder, diesmal mit schmachtender, honigsüßer Stimme.
Burbage winkte ab und bedeutete ihm aufzustehen. Die Mutter, die den Schauspieler unterdessen eingehend gemustert hatte, meinte: «Ihr seid doch nicht etwa Master Burbage?»
Er nickte kurz.
«Ich hatte gedacht, Ihr wärt viel größer», sagte sie.
«So, tatsächlich?» Richard Burbage, der klein und dick wie eine Tonne war, hätte seinen rechten Arm hingegeben, wenn er dafür noch fünf Zentimeter gewachsen wäre. Für einen Tragöden war seine Statur ein schlimmes Handikap. Und er schätzte es gar nicht, wenn jemand Bemerkungen darüber machte. «Komm, mein Junge», sagte er. «Jetzt steh auf und …»
«Master Alleyn ist von Statur sehr hübsch und imposant», sagte die Dame. «Aber freilich», fügte sie hinzu, denn sie war eine Frau, die sich etwas auf ihren Takt zugute hielt, «körperliche Größe allein ist nicht alles. Und als Edward II. habt Ihr mir gut gefallen, Master Burbage.»
«Ich habe Edward II. nie gespielt, Mistress Fox.»
Sie sah in ungläubig an. «Nein, wirklich nicht? Ich hätte schwören können …»
«Ihr könnt mir glauben, Madame. In diesem Punkte irre ich mich nicht. Komm, mein Junge. Jetzt lies das noch einmal. Ganz ruhig. Und langsam.»
«Aber mit Gefühl, Nicholas», sagte seine Mutter und wandte sich Burbage zu. «Mein Sohn hat viel Gefühl, müßt Ihr wissen. Er hat es mit der Muttermilch eingesogen, wenn Ihr mir diesen etwas familiären Ausdruck gestattet, Master Burbage.»
Kein Zweifel, seit ihr klargeworden war, daß sie es nicht mit einem beliebigen Schauspieler, sondern immerhin mit dem berühmten Master Burbage zu tun hatte, wurde sie immer huldvoller und freundlicher. «Gehört Master Shakespeare nicht auch zu Eurer Truppe?»
Mußte sie denn ständig unterbrechen, dachte Richard Burbage verzweifelt. Andererseits freute er sich immer, wenn er feststellen konnte, daß Williams Name zunehmend bekannter wurde. Deshalb sagte er fast herzlich: «Ja, Mistress Fox, er ist einer von uns.»
«Hatte ich’s mir doch gedacht.» Sie faltete befriedigt die Hände im Schoß. «So, Nicholas, nun zeig dem Herrn mal, was du kannst – dann wirst du vielleicht in dieselbe Schauspielertruppe aufgenommen, zu der auch Master Shakespeare gehört.»
Richard Burbage war ein gutmütiger Mann, aber er hatte durchaus seine menschlichen Schwächen. Und daß diese Frau nach Will fragte, während sie über seine Schauspielkunst offenbar so gut wie gar nichts wußte, kränkte seine Eitelkeit. «Und warum interessiert Ihr Euch so sehr für Master Shakespeare, Madam?» fragte er.
«Er logiert bei Mistress Mountjoy, wenn er in London ist.»
«Aha», sagte Richard Burbage. «So, Nicholas, und jetzt –»
«Und sie sagt, einen so liebenswürdigen, ruhigen Logiergast wie ihn gäb’s nicht noch einmal auf der Welt.»
«Das will ich gern glauben. Also, mein Junge.»
«Und so bescheiden! Ein Stückchen Rindfleisch zum Frühstück und einen eingelegten Hering zum Abendbrot – das ist alles, was er verlangt. Aber natürlich verwöhnt ihn Mistress Mountjoy, wenn er in London ist.»
«Natürlich.»
«‹Ich baut’ an Eurer Tür ein Weidenhüttchen›», begann der Junge wieder, «‹und riefe meiner Seel’ im Hause –›»
«Halt», sagte Richard Burbage plötzlich leise und mit unsicherer Stimme. Er stand gegenüber der Tür, und die Tür hatte sich geöffnet, und ein Mann stand auf der Schwelle, ein Mann mit einem sorgfältig gestutzten kastanienbraunen Bart und lachenden Augen. «Will!» rief Richard. Und Tränen traten ihm in die Augen, und er brachte kein Wort mehr heraus, während er auf ihn zuging. «‹Ließ’ Euren Namen an die Hügel hallen›», rief Nicholas von seinem eigenen Schwung mitgerissen.
Die beiden Männer umarmten sich tolpatschig wie zwei Bären.
Nell Fox betrachtete den Neuankömmling voller Interesse. Sie hatte ein Schwäche für stattliche Herren, und dieser gesund und kräftig aussehende, vornehm gekleidete Mann war in der Tat eine stattliche Erscheinung. Sie hatte ihn irgendwo schon einmal gesehen. Aber wo? Plötzlich fiel es ihr ein. «Ja, natürlich!» rief sie. «Das ist ja Mistress Mountjoys Logiergast.»
«‹O London, Blüte aller Städte›», hatte er vor sich hin gemurmelt, als er über die Brücke schritt – Worte eines schottischen Dichters, wie er sich lächelnd sagte. Und immer wieder ging ihm seit dem Tod der alten Königin die Geschichte von Banquo und Macbeth durch den Kopf – ein Stück schottischer Geschichte. War es möglich, daß er, der Edelmann William Shakespeare, unwillkürlich sein Mäntelchen nach dem Winde hängte?
Da er sich selbst sehr deutlich und ohne Illusionen sah, hielt er es sehr wohl für möglich. Er war längst zu dem Schluß gekommen, daß es dem neuen König aus Schottland schmeicheln würde, ein Stück zu sehen, das seine Abstammung von Banquo – und nicht von dem grausamen Macbeth – hervorhob. Also war er ein Schmeichler? Oder ging er zu streng mit sich selbst ins Gericht? War es nicht einfach so, daß er Freude daran hatte, anderen Menschen zu gefallen?
Seine Gefühle waren in Aufruhr. Vor zwei Jahren, nach dem mißglückten Aufstand seiner Freunde, der Grafen Essex und Southampton, war er aus London geflohen, um sein nacktes Leben zu retten. Essex war enthauptet worden, und Southampton lag seither, zu lebenslänglichem Gefängnis verurteilt, im Tower. Zwei sorglose Jahre in Stratford hatten ihn die Schrecken jener Tage vergessen lassen, doch jetzt durchlebte er sie wieder in seiner Erinnerung – die leeren Straßen, die unheimliche Stille vor dem Sturm, die Hagelkörner, die von einem kalten grauen Himmel herabstürzten, und wie immer die bösen Vorzeichen: Sterne, die ihre Bahnen verlassen hatten, ein bluttriefender Mond. Ihn schauderte. Damals hatte er vieles über die Schwächen des Edelmanns William Shakespeare erfahren, das er lieber nicht gewußt hätte. Die zwei friedlichen Jahre in New Place, seinem Herrenhaus in Stratford, hatten diesen bitteren Erkenntnissen den Stachel genommen. Doch seit er wieder in London war, quälten sie ihn von neuem.
Nach der langen Zeit im eigenen Haus war ihm sein Logis in London kalt und schmutzig vorgekommen. In den Zimmern über dem Laden des Kopfputzmachers Mountjoy im Stadtteil Cripplegate roch es so muffig, als sei dort während seiner Abwesenheit nicht ein einziges Mal gelüftet worden. Obwohl Mistress Mountjoy sofort Staub gewischt und Feuer gemacht hatte, war ihm zumute gewesen, als befände er sich in einer Grabkammer. Und die Mountjoys selbst rochen so, als hätten sie seit seiner Abreise vor zwei Jahren nicht ein einziges Mal mehr gebadet.
Draußen in den engen, sonnenlosen Straßen häufte sich noch immer der Unrat. O London, Blüte aller Städte! Und selbst die aufgespießten Köpfe der Verräter am Torhausturm der alten Brücke schienen noch dieselben. Regen und Frost und die hungrigen Vögel hatten dafür gesorgt, daß einer wie der andere aussah. Wieder schauderte ihn. Er dachte an den Grafen von Essex. O London, Perle aller Städte!
Draußen vor den Fenstern von New Place würden jetzt die letzten Sonnenstrahlen in hohen Ulmenzweigen spielen, und eine Schar wilder Jungen würde aus der Lateinschule gelaufen kommen und ausgelassen durch die Straßen stürmen. (Nur einer fehlte unter ihnen, der arme Hamnet, der so gern getobt und krakeelt hatte.) Anne würde nach getaner Küchenarbeit ihren besten blauen Kittel angezogen haben und am Fenster sitzen und stopfen und flicken. Die gute Anne. Eine neue Zärtlichkeit, eine wunderbare neue Liebe war in den vergangenen zwei Jahren zwischen ihnen erblüht. Einst, am Anfang, hatte er sie vor allem deshalb geliebt, weil sie ihn geliebt und bewundert hatte. Und weil sie sich ihm – ängstlich und ungeschickt und ganz und gar selbstlos – hingegeben hatte. Später hatte er sie oft gehaßt. Es war kein persönlicher Haß gewesen, sondern der Haß des Gefangenen gegen seine Kerkermauern. Inzwischen jedoch war das Gefängnis ein Zuhause geworden und der Gefängniswärter ein geliebter Gefährte. Die hohe Achtung, die er Anne jetzt entgegenbrachte, hatte das Band ihrer Ehe gefestigt.
Mein Gott, dachte er, was würde ich darum geben, wenn ich jetzt in Stratford mit Anne den Ausklang des Tages genießen könnte! Und einen Augenblick lang war die Sehnsucht fast ein körperlicher Schmerz, der sich schwer auf seine Brust legte und hinter seinen Augen brannte. Doch dann bot sich ihm ein Anblick, der ihn Stratford vergessen ließ und ihn zu Tränen rührte. Er ging jetzt am Südufer der Themse entlang, und dort drüben, eine dunkle Silhouette vor dem hellen westlichen Himmel, erhob sich ein Gebäude, das wie ein breiter Festungsturm alle anderen Häuser überragte – das ‹Globe›, sein Theater, Geburtsstätte und Heim so vieler seiner Gestalten.
Er ging hinein.
Ein weites, hallendes, leeres Rund. Ihn fröstelte. Würde je wieder stürmischer Beifall für Falstaff oder Agincourt hier aufbranden? Es hieß, der neue König werde alle Theater schließen lassen.
Er hörte Stimmen, die von der Garderobe herüberdrangen.
Er öffnete die Tür und trat ein.
Und dort stand Dick, sein Freund Richard Burbage! Man sah ihm auf den ersten Blick an, daß er vor Wut kochte.
Richard sah auf und erblickte ihn. Und plötzlich leuchtete sein müdes Gesicht auf vor Freude und Glück. William war gerührt. Es bewegte ihn, daß er von dem Freund und Weggefährten so geliebt wurde. «Dick!» – «Will!» Sie umarmten sich und klopften einander auf die Schultern und lachten und weinten. «Will, Will! Und ich dachte schon, du wärst in Stratford Ladenbesitzer geworden», sagte Burbage mit halb erstickter Stimme.
«‹Daß die vertraute Schwätzerin der Luft Olivia schrie›», schloß Nicholas, der Knabe, mit hoher, bebender Stimme.
Sie drehten sich um und sahen ihn beide verwirrt an. Was hatte der plappernde Junge jetzt hier zu suchen? «Nun, Will, hast du eine Truhe voll neuer Stücke? Du wirst doch nicht auf der Bärenhaut gelegen haben.»
«Nein, Stücke nicht, aber allerlei Ideen. In den ‹Chroniken› von Holinshed habe ich eine blutige Geschichte von zwei Schotten, Banquo und Macbeth, gelesen. Die würde dem König bestimmt gefallen. Und – und wie würde es dir gefallen, dein Gesicht zu schwärzen und einen vor Eifersucht rasenden Mohren zu spielen? Unter den Novellen von dem italienischen Dichter Cinzio –»
«Ich kann auch etwas aus Master Marlowes ‹Doktor Faustus› aufsagen», platzte Nicholas dazwischen.
«Ein andermal, mein Junge», sagte Burbage gedankenverloren. Sie hatten nie Stücke von Christopher Marlowe gespielt, und der Dichter war schon vor zehn Jahren bei einer Messerstecherei in einer Schenke ums Leben gekommen. Aber ein schwarzer wahnsinniger Mohr …! Das war etwas, das die Gründlinge, die Zuschauer im Parterre, erschaudern lassen würde.
Aber dem höflichen William war es unangenehm, wie sie, Richard und er, sich der Dame und dem Jungen gegenüber benahmen. Leise fragte er: «Taugt der Junge etwas?»
«Nein. Furchtbar! Ein kleiner Edward Alleyn.»
In diesem Augenblick begann Nicholas wieder zu deklamieren: «‹War dies das Antlitz, das tausend Schiffe in Bewegung setzte und die hohen Türme Ilions in Flammen aufgehen ließ?›»
«Oh, sei doch still!» fuhr Burbage ihn an.
William sagte hastig: «Komm, sei friedlich, Dick. Wir erzählen uns nachher, was es zu erzählen gibt. Laß uns erst mit der Dame sprechen.» Er wandte sich mit einer Verbeugung an Mistress Fox. «Verzeiht, Madam! Die Wiedersehensfreude ließ uns die Gebote der Höflichkeit vergessen.»
«Euch ist verziehen, Herr», sagte sie huldvoll, und ihr Gesicht glühte förmlich.
Er verbeugte sich abermals und wandte sich Nicholas zu: «So, mein Junge. Fang doch noch einmal von vorn an.» Er setzte sich auf einen x-förmigen Stuhl.
Nicholas ließ gequält und mit einem deutlich hörbaren Seufzer die Schultern sinken. Unverschämter kleiner Teufel, dachte Burbage. Aber William ermunterte den Jungen freundlich: «Nun? ‹War dies das Antlitz …›»
Nicholas gab nach und sagte den gelernten Text auf.
Es war furchtbar. Aber William hörte geduldig zu und war trotz der aufbrausenden Stimme, der heftigen Gesten und der rollenden Augen des Knaben hingerissen von der Schönheit der Verse Christopher Marlowes.
Danach saß er, das Kinn in die Hand gestützt, schweigend da und betrachtete nachdenklich den Knaben, sein unscheinbares schmales, blasses Gesicht, die scharfe Nase, die eng stehenden Augen. Nun, Henry Condell vermochte mit ein wenig Schminke wahre Wunder zu vollbringen. Und was den geschwollenen Ton betraf, so würde er ihm den schon abgewöhnen. Er würde ihn lehren, ‹so sanft zu brüllen wie ein saugendes Täubchen›, wie es im ‹Sommernachtstraum› hieß.
Plötzlich hörte er Burbage sagen: «Vielen Dank, Madam, Ihr werdet von uns hören.»
Er überlegte, ob er sich einmischen durfte. Aber schließlich war er auch Teilhaber. Er wandte sich Richard Burbage zu. «Dick», sagte er leise. «Brauchen wir denn neue Knabenschauspieler?»
«Ja», sagte Burbage kühl. «Aber ganz so dringend ist es auch wieder nicht.»
«Nimm ihn, Dick! Wir können ihm schnell beibringen –»
«Verdammt, ich will nicht!»
Die Frau und der Junge standen beide mit gespitzten Ohren da. William sagte: «Na gut, wie du willst. Edward Peers wird bestimmt in kürzester Frist etwas aus ihm machen.»
Mistress Fox besaß offenbar ein sehr gutes, sehr feines Gehör. «Master Peers», sagte sie, «hat gebeten und gebettelt, ich sollte ihm Nicholas für die St. Pauls-Kindertruppe geben. Aber ich habe zu ihm gesagt, nein, Nicholas soll an ein richtiges Theater. Er wird ja nicht immer und ewig ein Kind bleiben, habe ich gesagt.»
Der Unmut, der sich den ganzen Tag lang in Richard Burbage angestaut hatte, entlud sich in einem plötzlichen Donnerwetter. «Verdammt, Will!» brüllte er. «Zwei Jahre läßt du uns im Stich und lebst in Saus und Braus in Stratford, und dann geruhst du endlich wieder herzukommen und fängst schon in den ersten fünf Minuten an, den alten Freund zu lehren, was seines Amtes ist!» Er stand schwer atmend da, breitbeinig und mit zornig funkelnden Augen und starrte William böse an, nachdem er ihn eben noch umarmt hatte.
William wandte sich mit einer abermaligen Verbeugung an Mistress Fox. «Madam», sagte er, «ich muß Euch bitten, uns jetzt zu verlassen und morgen wiederzukommen. Wir haben dringende Geschäfte …»
Mistress Fox verabschiedete sich mit einem zuckersüßen Lächeln und ging, schnurrend wie eine Katze, mit Nicholas davon. Sie konnte es kaum erwarten, Marie Mountjoy von ihrer Begegnung mit Maries höflichem, wohlerzogenem Logiergast zu erzählen.
Richard sah William finster an.
William sah Richard lächelnd an. Vor zwei Jahren noch wäre er nach einem solchen Ausbruch bedrückt und gekränkt wie ein gescholtenes Kind heimgeschlichen und hätte den ganzen Abend lang Trübsal geblasen. Doch inzwischen nahm er solche Unwetter bei Richard nicht mehr tragisch. Das schöne Haus, das er in Stratford besaß, sein Erfolg und die Zuneigung seiner Freunde – das alles gab ihm innere Sicherheit. Er wußte, schon morgen würde Richard alles tun, um sein verletzendes Verhalten wiedergutzumachen. Der Junge war so gut wie angestellt.
Er klopfte seinem Freund auf die Schulter. «Komm, sei nicht so mürrisch, Dick», sagte er und rüttelte ihn. Dann hob er horchend den Kopf. Es hatte geklopft. Er blickte zur Tür, und plötzlich leuchteten eine Sekunde lang seine Augen glücklich auf. Dann wurde er aschfahl im Gesicht. Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und schluckte. «Ich hielt dich für einen anderen», murmelte er lautlos vor sich hin.
Beide blickten sie zur Tür.
Richard Burbage sah eine Frau mit einem Knaben.
William Shakespeare sah einen Knaben mit einer Frau.
Es war eine Frau, die einen Mann in Unruhe versetzen konnte.
Nicht daß sie ihre Schönheit bewußt zur Schau getragen oder gar durch ihre Kleidung ihre hübschen weiblichen Linien betont hätte. Sie trug ein schlichtes schwarzes Kleid. Ihr ovales Gesicht war von dunklem Haar gerahmt. Die Augenbrauen waren stark geschwungen. Und die makellose brünette Haut über ihrem seidenen Mieder wirkte wie dunkler Samt. Sie muß südländisches Blut in den Adern haben, dachte Burbage, italienisches oder gar spanisches.
Später sollte auch William Shakespeare die Schönheit der Frau bemerken. Doch jetzt konnte er immer nur den Knaben anstarren, der ihn so lebhaft an seinen toten Sohn Hamnet erinnerte.
Erinnerungen. Stratford, die Wiesen am Fluß und die kleine Hand vertrauensvoll in seiner großen Hand. Und das stolze Geplapper des Jungen. «Wenn ich groß bin, Vater, werde ich Schauspieler, und ich verspreche dir, daß ich die Rollen in deinen Stücken besser spiele als alle anderen.» Stratford, und dann Annes starres Gesicht. Anne, die mit gebrochenem Herzen zu ihm sagte: «Du hättest bei uns sein sollen, als dein Sohn krank war. Vielleicht wäre er dann nicht gestorben.»
Ja, vielleicht wäre er nicht gestorben. Seit sieben Jahren lebte er mit diesem Gedanken, der ihn bis an sein Grab begleiten würde.
Und hier war nun ein Junge genau wie Hamnet – ernst, stämmig und mit einem frischen, offenen Gesicht. Doch forschte er vergeblich in diesem Gesicht nach dem sicheren, unbekümmerten Vertrauen seines Sohnes, der gestorben war, ehe er wissen konnte, was Zweifel waren.
Er winkte den Jungen zu sich herüber. Der Junge, der neben seiner Mutter gestanden hatte, kam, stellte sich vor ihn hin und sah scheu zu ihm auf.
«Wie heißt du, mein Junge?»
«Matthew, Herr, Matthew Peyre.»
Nein, das war nicht Hamnets Stimme. Hamnets Stimme war warm und weich gewesen, sie hatte etwas von den Feldern und Wiesen um Stratford gehabt. Das hier war eine Londoner Stimme, schüchtern zwar, aber nüchtern und klar. Überdies sprach der Junge mit der Deutlichkeit eines Fremden, der nicht seine Muttersprache spricht. «Peyre?» sagte Will. «Das ist kein englischer Name, nicht wahr?»
«Nein, Herr, wir sind französischer Abkunft, mein Vater war Silberschmied.»
«War?»
«Ja, Herr. Er starb. Im letzten Jahr.»
«Das tut mir leid für dich, Matthew.»
«Ich danke Euch, Herr.»
Aha. Ein englischer Hamnet, ein französischer Matthew. Und doch einander so ähnlich. Und der verhaßte Tod hatte auch in Matthews Leben schon eingegriffen. Oh, du bist zu geschäftig, Tod! Lächelnd fragte er: «Und du möchtest gern Schauspieler werden?»
«Ja, Herr.» Der Junge nickte eifrig.
«Es ist kein leichtes Brot. Und eine strenge Lehre erwartet dich. Du mußt jeden Tag viele Stunden arbeiten – mehr Stunden, als für einen Jungen in deinem Alter gut ist –, mußt lernen, proben und bei den Aufführungen auftreten. Erschreckt dich das nicht?»
Der Junge schüttelte mit zusammengepreßten Lippen und glänzenden Augen heftig den Kopf.
«Du mußt lernen, wie eine Frau zu sprechen, zu gehen und sogar zu denken, und du mußt Frauenkleider tragen. Geniert dich das nicht?»
«Nein, Herr. Meine Mutter ist eine Frau – warum sollte ich mich schämen, eine Frau zu spielen?»
«Bravo. Aber du mußt auch tanzen und singen, mußt kokettieren und spröde tun und ausgelassen kichern. Du mußt deine Mutter verlassen und unter Männern arbeiten, die dir manchmal grob und ungebärdig vorkommen werden. Das Theater ist eine Männerwelt, Master Peyre.»
William bemerkte das leichte Zögern, die Zungenspitze, die über die Lippe fuhr. Aber die Antwort klang mutig und fest: «Mir ist davor nicht bange, Herr.»
«Und du mußt mit auf Reisen gehen, in Wagen schlafen, mußt in der Frühe die Bühne mit errichten und sie um Mitternacht wieder abschlagen. Und du wirst oft frieren und hungern. Ist dir auch davor nicht bange?»
«Nein, Herr.»
William lachte und legte die Hand auf seine Schulter. Dann sah er den abgegriffenen Bogen auf dem Tisch. Er gab ihn dem Jungen. «So, Matthew, jetzt lies mir das einmal vor. Und denke daran – du bist ein als Mann verkleidetes Mädchen und umwirbst eine junge Frau …»
Richard geleitete die Frau unter vielen Verbeugungen zu einem Stuhl.
Sie schritt zu dem Stuhl hin, setzte sich und neigte ein wenig den Kopf zur Seite, und das alles war gleichsam eine einzige fließende Bewegung, die durch nichts unterbrochen wurde. Dann saß sie da, ruhig und gelassen, die Hände im Schoß gefaltet, und wandte nicht eine Sekunde die Augen von ihrem Sohn ab.
Burbage betrachtete sie dankbar. Sie wirkte so erfrischend und so wohltuend wie ein See im heißen Sommer. Und die stille Heiterkeit, die sie ausstrahlte, ließ ihn seinen Ärger vergessen. Er sagte «Darf ich Euch ein Kompliment machen, Mistress?»
Der Blick, mit dem sie ihn kurz ansah, war nicht ermutigend, und ihr «Warum?» klang fast ein wenig verächtlich.
Sie war eine schöne Frau, und nach dem Tode ihres Mannes hatte sie schnell gelernt, worauf die Schmeicheleien der Männer einer jungen Witwe gegenüber meist hinausliefen und daß man ihnen am besten mit kühler Zurückhaltung begegnete.
«Ihr seid die erste Mutter, Madam», sagte Richard Burbage, «die ihren Sohn selbst sprechen läßt.»
Ihr Ausdruck wurde sanfter. Sie lachte sogar. «Er will schließlich Schauspieler werden», sagte sie. «Nicht ich. Nein, beim Kreuze Christi, nicht ich.»
Beim Kreuze Christi – welch seltsamer altmodischer Ausdruck für eine so ruhige junge Frau, dachte Richard Burbage. Seit der Glaube nicht mehr viel galt, hörte man dergleichen nur noch selten. Also war sie vermutlich Katholikin.
Solange die Menschen, mit denen er zu tun hatte, keine eifernden Puritaner waren, die er um so mehr haßte, als sie dafür sorgen wollten, daß die Theater geschlossen wurden, kümmerte es ihn nicht, welchem Glauben sie anhingen. Insgeheim dachte er sogar, daß die Welt ohne Religionen wahrscheinlich ein sehr viel angenehmerer Ort gewesen wäre. Aber der Allmächtige hatte es nun einmal so gefügt, und jetzt, da ein calvinistischer König auf dem Wege von Schottland nach London war, galt es, in den Fragen der Religion wieder auf der Hut zu sein. Es hatte Zeiten gegeben – und vielleicht standen solche Zeiten nun abermals bevor –, in denen oft schon die Bekanntschaft mit einem Papisten genügt hatte, daß unschuldige Männer und Frauen den Folterknechten überantwortet worden waren.
Er sagte: «Es ist eine schwere Arbeit, aber wir sorgen gut für die Knaben. Jeder von ihnen wird einem unserer verheirateten Teilhaber zugeteilt, bei dem er wohnt und wie ein Glied der Familie behandelt wird.»
«Da bin ich froh. Seit dem Tod meines Mannes fehlt dem Jungen die väterliche Hand. Und sicher ist es nicht gut für ihn», fügte sie traurig hinzu, «daß er so sehr an mir hängt. Aber –»
«Aber, Madam?»
«Wenn es möglich ist, Herr, würde ich gern sehen, daß mein Sohn bei Master Shakespeare in die Lehre geht.»
Trotz der höflichen Worte klang es wie ein Befehl. Richards Unmut brach wieder hervor. «Das ist nicht möglich, Madam. Das Gesetz bestimmt ausdrücklich, daß die Knaben in die Obhut von Familienoberhäuptern gegeben werden. Es könnte sonst zu Unannehmlichkeiten kommen, wie Ihr gewiß versteht, Madam.»
«Ist Master Shakespeare denn kein Familienoberhaupt?» Die schön geschwungenen Augenbrauen hoben sich verwundert.
«Doch, gewiß, Madam. Aber seine Familie wohnt nicht in London, sondern in der Grafschaft Warwick.»
«Er ist nicht in London zu Hause? Ihr erstaunt mich. Wer hätte gedacht, daß auf lehmigem Ackerboden so viel Witz gedeiht.»
Burbage schwieg. Dann sagte er: «Ich fürchte, Madam, wir werden keinen Platz für Euren Sohn haben.» Und mit schlecht verhohlener Gereiztheit fügte er hinzu: «Master Shakespeare hat gerade erst vor zehn Minuten einen Knaben in die Truppe aufgenommen.»
Doch jetzt kam William strahlend mit dem Knaben auf die beiden zu. «Dick», rief er, «dieser Junge ist Viola! Gleich beim ersten Vorlesen. Er wird die Rolle so gut spielen wie kein anderer.» Er wandte sich der Mutter des Knaben zu. «Mistress Peyre. Ich nehme den Jungen in meine Lehre. Gewöhnlich fertigen wir in solchen Fällen keine formellen Verträge aus, aber wenn Ihr etwas Schriftliches wünscht …»
Sie senkte den Kopf. «Ich bin Euch sehr dankbar, Herr.» Sie vermied es, Burbage anzusehen. Eine weniger taktvolle Frau hätte es sich nicht versagen können, den Triumph auszukosten.
Aber Richard Burbage sah sie an, und er sah den Jungen und schließlich Will an. Und mit fast übermenschlicher Anstrengung gelang es ihm, die Ruhe zu bewahren. Er sagte: «Es tut mir leid, Madam, aber wir können Euch noch keine feste Zusage geben. Master Shakespeare und ich haben einiges zu besprechen, bevor er Euch eine Lehrstelle für Euren Sohn anbieten kann.»
«Ich verstehe, Herr.» Sie erhob sich und schritt zur Tür. Es waren die gleichen anmutigen, fließenden Bewegungen wie zuvor. «Komm, Matthew», sagte sie. Als sie die Tür erreicht hatte, wandte sie sich den beiden Männern zu und neigte den Kopf. Sie bedachte Richard Burbage mit einem flüchtigen Lächeln und sah dann Master Shakespeare an. Es war ein langer, nachdenklicher Blick, den William seltsam beunruhigend fand.
2 Er ist in Schweiß und außer Atem …
Matthew Peyre kniete vor seinem Bett. Seine Mutter kniete neben ihm.
Er trug ein langes weißes Nachthemd mit Rüschen an den Ärmeln. Seine Mutter hatte ihr schwarzes Kleid an. Sie trug noch immer Trauer.
Sie erhoben sich und bekreuzigten sich. Matthew sprang ins Bett und zog sich die Decke bis ans Kinn. «Warum muß ich so früh ins Bett, Mutter? Es ist noch gar nicht dunkel draußen.»
«Pater Grainger kommt, um mir die Beichte abzunehmen.»
«Warum nimmt er nicht auch mir die Beichte ab?»
«Weil du nichts zu beichten hast, du Schelm.»
Er lachte. «Ich habe große Sünden begangen, Mutter.» Er ließ den Kopf hängen, machte ein zerknirschtes Gesicht und schlug die Hände über seinem blonden Schopf zusammen. «Miserere mei, Deus.»
«Laß das, mit so etwas treibt man keinen Scherz», sagte seine Mutter lächelnd und doch streng.
Er klopfte mit der Hand auf die Decke. «Bleib noch ein bißchen hier, Mutter, und sprich mit mir. Master Shakespeare hat mir gut gefallen.»
Sie setzte sich mit der ihr eigenen Anmut auf den Bettrand. «Wie schön, mein Junge. Er ist ein sehr gescheiter Mann. Und er kann dich mehr lehren als jeder andere Schauspieler in London.»
«Er …» Der Junge sah seine Mutter forschend an. Er wußte, daß man lieber nicht an vergessene Kümmernisse rührte, aber dieser eine Kummer würde nie in Vergessenheit geraten. «Er hat mich an Vater erinnert. Er ist so nett. So höflich.» Er sah sie wieder an. «Es kommt selten vor, daß ein erwachsener Mann zu einem Jungen höflich ist», fügte er hinzu. «Aber Vater war es. Und Master Shakespeare ist es auch. Seltsam, nicht wahr?»
«Ja», sagte sie kurz und stand auf. Er legte sich zurück, und sie machte wie jeden Abend das Zeichen des Kreuzes über ihm. «Gott gebe dir eine gute Nacht und einen erquickenden Schlaf, Matthew.»
«Ich werde beten, daß Gott dir das gleiche gibt, Mutter.»
Sie beugte sich über ihn und küßte ihn in einem Aufwallen von verzweifelter Zärtlichkeit. Dann ging sie hinunter ins Wohnzimmer, wo die letzten Strahlen der Abendsonne durch die rautenförmigen Butzenscheiben fielen und sich golden über die Täfelung ergossen. Unruhe war über sie gekommen. Die heiteren Frühlingsabende machten sie immer unruhig, lockten sie mit dem Versprechen sommerlicher Wärme hinaus ins Freie, wo ein kalter, peitschender Wind sie alsbald wieder ins Haus trieb.
Aber an diesem Abend raubte ihr noch etwas anderes die Ruhe.
Sie hatte an diesem Tag einen Schritt getan, der für sie selbst trostlose Einsamkeit bedeutete, zumal nur wenige Menschen den Mut hatten, mit Katholiken befreundet zu sein. Vor allem aber hatte sie Angst um ihren empfindsamen, verletzbaren Sohn. Würde er nicht Monate oder gar Jahre unglücklich sein, wenn er aus einem friedlichen, frommen Elternhaus in den Trubel des Theaterlebens gestoßen wurde? Außerdem war sie an diesem Tag zum erstenmal seit Roberts Tod aus ihrer einsamen Welt hinausgetreten und hatte zwei Männer kennengelernt – zwei kluge, höfliche Männer. Sie schätzte Klugheit, und sie vermißte das Gespräch mit klugen Männern, auf das sie seit Roberts Tod verzichten mußte. Matthew war klug, und er war ein lieber, aufmerksamer, guter Sohn. Aber ein Junge, wie lieb und zärtlich er auch sein mochte, konnte keinen Mann ersetzen. Und Pater Grainger – gewiß, er war klug, aber er war gleichsam nur ein schwarzes Gespenst, das mit den Motten und Fledermäusen durch die Dämmerung huschte.
Sie warf sich einen Mantel über und ging in den kleinen Garten hinaus, wo ein paar knorrige Apfelbäume zwischen erfrorenen gelben Narzissen standen und die hohe Ziegelmauer im letzten Sonnenlicht glühte.
Pater Grainger wollte kommen. Und das bedeutete Gefahr.