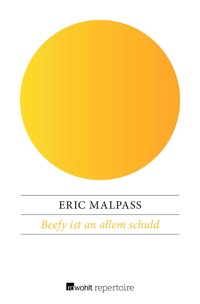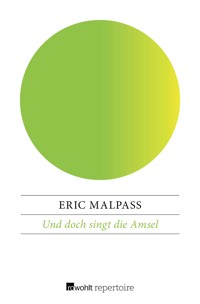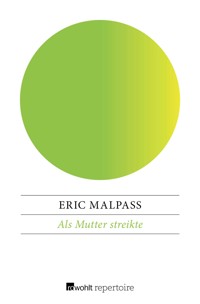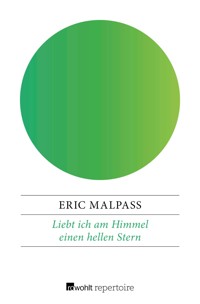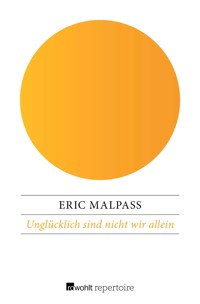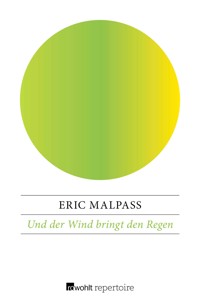
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Zeitromane
- Sprache: Deutsch
Mit seinen Gaylord-Romanen ist Eric Malpass weltberühmt geworden. Aber diesmal begegnen wir einer kleinbürgerlichen Familie mit engem Horizont – den Dormans. Tom, ihr Sohn, ist 1914 gefallen. Nell, die junge Witwe, ist den Dormans eine Fremde. Dennoch versorgt sie fröhlich die alten Schwiegereltern und läßt sich geduldig ausnutzen, erzieht ihren kleinen vaterlosen Sohn Benbow und findet nach einiger Zeit sogar den Mut zu einer neuen Ehe mit einem Bruder Leichtfuß. Ihr schmales Glück zerbricht wieder, sie findet Trost nur an ihrem Jungen. Benbows große Liebe, eine junge Deutsche, läßt sich von Hitlers Propagandatönen verlocken und kehrt in die Heimat zurück. Der Zweite Weltkrieg bricht aus, Bomben fallen. Der Soldat Benbow findet, als er auf Urlaub kommt, die geliebte Mutter nicht mehr vor. Er lebt sein Leben weiter in einer Durchschnittsehe, ein ruhiger, korpulenter Bankangestellter, der im Schreibtisch einen Zettel mit einer Berliner Adresse versteckt hält und sich mit vierundsechzig, nach dem Tode seiner Frau, eines Tages mit diesem Zettel auf den Weg macht ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Eric Malpass
Und der Wind bringt den Regen
Aus dem Englischen von Anne Uhde
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Mit seinen Gaylord-Romanen ist Eric Malpass weltberühmt geworden. Aber diesmal begegnen wir einer kleinbürgerlichen Familie mit engem Horizont – den Dormans. Tom, ihr Sohn, ist 1914 gefallen. Nell, die junge Witwe, ist den Dormans eine Fremde. Dennoch versorgt sie fröhlich die alten Schwiegereltern und läßt sich geduldig ausnutzen, erzieht ihren kleinen vaterlosen Sohn Benbow und findet nach einiger Zeit sogar den Mut zu einer neuen Ehe mit einem Bruder Leichtfuß. Ihr schmales Glück zerbricht wieder, sie findet Trost nur an ihrem Jungen. Benbows große Liebe, eine junge Deutsche, läßt sich von Hitlers Propagandatönen verlocken und kehrt in die Heimat zurück. Der Zweite Weltkrieg bricht aus, Bomben fallen. Der Soldat Benbow findet, als er auf Urlaub kommt, die geliebte Mutter nicht mehr vor. Er lebt sein Leben weiter in einer Durchschnittsehe, ein ruhiger, korpulenter Bankangestellter, der im Schreibtisch einen Zettel mit einer Berliner Adresse versteckt hält und sich mit vierundsechzig, nach dem Tode seiner Frau, eines Tages mit diesem Zettel auf den Weg macht ...
Über Eric Malpass
Eric Malpass (1910–1996) hat in seinem Heimatland Großbritannien lange Jahre als Bankangestellter gearbeitet. 1947 wurde er Mitarbeiter der BBC, außerdem schrieb er für diverse Zeitungen. Er verfasste zahlreiche Romane und lebte als freier Schriftsteller in Long Eton, nahe Nottingham.
Inhaltsübersicht
Der Halbmond zieht gen Westen, Lieb,
Und Regen bringt der Wind;
Du liegst so fern von mir, mein Lieb,
Die Meere zwischen uns sind.
Ob’s regnet, weiß ich nicht, mein Lieb,
Im Land, wo du jetzt ruhst;
Du schläfst ja auch so tief, mein Lieb,
Und so wenig wie ich weißt du’s.
A.E. HOUSMAN
In Erinnerung an Tom und Lilias, Blanche und Jack
1
Die Straßenbahn fuhr bis gegen zehn Uhr abends.
Benbow war noch klein, aber er hielt nicht viel von Gefühlsäußerungen, und so verlor er den Erwachsenen gegenüber nie ein Wort darüber, wie selig es ihn machte, wenn die Straßenbahn mit lautem Klingeln den Hügel heruntergerasselt kam oder wenn sie langsam und mühevoll bergauf knarrte. Die höchste Wonne war es, wenn eine aus jeder Richtung kam und sie sich genau vor seinem Schlafzimmerfenster trafen und majestätisch aneinander vorüberglitten. Großtante Min hatte ihm erzählt, einmal sei ein Betrunkener vor die Bahn gefallen, da, direkt vor dem Fenster, und die Räder hätten ihm beide Beine abgeschnitten. Es hatte ihn gegruselt, und dann hatte er lange darüber nachgedacht, ob der Mann selber oder ob nur seine Beine unter der Bahn gelegen hatten. Er war noch zu klein, um eine so schwierige Frage in Worte zu fassen. So stellte er sich mal die Beine und mal den Oberkörper des Mannes unter der Straßenbahn vor – wie ein Maler, der ein Bild entwirft –, wenn er zufrieden im Bett lag und draußen die Wagen vorüberfuhren und der Schein der Funken über die Zimmerdecke zuckte.
In einer hellen Vollmondnacht – «Zeppelinwetter» nannte seine Mutter solche Nächte – hörte er, wie draußen eine Bahn plötzlich bremste und vor seinem Fenster anhielt. Benbow war sofort aus dem Bett und am Fenster. Seine bloßen Füße spürten die Kälte nicht. «Lieber Gott, bitte mach, daß wieder einer drunterliegt», betete er inbrünstig.
Aber sein Gebet wurde nicht erhört. Die Bahn hatte mit blauverhängten Lampen einfach zwischen den zwei Haltestellen angehalten. Das war noch nie vorgekommen. Und jetzt lief eine junge Frau aus dem Schatten der Häuser auf die Straße, und der Schaffner sprang vom Wagen und küßte sie im hellen Mondlicht. Dann blieb die Frau allein zurück, und die Bahn setzte sich wieder in Bewegung.
Benbow hatte sich mehr erhofft. Enttäuscht schlüpfte er wieder in sein Bett. Er wunderte sich nur, daß die junge Frau so ausgesehen hatte wie seine Mutter. Natürlich konnte es seine Mutter nicht gewesen sein. Er hatte noch nicht viel Erfahrung, aber er wußte, daß Männer und Frauen einander nur küßten, wenn sie verlobt oder verheiratet waren. Und seine Mutter war seine Mutter und sonst nichts.
Deshalb dachte er nicht weiter darüber nach.
Sein Vater war ein Foto in einem silbernen Rahmen.
Das lag am Krieg. Benbow wußte nicht, was das war. Er wußte nur, daß die Erwachsenen immer ein bißchen weinten, wenn sie von Dad sprachen, vor allem Oma, Großtante Min und Tante Edith. Deshalb erwähnte Benbow seinen Vater auch nur, wenn er wirklich in der Klemme war und die Aufmerksamkeit von sich ablenken mußte.
Er hätte gern mehr gewußt. Aber niemand erklärte es ihm.
Oma Dorman sagte: «Er gab sein Leben für uns, mein Junge.»
Großtante Min murmelte: «Ich denke, er ist vielleicht besser dran als mancher, der zurückgekommen ist.»
Opa Dorman sagte seufzend: «Niemand hat größere Liebe denn die, daß er sein Leben läßt für seine Freunde.»
Und Benbows Mutter sagte: «So was Dummes – geht hin und läßt sich totschießen. Warum ist er nicht in der Munitionsfabrik geblieben, wie dein Onkel Albert!»
Aber niemand erklärte ihm, was der Krieg war. Und seine Verwirrung war noch größer geworden, als Großtante Min eines Tages gesagt hatte: «Wenn dein Vater damals nicht aus dem Krieg auf Urlaub gekommen wäre, dann wärst du heute nicht hier.»
Dann hatte Dad ihn also anscheinend im Tornister aus dem Krieg mitgebracht? Ratlos wandte er sich an seine Mutter. «Mam, Tante Min hat gesagt, ich wär nicht hier, wenn Dad damals nicht auf Urlaub gekommen wäre.»
Sie sah ihn an mit einem Blick, bei dem ihm bange wurde. «Die arme Alte», sagte sie. «Keine Ahnung hat sie.» (Oh, die Nacht in dem dumpfen kleinen Schlafzimmer, das angstvolle Warten auf die Morgendämmerung, denn am Morgen mußte er zurück in den Schlamm, in die Angst.)
Regen, Regen, geh doch wieder,
Komm an Mutters Waschtag wieder.
Die ganze Woche hindurch hatte Benbow das alte Liedchen vor sich hingesummt, wenn er mit plattgedrückter Nase am Fenster stand und den Wolken nachsah, die über die Schornsteine und die grauen Schieferdächer hinwegfegten. Und tatsächlich hing am Montagmorgen der Himmel wie eine nasse graue Decke über den Straßen. Das hieß, daß nachmittags beim Tee der Wäschetrockner vor dem Kaminfeuer stehen und es überall im Hause nach Seife und Dampf und nasser Wäsche riechen würde.
Der Montagmorgen war ihm sowieso verhaßt. Der Übergang war zu plötzlich. Sonntag – das hieß Braten mit Röstkartoffeln, ein Glas Limonade, bei gutem Wetter ein Spaziergang über den Spielplatz, wo er einen sehnsüchtigen Blick auf die Schaukeln warf, die sonntags alle hochgebunden waren, damit auch die Kinder den Feiertag heiligten, und abends saß man in der guten Stube am Klavier und sang Choräle, und Onkel Walter sang manchmal Pale hands I loved, beside the Shally, Ma.
Montag – das hieß Arbeit und kaltes Hammelfleisch mit Kartoffelbrei. Und der Montagmorgen war trostlose Düsternis.
Für Opa Dorman begann der Tag damit, daß er saubere Wäsche anziehen mußte. Ein lästiges Unternehmen. Die Hosenträger mußten durch die Schlaufen der langen wollenen Unterhosen gezogen werden, dann mußte er die Kragen- und Manschettenknöpfe an einem frischen Flanellhemd befestigen und ein sauberes, ungemütlich steifes Vorhemd anziehen. Aber schließlich hatte er es geschafft und kam nach unten.
In der Küche brannte schon ein helles Feuer. Dafür hatte Benbows Mutter gesorgt. Und sie hatte auch schon den Tisch gedeckt – für Oma und Opa. Benbow stocherte mit dem Löffel in seinem Brei herum. Seine Mutter war in der Waschküche und machte mit Reisig und der Sunday Chronicle Feuer unter dem großen Waschkessel.
«Sie will heute im Bett frühstücken, Nell», rief Opa ihr zu. «Sie fühlt sich nicht recht.»
«In Ordnung», sagte Benbows Mutter und warf eine Schaufel Kohlen aufs prasselnde Feuer.
«Heute nacht hat eine Straßenbahn draußen vorm Haus gehalten», verkündete Benbow.
Niemand beachtete ihn. «Sie hat keinen Appetit. Nur ein Stückchen Toast», sagte Opa. «Und Tee, natürlich.»
«Aber sie hatte keine Panne, und es hat auch keiner unter den Rädern gelegen.» Benbow gab sich alle Mühe, das Interesse der anderen zu wecken.
«Und ich hätte gern zu meinem Spiegelei den Rest Wurst von gestern, Nell», sagte Opa. «Wenn du sie mir ein bißchen aufwärmst.»
«Schön, Opa.» Nell blickte noch einmal in die züngelnden Flammen, dann ging sie in die Speisekammer und holte die graue Wurst. Opa nahm am Tisch Platz und schlug die Daily Mail auf. Benbow zog mit seinem Löffel das Bild des Sunny Jim auf dem Kraftflockenpaket nach. Dann sagte er: «Und als sie hielt, kam eine Dame und sprach mit dem Schaffner.»
«Du kannst mir ja ’ne Scheibe Brot mitbraten», sagte Opa.
Jetzt kam Benbows Mutter an den Tisch und fing an, Brot zu schneiden.
«Und der Schaffner hat sie umarmt und geküßt», fuhr Benbow fort.
Seltsam. Er hatte das schon manchmal bei Erwachsenen beobachtet: man konnte ihnen die interessantesten Sachen erzählen, und sie hörten überhaupt nicht zu. Wenn man dann aber noch irgendwas hinzufügte, konnte es geschehen, daß sie sich daran festbissen, als wäre es die Hauptsache.
Opa ließ jetzt die Zeitung sinken, nahm den Kneifer ab, setzte ihn wieder auf und starrte Benbow an. «Was sagst du da?» fragte er. Und Mutter blieb mit der Bratpfanne in der Hand wie erstarrt stehen.
«Ja», sagte Benbow, «sie hat draußen vor dem Haus angehalten. Eine von den offenen, ohne Verdeck.»
«Und was war das mit der Dame?»
«Die hat den Schaffner geküßt. Die Bahn mußte ganz lange warten.»
Mutter stellte die Pfanne wieder auf den Herd. «Woher weißt du das eigentlich, Benbow?» fragte sie mit strenger Stimme.
Wie üblich stellte sie genau die Frage, die er nicht hören wollte. Er sollte doch nach dem Zubettgehen nicht mehr herumstreunen, wie sie es nannte.
Aber diesmal rettete ihn Opa mit zwei Worten, die Benbow zwar nicht verstand, die sich aber höchst bedeutungsvoll anhörten und sogar Mutter von ihm ablenkten. «Taffy Evans», sagte Opa. «Klingt mir ganz nach Taffy Evans.»
Zu Benbows Überraschung erwiderte seine Mutter nichts darauf. Sie kam mit der Bratpfanne an den Tisch und schob das Spiegelei und die Wurst auf Opas Teller.
Benbow sah sie verwundert an. Das freundliche Gesicht seiner Mutter war plötzlich rot geworden. Sie schob sich eine blonde Haarsträhne aus der Stirn und ging wieder in die Waschküche.
«Taffy Evans», sagte Opa noch einmal. «Ich wette zehn Shilling, daß das Taffy Evans war.»
Er legte die Zeitung beiseite und machte sich an sein Frühstück. Nach jedem Bissen schlürfte er einen Schluck Tee durch seinen rötlichbraunen Schnauzbart. (Tee war sein Lebenselixier.)
Nell hockte vor dem Kamin und hielt Omas Toast über die Flammen. Abwesend blickte sie in die Kohlenglut.
Benbow war noch mit seinem Gefährten beschäftigt, der ihm jeden Morgen beim Frühstück Gesellschaft leistete: Sunny Jim auf der Flockenpackung. «War das erste Mal», murmelte er, «daß die Straßenbahn direkt vor unserm Haus gehalten hat.»
Aber niemand hörte ihm zu. Die Erwachsenen hörten nie richtig zu – außer bei Dingen, über die man nicht gern sprach: dann wollten sie immer noch mehr wissen.
«Mindestens fünf Minuten hat sie angehalten», fügte er hinzu.
«Du sagst oben kein Wort davon, hörst du!» wies Opa seine Schwiegertochter an, die gerade das Frühstückstablett für Oma fertig machte. «Es regt sie nur unnötig auf.» Dann betrachtete er das Tablett. «Oh, mach mir doch auch ein bißchen Toast, Nell.»
«Ja, gern. Ich will nur eben Oma das Frühstück bringen.»
Opa blieb mit wächsernem Gesicht sitzen. Sunny Jim, der Junge auf der Kraftflockenpackung, sprang wie jeden Morgen strahlend und mit apfelroten Wangen über das Gatter, und Benbow saß stumm auf seinem Stuhl im Mittelpunkt seines Universums, das auf der einen Seite bis zum Marktplatz und auf der andern bis zur Endstation der Straßenbahn reichte. Ein Universum aus ärmlichen Straßen und kleinen Läden, in dem Großeltern, Tanten und Onkel und Mam Sonne, Mond und Sterne waren und Dad ein ferner blasser Stern, der sich im Nebel verlor.
Lange bevor Benbow und sein Universum existierten, hatte die hübsche Nell Griffiths eines Tages in ihrer Heimatzeitung in Wales in einer Anzeige gelesen, daß in den Midlands Verkäuferinnen gesucht wurden. Mutig hatte sie sich auf den Weg gemacht, und es dauerte nicht lange, da hatte sie drei junge Männer kennengelernt: Frank Hardy, Tom Dorman und Taffy Evans, der auch aus Wales stammte. Sie schloß alle drei in ihr Herz. Aber sie heiratete den stillen, gutmütigen Tom Dorman. Er stellte die kleine schüchterne Nell seiner Familie vor. Da waren seine Schwestern, Edith mit ihrem verkrampften Lächeln und die kühle, gleichmütige Alice, da war seine Mutter, die mit einer freundlichen Miene ihre Härte verdeckte, und da war Toms Vater, der verstohlene Blicke über ihren Busen gleiten ließ – kein Grund zur Sorge, denn er war ein treuer Kirchengänger, in dessen Augen Gin und Wollust gleichermaßen sündig waren. Tante Min erklärte in der Küche hinter vorgehaltener Hand (aber laut genug, daß Nell jedes Wort verstand): «Die Waliser hab ich nie gemocht. Alle falsch, taugen nichts …» Nur Tante Mabel, die immer ein bißchen nach Schweinestall und Grünkohl roch, hatte ein gutes Wort für sie. Sie musterte Nell beifällig, als wäre sie eine Sau auf dem Viehmarkt, gab ihr lachend einen Klaps auf den Hintern und sagte: «Gott steh dir bei, Kindchen, in dieser Familie! Aber Tom ist in Ordnung, glaub mir. Bei Tom wirst du’s gut haben, Liebes.»
Dann kam die Zeit vor Benbows Geburt. Für Nell gab es nun keine grünenden Bergmatten mehr und auch keine Stimmen im Kirchenchor und keine Harfenmusik; ihr blieb nur der Stadtpark, wo der Rasen oft naß und schlammig war und wo an Winternachmittagen die Rufe der Sportler hallten und an Sommerabenden die Musik der Kapelle der Grenadier Guards ertönte: Opernpotpourri oder Indische Liebeslieder. Bis eines Tages die Musiker ihre roten Röcke auszogen und ihre Instrumente einpackten. Für Soldaten gab es jetzt andere Uniformen und andere Aufgaben.
Eine Welt, die für die Ewigkeit bestimmt schien, begann zu zerbrechen. Gelächter erstickte, lächelnde Lippen verzogen sich, als schmeckten sie Galle, und küßten nicht länger süß und sorglos, sondern in blinder Verzweiflung.
In Europa gingen die Lichter aus. Und in diese dunkle Welt wurde Benbow geboren.
«Was sollte ich bloß ohne dich machen, Nellie», sagte Oma und lehnte sich zufrieden in die Kissen zurück.
«Schreckliches Wetter heute morgen», meinte Nell. «Am besten, du bleibst im Bett.» Sie warf einen Blick auf das große Federbett und einen Augenblick beneidete sie Oma. Sie wandte sich der Tür zu.
«Oh, gib mir doch bitte noch meine Zähne, Nell», sagte Oma. «Da, auf der Kommode.»
Nell brachte ihr das Glas mit dem Gebiß und lachte ihr freundlich zu. Dann lief sie nach unten.
Oma widmete sich ihrem Frühstück. Sie hatte weiche blasse Wangen, doch ihre kleinen Augen wirkten kalt und hart wie Murmeln und die Lippen waren meist schmal zusammengepreßt. Weil sie seit sechzig Jahren alles und alle ablehnte, sagten manche. Weil sie ihr Leben lang leidend gewesen war, sagte Oma selber. Nicht, daß sie eine bestimmte Krankheit hatte. Sie war einfach leidend. Besonders natürlich an so naßkalten Tagen wie heute. Aber sie trug ihr Leiden mit Fassung.
Opa rollte seine frische Montagmorgen-Serviette zusammen und schob sie ungeschickt in seinen Serviettenring. Dann nahm er seine Zeitung, erhob sich und schickte sich an, in den Laden hinüberzugehen.
«Darf ich mit?» fragte Benbow.
«Ja.»
Benbow stand auf und folgte seinem Großvater. Er war jetzt fast vier, und Opa war vierundfünfzig, und beide hatten den gleichen steifen, gemessenen Gang. Was Benbow auch anhatte, es war immer fest zugeknöpft. Und die graue Tweedjacke mit dem Fischgrätenmuster, die er heute trug, saß so stramm über der Brust, daß er aussah wie ein gut verschnürtes Paket. Aber wer ihn gut kannte, hätte gesehen, daß das verschlossene Kindergesicht jetzt sogar eine Spur von freudiger Erregung zeigte. Denn der Laden war sein ganzes Entzücken.
In Opas Laden roch es nach Leim und frisch geschnittenem Holz, nach Polsterstoffen und Lack. Da gab es dreiteilige Möbelgruppen (langweilig), Tische (langweilig), Stühle (langweilig), Leimtöpfe (herrlich) und einen Druckerkasten (wunderschön), mit dem Opa die Preisschilder druckte und Benbow sich von oben bis unten schwarz einschmierte. Und hinten im Hof gab es einen Wagen, ein Pferd im Stall, ein WC und die Werkstatt, zu der ein paar Stufen hinaufführten. Und in der Werkstatt gab es Holz, Leim und George. George, der alte Gehilfe, war ein Muster an Mittelmäßigkeit, aber in Benbows Herzen besaß er einen festen Ruhmesplatz: er konnte sich den Mund mit dünnen Stahlnägeln vollstopfen und dann einen nach dem andern hervorziehen, um einen Stuhlsitz festzunageln. Für Benbow, der es selber heimlich probiert hatte, war das eine Leistung wie Feuerfressen oder Schwertschlucken.
«Darf ich mit dem Druckkasten spielen?» fragte er.
«Ja, aber schmier dich nicht ein», sagte Opa. Taffy Evans, dachte er. Ich freß ’n Besen, wenn das nicht Taffy Evans war!
Nach einer Weile meldete sich Benbow kleinlaut: «Du, Opa?»
«Ja, was ist?»
«Jetzt hab ich mich doch eingeschmiert.»
«Dann geh zu deiner Mutter», sagte Opa. Wäre die Arbeitsteilung nicht schon erfunden worden, hätte Opa das besorgt.
Benbow ging zu seiner Mutter hinüber und baute sich vor ihr auf. Schweigend – er war sparsam mit Worten. Er blickte nur an sich hinunter.
Nell folgte dem Blick. Auch sie sagte nichts. Bisher war alles glattgegangen heute morgen. Sie hatte den Tisch abgeräumt, Oma frisch gebettet, das Tablett hinuntergebracht und das Geschirr abgewaschen. Dann hatte sie die schmutzige Wäsche der Familie eingesammelt, und jetzt machte sie sich daran, sie vorzuwaschen und zu kochen, zu spülen, zu stärken und später dann zu mangeln und zu bügeln. Außerdem mußte sie das Essen kochen. Aber das ging heute schnell, obwohl Schwiegervater etwas von geschmorten Zwiebeln gesagt hatte, die er gern zum kalten Hammelfleisch essen würde.
Und nun das hier. «Oh, Benbow», seufzte sie vorwurfsvoll, «das ist ja schrecklich. Du weißt doch –»
Zu Benbows großer Erleichterung klingelte es an der Tür. Es war Großtante Min. «Tag, Nell. Ich hab eben Will drüben im Laden guten Tag gesagt. Er hat es mir erzählt – das mit Taffy Evans.»
«Ich wollte Opa gerade eine Tasse Tee rüberbringen», sagte Nell mit ruhiger Stimme. «Setz dich doch, ich mach dir auch eine.»
«Danke. Man stelle sich das vor! Hält einfach die Bahn an! Und dann noch diese Küsserei! Weißt du, wo der Kerl hingehört? In den Schützengraben!» Sie saß kerzengrade auf dem Stuhl und genoß ihre Entrüstung. «Ich möchte bloß wissen, wer das Mädchen war.»
«Wir wissen ja gar nicht, ob es überhaupt Taffy Evans war. Vielleicht hat Benbow die ganze Geschichte nur geträumt.»
Benbow war tief gekränkt. Er wußte sehr wohl, ob eine Straßenbahn angehalten hatte oder nicht.
Nell trat ans Küchenbord und nahm einen Becher herunter. Er war mit dem Union Jack und der Trikolore bemalt, und darunter stand «1915 – Gott erhalte unsere tapferen Jungen». Sie füllte den Becher mit starkem dunkelbraunem Tee, tat vier Sacharintabletten hinein, stellte den Löffel in den Becher und ging hinüber in den Laden.
Benbow sah seine Großtante an. «Wie geht’s Mr. Bates?» fragte er höflich.
«Er macht’s nicht mehr lange, Kleiner. Kein Wunder – er ist alt, und sie haben ihm fast alle Innereien rausgenommen.» Sie trank nachdenklich einen Schluck Tee. «Mich wundert’s, daß er’s immer noch macht.»
Benbow stellte sich Mr. Bates vor – grau und alt und ausgehöhlt. Und er starrte seine Großtante an.
Sie hatte kratzige Bartstoppeln und schiefe gelbe Zähne, mit vielen Lücken dazwischen, und man konnte sich gut vorstellen, wie sie nach ein oder zwei Wochen im Sarg aussehen würde. Ihr rötliches Haar lag schütter und dünn über ihrem grindigen Schädel. Benbow mochte sie, weil sie so viele Geschichten wußte, Gruselgeschichten, wie er sie liebte, Geschichten, in denen Blut floß und die böse endeten, wahre Geschichten …
Geräuschvoll schlürfte sie den Tee durch ihre Zahnlücken. Dann beugte sie sich mit einem listigen Lächeln vor und sagte leise: «Ich wette, du hast die Straßenbahn gar nicht halten sehen. Du hast dir das alles bloß ausgedacht!»
«Nein, hab ich nicht.»
«Du weißt bestimmt nicht einmal, wie der Schaffner aussah.»
Es war Benbow noch nie in den Sinn gekommen, daß ein Straßenbahnschaffner anders aussehen konnte als eben ein Straßenbahnschaffner. Er schwieg.
Ohne ihn aus den Augen zu lassen, schlürfte Großtante Min einen weiteren Schluck Tee. Dann sagte sie betont beiläufig: «Und wie die Dame aussah, weißt du bestimmt auch nicht.»
«Doch!» erwiderte Benbow heftig.
«Wie denn?» zischte sie. «Wie denn?»
Aber Benbows Herz ging zuweilen seltsame Wege, und jetzt bockte er plötzlich. Er starrte angestrengt auf einen Stuhl und machte sich an der Lehne zu schaffen. Dann wechselte er listig das Thema: «Was die wohl mit Mr. Bates’ Innereien gemacht haben.»
«Na, sicher haben sie alles in eine Flasche gefüllt und ein Etikett draufgeklebt. Sah die Dame so aus wie ich?» fragte sie kichernd.
«Nein, gar nicht.» Er schüttelte den Kopf. «Warum tun sie so etwas?»
Oh, dieser Teufelsbraten! «Na, falls sie mal zu viel rausgenommen haben, damit sie es ihm zurückgeben können. Willst du einen Bonbon?»
«O ja, bitte.»
Großtante Min langte in ihre Handtasche und zog mit der großen Geste eines Zauberkünstlers einen in Papier gehüllten Toffee heraus, den sie ihm vor die Nase hielt. «Denk mal nach, mein Schatz. Sah sie vielleicht so aus wie – wie deine Mam?»
Doch in diesem Augenblick kam seine Mutter wieder in die Küche. In Großtante Mins Augen flammte eine Sekunde lang Wut auf. Sie wollte den kostbaren Toffee wieder einstecken, aber es war zu spät. Nell, überrascht und erfreut ob der ungewohnten Großmut, sagte: «Sag danke, Benbow.»
«Danke.» Benbow wickelte den Toffee sofort aus und ließ ihn in seinem Mund verschwinden. Diesmal hatte Tante Min den kürzeren gezogen. Sie trank ihren Tee aus und verschwand.
Nell begann, die Druckerschwärze aus Benbows Sachen herauszuwaschen. «Was wollte sie denn wissen, mein Herz?» fragte sie, während sie rieb und scheuerte.
«Ach, wegen der Bahn. Und wie die Dame aussah, die den Schaffner geküßt hat.»
Nell rieb noch heftiger. «Und was hast du gesagt?»
«Gar nichts», sagte er gleichgültig, und dann erzählte er ihr aufgeregt: «Sie hat gesagt, sie haben Mr. Bates’ Innereien in eine Flasche getan und –»
Sie schloß einen Augenblick die Augen und preßte seinen Kopf an ihre Brust. Geier, dachte sie. Lauter Geier – Tante Min, Edith, Oma, Opa. Lauter lauernde schwarze Geier, die darauf warteten, über ihr Opfer herzufallen und es zu zerfleischen.
Taffy Evans war kein Ungeheuer. Aber er hatte zwei Fehler, für die es in den Augen der Leute von Ingerby keine Entschuldigung gab: er war Waliser, und er hatte Plattfüße.
Ein Waliser war für die meisten schon beinahe ein Ausländer. Deshalb war Taffy ihnen von Anfang an verdächtig. Sie trauten ihm alles zu. Sie hielten ihn für einen Wüstling, für einen Spion im Sold der Deutschen. Bei der Army hatte man ihn wegen seiner Plattfüße für kriegsuntauglich erklärt, und er hatte falsch darauf reagiert. Von einem Mann, dem so etwas widerfuhr, wurde erwartet, daß er sich auf dem Marktplatz heulend die Haare raufte und den Tag seiner Geburt verfluchte vor Wut und Verzweiflung darüber, daß er ‹nicht ins Feld durfte und den Hunnen eins auswischen konnte›. Statt dessen hatte Taffy Evans, der Dummkopf, über das ganze Gesicht gegrinst und gesagt: «Oh, fein! Ich hab noch nie Blut sehen können, vor allem nicht mein eigenes.» Und dann hatte er eine Stellung bei der Straßenbahn angenommen – auch wieder ein Fehler, denn wenn einer schon zum Kämpfen zu schwach war, dann ging er gefälligst in eine Munitionsfabrik und sorgte dafür, daß den Männern draußen an der Front die Kugeln nicht ausgingen. So war es nur natürlich, daß die Leute von Ingerby ihm alles in die Schuhe schoben, eine unerwünschte Schwangerschaft ebenso wie die Explosion in der Munitionsfabrik.
Den Dormans, die um Tom trauerten, war schon sein Name verhaßt. Er lebte, während Tom gefallen war. Sie wünschten ihm nichts Gutes, Großtante Min, die sich in Krankheit und Leiden auskannte, sprach für sie alle, als sie einmal sagte: «Wenn ihm seine Plattfüße doch wenigstens weh täten.»
Aber Nell hatte immer etwas übrig gehabt für den lustigen Taffy. Sie hätte es nicht in Worte fassen können, aber sie spürte, daß seine Keckheit, das, was die anderen an ihm so reizte, nur ein Deckmantel war für die Ängste eines schwachen Menschen in einer fremden, ja feindlichen Umgebung.
Ja, sie hatte immer etwas übrig gehabt für ihn. Wenn andere ihn heruntermachten, blieb sie stumm. Und wenn sie an ihn dachte, fiel ihr immer das Bank Holiday-Wochenende im August ein, das nun eine Ewigkeit zurücklag. Benbow war damals noch nicht geboren, und Tom war noch am Leben, und aus Wales war ihre Cousine Vanwy zu Besuch gekommen. Sie hatten den Wagen genommen und waren aufs Land hinausgefahren, zu einem richtigen Picknick. Die blonde, stämmige Nell sah immer ein bißchen so aus, als käme sie gerade aus der Backstube; aber Vanwy sah immer wie ein Gemälde aus mit ihrem rabenschwarzen Haar, ihren rosigen Wangen und ihren großen dunklen Augen. Nell konnte man leicht vom Gesicht ablesen, was sie dachte oder fühlte. Was in Vanwy vorging, konnte niemand sagen.
Damit die Cousine Gesellschaft hatte, hatten sie auch noch Taffy, Toms Schwester Alice und ihren Verlobten Frank Hardy mitgenommen.
Es war ein trockener Sommer gewesen, die Felder waren ausgedorrt und verbrannt. Sengende Hitze lag über dem Land. Die Kühe standen in der Flußniederung und peitschten mit den Schwänzen. Die Pferde wieherten leise und hielten die Nüstern an die rauhe Borke der Bäume. Ein schmaler Pfad führte am Flußufer entlang; dort hielten sie den Wagen an und trugen die Körbe mit dem Essen in den Schatten einer mächtigen Eiche. Tom schirrte das Pferd aus und hängte ihm den duftenden Futtersack um den Hals. Das Pferd stampfte und schnaubte zufrieden. Sie packten die belegten Brote aus und füllten die Becher mit Ingwerbier aus dem großen Steinkrug. Wortlos begannen sie zu essen und zu trinken. Ringsum herrschte tiefer Friede, und Friede war auch in ihnen. Für Nell war dies vielleicht der glücklichste Tag, seit sie in die Midlands gekommen war – aus dem lieblichen Wales ins harte Flachland.
Leise rauschte der Fluß. Sie sprachen wenig. Nell lag ausgestreckt im Gras, den Kopf auf der Brust ihres jungen Ehemanns, und lächelte ihm zu, und wenn er zurücklächelte, so erschien ihr sein Gesicht wie warmer Sonnenschein – wie die Liebe Gottes. Schatten spielten auf Vanwys rosigen Wangen und auf den blassen Städtergesichtern der anderen. Nell blickte zu Alice und Frank Hardy hinüber, die ruhig und ernst miteinander sprachen. Wie mochte es sein, dachte sie neidlos, wenn man so wie Alice war: groß, hübsch, klug und verlobt mit einem so vornehmen Mann wie Frank Hardy. Sie betrachtete auch ihre Cousine. Vanwy saß neben Taffy Evans, etwas entfernt von den anderen. Die beiden sprachen leise miteinander, und manchmal lachte Vanwy hell auf. Morgen muß sie wieder nach Merioneth zurück, dachte Nell. Morgen ist alles vorbei. Denn morgen war wieder Alltag, Arbeitstag. «Ich wünschte, es könnte immer so weitergehen», sagte sie zu Tom und fuhr ihm sanft mit einem langen Grashalm über das Gesicht.
«Ja, warum auch nicht?» erwiderte Taffy Evans. «Wir sind doch noch jung, und es wird noch viele andere Sommer geben, oder?»
Vanwy wandte den Kopf und sah ihn keck und herausfordernd an. «Für mich nicht. Jedenfalls nicht hier, in den häßlichen Midlands.»
Er machte eine Faust und hielt sie ihr lachend vor das Gesicht.
Und wieder herrschte schläfriges Schweigen. Man hörte nur das Summen der Bienen, das vorsichtige Flattern eines Wasservogels, das Schwirren der Mücken. Dann sagte Tom mit ruhiger Stimme: «Aber es wird nicht immer so weitergehen. Es wird nicht mehr lange so weitergehen.»
In seiner Stimme war etwas, was Nell erschauern ließ. Sie setzte sich auf und sah ihm in die Augen. Doch jetzt sprach Frank Hardy. «Tom hat recht», sagte er. «Die Menschen vertragen das Wohlleben nicht.»
Alice sah ihn erstaunt an. «Du bist verrückt, Frank Hardy.»
«Nein, das bin ich nicht», sagte er geduldig. «Denk nur mal an die Lage auf dem Balkan. Da kannst du sehen, wie es schon anfängt. Die Menschen sind des Friedens überdrüssig.»
Nell wußte nicht, was er mit der Lage auf dem Balkan meinte. Sie las nur selten Zeitung. «Du meinst, sie mögen es nicht, wenn das Leben so schön und friedlich ist wie heute?»
«Sie mögen es schon.» Ein wenig Ungeduld schwang jetzt in seiner Stimme mit. «Aber irgend etwas treibt sie dazu, es alles wegzuwerfen.»
«Die Politiker machen die Kriege», sagte Tom.
«Nein, alle Menschen», erwiderte Frank. «Auch wenn wir eigentlich ganz zufrieden sind, drängt uns irgend etwas, das Leid, das Unglück zu suchen.»
«Ach, Frank», sagte Alice schmollend, «muß das nun sein – an einem so schönen Tag?»
Krieg – das also meinten sie, dachte Nell. Und Taffy sprang auf, schulterte seinen Stock und spazierte vor den anderen auf und ab, wobei er so tat, als blase er Trompete. Vanwy bog sich vor Lachen und gab ihm einen Schlag in die Kniekehle, so daß er das Gleichgewicht verlor. Er fiel auf sie, und eine Weile lang balgten sie sich wie junge Hunde, bis sie sich plötzlich voneinander lösten und einander anstarrten, ernst und herausfordernd.
«Ich nehme an, wenn wir heute abend nach Hause kommen, haben wir Krieg mit Deutschland», sagte Frank Hardy.
Nell erschrak. Frank Hardy war einer der wenigen Männer, die nur redeten, wenn sie etwas zu sagen hatten. Deshalb hörte man auf ihn.
Die Sonne ging unter. Still begannen sie, die Sachen einzupacken. Tom machte das Pferd los und schirrte es an. Nell blickte zurück zu dem Platz, wo sie gelegen hatten. Bekümmert wandte sie sich ab. Tom kam zu ihr. Sie schob ihre Hand in die seine. «Komm, mein Mädchen», sagte er, und sie gingen zurück zum Wagen. Aber einen Augenblick lang kam es Nell so vor, als habe sie all ihr Glück, in einem Bündel verschnürt, dort auf dem Picknickplatz liegenlassen.
Der Wagen quietschte, das Pferd trabte mit klappernden Hufen durch den stillen Abend. Taffy sang ihnen ein neues Lied vor, das gerade große Mode war, wie er behauptete. Es war ein fröhliches Lied, aber zugleich klang es irgendwie traurig. «It’s a long way to Tipperary, it’s a long way to go.» Aber wie lang der Weg war, das wußte niemand von ihnen.
2
Seit Benbows Enthüllungen über den nächtlichen Halt der Straßenbahn war Taffy Evans Gesprächsthema Nummer 1 in der Familie Dorman. Und Großtante Min, die mehrmals vorbeikam, war unermüdlich auf der Suche nach Spuren, die zu der fraglichen Dame führten. Am Mittwoch befand Opa, Oma sei nun gekräftigt genug, um die Neuigkeit zu ertragen. Taffy Evans, eröffnete er ihr, poussiere nicht nur, sondern er tue das sogar in seiner Dienstzeit. «Eine halbe Stunde hat die Bahn vor unserem Haus angehalten, als die beiden –»
«Unerhört!» sagte Oma. Und sie preßte die Lippen noch fester zusammen. Ihr Kinn bebte. «Einfach unerhört! Und ein Schlag für unsere tapferen Jungen im Feld.»
«Jawohl. Und für jede anständige Engländerin», ereiferte sich Opa. «Aber keine Sorge, Mutter. Ich werde an die Straßenbahnverwaltung schreiben.»
«Aber – das kannst du doch nicht!» sagte Nell entsetzt.
Die Blicke der beiden Alten richteten sich auf sie wie Scheinwerferstrahlen auf einen Zeppelin. «Und ob ich das kann», sagte Opa kalt.
«Aber wir wissen das doch alles nur von Benbow. Und selbst wenn er es nicht geträumt hat – ihr wißt doch gar nicht, ob es wirklich Taffy … Mr. Evans war.»
«Es gibt nicht mehr viele Männer bei der Straßenbahn. Die meisten Schaffner sind heute Frauen. Außerdem –»
Benbow saß auf dem Fußboden und spielte mit seinen Bausteinen. Auf die endlosen Unterhaltungen der Erwachsenen achtete er nicht weiter, er hörte sie, wie ein Bauer das Rauschen des Baches hörte, der an seinem Haus vorbeifließt. Doch jetzt war er plötzlich hellwach. «Ich hab es nicht geträumt», sagte er tief gekränkt.
«Siehst du?» sagte Opa befriedigt.
«Und du willst wirklich einen Menschen unglücklich machen?» sagte Nell. «Bloß auf die Reden eines Kindes hin?»
«Wie sah die Dame denn aus, mein Schatz?» fragte Oma lächelnd und mit honigsüßer Stimme.
Nell wartete angespannt auf die Antwort. Sie bemühte sich, normal zu atmen und nicht rot zu werden. Aber Benbow hatte jetzt neun Bausteine aufeinander gestellt und versuchte gerade, einen zehnten obendrauf zu setzen – ein Unternehmen, das seine ganze Aufmerksamkeit beanspruchte. Er schwieg. Alle warteten. Oma wiederholte ihre Frage.
Der Turm schwankte ein wenig nach links, hielt sich, neigte sich nach rechts und fiel krachend in sich zusammen. «Verdammt!» rief Benbow laut und deutlich.
Taffy Evans war vergessen. Benbow hatte geflucht! Das würde Oma mindestens vier weitere Wochen bettlägerig machen. Wogen der Entrüstung und des Zorns schlugen über Benbow zusammen. Schließlich tupfte sich Oma die Augen und sagte: «Nie, nicht ein einziges Mal hab ich unsern guten Tom fluchen hören.» Dabei sah sie ihre Schwiegertochter anklagend an.
«Also, von mir hat er’s bestimmt nicht», verteidigte sich Nell.
«Hat ja auch niemand behauptet, Nell», sagte Opa. Dann blickte er Benbow streng an. «Von wem hast du das Wort, Junge?»
«Von Großtante Min», erklärte Benbow freimütig.
«Aha.» Opa nickte weise. Min. Also Omas Familie.
Oma mochte leidend sein, aber sie besaß die Fähigkeit der meisten Ehefrauen, eine aussichtslose Verteidigungsstellung flugs aufzugeben und sich schnurstracks in die Offensive zu begeben. «Na, ich weiß jedenfalls, was ich getan hätte, wenn unser Tom jemals solche Wörter in den Mund genommen hätte. Gleich rauf ins Bett, ohne Abendessen.»
«Und ich weiß auch, was sie meint, wenn sie immer ‹Scheibenhonig› sagt», verkündete Benbow stolz. «Sie meint Sch –»
Ein weiterer Schock blieb Oma erspart, denn eine kühle Stimme unterbrach Benbow und sagte: «Ihr könnt mir mal guten Tag sagen. Ich hab nämlich nur eine halbe Stunde Zeit.»
Alle blickten auf. Alice in ihrem langen Schwesternmantel stand in der Tür.
«Hallo, mein Mädchen, komm rein», rief Opa. «Nell, mach Alice eine Tasse Tee, schnell. Und ich trinke auch eine mit, wenn du schon dabei bist.»
Alice setzte sich und nickte ihrer Schwägerin zu, ohne Benbow zu beachten. Dann wandte sie sich ihrer Mutter zu. «Du siehst blaß aus, Ma.»
«Sie hat sich aufgeregt», sagte Opa.
«Aufgeregt – worüber?»
Mit zitternder Stimme flüsterte Oma: «Benbow hat geflucht!»
«Oh, ist das alles?» fragte Alice ungerührt und fuhr Benbow mit der Hand durch das blonde Haar. «Du wirst noch schlimmere Dinge sagen, bevor du mal stirbst, mein Junge.»
Es gab also noch Schlimmeres, dachte Benbow erstaunt. Aus der Aufregung der Erwachsenen hatte er geschlossen, er habe bereits die tiefsten Tiefen erreicht.
Alice zündete sich eine Zigarette an. Oma und Opa übersahen es geflissentlich. Rauchende Frauen waren eines der vielen Übel, die der Krieg mit sich brachte. Opa sagte: «Dieser Taffy Evans hat sich wieder ins Gerede gebracht.»
Alice lehnte sich müde auf ihrem Stuhl zurück. Sie hatte seit sechsunddreißig Stunden kein Auge zugetan. Gierig zog sie an ihrer Zigarette. Dann zwang sie sich zu fragen: «Ja – und?» Drüben im Lazarett waren die Säle überfüllt mit Verwundeten, und hier im Haus ‹Omdurman› lebte jeder sein kleines beschränktes Leben, als gäbe es keinen Krieg. «Ja, und?» fragte sie noch einmal müde.
Man erstattete Bericht. Sie war so wenig beeindruckt, daß Benbow entrüstet beteuerte: «Ich hab’s aber wirklich nicht geträumt, Tante Alice.»
«Aber woher denn, Kleiner. So was Dummes würdest du doch nie träumen, was?»
«Nein», sagte er erfreut. Es kam nicht oft vor, daß er in ihr eine Verbündete fand. Meistens schien sie ihn gar nicht zu sehen.
Nell kam jetzt mit dem Tee. Sie merkte, daß Alice sie musterte, und wie immer fühlte sie sich ihr unterlegen. Und das lag nicht nur daran, daß sie selber nett und lieb aussah und Alice eine regelrechte Schönheit war. Es war eher das Gefühl, daß Alice sich nicht weiter für sie interessierte, was bis zu einem gewissen Grad auch stimmte. Alice interessierte sich für niemanden, der nicht im Sterben lag oder blind oder verkrüppelt war. Nell fragte und ärgerte sich sogleich, weil ihre Stimme fast schmeichlerisch klang: «Hast du etwas von Frank gehört, Alice?»
Alice nickte und atmete den Rauch durch die Nase aus – eine Fähigkeit, um die Benbow sie glühend beneidete. Er hatte es einmal mit einem Mund voll Rauch vom Kaminfeuer versucht, und es war ihm schlecht bekommen. «Ja. Es geht ihm gut. Er meint, Weihnachten ist alles zu Ende. Ach ja, er läßt euch beide schön grüßen. Und dich auch, Nell.»
«Danke», sagte Nell, und sie errötete vor Freude darüber, daß Frank sich an sie erinnert hatte. Oma sagte: «Das war doch aber sicher nicht alles.»
«Was soll er sonst noch schreiben?» fragte Alice bissig. «‹Gestern war ich zum Entlausen›? Oder: ‹Ich bring den Ratten neue Lieder bei›?» Benbow fand das so komisch, daß er sich vor Lachen auf dem Boden wälzte. Aber Oma sank in ihrem Sessel zusammen. «Da hast du es», sagte Opa vorwurfsvoll zu Alice. «Jetzt hast du sie aufgeregt.»
«Hier, dein Tee.» Nell brachte ihr die Tasse.
Alice trank hastig. «Mein Gott, so spät ist es schon? Ich muß schleunigst gehen. Wiedersehen, Dad. Wiedersehen, Ma. Ach ja, ist es euch recht, wenn ich Walter am Sonntag mitbringe?»
Oma und Opa sahen einander an, und Oma sagte: «Findest du es denn richtig, Alice? Wo Frank doch im Felde ist?»
Alice erhob sich schnell, knöpfte ihren Mantel zu und erwiderte: «Das Leben geht weiter, Ma, auch wenn Frank im Felde ist.»
«Oh, ich weiß nicht», sagte Oma und wandte sich hilfesuchend an ihren Mann. «Sag du ihr doch, daß es nicht recht ist, Dad.»
Opa zauderte. Als Ehrenmann hätte er vielleicht einem Zivilisten, der mit der Braut eines Soldaten ausging, das Haus verbieten müssen. Aber hier war mehr als Ehre im Spiel, nämlich hin und wieder ein Pfund Wurst oder ein Stück Schinken, das Walter, der Schlachter, Opa zusteckte. Es waren hungrige Zeiten. «Alice tut gewiß nichts Unrechtes», murmelte er.
Nell war froh. Der Gedanke, daß Frank an sie gedacht und ihr Grüße gesandt hatte, wärmte ihr das Herz. Sie hatte niemals einen Mann wie ihn getroffen, er war anders als alle anderen Menschen, die sie kannte. Groß und schlank, das Gesicht von tiefen Furchen durchzogen, mit großen traurigen Augen und leicht angegrautem Haar – mehr wie ein Filmheld als jemand, den man wirklich kannte.
Vor allem aber imponierte ihr sein Geist – er wußte und verstand einfach alles. Und trotzdem kam man sich bei ihm niemals klein und häßlich vor. Immer war er ernst, höflich und ruhig. Er behandelte einen wie eine Lady.
Fast so sehr wie Frank bewunderte sie Alice. Beide, fand sie, waren ihr in jeder Beziehung weit überlegen. Um so unbegreiflicher schien es ihr, daß Alice sich mit einem Mann wie Walter abgab. Es beunruhigte sie geradezu. Sie nahm an, daß sie zu wenig von der Welt wußte, um solche Dinge zu verstehen. Deshalb tröstete es sie, daß ein redlicher Mann wie Opa der Ansicht war, es sei nichts Unrechtes dabei.
Opa saß in dem stickigen kleinen Büro hinter dem Laden. Er nahm den Korken aus der Tintenflasche, zupfte ein Haar aus der Feder im Federhalter, stieß die Feder in die Tinte und begann zu schreiben. Er ging mit der Feder so um wie mit dem Meißel. Seine Schrift war groß und kräftig, aber ungleichmäßig. Immerhin, es gelang ihm klarzumachen, was er mitteilen wollte. So klar, daß am nächsten Abend der Inspektor im Straßenbahndepot sagte: «Evans – Sie sollen zum Chef kommen.»
Samstag abend. Nell saß in der Küche am Feuer, über sich die zischende Gaslampe, vor sich eine Tasse Tee, und las Kipps.
Sie war so glücklich, wie sie es jetzt noch sein konnte. Benbow war im Bett und träumte – der Himmel mochte wissen, wovon, dachte sie mit plötzlichem Lächeln. Oma war versorgt, und Opa hatte sich auch endlich erhoben und war nach oben gegangen – ungern, denn das Recht, als letzter aufzubleiben, kam eigentlich ihm zu. Aber der Krieg änderte vieles. Man war nicht mehr Herr im eigenen Haus. Er hatte eine Weile herumgedruckst und schließlich gesagt: «Na, dann will ich auch mal raufgehen.»
«Recht hast du», hatte sie munter erwidert.
Grunzen. Ein letzter besorgter Blick im Zimmer umher. «Vergiß nicht das Licht.»
«Nein.»
Er ging mit schlurfenden Schritten zur Tür. «Alice hat es einmal die ganze Nacht brennen lassen.»
«Wirklich?» Es sollte erstaunt klingen, aber das war nicht ganz leicht, denn die Sache mit Alice und dem vergessenen Licht gehörte ebenso zu den Familiengeschichten wie Omas Wespenstich und Toms gebrochene Nase.
Mißgestimmt ging er hinaus. Sie hörte ihn mit schweren Schritten langsam die knarrende Treppe hinaufsteigen und dachte plötzlich mitleidig: Der arme Alte – um hundertachtzig Pfund zwölf Fuß hoch zu heben, braucht man einen Flaschenzug, und er macht das bestimmt viermal am Tag. Immer wenn er aufs Klo muß oder ins Bett geht. Viele hundertmal im Jahr, der arme Teufel.
Oma und Opa. Alice, Edith. Tom hatte sie hierhergebracht, zu diesen fremden Menschen, und hatte sie einfach dagelassen wie ein Stück Treibholz, das die Flut zurückläßt. Ein Haus voller Fremder. O ja, sicher, sie waren nett zu ihr. Nur Edith mocht sie nicht, aber sie zeigte es nicht offen. Ab und zu ein paar kleine Nadelstiche, verwunderte Blicke – aber auch das tat weh. Mit Oma ging es meistens. Und Opa: «Nell, du bist hier zu Hause. Hier ist immer ein Zuhause für Toms Frau.» Nicht für sie selber also. Für Toms Frau. Aber das war verständlich, denn sie war immer noch eine Fremde – fremd und verängstigt.
Was hatte sie also? Ein Dach über dem Kopf, genug zu essen und Gesellschaft. Nicht die Gesellschaft, die sie sich wünschte, aber sie war nicht allein. Und das war mehr, als Millionen anderer Menschen in dieser dunklen hungrigen Welt von 1918 von sich sagen konnten. Sie hatte Erinnerungen, die viele andere Mädchen dieser männerarmen Generation vielleicht nie haben würden. Sie hatte Benbow, ihren eigenwilligen unzugänglichen kleinen Jungen. Benbow war Toms Fleisch und Blut, und wenn er manchmal plötzlich strahlend lächelte, dann ging für sie die Sonne auf. («Wie seid ihr eigentlich auf den Namen Benbow gekommen?» hatte Edith einmal streng gefragt, und Nell hatte unsicher geantwortet: «Benbow war ein Admiral – jedenfalls gab es in einem Buch, das wir gelesen haben, ein Lokal Admiral Benbow.» Sie fühlte Ediths Blick, kalt und verächtlich. «Tom wollte es gern», hatte sie hastig hinzugefügt. «Er mochte das Meer so gern.» Tom, der das Meer nur vom Strand von Skegness kannte und das bißchen Wasser, das er von seinem Truppentransporter aus gesehen hatte, im Kanal. «Sie haben den Jungen nach einem Lokal in einem Buch genannt», hatte Edith später erzählt. «Als ich sie fragte, sagte sie, Tom wollte es. Landpomeranze aus Wales.» Edith war Lehrerin und wußte natürlich alles.)
Edith. Morgen abend kam sie. Morgen abend kamen alle, morgen war Sonntag. Der alte Mann in seinem guten Anzug – ausnahmsweise roch er nicht nach Leim und Holz – sagte dann: «Nun, Edith, wie wär’s mit ein bißchen Musik? Und wenn wir ein paar Lieder gesungen haben, kommst du dran, Albert.» Oma, von Kissen gestützt, ließ ihre Blicke über das Liederbuch wandern und genoß den Sonntagabend, denn an diesem Tag ruhten ihre Unpäßlichkeiten. Großtante Min saß neben ihr. Sie hörte und sah alles und merkte es sich, um es später mit eigenen Zutaten weiterzugeben. Edith, streng und schmallippig, kam manchmal ohne ihren Ehemann Albert, immer dann nämlich, wenn er Nachtdienst hatte. Auch Großtante Mabel war da; ihren kleinen Bauernhof hatte sie in der Obhut des deutschen Kriegsgefangenen Siegfried gelassen, der ihr mit dem Vieh half und ihr – wollte man Tante Min glauben – auch die Einsamkeit der Nächte erträglicher machte. Benbow saß auf dem Fußboden und spielte, er hörte ihr endloses Reden, verstand wenig und sagte nichts.
Das Leben war erträglich für Nell – ganz erträglich. Aber die Sonntagabende in diesem Haus, die fremden Menschen, ihr lebhaftes Gerede und manchmal Streiten … und dann die Erinnerung an die Abende am Harmonium, nach dem Gottesdienst, an Cwm Rhondda, Aberystwyth, an die Chormusik und die wunderschönen Waliser Stimmen … die Sonntagabende waren blanke Verzweiflung.
Doch noch war Samstag und sie war allein und hatte die Füße hochgelegt und ein Buch vor sich.
Ein leises Klopfen am Fenster. Sie horchte. Noch einmal. Erschrocken legte sie das Buch weg.
Die Verdunkelungsvorschriften waren streng, denn die Behörden waren der Ansicht, daß ein hochgeschobenes Verdunkelungsrouleau die gesamte deutsche Luftflotte anziehen würde wie das Licht die Motte. Deshalb ging Nell auf den Flur, tastete sich an der Wand entlang zur Haustür und machte sie vorsichtig auf. In der Dunkelheit konnte sie nicht gleich etwas sehen. Eine Stimme flüsterte: «Bist du das, Nell?»
«Wer ist da?» flüsterte sie zurück.
«Taffy. Kann ich rein?»
«Taffy! Das geht doch nicht! Na, komm schon. Hier, nimm meine Hand.»
Sie hatte Angst, aber sie fühlte sich freudig erregt und irgendwie zufrieden, als er ihre Hand ergriff und sie ihn durch den dunklen Flur in die helle warme Küche führte. Er kniff die Augen zusammen und lachte unsicher.
«Du kannst nicht bleiben», sagte sie. «Das ist nicht recht. Nicht hier, in ihrem Haus.»
Er breitete die Arme aus und sagte bittend: «Komm doch her, Liebes. Komm und gib mir ’n Kuß.»
Aber sie blieb stehen. «Nein, Taffy, das geht nicht. Du hättest nicht kommen dürfen.» Und dabei sehnte sie sich genauso wie er nach ein wenig Liebe und Zärtlichkeit.
Er ließ die Arme sinken und stand verloren vor ihr. «Ich hab meine Stellung verloren, Nell. Irgendwer hat uns neulich gesehen – neulich abends, du weißt. Hat mich angezeigt.»
«Nein!»
«Ich möcht wissen, wer das war.» Er sah, wie sie erschrak, und versuchte wieder, sie in die Arme zu nehmen.
Ein Geräusch an der Tür. Dann sagte eine müde Stimme: «O Gott.»
«Alice!»
Sie kam in die Küche und ließ sich, ohne von den beiden Notiz zu nehmen, auf einen Stuhl fallen.
«Taffy kam gerade vorbei», sagte Nell hastig.
Alice sah sie gereizt an. «Ist mir doch völlig egal. Behalt es für dich. Versteh doch! Es ist mir egal, ob du mit ihm schläfst oder ob ihr einen Mord plant. Ich will es nicht wissen – ich will gar nichts wissen. Ich habe nur zehn Minuten Zeit und möchte Ruhe haben. Ruhe.»
Nell machte Taffy ein Zeichen und sie gingen auf Zehenspitzen zur Haustür. Er nahm ihr Gesicht zwischen seine Hände. «Wann kann ich dich wiedersehen?»
«Es geht nicht, Taffy. Im Augenblick nicht. Sonst gibt es Krach.»
«Meinst du, sie wird was sagen?»
«Alice? Ich weiß nicht. Sie ist ganz in Ordnung. Aber sie ist Toms Schwester.»
«Tom ist doch tot», flüsterte er mit plötzlicher Bitterkeit. Es war die Bitterkeit eines Liebenden, dessen Rivale durch seinen Tod unbezwingbar geworden war.
Sie schob ihn nach draußen und schloß die Tür. Dann ging sie in die Küche zurück. Alice saß zusammengesunken im Sessel, die Arme hingen wie tot über die Lehnen. Sie öffnete die Augen und starrte Nell an. «Warte, ich mach dir eine Tasse Tee», sagte Nell.
Sie stellte den Kessel auf das Herdfeuer, und er begann sofort zu singen, dann wärmte sie die Kanne und gab den Tee hinein.
Alice starrte sie immer noch an. «Stille Wasser sind tief», sagte sie, und es klang eher bewundernd als zurechtweisend.
Nell nahm den Becher mit der Aufschrift «Gott erhalte unsere Jungen». «Nein, bloß den nicht», sagte Alice. «Wenn er wirklich unsere Jungen erhält, tut er das auf seltsame Art.»
«Sieht wohl schlimm aus im Lazarett?» fragte Nell teilnahmsvoll.
«Ja.» Alice starrte sie immer noch an. «Von mir wird niemand etwas erfahren, hörst du.»
«Danke, Alice», sagte Nell steif.
«Sag bloß nicht immer ‹Danke›! Es ist mir einfach nicht wichtig genug», sagte sie gleichgültig. Sie trank ihren Tee und erhob sich dann mit steifen Beinen. «Ich werd unsern Helden sagen, daß du nach ihnen gefragt hast. Wiedersehn.» Und draußen war sie.
3
An diesem Oktober-Wochenende wurden die Uhren zurückgestellt. Alle atmeten erleichtert auf; die neumodische Sommerzeit war nicht beliebt, sie war gegen die Natur und gegen das göttliche Gesetz. Sie brachte das Wetter durcheinander und Opas Appetit und Omas Verdauung. Und außerdem war sie eine Erfindung der Deutschen …
Aber jetzt hatte man Gott sei Dank wieder die richtige Zeit, die englische. Die Gaslampen wurden angezündet, die dunkelblaue Verdunkelung heruntergezogen; hinter dem Messinggitter tanzten die Flammen im Kamin, und die schwarze Marmoruhr schlug gewichtig die Viertelstunden – alles war, wie es sich für einen gemütlichen Sonntagabend gehörte.
Benbow lag vor dem Kamin und ließ sich rösten. Er war dabei, ein Bild von Kaiser Wilhelm II. zu zeichnen; die Schnurrbartenden waren einen Fuß lang, aber der Helm mit dem Spieker wollte ihm nicht recht gelingen. Benbow ließ jedoch nicht locker. Er gab nicht leicht auf.
Die Unterhaltung war stockend, denn die Damen waren in der Küche beim Geschirrspülen, und nur Oma, Opa und Onkel Albert, im blauen Sergeanzug mit pompöser Uhrkette, hielten die Konversation aufrecht. Auf dem Sofa hatte sich Crystal, Ediths und Alberts einziges Kind, in eine Ecke gefläzt; sie streckte die Beine von sich und warf ab und zu geringschätzige Blicke auf Benbows künstlerische Versuche.