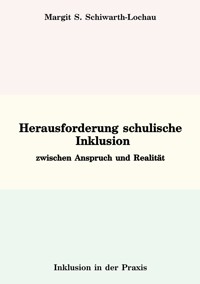Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jeder, auch das Mädchen Isabella, ist Glied in einer Kette von Generationen, verbunden und verknüpft durch weitergegebene, oft unbewusste familienbezogene Vermächtnisse. Eine sogenannte transgenerative oder transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen kann sich auf nachfolgende Generationen auswirken. Unfassbare Erlebnisse rufen bei den Betroffenen Sprachlosigkeit darüber hervor und können innerlich nicht verarbeitet werden. Sie bleiben für immer gegenwärtig, zeigen sich im Verhalten und werden unbewusst auf die eigenen Kinder übertragen. Emotionale Vernachlässigung, Verwahrlosung und Missbrauch im frühen Kindesalter sind Risikofaktoren für die Persönlichkeitsentwicklung sowie für spätere gesundheitliche und psychische Probleme. Die kleine Isabella erlebte in ihrer Herkunftsfamilie unfassbar Schreckliches. Im 2. Lebensjahr wurde sie das erste Mal in Obhut genommen, mit zweieinhalb Jahren kam sie in eine Pflegefamilie. Das Pflegeverhältnis scheiterte, als Isabella 14 Jahre alt war, da die zunehmenden Probleme im Sozialverhalten des Mädchens die Familie überforderte. Heute würde man Jungen und Mädchen mit gravierenden sozial-emotionalen Störungen als "Systemsprenger" bezeichnen. Wie sollte es mit Isabella nach der Herausnahme aus ihrer Pflegefamilie weitergehen? Für welche Hilfeform würde sich das Jugendamt entscheiden? Es gab zwei Möglichkeiten: Heimeinweisung oder die Betreuung in einer sozialpädagogischen Bereitschaftspflege. Familie Stein nahm Isabella auf. Die neuen Pflegeeltern waren bereit, die schwierige Aufgabe, dem traumatisierten jungen Mädchen positive Erfahrungen und Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit anderen Menschen mit auf den Weg zu geben, anzunehmen. Würde eine Psychotherapie zur Verhaltensänderung führen? Der Roman "Bella Isabella - Umbrüche im Leben eines Pflegekindes" widmet sich einfühlsam dem Kinderschicksal und den Herausforderungen, die im Elternhaus und in der Schule zu bewältigen waren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Rückblick
Begegnung mit Isabella
Agnes und Peter
Renate und Anita
Anita und Peter
Familie in Not
Neues von Isabella
Isabella bei uns zu Hause
Die ersten sechs Wochen
Familienurlaub
Nach dem Urlaub
Vorstellung und Anamnese in der KJP
Im Wechselbad der Gefühle
Nach den Sommerferien
Die Welt dreht sich um Isabella
Lügengeschichten und Schulstress
Kampf um die Kinder
Weitere Herausforderungen
Oktoberferien
Unterschiedliche Beurteilungen und Schlussfolgerungen
Nach den Oktoberferien bis zum Jahresende
Im neuen Jahr
Inneres Kind - Schattenkind
Vor Aufnahme in der KJP
Therapiebeginn
Uwe auf den Spuren der Herkunftsfamilien
Ende der Bereitschaftspflege
Jahre später
Autorenvita
Anmerkung der Autorin
Traumapsychologische Hintergründe und traumabedingte Stressreaktionen bei Kindern mit PTBS
Danksagung
Rückblick
Begegnung mit Isabella
Oh, schon 9.50 Uhr! Ich muss gleich los zum Bus, doch das Telefon klingelt. Schaffe ich es noch ranzugehen? Na, wird sicher nicht länger als fünf Minuten dauern. Am anderen Ende der Telefonleitung ist Frau Braunkohl vom Jugendamt: „Hallo, guten Tag Frau Ziegel-Stein, haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich?“ „Ich grüße Sie, Frau Braunkohl, eigentlich bin ich auf dem Sprung, 10.07 Uhr fährt mein Bus. Worum geht es denn?“ „Können Sie uns helfen? Wir brauchen dringend eine Bereitschaftspflege für ein vierzehnjähriges Mädchen! Es sitzt schon bei uns! Die bisherige Pflegemutter hat es hergebracht.“ „Oh je, dann werde ich erst zu Ihnen ins Amt kommen und danach meine Behördenwege erledigen. Bis bald, ich muss los!“ „Danke.“
So begann damals, vor 15 Jahren, die Geschichte mit Isabella, meiner Pflegetochter auf Zeit. Unweigerlich musste ich an die bewegenden Erlebnisse mit ihr denken, nachdem ich über die Tageszeitung und das Fernsehen erfahren hatte, dass händeringend Pflegeeltern gesucht wurden und im Jahr 2018 bundesweit 40400 Kinder durch die Jugendämter in Obhut genommen und in Heimen untergebracht werden mussten.
„Wie es Isabella wohl jetzt geht?“, fragte ich mich. Sie hatte mehrfach ihren Wohnort gewechselt. Der Kontakt war abgebrochen.
Isabella war neunzehn Jahre alt, als wir uns nach längerer Zeit zufällig in der Stadt trafen. „Hallo, Margret“, sprach mich eine junge Frau mit fuchsrot gefärbten Haaren an. Sie blieb mit einem Kinderwagen neben mir stehen. Erstaunt sah ich sie an: „Isabella! Schön dich zu sehen. Geht es dir gut?“ Wir umarmten uns. „Machst du Babysitter oder ist das etwa …?“ „Darf ich vorstellen, das ist Johnny, mein Sohn, sechs Monate alt“, klärte sie mich auf. „Oh, herzlichen Glückwunsch! Und, steht der Papa des Kleinen zu euch?“ „Nee, mit dem Vogel habe ich noch vor Johnnys Geburt Schluss gemacht. Der war mehr besoffen als nüchtern und es gab nur Zank und Streit. Und außerdem ist der ein ganz perverses Schwein. Bei so was sehe ich rot!“, ereiferte sich Isabella. „Das kann ich mir gut vorstellen. Wie kommst du zurecht?“, wollte ich wissen. „Och, ganz gut. Wir sind noch in einer Mutter-Kind-Einrichtung. Wenn ich eine Wohnung habe, ziehe ich dort aus. Ja, und wenn Johnny in die Kita kann, will ich eine Ausbildung anfangen“, gab Isabella bereitwillig Auskunft. „Da drücke ich dir die Daumen, dass alles gelingt, was du dir vorgenommen hast. Wir müssen aber nicht hier auf der Straße stehenbleiben. Ich würde dich gern in ein Cafe´ einladen“, bot ich an. „Habe leider keine Zeit, treffe mich gleich mit meinem neuen Freund. Das ist ein ganz Lieber. Ich rufe dich an! Grüße Hartwig von mir!“ Und schon eilte sie mit ihrem Kind davon.
Wieder zu Hause angekommen, kreisten meine Gedanken um unser ehemaliges Pflegekind. Hoffentlich holen Isabella die Schatten ihrer frühen Kindheit nicht ein, dachte ich, sodass sie vor ähnlichen Problemen steht, wie damals ihre leiblichen Eltern und Großeltern. Denn jeder ist Glied in einer Kette von Generationen, verbunden und verknüpft durch weitergegebene, oft unbewusste familienspezifische Vermächtnisse. Erst nachdem ich einiges über das schwere Schicksal ihrer Herkunftsfamilien erfahren hatte, konnte ich mir das oftmals verstörend wirkende Verhalten des Mädchens erklären.
Inzwischen weiß ich, dass es eine sogenannte transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen gibt, welche sich auf nachfolgende Generationen auswirken kann. Stark prägende und für die Betroffenen unfassbare Ereignisse oder Erlebnisse rufen Sprachlosigkeit darüber hervor, können innerlich nicht verarbeitet werden. So bleiben sie für immer gegenwärtig und werden unbewusst auf die eigenen Kinder übertragen. Ob auch Isabella in einem solchen Teufelskreis gefangen ist?
Agnes und Peter
Ende 1944 erreichte der 2. Weltkrieg die Ostgrenze Deutschlands. Im Januar 1945 begann die Rote Armee eine Großoffensive gegen die deutsche Wehrmacht. In nur wenigen Wochen stieß die Sowjetarmee kämpfend bis zur Oder vor, nur noch achtzig Kilometer von der Reichshauptstadt Berlin entfernt. Der Krieg war für Deutschland militärisch faktisch schon verloren. Eine Kapitulation kam für Hitler nicht in Frage. Er befahl der Wehrmachtsführung bis zum Ende zu kämpfen. Sie schickten als letztes Aufgebot Jugendliche, Alte und Invaliden in das Gefecht gegen die übermächtigen Armeen der Alliierten, was weiterhin viele sinnlose Opfer und unermessliches Leid für die Bevölkerung brachte.
„Die Russen kommen!“ Dieser Ausruf erzeugte panische Angst und Schrecken. Millionen Menschen aus den östlichen Gebieten Deutschlands, wie z. B. Oberschlesien, flüchteten aus ihrer Heimat in Richtung Westen. Davon war auch die Familie meines Vaters betroffen.
Die sechzehnjährige Agnes und ihre Mutter Olga schlossen sich, nur mit dem Nötigsten bepackt und was sie tragen konnten, einem Flüchtlingstreck an. Der Winter 1944/45 war durch extremen Frost und starke Schneefälle besonders hart. Tausende überlebten die Gewaltmärsche nicht. Agnes und Olga mussten schreckliche Dinge erleben und mit ansehen: Mütter mit ihren Säuglingen im Arm am Wegesrand, völlig erschöpft oder gar erfroren, verstümmelte Leichen, Kriegsverletzte, Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen. Hunger und Elend begleiteten die verzweifelten Menschen auf der wochenlangen Flucht. In den Dörfern und vom Krieg gezeichneten Städten, durch die sie zogen, waren die frierenden und ausgemergelten Flüchtlinge nicht gern gesehen. Auch die ansässigen Menschen hatten nichts mehr zu verteilen und litten größte Not.
Olga und Agnes kamen kurz vor Kriegsende bei einem Großbauern, mit Namen Erdmann, als billige Arbeitskräfte unter. Sie bewohnten eine nicht beheizbare, im ehemaligen Pferdestall notdürftig hergerichtete Kammer. Beide schufteten täglich zwölf Stunden auf dem Bauernhof und bekamen als Lohn etwas Essen und Trinken sowie ein geringes Taschengeld.
Als der schreckliche Krieg endlich beendet war, bestimmte die Angst vor den Besatzern, der Kampf um Unterkunft, Lebensmittel und Bekleidung das Leben der Menschen. Zehntausende Flüchtlinge, verschleppte Zwangsarbeiter, Waisen und Witwen irrten zu Fuß durch das Land. Sie machten kurzzeitig Halt in notdürftigen Zwischenlagern unter unsäglichen hygienischen Zuständen. Läusebefall, Krätze und Infektionskrankheiten, wie Typhus und Tuberkulose, waren oft die Folgen.
In einer Scheune des Bauern hatten sich mehrere Flüchtlinge im Stroh versteckt, was Agnes und Olga nicht verborgen blieb. Sie versuchten den verzweifelten Menschen zu helfen, indem sie große Mengen Tee kochten und in Milchkannen und Eimern zur Scheune brachten. Lebensmittel standen ihnen nicht zur Verfügung. Als der grobschlächtige Bauer davon Wind bekam, wurde er sehr wütend. Erdmann kippte die Eimer um und vertrieb „das Pack“. Olga und Agnes bestrafte er mit einem Tag Essensentzug.
Immer wieder zogen Städter durch die Dörfer, in der Hoffnung, ihre letzten Habseligkeiten und Wertsachen gegen Lebensmittel eintauschen zu können. Der Schwarzhandel blühte, was Erdmann schamlos ausnutzte.
Den nächsten Winter überlebte Olga nicht, sie starb an Auszehrung (Tbc). Nun stand Agnes völlig auf sich selbst gestellt, allein da. Ihr Vater und die beiden Brüder waren in den letzten Kriegsmonaten an der Ostfront gefallen.
Der Bauer nutzte die Notlage des jungen Mädchens schamlos aus. Eines Nachts verschaffte er sich Zutritt zu ihrer Kammer und verging sich an Agnes, die sich vergeblich heftig wehrte. Voller Ekel und völlig verzweifelt schlich sich das Mädchen, nur mit ein paar Kleidungsstücken und einer Feldflasche mit Wasser im Bündel, vom Hof. Nach einem langen Fußmarsch durch Wald und Flur und schließlich entlang einer Landstraße, wurde sie noch ein Stück des Weges auf einem Pferdefuhrwerk mitgenommen.
Agnes erreichte nach Tagen die nächstliegende Stadt. Überall waren die Folgen des schrecklichen Krieges präsent: zerstörte Häuser, frierende und hungernde Menschen – der Kampf ums Überleben war allgegenwärtig. Am örtlichen Krankenhaus bekam das junge Mädchen eine Anstellung, da Arbeitskräfte dringend gebraucht wurden. Ihm kam zugute, dass es aus der Zeit im Pflichtjahr bereits über Erfahrungen in der Pflege und Betreuung eines Kriegsversehrten verfügte.
Agnes war sehr fleißig und versuchte, durch aufopferndes Kümmern um Hilfsbedürftige ihren Kummer zu verdrängen. Bald merkte sie, dass die Vergewaltigung Folgen hatte. Ihre ungewollte Schwangerschaft bedeutete für Agnes Stress – vor ihrem inneren Auge waren täglich die unfassbaren Ereignisse und Erlebnisse präsent. Sie litt unter Albträumen und hatte niemanden, bei dem sie hätte Schutz und Trost finden können. Die Vermieterin des kleinen, spärlich eingerichteten Zimmers war ihr nicht wohlgesonnen.
Agnes wurde mit gerade mal achtzehn Jahren Mutter. Der Geburtsvorgang war wegen der Beckenendlage des Kindes langwierig und schwierig, raubte ihr die letzten Kraftreserven. Die junge Frau hatte gehofft, ein Mädchen zu bekommen. Sie wurde enttäuscht. Voller Zukunftsangst versorgte Agnes, welche Familie und Heimat verloren hatte, ihr Kind auf der körperlichen Ebene dennoch so gut wie möglich. In ihrem Elend vermochte Agnes dem Kleinen nicht die erforderliche liebevolle Zuwendung zu geben. Selbst untergewichtig, konnte sie nicht stillen und empfand weder Freude noch Mutterliebe, hatte jedoch ein Pflichtgefühl ihrem Sohn gegenüber. Ein Säugling spürt unbewusst die Ablehnung und Trostlosigkeit, erkennt diese am Gesicht und dem Verhalten der Mutter. Ängste und Abwehrreaktionen entstehen, das Kind wird schreckhaft, schreit viel, lässt sich nur schwer beruhigen.
Agnes war gezwungen, allein für sich und das Kind den Unterhalt zu bestreiten. Sechs Wochen nach der Entbindung musste die junge Mutter wieder arbeiten gehen. Der kleine Peter kam in ein Säuglingsheim. Seine Mutter konnte ihn nur unregelmäßig besuchen.
Neben der Arbeit qualifizierte sie sich weiter und erlangte den Abschluss als Krankenschwester. Agnes wollte unbedingt etwas erreichen. Mit Gründung der DDR (Deutsche Demokratische Republik) wurde sie auch Mitglied der SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands). Die junge Genossin sollte gefördert werden, man schickte sie zu politischen Schulungen. In der Verfassung des neu gegründeten Staates wurde die Gleichberechtigung von Frau und Mann festgeschrieben. Die wenigen zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte, also auch die Frauen, sollten voll arbeiten gehen können und dennoch für Nachwuchs sorgen. Deshalb erfolgte ab 1951 ein massiver Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen, in denen die Kleinen ganztags betreut werden konnten. Auch alleinerziehende und in Schichten arbeitende Mütter sollten unbesorgt ihrer Berufstätigkeit nachgehen können, was programmgemäß der Sicherung und Durchsetzung der Gleichberechtigung dienen sollte.
Peter war inzwischen in einem Wochenheim untergebracht. An den Wochenenden, falls Agnes frei hatte, holte sie ihren Sohn zu sich nach Hause in ihre neue kleine Teil-Wohnung. Agnes verfügte über ein Zimmer und eine Wohnküche ohne Wasseranschluss, dafür gab es auf dem Flur ein gusseisernes Becken mit Wasserhahn für vier Mietparteien sowie das WC halbe Treppe tiefer.
Es kam vor, dass der Junge zwei oder gar drei lange Wochen ununterbrochen in der Einrichtung bleiben musste, wenn Agnes kranke Kolleginnen vertreten oder zu Parteischulungen gehen musste. Seitens der Heimleitung wurde es nicht gern gesehen, wenn Mütter an freien Tagen in der Woche ihr Kind besuchen oder abholen wollten, was damit begründet wurde, dass die Kontinuität in der Erziehungsarbeit gestört werden würde. Die Kollektiverziehung wurde damals als effektivste Erziehungsmethode proklamiert und über die Familienerziehung gestellt, wobei man die Bedeutung von Bezugspersonen sowie die verlässliche Bindung an diese verkannte oder leugnete. Jedes Mal, wenn Agnes den Kleinen abholte, reagierte er zunächst ablehnend, doch wenn sie ihn wieder zurück ins Heim brachte, klammerte er sich an ihren Beinen fest und schrie erbärmlich.
Mit sechs Jahren, kurz vor seiner Einschulung, hatte Peter endlich ein Zuhause. Der Junge war anstrengend: zappelig, verhaltensauffällig, reizbar, misstrauisch, ließ körperliche Nähe kaum zu. Selten zeigte Peter ein Lächeln. Agnes litt ihrem Kind gegenüber unter Schuldgefühlen. Doch ihr blieb keine andere Wahl. Als alleinerziehende Mutter in der Not der ersten Nachkriegsjahre musste sie ihren Sohn der Heimerziehung aussetzen, denn in der DDR war jeder per Verfassung und gesetzlich zur Arbeit verpflichtet.
Agnes lernte bei einer Parteischulung ihren künftigen Mann kennen. Sie startete mit der Eheschließung den Versuch, sich ein neues Leben in einer sicheren, unbelasteten Umgebung aufzubauen. Bald bekam sie einen weiteren Sohn, der von beiden Elternteilen geliebt und gehätschelt wurde. Holger, der Stiefvater, war mächtig stolz auf seinen Stammhalter, den Großen dagegen empfand er als lästig. Peter fühlte sich zurückgesetzt, war äußerst eifersüchtig und reagierte mit seltsamen, regressiven Verhaltensweisen. Er wollte auch aus der Babyflasche trinken, kroch auf dem Fußboden herum und lallte, nässte nachts wieder verstärkt ein. Das brachte ihm jedoch nicht die erwünschte Zuwendung, das Gegenteil war die Folge; er bekam Prügel vom Stiefvater.
In der Schule gab es fast täglich Ärger. Peter fiel durch seine ausgeprägte motorische Unruhe, aggressives Verhalten sowie Lernschwierigkeiten – besonders in den Bereichen Sprache, Lesen und Schreiben – auf. Die vierte Klasse musste er wiederholen. Der Junge wurde viel getadelt, gehänselt und hatte keine Freunde unter Gleichaltrigen. Immer häufiger rastete Peter aus, versuchte Konflikte mit der Faust zu lösen, nutzte dabei seine körperliche Überlegenheit aus. Zu Hause gab es Strafpredigten, moralisierende Erklärungen und allerlei Verbote. Peter hasste seinen Stiefvater und den kleinen Bruder. Seiner Mutter gegenüber hegte er ambivalente Gefühle. Einerseits machte Peter sie für seine Probleme verantwortlich, andererseits litt er unter Schuldgefühlen und war überzeugt, dass die Mama ihn lieben würde, wenn er nicht so böse wäre.
Holger bestrafte den Jungen hart, schlug zu, schon bei kleineren Vergehen oder vermeintlichem Fehlverhalten. Die Mutter konnte ihr Kind nicht schützen, hatte nicht die Kraft dazu und wurde bedrängt, Peter in die Kinder- und Jugendpsychiatrie einweisen zu lassen. Der Stiefvater war der Meinung, dass der Junge nicht ganz richtig im Kopf sei und behandelt werden müsse, damit er nicht auf die schiefe Bahn gerate.
Der Psychiatrie-Aufenthalt führte nicht zu der erhofften Verhaltensbesserung. Der Junge blieb unzugänglich und leicht erregbar. Peter zog sich innerlich noch mehr zurück, gab sich seinen Träumen, in denen er fliegen konnte und übermächtige Kräfte besaß, hin. Er wollte allen zeigen, dass er allein zurechtkommen würde, Hilfe nicht nötig hätte. Peters Bewegungsdrang diente dem Spannungsabbau, der Pausenhof wurde zum Kampfplatz. Nähe und Beziehung zu anderen Menschen vermied er unbewusst, um nicht weiter enttäuscht zu werden.
Peter lief von zu Hause weg, schwänzte die Schule, galt als rebellisch und politisch unbelehrbar. Da er sich nicht in die sozialistische Gesellschaft einfügen wollte, wurde er auf Beschluss des Jugendhilfeausschusses des zuständigen Kreises für sechs Monate in einen Jugendwerkhof eingewiesen. Das Erziehungsziel in den JWH bestand darin, „Besonderheiten in der Persönlichkeitsentwicklung und Eigenheiten im Denken des Jugendlichen“ sowie „gesellschaftswidriges“ Verhalten zu überwinden.
Anschließend absolvierte Peter eine Lehre im Tief- und Straßenbau und diente pflichtgemäß (1962 wurde in der DDR die Wehrpflicht eingeführt) achtzehn Monate bei der Nationalen Volksarmee (NVA). Danach arbeitete er im erlernten Beruf, zog von einer Baustelle zur anderen, quer durch die gesamte Republik. Seine körperliche Kraft und Ausdauer bei der Arbeit verschafften ihm Bewunderung. Er machte viele Überstunden, ließ sich leicht beeinflussen und ausnutzen, vermutlich um Anerkennung zu gewinnen. Peter erwies sich als ein Mann der Tat und wenigen Worte. Er war der Typ Kumpel für jedermann, ein zuverlässiger, ziemlich trinkfester Kerl. Niemand traute sich mehr, ihn zu beleidigen oder herabzusetzen.
Zu Frauen hatte er ein zwiespältiges Verhältnis, sie verunsicherten ihn. Besonders mit den selbstbewussten, dominant wirkenden Mädchen konnte er nichts anfangen, sie schreckten ihn regelrecht ab. Den Kontakt zur Familie hatte Peter längst abgebrochen, er fühlte sich frei, unabhängig und war überzeugt von der eigenen Stärke und seinen Fähigkeiten. Oft begab er sich im persönlichen Leben waghalsig in riskante Situationen, missachtete den Arbeitsschutz, achtete nicht auf sich, ließ sich treiben.
Renate und Anita
Renate war Kriegswaise und lebte bei ihrer strengen, verbitterten Großmutter väterlicherseits, welche sie bis zu ihrem Lebensende pflegte. Weitere Verwandte gab es nicht mehr. Mit einundzwanzig war die Kriegswaise endlich volljährig und heiratete den zehn Jahre älteren Franz. Er war einst ihr heimlicher Jugendschwarm aus der Nachbarschaft gewesen.
Franz erlitt in den letzten Kriegsmonaten an der Ostfront schwerwiegende Verletzungen. Um sein Leben zu retten, musste der rechte Unterschenkel amputiert werden. Seine Eltern starben im Konzentrationslager, da sie aktive Gegner des Nationalsozialismus waren. Franz war als Verfolgter des Naziregimes anerkannt und bezog daher eine Rente.
Er bekam in der neugegründeten DDR einen verantwortungsvollen Posten beim Rat des Bezirkes und verdiente recht gut. Die hübsche, junge Sekretärin hatte es ihm angetan. Er erkannte in ihr zunächst nicht das frühere Nachbarmädchen. Franz umwarb die junge Frau, verwöhnte sie mit kleinen Mitbringseln, die es nicht einfach so zu kaufen gab – er hatte eben seine Beziehungen. Sie waren bald ein Paar und Renate guter Hoffnung. Im Überschwang der Glücksgefühle versprach der Mann seiner schönen Braut, ihr die Sterne vom Himmel zu holen.
Drei Monate nach der Geburt des Töchterchens Anita nahm Renate ihre Berufstätigkeit wieder auf. Sie qualifizierte sich weiter und war als Genossin und Kollegin anerkannt und sehr beliebt.
Ihr Mann reagierte darauf grundlos misstrauisch und eifersüchtig. Franz wollte ein zweites Kind und hoffte, dass seine Frau dann zu Hause bleiben würde. Finanziell konnten sie sich das leisten. Dazu war Renate jedoch nicht bereit. Immer häufiger kam es zu Streit, bis hin zu Drohungen und Handgreiflichkeiten. Anita litt unter den Spannungen im Elternhaus. Renate reichte, nach einer heftigen Auseinandersetzung, bei der Franz ihr vor den Augen der Tochter hart ins Gesicht geschlagen hatte, die Scheidung ein. Lieber wollte sie mit ihrer zehnjährigen Tochter allein leben, als sich vom krankhaft eifersüchtigen, cholerischen Ehemann weiter unterdrücken und bevormunden zu lassen.
Anita fühlte sich zwischen den Elternteilen hin und her gerissen. Wie zu DDR-Zeiten üblich, hatte die Mutter das alleinige Sorgerecht, der Vater nur ein Besuchsrecht. Franz war ein liebevoller Papa, der die Tochter verwöhnte und versuchte, sie in seinem Sinne zu beeinflussen.
Renate arbeitete als alleinerziehende Mutter weiterhin ehrgeizig und engagiert sowohl im Beruf als auch für die Partei. Sie wurde befördert und sollte fortan bei der Landesregierung arbeiten. Renate und Anita zogen deshalb in eine andere Stadt.
Das Mädchen sah seinen Vater nur noch selten und vermisste ihn. In den Sommerferien durfte Anita zwar mit dem Papa nach Ungarn oder in die Tschechoslowakei in den Urlaub fahren, doch außerhalb der vereinbarten Besuchszeiten sollte Anita keinen Kontakt zum Vater pflegen, sondern lieber lernen. Sie war nämlich nach dem Umzug in ihren schulischen Leistungen abgesackt, was ihre Mutter jedoch nicht hinnehmen wollte. Schließlich sollte die Tochter einmal zur Erweiterten Oberschule (EOS) gehen, das Abitur machen und danach studieren. In diesem Punkt waren sich die Eltern sogar einig.
Als Anita vierzehn war, lernte Renate Achim kennen. Dieser, Anfang dreißig, ein wenig jünger als sie, sah gut aus, war lebenslustig und wirkte unbeschwert. Er strahlte ein natürliches Selbstbewusstsein sowie Optimismus aus, was der jungen Frau einfach gut gefiel.
Achim machte Anita von Anfang an klar, dass er nicht die Absicht habe, sich als ihr Vater aufzuspielen. Schließlich habe sie ja einen lieben Papa. Er wollte Freund und Kumpel sein, behandelte das Mädchen respektvoll. Nach und nach vertraute Anita ihm sogar. Erst als Renate schwanger wurde, zogen sie in eine gemeinsame Wohnung.
Mit fünfzehneinhalb war Anita nun große Schwester. Achim stand seiner Frau bei der Geburt zur Seite und fühlte sich überglücklich beschwingt. Als er abends aus der Klinik heimkam, klopfte er an Anitas Tür. Er fragte, ob sie noch munter sei und er hereinkommen dürfe. Achim hatte eine Packung Weinbrandbohnen sowie eine Flasche Sekt dabei. Er wollte mit ihr auf das Brüderchen anstoßen. Der Mann war so stolz und begeistert, da konnte sie doch nicht nein sagen. Er setzte sich auf die Bettkante und füllte die Gläser. Anita fühlte sich bald beschwipst, kicherte vergnügt über die Witzeleien und Komplimente von Achim. Auch der frischgebackene Vater amüsierte sich köstlich und goss mehrmals ihr halbleeres Glas nach. Sich selbst genehmigte er zusätzlich zwei, drei Gläschen Weinbrand. Anita vertraute ihm an, dass sie froh wäre, wenn ihr Papa auch so lustig und locker sein könnte, lehnte sich dabei vertrauensvoll an seine Schulter. Achim nahm das Mädchen väterlich in den Arm und scherzte weiter. Schlagartig änderte sich die Situation...
Am nächsten Morgen wachte Anita mit Übelkeit und Kopfschmerzen auf. Außerdem hatte sie verschlafen. Nur mühsam kam sie zu sich und erschrak: Ihr Laken war blutig, es fühlte sich zwischen den Beinen klebrig und wund an. Langsam dämmerte ihr, was geschehen war. Voller Ekel und geplagt von Schuldgefühlen zog sie die Bettwäsche ab, schlurfte ins Badezimmer und duschte lange. Dann stellte sie die Waschmaschine an. Achim klopfte an die Tür. Das Mädchen reagierte nicht. Er hörte es schluchzen. Als Anita endlich das Bad verließ, fasste Achim sie bei den Schultern, hob dann ihr Kinn an und schaute ihr eindringlich in die Augen. Er entschuldigte sich für sein Verhalten und versicherte ihr, dass er sie wie eine Tochter liebhabe und dass der letzte Abend ein Ausrutscher gewesen sei, keine Wiederholung fände. Anita schaute zu Boden und blieb stumm. Achim war der Meinung, dass sie eine Mitschuld tragen würde. Sie habe ihm aber auch tüchtig eingeheizt. Anita sollte schweigen, denn er liebe Renate und seinen kleinen Sohn. Wenn sie quatsche, trüge sie die Schuld am Zerbrechen der Familie und sie würde dem kleinen Bruder und sich selbst damit schaden. Für die Schule schrieb Achim einen Entschuldigungszettel.
Als Renate mit dem Baby zu Hause war, schien sie blind vor Glück zu sein. Zunächst bemerkte sie die Verhaltensänderung bei der Tochter nicht einmal. Anita zog sich zurück und wurde schweigsam. Den Familienzuwachs beachtete sie kaum. Ihre Mutter deutete das als Eifersucht auf den kleinen Bruder. Nur unwillig erledigte das Mädchen ihr übertragene Hausarbeiten. Achim ging arbeiten und tat so, als ob alles in bester Ordnung sei. Seine Erklärung für Anitas Verhalten: Pubertät!
Manchmal fragte er Anita, ob sie einen Wunsch hätte. Sie verlangte dann zum Beispiel Geld, um ein neues Kleidungsstück kaufen oder ins Kino gehen zu können. Die Mutter war dagegen, wenn Anita mit einer Freundin (oder gar mit einem Freund?) die Abendvorstellung besuchen wollte. In Achim fand sie einen Fürsprecher. Materiell wurden dem jungen Mädchen fast alle Wünsche erfüllt, dafür sorgten sowohl Achim als auch Franz, ihr Vater.
Nach zwanzig Wochen Babypause ging Renate wieder arbeiten, der Kleine kam in die Krippe. Morgens um sieben Uhr verließ Anita gewöhnlich die Wohnung, um zur Schule zu gehen. Nachmittags traf sie sich mit Freunden oder ging mit zu einer Klassenkameradin, da sie gemeinsam lernen und Hausaufgaben erledigen wollten. Das akzeptierte die Mama, da sie eine hohe Erwartungshaltung bezüglich der schulischen Leistungen ihrer Tochter hatte. Manchmal kam Anita verspätet zu Hause an. Dann gab es Zank mit der Mutter.
Waren denn alle blind? Nahmen sie die stummen Signale nicht wahr? Anita veränderte sich auch äußerlich. Sie lief im Schlabber-Look herum, hatte Augenringe, ihr Gesicht war voller geworden. Die knapp Sechzehnjährige wirkte müde, mürrisch-unzufrieden, brauste schnell auf, zankte sich mit der Mutti, war Achim gegenüber feindselig-abweisend. Konnte man das noch mit der Pubertät erklären?
Doch Außenstehende waren aufmerksamer, machten sich Gedanken. Eines Tages rief die Lehrerin Anitas Mutter während der Arbeitszeit an. Sie fragte nach, ob es ihrer Tochter wieder besser ginge. Wieso? Renate fiel aus allen Wolken. Sie vereinbarten einen Termin für ein persönliches Gespräch.
Renate und Anita saßen im Büro des Direktors der POS (Polytechnische Oberschule). Jetzt kam alles zur Sprache. Die Liste der Verfehlungen war lang: gefälschte Unterschriften und Entschuldigungen, Schulbummelei, aufsässiges Verhalten, Arbeitsverweigerung, Schwänzen des Sportunterrichts, wechselnde Bekanntschaften mit Jungen, die Anita nach dem Unterricht abholen wollten. Außerdem sei der Abschluss der 10. Klasse gefährdet. Renate schüttelte bekümmert den Kopf und meinte, dass sie völlig ahnungslos gewesen sei. Sie musste sich sagen lassen, dass das unmoralische und asoziale Verhalten ihrer Tochter nicht geduldet werden könne. Sie als Mutter und Genossin trage eine Verantwortung! Anita schwieg trotzig zu allem und vermied jeglichen Blickkontakt. Nun wurde auch noch die Vermutung einer Schwangerschaft geäußert! Renate fiel abermals aus allen Wolken und bekam die Auflage, mit dem Mädchen zum Frauenarzt zu gehen. Der Verdacht bestätigte sich.
Asoziales Verhalten durfte keinesfalls toleriert werden! Anita wurde zwangsweise in ein Krankenhaus - auf eine sogenannte venerologische Station – eingewiesen. Sie wusste nicht, was sie dort erwarten würde und kannte auch nicht die im Volksmund gebräuchliche Bezeichnung „Tripper-Burg“.
Da dem Mädchen unmoralisches Verhalten oder gar heimliche Prostitution vorgeworfen wurde, musste es entwürdigende und rücksichtslose gynäkologische Untersuchungen ertragen. Der Aufenthalt in solchen geschlossenen Abteilungen diente offiziell der Behandlung, Bekämpfung und Verhütung von Geschlechtskrankheiten. Venerologische Stationen sollten als Orte der Disziplinierung auch der Erziehung zu sozialistischen Persönlichkeiten dienen.
Die Testauswertungen dauerten etwa drei Wochen. Da Anita gesund war, wurde sie nach vierwöchigem Zwangsaufenthalt aus dem Krankenhaus entlassen und anschließend in ein Heim für schwererziehbare Jugendliche eingewiesen. Dort brachte sie ihr Kind zur Welt. Die junge Mutter durfte es nicht einmal sehen, wusste nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen war. Das Neugeborene wurde gleich zur Adoption vermittelt.
Anita holte den Schulabschluss nach und absolvierte eine Lehre als Köchin. Erst mit achtzehn Jahren konnte sie das Heim verlassen. Das Verhältnis zur Mutter und zu Achim war äußerst angespannt, von gegenseitigen Vorwürfen und Schuldzuweisungen geprägt. Anita brach nie ihr Schweigen, jedoch in ihrem Inneren war etwas zerbrochen. Diese traumatischen Ereignisse hinterließen in ihrer Seele tiefe Spuren mit schwerwiegenden Folgen, wie Ängste, Schlafstörungen, Depressionen, Abneigung gegen Ärzte.
Anita wollte keinesfalls wieder bei ihrer Mutter wohnen, deshalb zog sie in die Nähe ihres Vaters. Dieser war inzwischen Invalidenrentner und durfte in die Bundesrepublik reisen, wo eine entfernte Verwandte lebte. Er versuchte weiterhin, seine Tochter materiell zu verwöhnen und an sich zu binden. Vom Missbrauch seiner Tochter und der unerwünschten Schwangerschaft hatte er keine Kenntnis.
Anita wollte lieber allein und unabhängig in ihrer Einraumwohnung leben; sie ging selten aus. Bei der Arbeit in einer Betriebsküche nahm sie kein Blatt vor den Mund, wenn sie Ungerechtigkeiten oder Missstände ansprach. Man wollte sie als Parteimitglied oder wenigstens für die Gewerkschaft gewinnen. Andere zu bespitzeln, lehnte Anita ab. Irgendwie hatte die junge Frau den Eindruck, ständig beobachtet und kontrolliert zu werden. Sie fühlte sich einsam und unverstanden, sehnte sich nach liebevoller Zuwendung. War das Torschlusspanik? Immerhin war sie schon Ende Zwanzig. Nun dachte sie doch über eine eigene Familie nach. Ihre wenigen Männerbekanntschaften waren nicht von Dauer gewesen. Anita war Männern gegenüber misstrauisch und nicht in der Lage, eine stabile Beziehung aufzubauen.
Anita und Peter
Der 35. Jahrestag der DDR wurde überall in der Republik mit Volksfestcharakter gefeiert. Zuvor fanden die üblichen Kundgebungen, mit der örtlichen Politprominenz auf der Tribüne, statt. Fähnchen schwingende Pioniere jubelten den Parteigenossen zu. Anita war mit zwei Freundinnen unterwegs, sie amüsierten sich darüber und schlenderten in Richtung Festwiese.
Anita war mit blauen Jeans und einer echten, schwarzen Lederjacke (aus dem Westen) bekleidet. Das lange, braune Haar glänzte in der Sonne. Die drei gut gelaunten Mädels fielen einer Gruppe junger Männer auf, welche nach Bauarbeitermanier hinter ihnen her pfiffen. Anita drehte sich um – warum, hätte sie nicht erklären können. Ihr fiel der große, breitschultrige Mann auf, der sich etwas im Hintergrund hielt. Ihre Blicke trafen sich. Einer seiner Begleiter meinte anzüglich: „Eh Langer, da is’ ‘ne steile Braut für dich dabei!“ Die jungen Leute lachten, kamen ins Gespräch, man feierte gemeinsam weiter.
Anita und der lange Peter verabredeten sich und waren bald darauf ein Paar. Sie fühlten sich wie zwei Seelenverwandte zueinander hingezogen und hofften, jeweils beim anderen Verständnis, Anerkennung, Liebe und Geborgenheit zu finden, die sie in der Kindheit oder Jugend vermissten. Beide hatten schmerzliche Erfahrungen mit körperlicher Gewalt, seelischer Verletzung und mehreren Beziehungsabbrüchen gesammelt, waren zwangsweise in Heimen untergebracht worden.
Gerade in den Spezialheimen für schwererziehbare Kinder und Jugendliche und in den JWH (Jugendwerkhof) erfolgte die „Umerziehung“ mit strenger disziplinarischer Ordnung unter Anwendung grober und grausamer Strafen. Nicht selten kam es zum Machtmissbrauch durch Erzieher oder ältere Jugendliche, zu sexuellen Übergriffen, Herabwürdigung, Unterdrückung. Besonders Peter litt unter den unliebsamen Erlebnissen, über die er nicht sprechen wollte. Anita sprach jedoch über die bisher verdrängten Erlebnisse, die schmerzvolle, traumatische Erfahrung des sexuellen Missbrauchs durch den Stiefvater und die ungewollte Schwangerschaft, ebenso über die Gefühle des Ausgeliefertseins, der Ohnmacht, nicht entscheiden zu dürfen, ob sie ihr Kind selbst großziehen möchte. Anita hatte das Vertrauen zu ihren wichtigsten Bezugspersonen verloren, fühlte sich in ihrer Not verraten und alleingelassen. Sie durfte ihr Schweigen nicht brechen, weil sie sich mitschuldig fühlte. Anita kam gar nicht auf den Gedanken, dass sie damit lediglich den Vergewaltiger schützte. Für ihre verletzte Seele war es Balsam, sich endlich einem Menschen anvertrauen zu können. Peter verstand sie, hatte selbst viel durchgestanden. Beide klammerten sich aneinander. Gemeinsam wollten sie es besser machen, ihr bisheriges Schicksal hinter sich lassen, um ihr künftiges Leben selbst in die Hand zu nehmen, eine eigene Familie zu gründen.
Noch vor der Geburt ihres Sohnes Uwe heirateten sie. Eine Eheschließung ermöglichte ihnen die Berechtigung, einen Wohnungsantrag zu stellen. Die junge Familie bekam eine Dreiraumwohnung im Plattenbau zugewiesen. Anita war dreißig, Peter bereits achtunddreißig Jahre alt. Sie fühlten sich glücklich. Anita genoss das Babyjahr und freute sich auf die Wochenenden, wenn Peter auch zu Hause war. Sie legte viel Wert auf Wohnkultur und verwöhnte ihren Liebsten, der sich erstmals in seinem Leben geborgen fühlte. Selbstverständlich nahm sie ein Jahr später wieder ihre Berufstätigkeit auf. Nach vier weiteren Jahren erblickte ihre Tochter Isabella das Licht der Welt.
Doch das Familienglück wurde bald getrübt. Noch während des Erziehungsurlaubs erhielt Anita eine betriebsbedingte Kündigung. Nach der politischen Wende 1989/90 griffen Privatisierung und Abwicklung der ehemals volkseigenen Betriebe um sich. Auch die Baufirma, bei der Peter arbeitete, wurde privatisiert. So wie viele andere erhielt er eine Kündigung. Nun mussten sich beide arbeitslos melden. Ein neuer Arbeitsplatz war nicht in Sicht, ihre bescheidenen Ersparnisse waren bald aufgebraucht. Beide empfanden den Gang zum Arbeits- und später zum Sozialamt als erniedrigend. Vielen in der Nachbarschaft erging es ähnlich.
Zunächst fühlte sich Anita daheim ausgelastet, sie versorgte ihre beiden Kindern und die zwei Katzen, kümmerte sich um den Haushalt. Die kleine Isabella war immer freundlich, pflegeleicht und sehr anschmiegsam, einfach ihr Sonnenschein. Um das Geld für den Kindergartenplatz zu sparen, blieb auch Uwe zu Hause. Der Sohn verlangte ihr viel ab. So wie der Vater in der Kindheit, war er ein Zappelphilipp, musste alles erkunden, blieb nie lange bei einer Beschäftigung. Aber Anita liebte ihn und war meistens sehr nachsichtig.
Uwe erlebte Mutter und Schwester als eine Einheit, fühlte sich manchmal benachteiligt und nicht dazugehörig. Wenn sich Anita mit dem unruhigen, quengelnden Sohn überfordert fühlte, reagierte sie mitunter feindlich ablehnend, dann wieder fürsorglich, um seine Sicherheit besorgt. Diese wechselnden Gefühlslagen erzeugten bei Uwe eine hohe Ambivalenz der Mutter gegenüber und vor dem unberechenbar reagierenden Vater fürchtete sich der Junge sogar.