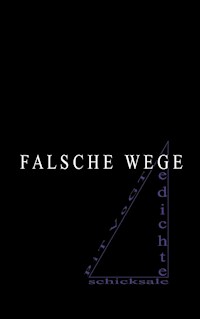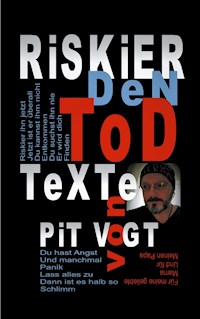Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Glauben Sie an Geister? Oder glauben Sie zumindest an den Teufel oder an unerklärbare Begebenheiten? In diesem Buch finden Sie solcherlei Geschichten - immer hat der Teufel seine Hand im Spiel! Sonderbare Geisterzüge wechseln sich ab mit Blutverträgen, die mit dem Teufel geschlossen werden. Und dann ist da das Geheimnis der blutigen Oblaten! Sollte möglicherweise auch hier der Teufel ...? In jedem Fall mag es gewiss absonderliche Dinge geben, die wir uns nicht erklären können! Teufel oder nicht, es liegt an uns, mit solcherlei Vorfällen umzugehen. Nicht die Frage, ob es so etwas gibt, sollte uns umtreiben. Vielmehr sollte es die Klarheit um unser eigenes Leben sein, die uns erstarkt. Denn Teufel gibt es sicherlich genügend in unserer realen und zurechtgebügelten Welt. Wir müssen lernen, sie zu erkennen. So manch ein geheimnisvoller Teufel entpuppt sich dann schnell als ganz normaler Mensch, der uns nicht wohlgesonnen ist. Das ganz normale Leben bietet eine Menge unfassbarer Dinge, die am Ende doch immer wieder recht eindeutig und wichtig für uns sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 223
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Gelbe Rosen
Die alte Bar
Der Fluch
Sonderbare Telefonzelle
Der alte Helm
Das Loch
Späte Buße
Banküberfall
Flug des Grauens
Der Jungbrunnen
Die Hexe
Flaschenpost aus dem Jenseits
Irrlichter
Blutige Oblaten
Die H-Bombe
Pestbeulen
Kannibalen
Teuflische Begegnung
Tödliche Auszeichnung
Das Ende der Welt
Schwester Annemarie
Marienbach
Motel des Grauens
Poltergeist
Das Geheimnis von Schloss Greenhouse
Letzte Taxifahrt
Die schwarze Pendeluhr
Kellergrusel
Der Blutvertrag
Teufelsasche
Die geheimnisvolle Grenze
Das hölzerne Kreuz
Kreditvertrag mit dem Teufel
Der Geisterzug
Gelbe Rosen
Es war der dritte und letzte Verhandlungstag. Der arbeitslose Gauner Eddi Johns war angeklagt, den Banker James Miller aus Habgier ermordet zu haben. Auf einem Friedhof sollte er den Banker abgefangen haben, als dieser gerade dabei war, seinem Vater einen Strauß seiner geliebten gelben Rosen aufs Grab zu legen. Eddi wollte Geld von ihm. Doch als dieser ihm keines geben konnte, schoss er auf ihn. Der Banker starb noch auf dem Grab seines Vaters. Auch der starb vor wenigen Wochen unter merkwürdigen Umständen. Der Mord wurde von einem angetrunkenen Obdachlosen beobachtet, der sein Nachtlager in unmittelbarer Nähe des Grabes aufgeschlagen hatte. Eddi leugnete jedoch bis zur letzten Minute. Schließlich wurde er freigesprochen. Denn obwohl man dem Obdachlosen glaubte, konnte die Waffe, mit welcher er umgebracht wurde, nirgends gefunden werden. Damit schien der Fall abgeschlossen. Eddi verließ als freier Mann das Gerichtsgebäude. Millers Mutter aber blieb verstört und allein gelassen zurück. Ihre Trauer war unbeschreiblich. Sie konnte den Verlust des einzigen Sohnes einfach nicht verkraften. Ihr ging es von Tag zu Tag immer schlechter. Ein klein wenig Trost fand sie bei ihren geliebten gelben Rosen. Überall im Garten hatte sie diese wunderschönen Blumen angepflanzt. Sehr oft sprach sie mit ihnen. Und gerade jetzt, wo sie in so kurzer Zeit hintereinander den Mann und den Sohn verlor, weinte sie sich bei ihren Rosen aus. Beinahe jeden Tag ging sie auf den Friedhof, um am Familiengrab, in welchem nun auch ihr geliebter Sohn lag, zu trauern. Jedes Mal nahm sie einen Strauß ihrer gelben Rosen mit. Sie konnte nicht mehr allein zu Hause sein. Zu schwer wog der Verlust. An einem Sonntag ging sie wieder einmal völlig verzweifelt zum Grab. Sie hatte zwei große Sträuße gelber Rosen bei sich. Als sie vor dem Grab stand, brach sie weinend zusammen. Dabei fielen ihr die Sträuße aus der Hand. Sie landeten auf der Wiese neben dem Grabstein. Als sie die Blumen wieder aufheben wollte, bemerkte sie etwas Glänzendes, welches sich unter den Blumen im dichten Gras verbarg. Als sie das Gras etwas beiseite drückte, erstarrte sie vor Schreck … im Gras lag ein Revolver! Sie holte den Friedhofsverwalter und der alarmierte die Polizei. Da sich der Fundort in unmittelbarer Nähe des Grabes befand, hatten die Ermittler einen ganz bestimmten Verdacht. Vermutlich war das die Waffe, mit der Eddi den Banker erschossen hatte. Der Revolver wurde auf Fingerabdrücke untersucht. Und wirklich – auf der Waffe fanden die Ermittler seine Fingerspuren. Eddi gestand alles. Doch beim Verhör gab es plötzlich Unklarheiten. Eddi beteuerte, die Waffe in einen Fluss geworfen zu haben. Er beschrieb sogar, an welcher Stelle er den Revolver ins Wasser warf. Die Ermittler untersuchten das gesamte Gelände, welches Eddi beschrieb. Doch einen Revolver fanden sie nicht. Dafür aber einen wunderschönen Strauß gelber Rosen. Irgendjemand hatte sie in den Papierkorb, der am Flussufer neben einer weißen Holzbank stand, geworfen. Einer der Ermittler nahm den Strauß aus dem Korb. Dabei fiel eine kleine weiße Tüte heraus. Darauf war der Schriftzug „Arsen“ zu lesen. Sofort wurde der Rosenstrauß zur Gerichtsmedizin gebracht. Es stellte sich heraus, dass die Tüte ebenfalls Eddi gehört hatte. Denn neben den Fingerspuren, welche auf der Tüte gesichert werden konnten, fanden die Ermittler auch einen kleinen Notizzettel, auf dem der Name und die Adresse von Millers Vater stand. Es war eindeutig Eddis Handschrift! Nun konnte auch der rätselhafte Tod von James Millers Vater aufgeklärt werden. Als die Ermittler Eddi mit dem Rosenstrauß, in welchem sie die Arsentüte fanden konfrontierten, bestritt dieser, jemals einen Rosenstrauß in seinen Händen gehalten zu haben. Er litt seit seiner Kindheit an einer seltenen Rosenallergie.
Die alte Bar
Manchmal, wenn ich allein zu Hause sitze, erinnere ich mich an die alten Zeiten. Dann krame ich mir die alten Fotos aus dem Schrank und verbeiße mir so manche Träne. Ja, es war schon eine ereignisreiche Zeit, damals, vor 30 Jahren. Auf einem Foto entdeckte ich eines Tages auch unsere kleine alte Bar. Dort hatte ich damals meinen Ehemann Jim kennen gelernt. Die Musik, der Blues „What a Wonderful World“ mit Louis Armstrong. Ich höre es noch, als wären all die vielen Jahre nicht vergangen. Ich sah mich mit Jim an einem der wackeligen Holztische sitzen und Rotwein trinken. Ach, wir konnten uns damals kaum etwas leisten. Aber in die kleine Bar gingen wir dennoch immer, wenn wir Zeit hatten. Damals lebten wir noch in einem herunter gekommenen Zimmer mitten in Boston. Wenn wir miteinander tanzten, dann war es so, als kannten wir uns schon eine Ewigkeit. Und dann heirateten wir. Irgendwann zogen wir weg aus der Gegend. Dann kamen die Kinder, die Karriere, das Haus, die Scheidung. Tränen liefen mir übers Gesicht. In die alte Bar sind wir seither nie mehr gegangen. Ich klappte das Fotoalbum zu und beschloss, nach Bosten zu fahren. Noch einmal wollte ich nach der Bar suchen, vielleicht gab es sie ja noch. Mir war nach Erinnerungen und die Neugierde ließ mir einfach keine Ruhe. Ich zog eine Jacke über, stieg ins Auto und fuhr nach Boston. Natürlich konnte ich mich nicht mehr genau erinnern, wo sich die Bar befand. Aber ich erinnerte mich noch, dass sie wohl zwischen zwei zierlichen runden Gebäuden stand, die aussahen wie Türmchen. Und tatsächlich, nachdem ich mich mehrmals verfahren hatte, entdeckte ich die winzige Seitenstraße mit den beiden Türmchen. Sogar die Bar gab es noch. Doch die Fenster waren vernagelt und das Schild überm Eingang, welches mir damals viel größer erschien, hing nur noch an einer alten Stromleitung und pendelte im Wind hin und her. Die Schrift darauf war nicht mehr zu erkennen. Ich erinnerte mich, dass wir damals heimlich, um nicht den Eintrittspreis zahlen zu müssen, durch einen Nebeneingang, den ausschließlich das Personal nutze, hinein gingen. Ich suchte nach diesem Nebeneingang. Und ich fand ihn. Er stand offen. Vorsichtig trat ich ein. Unter meinen Schuhen knirschten Glasscherben der zerbrochenen Fensterscheiben. Die schmale Treppe, die zum Tanzsaal hinaufführte, war total verdreckt. Überall lagen zerfetzte Zeitungen und Unrat herum. Es roch muffig und alt. Sogar die Pendeltür zum Saal gab es noch. Ich stieß sie auf und stand augenblicklich in meiner eigenen Vergangenheit. Durch die Spalten der Bretter, die vor die Fenster genagelt wurden, fiel etwas Sonnenlicht auf das zerschundene Parkett. Das Licht verfing sich im Staub des leeren Raumes und verzauberte ihn regelrecht. In der Mitte des Saales stand vergessen ein kaputter Stuhl herum. Ich setzte mich, und was dann geschah, erscheint mir noch heute wie ein Wunder. Als ich mit meinen Fingern an der Unterseite des Stuhles entlang tastete, stieß ich auf etwas Weiches, das unterm Sitzpolster klemmte, es schien Papier zu sein. Ich zog es hervor und betrachtete es. Es war eine alte Zeitungsseite aus dem Jahre 1976. Unter einem langen Text konnte ich ein Foto sehen. Es war schon recht vergilbt. Aber ich konnte genau erkennen, was, oder besser gesagt wer darauf abgebildet war: Jim und ich, wie wir auf dem Parkett tanzend unsere Runden drehten. Ich konnte es nicht fassen, wir beide, damals vor über dreißig Jahren, unbegreiflich. Mir schien es beinahe so, als sollte ich diese Zeitung finden. Denn plötzlich knackte es draußen vor der Pendeltür. Ich erschrak und schaute ängstlich zur Tür. Was, wenn irgendwelche Gauner hereinkämen? Oder vielleicht Obdachlose, die das verfallene Haus für sich okkupiert hatten? Doch es kam ganz anders. Als das Knacken und Knirschen verstummte, stieß jemand die Pendeltür auf. Durch das staubige Sonnenlicht konnte ich zunächst nicht sehen, wer da gekommen war. Langsam erhob ich mich von meinem Stuhl. Und jetzt konnte ich sehen, wer dort stand: Jim! Er schaute mich an und wir sprachen kein Wort. Wie konnte das nur möglich sein? Woher wusste er, dass ich ausgerechnet heute hier sein würde? Ich konnte mir all das nicht erklären. Doch es war real, Jim stand wirklich vor mir! In diesem Augenblick spürte ich einen heftigen Stich im Herzen. Mir schossen die Tränen in die Augen. Ich konnte meine Gefühle nicht mehr kontrollieren. Jim lächelte mich an und sprach noch immer kein einziges Wort. Und auch ich konnte nichts sagen, mir hatte es regelrecht die Sprache verschlagen. Das konnte einfach kein Zufall sein! Wir liefen aufeinander zu und umarmten uns. Wir konnten uns nicht mehr loslassen und in diesem Moment war es so, als gäbe es nichts, dass uns noch trennen konnte. Was für ein faszinierender märchenhafter Augenblick. Wir küssten uns und tanzten so wie damals unsere Runden – quer durch den Saal. Und wie im Märchen ertönte der alte Blues, zu dem wir schon damals getanzt hatten: „What a Wonderful World“ mit Louis Armstrong. Wir konnten unser Glück nicht fassen. Stundelang tanzten wir zu einer Musik, die eigentlich gar nicht da zu sein schien. Als es draußen langsam dunkler wurde, hielten wir uns noch immer in den Armen. Wir wussten in diesem magischen Augenblick genau – es musste ein Zeichen sein, dass wir uns genau zu diesem Zeitpunkt in dieser kleinen verfallenen Bar mitten in dieser riesigen Stadt wiederfanden. Es war fantastisch und unwirklich zugleich. Es war unfassbar! Als wir gemeinsam die Bar verließen schien es uns, als wollte sie sich von uns verabschieden. Ein seltsam trauriges Gefühl schwebte in der Luft. Wir bedankten uns beim Verlassen des alten Gebäudes für diese wundervolle Schicksalsfügung. Und irgendwie schien es, als wünschte uns die alte Bar alles erdenkliche Glück dieser Welt. Jim und ich lebten seitdem wieder zusammen. Und es begann eine intensive und liebevolle Zeit, die wir dankbar entgegennahmen. Ein Jahr später, es war unser Hochzeitstag, wollte Jim wieder zur alten Bar zu fahren. Vielleicht konnten wir dort wie früher tanzen und dem alten Blues lauschen. Dazu nahm Jim einen kleinen CD-Player mit. Er hatte sich vor Jahren die CD mit unserem Lied gekauft. Wir fuhren nach Boston, doch das Gebäude, unsere kleine Bar zwischen den Türmchen gab es nicht mehr. Sie war weggerissen worden. An der Stelle, an welcher sie stand, befand sich nur noch ein Trümmerhaufen. Das Merkwürdigste aber war, dass wir neben dem Schutthaufen einen alten Stuhl fanden. Ich betrachtete ihn mir genau und fand die alte Zeitungsseite mit unserem Foto unter dem Sitzpolster. Ich zog sie heraus und steckte sie ein. Dann erkundigten wir uns in einem Antiquitätenladen ganz in der Nähe, wann das Gebäude weggerissen wurde. Die freundliche Inhaberin schaute uns irritiert an. Offensichtlich wunderte sie sich über diese Frage. Schließlich meinte sie kühl: „Die Bar gibt es schon seit dreißig Jahren nicht mehr. Sie ist damals bis auf die Grundmauern abgebrannt. Seitdem liegt der Schutthaufen hier herum und keiner kümmert sich mehr darum.“ Wir konnten es nicht glauben. Doch plötzlich erklang Musik aus der Ferne ein Blues, welcher uns beiden sehr bekannt vorkam und uns die Tränen in die Augen trieb: „What a Wonderful World“ mit Louis Armstrong. Und wir tanzten in dem kleinen Laden dazu, als sei die Zeit niemals vergangen.
Der Fluch
Christin liebte die schier endlosen wunderschönen Weinberge. Diese Weite und die Ursprünglichkeit dieses herrlichen Landes hatte sie tief in ihr Herz geschlossen. Nie wollte sie fort von hier. Und nie konnte sie sich auch nur im Entferntesten vorstellen, für einen Mann all das aufzugeben. Ewig wollte sie hierbleiben, allein. Der kleine Weinbetrieb, den damals schon ihr Vater bewirtschaftete, schien ein Stück von ihr selbst zu sein. Sie opferte sich für ihn auf und der Wein gedieh wie sonst keiner. Nach der Lese wurde in jedem Jahr ein köstlicher Wein auf den Markt gebracht. Doch es gab einen Wermutstropfen, der die Stimmung in jenem verhängnisvollen Jahr trübte. Es war die Reblaus, die urplötzlich große Mengen der Weinstöcke vernichtete. Und es kam so, wie sie es niemals dachte – es konnten nicht mehr so viele Flaschen wie in den vorherigen Jahren auf den Markt gebracht werden. Das bedeutete, dass nicht mehr alle Kunden zufrieden gestellt werden konnten. Sie sprangen ab. Und viel zu schnell sprach sich das Debakel herum. Beinahe 70 Prozent aller Kunden kündigte ihre Verträge. Christin konnte das einerseits zwar verstehen, doch anderseits hatte sie geglaubt, die alten Freunde hielten noch zu ihrer Familie. Leider blieben auch sie dem Weingut fern. Und so dachte Christin bereits über den immer näher rückenden Konkurs nach. Eines Tages dann das nicht mehr abwendbare Desaster – das Weingut war bankrott! Und als ob das noch nicht das Schlimmste sei, hatte sich wegen der Neuinvestitionen ein kapitaler Schuldenberg angehäuft. Christin wusste keinen Ausweg mehr. Der Konkursverwalter sprach nicht mehr nur von Entlassungen und vom Verkauf des Weingutes. Nein, er wollte nun auch an das Elternhaus, welches sich so friedlich und harmonisch an die Weinberge schmiegte. Das konnte Christin unmöglich zulassen. Aber was sollte sie nur tun? Abend für Abend saß sie mit ihrem treuesten und besten Freund, dem verständnisvollen Arbeiter Jo im Weinkeller beim Heurigen. Sie mochte ihn wirklich sehr und er hatte nicht nur Augen für Christin übrig. Doch er schwieg und ließ sich nichts anmerken. Nur sein Herz, das sprang ihm bald vor Trauer aus der Brust, als er seine geliebte Christin so leiden sehen musste. Irgendwie hofften ja beide, dass ihnen vielleicht beim köstlichen Wein etwas einfiel. Doch die Flaschen leerten sich und die Köpfe waren es auch. Keine Idee, keine Hoffnung, keine Aussicht. Es war sehr kühl hier unten und so brachte Jo zu jedem Treffen einen Kerzenleuchter mit nach unten, damit es ihnen etwas wärmer und gemütlicher zumute war. Als Jo die Kerzen entzündete, wärmten sich die beiden ihre kalten Hände an den kleinen Flämmchen. Doch am Abend vor der Zwangsversteigerung geschah etwas Seltsames. Wieder saßen sie zusammen beim Wein und sannen nach einem Ausweg. Das Personal war bereits entlassen und die letzten Fässer würden am folgenden Tag unter den Hammer kommen. Da hieß es nur: trinken, was das Zeug hielt! Die Kerzen verbreiteten ein angenehm warmes Licht und die Christin konnte ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Jo traute sich etwas näher an Christin heran und drückte sie ganz fest an sein Herz. Plötzlich fuhr ein kaum wahrnehmbarer Luftzug durch den Keller. Die Kerzen flackerten ein wenig. Jo, dem das aufgefallen war, rüttelte die noch immer weinende Christin ganz sachte. „Schau mal, woher kommt denn der Wind? Alle Türen sind dicht und Fenster gibt’s hier keine.“ Christin schaute zuerst zu Jo und dann auf die Kerzen. Da, wieder bewegte ein unmerklicher Luftzug die Flamme der Kerzen. Christin wischte sich die Tränen aus ihrem Gesicht. „Tatsächlich“, sagte sie dann leise, „wie kann das nur sein? Da muss doch irgendwo eine Öffnung sein, oder?“ Jo nickte verlegen. Die beiden erhoben sich und gingen die lange Reihe der Weinfässer entlang. Doch nirgendwo gab es auch nur einen einzigen Hinweis auf eine Öffnung oder einen Spalt in der Mauer oder in der Decke. Am Ende des endlos lang gezogenen Kellers wollten sie wieder umkehren. Da bemerkte Jo, dass sich eine der Steinfliesen unter ihren Füßen bewegte. Mehrmals trat Jo auf sie und rüttelte mit seinem Fuß an ihr. Die Fliese schien nicht fest auf dem Boden zu liegen. Er bückte sich und konnte tatsächlich die Fliese vom Fußboden nehmen. Christin fand das mehr als merkwürdig. Zusammen rüttelten sie an den umliegenden Fliesen. Es handelte sich wahrhaftig nicht um die einzige Fliese, die locker war. Gemeinsam hoben sie die lockeren Fliesen vom Boden auf. Sie gaben schließlich die Sicht auf eine Stein-Tür, die in den Boden eingelassen war, frei. Sie war rund und an deren Rand befand sich eine Einkerbung. Vermutlich konnte man die Tür dort öffnen. Doch so sehr sie sich auch mühten, sie bekamen die Tür nicht auf. Sie schien fest mit dem Boden verwurzelt zu sein. Ratlos setzten sich die beiden an den Rand der Tür. Aus einer Werkzeugkiste, die in einer Ecke herumstand, holte Jo ein Stemmeisen. Doch auch damit ließ sich die Tür nicht bewegen. Christin schaute auf die zahlreichen Weinfässer. Sollte all die viele jahrzehntelange Arbeit, die Arbeit ihres Vaters, ja ihrer gesamten Familie umsonst gewesen sein? Gedankenlos las einen der Sprüche, die auf dem Fass vor ihr eingebrannt war und hatte dabei schon wieder Tränen in den Augen. Doch welch Wunder, ein seltsames Vibrieren ließ den Keller erzittern. Die beiden glaubten schon an ein Erdbeben. Aber es war kein Beben. Es war die Stein-Tür, die sich rumpelnd und ganz langsam zur Seite bewegte. Christin und Jo konnten es nicht fassen. Sollte tatsächlich der Spruch bewirkt haben, dass sich die Tür öffnete? Fassungslos starrten die beiden auf das rätselhafte Geschehen. Als die Tür vollständig zur Seite geschwenkt war, gab sie den Blick in einen pechschwarzen Tunnel frei. Was verbarg sich dort? Was befand sich hinter dieser Tür? Nie hatte ihr der Vater oder die Mutter etwas von dem Tunnel berichtet. Sollten sie jetzt dort hinein gehen? Jo fasste sich als erster: „Komm Christin, wir gehen rein! Was haben schon zu verlieren? Der Weinberg ist doch sowieso verloren.“ Christin musste ihm zustimmen und war mit seinem Vorschlag einverstanden. Sie standen auf und kletterten in den Tunnel hinein. Nachdem sie in dem schwarzen Höllenschlund verschwunden waren, schloss sich die Tür über ihnen wieder. Erschrocken sahen sie mit an, wie sich das Tor zur Freiheit verschloss. Wie sollten sie hier je wieder herauskommen? Sie wussten es nicht, schienen in dem schwarzen Loch gefangen zu sein. Doch plötzlich vibrierte es erneut! Der schwarze Schlund verwandelte sich in einen hellen Kellerraum. Wie war das nur möglich? Wo kam das Licht so plötzlich her? Überall an den felsigen Wänden hingen Bilder und inmitten des Raumes stand ein Tisch mit einem riesigen goldenen Kerzenleuchter. Die langen goldfarbenen Kerzen verbreiteten dieses wohlig warme Licht. Die beiden trauten ihren Augen nicht. Wer lebte hier unten? Als hätte jemand diese Frage gehört verfärbte sich plötzlich die Felswand und ein alter Mann in einem schwarzen Umhang stand vor ihnen. Christin starrte wie gebannt auf diesen Zauber. Sie konnte nicht glauben, was sie da sah. Vor ihr stand ihr verstorbener Vater! Auch Jo musste sich an den schroffen Felswänden festhalten. War so etwas überhaupt möglich? All das grenzte an Magie, an Zauberei. Oder hatten sie nur zu viel Wein getrunken? War das schon das Delirium? Nein! Denn auf einmal sprach der Mann zu ihnen: „Christin, wie schön, dass Du gekommen bist. Meine geliebte Tochter. Nun weiß ich, dass Du endlich jemanden gefunden hast, der Dich liebt. Möge ewiges Glück Euch beiden zuteilwerden. Der Zauber ist damit ausgelöscht. Und es wird wieder Wein geben, Wein in unseren Weinbergen!“ Der Mann verschwand und Christin stand noch immer weinend vor der fahl schimmernden Felswand. Von welchem Fluch hatte da ihr Vater gesprochen? Und warum machte sich ihr eigener Vater über ihr Unglück lustig? Fassungslos hielt sie sich ihre Hände vors Gesicht. Jo kam näher und streichelte Christin über ihre langen schwarzen Haare. Dann meinte er nur: „So sei es. Lass uns zurückgehen.“ Und als ob auch dieser Satz gehört wurde, schob sich die Felsentür beiseite und die beiden kletterten aus dem Loch in den Weinkeller zurück. Die Tür verschloss sich und selbst die Einkerbung, sowie ihre Umrisse verschwanden vor ihren Augen. Nichts deutete mehr darauf hin, dass hier jemals eine Tür gewesen sei. Noch immer unter dem Einfluss des soeben Erlebten stehend schauten sich die beiden lange in die Augen. Hatten sie das alles vielleicht doch nur geträumt? Da vernahmen sie laute Stimmen. Es hörte sich an wie Geschrei, Jubelgeschrei! Das musste von draußen kommen. Die Tür zum Weinkeller wurde aufgerissen und zwei Weinbauern, die Christin bis zuletzt die Treue hielten, stürmten herein: „Hallo Christin! Du glaubst ja gar nicht, was draußen geschehen ist.“ Christin schaute die beiden misstrauisch an. Was sollte das? Wollten sie nun auch noch die beiden Mitarbeiter verkohlen? „Komm mit raus“, riefen sie, „und überzeuge Dich selbst! Und Du auch Jo, kommt mit raus!“ Die vier liefen aus dem Weinkeller und standen plötzlich inmitten herrlicher Weinstöcke. Alle überreif und voller gesunder Trauben. Auch die Nacht war vorüber und die Sonne schien vom Himmel als sei nichts geschehen. Kein Zweifel, das musste ein Wunder sein. Dicke Tränen rannen Christin über die rosigen Wangen. Aber es waren Tränen der Freude und der Dankbarkeit. Der Weinberg und das gesamte Weingut schienen gerettet. Der Insolvenzverwalter musste einsehen, dass er hier nichts mehr zu tun hatte. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Kunde von dem Wunder im Weinberg. Auch die Hausbank gab Christin wieder Kredit. Schnellstens stellte sie das gesamte ehemalige Personal wieder ein und das Weingut schrieb fortan nur noch schwarze Zahlen. Jo aber, der sich schon vor vielen Jahren heimlich in Christin verliebt hatte, heiratete sie endlich. Die beiden wurden ein glückliches Paar und bekamen drei Söhne. Und noch heute sitzen die beiden abends zusammen im Weinkeller und sprechen über die wundersamen Erlebnisse, die ihnen widerfuhren. Der Fluch, von dem der Vater sprach, war ein altes Zitat aus einem keltischen Kalender. Darin wurde dem Weinberg vorausgesagt, dass dieser mit der ersten Tochter, die keinen Mann, der sie ehrlich liebte nach Hause bringt, verderben solle. Als Christin zusammen mit Jo in den Tunnel vordrang, ihr dort ihr eigener Vater erschien, wurde dieser Fluch für immer beseitigt. Denn es war Liebe in allen Herzen. Und die Heirat besiegelte letztlich nur noch das Ende des Fluches. Er hatte fortan keine Macht mehr über das Gut. Und noch heute wacht der Geist des Vaters über dem Weinberg. Manchmal glaubt Christin seine Stimme zu hören, die leise sagt: „Nun weiß ich, dass Du endlich jemanden gefunden hast, der Dich liebt. Möge ewiges Glück Euch beiden zuteilwerden.“
Sonderbare Telefonzelle
Gerade hatte ich mir ein neues Handy gekauft. Stolz telefonierte ich mit sämtlichen Bekannten und war stundenlang damit beschäftigt, das neue Wunderwerk meinen Bedürfnissen anzupassen. Ich lud mir die verrücktesten Klingeltöne herunter und hörte damit immer und überall meine Musik. Als ich Tage später in den Urlaub fuhr, geschah genau das, womit ich nicht gerechnet hatte. Irgendwo draußen, zwischen zwei riesigen Feldern blieb der Wagen stehen und bewegte sich keinen Meter mehr vorwärts. Fluchend schlug ich auf das Lenkrad ein. Doch alles Schimpfen nutze nichts, der Wagen funktionierte nicht mehr und musste wohl abgeschleppt werden! Genervt griff ich nach meinem nagelneuen Handy und wollte den Abschleppdienst anrufen. Doch ich konnte es nicht glauben, es ließ sich einfach nicht einschalten. Mir fiel ein, dass ich am gestrigen Abend noch stundenlang daran herumgestellt hatte. Vermutlich war der Akku leer. Voller Wut warf ich es auf den Beifahrersitz. Zu allem Unglück begann es auch noch zu regnen. Aber es half nichts, ich musste aussteigen, um Hilfe zu holen. Vielleicht gab es in der Nähe eine Siedlung oder ein bewohntes Haus. Ich stieg aus, zog mir die Jacke über den Kopf und lief los. Zu meinem Glück entdeckte ich an einer Trafostation eine alte Telefonzelle. Entschlossen ging ich hinein. Doch auch dort funktionierte nichts. Das Telefon war, wie ich es mir bereits dachte, tot. Gerade wollte ich die Telefonzelle wieder verlassen, da hielt ein klappriger Lieferwagen und drei maskierte Männer sprangen heraus. Ich wollte wegrennen, doch zum Fliehen war es bereits zu spät. Die Männer rissen die Tür auf und brüllten: „Los, Geld raus, her mit den Wertsachen!“ Mir rutschte das Herz in die Hose. Entsetzt starrte ich die Männer an und zog umständlich meine Geldbörse aus der Hosentasche. Plötzlich geschah etwas Merkwürdiges. Einer der Gauner griff schon nach der Börse, die ich ihm entgegenhielt, da knarrte und quietschte die Tür der Telefonzelle und schlug unvermittelt und laut zu. Ich konnte gerade noch rechtzeitig meine Hand zurückziehen. Die Gauner aber gaben nicht auf. Sie versuchten mit aller Kraft, die Tür wieder zu öffnen. Doch es ging nicht. Aus irgendeinem Grund ließ sich die Tür nicht mehr öffnen. Abwechselnd schlugen die drei gegen die Scheiben, traten heftig mit ihren Springerstiefeln dagegen. Aber die Tür rührte sich nicht. Nun griffen sie zu härteren Mitteln. Eifrig beschäftigten sie sich damit, große Steine in der Umgebung zusammen zu suchen. Ich ahnte, was sie damit vorhatten. Meine Befürchtungen wurden bittere Realität. Mit aller Kraft schleuderten sie die Brocken gegen die Verglasung der Zelle. Schon bildeten sich lange Risse und ich sah mich bereits leblos am Boden liegen. Da knackte und knirschte es in den Scheiben und sämtliche Risse verschwanden. Die Telefonzelle schien sich selbst zu regenerieren. Innerhalb von wenigen Sekunden waren die Scheiben wieder vollkommen in Ordnung. Den drei Gaunern, die jene seltsamen Geschehnisse ebenfalls verfolgt hatten, stand das blanke Entsetzen ins Gesicht geschrieben. Auch sie konnten nicht glauben, was sie da sahen. Schnellstens sprangen sie in ihren Wagen zurück und verschwanden. Es dauerte nicht lange, da erschien ein Streifenwagen der Polizei. Die Beamten erkundigten sich, ob ich drei junge Männer in einem alten Lieferwagen gesehen hätte. Noch immer unter Schock stehend schilderte ich ihnen die furchtbaren Geschehnisse. Mein seltsames Erlebnis mit der Telefonzelle aber verschwieg ich. Vor lauter Schreck vergaß ich, die Beamten um Hilfe wegen meines liegen gebliebenen Wagens zu bitten. Erst als sie wieder abgefahren waren, fiel es mir wieder ein. Jedoch kam ich nicht dazu, mich endlosen Selbstvorwürfen hinzugeben. Ich traute meinen Augen nicht, die drei Gauner, die ich schon weit entfernt glaubte, kehrten zurück. Doch diesmal wollte ich mich nicht von den dreien bedrohen lassen. Schnell versteckte ich mich hinter einem Busch neben dem Trafohäuschen. Die drei hielten tatsächlich an und stiegen aus. Schließlich untersuchten sie die Telefonzelle. Dabei gingen sie äußerst rabiat vor. Sie zerfetzten die herum liegenden Telefonbücher und schlugen wie wild auf den Telefonapparat ein. Vermutlich erhofften sie sich auf diese Weise an das Geld im Inneren heran zu kommen.