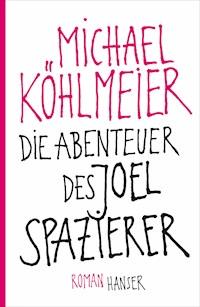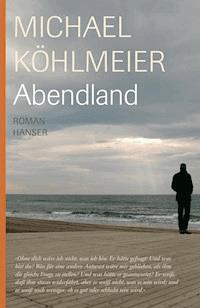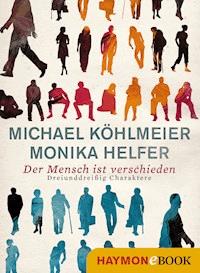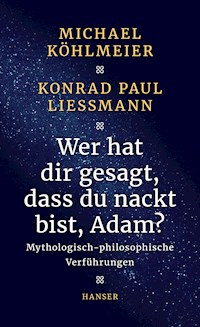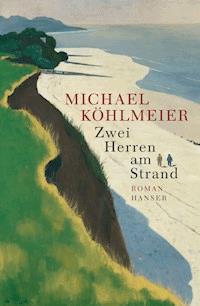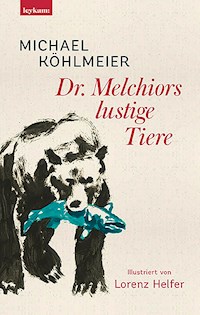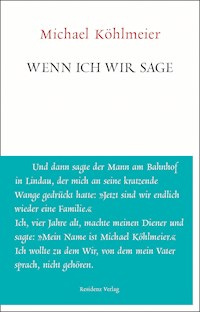16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Benevento
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Berühmte Ikonen unserer Zeit: tollkühn, mutig oder aufopferungsvoll – auf jeden Fall außergewöhnlich! Es gibt wahre Lebensgeschichten, die klingen, als wären sie erfunden: Der Autor Michael Köhlmeier hat sie aufgespürt und ein buntes Panoptikum herausragender Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen des Lebens zusammengestellt. Seine modernen Heldensagen sind faktentreu, aber literarisch frei formuliert. Von Genie und Wahnsinn, von Lebenslügen und Sternstunden: Es sind Geschichten, die Sie in den Bann ziehen werden. - 30 biografische Geschichten von Erfolgsautor Michael Köhlmeier - Berühmte Männer und Frauen im Porträt: Was macht sie so außergewöhnlich? - Lebenswege: Wendepunkte, schicksalhafte Fügungen und Sternstunden berühmter Personen - Eine Anthologie über Stil-Ikonen aus Kunst und Kultur sowie Legenden aus Musik, Sport, Wissenschaft und mehr - Großes Lesevergnügen: Ein modernes Heldensagen-Buch für unsere Zeit Moderne Helden: von Sportgrößen, Musiklegenden, Schach-Giganten und Glamour-Stars Mit gekonnter Leichtigkeit erzählt Michael Köhlmeier in seinem Buch von der berühmten schwarzen Sportlerin Wilma Rudolph, die trotz Kinderlähmung zur Weltrekord-Läuferin wurde. Er porträtiert den jungen Arzt Ignaz Semmelweis, der die Geburtshilfe sicherer machte und damit unzähligen Müttern das Leben rettete. Dem Entfesselungskünstler Houdini begegnen die Leser:innen ebenso wie der faszinierenden Mata Hari oder Marilyn Monroe. Die kurzen – und kurzweiligen – Geschichten bringen uns das Leben berühmter Künstlerinnen und Künstler näher und gewähren einen Blick hinter die Kulissen. Diese Anthologie über moderne Helden bietet eine reiche Auswahl an unterschiedlichen Biografien. Ein kurzweiliges und aufschlussreiches Buch, das beste Unterhaltung verspricht: Welche Geschichte Ihnen wohl am meisten gefallen wird?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
MICHAEL KÖHLMEIER
BOULEVARD DER HELDEN
30 moderne Legenden
Sämtliche Angaben in diesem Werk erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung der Autoren bzw. Herausgeber und des Verlages ist ausgeschlossen.
1. Auflage
© 2023 Benevento Verlag bei Benevento Publishing Salzburg – München, einer Marke der Red Bull Media House GmbH, Wals bei Salzburg
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen sowie der Übersetzung, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Medieninhaber, Verleger und Herausgeber:
Red Bull Media House GmbH
Oberst-Lepperdinger-Straße 11–15
5071 Wals bei Salzburg, Österreich
Satz: MEDIA DESIGN: RIZNER.AT
Gesetzt aus der Palatino, Futura MdCn BT, Univers LT Std
Umschlaggestaltung und Satzdesign: www.b3k-design.de,
Andrea Schneider & diceindustries
Printed by CPI Books GmbH, Deutschland
ISBN 978-3-7109-0166-9
eISBN 978-3-7109-5154-1
INHALT
Wilma Rudolph – Die schwarze Gazelle
Ignaz Semmelweis – Der Retter der Mütter
Max Schmeling – Der gütige Riese
Thelonious Monk – Hinter Gittern
Abebe Bikila – Eine afrikanische Ikone
Truganini – Die Überlebende
Toni Innauer – Flug für die Ewigkeit
Victor Lustig – Eiffelturm for sale
John Glenn – Vom größten Schmerz
Harry Houdini – Der Entfesslungskünstler
Bob Dylan und Bobby Fischer – Königsschach
Mata Hari – Triumph der Einbildungskraft
Egon Zimmermann – Das Pech des Siegers
Michail Scholochow – Das Versprechen
Yvonne Louise Stolz – Der Einzi-Fall
Erika Fuchs – Dem Ingeniör ist nichts zu schwör
Sequoyah – Der die Welt erfand
Jane Goodall, Dian Fossey, Birutė Galdikas – Die Träume der Affen
Reinhold Bilgeri – Der stärkste Mann der Welt
Rudi Dutschke – Liebet eure Feinde
Ella Fitzgerald und Norman Granz – Das Glück des Lebens
Clärenore Stinnes – Einmal um die Welt
Juliette Gréco – Die Muse
Lise Meitner – Die heilige Rationalität
Alan Lomax – Der Mann, der den Rock entdeckte
Humphrey Bogart – Der Held schlechthin
Django Reinhardt – Die unendliche Leichtigkeit des Spiels
Beate Uhse – Mutter Courage des Tabubruchs
Marilyn Monroe – Die Zerrissene
Alice Augusta Ball – Die Heldin als Heilige
01
WILMA RUDOLPH
DIE SCHWARZE GAZELLE
Es dürfte schwer sein, in Clarksville, Tennessee, jemanden zu finden, der nicht weiß, wer Wilma Rudolph war – aber nicht ganz so leicht, jemanden, der sie persönlich gekannt hat. Ich traf Irene Temple bei Starbucks am Ford Campbell Boulevard, eine kleine, sportliche Frau in einem dunkelvioletten Trainingsanzug, ich schätzte sie auf Mitte fünfzig, kurzes krauses Haar, an den Schläfen grau. Sie ist die Nichte von Ed Temple, der Wilma Rudolph in den Fünfzigerjahren trainierte, nachdem er sie der Basketballtruppe der Tigerbelles abgeworben hatte. Ed Temple war der Coach der Leichtathleten am Tennessee State College, der lange Zeit einzigen staatlichen Hochschule für Afroamerikaner in den USA. Ihr Onkel Ed, so erzählte mir Irene, habe die zwölfjährige Wilma gesehen, wie sie, den Ball in beiden Händen haltend, rund um das Spielfeld gelaufen sei, so schnell, dass ihr keine aus dem Team ihrer Gegnerinnen folgen konnte. Der Basketballtrainer habe sie ausgeschimpft, man dürfe den Ball nicht so lange in Händen halten, das sei gegen die Regeln, sie müsse entweder abgeben oder auftippen. Mr. Temple saß auf der leeren Zuschauertribüne und hörte und schaute zu.
»Mein Onkel«, erzählte mir Irene bei Starbucks, »gab später zu, er habe gehofft, der Trainer schimpft Wilma ordentlich aus, so ordentlich, dass sie zurückschimpft, er solle sie am Arsch lecken oder so. Der Umgangston unter den Sportlerinnen war nicht weniger grob als unter den Männern, das ist bis heute so, das können Sie mir glauben, dagegen sind die Männer schon direkt höflich. Aber Wilma, so hat mir mein Onkel erzählt, hat nur ruhig zugehört und am Ende hat sie gesagt: Ich kann nicht abgeben, weil alle anderen hinter mir sind, wenn ich laufe, und ich kann auch nicht auftippen, weil der Ball viel langsamer ist als ich. Diesen Satz hat sich mein Onkel sein Leben lang gemerkt und sicher hundertmal in irgendein Mikrofon hineingesagt. Jedenfalls, nach dieser Szene hat er mit dem Trainer geredet und zu ihm gesagt: He, das hat doch keinen Sinn, die lernt es nie, gib sie mir. Und so war das dann. Wilma ist zu den Sprinterinnen gewechselt. Sie selber hat gesagt, also das hat sie gesagt, das sage nicht ich, sie hat gesagt: Ich bin zwar immer allen davongelaufen, aber den Ball habe ich nie in den Korb gekriegt. Beim Hundertmeterlauf gibt es keinen Ball. Ich sage, gut, dass sie keinen Ball in den Korb gekriegt hat, sonst wäre sie vielleicht keine Sprinterin geworden.«
Wilma Rudolph wurde am 23. Juni 1940 geboren, in den Sechzigerjahren war sie der größte weibliche Leichtathletikstar der Welt. Bei den Olympischen Spielen in Rom 1960 gewann sie den 200-Meter-Lauf, den 100-Meter-Lauf und zusammen mit Martha Hudson, Lucinda Williams und Barbara Jones die 4-mal-100-Meter-Staffel. In den Einzeldisziplinen lag sie um mehrere Zehntelsekunden vor der jeweils Zweiten.
Ich hatte mit Irene Temple telefoniert und ihr gesagt, dass ich über Wilma Rudolph schreiben möchte; schon eine halbe Stunde später saß sie mir gegenüber. Sie hatte drei Alben mitgebracht, in denen nur Dokumente über Wilma Rudolph eingeklebt waren, Zeitungsausschnitte, Zeitungsfotos, aber auch Originalfotos, eines, das sie zusammen mit Buford Ellington zeigt, dem damaligen Gouverneur von Tennessee, eines zusammen mit Richard Nixon, dem damaligen Vizepräsidenten und späteren Präsidenten der Vereinigten Staaten, viele Fotos, die ihr Onkel gemacht hatte – oder Irene selbst, später, als Wilma nicht mehr aktiv war, aber immer noch eine enge Freundin der Familie.
»Und eine enge Freundin von mir«, sagte Irene. »Ich war ja noch ein Kind, aber ich war ihr Liebling. Ich habe sie bewundert, und sie hat zu mir gesagt, das soll ich nicht, ich soll einfach nur ihre Freundin sein. Aber ich habe sie trotzdem bewundert. Dass sie jeder in der ganzen Welt kannte, das war es gar nicht, das wusste ich. Ja, aber ich war sechs Jahre alt, da kann man sich die ganze Welt nicht vorstellen. Meine Mama hat mir irgendwann erzählt, wie Wilma als Kind gewesen war und was sie gelitten hat, das war eine so traurige Geschichte, dass ich meinte, es sei doch eigentlich ein Märchen oder ein Film, ich habe sehr geweint.«
Tatsächlich ist es wie im Märchen. Oder wie im Film. Ausgerechnet im Jahr 1994, dem Jahr, als Wilma Rudolph starb, kam der Film Forrest Gump in die Kinos. Darin spielt Tom Hanks einen Mann, der als Kind an Kinderlähmung litt, nur mit Stützapparaten gehen konnte und schließlich zum schnellsten Läufer wurde. Eric Roth, der Drehbuchautor, soll gesagt haben, der ganze Film sei eine Hommage an Wilma Rudolph. Wilma war im Alter von fünf Jahren an Kinderlähmung erkrankt, ihr linkes Bein musste geschient werden, der Arzt gab der Familie nur wenig Hoffnung, dass sie je normal würde gehen können. Hinken werde sie immer, sagte er, das sei das Wenigste. Wilma wuchs in einer sehr großen Familie auf. Zusammen mit ihren Halbgeschwistern waren sie achtzehn Kinder.
Irene Temple: »Wilma hat oft gelacht und gesagt, der Vater habe nie, ohne länger zu überlegen, die Namen von allen seinen Kindern zusammengebracht.«
Eine ihrer Schwestern – »Ich glaube, sie hieß Mary oder Marylou«, sagte Irene – hat sich um Wilma gekümmert. Sie hat ihr Beim massiert, hat mit ihr Übungen gemacht, die sie sich selbst ausdachte, und sie hat nicht aufgegeben, bis Wilma normal gehen konnte wie jedes andere Mädchen auch. Keine Spur von Hinken.
Irene Temple: »Ich habe Wilma gefragt, ob sie denn gar nichts mehr spürt von ihrer Kinderlähmung. Was denken Sie, hat sie gesagt?«
»Dass sie nichts mehr spürt?«
»Das würde man denken, ja.«
»Aber das stimmt nicht?«
»Nein, das stimmt nicht. Sie hat gesagt, dass sie nicht eine Minute ihres Lebens nicht diesen feinen Schmerz im linken Bein spürt. Meistens fein, manchmal heftig, manchmal sehr heftig. Nicht eine Minute nicht.«
»Auch nicht, wenn sie gelaufen ist?«
»Dann nicht. Das ist ja das Wunderbare. Aber länger als 23 Sekunden ist sie nie gelaufen. Ihr Weltrekord auf 200 Meter war 22,9 Sekunden. Sie läuft und hat keinen Schmerz, und dann geht sie von der Aschenbahn in die Kabine, und da ist er wieder.«
Irene zeigte mir in einem Album das Bild, auf dem Wilma 1961 im Madison Square Garden durchs Ziel läuft. Und dann das Bild von Rom ein Jahr zuvor. Typisch für sie: den Kopf weit im Nacken, lächelnd.
»Sie werden kein Foto von ihr finden, ich meine, kein Foto, das sie zeigt, wie sie läuft, auf dem sie nicht lächelt«, sagte Irene. »Ich denke mir, sie lächelt, weil sie keine Schmerzen hat. Aber vielleicht stimmt das gar nicht. Sie hat immer gelächelt. Jedenfalls immer, wenn ich mit ihr zusammen war.«
»Weil Sie ihr Liebling waren.«
»Ja, das war ich.«
Unter den Schwarzen in Clarksville wird Wilma Rudolph bis heute wie eine Heilige verehrt. Und das hat gar nicht eigentlich mit ihren Erfolgen zu tun. Auch, natürlich. Es hat in der Geschichte des Sports in den USA viele schwarze Athleten gegeben, die ebenso große Erfolge hatten – Jesse Owens, Olympiasieger in den drei Sprinterkategorien und im Weitsprung in Berlin 1936, oder Bob Beamon, legendärer Weitsprungweltrekordler in Mexiko 1968, oder Carl Lewis, Sprinter und Weitspringer, oder Florence Griffith-Joyner, Sprinterin, übrigens eine Schülerin von Wilma Rudolph – sie alle wurden verehrt, aber doch nicht wie eine Heilige.
Als Wilma Rudolph nach ihren sensationellen Siegen aus Rom nach Hause zurückkehrte, wollte der Gouverneur, der bereits erwähnte Buford Ellington, ihr einen rauschenden Empfang bereiten, ein Fest, wie es Clarksville noch nie erlebt hatte. Und eben doch ein Fest wie alle anderen Feste. Nämlich ein Fest, zu dem nur Weiße eingeladen waren – berühmte Weiße, bis hinauf zum Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten, Richard Nixon. Alle waren da. Alle warteten in dem großen Zirkuszelt am Rand der Stadt. Clarksville verfügte über keinen Saal, in dem alle Platz gehabt hätten, die bei diesem Fest unbedingt dabei sein wollten. Sie warteten. Sie warteten auf den Star. Auf Wilma Rudolph.
Irene Temple: »Mein Onkel war mit Wilma in seinem Dodge zum Zelt gefahren. Wilma wusste, dass er nicht hineindurfte. Eben weil er schwarz war. Ihm machte das nichts aus. Er war das gewöhnt. Sein Bruder war Musiker. Ich habe Onkel Willie nicht gekannt, er soll ein ausgezeichneter Jazzmusiker gewesen sein, Posaune, er hat mit Count Basie gespielt und angeblich auch mit Lester Young, aber in die Lokale, in denen er auf der Bühne stand, in die durfte er selber nicht hinein, nur auf die Bühne, unten hat er nicht einmal ein Bier bekommen. Meinem Onkel war das egal, ob er ins Zelt durfte oder nicht, die Familie hat ja auch gefeiert hinterher, das genügte ihm. Aber Wilma war es nicht egal. Sie ist im Auto sitzen geblieben. Sie müssen sich das so vorstellen: Da steht das Zelt, ein Riesenzelt, ein Zirkuszelt, das der Gouverneur irgendwo ausgeliehen hat, das steht mitten in der Wiese, und die Autos der Gäste stehen davor, und rundherum stehen die Schwarzen, draußen, das waren tausend Leute, sage ich Ihnen, die stehen da und wollen Wilma zujubeln, sie wollen ihr einfach nur zujubeln. Aber Wilma steigt nicht aus. Ich muss ja lachen, wenn ich dran denke! Mein Onkel, der hat Blut geschwitzt, wie man so sagt, der hat sich neben seinen Dodge hingekniet und hat gebettelt. Bitte, bitte, Wilma, der Vizepräsident! Aber Wilma hat gesagt: Geh hinein, Ed, geh, geh zum Vizepräsidenten und sag ihm, ich komme, aber ich komme nur zusammen mit den schwarzen Leuten. Wenn das nicht geht, dann geht es eben nicht. Dann müssen sie ohne mich feiern. Also ich sage Ihnen: Die Feier hätte um zwölf Uhr mittags beginnen sollen. Der Vizepräsident wollte nämlich die Nachmittagsmaschine nach Washington erreichen. Begonnen hat die Feier dann erst um zwei. Mein Onkel hat beim Eingang mit der Polizei verhandelt, er möchte den Gouverneur sprechen, sagte er, hinein durfte er ja nicht, weil schwarz. Nur eine Schwarze hätte hineingedurft, nämlich Wilma. Und dann kam der Gouverneur heraus. Ich stelle mir vor, auch er hat sich neben den Dodge von meinem Onkel hingekniet und hat Wilma angefleht, sie soll doch kommen. Der Vizepräsident! Und Wilma sagte, sie kommt, aber sie kommt nur zusammen mit den schwarzen Leuten. Ja, und dann sind die Regeln geändert worden. Und Wilma ist einmarschiert in das große Zelt – zusammen mit den schwarzen Leuten.«
Ich fragte Irene Temple, ob ich ein paar Seiten aus den Alben mit meinem Handy abfotografieren dürfte. Das erlaubte sie mir gern.
02
IGNAZ SEMMELWEIS
DER RETTER DER MÜTTER
In Bismarck, der Hauptstadt des US-Bundesstaates North Dakota, fand ich eine Apotheke, sie war untergebracht in einem unscheinbaren Plattenbau mit aufgeklebten Klinkern, angebaut an einen Supermarkt, nicht weit von der Corpus Christi Catholic Church. Über dem Eingang stand in roten Großbuchstaben: SEMMELWEIS PHARMACY. Ich wollte mich für meine Reise mit Aspirin und Kohletabletten versorgen, öffnete die Tür – und meinte, mit dem Übertreten der Schwelle die Welt gewechselt zu haben. Als wäre ich in Wien gelandet oder in einer verschlafenen deutschen Kleinstadt. So würde ein Regisseur eine Apotheke ausstatten für einen Film, der um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert spielte. Der Boden war mit Fliesen in Schachbrettform belegt, der Tür gegenüber zog sich eine breite Theke aus Kirschholz über die Länge des Raumes, ihre Ecken markierten geschnitzte Äskulapköpfe. Die Tischplatte war aus trüb geschliffenem Glas. In die Wände an drei Seiten des Raumes waren bis in eine Höhe von vier Metern schmale Regale eingelassen, ebenfalls aus rötlichem Kirschholz, an jedem ein zierliches Schildchen. Zwei Leitern hingen in Schienen. Überall standen Töpfe aus dunkelbraunem Glas, sorgsam mit weißen Lettern beschriftet, steinerne Mörser, alle möglichen Tiegel in verschiedenen Größen, Apothekerwaagen und anderes Gerät aus Messing. Besonders aber fiel mir das steinerne Becken auf, das rechts neben dem Eingang stand und aus dessen Mitte eine Wasserfontäne einen halben Meter in die Höhe hüpfte. Ich war so überrascht von dem, was ich sah, dass ich »Du meine Güte, das gibt’s doch nicht!« ausrief. Woraufhin der Herr hinter der Theke ebenfalls ausrief: »Sie sprechen ja Deutsch!«
So lernte ich das Ehepaar Jeff und Rita Conner kennen, zwei Pharmazeuten und die freundlichsten Menschen, die ich auf meiner Amerikareise getroffen habe. Das war im Jahr 1996 gewesen, Jeff war schon an die siebzig Jahre alt, Rita knapp jünger. Beide sprachen nur wenige Worte Deutsch, die hatten sie sich, wie sie sagten, »aufbewahrt in Erinnerung an unsere Vorfahren«, die um die Jahrhundertwende aus Deutschland nach North Dakota ausgewandert waren. Aus Coburg in Franken waren diese ausgewandert, und da hatten wir auch schon etwas Gemeinsames, denn aus Coburg stammte auch meine Mutter. Das genügte: Jeff und Rita luden mich zum Abendessen ein. Ihre Wohnung lag über der Apotheke. Später kam ihr Sohn dazu, ebenfalls Pharmazeut, und gemeinsam erzählten sie mir die Geschichte ihrer Familie.
Und diese Geschichte, als wäre er der Gründer derselben, hatte mit Ignaz Semmelweis zu tun, dem zu Ehren sie ihre Apotheke benannt hatten.
Vor nicht ganz hundertfünfzig Jahren nämlich hatte Dr. Semmelweis einer gewissen Charlotte Könner das Leben gerettet. Charlotte Könner war die Ururgroßmutter von Jeff Conner gewesen. Sie hatte in Wien gelebt, war damals eine Frau von dreißig Jahren, ein Dienstmädchen bei reichen Leuten, unverheiratet, und dann war sie schwanger geworden. Ledige Schwangere waren nicht anders als heute keine Seltenheit, in den feineren Kreisen sprach man nicht darüber, bei einem Dienstmädchen kümmerte sich keiner darum. Im Fall der Charlotte kam pikanterweise dazu, dass sie von ihrem Cousin schwanger war, der im gleichen Haus als Gärtner arbeitete und oben unter dem Dach sein Zimmer hatte, gleich neben ihrem. Die Herrschaften wollten Charlotte, als es so weit war, in die Gebärklinik von Professor Klein bringen, einem Freund des Hausherrn. Dieses Spital war in Wien berüchtigt, auch ein unbedarftes Dienstmädchen, das kaum lesen und schreiben konnte, hatte davon schon erfahren.
Dort, so hieß es, wüte seit neuestem ein Teufel, fünfzehn von hundert Wöchnerinnen nehme er mit und ihre Kinder dazu, das sei sein Pfand. Charlotte flehte den Hausherrn an, er solle doch erlauben, dass sie oben in ihrem Dachzimmer entbinden dürfe, in der Not allein, wenn nicht erlaubt werde, dass eine Hebamme das Haus betrete. Charlotte habe sich vor ihre Dienstherrin auf den Boden geworfen, habe geweint und gebeichtet, dass sie verbotenerweise einen Liebhaber zu sich gelassen habe und dass sie als Strafe jede Woche einen Tag unbezahlt arbeiten wolle. »Schicken Sie mich nicht zu dem Teufel!«, weinte sie.
Und auch Hermann, ihr Cousin, flehte, er kniete sich vor seinen Herrn nieder, bat, er möge seine Cousine verschonen. Nur er und Charlotte, jammerte er, seien aus ihrer Familie noch übrig, er habe seiner Tante an ihrem Totenbett versprochen, er werde auf sie aufpassen. Wie auch Charlotte verschwieg er, dass er jener Liebhaber war. Er fürchtete, dann werde sich der Herr auf gar keinen Fall umstimmen lassen. Es nützte nichts. Dienstherr und Hausherrin blieben konsequent. Es müsse neben allem anderen auch ein Exempel gegen den Aberglauben statuiert werden.
So wurde Charlotte Könner in die berüchtigte Gebärklinik gebracht. Und dort lernte sie den jungen Dr. Semmelweis kennen, und er rettete ihr Leben.
Ignaz Semmelweis war erst Anfang dreißig. Im Unterschied zu seinen Kollegen, die es für nicht allzu aufregend hielten, dass in Professor Kleins Klinik fünfzehn Prozent der Frauen am Kindbettfieber starben, bewegte ihn das Schicksal dieser Frauen sehr. Die meisten kamen aus der Unterschicht, waren hilflos und eingeschüchtert, keine empörte sich, niemand stand ihnen bei. Es war eine düstere Zeit. Die Freiheiten, die von den 1848er-Revolutionären verkündet worden waren, hatte das Metternich’sche System hinweggefegt. Die Gesellschaft begegnete allem Neuen – und zwar auf allen Gebieten – mit Skepsis und drastischer Ablehnung. Dr. Semmelweis interessierte sich nicht für Politik, aber er wollte und konnte nicht hinnehmen, dass Mütter starben, ohne dass sich auch nur einer der Ärzte fragte, warum das in solcher Auffälligkeit in diesem Spital geschah.
In diesem Krankenhaus wurden junge Ärzte seit einiger Zeit in Anatomie ausgebildet, und zwar nicht an Puppen aus Leder oder an aus Wachs nachgebauten Körpern wie an den Universitäten, sondern an Leichen. Professor Klein brüstete sich damit, dass bei ihm die Wissenschaft der Anatomie in einer Weise betrieben werde wie sonst nirgendwo in der Monarchie. Dr. Semmelweis sah sich die Statistiken an und stellte fest, dass die Sterblichkeit der Wöchnerinnen in der Zeit vor der neuen anatomischen Ausbildung wesentlich geringer gewesen war. Die Existenz von Bakterien und Viren war noch nicht bekannt. Dr. Semmelweis stellte also keine theoretischen Überlegungen an, er wollte lediglich empirisch untersuchen, ob ein Zusammenhang zwischen der Arbeit an Leichen und der Sterblichkeit der Wöchnerinnen bestehe. Er schlug vor, dass sich die Ärzte, wenn sie aus der Pathologie kamen, die Hände waschen, bevor sie den Frauen bei der Entbindung halfen. Er wurde ausgelacht. Und angefeindet. Die Herren Ärzte wollten sich nicht vom Jüngsten aus ihrem Kreis etwas vorschreiben lassen. Aber er gab nicht auf. Im Gegenteil. Er forderte nun sogar, dass die Hände nicht einfach mit Seife gewaschen, sondern mit Chlorkalk desinfziert werden sollten. Schließlich willigte Professor Klein ein und erlaubte das Experiment. Begrenzt auf einen Monat. Dann würden sich die Flausen des jungen Kollegen erledigt haben. Der Erfolg war sensationell. Die Todeszahlen in der Gebärklinik sanken umgehend gegen null.
Voll Stolz erzählten mir Jeff Conner und seine Frau Rita, dass dieser Erfolg auch und nicht nur zu einem kleinen Teil der Ururgroßmutter zu verdanken sei. In den Tagen, als Charlotte in die Klinik gebracht wurde, sei Dr. Semmelweis nämlich im Begriff gewesen, seinen Kampf gegen die Ignoranz seiner Kollegen aufzugeben. Er habe Charlotte später erzählt, gerade an dem Tag, als sie ihm vorgestellt worden sei, habe er sich entschlossen, die Klinik zu verlassen und nach Ungarn, woher er stammte, zurückzukehren. Er sei durch den Saal gegangen, in dem die Frauen lagen, ein letztes Mal, wie er dachte, da habe sie, Charlotte, ihn am Kittel festgehalten und nicht losgelassen.
»Bitte, lieber Herr Doktor«, hatte sie gefleht, »bitte, helfen Sie mir gegen den Teufel! Ich habe große Sünde auf mich geladen, und ich will nicht sterben, bevor ich gebüßt habe, und büßen kann ich doch nur, indem ich aus meinem Kind einen guten Menschen mache.«
Dr. Semmelweis setzte sich an ihr Bett, und sie beichtete ihm, dass sie Blutschande mit ihrem Cousin getrieben habe, aber dass sie und Hermann heiraten wollten, dass sie ihn so sehr liebe und er sie auch und dass Hermann bereits den Pfarrer gebeten habe, ein Wort für sie beide einzulegen, dass sie heiraten dürfen, beim Adel sei das ja auch möglich. So innig habe sie den Arzt gebeten, ihr zu helfen, er sei ihr Engel, habe sie gesagt, immer und immer, dass bald auch Dr. Semmelweis die Tränen aus den Augen gesprungen seien. Und da habe er sich aufgerafft und alle Kraft und Autorität zusammengenommen, diese eine Frau wenigstens sollte gerettet werden, und habe seinen Chef, nein, nicht gebeten, sondern befohlen habe er ihm, zu tun, was getan werden müsse, nämlich: Hände waschen!
Charlotte Könner habe überlebt und einen Sohn zur Welt gebracht, und sie habe Dr. Semmelweis versprochen, sie werde ihren Sohn Ignaz nennen, nach seinem Retter, und sie werde arbeiten und sparen und auch Hermann, der Vater, werde arbeiten und sparen, damit Ignaz studieren könne und Arzt werde.
»Zum Arzt hat es dann doch nicht gereicht«, sagte Jeff und lachte, »aber Apotheker ist er geworden, der Ignaz. Und was ist ein Apotheker anderes als ein kleiner Arzt.«
Ignaz Könner studierte in Wien Pharmazie, er heiratete, seine Frau brachte vier Kinder zur Welt. Der älteste Sohn, Ignaz wie sein Vater, wurde wie dieser Pharmazeut, zog nach Coburg in Franken und eröffnete dort eine Apotheke. Dessen Ältester wiederum, auch er ein Ignaz, wanderte am Ende des Jahrhunderts nach Amerika aus. Der Staat North Dakota warb um deutsche Einwanderer; um sie anzulocken, war die Hauptstadt Edwinton in Bismarck umbenannt worden. In der neuen Heimat änderte Ignaz III. seinen Familienname von Könner in Conner.
»Das ist unsere Geschichte«, sagte Jeff. »Ich bin zwar kein Ignaz, aber ein Apotheker. Vor ein paar Jahren haben wir unsere Apotheke umbauen lassen.«
»Was sehr viel Geld gekostet hat«, ergänzte Rita.
»Wir haben«, sagte Jeff, »unseren Laden exakt nach alten Fotos der Coburger Apotheke umbauen lassen, und so sind wir heute – ähnlich wie die Benediktinerabtei in Richardson – eine Sehenswürdigkeit in ganz North Dakota.«
Und Rita sagte: »Genauso wie in der Coburger Apotheke steht neben dem Eingang der Semmelweis-Brunnen. Zu Ehren des Dr. Semmelweis, der das Leben der Charlotte Könner gerettet hat.«
»Und das Leben so vieler anderer Mütter«, sagte Jeff.
Und dann stellten mir die beiden ihren Sohn vor, der mit seiner Familie in der Nachbarschaft wohnte: »Ignaz Conner.«
»Der ist wieder ein Ignaz«, sagte Jeff.
Als die Corona-Pandemie ausbrach, mailte ich nach Bismarck, North Dakota: »Lieber Ignaz Conner, erinnern Sie sich noch an mich?« Und bekam Antwort: »Ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich gut. Meine Eltern sind schon vor über zehn Jahren gestorben. Sie haben oft von Ihrem Besuch erzählt. Ich wünsche mir, dass wir in dieser Zeit alle fest aneinander denken.«
Ich schrieb zurück: »Das wünsche ich mir auch.«
03
MAX SCHMELING
DER GÜTIGE RIESE
Mein Onkel Hans aus Coburg in Franken war weit über seine Stadt hinaus bekannt und beliebt und auch ein bisschen berühmt, weil er sich in den Fünfziger-, Sechziger- und Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts so hingebungsvoll dem Sport gewidmet hat. Er trainierte und organisierte, entdeckte und förderte und war mit allen großen deutschen Sportlern, ganz gleich welcher Disziplin, bekannt oder befreundet, mit den Fußballern Fritz Walter und Uwe Seeler, aber auch mit dem Radrennfahrer Rudi Altig und dem Versandkaufmann und Dressurreiter Josef Neckermann. 1972 bei den Olympischen Spielen in München leitete er das Schiedsgericht beim Hochsprung. Ich saß zu Hause vor dem Fernseher, und als die erst sechzehnjährige Ulrike Meyfarth mit 1,92 Metern einen neuen Weltrekord aufstellte und damit Gold für die Bundesrepublik Deutschland gewann, sah ich meinen Onkel Hans, wie er die Arme in die Luft warf und schreiend im Kreis lief, die ganze Welt konnte das sehen.
1960, ich war noch ein Kind, wurde meine Mutter krank, und ich verbrachte ein Jahr in Coburg. Mein Onkel Hans nahm mich zweimal in der Woche mit auf den Sportplatz. Er meinte, aus mir könnte ein Sprinter werden. Ich liebte das Training. Er nahm mich »hart ran«, das gefiel mir. Und ich liebte es, nach dem Training allein durch die Stadt nach Hause zu gehen. Mein Onkel wollte nämlich mit den Kollegen noch ein Bier trinken. Ich war zehn Jahre alt und hatte den Kopf voll mit Träumen. In allen Träumen war ich ein Leichtathlet, einer wie Armin Hary oder Martin Lauer, die erst wenige Wochen zuvor in Rom goldene Medaillen gewonnen hatten.
Zu Hause klingelte ich, aber statt meiner Tante öffnete ein Mann, den ich nicht kannte, ein großer, schwergewichtiger Mann in einem hellgrauen Anzug, zweifärbigen Schuhen und einer roten Krawatte. Er hatte geschorenes schwarzes Haar, und als Erstes fielen mir an ihm seine balkendicken schwarzen Augenbrauen auf.
»Und wer bist du?«, fragte er.
»Und wer sind Sie?«, fragte ich zurück.
Da lachte er schallend und hielt mir die Hand hin, eine Hand, wie ich noch nie eine gesehen hatte, mein halber Unterarm verschwand in ihr. »Ich bin der Max«, sagte er, und ich sagte ihm, wer ich bin. Er sei ein Freund meines Onkels, meine Tante sei nur schnell in die Stadt, um Kuchen für den Kaffee zu kaufen. Er freue sich, wenn ich ihm Gesellschaft leiste.
Ich erzählte ihm, dass ich vom Sportplatz komme, wo ich zweimal in der Woche trainiere, ich wolle nämlich Sprinter werden, und ich nannte ihm meine Vorbilder.
»Stell dich hin!«, befahl er.
Wir standen im Wohnzimmer, das sehr gemütlich, aber doch ziemlich eng war. Mir war, als nähme der Mann ein Drittel des Raumes ein.
Er drehte mich, befahl mir, die Arme zu heben, befahl mir, mich zu strecken, befahl mir, in Startposition zu gehen. Schließlich sagte er: »Du wirst kein Sprinter.«
»Ihnen würde ich auf jeden Fall davonlaufen«, sagte ich.
Wieder lachte er, dass die Weingläser in der Kommode klimperten und das Mobile, das von der Lampe hing, sich drehte. »Schau dir den Armin Hary an, dein Vorbild, oder den Livio Berruti, schau ihre Beine an, sie haben lange Beine, ein Sprinter muss lange Beine haben, das ist doch klar, du hast kurze Beine, aus dir wird nie ein Sprinter!«
Wie er es sagte, kränkte es mich nicht. Ja, ich sah im selben Augenblick ein, dass er recht hatte.
»Und was kann aus mir werden?«, fragte ich.
»Du hast eine Figur wie ein Hydrant«, sagte er. »Kurz, gedrungen, kräftig. Entweder ein Kunstturner oder ein Ringer.«
»Kunstturner will ich nicht«, sagte ich. »Das ist langweilig.«
»Da gebe ich dir völlig recht«, sagte er und dass ich mich wieder setzen solle. Er griff in seine Jackentasche und nahm ein in grünes Papier eingewickeltes Eukalyptusbonbon heraus. »Willst du auch eines? Man riecht aus dem Mund und merkt es nicht, das muss nicht sein.«
Ich nahm eines. Nun sprach es sich noch leichter.
»Ringen kommt, du wirst sehen, Ringen kommt, immer mehr interessieren sich fürs Ringen«, sagte er. »Ringen ist elegant. Aber du könntest auch Boxer werden.«
»Ja«, sagte ich, »aber höchstens Weltergewicht.«
»Ist das nichts?«
»Nein, das ist nichts«, sagte ich vorlaut. »Boxen ist entweder Schwergewicht oder gar nichts.«
Und wieder lachte er los, und wieder gab er mir recht. Er werde, sagte er, mit meinem Onkel sprechen, dass er mich in einem Ringerklub anmelde.
»Und wenn etwas aus dir geworden ist, dann will ich Bericht!«
Am Abend, als er gegangen war – wir lauschten, bis wir seine Schritte im Stiegenhaus nicht mehr hörten –, packte mich mein Onkel Hans an beiden Oberarmen, schüttelte mich und flüsterte, als wäre er noch hier: »Weißt du, wer das war? Weißt du, wer das war?«
»Ein netter Kerl«, sagte ich. »Er hat gesagt, ich soll Du zu ihm sagen. Max. Das habe ich auch getan.«
»Das war Max Schmeling!«, rief nun mein Onkel in die Wohnung hinein, damit es auch der letzte Unterteller hören konnte. »Max Schmeling! Der schon gegen Jack Sharkey geboxt hat, da war er kaum fünfundzwanzig, nur wenig älter als du!«
»Ich bin erst zehn«, sagte ich.
Mein Onkel wischte den Einwand beiseite. »Er war Schwergewichts-Boxweltmeister!«, brüllte er. »Einer der größten Athleten der Welt, wenn nicht gar der größte!«
Das beeindruckte mich dann doch.