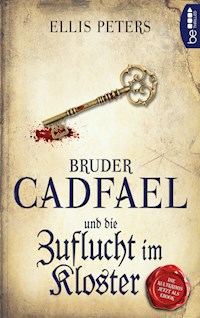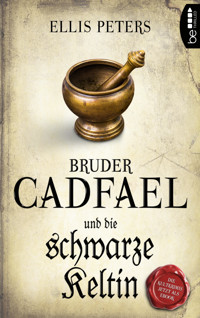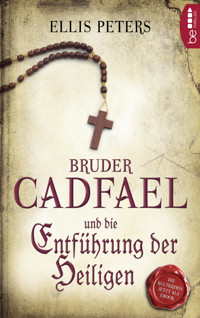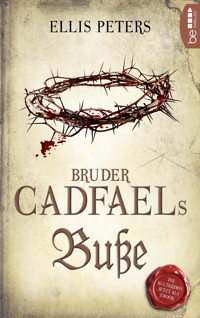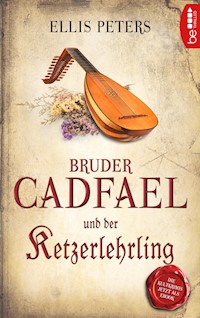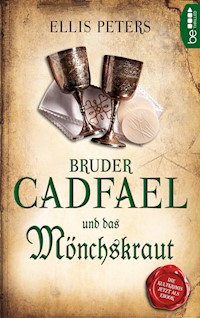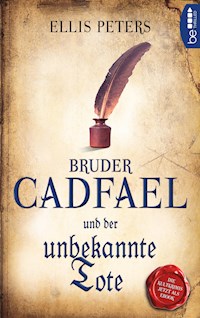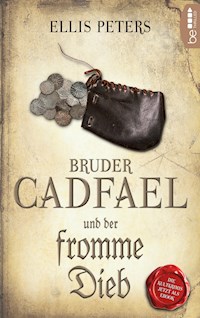
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für den Mönch
- Sprache: Deutsch
Die Kult-Krimi-Serie endlich als eBook!
Nach einem Unwetter müssen die Mönche des Klosters von Shrewsbury voller Entsetzen feststellen, dass ihnen die wertvollen Reliquien der Heiligen Winifred gestohlen wurden. Der Verdacht fällt schnell auf einen jungen Mönch, der gerade im Kloster zu Gast ist. Bruder Cadfael sucht nach weiteren Hinweisen auf den Täter, doch dann wird der wichtigste Zeuge ermordet und die Schuld des Klosterbruders scheint endgültig bewiesen. Aber ist der junge Benediktiner tatsächlich ein Räuber und sogar ein Mörder? Obwohl alle Umstände dafür sprechen, zweifelt Bruder Cadfael daran ...
Über die Reihe: Morde und Mysterien im finstersten Mittelalter des 12. Jahrhunderts liefern den perfekten Hintergrund für die spannenden Abenteuer des Bruders Cadfael, eines ehemaligen Kreuzritters, der sich als Mönch in die Abtei St. Peter & Paul nahe Shrewsbury zurückgezogen hat. Doch ein ruhiges Leben als Kräutergärtner und Heilkundiger ist ihm nicht vergönnt: Immer wieder muss er seine detektivischen Fähigkeiten einsetzen, um Verbrechen in der Gemeinde aufzuklären.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Reihe
Über die Autorin
Titel
Impressum
Prolog
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Weitere Titel der Autorin
Bruder Cadfael und die Entführung der Heiligen
Bruder Cadfael und der unbekannte Tote
Bruder Cadfael und das Mönchskraut
Bruder Cadfael und der Hochzeitsmord
Bruder Cadfael und der Aufstand auf dem Jahrmarkt
Bruder Cadfael und die Jungfrau im Eis
Bruder Cadfael und die Zuflucht im Kloster
Bruder Cadfael und der Ketzerlehrling
Bruder Cadfael und das Geheimnis der schönen Toten
Bruder Cadfael und die schwarze Keltin
Über dieses Buch
Nach einem Unwetter müssen die Mönche des Klosters von Shrewsbury voller Entsetzen feststellen, dass ihnen die wertvollen Reliquien der Heiligen Winifred gestohlen wurden. Der Verdacht fällt schnell auf einen jungen Mönch, der gerade im Kloster zu Gast ist. Bruder Cadfael sucht nach weiteren Hinweisen auf den Täter, doch dann wird der wichtigste Zeuge ermordet und die Schuld des Klosterbruders scheint endgültig bewiesen. Aber ist der junge Benediktiner tatsächlich ein Räuber und sogar ein Mörder? Obwohl alle Umstände dafür sprechen, zweifelt Bruder Cadfael daran ...
Über die Reihe
Morde und Mysterien im finsteren Mittelalter des 12. Jahrhunderts liefern den perfekten Hintergrund für die spannenden Abenteuer des Bruders Cadfael, einem ehemaligen Kreuzritter, der sich als Mönch in die Abtei St. Peter & Paul nahe Shrewsbury zurückgezogen hat. Doch ein ruhiges Leben als Kräutergärtner und Heilkundiger ist ihm nicht vergönnt: Immer wieder muss er seine detektivischen Fähigkeiten einsetzen, um Verbrechen in der Gemeinde aufzuklären.
Über die Autorin
Ellis Peters ist das Pseudonym der 1913 geborenen englischen Autorin Edith Pargeter. Ihre Bruder-Cadfael-Reihe erschien in 15 Sprachen und mehr als 20 Ländern und wurde erfolgreich von der BBC verfilmt. Ihr Wissen als Apothekenhelferin war der Ausgangspunkt für den kräuterkundigen Bruder Cadfael. Ellis Peters starb im Oktober 1995.
Ellis Peters
Bruder Cadfael und der fromme Dieb
Aus dem Englischen von Bettina Runge
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1992 by Ellis Peters
Titel der britischen Originalausgabe: »The Holy Thief«
Originalverlag: Headline Publishing Group Limited, London
Für die deutschsprachige Erstausgabe:
Copyright © der deutschen Übersetzung 1997 by Wilhelm Heyne Verlag GmbH Co. KG, München
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Rebecca Schaarschmidt
Covergestaltung: Thomas Krämer unter Verwendung von Motiven © Shutterstock.com
eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)
ISBN 978-3-7517-0728-2
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Prolog
In den letzten Augusttagen des Jahres 1144 gab Geoffrey de Mandeville, Graf von Essex, der brütenden Sommerhitze nach und machte den letzten fatalen Fehler seiner langen und eigennützigen Laufbahn. Er plante damals die Belagerung und Zerstörung des einfachen, aber wirkungsvollen Festungsrings, den König Stephen hatte errichten lassen, um den Raubzügen von Geoffreys Horden in den Fens, dem flachen Marschland im östlichen England, Einhalt zu gebieten. Von seinen wechselnden Stützpunkten hier in den Fens aus hatte Geoffrey mit seinen geächteten Mannen das Land verwüstet und ausgeplündert, auf dass kein Feld mehr bepflanzt und geerntet, kein Gutshof mehr bewirtschaftet werden konnte, auf dass kein Mensch, der etwas sein eigen nannte, in seinem Besitz bleiben, und keiner, der sich weigerte, es herauszugeben, auch nur so viel wie sein nacktes Leben zurückbehalten würde. Da ihm der König all seinen mehr oder weniger rechtmäßigen Besitz, seine Burgen, Schlösser, Ländereien und Titel entrissen hatte – und das, um ehrlich zu sein, auch nicht auf ganz rechtmäßige Weise –, hatte sich Geoffrey daran gemacht, jedem, der seinen Weg kreuzte, egal ob arm oder reich, Ähnliches anzutun. Ein Jahr lang waren die Fens von den Grenzen Huntingdons bis Mildenhall in Suffolk und über weite Strecken des Cambridgeshire ein geschlossenes Diebeskönigreich geworden, und obwohl Stephens Befestigungsring dessen weitere Ausdehnung hatte verhindern können, hatte er die Bewegungsfreiheit des Grafen doch nicht sonderlich einzuschränken oder ihn zu einer Schlacht herauszufordern vermocht, welche dieser stets geschickt zu vermeiden wusste.
Der Stützpunkt in Burwell, nordöstlich von Cambridge, erzürnte Geoffrey indes, gefährdete er doch seine Nachschubwege – fast sein einziger wunder Punkt. Und so umritt er an einem der heißesten Augusttage diese lästige Burg mit der Absicht, die vorteilhafteste Möglichkeit für einen Angriff auszukundschaften. Wegen der glühenden Hitze hatte er seinen Helm abgenommen und auch den Kettenpanzer, der seinen Nacken schützte. Ein einfacher Bogenschütze hoch oben auf der Festungsmauer zielte auf ihn und traf ihn in den Kopf.
Geoffrey, den die Verletzung leicht dünkte, lachte nur; er zog sich zurück, um sich eine kurze Zeit der Genesung zu gönnen. Doch nach wenigen Tagen erfasste ihn das heftige Fieber einer Entzündung, die ihm das Fleisch von den Knochen schälte und ihn ans Bett fesselte. Man brachte ihn bis nach Mildenhall in Suffolk und kam dort zu der Erkenntnis, dass sein Ende gekommen sei. Was die Heere König Stephens nicht erreicht hatten, das hatte die Sonne fertiggebracht.
Dass er in Frieden stürbe, war schlechterdings nicht möglich, hatte man ihn doch exkommuniziert. Nicht einmal ein Priester konnte ihm helfen, denn auf dem Konsilium um die Mitte der Fastenzeit, das im Jahr zuvor von Henry von Blois, dem Bischof von Winchester, Bruder des Königs und damals päpstlicher Legat, einberufen worden war, hatte man beschlossen, dass keinem Mann, der einem Geistlichen Gewalt angetan habe, die Absolution erteilt werden könne, es sei denn durch den Papst höchstselbst und dann auch nicht durch ein Dekret aus der Ferne, sondern ausschließlich in Gegenwart des Heiligen Vaters. Von Mildenhall nach Rom, das war ein langer Weg für einen Sterbenden, der das Höllenfeuer zu fürchten hatte. Der Kirchenbann über Geoffrey war die Strafe für seine gewaltsame Einnahme der Abtei von Ramsey, für die Vertreibung des Abtes und der Mönche, für die Umwandlung des Klosters in die Hauptstadt seines Königreichs von Dieben, Plünderern und Mördern. Für ihn gab es keine Aussicht auf Absolution, keine Hoffnung auf eine Bestattung. Die Erde wollte ihn nicht aufnehmen.
Einige seiner Mannen taten ungestüm ihr Bestes, um seine Seele zu verteidigen, wo sie seinem Leib schon nicht helfen konnten. Als er so schwach wurde, dass er zu toben aufhörte und in Apathie versank, begannen seine Rechtsberater und Dienstleute fieberhaft, öffentliche Briefe in seinem Namen zu verfassen und der Kirche verschiedene Besitztümer, die er ihr entrissen hatte, zurückzugeben, darunter die Abtei von Ramsey. Ob das mit seinem Einverständnis geschah, fragte niemand und sollte auch niemand erfahren. Die Anordnungen wurden ausgeführt und befolgt, aber sie nützten Geoffrey nicht. Seinem Leib wurde ein christliches Begräbnis verwehrt, seine Grafenwürde wurde ihm entzogen, seine Besitzungen und Ämter blieben verwirkt, und seine Familie wurde enterbt. Sein ältester Sohn war zusammen mit ihm exkommuniziert worden, weil jener an dessen Rebellion teilgenommen hatte. Ein jüngerer Sohn, sein Namensvetter, befand sich bereits am Hofe der Kaiserin Maud und war von ihr als Graf von Essex anerkannt worden. Aber was nützte das schon ohne Land?
Am sechzehnten Tage des Monats September starb Geoffrey, noch immer unter Kirchenbann, noch immer ohne Absolution. Ein Rest von Barmherzigkeit wurde ihm nur durch gewisse Tempelritter zuteil, die gerade in Mildenhall weilten und den Sarg mit seiner sterblichen Hülle nach London mitnahmen, wo sie ihn gezwungenermaßen in einer Grube außerhalb des Friedhofs der Templer, in ungeweihte Erde, verscharrten. Selbst das überschritt die Gesetze des kanonischen Rechts, denn nach den Buchstaben dieses Gesetzes hätte er überhaupt nicht beerdigt werden dürfen.
In seinem bunt zusammengewürfelten Heer gab es niemanden, der stark genug war, ihn zu ersetzen. Alles, was es zusammengehalten hatte, waren Selbstsucht und Habgier, und ohne Geoffrey zerfiel die fragwürdige Gemeinschaft, nachdem die königlichen Truppen mit erneuter Entschlossenheit angerückt waren. Die Gesetzlosen zerstreuten sich in kleinen Gruppen in alle Richtungen, um nach weniger bevölkerten Breiten und einsameren Gefilden zu suchen, wo sie hofften, ihr Leben als Beutejäger fortsetzen zu können. Die Achtbaren unter ihnen oder die von höherer Geburt zogen umher und versuchten, mit sich ins Reine zu kommen und sich sichereren Bündnissen anzuschließen.
Allen anderen bereitete die Nachricht vom Tode Geoffreys große Befriedigung. Schnell erreichte sie den König; der Tod befreite ihn von seinem gefährlichsten und erbittertsten Feind und enthob ihn der Notwendigkeit, den Großteil seines Heeres in einer bestimmten Region zu binden. Die frohe Botschaft vom Rückzug der marodierenden Horden verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den Fens, und die Menschen, die in Angst und Schrecken gelebt hatten, tauchten vorsichtig aus ihren Verstecken auf, um die Reste der geplünderten Feldfrüchte zu bergen, ihre niedergebrannten Häuser wieder aufzubauen, ihre Familienangehörigen erneut um sich zu scharen und ihre Toten angemessen zu bestatten, nachdem der Sensenmann in ihren Breiten so reiche Ernte eingebracht hatte. Bis ein halbwegs gewöhnlicher Alltag wieder einkehrte, würde mehr als ein Jahr ins Land gehen müssen, aber wenigstens konnten die ersten mühsamen Schritte getan werden.
Und vor Ablauf des Jahres erreichte die Kunde auch Abt Walter von Ramsey zusammen mit der Sterbebettverfügung Geoffreys, durch die jener sein Kloster zurückerhielt. Er stattete Gott dem Herrn den schuldigen Dank ab und schickte Boten aus, nach seinem Prior, seinem Subprior und den verstreuten Brüdern, die völlig mittellos vertrieben worden waren und irgendwo hatten Unterschlupf suchen müssen – manche bei ihren Verwandten, manche in anderen gastfreundlichen Benediktinerabteien. Diejenigen, die in der Nähe untergekommen waren, eilten rasch herbei und fanden ihre Abtei völlig verwüstet vor. Von den Klostergebäuden waren nur mehr leere Hüllen zurückgeblieben, die Felder lagen brach, die Gutshöfe, die ehemals dem Kloster gehört hatten, waren von Dieben und Landstreichern bewohnt und all ihrer Schätze beraubt. Die Mauern, so hieß es, hätten vor Kummer geblutet. Aber dennoch: Abt Walter und seine Brüder machten sich daran, ihr Haus und ihre Kirche wieder aufzubauen, und sandten allen Mönchen und Novizen, die in der Ferne Zuflucht gefunden hatten, die Nachricht von ihrer Rückkehr. Da sie Mitglieder einer größeren Brüderschaft waren, die dem Benediktinerorden nahestand, verschickten sie auch einen dringenden Hilferuf um Almosen, Baumaterial und Arbeitskräfte für den raschen Wiederaufbau des geheiligten Ortes.
Die Nachricht, die Einladung und der Hilferuf erreichten gerade zur rechten Zeit das Pförtnerhaus der Abtei St. Peter und St. Paul in Shrewsbury.
Erstes Kapitel
Die Boten trafen während des halbstündigen Kapitels ein und weigerten sich zu essen, zu trinken, zu ruhen oder auch nur den Schmutz der Straßen von den Füßen zu waschen, bis sie in den Kapitelsaal vor die Versammlung geführt worden waren und ihren Auftrag erfüllt hatten.
Jetzt standen sie da, aller Augen auf sie gerichtet, und wollten sich nicht setzen, ehe ihr Anliegen vorgetragen war. Subprior Herluin, ein Mann von großer Erfahrung und Autorität und von eindrucksvoller Erscheinung, stand dem Abt gegenüber, die schmalen Hände vor dem Gürtel gefaltet. Der junge Novize, der mit ihm von Ramsey gekommen war, hielt sich bescheiden einen oder zwei Schritt zurück und ahmte demütig die reglose Haltung des Subpriors nach. Die drei Laiendiener ihres Hauses und Begleiter auf ihrer Reise hatten sie beim Pförtner im Torhaus zurückgelassen.
»Vater Abt, wie jedermann kennt Ihr unsere beklagenswerte Geschichte. Zwei Monate sind jetzt vergangen, seit uns Haus und Ländereien wieder überlassen wurden. Abt Walter ruft nun all jene Brüder zu ihren Pflichten zurück, die fliehen und anderswo Unterschlupf suchen mussten, nachdem die Rebellen und Marodeure uns alles entrissen und uns mit vorgehaltener Klinge vertrieben hatten. Diejenigen von uns, die in der Nähe bleiben konnten, kehrten so bald als möglich an die Seite unseres Abtes zurück. Was wir vorfanden, war die reine Verwüstung. Wir waren die rechtmäßigen Besitzer vieler Lehnshöfe gewesen, nach der Enteignung aber wurden sie solchen gesetzlosen Schurken übergeben, die bereit waren, de Mandeville zu unterstützen. Und so hilft es uns gar nichts, sie zurückzufordern, da wir sie nur per Gesetz von den Banditen zurückbekämen, und das Gesetz wird Jahre brauchen, um uns zu unserem Recht zu verhelfen. Außerdem wird dann alles, was Wert hat, geplündert und zerstört, vielleicht sogar niedergebrannt sein. Und innerhalb des Klosters ...«
Er besaß eine klare, überzeugende Stimme, die bis an diesen Punkt kräftig, aber leidenschaftslos geklungen hatte. Doch als er jetzt den Tag der Rückkehr zu schildern begann, konnte er einen Augenblick lang seine Empörung nicht im Zaume halten.
»Ich war dort. Ich habe gesehen, was sie aus dem geheiligten Ort gemacht haben. Ein Gräuel! Einen Abfallhaufen! Die Kirche geschändet, das Kloster ein schmutziger Stall, Schlaf- und Speisesaal ihrer Holztäfelung beraubt, um sie zu verfeuern, alle Vorräte aufgebraucht und alles Wertvolle, was wir nicht hatten verstecken können, gestohlen. Alle Dachplatten von den Dächern gerissen, alle Türen und Fenster weit geöffnet und das Innere den Unbilden der Witterung ausgesetzt. Nicht einmal einen Topf zum Kochen, nicht ein einziges Messbuch, nicht ein Stück Pergament haben sie zurückgelassen. Zerstörte Mauern, völlige Leere, Wüstenei. Und all das wieder aufzubauen, schöner noch als zuvor, dazu haben wir uns verpflichtet. Aber das können wir nicht alleine. Abt Walter hat viel von seinem persönlichen Reichtum geopfert, um Nahrungsmittel für die Dorfbewohner zu kaufen, nachdem die Ernten nicht eingebracht werden konnten. Denn wer hätte, den Tod stets auf den Fersen, seine Äcker bestellen können? Selbst den Ärmsten der Armen entrissen diese Bösewichter die letzten erbärmlichen Habseligkeiten, und wem sie nichts mehr stehlen konnten, dem ließen sie nicht mal das nackte Leben.«
»Wir haben wohl von den Gewalttaten in Eurem Land gehört«, sprach Abt Radulfus. »Mit großem Kummer haben wir es vernommen und für ein Ende der Schrecken gebetet. Nun, da das Ende gekommen ist, gibt es kein Haus unseres Ordens, das sich weigern kann, alle nur mögliche Hilfe bei der Wiederherstellung des Zerstörten zu leisten. Sagt uns, womit wir Ramsey am besten dienen können. Denn Ihr seid als Bruder zu Brüdern gesandt worden, und innerhalb unserer Familie bedeutet Schaden für den einen Schaden für alle.«
»Ich wurde hierher gesandt, um von diesem Hause Hilfe zu erbitten; auch von jedem unter der Laienschaft, der zu einem Akt der Barmherzigkeit in Form von Spenden oder auch von handwerklicher Unterstützung bewogen werden kann, sofern es in Shrewsbury Männer gibt, die Erfahrung im Bauen haben und willens sind, sich für einige Wochen fern ihrer Heimat nützlich zu machen. Für jede erdenkliche Hilfe beim Wiederaufbau unseres Klosters, für jede Münze, für jedes Gebet wird Ramsey dankbar sein. Und deshalb bitte ich, zunächst hier in der Kirche predigen zu dürfen, und, die Erlaubnis des Sheriffs und der Geistlichkeit vorausgesetzt, auch am Marktkreuz von Shrewsbury, auf dass jeder Hausherr der Stadt sein Herz erforsche und so viel spende, wie dieses ihm eingibt.«
»Wir werden mit Vater Boniface reden«, sagte Radulfus, »und er wird sich gewiss einverstanden erklären, dass Ihr bei einem Gemeindegottesdienst predigt. Des Wohlwollens dieses Hauses könnt Ihr bereits gewiss sein.«
»Ich wusste doch«, sagte Herluin erfreut, »dass wir uns auf brüderliche Liebe verlassen können. Neben Bruder Tutilo hier und mir wurden auch andere ausgeschickt, um bei Benediktinerklöstern in anderen Grafschaften um Unterstützung zu bitten. Wir wurden außerdem beauftragt, all den Brüdern, die ihr Leben in der Ferne fristen mussten, Nachricht zu geben und sie aufzufordern, ins Kloster zurückzukehren, wo man ihrer dringend bedarf. Denn viele werden noch gar nicht wissen, dass Abt Walter wieder in seiner Abtei ist, auf die Arbeit und den Glauben jedes Sohnes angewiesen, um das große Werk der Erneuerung zu vollbringen. Einer der unseren«, sagte er, wobei er aufmerksam das Gesicht des Abtes musterte, »ist, wie ich glaube, hier in Shrewsbury bei seiner Familie untergekommen. Ich muss ihn aufsuchen und ihn bewegen, mit uns zurückzukehren.«
»Ihr habt recht«, erwiderte Radulfus. »Es ist Sulien Blount vom Gutshofe Longner. Er kam durch Abt Walters Fürsprache zu uns. Der junge Mann hatte sein letztes Gelübde noch nicht abgelegt. Das Ende des Noviziats rückte näher, und ihm kamen Zweifel an seiner Berufung. Der Abt hatte ihm eine Frist eingeräumt und ihm Zeit gelassen, über seine Zukunft nachzudenken. Es war seine eigene Entscheidung, dieses Haus zu verlassen und zu seiner Familie zurückzukehren, und so ließ ich ihn gehen. Wenn Ihr mich fragt, ist er irrtümlicherweise in den Orden eingetreten. Wie dem auch sei, er wird und muss selbst die Antwort finden. Ich werde einen der Brüder anweisen, Euch zum Hof von Suliens älterem Bruder zu führen.«
»Ich werde mein Bestes tun, Sulien wieder den rechten Weg zu weisen«, sagte Herluin mit einem gewissen Unterton in der Stimme, der darauf schließen ließ, dass es ihm eine stille Freude bereitete, ein davongelaufenes, widerstrebendes Schäfchen in seine Herde zurückzutreiben.
Bruder Cadfael beobachtete die eindrucksvolle Person aus einer verborgenen Ecke des Saals, und die langen Jahre seiner weltlichen und klösterlichen Erfahrung mit allerhand Leuten sagten ihm, dass der Subprior wohl einen guten Prediger am Marktkreuz abgeben und manch einer gewissensgeplagten Seele große Schenkungen entlocken würde, denn er war redegewandt und sogar zu Leidenschaft fähig, wenn es um sein Kloster ging. Doch was seine Aussichten betraf, den jungen Sulien Blount umzustimmen, jetzt, wo dieser bald schon sein Feinsliebchen heiraten wollte, da konnte Cadfael nur den Kopf schütteln. Wenn es ihm gelingen würde, wäre er ein Wundertäter auf dem besten Weg, ein Heiliger zu werden. Es gab in Cadfaels Hagiographie ein paar weit unerfreulichere Heilige, denen er am liebsten nicht den Heiligenstand zugebilligt hätte, die er ärgerlicherweise aber anerkennen musste. Alles in allem empfand er fast so etwas wie Mitleid mit Subprior Herluin, der im Begriff war, seine Waffen im Kampf mit dem unverwundbaren Schild der Liebe abzustumpfen. Sollte er nur versuchen, Pernel Otmere von Sulien Blount wegzureißen! Er, Cadfael, kannte die beiden inzwischen zu gut, um solch einem Unterfangen Aussicht auf Erfolg zuzubilligen.
Er merkte, dass er bislang keine allzu große Zuneigung zu Subprior Herluin verspürte, obwohl er dessen Zähigkeit, solch eine lange Fußreise zu unternehmen, und auch seine Entschlossenheit, Ramseys geplünderte Truhen wieder aufzufüllen, um das zerstörte Kloster wieder aufzubauen, nur bewundern konnte. Sie waren schon ein seltsames Gespann, diese beiden umherziehenden Brüder aus den Fens. Der Subprior war ein hochgewachsener, breitschultriger Mann, dessen Leib wohl einmal üppig, vielleicht allzu üppig gewesen, jetzt aber zusammengefallen und ein wenig schlaff geworden war. Gewiss war ihm nichts vorzuwerfen; er schien den Mangel geteilt zu haben, den die unglücklichen Bewohner der Fens während des kargen Jahres der Unterdrückung hatten erleiden müssen. Sein unbedeckter Kopf ließ eine blasse Tonsur erkennen, die von angegrauten, eher braunen als weißen Haaren umgeben war; darunter ein längliches Gesicht mit strengen Zügen, tiefliegenden und ernsten Augen sowie einem schmalen Mund, der fast lippenlos wirkte, als wäre ihm das Lächeln völlig fremd. Es hatte, so schätzte Cadfael, etwa fünfzig Jahre bedurft, um solche bedrohlichen Gesichtszüge auszubilden – fünfzig Jahre der Kasteiung und Entsagung.
Kein besonders angenehmer Begleiter auf einer langen Reise, wenn der erste Eindruck nicht täuschte. Bruder Tutilo, der bescheiden ein Stück hinter seinem Vorgesetzten stand und jedem seiner Worte mit gespannter Aufmerksamkeit lauschte, sah aus, als zählte er zwanzig Lenze, vielleicht sogar noch weniger; ein zart gebauter junger Mann, auffällig geschmeidig und anmutig in seinen Bewegungen, ein Musterbeispiel disziplinierter Beherrschung. Sein Kopf reichte gerade bis zu Herluins Schulter und war mit einer Fülle blonder Locken bedeckt, die während der langen Reisezeit kräftig gewachsen waren. Ohne Zweifel würden diese Locken, sobald er wieder in Ramsey war, radikal gestutzt werden. Jetzt aber hätten sie einem gemalten Engel in einer Missale wohl angestanden, obwohl das Gesicht unter dieser Aureole – trotz seines Ausdrucks strahlender Hingabe – wenig engelgleich war. Auf den ersten Blick wirkte er wie ein reizendes Unschuldslamm, so offenherzig mit seinen weitgeöffneten Augen und seinen mädchenhaft rosigen Wangen. Bei genauerem Hinsehen jedoch wurde man gewahr, dass sich hinter diesem kindlichen Anstrich ein ovales Gesicht von klassischem Gleichmaß und scharfen, ausgeprägten Formen verbarg. Ja, diese rosengleiche Färbung auf den Marmorzügen wirkte fast wie eine Tarnung, hinter der eine gewinnende, aber doch leicht gefährliche Kreatur lauerte.
Tutilo – ein seltsamer Name für einen jungen Engländer; er hatte nichts von einem Normannen oder Kelten an sich. Vielleicht hatte man diesen Namen bei seinem Eintritt ins Noviziat für ihn gewählt. Er wollte Bruder Anselm fragen, was der Name bedeute und wo die ehrwürdigen Brüder von Ramsey ihn gefunden haben mochten. Cadfael wandte seine Aufmerksamkeit wieder dem Gespräch zwischen Gastgeber und Gästen zu.
»Da Ihr nun schon in dieser Gegend seid«, ließ sich der Abt vernehmen, »habt Ihr vielleicht den Wunsch, weitere Benediktinerklöster zu besuchen. Ich versorge Euch mit Pferden, wenn ich Euch damit dienen kann. Die Jahreszeit ist ungünstig für eine Fußwanderung. Die Flüsse führen Hochwasser, der eine oder andere wird unpassierbar sein; da ist es besser, Ihr seid zu Pferd unterwegs. Wir werden uns beeilen, Eure weiteren Vorhaben nach allen Kräften zu unterstützen, und zunächst mit Vater Boniface über die Nutzung der Kirche reden, denn er ist für die Seelsorge zuständig. Auch mit Hugh Beringar, dem Sheriff sowie dem Bürgermeister und dem Gildenmeister der Stadt müssen wir wegen Eurer Versammlung am Marktkreuz von Shrewsbury verhandeln. Wenn es noch etwas gibt, womit wir Euch dienlich sein können, braucht Ihr es nur zu äußern.«
»Wir wären in der Tat dankbar, wenn wir für eine Weile beritten weiterziehen könnten«, sagte Herluin und kam dabei einem Lächeln so nahe, wie seine Züge es eben erlaubten, »denn wir beabsichtigen, wenigstens bis zu unseren Brüdern in Worcester zu gelangen, vielleicht auch nach Evesham und Pershore, und wir könnten leicht über Shrewsbury zurückkehren und die Pferde bei Euch wieder abliefern. Die unsrigen wurden uns alle von Geoffreys Schurken gestohlen. Zuerst aber, wenn möglich heute noch, möchten wir mit Bruder Sulien sprechen.«
»Wie es Euch beliebt«, sagte Radulfus nur. »Ich glaube, Bruder Cadfael ist am besten mit dem Weg vertraut – man muss eine Fähre benutzen – und auch mit der Familie des Herrn von Longner. Es empfiehlt sich wohl, dass er Euch begleitet.«
»Bruder Sulien«, sagte Cadfael, als er mit Bruder Anselm, Vorsänger und Bibliothekar, den Hof überquerte, »ist schon eine Weile nicht mehr Bruder genannt worden und wird wohl kaum wieder Gefallen an diesem Titel finden. Und das hätte Radulfus diesem Herluin ruhig sagen können, denn er kennt die ganze Geschichte des jungen Mannes so gut wie ich. Aber hätte er es gesagt, würde Herluin ihm wahrscheinlich gar nicht zugehört haben. ›Bruder‹ bedeutet für Sulien jetzt nichts anderes als sein leiblicher Bruder Eudo. Sulien lässt sich für die Waffen schulen und wird einer von Hughs jungen Männern in der Garnison oben in der Burg sein, sobald seine Mutter gestorben ist, und das wird, wie ich höre, nicht mehr lange dauern. Zudem wird er ein verheirateter Mann sein, noch ehe das geschehen ist. An eine Rückkehr nach Ramsey ist da nicht zu denken.«
»Wenn der Abt den Jungen nach Hause geschickt hat, damit er eine eigene Entscheidung treffen möge«, meinte Anselm nachdenklich, »kann der Subprior kaum das Recht haben, ihn allzu sehr unter Druck zu setzen und zu einer Rückkehr zu zwingen. Er mag ihm zureden, ihn ermahnen, aber er ist machtlos, wenn der junge Mann sich nicht bewegen lässt. Es kann allerdings sein«, fügte er trocken hinzu, »dass er sich vor allem einen Ablass in Silber davon verspricht.«
»Das ist durchaus denkbar, und den bekommt er wahrscheinlich auch. Es gibt in diesem Hause mehr als ein Gewissen, das sich Ramsey gegenüber schuldig fühlt«, stimmte Cadfael zu. »Und was«, fragte er, »hältst du von dem anderen?«
»Von dem Jungen? Ein Schwärmer, ein Träumer mit einer Anmut und einer Inbrunst, die durch seine kindlichen Wangen schimmern. Wahrscheinlich als Begleiter für Herluin ausgewählt, um dessen Eiseskälte auszugleichen, was meinst du?«
»Und wie hat er diesen fremdländischen Namen bekommen?«
»Tutilo! Ja«, sagte Anselm sinnend, »gewiss nicht bei seiner Taufe! Es muss einen Grund geben, weshalb man diesen Namen für ihn gewählt hat. Tutilo gehört zu den Heiligen des März, allerdings beachten wir ihn hier kaum. Er war ein Mönch in Sankt Gallen und ist seit über zweihundert Jahren tot. Nach dem, was man hört, war er Meister in allen Kunstarten, Maler, Dichter, Musiker und dergleichen. Vielleicht haben wir einen begabten Jüngling unter uns. Ich will ihn dazu bringen, sich an Rebec oder Drehleier zu versuchen, und sehen, was dabei herauskommt. Wir hatten einst einen fahrenden Sänger hier, erinnerst du dich? Der kleine Schelm, der sich die Küchenmagd des Goldschmieds zur Frau nahm, bevor er uns verließ. Ich flickte ihm damals die Rebec. Wenn sich Tutilo als besser denn jener erweist, hat er vielleicht ein Anrecht auf den Namen, den sie ihm gegeben haben. Horch ihn ein wenig aus, Cadfael, wenn du ihn heute Nachmittag nach Longner begleitest. Herluin wird mit seinem verirrten Schäfchen beschäftigt sein. Versuch, an Tutilo heranzukommen.«
Der Pfad zum Gutshof von Longner zweigte in nordöstlicher Richtung von der Straße der Abteivorstadt ab, schlängelte sich durch ein kleines, dichtes Wäldchen und führte auf einen gras- und heidebewachsenen Kamm, der einen Blick auf den gewundenen Lauf des Severn gewährte. Der Fluss war angeschwollen und trug herabgefallene Äste und Grasbüschel von der Uferböschung in seinem Lauf. Es hatte im Winter viel Schnee gegeben, ohne große Stürme oder Frost. Das Tauwasser füllte die Täler, und selbst auf den Wiesen zwischen Fluss und Bach rann es und rieselte silbrig zwischen den Gräsern. Die Furt ein wenig flussaufwärts war schon unpassierbar, die Insel, die normalerweise das Überqueren des Flusses vereinfachte, war überschwemmt. Der Fährmann aber brachte seine Passagiere kräftig stakend ans andere Ufer; er war so mit seinen aufgewühlten Wassern vertraut, dass Flut, Sturm und Windstille keinen Unterschied für ihn machten.
Auf der anderen Seite des Severn wand sich der Pfad durch nasse Wiesen, und der Fluss nagte bereits eine Elle weit vom Ufer ins bräunliche Wintergras. Wenn über dem walisischen Hügelland auf das Tauwetter heftiger Frühlingsregen folgte, so kam es zu Überschwemmungen unter den Stadtmauern von Shrewsbury, der Meole-Bach und der Mühlteich traten über ihre Ufer und bedrohten sogar das Hauptschiff der Klosterkirche. Das war zweimal geschehen, seitdem Bruder Cadfael dem Orden beigetreten war. Im Westen hing der Himmel jetzt schon blauschwarz und bedrohlich über den fernen Bergen.
Sie umgingen das steigende Wasser unterhalb des dunklen Töpferackers, erklommen dankbar die sanfte Anhöhe bis hinauf in das gepflegte Wäldchen, das zum Longner-Gut gehörte, und gelangten zu der Lichtung, auf der sich die Gutsgebäude, durch eine hohe Palisadenumfriedung vor den Westwinden geschützt, behaglich an den Hang schmiegten.
Als sie durch das Eingangstor kamen, trat Sulien Blount gerade aus den Stallungen, um zum Wohnhaus zu gehen. Er trug als Arbeitskleidung Lederwams und Kniehosen. Wie es sich für einen jüngeren Bruder gehörte, leistete er auf dem Besitz des älteren Bruders seinen Teil, bis er Gelegenheit fand, einen eigenen Hof zu bewirtschaften, was er sicher einmal tun würde. Beim Anblick der drei Männer blieb er starr vor Staunen stehen, erkannte dabei sogleich seinen ehemaligen geistlichen Vorgesetzten, höchst befremdet, ihn hier, so fern von seinem Kloster, anzutreffen. Aber er eilte augenblicklich herbei und grüßte mit ehrfürchtiger, vielleicht sogar etwas ängstlicher Höflichkeit. Die Belastungen des letzten Jahres hatten ihn so weit von Kloster und Tonsur entfernt, dass die Begegnung hier in seinem Zuhause mit dem, was für ihn längst vergangen und abgetan war, einen Augenblick lang einer Bedrohung gleichkam, einer Bedrohung seines neuen und hart erkämpften Gleichgewichts und der Zukunft, die er für sich gewählt hatte. Nur einen Augenblick freilich. Sulien hatte keinen Zweifel an dem Weg, den er einschlagen wollte.
»Vater Herluin, seid willkommen in meinem Zuhause! Es freut mich, Euch bei guter Gesundheit zu sehen und zu hören, dass Ramsey dem Orden zurückgegeben wurde. Wollt Ihr nicht eintreten und uns wissen lassen, womit Longner Euch dienen kann?«
»Ihr könnt Euch nicht vorstellen«, begann Herluin, auf einen möglichen Kampf gefasst, »in welchem Zustand uns das Kloster zurückgegeben wurde. Ein Jahr lang diente es als Stützpunkt eines verbrecherischen Heeres, wurde geplündert und ausgeraubt, das Mauerwerk geschändet, wenn nicht sogar vor dem Abzug gänzlich zerstört. Wir brauchen jeden Sohn des Hauses und jeden Freund des Ordens, um vor Gott wieder aufzurichten, was entheiligt worden ist. Ich bin zu Euch gekommen, um mit Euch zu reden.«
»Ein Freund des Ordens«, entgegnete Sulien, »wünsche ich zu sein. Ein Sohn von Ramsey und ein Bruder seiner Brüder bin ich nicht mehr. Abt Walter hat mich gerechterweise hierher zurückgeschickt, um meine Berufung zu überdenken, die er selbst als zweifelhaft erkannte. Er hat mein Noviziat Abt Radulfus überlassen, und der hat mich von meiner Pflicht entbunden. Aber tretet ein, damit wir uns als Freunde unterhalten können. Ich werde Euch ehrfürchtig lauschen, Vater, und respektieren, was Ihr zu sagen habt.«
Und das tat er dann auch, war er doch ein junger Mann, dazu erzogen, alle Pflichten des Jüngeren gegen die Älteren zu erfüllen; und das umso mehr als jüngerer Sohn ohne Erbe, der seinen eigenen Weg würde gehen müssen und der es deshalb umso nötiger hatte, denen zu gefallen, die Macht und Ansehen besaßen und ihm auf seinem Weg behilflich sein konnten. Er würde zuhören, doch er würde sich nicht umstimmen lassen. Und er brauchte auch keine geneigten Fürsprecher, um seine Ansichten über die Angelegenheit zu unterstützen. Warum sollten Herluins Ansichten darüber von einem ergebenen und stillen jungen Gefolgsmann unterstützt werden, der einem ehemaligen Bruder durch seine bloße Gegenwart eine Pflicht aufzwingen wollte, die nicht länger die seine war und die er nur irrtümlicherweise und aus den falschen Gründen auf sich genommen hatte?
»Ihr wünscht gewiss, unter vier Augen zu beratschlagen«, sagte Cadfael und folgte dem Subprior die Steintreppe hinauf zur Eingangstür. »Mit deiner Erlaubnis, Sulien, werden dieser junge Bruder und ich bei deiner Mutter vorbeischauen. Natürlich nur, wenn sie sich wohl fühlt und gewillt ist, Besuch zu empfangen.«
»Den Euren immer!«, erwiderte Sulien mit einem aufblitzenden Lächeln über seine Schulter hinweg. »Und ein neues Gesicht wird ihr Freude machen. Ihr wisst, wie sie das Leben und die Welt jetzt betrachtet – sehr friedfertig!«
Das war nicht immer so gewesen. Donata Blount litt seit Jahren an einer unheilbaren Krankheit, die ihre Kräfte langsam, verbunden mit starken Schmerzen, verzehrte. Erst im letzten Stadium ihrer Körperschwäche hatte sie den Schmerz selbst fast überwunden und sich mit der Welt, die sie verlassen würde, ausgesöhnt, je näher sie dem Tor kam, das sich in eine andere Welt öffnete.
»Es wird bald soweit sein«, sagte Sulien schlicht. Im hohen, dämmrigen Eingang blieb er stehen. »Ich bitte Euch, Vater Herluin, mit mir in die Stube zu treten. Ich werde Euch eine Erfrischung bringen lassen. Mein Bruder ist auf den Feldern. Ich bedauere, dass er Euch nicht begrüßen kann, aber wir wurden über Euer Kommen nicht benachrichtigt. Ihr werdet ihn entschuldigen. Aber da Euer Anliegen mir gilt, ist es vielleicht besser so.« Und zu Cadfael gewandt: »Geht ins Zimmer meiner Mutter. Ich weiß, dass sie wach ist, und seid gewiss, dass Ihr ihr stets willkommen seid.«
Lady Donata, nunmehr ans Bett gefesselt, lag, von Kissen gestützt, in ihrer kleinen Schlafkammer. Die Fensterläden waren geöffnet, und in einer Zimmerecke brannte auf dem nackten Steinfußboden ein Kohlenbecken. Sie war nur noch Haut und Knochen, ihre mageren Hände ruhten auf der Decke wie herabgefallene Lilienblätter, so zart und durchscheinend waren sie. Ihr Gesicht war zu einer zerbrechlichen Maske aus silbrigen Knochen gemeißelt, und in ihren tiefen Augenhöhlen lagen eisblaue Schatten rund um die verblüffende, unvergängliche Schönheit der Augen selbst, die noch immer klar und intelligent und in dem denkbar tiefsten und leuchtendsten Blau erstrahlten. Der Geist in dieser fragilen Hülle war noch lebendig, unbezähmbar und höchst teilnehmend an der Welt ringsum, ohne jede Furcht, sie verlassen zu müssen, und ohne jede Abneigung, zu gehen.
Sie schaute zu ihren Besuchern auf und begrüßte Cadfael mit leiser Stimme, die freilich nichts von ihrer Festigkeit eingebüßt hatte. »Bruder Cadfael, welche Freude, ich habe Euch in diesem Winter kaum gesehen. Ich wäre nicht gern gegangen ohne Eure Abschiedsworte.«
»Ihr hättet mich rufen lassen können«, sagte er und rückte einen Stuhl neben ihr Bett. »Ich bin stets abkömmlich, und Bruder Radulfus würde Eure Bitte nicht abschlagen.«
»Er ist bereits selbst zu mir gekommen«, sagte Donata, »um an Weihnachten meine Beichte abzunehmen. Ich bin ein Schaf seiner Herde. Er vergisst mich nicht.«
»Wie steht’s um Euch?«, fragte er, ihr gelassenes Gesicht betrachtend. Bei Donata bedurfte es keiner Umschweife; sie zog den direkten Weg vor.
»Was die Frage von Leben und Tod anbetrifft«, sagte sie, »ausgezeichnet. Und die Schmerzen ... Ich habe sie überwunden, es ist nicht mehr viel da, um sie zu fühlen oder sie zu beachten, wenn sie sich bemerkbar machen sollten. Ich betrachte das als das Zeichen, auf das ich gewartet habe.« Sie sprach ohne Furcht oder Bedauern, auch ohne Ungeduld, als wäre sie völlig einverstanden damit, die kurze Frist noch abzuwarten. Und sie hob ihre tiefblauen Augen zu dem abseits stehenden jungen Mann.
»Und wen habt Ihr mir da mitgebracht? Ein neuer Gehilfe in Eurem Kräutergarten?«
Tutilo, der dies zu Recht als eine Aufforderung betrachtete, trat näher. Seine großen, runden Augen nahmen ihren Zustand wahr – Jugend und überquellendes Leben, konfrontiert mit dem Tod. Und doch schien er weder bestürzt noch mitleidsvoll. Donata ermutigte nicht zu Mitleid. Der Junge besaß viel Feingefühl und eine rasche Auffassungsgabe.
»Nicht meiner«, erwiderte Cadfael und betrachtete den schlanken jungen Mann, ein aufgeweckter Schüler, wie er zugeben musste, den er gewiss nicht abgelehnt hätte. »Nein, dieser junge Bruder ist mit seinem Subprior aus der Abtei von Ramsey gekommen. Abt Walter ist wieder in seinem Kloster und fordert alle Brüder auf, beim Wiederaufbau der Abtei zu helfen, denn Geoffrey de Mandeville und seine Banditen haben nichts als eine leere Hülle zurückgelassen. Und um Euch alles wissen zu lassen: Subprior Herluin ist augenblicklich in der Stube und gibt sich alle erdenkliche Mühe mit Sulien.«
»Den wird er niemals zurückgewinnen«, sagte Donata fest und überzeugt. »Es hat mich damals sehr bekümmert, dass er dazu verleitet wurde, sich selbst so zu verkennen. Und wenn Geoffrey de Mandeville sonst nichts Gutes getan hat, so hat sein Überfall doch wenigstens bewirkt, dass Sulien zu seinem wahren Selbst zurückgefunden hat. Mein jüngster Sohn«, fuhr sie fort und begegnete Tutilos großen goldenen Augen mit einem nachdenklichen und anerkennenden Lächeln, »war nie für ein Leben als Mönch geschaffen.«
»Das sagte ein Kaiser, wenn ich recht liege«, sagte Cadfael, der sich erinnerte, was Anselm über den Heiligen von Sankt Gallen gesagt hatte, »auch von dem ersten Tutilo, nach dem dieser junge Bruder benannt ist. Denn dies ist Bruder Tutilo, ein Novize aus Ramsey und, wie ich von seinem Subprior erfuhr, kurz vor dem Ende seines Noviziats. Und wenn er seinem Namensgeber nachschlägt, müsste er Maler, Bildhauer, Sänger und Musiker sein. Bedauerlich, sagte König Karl – Karl der Dicke genannt –, wenn ein solches Genie zum Mönch gemacht würde. Er verfluchte den Mann, der das tat. So hat es Anselm jedenfalls erzählt.«
»Und eines Tages«, sagte Donata, wobei sie diesen wohlgestalteten und anmutigen jungen Mann von Kopf bis Fuß betrachtete und mit unverhohlener Bewunderung in sich aufnahm, was sie erblickte, »wird vielleicht irgendein König das Gleiche von diesem hier sagen. Oder irgendeine Frau, natürlich! Seid Ihr ein Vorbild an Tugend, Tutilo?«
»Aus diesem Grund hat man mir diesen Namen gegeben«, sagte der Junge mit ehrlicher Offenheit, und eine leichte Röte stieg von seinem kräftigen Hals bis in seine glatten Wangen, was ihm jedoch nicht das geringste Unbehagen bereitete. Seine Augen, die fasziniert auf Donatas Gesicht ruhten, senkten sich nicht. In die Gelassenheit dieses Antlitzes war etwas von der lange verblichenen Schönheit zurückgekehrt, die Donata noch beeindruckender und bewundernswerter machte. »Ich besitze einige Fertigkeiten in der Musik«, sagte er mit der Gewissheit einer Person, die eines unvoreingenommenen Urteils fähig war, ohne Prahlerei und ohne die eigenen Fähigkeiten herabzusetzen. Kleine Flammen von Neugier und Zuneigung flackerten in Donatas Augen.
»Hervorragend! Dann sollt Ihr zeigen, was Ihr so gut zu meistern wisst«, sagte sie anerkennend. »Die Musik ist für mich der leichteste Weg, den Schlaf zu finden. Mein Trost auch, wenn die Teufel zu lebendig waren. Jetzt schlafen sie, und ich liege wach.« Sie bewegte eine schwache Hand und wies auf eine Truhe, die in einer Ecke des Raumes stand. »Darin findet Ihr ein Psalterium, das schon lange nicht mehr angerührt wurde. Wollt Ihr es ausprobieren? Sicher wäre es dankbar, wenn man es wieder erklingen ließe. In der Diele steht auch eine Harfe, aber niemand kann auf ihr spielen.«
Tutilo trat auf die Truhe zu, um den schweren Deckel zu heben und auf den kostbaren Inhalt darin zu schauen. Er hob das Instrument heraus, kein sehr großes, eines, das man auf den Knien spielen musste, und das die Form einer breiten Schweinsschnauze besaß. Die Art, wie er damit umging, war ein Beweis für Interesse und Liebe zur Musik, und wenn er die Stirn runzelte, dann nur, weil ein Saitenchor gerissen war. Er beugte sich tiefer über die Truhe auf der Suche nach einem Plektron, doch er fand keines und runzelte erneut die Stirn.
»Es gab Zeiten«, sagte Donata, »da schnitzte ich etwa jede Woche aus Federkielen ein neues Plektron. Es tut mir leid, dass wir unsre Pflicht vernachlässigt haben.«
Er antwortete mit einem kurzen, gedankenverlorenen Lächeln, doch seine Aufmerksamkeit galt erneut dem Psalterium. »Ich kann mit den Fingernägeln spielen«, sagte er, trug das Instrument zu ihrem Krankenlager und setzte sich ohne Umstände oder Zögern auf die Bettkante, legte das Psalterium auf seine Knie und ließ die Finger über die Saiten gleiten, die ein sanftes, zitterndes Murmeln von sich gaben.
»Eure Nägel sind zu kurz«, sagte Donata. »Ihr werdet Euch die Fingerkuppen verletzen.«
Immer noch konnte ihre Stimme Farben und Töne heraufbeschwören, die selbst die simpelste Äußerung vielsagend machten. Für Cadfael klang es so, als warnte eine Mutter halb nachsichtig, halb ungeduldig einen Jüngling vor einem vielleicht schmerzhaften Unterfangen. Doch nein, vielleicht weniger eine Mutter, auch keine ältere Schwester, etwas Ferneres als eine Blutsverwandte mit berechtigten Ansprüchen, und dennoch näher. Denn solche Bande, frei von jeder Verpflichtung und Verantwortung, sind auch frei von allen Schranken und können sich so schnell näherkommen, wie sie wollen. Und ihr blieb nur sehr wenig Zeit, um sich Beschränkungen zu unterwerfen. Ob der Junge das bewusst begriff, war nicht zu erkennen, aber er warf ihr einen leuchtenden, klaren Blick zu, der mehr beunruhigt als erstaunt war; seine Finger verweilten einen Augenblick, und er lächelte.
»Meine Fingerkuppen sind wie aus Leder – seht!« Er streckte die Handflächen aus und spreizte die langen Finger. »Ich war über ein Jahr Harfenspieler bei meines Vaters Herrn auf dem Lehnsgut Berton, bevor ich ins Kloster von Ramsey eintrat. Still, jetzt lasst es mich versuchen! Da ein Saitenchor fehlt, müsst Ihr etwaige Makel entschuldigen.« Auch in seiner Stimme schwang ein Hauch von Nachsicht mit, eine Spur von Belustigung, als müsste er einen übertrieben besorgten Älteren von seiner Fertigkeit überzeugen.
Er hatte den Stimmschlüssel in der Kiste neben dem Instrument gefunden und stimmte zunächst die Darmsaiten an den Stiften, in denen sie verankert waren. Das singende Murmeln schwoll an wie zu einem Chor von Insekten auf einer Sommerwiese, und Tutilos tonsurierter Kopf beugte sich völlig versunken über seine Arbeit, während Donata, in ihren Kissen ruhend, ihn unter halbgesenkten Lidern hervor beobachtete, und das umso aufmerksamer, als er ihr jetzt keine Beachtung schenkte. Und doch verband sie eine seltsame Vertrautheit, denn als plötzlich bei aller Anspannung ein leidenschaftliches Lächeln über seine Züge huschte, spielte bei seinem Anblick auch eines um ihre Lippen.
»Wartet, eine der gerissenen Saiten in diesem Chor ist lang genug, um noch brauchbar zu sein. Besser eine als keine, obwohl Euch auffallen wird, wieviel schwächer der Klang ist.« Seine Finger, vom Harfenspiel gestärkt, waren sehr geschickt und hurtig im Umgang mit dem Instrument. »Fertig!« Er strich mit leichter Hand über die Saiten und erzeugte ein sanftes Rinnsal von Tönen. »Drahtsaiten wären lauter und kräftiger als Darm, aber die hier sind ausreichend.«
Und er beugte den Kopf über das Instrument wie ein Falke im Sturzflug und begann mit geschmeidigen, tanzenden Fingern zu spielen. Der alte Resonanzboden vibrierte und bebte unter der Fülle der Klänge, die zu gewaltig schienen, um einen Ausweg durch die ausgesägte Rose in der Mitte zu finden.
Cadfael rückte seinen Stuhl ein wenig vom Bett zurück, um die beiden im Blickfeld zu haben, denn es war interessant, sie zu beobachten. Der Junge war ohne Zweifel höchst begabt. In der Leidenschaft seines Spiels lag fast etwas Beunruhigendes. Es war, als wäre ein Vogel lange Zeit hindurch zum Schweigen verurteilt gewesen, bis seine erstickte Kehle schließlich die Sprache wiedergefunden hatte.
Nach einer kleinen Weile war sein erster Hunger gestillt, und er ging zum moderaten Spiel über, um nunmehr dankbar und anmutig seiner Kunst zu frönen. Der funkelnde, wirbelnde Tanzrhythmus, trotz aller Leidenschaft leicht wie Distelwolle, mäßigte sich zu einer sanften Weise, die für ein so zartes Instrument besser geeignet war. Sogar zu einem Hauch von Wehmut, zu einer Art Ringellied, rhythmisch und melancholisch. Wo hatte er das gelernt? Gewiss nicht in Ramsey; so etwas, dachte Cadfael, wurde dort sicher nicht geschätzt.
Weltverdrossen und wohlvertraut mit der Ironie von Leben und Tod, lag Lady Donata reglos in ihren Kissen und wandte den Blick nicht mehr von dem jungen Mann, der offenbar ihre Gegenwart völlig vergessen hatte. Sie war nicht die Zuhörerschaft, für die er spielte, sondern der tiefe Geist, der ihn aufsog. Sie verschlang ihn mit ihren großen blauen Augen und trank seine Musik, und die war Wein für ihren Durst. Einst, auf seiner Reise durch halb Europa, hatte Cadfael im Gras der Bergwiesen Enzian gesehen, blauer als blau, über die Maßen tiefblau wie ihre Augen. Ihre Lippen, schmerzlich lächelnd, erzählten eine andere Geschichte. Tutilo war für sie bereits kristallklar, sie wusste mehr von ihm als er selbst.
Der liebevoll skeptische Zug um ihren Mund schwand, als er zu singen anhob. Die Melodie war zugleich einfach und erlesen, umfasste nicht mehr als ein halbes Dutzend Noten, und seine Stimme – höher als beim Sprechen und sehr sanft und lieblich – besaß die gleichen Gegensätze, war unschuldig wie die Kindheit und durchdringend wie der Schmerz des Erwachsenseins. Er sang nicht in englischer Sprache, auch nicht in normannisch-französischer, wie England sie kannte, sondern in der langue d’oc, an die Cadfael sich aus vergangenen Zeiten verschwommen erinnerte. Wo hatte dieser Klosternovize diese Weisen der provenzalischen Troubadoure gehört und gelernt? Bei dem Herrn etwa, wo er Harfenspieler gewesen war? Donata verstand kein Südfranzösisch, Cadfael hatte es lange vergessen, aber beide erkannten sofort, dass es ein Liebeslied war. Wehmütig, unerfüllt, ewig hoffend, eine amour de loin, dazu bestimmt, einander nie näherzukommen.
Unvermittelt veränderte sich die Kadenz, die geheimnisvollen Worte verwandelten sich auf magische Weise in »Ave mater salvatoris ...«, und sie waren mitten in der Liturgie des heiligen Martian, bevor sie wahrnahmen, was Tutilo mit der Witterung eines Fuchses längst wahrgenommen hatte – dass die Zimmertür sich geöffnet hatte. Er wollte kein Wagnis eingehen. Zwar war die Tür von einer harmlosen Person, das heißt von Sulien Blount, geöffnet worden, aber dicht hinter ihm stand Subprior Herluin, drohend wie eine Gewitterwolke.
Donata lag lächelnd da und hieß den blitzenden Witz gut, mit dem Tutilo den Kurs so schnell, ohne Bruch, ohne Erröten zu wechseln vermochte. Gewiss, Herluin hatte seine strenge Stirn missbilligend gerunzelt, als er seinen Novizen auf dem Bettrand einer Frau sitzen und ihr zum Vergnügen vorsingen sah; ein Blick auf die Frau selbst in ihrer schwindenden und dennoch beängstigenden Würde entwaffnete ihn indes sogleich. Es traf ihn umso mehr, als sie nicht alt, sondern in ihrer Blüte verwelkt war.
Tutilo erhob sich bescheiden, drückte das Psalterium an seine Brust und zog sich, die Augen niedergeschlagen, pflichtbewusst in eine Ecke des Raumes zurück. Wenn er nicht zu ihr hinüberschaute, vermutete Cadfael, sah er sie umso deutlicher.
»Mutter«, sagte Sulien, ernst und ein wenig ungelenk noch von der kleinen zurückliegenden Auseinandersetzung, »dies hier ist Subprior Herluin, mein einstiger Lehrer in Ramsey, der dir wohlgesinnt ist und für dich zu beten verspricht. Heiße ihn, wie ich, im Namen meines Bruders willkommen.«
In Abwesenheit von Sohn und Schwiegertochter sprach sie gebieterisch für sie beide. »Vater, betrachtet unser Haus als das Eure. Euer Besuch ehrt uns. Es war für uns alle eine erfreuliche Nachricht, dass Ramsey wieder dem Dienste Gottes übergeben wurde.«
»Gott hat uns fürwahr erhört«, sagte Herluin behutsam und weniger bestimmt als sonst, denn ihr Anblick hatte ihn erschüttert. »Aber es gibt noch viel für den Wiederaufbau unseres Hauses zu tun, und wir benötigen jeden Mann, der zur Hilfe überredet werden kann. Ich hatte gehofft, Euren Sohn mit mir zu nehmen, aber es scheint, ich darf ihn nicht länger Bruder nennen. Seid aber dennoch gewiss, dass er und Ihr in meinen Gebeten sein werdet.«
»Und ich«, sagte Donata, »will in meinen Gebeten an Ramsey denken. Aber wenn das Haus Blount Euch auch einen Bruder verweigert hat, könnten wir dennoch auf andere Weise helfen.«
»Wir erbitten die Barmherzigkeit aller guten Menschen«, erwiderte Herluin eifrig, »in welcher Form es auch sei. Unser Haus ist zerstört, und man ließ uns nichts als das nackte Mauerwerk, selbst die Wandtäfelungen wurden verbrannt oder man hat sie mitgenommen.«
»Ich habe versprochen«, sagte Sulien, »nach Ramsey zurückzukehren und, wenn die Zeit es erlaubt, einen Monat lang selbst Hand anzulegen.« Er hatte sich noch nicht gänzlich von dem Schuldgefühl befreit, den Weg verlassen zu haben, den er törichter- und irrtümlicherweise eingeschlagen hatte. Er schätzte sich glücklich, sich mit harter Arbeit freikaufen und sein Gewissen entlasten zu können, bevor er seine Braut heimführte. Und Pernel Otmere würde ihm zustimmen und ihn gehen lassen.
Herluin dankte ihm für das Angebot, wenn er auch nicht große Begeisterung zeigte, vielleicht zweifelte er noch, dass dieser aufsässige junge Mann überhaupt für Ramsey zu arbeiten willens war.
»Ich werde auch mit meinem Bruder sprechen«, fuhr Sulien ernst fort, »und sehen, was wir sonst noch tun können. Es wird jetzt Holz geschlagen; sicher gibt es auch abgelagertes. Aus den Waldungen werden einige gutgewachsene Bäume gefällt. Ich will meinen Bruder um eine Ladung Bauholz für den Wiederaufbau bitten, und ich bin sicher, er wird mir das zugestehen. Ich werde auf meinen Anteil verzichten, bis ich in des Königs Dienste in Shrewsbury eintrete. Kann das Kloster einen Wagen für den Transport stellen? Eudo kann seinen Wagen nicht so lange entbehren.«
Dieses opportune Angebot wurde von Herluin mit weit größerer Wärme entgegengenommen. Er war noch immer verstimmt, so dachte Cadfael, dass es ihm nicht gelungen war, allen Argumenten Suliens zu begegnen und den Abtrünnigen mit heimzunehmen, nicht nur für die in Aussicht gestellte Monatsfrist, sondern für immer. Nicht dass Sulien selbst von großem Wert war, aber Herluin war es nicht gewohnt, auf solch hartnäckigen Widerstand zu stoßen. Alle Barrieren hätten beim Schmettern seiner Posaunen fallen müssen, wie die Mauern von Jericho.
Immerhin hatte er alles, was in seiner Macht stand, herausgeholt, und schickte sich deshalb an, Abschied zu nehmen. Die Ohren gespitzt, die Augen demütig gesenkt, hob Tutilo leise den Deckel der Truhe und legte das Instrument hinein, das er eben noch ans Herz gedrückt hatte. Die betonte Behutsamkeit, mit der er es verstaute und dann langsam den Deckel niederließ, bewirkte ein kurzes Zucken um Donatas fahlen Mund.
»Ich möchte Euch um eine Gunst bitten, wenn Ihr mich erhören wollt«, sagte sie. »Euer Singvogel hat mir Freude und Behagen bereitet. Würdet Ihr mir, während Ihr hier in Shrewsbury weilt, diesen Trost für eine Stunde ausleihen, wenn ich nicht schlafen kann und Schmerzen erleide? Ich werde ihn nur rufen lassen, wenn ich seiner wirklich bedarf. Werdet Ihr ihn zu mir kommen lassen?«
Sollte Herluin durch eine solche Bitte überrascht worden sein, so war er doch scharfsinnig genug, zu erkennen, dass er ihr gegenüber im Nachteil war; auch wenn er wohl hoffte, so dachte Cadfael, dass es ihr nicht recht bewusst war. In dieser Hoffnung täuschte er sich jedoch. Sie wusste nur zu gut, dass er ihr die Bitte nicht abschlagen konnte. Einen leicht zu beeinflussenden Novizen bei einer Frau musizieren zu lassen, noch dazu einer Frau im Bett, war undenkbar, ja skandalös. Nur war diese Frau so vertraut mit dem Tode, dass ihre Stimme schon das leise Knarren der sich öffnenden Tür in jene andere Welt vernehmen ließ und die durchscheinende Blässe der körperlosen Seele bereits in ihrem Gesicht gegenwärtig war. Sie war nicht mehr empfänglich für die Schicklichkeiten dieser Welt, noch fürchtete sie die schrecklichen Zweifelhaftigkeiten der kommenden.
»Musik bringt mir Frieden«, sagte sie und wartete geduldig auf seine Zustimmung. Der junge Mann in seiner Ecke stand stumm und ergeben da, aber unter den langen gesenkten Wimpern leuchteten seine bernsteinfarbenen Augen erfreut, ernst, wachsam.
»Wenn Ihr in äußerster Not nach ihm ruft«, entgegnete Herluin schließlich, seine Worte sorgfältig wählend, »wie könnte unser Orden eine solche Bitte ausschlagen? Wenn Ihr nach ihm ruft, wird Bruder Tutilo kommen.«
Zweites Kapitel
Kein Zweifel, wie er zu seinem Namen gekommen ist«, sagte Cadfael, als er sich am nächsten Morgen nach dem Hochamt in Bruder Anselms Klosterwerkstatt aufhielt. »So entzückend wie eine Lerche.«
Sie hatten die Lerche soeben singen gehört und in der Nische des Kantors innegehalten, um zuzusehen, wie sich die Kirchgänger, darunter auch die Besucher aus dem Gästehaus, zerstreuten. Für Unterkunftsuchende war es ratsam, wenn auch nicht verpflichtend, wenigstens die wichtigste Messe des Tages zu besuchen. Im Monat Februar gab es für Bruder Denis, den Hospitarius, nicht allzu viel zu tun, dennoch waren immer ein paar Reisende auf der Suche nach Quartier.
»Der Junge ist hochbegabt«, stimme Anselm zu. »Ein feines Gehör und ein ausgezeichnetes Gespür für Wohlklang. Allerdings keine Stimme für einen Chor«, fügte er hinzu, »dazu sticht sie zu sehr hervor. Dieses Licht lässt sich nicht unter den Scheffel stellen.«
Das brauchte man nicht länger zu erörtern; das Urteil war bereits gefällt. Niemand, an dessen Ohr dieser reine, strahlende und dabei doch so sanfte Gesang gedrungen war, hätte das bestreiten können. Es war undenkbar, diese Stimme der Namenlosigkeit eines Chores unterzuordnen. Cadfael fragte sich, ob es nicht ebenso kurzsichtig war, zu versuchen, den Besitzer dieser Stimme zu einer angepassten Seele in einer disziplinierten Bruderschaft machen zu wollen.
»Bruder Denis’ provenzalischer Gast hat, als er den Jungen vernahm, sogleich die Ohren gespitzt«, bemerkte Anselm. »Gestern Abend bat er Herluin, ihn am Probesingen in der Halle teilnehmen zu lassen. Dorthin gehen sie jetzt. Ich soll seinen Rebec neu besaiten. Ich kann nur betonen, wie er seine Instrumente liebt.«