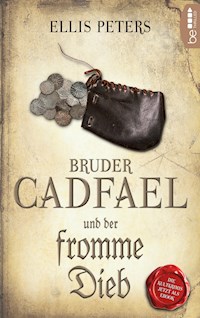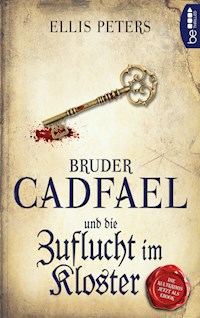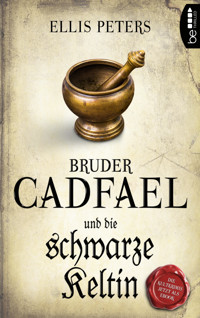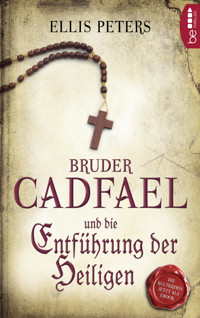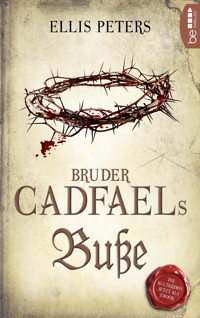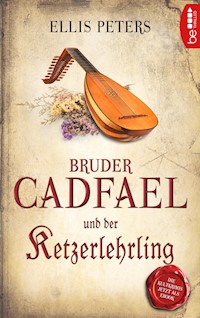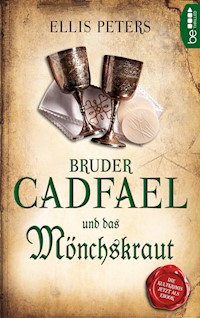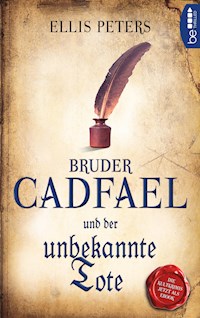
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für den Mönch
- Sprache: Deutsch
Die Kult-Krimi-Serie endlich als eBook!
Frühsommer 1138. In England herrscht Bürgerkrieg - und in Shrewsbury tobt eine Schlacht. Die Burg wird erobert und die gefangenen Soldaten, 94 an der Zahl, gehängt. Bruder Cadfael wird aufgetragen, die Leichen zu bestatten. Doch zu seiner Überraschung findet er einen Leichnam zu viel! Schnell stellt Cadfael fest, dass einer der Toten nicht am Galgen starb, sondern erdrosselt wurde ... Doch wer ist dieser Tote? Und wer hat die Kriegswirren benutzt, um einen Mord zu begehen?
Der Krimi ist in einer früheren Auflage bereits unter dem Titel "Bruder Cadfael und ein Leichnam zuviel" erschienen.
Über die Reihe: Morde und Mysterien im finstersten Mittelalter des 12. Jahrhunderts liefern den perfekten Hintergrund für die spannenden Abenteuer des Bruders Cadfael, eines ehemaligen Kreuzritters, der sich als Mönch in die Abtei St. Peter & Paul nahe Shrewsbury zurückgezogen hat. Doch ein ruhiges Leben als Kräutergärtner und Heilkundiger ist ihm nicht vergönnt: Immer wieder muss er seine detektivischen Fähigkeiten einsetzen, um Verbrechen in der Gemeinde aufzuklären.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Cover
Weitere Titel der Autorin
Über dieses Buch
Über die Reihe
Über die Autorin
Titel
Impressum
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
Bruder Cadfaels nächster Fall
Weitere Titel der Autorin
Bruder Cadfael und die Entführung der Heiligen
Bruder Cadfael und das Mönchskraut
Bruder Cadfael und der Aufstand auf dem Jahrmarkt
Bruder Cadfael und der Hochzeitsmord
Über dieses Buch
Frühsommer 1138. In England herrscht Bürgerkrieg – und in Shrewsbury tobt eine Schlacht. Die Burg wird erobert und die gefangenen Soldaten, 94 an der Zahl, gehängt. Bruder Cadfael wird aufgetragen, die Leichen zu bestatten. Doch zu seiner Überraschung findet er einen Leichnam zu viel! Schnell stellt Cadfael fest, dass einer der Toten nicht am Galgen starb, sondern erdrosselt wurde ... Doch wer ist dieser Tote? Und wer hat die Kriegswirren benutzt, um einen Mord zu begehen?
Der Krimi ist in einer früheren Auflage bereits unter dem Titel »Bruder Cadfael und ein Leichnam zuviel« erschienen.
Über die Reihe
Morde und Mysterien im finsteren Mittelalter des 12. Jahrhunderts liefern den perfekten Hintergrund für die spannenden Abenteuer des Bruders Cadfael, eines ehemaligen Kreuzritters, der sich als Mönch in die Abtei St. Peter & Paul nahe Shrewsbury zurückgezogen hat. Doch ein ruhiges Leben als Kräutergärtner und Heilkundiger ist ihm nicht vergönnt: Immer wieder muss er seine detektivischen Fähigkeiten einsetzen, um Verbrechen in der Gemeinde aufzuklären.
Über die Autorin
Ellis Peters ist das Pseudonym der 1913 geborenen englischen Autorin Edith Pargeter. Ihre Bruder-Cadfael-Reihe erschien in 15 Sprachen und mehr als 20 Ländern und wurde erfolgreich von der BBC verfilmt. Ihr Wissen als Apothekenhelferin war der Ausgangspunkt für den kräuterkundigen Bruder Cadfael. Ellis Peters starb im Oktober 1995.
Ellis Peters
Bruder Cadfael und der unbekannte Tote
Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren
beTHRILLED
Digitale Erstausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 1979 by Ellis PetersTitel der britischen Originalausgabe: »One Corpse Too Many«
Originalverlag: Macmillan, London
Für die deutschsprachige Erstausgabe:
Copyright © 1985 der deutschen Übersetzung
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: »Ein Leichnam zuviel«
Verlag: Wilhelm Heyne Verlag GmbH & Co. KG, München
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat/Projektmanagement: Rebecca Schaarschmidt
Covergestaltung: Thomas Krämer unter Verwendung von Motiven © shutterstock: Color Symphony | optimarc | Andrey_Kuzmin | BrAt82
eBook-Erstellung: 3WplusP, Rimpar
ISBN 978-3-7325-6927-4
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
KAPITEL 1
Bruder Cadfael arbeitete in dem kleinen Küchengarten, der neben dem Fischteich des Abtes lag, als man den Jungen zu ihm brachte. Es war ein heißer Mittag im August, und wenn er genügend Helfer gehabt hätte, so wären sie um diese Zeit wahrscheinlich schnarchend im Schatten gelegen, anstatt in der sengenden Sonne zu schwitzen; aber der einzige ihm zugeteilte Gehilfe, der sein Noviziat noch nicht beendet hatte, hatte die Meinung über seine Berufung zum Klosterleben geändert und sich aufgemacht, um im Bürgerkrieg um die Krone Englands an der Seite seines älteren Bruders für König Stephen zu kämpfen; der andere, dessen Familie für die Kaiserin Maud eintrat, hatte angesichts des Näherrückens der königlichen Armee Angst bekommen. Das elterliche Rittergut in Cheshire erschien ihm weit sicherer als das belagerte Shrewsbury. So war Cadfael also ganz auf sich gestellt, aber er hatte in seinem Leben schon unter glühenderen Sonnen als dieser gearbeitet, und er war fest entschlossen, das ihm anvertraute Reich nicht verkommen zu lassen, ganz gleich, ob die Welt um ihm herum im Chaos unterging oder nicht.
In diesem Frühsommer 1138 dauerte der Bruderkrieg, der bis jetzt einen eher planlosen Verlauf genommen hatte, schon zwei Jahre, aber noch nie vorher war Shrewsbury so unmittelbar betroffen gewesen. Wie der Schatten des Todes hing die Drohung nun über Burg und Stadt. Dennoch waren Bruder Cadfaels Gedanken nicht auf Zerstörung und Krieg gerichtet, sondern stets auf Leben und Wachstum, und er ahnte nicht, dass eine andere Art des Tötens, nämlich gemeiner Mord, der selbst in diesen gesetzlosen Zeiten ein hinterhältiges Verbrechen war, schon bald den Frieden seines Daseins stören sollte.
Normalerweise hätte er im August nicht so viel im Garten zu tun gehabt, aber für einen allein gab es mehr als genug Arbeit, die erledigt werden musste. Man hatte ihm Bruder Athanasius als Hilfe angeboten, aber der war taub, ziemlich senil und konnte eine Heilpflanze nicht von Unkraut unterscheiden. Also hatte Cadfael das Angebot abgelehnt. Alleine kam er weit besser zurecht. Ein Beet für die späten Kohlarten musste vorbereitet und die Samen der winterfesten Sorten ausgesät werden, die Erbsen mussten geerntet und die vertrockneten Halme der ersten Getreideernte eingebracht werden, für Futter und Streu. Und in dem Holzverschlag im Herbarium, auf das er besonders stolz war, hatte er außer Kräuterweinen, die jetzt blubbernd goren, in Glasgefäßen und Mörsern auf den Regalen ein halbes Dutzend Essenzen angesetzt, nach denen er mindestens einmal täglich schauen musste. Jetzt war Erntezeit für die Heilkräuter, und er musste alle Arzneien zubereiten, die man im Winter brauchen würde.
Es entsprach nicht seiner Art, irgendeinen Teil seines kleinen Königreiches verkommen zu lassen, wie schlimm der Kampf um den englischen Thron zwischen den Geschwisterkindern Stephen und Maud außerhalb der Klostermauern auch tobte. Als er Kompost auf das Kohlbeet verteilte, konnte er die Rauchschwaden sehen, die sich über den Dächern des Klosters, der Stadt und der Burg drüben zusammenballten, und den ätzenden Gestank des Brandes gestern riechen. Diese Brandwolken und der üble Geruch hingen nun schon seit fast einem Monat wie eine Dunstglocke über Shrewsbury, während König Stephen in seinem Lager vor der Burgsiedlung wütete und tobte. Das Lager blockierte, wenn man von den Brücken absah, die einzige Zufahrt zur Stadt, und William FitzAlan, der ein banges Auge auf seine dahinschwindenden Vorräte hatte, hielt die Burg mit wilder Entschlossenheit und überließ es seinem unverbesserlichen Onkel Arnulf von Hesdin, der nie gelernt hatte, dass Vorsicht der bessere Teil der Tapferkeit ist, die Belagerer mit den wüstesten Verwünschungen zu bedenken. Die Einwohner der Stadt zogen die Köpfe ein, verbarrikadierten ihre Türen und schlossen ihre Geschäfte oder flohen, wenn sie konnten, westwärts nach Wales, zu alten, vertrauten Feinden, die man weniger zu fürchten hatte als Stephen. Den Walisern passte es sehr gut, dass die Engländer – sofern man Maud und Stephen überhaupt als Engländer bezeichnen konnte! – sich gegenseitig bekämpften und Wales in Ruhe ließen, und sie halfen den Flüchtlingen bereitwillig, vorausgesetzt, der Krieg ging munter weiter.
Cadfael richtete sich auf und wischte sich den Schweiß auf seiner Tonsur ab; die kahle Stelle auf seinem Kopf war von der Sonne so verbrannt, dass sie aussah wie eine verschrumpelte Haselnuss. Bruder Oswald, der Almosenverwalter, kam den Pfad herunter eilig auf ihn zu. Die Schöße seiner Kutte flatterten, und er schob einen etwa 16jährigen Jungen vor sich her, der, wie die Bauern der Gegend, einen groben Kittel und eine kurze Hose trug. Er hatte keine Strümpfe, aber sehr ordentliche, lederne Schuhe an und wirkte alles in allem frisch gewaschen und für einen besonderen Anlass ausstaffiert. Der Junge ließ sich willig leiten und hatte die Augen in nervöser Demut niedergeschlagen. Noch eine Familie, die dafür sorgt, dass ihre Kinder nicht für eine der beiden Seiten zum Kriegsdienst gezwungen wird, dachte Cadfael, und man kann es ihnen auch kaum verdenken.
»Ich glaube, du brauchst einen Gehilfen, Bruder Cadfael, und hier ist ein Junge, der behauptet, dass er harte Arbeit nicht scheut. Eine Frau aus der Stadt hat ihn zum Pförtner gebracht und gebeten, er möge aufgenommen und erzogen werden wie ein Laienbruder. Er ist ihr Neffe aus Hencot, sagt sie. Seine Eltern sind tot. Sie hat ihm Unterhaltsgeld für ein Jahr mitgegeben. Prior Robert hat Erlaubnis gegeben, ihn aufzunehmen, und im Dormitorium der Jungen ist noch Platz. Er wird mit den anderen Novizen am Unterricht teilnehmen, aber ein Gelübde braucht er erst ablegen, wenn er selber es will. Was meinst du – willst du ihn haben?«
Cadfael betrachtete den Jungen mit Interesse, und da er froh war, eine junge und willige Arbeitskraft zu bekommen, war er, ohne lange zu überlegen, einverstanden. Der Knabe war zart gebaut, machte aber einen lebhaften und sicheren Eindruck und bewegte sich flink. Er blinzelte aufmerksam unter einem zurechtgestutzten Gewirr brauner Locken hervor. Seine Augen mit den langen Wimpern waren dunkelblau und machten einen hellwachen und intelligenten Eindruck. Zwar benahm er sich bescheiden und wohlerzogen, aber er wirkte keineswegs verschüchtert.
»Ich nehme dich herzlich gerne«, sagte Cadfael, »wenn dir die Arbeit an der frischen Luft mit mir zusagt. Wie heißt du, mein Junge?«
»Godric«, kam die Antwort mit leiser, belegter Stimme. Der Knabe musterte Cadfael ebenso eingehend wie dieser ihn.
»Nun gut, Godric, ich glaube, wir werden ganz gut miteinander auskommen. Zuerst werde ich dir den Garten zeigen, wenn du magst, und dir erklären, welche Arbeiten erledigt werden müssen. Du wirst dich natürlich noch an das Leben innerhalb dieser Mauern gewöhnen müssen. Vielleicht wirst du es recht seltsam finden, aber immerhin ist es hier sicherer als in der Stadt dort drüben, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum deine brave Tante dich zu uns gebracht hat.«
Der Junge warf ihm aus seinen blauen Augen einen kurzen Blick zu, schlug sie aber sofort wieder nieder.
»Begleite nachher Bruder Cadfael zur Vesper«, wies ihn der Almosenverwalter an, »und nach dem Abendessen wird Bruder Paul, der Aufseher der Novizen, dir dein Bett zeigen und dich über deine Pflichten aufklären. Beherzige, was Bruder Cadfael dir sagt, und sei so folgsam, wie es von dir erwartet wird.«
»Ja, Herr«, sagte der Junge gehorsam. Unter der demütigen Oberfläche ließ sich ein kleines Lachen erahnen. Als Bruder Oswald davoneilte, folgten ihm die blauen Augen, bis er außer Sichtweite war, und richteten sich dann auf Cadfael. Der Junge wirkte verschlossen; er hatte ein schmales Gesicht mit einem großen Mund, der sicher gerne lachte, aber schnell wieder in ernste Schwermut verfiel. Es waren harte Zeiten, auch für Menschen heiteren Charakters.
»Komm, schau dir mal an, welche Art von Arbeit auf dich wartet«, sagte Cadfael aufmunternd und legte den Spaten beiseite, um seinen neuen Gehilfen durch den eingezäunten Garten zu führen und ihm das Gemüse, die Kräuter, die die Mittagsluft mit ihrem Duft erfüllten, die Fischteiche und die Erbsenbeete zu zeigen, die fast bis hinunter an den Bach reichten. Das erste Feld war schon abgeerntet, aber auf dem später gesäten Feld hingen die Hülsen schwer und erntereif.
»Die müssen heute und morgen abgeerntet werden. In dieser Hitze dauert es nur einen Tag, und sie verderben. Und diese abgeernteten Beete müssen dann gejätet werden. Damit kannst du anfangen. Zieh die Pflanzen nicht heraus, sondern nimm die Sichel und schneide sie knapp über dem Boden ab. Die Wurzeln werden wir einpflügen – sie sind ein guter Dünger für den Boden.« Er sprach leichthin und aufgeräumt, um den Jungen nicht zu verschrecken. »Wie alt bist du eigentlich, Godric?«
»17«, hörte er die heisere Stimme neben sich. Für 17 war der Junge recht zierlich; sollte er sich später beim Umgraben versuchen, würde er sich schwertun.
»Ich kann gut arbeiten«, sagte der Junge, als habe er den Gedanken erraten und sich darüber geärgert. »Ich weiß zwar nicht viel, aber ich werde alles tun, was Ihr mir sagt.«
»Das sollst du auch, und du wirst also mit den Erbsen anfangen. Lege die trockenen Stängel hierher – das gibt eine gute Streu für die Ställe. Die Wurzeln kommen wieder in die Erde.«
»Wie die Menschen«, sagte Godric unvermutet.
»Ja, wie die Menschen.« In diesem Bruderkrieg wurden zu viele vor ihrer Zeit beerdigt. Cadfael bemerkte, wie der Junge fast unwillkürlich seinen Kopf wandte und über das Gelände und die Dächer des Klosters auf die Burg sah, deren halbzerstörte Türme aus einer Rauchwolke aufragten. »Sind welche von deiner Familie dort drüben?«, fragte Cadfael leise.
»Nein!«, erwiderte der Junge schnell – zu schnell. »Aber ich muss immer an sie denken. In der Stadt sagen sie, dass es nicht mehr lange dauern kann, dass sie vielleicht schon morgen fällt. Und doch haben sie sicher das Richtige getan! Bevor König Henry starb, ließ er die Prinzessin Maud von seinen Baronen als Nachfolgerin bestätigen, und alle haben ihr Gefolgschaft geschworen. Sie war sein einziges Kind, und sie musste Königin werden. Und doch: Als ihr Vetter, Graf Stephen, sich auf den Thron setzte und sich krönen ließ, vergaßen nur zu viele ihren Eid und waren einverstanden. Das kann nicht recht sein! Und es kann nicht falsch sein, treu zur Kaiserin zu stehen! Wie können sie ihren Seitenwechsel rechtfertigen? Wie können sie behaupten, dass Graf Stephens Anspruch zu Recht besteht?«
»Zu Recht mag vielleicht das falsche Wort sein, aber es gibt Herren, die sagen, es sei besser, einen Mann als Herrscher zu haben als eine Frau, und das sind weit mehr als jene, die der gegenteiligen Ansicht sind. Und wenn man einen Mann will – nun ja, Stephen stand dem Thron so nahe wie jeder andere. So wie Maud die Enkelin, so ist er ein Enkel von König William.«
»Aber er ist nicht der Sohn des letzten Königs. Und mit König William ist er nur durch seine Mutter verwandt, einer Frau, wie Maud eine ist. Wo ist da also der Unterschied?« Der Junge sprach jetzt nicht mehr verhalten und gedämpft, sondern mit erregter Stimme. »Der eigentliche Unterschied liegt darin, dass Graf Stephen dahergekommen ist und sich genommen hat, was er wollte, während die Kaiserin weit weg in der Normandie war und nichts Böses ahnte. Und jetzt, da die Hälfte der Barone sich ihres Eides erinnert und sich schließlich wieder zu ihr bekennt, ist es fast zu spät, und was soll daraus entstehen außer Blutvergießen und Tod? Hier in Shrewsbury beginnt es, aber das wird erst der Anfang sein.«
»Vertraust du mir nicht zu sehr, mein Kind?«, fragte Cadfael.
Der Junge, der die Sichel in die Hand genommen hatte und sie hin- und herschwang, wandte sich um und sah ihn aus seinen blauen Augen gerade und aufrichtig an. »Ja, das tue ich«, sagte er.
»Und das kannst du auch. Aber sei vorsichtig in Gegenwart anderer. Unsere Tore sind keinem verschlossen, und hier bist du dem Schlachtfeld so nahe wie in der Stadt. Viele Menschen kommen hierher, und in Zeiten wie diesen wollen sich manche durch das Weitererzählen dessen, was sie gehört haben, Vergünstigungen erkaufen. Manche leben sogar vom Sammeln von Geschichten. In deinem Kopf sind deine Gedanken am sichersten – das Beste ist, du behältst sie dort.«
Der Junge trat einen Schritt zurück und ließ den Kopf hängen. Vielleicht fühlte er sich getadelt, vielleicht auch nicht. »Ich werde mit dir so offen sein, wie du es mir gegenüber bist«, sagte Cadfael. »Zwischen diesen beiden Herrschern gibt es in meinen Augen keine wirkliche Wahl, aber ich respektiere es, wenn ein Mann seinen Treueschwur hält. Und jetzt geh an die Arbeit. Wenn ich mit meinem Kohlbeet hier fertig bin, werde ich dir helfen.«
Er sah, dass der Junge mit großem Eifer arbeitete. Der grobe Kittel war sehr weit geschnitten und wurde in der Taille von einem Gürtel gehalten, was dem geschmeidigen Körper des Jungen das Aussehen eines unförmigen Kleiderbündels gab; möglicherweise hatte er ihn von einem älteren und größeren Verwandten geerbt, der ihn zu schäbig gefunden hatte. Mein Freund, dachte Cadfael, bei dieser Hitze wirst du solch ein Arbeitstempo nicht lange durchhalten können, und dann werden wir sehen!
Als er an der Seite seines neuen Helfers im raschelnden Erbsenstroh arbeitete, war der Junge rot im Gesicht und schwitzte. Er atmete schwer, aber sein Arbeitstempo behielt er bei. Cadfael trug einen Arm voll getrockneter Halme an den Rand des Feldes und sagte: »Wir machen hier keine Zwangsarbeit, Junge. Mach dir den Oberkörper frei, dann fällt die Arbeit leichter.« Und er streifte seine Kutte, die er schon bis zum Knie geschürzt hatte, von seinen starken, sonnengebräunten Schultern, so dass sie, von seinem Gürtel gehalten, herabhing.
Die Reaktion war merkwürdig. Der Junge hielt kurz inne und sagte mit bewundernswerter Gelassenheit: »Danke, es geht ganz gut so!« Aber seine Stimme war nicht so tief und heiser wie vorher, und als er die Arbeit wieder aufnahm, stieg eine deutliche Röte über den schlanken Hals in seine Wangen. Durfte man daraus die naheliegenden Schlüsse ziehen? Möglicherweise hatte er ein falsches Alter angegeben – der Stimmbruch war vielleicht noch nicht lange her. Und vielleicht trug er unter seinem Kittel kein Hemd und schämte sich, seinem neuen Bekannten dies einzugestehen. Nun ja, es gab ja noch andere Methoden. Aber dieses Problem sollte besser gleich geklärt werden. Wenn das, was Cadfael vermutete, der Wahrheit entsprach, musste die ganze Angelegenheit wohl bedacht werden.
»Da ist schon wieder dieser Reiher und räubert in unseren Fischteichen!«, rief er plötzlich und wies mit ausgestrecktem Finger auf den Meole-Bach, in dem der Vogel watete. Gerade legte er seine riesigen Schwingen zusammen.
»Wirf einen Stein hinüber, Junge! Du bist näher dran als ich.« Der Reiher ließ sich nur selten sehen und war gewiss kein Räuber, aber wenn Cadfael Recht hatte, würde ihm schwerlich etwas geschehen.
Godric hob einen Stein auf und warf ihn in die Richtung des Vogels. Er holte weit aus, legte das ganze Gewicht seines schmächtigen Körpers in den Schwung und schleuderte den Stein in die seichte Stelle des Baches. Obwohl er den Reiher um mehrere Meter verfehlte, schreckte das Klatschen den Vogel auf.
»So, so!«, dachte Cadfael und begann scharf nachzudenken.
In seinem Heerlager, das sich von einer Schleife des Flusses Severn zur nächsten erstreckte und damit den gesamten Landzugang zur Burgsiedlung blockierte, feierte und wütete König Stephen. Er belohnte die wenigen loyalen Einwohner von Shrewsbury – loyal ihm gegenüber! –, die ihm ihre Gefolgschaft anboten, und plante seine Rache an den vielen, die nicht erschienen waren.
Er war ein großer, lauter, gutaussehender und einfältiger Mann mit sehr hellem Haar und einem sehr gut geschnittenen Gesicht. Im Augenblick war er völlig verwirrt über den Widerstreit zwischen seiner angeborenen Gutmütigkeit und dem schmerzhaften Gefühl, dass ihm Unrecht widerfuhr. Es hieß, er sei etwas langsam von Begriff, aber als sein Onkel Henry gestorben war und keinen Erben, außer einer Tochter, hinterlassen hatte (die, wenn sich auch die Vasallen ihres Vaters gehorsam seinem Willen gebeugt und sie als Königin anerkannt hatten, durch ihren aus Anjou stammenden Ehemann benachteiligt war und sich in Frankreich aufhielt), da jedenfalls hatte Stephen mit bewundernswerter Schnelligkeit und Entschlossenheit reagiert. Er hatte seine potentiellen Untertanen dazu gebracht, ihn als Herrscher zu akzeptieren, noch bevor sie ihre eigenen Interessen abwägen, geschweige denn sich an ihren widerwillig geleisteten Treueeid erinnern konnten. Warum also schien dieser anfangs so erfolgversprechende Staatsstreich auf einmal schiefzugehen? Das würde er nie verstehen. Warum hatte sich die Hälfte der einflussreichen Adligen, die er für eine Zeitlang so verschreckt hatte, dass sie nichts unternahmen, nun plötzlich gegen ihn erhoben? Plagten sie Gewissensbisse? Waren sie von Widerwillen gegen einen König ergriffen, der die Macht an sich gerissen hatte? Oder hatte sich ihrer gar eine abergläubische Furcht vor König Henry und seinem Einfluss bei Gott bemächtigt?
Stephen war gezwungen, die Opposition gegen ihn ernst zu nehmen. Er hatte zu den Waffen gegriffen und jenen Weg eingeschlagen, der seiner Natur entsprach: Er hatte hart zugeschlagen, wenn er dazu gezwungen war, aber allen, die es sich anders überlegten, die Türen weit offengehalten. Und was war dabei herausgekommen? Dass er seinen Feinden Schonung gewährte, hatte man ausgenutzt und ihn dafür verachtet. Als er nordwärts, in Richtung der Stützpunkte der Rebellen, gezogen war, hatte er Unterwerfung ohne Strafgericht angeboten, aber der Adel hatte sich voller Verachtung von ihm abgewandt. Der Angriff, der im Morgengrauen stattfinden sollte, würde das Schicksal der Burg von Shrewsbury besiegeln und ein Exempel statuieren. Wenn sie seiner Aufforderung nicht loyal und friedlich folgen wollten, dann mussten sie eben wie die Ratten angekrochen kommen. Und was Arnulf von Hesdin anging ... Die ehrverletzenden Worte und Beleidigungen, die er von den Zinnen der Burg herabgeschrien hatte, würde er bald bitter, wenn auch nur kurz, bereuen.
Am späten Nachmittag beriet sich der König in seinem Zelt mit Gilbert Prestcote, seinem Ersten Adjutanten, der für den Posten des Statthalters der Grafschaft Shrewsbury vorgesehen war, und Willem Ten Heyt, dem Anführer der flämischen Söldnertruppe.
Etwa zur selben Zeit wuschen sich Bruder Cadfael und Godric die Hände und brachten ihre Kleider in Ordnung, um zum Vespergottesdienst zu gehen.
Die ortsansässigen Adligen hatten ihm keine Truppen zur Verfügung gestellt, und so musste Stephen sich hauptsächlich auf die Flamen verlassen. Man hasste sie, weil sie nicht nur Fremde, sondern auch hartgesottene Berufssoldaten waren, die sich genauso gern betranken, wie sie ein Dorf niederbrannten und nichts dagegen hatten, das eine mit dem anderen zu verbinden. Ten Heyt war ein hünenhafter, gutaussehender Mann mit rotblondem Haar und einem großen Schnurrbart, ein schlachtenerprobter Soldat, obwohl er erst dreißig Jahre alt war. Prestcote, ein ruhiger Edelmann, der nicht viele Worte machte, war über fünfzig, ein erfahrener, ausgezeichneter Kämpfer und ein weiser Ratgeber – sicher kein Mann, der zu extremen Ansichten neigte, aber auch er plädierte jetzt für ein hartes Vorgehen.
»Die Milde, die Ihr habt walten lassen, Euer Gnaden, ist schamlos ausgenutzt worden. Jetzt ist es an der Zeit, die Feinde in Schrecken zu versetzen.«
»Zuerst«, bemerkte Stephen trocken, »müssen wir die Burg und die Stadt einnehmen.«
»Das könnt Ihr als so gut wie geschehen betrachten. Unser Angriff morgen früh wird Euch Shrewsbury in die Hand liefern. Wenn sie ihn überleben, mögt Ihr mit Fitz-Alan, Adeney und Hesdin nach Belieben verfahren; die gemeinen Soldaten der Burg sind zwar unwichtig, aber selbst da mögt Ihr in Betracht ziehen, ob es nicht angebracht wäre, ein Exempel zu statuieren.« Der König wäre zufrieden gewesen, nur an den drei Anführern des örtlichen Widerstandes Rache zu nehmen: William FitzAlan verdankte ihm seinen Posten als Statthalter der Grafschaft Shrewsbury, und dennoch trat er für seine Rivalin Maud ein und hielt die Burg für sie. Fulke Adeney, der mächtigste von FitzAlans Vasallen, hatte bei dem Verrat mitgemacht und war seinem Lehensherrn treu ergeben. Und Hesdins arrogantes Mundwerk hatte ihm sein Urteil selbst gesprochen. Der Rest waren unwichtige Bauern.
»Ich habe gehört, dass man sich in der Stadt erzählt«, sagte Prestcote, »FitzAlan habe seine Frau und seine Kinder schon fortgeschickt, bevor wir den nördlichen Zufahrtsweg zur Stadt blockiert haben. Aber Adeney hat auch ein Kind, eine Tochter. Sie soll noch immer in der Stadt sein. Man hat die Frauen schon früh aus der Burg geschafft.« Prestcote stammte aus der Grafschaft und kannte den örtlichen Adel zumindest dem Namen nach. »Adeneys Tochter wurde schon als Kind Robert Beringars Sohn aus Maesbury bei Oswestry zur Frau versprochen. Ihre Ländereien grenzten dort aneinander an. Ich erwähne das, weil dieser Mann, Hugh Beringar aus Maesbury, um Audienz bei Euch bittet. Ihr mögt ihn einsetzen, wie Ihr wollt, aber bis heute hätte ich gesagt, er sei FitzAlans Mann und folglich Euer Feind. Bittet ihn herein und seht selber. Wenn er die Seite gewechselt hat, gut und schön. Er verfügt über genug Männer, um uns von Nutzen zu sein, aber ich würde es ihm nicht allzu leicht machen.«
Der Wachoffizier hatte den Pavillon betreten und wartete darauf, dass man ihm gestattete zu sprechen; Adam Courcelle, ein bewährter Soldat von etwa dreißig Jahren, war einer von Prestcotes Hauptvasallen und seine rechte Hand.
»Euer Gnaden, Ihr habt noch einen Gast«, sagte er, als der König sich ihm zuwandte. »Eine Dame. Wollt Ihr sie zuerst empfangen? Sie hat noch keine Unterkunft, und es ist schon spät ... Ihr Name ist Aline Siward, und sie sagt, dass ihr erst kürzlich verstorbener Vater immer auf Eurer Seite stand.«
»Die Zeit drängt«, sagte der König. »Lasst beide eintreten, und die Dame mag zuerst sprechen.«
Courcelle führte sie an der Hand herein. Er zollte ihr ganz offensichtlich Hochachtung und Bewunderung, und tatsächlich war sie der Aufmerksamkeit eines jeden Mannes würdig. Sie war zierlich und schüchtern, sicher nicht älter als achtzehn, und der Ernst ihrer Trauer und die weiße Haube mit dem Schleier, aus der einige blonde Locken hervorlugten und ihre Wangen umrahmten, ließen sie noch jünger und verletzlicher erscheinen. Sie strahlte eine zurückhaltende Würde und den Stolz eines Kindes aus. Bei der Begrüßung sah sie den König aus großen dunkelblauen Augen an.
»Mein Fräulein«, sagte Stephen und reichte ihr die Hand, »Euer Verlust, von dem ich eben erst erfahren habe, betrübt mich. Verfügt über mich, wenn mein Schutz Euch in irgendeiner Weise dienlich sein kann.«
»Ihr seid sehr freundlich, Euer Gnaden«, sagte das Mädchen mit leiser, ehrfürchtiger Stimme. »Ich bin jetzt eine Waise und die einzige meines Hauses, die Euch die Treue und Gefolgschaft, die wir Euch schulden, anbieten kann. Ich tue, was mein Vater gewollt hätte. Krankheit und Tod haben ihn daran gehindert und mein Kommen verzögert. Bis Ihr nach Shrewsbury kamt, hatten wir keine Gelegenheit, Euch die Schlüssel der beiden Burgen, die uns gehören, zu übergeben. Das will ich nun tun!«
Ihre Zofe, eine ruhige junge Frau, die etwa zehn Jahre älter war als ihre Herrin, stand abseits. Sie trat nun vor und übergab die Schlüssel Aline, die sie feierlich in die Hände des Königs legte.
»In unseren Diensten stehen fünf Ritter und mehr als vierzig Soldaten, die ich jetzt aber alle in unseren Burgen zurückgelassen habe, da sie dort für Euer Gnaden von größerem Nutzen sind.« Sie zählte ihre Besitzungen und die Namen ihrer Burgvögte auf. Es klang wie bei einem Kind, das ein Gedicht auswendig hersagt, aber sie sprach so würdevoll und ernst wie ein General auf dem Schlachtfeld. »Noch etwas, das mir schwer auf der Seele lastet, will ich offen sagen. Ich habe einen Bruder, der diese Pflicht hätte erfüllen sollen.« Ihre Stimme bebte leicht, aber sie fing sich wieder. »Als Ihr die Herrschaft übernahmt, schlug sich mein Bruder auf die Seite der Kaiserin Maud, und nach einem offenen Streit mit meinem Vater verließ er uns, um für sie zu kämpfen. Ich weiß nicht, wo er sich jetzt befindet, aber es gehen Gerüchte, dass er zu ihr nach Frankreich ist. Ich konnte Euer Gnaden diesen Streit nicht verschweigen, der mich so sehr belastet, wie er Euch betrüben muss. Ich hoffe, Ihr werdet darum nicht ausschlagen, was ich Euch bringe, sondern freien Gebrauch davon machen, wie es mein Vater gewollt hätte und wie ich es will.«
Sie seufzte tief auf, als sei sie jetzt von einer schweren Last befreit. Der König war entzückt. Er zog sie an sich und küsste sie herzlich auf die Wange. Auf Courcelles Gesicht stand deutlich der Neid geschrieben.
»Gott bewahre, mein Kind«, sagte der König. »Ich will keinen weiteren Kummer auf Eure Schultern laden, sondern Euch nach Kräften entlasten. Von ganzem Herzen nehme ich Eure Gefolgschaft an, und sie ist mir so lieb wie die eines Grafen oder Barons. Ich danke Euch für die Mühsalen, die Ihr auf Euch genommen habt, um mir zu helfen. Und nun sagt mir, was ich für Euch tun kann, denn dies Feldlager ist kein geeigneter Aufenthaltsort für Euch, und man hat mir gesagt, Ihr hättet noch keine Unterkunft gefunden. Bald wird es Abend sein.«
»Ich hatte gedacht«, sagte sie zaghaft, »es wäre vielleicht möglich, im Gästehaus des Klosters zu wohnen, wenn uns ein Boot über den Fluss setzen könnte.«
»Selbstverständlich sollt Ihr sicher über den Fluss gebracht werden, und ich werde den Abt bitten, Euch in einem der Gästehäuser des Klosters unterzubringen, wo Ihr ungestört und geschützt seid, bis wir eine Eskorte abkommandieren können, die Euch sicher nach Hause geleitet.« Er sah sich nach einem Boten um; Courcelles eifrige Bereitschaft war schwer zu übersehen. Der junge Mann hatte hellbraunes Haar und Augen von derselben Farbe, und er wusste, dass er bei seinem König in Gunsten stand. »Adam, wollt Ihr Euch um das Fräulein Siward kümmern und dafür sorgen, dass sie alles erhält, was sie braucht?«
»Von Herzen gern, Euer Gnaden«, sagte Courcelle und reichte der Dame seine Hand.
Hugh Beringar betrachtete das Mädchen, als es an ihm vorbeiging. Ihre Hand lag folgsam in der kräftigen, sonnengebräunten Hand des Wachoffiziers, ihre Augen waren niedergeschlagen, ihr kleines, zartes Gesicht mit den ungewöhnlich großen und edel geschwungenen Augenbrauen war nun, da sie ihre Aufgabe treu erfüllt hatte, müde und traurig. Von seinem Platz vor dem königlichen Zelt hatte er jedes Wort gehört. Nun sah sie aus, als wolle sie jeden Moment in Tränen ausbrechen, wie ein kleines Mädchen nach einer anstrengenden Prüfung, eine Kind-Braut, die man ihres Reichtums oder ihrer Herkunft entsprechend in teure Kleider gesteckt hat, und die kurzerhand wieder ins Kinderzimmer geschickt wird, wenn die Zeremonie vollzogen ist. Wie verzaubert ging der Wachoffizier des Königs neben ihr her, wie ein Eroberer, der erobert worden ist, und das war auch wohl kaum verwunderlich.
»Tretet ein, der König erwartet Euch«, hörte er die gutturale Stimme Willem Ten Heyts neben sich. Er wandte sich um und bückte sich, um das Zelt zu betreten. Im Dämmerlicht, das im Inneren herrschte, war die stattliche Gestalt des Königs nur undeutlich zu erkennen.
»Hier bin ich, Herr«, sagte Hugh Beringar und verbeugte sich. »Hugh Beringar von Maesbury, mit allem was ich habe, zu Euer Gnaden Diensten. Mein Aufgebot ist nicht groß, sechs Ritter und etwa fünfzig bewaffnete Männer, aber die Hälfte von ihnen Bogenschützen und gut ausgebildet. Sie alle stehen Euch zur Verfügung.«
»Euer Name, Herr Beringar, ist uns bekannt«, sagte der König trocken. »Ebenso Eure Besitzungen und Eure Gefolgschaft. Dass sie uns zur Verfügung stehen, ist uns neu. Ich habe gehört, dass Ihr bis vor kurzem noch ein Verbündeter der Verräter FitzAlan und Adeney wart. Euer Sinneswandel kommt recht unerwartet. Seit vier Wochen bin ich in dieser Gegend, ohne dass Ihr Euch bei mir gemeldet hättet.«
Ohne sich vorschnell zu entschuldigen, und mit keinem Anzeichen des Unbehagens über diesen kühlen Empfang sagte Beringar: »Euer Gnaden, von klein auf habe ich diese Männer, die Ihr verständlicherweise Verräter nennt, als Freunde und meinesgleichen betrachtet, und sie haben mich nie im Stich gelassen. Ihr seid ein einsichtiger Mann und werdet verstehen, dass für jemanden wie mich, der bis jetzt noch keinem Gefolgschaft geschworen hat, die Entscheidung über den weiteren Verlauf des Weges eine Sache ist, die wohl bedacht sein will, da sie ja nicht widerrufen werden darf. Dass König Henrys Tochter einen vertretbaren Anspruch auf den Thron hat, steht sicherlich außer Frage. Ich kann einen Mann, der für sie eintritt, nicht einen Verräter nennen, obgleich es zu verurteilen ist, wenn er den Eid, den er Euch gab, gebrochen hat. Was mich betrifft, so bin ich erst vor einigen Monaten auf meine Besitzungen zurückgekehrt, und ich habe bis jetzt noch keinem den Treueeid geleistet. Ich habe es mir reiflich überlegt, wem ich dienen will. So stehe ich denn vor Euch. Die, welche sich um Euch scharen, ohne lange überlegt zu haben, könnten Euch genauso schnell auch wieder verlassen.«
»Und das werdet Ihr nicht?«, meinte der König misstrauisch. Kritisch betrachtete er diesen kühnen und vielleicht etwas zu wortreichen jungen Mann. Nicht sehr kräftig, mittelgroß und schlank, aber mit ausgewogenen und sicheren Bewegungen; was ihm an Größe und Schlagkraft fehlte, mochte er durch Flinkheit und Beweglichkeit wettmachen. Zweiundzwanzig oder dreiundzwanzig Jahre alt, schwarze Haare, ein schmales, aufmerksames Gesicht und buschige, geschwungene Augenbrauen. Ein unberechenbarer Bursche – es war unmöglich, an seinem Gesicht abzulesen, was sich hinter den tiefliegenden Augen verbarg. Seine offenen Worte konnten ebenso gut ehrlich gemeint wie berechnend sein. Es war ihm zuzutrauen, dass er den König genau taxiert hatte und zu dem Ergebnis gekommen war, dass Aufrichtigkeit die beste Taktik sei.
»Nein das werde ich nicht«, sagte er mit Bestimmtheit. »Aber nicht nur mein Wort steht dafür. Ich bin bereit, es zu beweisen. Ich bitte Euer Gnaden, mich auf die Probe zu stellen.«
»Ihr habt Eure Streitkräfte nicht mitgebracht?«
»Nur drei meiner Männer begleiten mich. Es wäre töricht, eine gute Burg ohne Bemannung oder unterbesetzt zurückzulassen, und ich würde Euch einen schlechten Dienst erweisen, wenn ich von Euch verlangte, fünfzig weitere Männer zu versorgen. Befehlt mir nur, wo ich Euch dienen soll, und es soll geschehen.«
»Nicht so schnell«, sagte Stephen. »Auch andere wollen oft eine Bedenkzeit, bevor sie Euch mit offenen Armen empfangen, junger Mann. Vor nicht allzu langer Zeit wart Ihr noch ein Vertrauter von FitzAlan.«
»Das ist richtig. Und immer noch steht nichts zwischen uns, außer dass er den einen Weg eingeschlagen hat und ich den anderen.«
»Man sagt, Fulke Adeneys Tochter sei Euch zur Frau versprochen.«
»Ich weiß nicht, ob ich sagen soll: So ist es! Oder: So war es! Die Zeiten haben viele Pläne zerstört, die früher gemacht worden sind, und das gilt nicht nur für mich. Im Augenblick weiß ich nicht einmal, wo das Mädchen ist, und ob die Abmachung überhaupt noch gilt.«
»Angeblich sind keine Frauen mehr in der Burg«, sagte der König und sah ihn scharf an. »FitzAlans Familie ist möglicherweise geflohen, vielleicht hat sie das Land jetzt schon verlassen. Von Adeneys Tochter aber heißt es, sie verstecke sich in der Stadt. Es wäre mir nicht unangenehm«, sagte er mit leisem Nachdruck, »eine so wertvolle Dame in sicherem Gewahrsam zu haben – für den Fall, dass sogar ich meine Pläne ändern muss. Da Ihr ein Parteigänger ihres Vaters wart, werdet Ihr wohl wissen, wo sie Unterschlupf gefunden haben könnte. Wenn der Weg frei ist, solltet Ihr am ehesten in der Lage sein, sie zu finden.«
Mit einem unergründlichen Gesichtsausdruck sah ihn der junge Mann an. Aus seinen schlauen schwarzen Augen sprach nur Verständnis, nicht mehr, weder Zustimmung noch Ablehnung, und auch kein Eingeständnis des Wissens, dass die Gunst des Königs von der Erfüllung dieser Aufgabe abhing. Mit ausdruckslosem Gesicht und unverbindlicher Stimme sagte er: »Das war auch meine Absicht, Euer Gnaden. Sie zu finden, hatte ich schon vor, als ich aus Maesbury aufbrach.«
»Gut«, sagte Stephen zufrieden. »Obwohl wir im Augenblick keine bestimmte Aufgabe für Euch haben, mögt Ihr Euch bis zum Fall der Stadt zur Verfügung halten. Wo werdet Ihr zu finden sein, wenn ich Euch brauche?«
»Wenn dort Platz ist«, sagte Beringar, »werde ich im Gästehaus des Klosters wohnen.«
Während des Vespergottesdienstes stand Godric bei den Jüngsten der Klosterschüler und Novizen in der Nähe der Laien, die außerhalb der Stadt auf dieser Seite des Flusses lebten und diesen Zufluchtsort noch aufsuchen konnten. Er sieht richtig klein und verloren aus, dachte Bruder Cadfael, als er sich nach dem Jungen umsah, und sein Gesicht, das im Herbarium noch recht unbekümmert und fast frech wirkte, hatte hier in der Kirche einen sehr feierlichen Ausdruck angenommen. Die Nacht brach herein, seine erste Nacht innerhalb dieser Mauern. Aber jemand hatte sein Geschick in die Hand genommen, und zwar besser, als er selbst wohl annahm, und der Prüfung, auf die er sich vorbereitete, brauchte er sich, wenn alles klappte, nicht zu stellen – jedenfalls nicht heute Nacht. Bruder Paul, der Novizenmeister, hatte genug andere Jungen zu beaufsichtigen und war froh, wenn ihm die Verantwortung für einen abgenommen wurde.
Cadfael nahm sich seines Schützlings nach dem Abendessen wieder an, bei dem Godric, wie er befriedigt feststellte, tüchtig zulangte. Offenbar war der Junge entschlossen, den Ängsten und Schwierigkeiten, denen er sich gegenübersah, zu widerstehen, und war vernünftig genug, sich durch die Stärkung des Fleisches gegen die Anfechtungen des Geistes zu wappnen. Noch beruhigender war der erleichterte Blick, den er Cadfael zuwarf, als dieser ihn beim Verlassen des Refektoriums die Hand auf die Schulter legte.
»Komm, bis zum Komplet haben wir frei, und in den Gärten ist es kühl. Wir brauchen nicht hier drinnen zu bleiben, wenn du nicht willst.«
Godric wollte nicht, er war froh, in den Sommerabend hinauszukommen. Langsam gingen sie auf die Fischteiche und das Herbarium zu. Der Junge lief an Cadfaels Seite und pfiff vor sich hin, brach dann aber plötzlich ab.
»Ihr sagtet, der Novizenmeister werde sich nach dem Abendessen meiner annehmen. Darf ich denn wirklich so einfach mit Euch gehen?«
»Es ist alles geregelt, mein Kind, keine Sorge. Ich habe mit Bruder Paul gesprochen, wir haben sein Einverständnis. Du bist mein Gehilfe, und ich bin verantwortlich für dich.« Sie hatten den umzäunten Garten betreten und waren plötzlich von sonnendurchwärmten Gerüchen umgeben: Rosmarin, Thymian, Fenchel, Dill, Salbei, Lavendel – eine Welt geheimnisvoller Düfte. Selbst in der Kühle des Abends konnte man die mit dem Aroma der Pflanzen angereicherte Hitze des Tages ahnen. Über ihnen schossen Mauersegler zirpend durch die Luft.
Sie waren bei dem hölzernen Schuppen angelangt, dessen ölgetränkte Bretter Wärme ausstrahlten. Cadfael öffnete die Tür. »Hier wirst du schlafen, Godric.«
Am einen Ende des Raumes stand eine Bank, auf der ein Bett bereitet war. »Hier setze ich die Arzneien an«, erklärte Cadfael, »man muss sich regelmäßig um sie kümmern, um manche auch schon sehr früh, denn wenn man nicht achtgibt, verderben sie. Ich werde dir zeigen, was du zu tun hast, es ist nicht weiter schwer. Hier ist dein Bett, und diese Luke kannst du öffnen, wenn du frische Luft willst.« Der Junge musterte Cadfael mit einem abschätzenden Blick; seine großen dunkelblauen Augen blickten ihn unverwandt an. Es schien, als spiele ein Lächeln um seine Lippen, aber es schimmerte auch ein Gefühl verletzten Stolzes durch. Cadfael wandte sich zur Tür und machte ihn auf den schweren Riegel aufmerksam, der sie von innen sicherte, und dass es, wenn er einmal vorgelegt war, unmöglich war, sie von außen zu öffnen. »Du kannst die Welt und mich aussperren, so lange du willst.«
Der Junge Godric war in Wirklichkeit alles andere als ein Junge. Er sah Cadfael jetzt trotzig und gekränkt, aber alles in allem sehr erleichtert an.
»Wie habt Ihr es herausgefunden?«, fragte sie und reckte das Kinn vor.
»Wie wärst du im Dormitorium zurechtgekommen?«, fragte Bruder Cadfael zurück.
»Das wäre kein großes Problem gewesen. Jungen sind nicht sehr schlau, ich hätte sie schon irregeführt. Bei einer solchen Verkleidung«, sie raffte einige Falten ihres Kittels, »sehen alle gleich aus, und Männer sind blind und dumm.«
Sie musste lachen, als ihr einfiel, wie mühelos Cadfael sie durchschaut hatte, und mit einem Mal war sie ganz Frau, und ihre Heiterkeit und Erleichterung machten sie überraschend schön. »Oh, Ihr nicht! Aber wie habt Ihr es herausgefunden? Ich habe mich so bemüht, ich dachte, ich könnte jeden täuschen. Was habe ich falsch gemacht?«
»Du hast es sehr gut gemacht«, sagte Cadfael beruhigend. »Aber ich bin vierzig Jahre lang in der Welt herumgekommen, von einem Ende zum anderen, bevor ich das Gelübde ablegte und hierher kam, um ein ruhiges, erfülltes Ende zu finden. Ja, was hast du falsch gemacht? Versteh mich jetzt richtig und betrachte das, was ich dir sage, als einen guten Rat von einem Freund. Als du mir hitzig widersprachst, wurde deine Stimme heller, und zwar ganz übergangslos. Das kann man lernen – wenn wir Zeit haben, werde ich es dir beibringen. Und dann, als ich dir sagte, du solltest es dir bequem machen und deinen Kittel ausziehen – nein, du brauchst nicht rot zu werden, zu dem Zeitpunkt war ich noch gar nicht sicher! –, da hast du dich natürlich geweigert. Und schließlich, als ich dich den Stein werfen ließ, da hast du ihn geschleudert wie ein Mädchen, ohne den Arm über deinen Kopf zu heben. Hast du schon einmal einen Jungen so werfen sehen? Lass dich nicht dazu verleiten, bis du es gelernt hast. Es verrät dich sofort.«
Er hielt inne und schwieg geduldig, denn sie hatte sich auf das Bett gesetzt und den Kopf in die Hände gestützt. Erst lachte sie, dann weinte sie, und dann tat sie beides gleichzeitig. Er ließ sie in Ruhe – sie hatte nicht mehr die Fassung verloren als ein Mann, der Gewinne und Verluste erlitten hatte und jetzt die Bilanz zog. Nun glaubte er wohl, dass sie siebzehn war, ein Mädchen an der Schwelle zur Frau. Und sie würde eine gute Frau sein.
Nach einer Weile wischte sie ihre Tränen mit dem Handrücken ab und sah ihn lächelnd an. »Habt Ihr das wirklich ernst gemeint?«, sagte sie. »Dass Ihr verantwortlich seid für mich? Dass ich Euch vertraue, habe ich Euch ja schon gesagt.«
»Mein Kind«, sagte Cadfael geduldig, »was kann ich anderes tun als dir dienen, so gut ich kann, und dich sicher von hier wegbringen, wo immer du hinwillst?«
»Aber Ihr wisst doch nicht einmal, wer ich bin«, sagte sie verwundert. »Wer vertraut jetzt wem zu sehr?«
»Was macht es schon, wenn ich weiß, wie du heißt? Ein Mädchen, das hier Zuflucht sucht und das zu seiner Familie will – ist das nicht genug? Was du mir sagen willst, wirst du mir sagen, und mehr brauche ich nicht zu wissen.«
»Es wird am besten sein, wenn ich Euch alles erzähle«, sagte das Mädchen und sah ihn mit großen, aufrichtigen Augen an. »Mein Vater ist in diesem Augenblick entweder in der Burg von Shrewsbury und in äußerster Lebensgefahr oder aber zusammen mit William FitzAlan auf der Flucht in die Normandie zur Kaiserin, und er wird sicher von allen gehetzt. Ich bin eine Last für jeden, der sich jetzt mit mir abgibt, und wahrscheinlich wird man versuchen, meiner als Geisel habhaft zu werden, sobald sie merken, dass ich nicht da bin, wo ich sein sollte. Und auch Euch bringe ich in Gefahr, Bruder Cadfael. Ich bin die Tochter von FitzAlans Hauptvasallen und Freund. Mein Name ist Godith Adeney.«